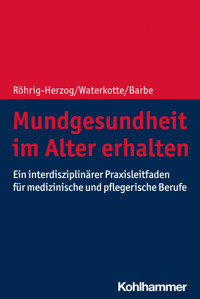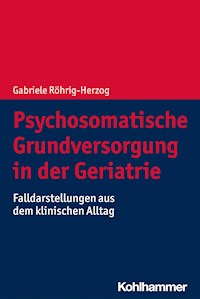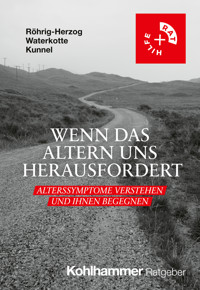
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Sowohl Betroffene als auch Angehörige kennen das irritierende Gefühl, wenn gewohnte Verhaltensweisen sich im Alter ändern. Oft verläuft dies langsam, schleichend, und man glaubt an eine Sonderlichkeit des Älterwerdens: Zuverlässige werden vergesslich, Lebensfrohe depressiv, Sportliche trauen sich kaum noch zu gehen. Diesen Veränderungen steht man selbst oft hilflos gegenüber und Menschen im sozialen Umfeld können sie nur schwer nachvollziehen. Ziel dieses Ratgebers ist es, im Alter häufig vorkommende Symptome allgemeinverständlich und anhand von Fallbeispielen darzustellen, ihre gesundheitlichen Ursachen und Folgen zu erläutern und konkrete Schritte zur Abklärung aufzuzeigen. Es wird deutlich, dass man solchen Veränderungen nicht hilflos gegenüberstehen muss, sondern auch im Alter aktiv handeln kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Vorwort
Einleitung
Was ist »Altersmedizin«?
Was macht ein Geriater (Altersmediziner)?
Was sind »geriatrische Syndrome«?
Wie erfolgt eine geriatrische Behandlung im Krankenhaus?
Gibt es auch eine geriatrische Behandlung in Arztpraxen?
Was im Alter besser wird
1 Kommunizieren können
1.1 Demenz
Autofahren bei Demenz
1.2 Delir
2 Sich bewegen können
2.1 Schwindel und Gangunsicherheit
2.2 Sturzereignisse
2.3 Wunden
2.4 Bettlägerigkeit
Lungenentzündungsprophylaxe
Prophylaxe gegen offene Wunden und Druckstellen (Dekubitusprophylaxe)
Prophylaxe gegen Gelenksversteifungen (Kontrakturenprophylaxe)
Fünf Phasen der Bettlägerigkeit
3 Aufrechterhaltung von vitalen Funktionen des Lebens
3.1 Polypharmazie
3.2 Sarkopenie
3.3 Mundtrockenheit
3.4 Umgang mit Schmerz
3.5 Der vergessene Schmerz
Die Dimensionen von Schmerz
3.6 Depression im Alter
4 Sich pflegen können
4.1 Aufkommende Pflegebedürftigkeit
4.2 Trockene Haut
4.3 Nagelpilz
5 Essen und Trinken
5.1 Veränderte Mobilität und Gewichtszunahme
5.2 Veränderte Präferenz beim Essen und Trinken
6 Ausscheiden können
6.1 Obstipation
6.2 Inkontinenz
7 Ruhen und Schlafen können
7.1 Schlafstörungen im Alter
8 Sich beschäftigen können
9 Soziale Bereiche des Lebens sichern können
10 Mit existenziellen Erfahrungen des Lebens umgehen können
10.1 Ein Riss durch die Familie
10.2 Suizidalität im Alter
Literatur
Sachwortverzeichnis
Rat + Hilfe
Fundiertes Wissen für Betroffene, Eltern und Angehörige –Medizinische und psychologische Ratgeber bei Kohlhammer
Eine Übersicht aller lieferbaren und im Buchhandel angekündigten Ratgeber aus unserem Programm finden Sie unter:
https://shop.kohlhammer.de/rat+hilfe
Die Autorinnen
Gabriele Röhrig-Herzog, Prof. Dr. med., MPH, ist Geriaterin und Psychotherapeutin an der Hochschule für Gesundheit, Pädagogik und Soziales EUFH in Köln und leitet dort die geriatrische Hochschulsprechstunde.
Ramona Waterkotte ist u. a. examinierte Altenpflegerin. Sie hat Erziehungswissenschaft und Soziologie B.A. sowie Schulmanagement M.A. studiert. Sie arbeitet an der Fort- und Weiterbildung der Universitätsmedizin Mainz sowie als freiberufliche Referentin und Projektleiterin zur Thematik Recruiting und Generationsmanagement.
Asha Kunnel, Dr. med., ist Neurologin, Nervenärztin und Geriaterin und als geschäftsführende Oberärztin im Cellitinnen Krankenhaus Köln in der neurologischen und fachübergreifenden Frührehabilitation tätig.
Gabriele Röhrig-HerzogRamona WaterkotteAsha Kunnel
Wenn das Alternuns herausfordert
Alterssymptome verstehenund ihnen begegnen
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten verändern sich ständig. Verlag und Autoren tragen dafür Sorge, dass alle gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Eine Haftung hierfür kann jedoch nicht übernommen werden. Es empfiehlt sich, die Angaben anhand des Beipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2024
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:ISBN 978-3-17-043217-8
E-Book-Formate:pdf:ISBN 978-3-17-043218-5epub:ISBN 978-3-17-043219-2
Vorwort
Warum dieses Buch? »Noch ein Buch über Altersmedizin? Da gibt's doch schon so viele!« Das mag stimmen, aber diese Bücher sind für medizinisches Fachpersonal geschrieben. Für die wichtigsten Personen der Altersmedizin, unsere Patienten und deren Angehörige, gibt es hingegen bisher kein Buch über Altersmedizin. Und genau für sie haben wir dieses Buch geschrieben.
Wir alle arbeiten jeden Tag mit Menschen zusammen, die aufgrund ihres hohen Alters über viel mehr Lebenserfahrung verfügen als wir. Sie waren bei Ereignissen dabei, die wir nur aus Geschichtsbüchern kennen, und haben zum Teil Erfahrungen gemacht, die wir glücklicherweise nicht machen mussten. Sie sind lebenserfahren, haben viel erlebt und viel ertragen und sie wissen viel. Doch wenn es um die eigene Gesundheit im Alter geht, kommen diese lebenserfahrenen Menschen oft an unbekannte Grenzen, die sie mitunter resignieren lassen: »Im Alter hat man nur Leid und Schmerzen und ist nur noch krank!« Aber das stimmt nicht! Altern ist keine Krankheit, sondern eine Herausforderung. Und Herausforderungen haben diese Menschen in ihren langen Leben schon viele gemeistert. Man kann das eigene Älterwerden sehr wohl aktiv mit beeinflussen. Mit diesem Buch wollen wir all denjenigen interessierten Seniorinnen und Senioren sowie ihren Angehörigen zeigen, wozu Altersmedizin (= Geriatrie) gut ist, welche Angebote es gibt und wie sie helfen kann, neben gesundheitlichen Einschränkungen auch gesundheitliche Ressourcen zu entdecken, die jeder für sich nutzen kann. Wir wollen mit diesem Buch den Wissensdurstigen möglichst viel Zusammenhänge über die Gesundheit im Alter verständlich erläutern, wir wollen den Suchenden Informationen mitgeben, wo sie Hilfe bei der Pflege finden können, und wir wollen denjenigen, die sich niedergeschlagen fühlen, Mut machen, auch über Unterstützungs- und Hilfsangebote nachzudenken, die sie bisher nicht kannten oder denen sie eher skeptisch gegenüberstanden.
Zugunsten einer lesefreundlichen Darstellung wird in diesem Werk bei personenbezogenen Bezeichnungen in der Regel die männliche Form verwendet. Diese schließt, wo nicht anders angegeben, alle Geschlechtsformen ein (weiblich, männlich, divers).
Gabriele Röhrig-Herzog, Ramona Waterkotte und Asha Kunnel
Einleitung
Was ist »Altersmedizin«?
Wenn ein Säugling Bauchweh hat, ein 5-jähriges Mädchen stark erkältet ist oder ein 14-jähriger Junge plötzlich Fieber bekommt, dann wird den Eltern ganz selbstverständlich geraten, mit ihren Kindern zum Kinderarzt zu gehen. Kinderärzte kennen sich mit den besonderen Abläufen und Organfunktionen im Körper eines Kindes genau aus. Diese unterscheiden sich nämlich sehr oft von den Abläufen und Funktionen im Körper eines erwachsenen Menschen. Das hat man schon vor über 150 Jahren erkannt und um 1850 in Würzburg die erste Universitäts-Kinderklinik eröffnet.
Dass auch der Organismus von Senioren seine sehr eigenen Abläufe hat und sich Organfunktionen im Alter oft sogar sehr wesentlich von den Organfunktionen jüngerer Erwachsener unterscheiden, wurde erst viel später zu Beginn des 20. Jahrhunderts erkannt. Dem Arzt Ignatz Nascher (1863 – 1944) fiel 1908 bei einem Besuch des Wiener Versorgungsheimes Lainz auf, dass die hier versorgten älteren Patienten eine im Vergleich zu anderen Altersgenossen deutlich niedrigere Sterberate hatten. Das beeindruckte ihn sehr, denn die mittlere Lebenserwartung lag in Österreich um die Jahrhundertwende bei 40 – 43 Jahre. Was machte man anders im Versorgungsheim Lainz? Im Gespräch mit einem der behandelnden Ärzte erfuhr er: »Wir verfahren mit den Patienten hier so, wie ein Kinderarzt (Pädiater) mit den Kindern.« Diese Erkenntnis veranlasste Dr. Nascher, in Anlehnung an den Begriff »Pädiatrie« den Begriff »Geriatrie« zu prägen, als Bezeichnung für die Altersmedizin. Er legte damit den Grundstein für diese medizinische Fachrichtung.
In London machte die Ärztin Marjorie Warren ähnliche Beobachtungen bei den stationär versorgten Patienten und stellte fest, dass das Überleben deutlich besser wurde, wenn jeder der betagten Patienten seinen individuellen gesundheitlichen Bedürfnissen entsprechend behandelt wurde und nicht alle nach dem gleichen, einheitlichen Schema. Während ihrer leitenden Tätigkeit im Middlesex County Hospital ab 1935 erarbeitete sie erstmals konkrete klinische Konzepte zur Behandlung stationär versorgter chronisch Kranker, woraus sich in den folgenden Jahren die geriatrietypischen, individuell angepassten Therapiekonzepte entwickelten (Warren 1951).
Heute wissen wir, dass jeder ältere Mensch auch in gesundheitlicher Hinsicht ein Individuum ist und eine individuelle Diagnostik und Therapie benötigt. Das liegt daran, dass sich die Funktionen unserer Organe und unseres Körpers im Laufe des Lebens ganz unterschiedlich verändern. Dabei spielt zum einen sicher die Art und Weise eine Rolle, wie sehr wir auf unseren Körper im Laufe des Lebens achten: ob wir ihn regelmäßig überanstrengen durch Stress und schwere körperliche Arbeit; ob wir auf ihn hören, wenn er Ruhe braucht oder aber diese »Rufe« ignorieren; ob wir ihm zumuten, mit Schadstoffen fertigzuwerden wie Nikotin, Alkohol oder Drogen; ob wir ihn regelmäßig bewegen und damit unseren Muskeln die Möglichkeit geben, stark zu bleiben und den Körper zu halten. Natürlich spielen auch Erkrankungen, Unfälle oder vererbte oder angeborene Funktionsstörungen eine Rolle. Und zu guter Letzt ist natürlich auch unsere persönliche Einstellung zum Altwerden von großer Bedeutung.
Was macht ein Geriater (Altersmediziner)?
Ein Geriater ist ein Arzt, der eine zusätzliche, spezielle Ausbildung in Altersmedizin erworben hat und daher spezialisiert darauf ist, ältere Menschen, sogenannte geriatrische Patienten, gezielt zu behandeln. Ein Geriater kennt sich mit den Veränderungen der Organfunktionen im Alter aus und kann daher besser einschätzen, z. B. welche Medikamente sich für einen älteren Menschen eignen und welche dagegen überwiegend schaden würden. Auch ist ein Geriater in der Lage, durch spezielle, gezielte Untersuchungen und Testverfahren (Assessments) festzustellen, wo ein geriatrischer Patient seine Schwierigkeiten und Probleme hat und wo er hingegen vollkommen fit ist. Wenn ein Patient z. B. immer wieder stürzt, ist es sicher wenig hilfreich, mit ihm das Sprechen zu üben, denn das kann er ja. Hier ist es viel sinnvoller, gemeinsam mit dem Patienten herauszufinden, warum er immer wieder stürzt, ob er an Schwindel oder unter Schmerzen leidet, ob er vielleicht eine Schwäche in den Beinen verspürt oder ob er möglicherweise schlechter sieht als sonst. Wenn man auf so differenzierte Weise mit Hilfe der Assessments erfährt, wo die Ursache für das Stürzen liegt, kann man sie auch ganz gezielt behandeln und dem Patienten wieder helfen, sich sicherer zu bewegen.
Was sind Geriatrische Assessments?
Geriatrische Assessments sind bestimmte Untersuchungsmethoden, die zwei wichtige Aufgaben in der Geriatrie haben:
1.DiagnosestellungMit Hilfe von geriatrischen Assessments kann ein Geriater feststellen, wo ein Patient Probleme hat und wo nicht. Das hilft zu vermeiden, dass ein Patient für etwas behandelt wird, wo ihm gar nichts fehlt. Auf der anderen Seite kann durch die Assessments viel genauer herausgefunden werden, wann und wo der Patient Probleme hat und wo sie herkommen. Dadurch kann man sie auch sehr gezielt behandeln.
2.TherapiekontrolleAssessments haben noch eine weitere wichtige Aufgabe: Man kann mit ihrer Hilfe prüfen, ob sich ein bestimmtes körperliches Problem unter der eingesetzten Therapie schon gebessert hat, z. B., ob ein Patient mit Unsicherheit beim Laufen schon wieder sicherer geworden ist und vielleicht sogar ohne einen Stock eine Strecke gehen kann. Dafür vergleicht man das Ergebnis des Assessments vor der Therapie mit dem Ergebnis des Assessments nach der Therapie und kann daraufhin auch ziemlich genau sagen, wo der Patient noch Übung braucht oder auch welches Hilfsmittel er weiterhin braucht.
Geriatrische Assessments kommen routinemäßig im Rahmen von geriatrischen Behandlungen im Krankenhaus zum Einsatz, inzwischen aber auch zunehmend in Arztpraxen.
Was sind »geriatrische Syndrome«?
Unter einem geriatrischen Syndrom versteht man einen Befund, der im Unterschied zu jüngeren Patienten bei geriatrischen Patienten typischerweise durch mehrere, meist kombinierte Ursachen begründet wird und zu einer ganzen Kette von Folgestörungen führen kann. Betrachtet man zum Beispiel das geriatrische Syndrom »Sturz«, so ist zunächst einmal klar, dass man in jedem Alter stürzen kann, z. B. Kinder stürzen auf dem Spielplatz, Erwachsene beim Skilaufen oder von der Gartenleiter.
Meistens sind solche Stürze durch Stolpern oder Gleichgewichtsverlust bedingt und die Betroffenen können sich an den Sturz genau erinnern. Da ihre jüngeren Körper noch sehr viel belastbarer sind, heilen die Sturzfolgen wie Knochenbrüche, Verstauchungen oder Blutergüsse bei Erwachsenen gewöhnlich nach einer Behandlung auch schnell und folgenlos ab.
Bei geriatrischen Patienten sind Stürze dagegen oft durch mehrere gleichzeitig wirkende Faktoren bedingt wie bspw. Sehstörungen, Muskelschwäche, Taubheitsgefühle an den Füßen oder Beinen (Polyneuropathie) und Schwindelgefühle. Häufig kann auch eine Störung des Pulsschlages oder des Blutdruckes zu einem Sturz führen. Dann kann es auch vorkommen, dass sich die Personen gar nicht mehr an den Sturz erinnern, also eine Erinnerungslücke haben (Synkope). Das ist eine sehr wichtige Information für die behandelnden Ärzte und Therapeuten. Man unterscheidet daher bei geriatrischen Patienten auch zwischen einem intrinsisch (= durch eine Fehlfunktion von Herz, Kreislauf oder anderen Organen) und einem extrinsisch (= durch äußere Einwirkung bedingt, wie Aufprall, Stoß oder Stolpern) bedingten Sturz. Diese Informationen sind für die Ursachensuche sehr wichtig, um daraus Erkenntnisse zu ziehen, wie man zukünftig weitere Stürze vermeiden kann.
Oft klappt es auch nicht mehr rechtzeitig, den Sturz abzufangen. Wenn dann auch noch eine erhöhte Knochenbrüchigkeit (Osteoporose) hinzukommt, kann es schnell passieren, dass ein oder mehrere Knochen brechen. Sehr häufig sind das dann Teile des Oberschenkelknochens oder der Hüfte. Wenn der Betroffene versucht hat, sich beim Sturz noch abzufangen, kann es auch oft zu einem Bruch von Handgelenk oder Oberarm kommen. Auch wenn die Knochenbrüche dann durch Operation oder Ruhigstellung versorgt wurden, bleiben in vielen Fällen Folgestörungen bestehen. Nach Brüchen von Oberschenkel oder Hüfte bleibt meist eine eingeschränkte Gehfähigkeit bestehen, weswegen die Patienten dann eine Gehhilfe (Rollator oder Stock) benutzen. Dadurch, dass man mit zunehmendem Alter gerade bei fehlender Bewegung sehr schnell Muskelmasse verliert (Sarkopenie), kann es durch die abnehmende Bewegung nach einem Sturz auch innerhalb von Tagen bis Wochen zu einem Schwund der Muskelmasse und der Muskelkraft kommen, was das Risiko für einen neuen Sturz erhöht. Spüren diese Patienten zusätzlich Angst vor neuen Stürzen und bewegen sich deshalb auch weniger (Vermeidungsverhalten), steigt das Risiko zu stürzen noch einmal an. Ein Sturz beim älteren Menschen kann also – anders als bei vielen jüngeren Menschen – zum einen durch mehrere zusammenspielende Ursachen ausgelöst werden und zum anderen sehr weitreichende Folgen haben, welche die Selbstständigkeit im Alltag bedrohen und auch massiv einschränken können.
Weitere Beispiele für geriatrische Syndrome sind Störungen der Hirn- und Gedächtnisfunktion (Demenz/Delir), Blasenschwäche (Harninkontinenz), Mangelernährung (Malnutrition), Schluckstörungen (Dysphagie) oder auch eine gestörte Mundgesundheit oder Blutarmut (Anämie).
Wie erfolgt eine geriatrische Behandlung im Krankenhaus?
In Deutschland gibt es drei verschiedene Formen von geriatrischer Krankenhausbehandlung, die allerdings nicht in allen Bundesländern gleichermaßen angeboten werden:
1.
AkutgeriatrieIn einer Akutgeriatrie werden Patienten ab einem Alter von 70 Jahren behandelt, die an einem geriatrischen Syndrom leiden und eine akute behandlungsbedürftige Erkrankung haben wie z. B. eine Lungenentzündung oder ein Schmerzsyndrom. Sie werden gewöhnlich vom Hausarzt oder einem anderen mitbehandelnden Arzt eingewiesen, können aber auch im Notfall über eine Notaufnahme aufgenommen werden. Sind sie stationär aufgenommen, erhalten sie während des meist 15-tägigen Krankenhausaufenthaltes sowohl ärztlich-pflegerische Diagnostik und Therapie als auch bereits von Anfang an therapeutisches Training wie in einer Rehabilitation. Diese Kombination aus akuter Behandlung und Rehamaßnahmen nennt man daher auch geriatrische Frührehabilitation oder geriatrische Komplexbehandlung. Diese werden in Abteilungen angeboten, die sich Akutgeriatrie oder auch einfach nur Geriatrie nennen. Die Patienten werden von einem Behandlungsteam betreut, das sich aus Altersmedizinern (Geriatern), Pflegefachkräften, Therapeuten (Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie), Sozialarbeitern und Neuropsychologen zusammensetzt. Um genau zu wissen, woran der jeweilig neu aufgenommene Patient leidet, ob Funktionsstörungen von Körper oder Gedächtnis vorliegen, vielleicht eine Muskelkraftminderung oder Gehstörung bestehen und ob der Patient seine Alltagstätigkeiten noch selbstständig durchführen kann, untersucht man den Patienten mit Hilfe geriatrischer Assessments. Diese werden zu Beginn des Aufenthaltes und kurz vor der Entlassung durchgeführt. Man vergleicht dann die Ergebnisse miteinander und kann so erkennen, in welchen Bereichen der Patient nach der Entlassung möglicherweise weitere Unterstützung benötigt. Diese kann nach Absprache vom Sozialdienst organisiert werden. Gemeinsam mit dem Patienten und seinen Angehörigen werden diese Angebote besprochen, damit der Patient selbst entscheiden kann, welche Maßnahmen er bevorzugt. Bei Entlassung bekommt der Patient gewöhnlich einen Entlassbrief für den Hausarzt mit, in dem sowohl die Diagnosen und durchgeführten Therapien als auch die Ergebnisse der geriatrischen Assessments und die Medikamente aufgeführt sind.
2.
Geriatrische RehabilitationIn einer geriatrischen Rehabilitation werden ebenfalls Patienten über 70 Jahre aufgenommen. Der Unterschied ist, dass der Patient nicht an einer akut behandlungsbedürftigen Erkrankung leidet. Meist sind diese Patienten schon wieder deutlich gesünder als Patienten in der Akutgeriatrie und können sich im Alltag ohne oder mit nur wenig Unterstützung selbst versorgen. Ein Aufenthalt in einer geriatrischen Rehabilitation ist nur dann möglich, wenn vorher bei der Krankenkasse ein Antrag gestellt wurde und dieser für einen bestimmten Zeitraum (meist für drei Wochen) bewilligt wurde. Auch in einer geriatrischen Rehabilitation wird der Patient von einem Team betreut, allerdings liegt hier der Behandlungsschwerpunkt bei den Therapeuten. Anders als in der Akutgeriatrie machen die Geriater in einer geriatrischen Rehabilitation gewöhnlich nicht jeden Tag Visite, weswegen die Patienten mitunter auch an manchen Tagen keine Ärzte sehen, obwohl sie da sind. Ebenso wie in einer Akutgeriatrie werden auch in einer geriatrischen Rehabilitation geriatrische Assessments durchgeführt und deren Ergebnisse vom Aufnahmezeitpunkt mit denen vom Entlasszeitpunkt verglichen, um aus den Unterschieden Schlüsse darüber ziehen zu können, wo der Patient nach Entlassung noch Unterstützungsbedarf hat.
3.
Geriatrische TagesklinikFür die Aufnahme in eine geriatrische Tagesklinik muss kein Antrag bei der Krankenkasse gestellt werden. Hier genügt eine Einweisung vom Hausarzt. Das Besondere an einer tagesklinischen (oder auch teilstationären) Behandlung ist, dass die Patienten nachts und am Wochenende zu Hause sind. Sie kommen an den Wochentagen morgens in die Tagesklinik, werden dort entsprechend der geriatrischen Assessmentergebnisse von Ärzten, Pflegemitarbeitern und Therapeuten betreut und behandelt und gehen nachmittags wieder nach Hause. Oft gibt es dafür auch Fahrdienste. Patienten, die in eine Tagesklinik kommen, sind gewöhnlich fitter als Patienten in einer Akutgeriatrie und sind auch nicht akut erkrankt. Ein tagesklinischer Aufenthalt bietet sich für die Patienten an, die ihre Selbstständigkeit im Alltag erhalten wollen oder sich auch nach längeren Krankenhausaufenthalten wieder langsam in den häuslichen Alltag einleben wollen.
Gibt es auch eine geriatrische Behandlung in Arztpraxen?
Im ambulanten Bereich werden geriatrische Patienten meist von ihren Hausärzten behandelt, die idealerweise über Grundkenntnisse der Altersmedizin verfügen. Das ist jedoch nicht immer der Fall, da Hausärzte trotz ihrer breiten Ausbildung eigene Schwerpunkte haben, die nicht immer die Altersmedizin mit einbeziehen. Man kann daher offen danach fragen. Inzwischen gibt es sehr vereinzelt auch erste Praxen in Deutschland, in denen eine spezielle geriatrische Diagnostik von ausgebildeten Geriatern angeboten wird. Das ist bisher aber noch sehr selten. Allerdings wird auch in diesen Praxen keine Behandlung angeboten, die der Komplexbehandlung in einer Akutgeriatrie oder einer geriatrischen Rehabilitation gleicht. Auch gibt es im ambulanten Bereich leider bis heute keine geregelte Teamarbeit aus Geriatern, Pflegefachkräften, Therapeuten und Sozialarbeitern. Therapeuten können nur nach ärztlicher Überweisung handeln, Pflegefachkräfte können meist erst nur nach Bewilligung eines Pflegegrades aktiv werden und für eine sozialdienstliche Beratung kann man sich an lokale Bürgerbüros oder auch an Seniorenberatungszentren unterschiedlicher Trägerschaften wenden. Im ländlichen Bereich ist auch in diesen Fällen der Hausarzt der erste Ansprechpartner.
Was im Alter besser wird
Für viele Menschen ist Altern vor allem mit körperlichem und geistigem Abbau und Funktionsverlust verbunden. In unserer Gesellschaft wird Altern daher auch oft sehr negativ betrachtet. Dabei wird dann übersehen, dass Altern auch eine ganze Reihe Vorteile mit sich bringt:
ZeitDurch den Eintritt in den Ruhestand endet die Verpflichtung für eine Berufstätigkeit. Hinzu kommt, dass sich die familiären Verpflichtungen ändern, die Kinder sind inzwischen erwachsen und selbstständig und der Alltagsstress wird weniger. Man hat mehr Zeit für sich und seine Interessen. Wer sich dennoch eine neue Aufgabe suchen will, kann das tun und dabei ganz gezielt nach einem Aufgabenfeld schauen, das den eigenen Ansprüchen auch entspricht. So gibt es Senioren, die sich ein Ehrenamt suchen oder eine Weiterbildung und mitunter auch ein Studium beginnen. Dadurch, dass der Druck wegfällt, finanziell unabhängig werden zu müssen, kann man sich auch viel entspannter in neue Aufgaben einarbeiten.
LebenserfahrungZu keinem früheren Zeitpunkt verfügt man über so viel Lebenserfahrung wie im hohen Alter. Diese Lebenserfahrung kann einem persönlich helfen, Krisen besser zu bewältigen. Wenn man diese Lebenserfahrung mit anderen, jüngeren Menschen teilt (aber nicht aufdrängt!), kann man damit sehr hilfreich unterstützen und Mut machen.
EinflussnahmeMenschen, die auf ein langes Leben zurückblicken, haben sehr oft Zeiten, Abläufe und Entwicklungen erlebt, die jüngere Menschen nur aus Büchern oder Medien kennen. Hochbetagte Menschen können als Zeitzeugen sehr wesentlichen Einfluss auf den Umgang mit Geschichte nehmen und dazu beitragen, dass nicht vergessen wird, was in Erinnerung bleiben soll. Darüber hinaus regt der Austausch mit Hochbetagten über das »Früher« und »Heute« auch dazu an, Entwicklungen zu hinterfragen und neue Ideen aufkommen zu lassen.
Lesen ohne BrilleViele ältere Menschen benötigen mit zunehmendem Lebensalter eine Lesebrille. Das hängt mit der schwächer werdenden Verformbarkeit der Augenlinse zusammen. Dadurch kann man in der Ferne besser sehen als in der Nähe (Altersweitsichtigkeit). Kurzsichtige Menschen erleben mit zunehmendem Alter jedoch oft, dass sie aufgrund der Altersweitsichtigkeit auch ohne Brille lesen können und beim Zeitunglesen die Brille abnehmen, statt aufsetzen.
Gewicht darf höher seinBei älteren Menschen gelten für den sogenannten Body-Mass-Index (BMI) andere Grenzwerte. Während bei jüngeren Menschen die Grenze des BMI von Normalgewicht zu Übergewicht schon bei 25 kg/m2 liegt, verschiebt sie sich bei hochbetagten Personen auf > 25 kg/m2. Das liegt an einer veränderten Verteilung von Fettgewebe und Wasseranteilen im Körper. Ältere Menschen mit einem höheren BMI haben bei schweren Erkrankungen auch eine größere Genesungschance als Patienten mit einem niedrigeren BMI.
Zurückgeben könnenGerade wenn die Ehefrau aufgrund von akuten oder chronischen Erkrankungen eine Pflegebedürftigkeit entwickelt und der Ehemann in den Part des Pflegenden kommt, sprechen nicht wenige davon, etwas zurückgeben zu können, wofür sie tiefe Dankbarkeit empfinden. Denn meistens haben die Ehefrauen zu Gunsten der Kinder in der Vergangenheit verzichtet.
Normalität