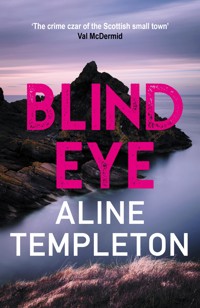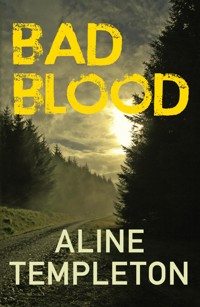5,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ein Fall für Marjory Fleming
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Wenn eine Idylle ein düsteres Geheimnis hütet: Der fesselnde Kriminalroman »Wer die Toten weckt« von Aline Templeton jetzt als eBook bei dotbooks. Sie läuft um ihr Leben, doch es gibt kein Entkommen … 15 Jahre später: Ein kleines Dorf im schottischen Galloway wird durch einen grausigen Fund erschüttert. Bei Grabungsarbeiten auf einer Viehweide wird die Leiche der jungen Diana Harvey gefunden, die vor Jahren spurlos verschwand. Als DI Marjory Fleming die Ermittlungen übernimmt, stößt sie in der Idylle der schottischen Lowlands auf eine Mauer des Schweigens. Gemeinsam mit Laura Harvey, die ihrer toten Schwester zum Verwechseln ähnlich sieht, versucht DI Fleming, das Geheimnis um den Mord zu lösen – doch die beiden Frauen merken nicht, wie sie mit jedem Schritt Richtung Wahrheit immer mehr in die Fänge des Mörders stolpern … »Aline Templeton ist die Krimi-Königin von Schottland!« Bestsellerautorin Val McDermid Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der düstere Kriminalroman »Wer die Toten weckt« von Aline Templeton – der erste Fall für Marjory Fleming. Die Romane der Serie können unabhängig voneinander gelesen werden. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 524
Ähnliche
Über dieses Buch:
Sie läuft um ihr Leben, doch es gibt kein Entkommen … 15 Jahre später: Ein kleines Dorf im schottischen Galloway wird durch einen grausigen Fund erschüttert. Bei Grabungsarbeiten auf einer Viehweide wird die Leiche der jungen Diana Harvey gefunden, die vor Jahren spurlos verschwand. Als DI Marjory Fleming die Ermittlungen übernimmt, stößt sie in der Idylle der schottischen Lowlands auf eine Mauer des Schweigens. Gemeinsam mit Laura Harvey, die ihrer toten Schwester zum Verwechseln ähnlich sieht, versucht DI Fleming, das Geheimnis um den Mord zu lösen – doch die beiden Frauen merken nicht, wie sie mit jedem Schritt Richtung Wahrheit immer mehr in die Fänge des Mörders stolpern …
»Aline Templeton ist die Krimi-Königin von Schottland!« Bestsellerautorin Val McDermid
Über die Autorin:
Aline Templeton wurde in einem Fischerdorf an der schottischen Ostküste geboren. Sie studierte in Cambridge Literaturwissenschaft und arbeitete später in der Erwachsenenbildung und beim Rundfunk. Ihre Kriminalromane wurden in mehrere Sprachen übersetzt. Aline Templeton lebt mit ihrer Familie in Edinburgh.
Aline Templeton veröffentlichte bei dotbooks weiterhin »Wo der Tod lauert«.
***
eBook-Neuausgabe Juli 2020
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2005 unter dem Originaltitel »Cold in the Earth« bei Hodder & Stoughton, UK.
Copyright © der englischen Originalausgabe 2005 by Aline Templeton
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2005 Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin / Marion von Schröder
Copyright © der Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Brendan Howard, brickrena
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (CG)
ISBN 978-3-96148-869-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Wer die Toten weckt« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Aline Templeton
Wer die Toten weckt
Roman
dotbooks.
Für Iain und Clare, mit viel Liebe,zum Beginn ihres gemeinsamen Lebens.
Kalt in der Erde – und fünfzehn Jahre schonschmolz von jenen braunen Hügelnder wilde Dezember ins Frühjahr.
Emily Brontë
Prolog
Kalt, Kalt, Kalt. Ein Gefühl äußersten Unbehagens drang schließlich in ihr Bewußtsein, und sie stellte fest, daß sie heftig mit den Zähnen klapperte. Ihre Hände waren taub, und ihre nassen Füße prickelten schmerzhaft. Keuchend riß sie die Augen auf.
Es war Nacht. Der Himmel, der sich klar und schwarz über ihr wölbte, glitzerte von Millionen von Sternen. Über dem schattenhaften Umriß des Hauses stand der Vollmond elfenbeinweiß vor der Dunkelheit. Die Äste der Bäume und die Blätter der Ligusterhecke, die weiß von Reif waren, schimmerten im stählernen, unirdischen Licht.
Sie stand auf einem der schmalen überwucherten Pfade des Labyrinths. Eben hatte sie noch davon geträumt, und jetzt befand sie sich tatsächlich hier. Ihre Füße waren voll Schlamm, und sie mußte sich an der Sohle geschnitten haben, denn es blutete. Das dünne Goldkettchen, das sie immer um die Fessel trug, war auch nicht mehr da. Der Ärmel ihres dicken Männerpyjamas aus Flanell hatte einen Riß, und darunter war eine lange Schramme auf der Haut – offensichtlich hatte sie sich durch eine Lücke in der Hecke gezwängt. Zu schlafwandeln, wenn sie Kummer hatte, war eine Angewohnheit aus ihrer Kindheit, die sie eigentlich überwunden glaubte. Aber in den letzten Wochen hatte sie ja auch besonders viel Kummer gehabt, großen Kummer.
Sie zitterte vor Kälte und Schock, während sie sich verwirrt umschaute. Immer wenn sie so abrupt aufwachte, war ihr übel, und alles wirkte zunächst noch verschwommen und unwirklich. Sie schüttelte den Kopf, als wolle sie sich befreien, und drehte sich in Richtung Eingangstor, um sich zu orientieren.
Noch während sie versuchte festzustellen, wo sie sich befand, hörte sie das Schloß am Tor klicken. Sie erstarrte. Wer mochte mitten in der Nacht hier draußen sein? Auch das hatte ihr unbehaglich werden lassen, der Verdacht, daß man ihr nachspionierte, ihr ungesehen folgte ...
Durch die kümmerliche Ligusterhecke am Ende der Allee trat – etwas. Es war ganz in Schwarz gehüllt, und der Kopf war eine silberne Stiermaske mit spitzen, gebogenen Hörnern, die im Mondlicht schimmerten. Es sprang auf sie zu und senkte dabei angriffsbereit den Kopf. Eine Figur aus einem Alptraum.
Sie drückte sich in die hinterste Ecke des Irrwegs, und ihr Herz schlug so heftig, daß sie glaubte, es müsse ihr aus der Brust springen. Es ergab keinen Sinn ...
Es war doch nicht real, oder? Sie träumte bestimmt noch, auf diese grauenvolle Art, die wie ein Fluch über ihrem Leben lag, wenn man wußte, daß man schlief, sich jedoch nicht aus dem Entsetzen, das einen gepackt hielt, befreien konnte. Und in diesem Zustand befand sie sich jetzt, in der Lähmung des Traums, in dem die Beine zu schwer sind, um wegzulaufen, und es keinen Sinn hat zu schreien, weil die Stimme im Hals eingefroren ist.
Es sprang nicht mehr. Jetzt senkte es den Kopf und galoppierte los. Sie saß in der Falle; selbst wenn sie ihre bleiernen Gliedmaßen zu einer Bewegung hätte zwingen können, so war sie doch auf drei Seiten von der dichten Hecke eingeschlossen. Sie hörte das animalische Schnauben und den schweren Atem, als das Etwas immer schneller auf sie zukam.
Wenn das Schreckliche geschah, würde der Schock sie wie gewöhnlich wecken, und sie würde im Bett auffahren, keuchend und schluchzend und schweißgebadet. Bitte, lieber Gott, laß es schnell gehen!
Erst als eins der spitzen Silberhörner, scharf wie ein Rasiermesser, mit köstlicher Qual in ihr Herz drang, begriff sie, daß dies kein Traum war, jedoch nur in dem kurzen Moment, ehe sie in dem Schlaf versank, der kein Erwachen kennt.
Kapitel 1
Die Hennen, die gerade aus der nächtlichen Schutzhaft entlassen worden waren, stolzierten pickend über die Hühnerleiter mit einer Art träumerischer Entschlossenheit und blinzelten in den wässerigen Sonnenschein des Januarmorgens, der überraschend mild für diese südwestliche Ecke von Schottland war. Ihr nachdenkliches Glucken hing in der feuchten Luft, ab und zu unterbrochen von einem empörten Gackern, wenn irgendein junges Ding sich mit unziemlicher Hast an den Matronen vorbeidrängte.
Die haselnußbraunen Augen der Frau funkelten amüsiert, während sie die Hennen beobachtete, die auf dem aufgeweichten Gras unter den alten Apfelbäumen zu scharren begannen. Scharfe gelbe Schnäbel bohrten sich hoffnungsvoll in die Erde, um delikate Würmer oder köstliche Käfer herauszuziehen. Die Frau war groß, beinahe einsachtzig, mit einer jungenhaften, athletischen Figur; sie trug einen blauen Overall und Gummistiefel, und ihre Haare, kastanienbraun mit ein paar grauen Strähnen, waren kurz geschnitten. Ihr Teint wies Spuren vom häufigen Aufenthalt an der frischen Luft auf, ihre Hände allerdings waren merkwürdig glatt und gepflegt: hübsch geformte, große, zupackende Hände mit sorgfältig manikürten Nägeln.
»Na los, putt putt putt!«
Sie scheuchte die letzten Langschläfer aus dem Hühnerhaus und sammelte rasch die in der Nacht gelegten Eier in die mitgebrachte Schüssel, dann stellte sie sie draußen ab, um den Eimer mit dem Morgenfutter aus seinem Versteck hinter dem Hühnerstall zu holen. Das sollte man tunlichst erst dann machen, wenn alle Hühner draußen waren, weil der Anblick unweigerlich aufgeregtes Gackern, Flügelschlagen und Drängeln zur Folge hatte.
Sie mochte Hühner. Sie mochte ihre runden, rotbraunen, dicht mit Federn bedeckten Körper auf den unglaublich dünnen Beinchen, sie mochte die Uhrwerk-Bewegungen, die behaglichen Laute und ihr albernes soziales Gegacker. Sie mochte das eingerostete Räuspern von Clinton, dem Hahn – der so hieß, weil er sich ständig an alle Jüngeren seines Hofstaates heranmachte –, ehe er morgens krähte. Und da stolzierte er auch schon heran, mit seinem prächtigen roten Kamm, und reckte den Hals.
Sie kippte die Maische in den Trog, beobachtete kurz den Aufruhr, den sie dadurch verursachte, dann hängte sie sich den leeren Eimer über den Arm, ergriff die Schüssel mit den Eiern und ging durch das kleine Tor in der Trockenmauer um den Obstgarten herum zum Haus zurück. Es schmiegte sich an einen der grünen Hügel von Galloway, und da es aus den für die Gegend typischen Steinen gebaut war, wirkte es eher wie eine geologische Formation und nicht wie das Werk menschlicher Hände. Wie bei einer Kinderzeichnung hatte es unten ein Fenster auf jeder Seite der Tür, im ersten Stock drei Fenster und darüber ein Dach aus grauem Schiefer, das jetzt in der Morgensonne silbern glänzte.
Sie drehte sich um, als sie das Motorengeräusch eines Geländemotorrads hörte, und sah, wie ihr Mann Bill auf dem Hügel gegenüber einen Anhänger mit Futter zu den trächtigen Schafen brachte, die so schnell es ihre wolligen Bäuche erlaubten hinter ihm her galoppierten. Die Colliehündin Meg umrundete sie wichtigtuerisch und blieb ihnen immer dicht auf den Fersen, obwohl ihre Arbeit eigentlich nicht vonnöten war. Bill hielt an und sprang vom Bike. Er war ein großer, kräftig gebauter Mann, daß er gerade seinen dreiundvierzigsten Geburtstag gefeiert hatte, sah man ihm nicht an.
Der dichte Bodennebel ließ ahnen, daß die Sonne nicht mehr allzu lange scheinen würde, aber im Moment verlieh er der Landschaft eine fast unwirkliche Schönheit. Die weichen Hügel wirkten wie hinter einem leuchtenden Schleier, und die Wipfel der kahlen Bäume ragten aus dem Dunst hervor. Einen Augenblick lang gestattete sie sich, die Landschaft zu bewundern, die sie schon ihr Leben lang kannte und liebte – »Gottes privaten Garten« hatte ihr Vater diese stille Ecke von Schottland, an der die geschäftige Welt vorbeirauschte, immer genannt.
»Mum! Mum!« Catrionas aufgeregte Rufe von der Tür des Bauernhauses her unterbrachen sie in ihrer Träumerei. »Beeil dich! Wir kommen zu spät!« Als gewissenhafte Elfjährige lebte Cat in der ständigen Angst, sie könne durch irgendeine entsetzliche Regelübertretung, wie zum Beispiel ein paar Minuten zu spät zur Schule zu kommen, unangenehm auffallen.
»Ich komme schon!« rief ihre Mutter über die Schulter. »Sag Cammie Bescheid, ja?« Cameron würde man wahrscheinlich von seinem Gameboy loseisen müssen; mit Pflichten stand der Neunjährige auf Kriegsfuß.
Sie steckte zwei Finger in die Mundwinkel und stieß einen gellenden Pfiff aus, der durch das Tal hallte. Bill blickte auf; sie winkte ihm zum Abschied, und noch während er den Gruß erwiderte, wandte sie sich bereits zum Gehen. Sie säuberte ihre Stiefel mit der derben Bürste aus Schweineborsten, die an der Tür zum Windfang stand, dann trat sie ein und stellte sie auf das Metallregal, das unten an der Wand entlanglief. Cammies Stiefel lagen natürlich mal wieder auf den Fliesen; automatisch räumte sie sie auf, während sie auf ihren dicken Socken zur Küche tappte.
Cammie saß in dem durchgesessenen Lehnsessel neben dem alten Aga, den unvermeidlichen Gameboy in den Händen. Cat versuchte gerade ohne viel Erfolg, ihm das Spielzeug wegzunehmen. Sie hatte die blonden Haare ihres Vaters, war jedoch schlank und langbeinig, während Cammie mit seinem kräftigem Knochenbau, groß für sein Alter und bereits ein Star in der Kinderrugbymannschaft im Ort, bestimmt auf seinen Vater kam, jedoch ihre dunklen Haare und Augen geerbt hatte.
»Hau ab«, beschwerte er sich und wehrte Cat ab. »Ich mache nur noch dieses Spiel zu Ende, reg dich ab. Okay?«
»Wir kommen zu spät! Mum, sag ihm ...«
»Cat, wenn du ihn zu Ende spielen läßt, geht es schneller. Cammie, in drei Minuten stehst du fix und fertig an der Haustür, sonst siehst du dieses Ding in den nächsten vierundzwanzig Stunden nicht wieder.«
»Klar, klar«, grummelte er. Er stand auf und ging zur Garderobe, wobei er ständig weiter die Tasten drückte. Seine Schwester seufzte dramatisch.
Oben zog ihre Mutter rasch den Reißverschluß des schweren Overalls auf, während sie ins Badezimmer ging, um sich die Hände zu waschen. Dann hüpfte sie ins Schlafzimmer, wobei sie sich auf dem Weg die Socken von den Füßen zog. Auch den Overall zog sie aus. Darunter trug sie einen schicken grauen Hosenanzug und einen weißen Pullover mit V-Ausschnitt. Sie schlüpfte in ein paar flache schwarze Slipper, fuhr sich mit der Bürste durch die Haare, trug rasch etwas Lippenstift auf und musterte sich dann in dem Spiegel an der Tür zur Garderobe. Kurz zupfte sie hinten am Blazer und strich die Aufschläge glatt.
In Ordnung. Detective Inspector Marjory Fleming war bereit zur Arbeit.
Laura Sonfeldt schloß die Haupttür mit der abblätternden Farbe, dann die Sicherheitstür aus Metall und ging langsam die Außentreppe des Frauenhauses hinunter.
Es war bitterkalt. Ein scharfer Wind peitschte strömenden Regen durch die schmale Straße in New York und trieb Müll über den Bürgersteig. Ein mit Sauce beschmierter Fastfood-Karton wurde gegen ihre beigefarbene Hose geweht, aber sie merkte es kaum. Nur mühsam hielt sie die Tränen zurück, während sie ihre blonden Haare in ihre geringelte Wollmütze schob, sie tief über die Ohren zog und den Pelzkragen ihres Mantels hochschlug.
Sie fühlte sich unendlich schuldig. Es war ein so rührender Abschied gewesen in dem schäbigen Gemeinschaftsraum mit seiner wüsten Mischung aus erbettelten und geliehenen Stühlen und Tischen. Man sah dem Raum an, wie viele Personen sich darin aufhielten, überall waren Flecken von Essensresten und Kinderspielzeug, das unordentlich herumlag, und es gab nicht genug Desinfektionsmittel, um den Geruch nach vollen Windeln und Erbrochenem zu übertünchen. Die Frauen waren entweder klapperdürr, übernervös und auf irgendeiner Droge, legal oder illegal, oder aber sie waren übergewichtig, weil sie zu viel in sich hineinstopften, um die Angst zu überdecken, die sie letztendlich ins Frauenhaus getrieben hatte. Und alle hatten den gleichen gehetzten, wachsamen Blick. Sie hatten sich von Laura verabschiedet, mit Reden, Umarmungen, Tränen und einer plumpen Gipsskulptur einer Mutter mit Kind, die jetzt in ihrer Einkaufstasche steckte.
Es war ihr schwergefallen, sie zu verlassen, auch wenn sie sich in den vergangenen fünf Jahren nie ganz sicher gewesen war, wie gut sie der Aufgabe, einer endlosen Folge verzweifelter Frauen verständnisvoll zuzuhören, gerecht geworden war. Die meisten Frauen schleppten eine Vergangenheit mit sich herum, die sie zu ewigen Opfern machte, und sie zu beraten war ihr oft vorgekommen, als wolle sie amputierte Gliedmaßen mit einem Pflaster versorgen. Wenn diese Frauen jemals wieder Fuß fassen wollten, dann bräuchten sie intensive Therapie, und selbst dann ... Na ja, mit der Zeit hatte sie eine immer zynischere Einstellung zu ihrem Beruf entwickelt, obwohl – oder vielleicht gerade weil – ihre Therapiesitzungen mit den verwöhnten, reichen Damen der Gesellschaft ihr ihre ehrenamtliche Arbeit im Frauenhaus ermöglicht hatten.
Wenn ihre Mutter nicht gewesen wäre, hätte sie vielleicht noch jahrelang so weitergemacht, ohne sich ihre allgemeine Unzufriedenheit einzugestehen, da ja Kinder von Schustern bekanntlich die schlechtesten Schuhe tragen. Als jedoch die Nachbarin ihrer Mutter aus England angerufen hatte – »Jane bringt mich wahrscheinlich um, wenn sie davon erfährt, aber ich dachte, ich sage dir besser, daß sie einen leichten Herzinfarkt hatte« –, war dem Schrecken die Klarheit gefolgt: Sie war eine Fremde in einem Land, in dem eine irreführend ähnliche Sprache gesprochen wurde, und sie hatte unglaubliches, unerträgliches Heimweh.
Es wäre etwas anderes gewesen, wenn es mit Bradley geklappt hätte, aber das hatte es nicht. Der Rhodes-Stipendiat, in den sie sich in Oxford verliebt und den sie in einer romantischen Zeremonie in der College-Kapelle zwei Wochen nach ihrem Examen geheiratet hatte, hatte sich zu Hause in New York in einen langweiligen Banker verwandelt. Als ihre Erfahrungen in der ärmlichen Bowery und seine in der Wall Street sich immer weiter voneinander entfernten, starb die Ehe einen langsamen Tod, bis es schließlich nur noch eine Frage der Barmherzigkeit war, sie von ihrem Leiden zu erlösen.
Aber selbst damals hatte sie nicht daran gedacht, nach Hause zurückzukehren. Sie hatte gute Freunde, und die Lebensfreude, die sie von Anfang an in New York empfunden hatte, war noch nicht ganz verschwunden. Über ihren Job in einer großen Praxis, die für wohlhabende Frauen schicke Therapien anbot, deren schmächtige Körper und überproportional große Köpfe sie wie Kartoffeln auf Stöcken aussehen ließen, konnte sie sich eigentlich nicht beklagen; er wurde gut bezahlt und war nicht wirklich anstrengend, wenn man einmal davon absah, daß man ständig dem Drang widerstehen mußte, den Frauen zu sagen, sie sollten etwas Sinnvolles tun und etwas Anständiges essen. Die Trivialität ihrer Arbeit rechtfertigte sie mit ihrer Aufgabe im Frauenhaus, wobei sie manchmal schuldbewußt dachte, daß sie viel mehr davon profitierte als die armen Frauen dort.
Aber jetzt war sie das Stadtleben leid. Sie hatte den Lärm und den Gestank und die Luftverschmutzung satt, die hartnäckigen Probleme und den Glauben, daß ständige Bewegung das gleiche wie Fortschritt sei. Während sie dem Sprühregen auswich, den ein Auto, das durch eine Pfütze am Straßenrand fuhr, verursachte, dachte sie sehnsüchtig an das ruhige Landleben in England und an ihre Mutter, die nie von ihr verlangt hatte, sie müsse zurückkommen, obwohl sie bereits eine Tochter verloren hatte. Mit einem letzten schuldbewußten Blick auf die schmutzigen Fenster machte sich Laura auf den Weg. Diese Zeit ihres Lebens war vorbei. Jetzt mußte sie nur noch in ihre Wohnung, ihren Flug buchen und ihrer Mutter die gute Nachricht mitteilen; ihre Mundwinkel verzogen sich, als sie an die Freude in der Stimme ihrer Mutter dachte. Und sie würde endlich nicht mehr Laura Sonfeldt sein, die Frau, die in der Fremde lebte, die ihr jetzt beinahe schon wie Vergangenheit vorkam. Wenn sie zurückging, würde sie wieder Laura Harvey sein, eine Frau in ihrer Heimat, mit sich selbst im reinen.
Als sie in ihre Wohnung im dritten Stock eines Mietshauses trat, blinkte das rote Lämpchen ihres Anrufbeantworters. Arglos drückte sie den Knopf zur Wiedergabe der Nachrichten, zog sich die Handschuhe aus, während sie zuhörte, und warf sie auf die Couch neben dem Telefontischchen. Es dauerte einen Moment, bis sie begriff, was sie gehört hatte, aber dann erstarrte sie mitten in der Bewegung, als ob die kalten Worte ihre Adern zu Eis hätten gefrieren lassen. Sie hörte sich schreien, wie ein Kind: »Oh, nein, nein! Es ist einfach nicht fair!« Dann sank sie auf die Couch und schluchzte, als ob ihr das Herz brechen würde.
Marjory Fleming legte ihren Füller hin und ließ ihre verspannten Schultern kreisen. Ihre Augen brannten vom angestrengten Blicken auf den Computermonitor, und sie legte kurz die Hand darüber. Dann gähnte sie herzhaft.
Es war Ende Januar, ein Montagnachmittag, und der Regen prasselte unnötig heftig gegen die Fenster des Polizeipräsidiums von Galloway. Man konnte noch nicht einmal wie sonst die Dächer des Marktfleckens Kirkluce, in der Mitte zwischen Stranraer und Newton Stewart, sehen. Fast den ganzen Tag über hatte in Detective Inspector Flemings kleinem Büro im vierten Stock das Licht gebrannt, während sie Statistiken zusammenstellte.
Hatte sich die Mühe, die sie in ihre Karriere investiert hatte, wirklich gelohnt? Das Studium, das Examen, die Kurse, die Gespräche? Ehrlich gesagt genoß sie ihre Verantwortung im Kommissariat, und mit dem Managen hatte sie kein Problem: Wenn man Kinder hatte, besaß man die nötige Erfahrung, um Streitigkeiten zu schlichten, zu verhandeln, zu motivieren und seine Position zu behaupten, wenn es kritisch wurde. Sie kannte ihren Spitznamen – Big Marge –, und er war zwar im großen und ganzen liebevoll gemeint, zeugte jedoch auch von einem gewissen wachsamen Respekt. Ihr Ruf war ihr gleichgültig, aber sie war nicht immun gegen die Freuden der Macht, und auch das Geld kam nicht ungelegen, da Farmer zur Zeit ziemliche Probleme hatten.
Aber der Papierkram! Jeden Monat wurde es mehr. Unten auf dem Revier brauchte man allein dreizehn verschiedene Formulare, nur um einen Betrunkenen in die Ausnüchterungszelle sperren zu können. Und hier oben im vierten Stock verdreifachte sich diese Arbeit.
Sie hatte noch nicht wirklich analysiert, warum sie so unbedingt zuerst ihre Sergeant-Streifen hatte haben wollen und dann auch noch die Beförderung zum Inspector. Es war Bill, der sie in seiner üblichen scharfsinnigen Art darauf hinweisen mußte, daß es bestimmt etwas mit ihrem Vater zu tun hatte. Vermutlich wollte sie ihm beweisen, daß sie alles genauso gut konnte wie der Sohn, der ihm versagt geblieben war. Aber es hatte nicht funktioniert, oder?
Angus Laird, »Sarge« für Generationen von Polizeibeamten in Galloway, war eine Legende gewesen, sowohl wegen der Länge seiner Dienstzeit als auch wegen seiner Fähigkeiten. Er war noch im Dienst geblieben, als er das Pensionsalter schon längst überschritten hatte, weil er sich als Verkörperung seines Berufs empfand. Er war der Gralshüter, eine Ein-Mann-Bastion gegen die neue Empfindsamkeit, die mittlerweile bei der Polizei herrschte. Als er letzten Endes gelangweilt und frustriert doch in den Ruhestand ging, hielt sein Chef eine freundliche Rede, war jedoch sichtlich erleichtert.
Marjory sagte ihm nichts davon, als sie sich bei der Polizei bewarb, präsentierte sich ihm jedoch an ihrem ersten Tag im Job in Uniform, so hoffnungsvoll, wie ein Labradorwelpe seinem Herrchen eine Trophäe anbietet. Mit einem halbzerkauten Hausschuh hätte sie wahrscheinlich bessere Chancen gehabt. Er machte ihr klar, daß sie nur eine Frau war, die nie mehr als einen zweitklassigen Beitrag zur Männerwelt leisten konnte.
Auch ihre Beförderung zum Sergeant und ihre beeindruckende Arbeit im Kommissariat änderten seine Einstellung nicht. »Was du auch tust, es wird nie genug sein«, warnte Bill sie immer, wenn sie sich bei ihm ausweinte, aber irgendwie konnte sie es nicht lassen. In Rekordzeit wurde sie zum Inspector befördert.
»Jetzt muß er ja wohl anerkennen, wie gut ich bin«, hatte sie triumphierend zu ihrem Mann gesagt, als sie sich darauf vorbereitete, zum Bungalow ihrer Eltern am Stadtrand von Kirkluce zu fahren, um ihnen von ihrem Erfolg zu berichten.
Bill war ein schweigsamer Mann, der seine Worte immer sorgfältig abwägte. Auch jetzt zögerte er, ehe er liebevoll erwiderte: »Ist dir klar, daß du es total versiebt hast? Er wird dir nie verzeihen, daß du etwas erreicht hast, was ihm in all seinen Dienstjahren nicht gelungen ist.«
Betroffen blieb sie stehen. Nein, das würde er doch wohl nicht tun!
Mit seinen siebzig Jahren war Angus Laird immer noch ein aufrechter Mann mit vollen weißen Haaren. Er hatte die Augen zusammengekniffen, und erschreckt hatte sie Neid und sogar Haß darin gesehen.
»Es ist ein trauriger Tag für die Polizei, der ich immer voller Stolz angehört habe, wenn sie aufgehört haben, einen Mann die Arbeit eines Mannes tun zu lassen. Es wäre zumindest so, wenn es überhaupt noch Männerarbeit wäre.«
Mehr sagte er nicht, während seine Frau Janet, rundlich, warmherzig und voller unkritischer Bewunderung für beide Mitglieder ihrer Familie, über Marjorys außergewöhnliche Klugheit in Entzückensschreie ausgebrochen war und gesagt hatte, wie stolz sie auf sie sei. Ungerechterweise bedeutete ihrer Tochter das jedoch kaum etwas.
Marjory seufzte. Heute war einer der Tage, an denen sie auf dem Heimweg immer bei ihren Eltern vorbeischaute; wie üblich würde ihr Vater vor dem Fernseher sitzen und sich darüber beklagen, daß heutzutage kein gescheites Programm mehr liefe, und ihre Mutter würde sie, genau wie früher, wenn sie aus der Schule gekommen war, fragen: »Was hast du denn heute gemacht, Liebes?« Daß sie nur Papierkram erledigt hatte, würde sie besser nicht erwähnen, sonst zöge sie sich sowieso nur den Unmut ihres Vaters zu.
Na ja, hier herumzusitzen und zu grübeln nützte auch nichts, die Arbeit tat sich schließlich nicht von allein. Widerwillig griff sie erneut zu ihrem Füller, als es an der Tür klopfte. »Herein!« rief sie, legte den Schreiber rasch wieder hin und blickte erwartungsvoll auf.
»Haben Sie einen Moment Zeit, Ma'am?« PC Sandy Langlands war ein junger Beamter mit lockigen dunklen Haaren und fröhlicher Ausstrahlung. Flemings Gesicht hellte sich auf.
»Kommen Sie herein! Sie sind ein willkommener Anblick!« Während er sich ihr gegenüber setzte, zeigte sie auf die Unordnung auf ihrem Schreibtisch und fügte hinzu: »Aber bilden Sie sich bloß nichts darauf ein! Selbst Hannibal Lecter wäre jetzt ein willkommener Anblick. Wenn wir soviel Zeit in Ermittlungen stecken würden wie in diese Zahlen, nur damit die Zivilangestellten auf ihrem dicken Hintern sitzen und ihr dickes Gehalt einstreichen können, dann würde die Kriminalitätsrate ganz von allein sinken – aber genug davon. Was kann ich für Sie tun?«
Big Marge war berühmt dafür, daß sie ihre Worte nicht auf die Goldwaage legte. Langlands grinste. »Hauptsächlich geht es um etwas Gesellschaftliches.«
Sie nahm das Wort »hauptsächlich« zur Kenntnis, während er einen Stapel Eintrittskarten schwenkte und fortfuhr: »Das Burns-Mahl. Es ist am Samstag ...«
Sie kniff die Augen zusammen. »Hat Detective Sergeant MacNee Ihnen das aufgetragen?«
Er warf ihr einen erschreckten Blick zu. »Nun, ja, ja, das hat er.«
Fleming stöhnte. Tam MacNee war ihr Senior Sergeant, und er zitierte Burns bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Ihre geringe Meinung von dem Mann, der als der größte Sohn der Stadt galt, hielt er für Häresie. Sie lehnte sich in ihrem Stuhl zurück.
»Hören Sie zu, Junge. Ich habe nichts gegen ein deftiges Essen. Ich habe noch nicht einmal etwas gegen die Gedichte dieses Mannes. Es ist dieser hirnlose Zirkus, der um den Mann gemacht wird, der mir so auf die Nerven geht. Sie müssen mich schon in Beugehaft nehmen, wenn Sie mich dazu bewegen wollen, mich dahin zu setzen und mir anzuhören, wie sich gefühlsduselige Männer und wimmernde Frauen für diesen scheinheiligen Bastard begeistern.«
»Darf ich das als Nein verstehen?« fragte er ernst.
»Bei Ihren Fähigkeiten zu logischer Ableitung sollten Sie im Kommissariat arbeiten. Gut, das wäre also geklärt. Und was war das andere?«
Langlands blickte sie verblüfft an. »Das andere? Wie ... wie ...?«
Es konnte ja nicht schaden, wenn man sie jetzt auch noch für eine Hellseherin hielt. »Die Angelegenheit, wegen der Sie eigentlich zu mir gekommen sind.«
Verwirrt sagte er: »Na ja, es ist ein bißchen kompliziert. Inoffiziell sozusagen, Ma'am.«
Fleming grinste innerlich. Dieses Spiel war einer der Flüche der Polizeiarbeit. Es wurde zwar von einem erwartet, daß man handelte, man durfte jedoch den Beweis, den man erhalten hatte, um die Handlung zu rechtfertigen, nicht verwenden. »Mmm«, sagte sie. »Nur zu, aber Sie müssen wissen, daß mir die Hände gebunden sind, wenn es inoffiziell ist.«
»Ja, Ma'am. Es ist nur – na ja, es ist ein Problem mit einem der Detective Sergeants, und ich dachte, Sie könnten vielleicht etwas dagegen unternehmen, bevor eine formelle Beschwerde beim Super draus wird.«
»Das ist fair, das schätze ich, Sandy.« Und das tat sie auch. Eine formelle Beschwerde über einen Untergebenen war eine alptraumhafte Prozedur. »Dann lassen Sie mal hören.«
Der Constable räusperte sich nervös. »Es handelt sich ... es handelt sich um DS Mason.«
Nicht die größte Überraschung seit dem Inhalt ihrer Nikolausstrümpfe. »Ach ja?«
»Police Constable Jackie Johnston – kennen Sie sie? Sie hat vor drei Wochen hier angefangen.«
»Im Moment kann ich ihr kein Gesicht zuordnen.« Als Detective Inspector war sie für die Verbrechensaufklärung zuständig, und mit den Beamten in der Ausbildung hatte sie nicht viel zu tun.
»Ja, natürlich. Sie ist ein ruhiges, nettes Mädchen, und nur unter uns, ich bin nicht sicher, daß sie für den Job wirklich geschaffen ist. Sie war fast hysterisch, als er mit ihr fertig war, und nur weil sie einen Verhafteten über seine Rechte aufklären sollte und sie nicht wie aus der Pistole geschossen hersagen konnte. Wenn jemand, der fünfzehn Jahre älter als sie und doppelt so groß wie sie ist, sie anschreit, wird sie sich nie durchsetzen können.«
Fleming seufzte. Die Masons. Sie kannte drei Generationen dieser temperamentvollen Familie, und es war nicht zum ersten Mal mit Conrad durchgegangen. Er war sowieso nicht allzu beliebt bei seinen Kollegen, aber wie MacNee einmal gesagt hatte: »Er mag ja gallus sein, aber er hat zumindest smeddum.« Dem konnte sie nur zustimmen, denn obwohl er ein bißchen viel von einem Landjunker an sich hatte, besaß er doch auch jenen Funken lebendiger Energie, den Schotten mit dem Namen eines uralten, äußerst wirksamen Insektenvernichtungsmittels bezeichneten. Sie hätte ihn auf jeden Fall ungern wegen eines Mädchens verloren, das offensichtlich zu weich für den Job war. Andererseits blieb natürlich der Tatbestand der Belästigung, vor allem bei der heutigen Gesetzgebung.
Langlands blickte sie erwartungsvoll an. Fleming legte ihre Finger zu einer Pyramide zusammen und stützte ihr Kinn darauf. Sie überlegte eine Weile, dann sagte sie: »Gut. Demnächst steht eine Beurteilung bei ihm an, und wir werden ihm empfehlen, an einem Anti-Aggressionstraining teilzunehmen. Für den Moment bekommt er von mir eine Verwarnung, daß er seine Karriere knicken kann, wenn es auch nur eine Beschwerde gibt. Das wird ihn zur Räson bringen, und er wird mit Ihrer Kleinen sanft sein wie ein Lämmchen. Genügt Ihnen das?«
Das Gesicht des Constable hellte sich auf. »So eine Art Bewährung, damit er Gelegenheit hat, sich gut zu benehmen? Danke, Ma'am.«
Er war schon beinahe durch die Tür, als sie sagte: »Die Kleine gefällt Ihnen, was?« Befriedigt sah sie, wie er hellrot anlief.
Als er weg war, verzog Fleming das Gesicht. Die Masons waren schon ein seltsamer Haufen. Der Großvater hatte mit den Republikanern im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft und hatte angeblich sogar Hemingway gekannt – dieses ganze Zeug aus den Dreißigern mit Stierkämpfen und prahlen und ein Mann sein. Er war davon ganz besessen gewesen, hatte seinen Sohn und seine Tochter Jake und Brett nach Figuren in einem der Romane genannt und sich eine Zuchtherde mit Welshblack-Rindern angeschafft. Brett war Conrad Masons Mutter, und sie fuhren immer noch jedes Jahr nach Spanien zur corrida. Marjorys Mitgefühl galt den Stieren, und für Hemingway hatte sie auch nichts übrig. Sie hatten ihn in der Schule gelesen, und sie hatte ziemliche Probleme bekommen, weil sie geschrieben hatte, seine Frauen seien so gefügig, daß sie ebensogut aufblasbare Gummipuppen sein könnten.
Sie hatte einmal etwas über Zwischenfälle wegen des Mason-Temperaments gehört – irgend etwas war mit Conrads Onkel Jake beim Bullenverkauf gewesen –, aber an Einzelheiten konnte sie sich nicht mehr erinnern. Zwar kannte sie ihre Schäfchen, war sogar berühmt dafür, aber ihr Vater hatte mehr Ahnung von den alten Geschichten. Sie konnte ihn heute abend danach fragen. Er freute sich über jede Gelegenheit, sein großes Wissen demonstrieren zu können – und sie war leider immer noch ängstlich darauf bedacht, ihm eine Freude zu bereiten.
Marjory griff wieder zu ihrem Füller, obwohl sie in Gedanken immer noch bei Conrad Mason war. Er hatte sich schon häufiger so verhalten, und es war ein bißchen wie bei einem gewalttätigen Ehemann: Er entschuldigte sich und versprach hoch und heilig, es nie wieder zu tun. Bis zum nächsten Mal.
Sie hatte keine Zeit für Psychologie. Anti-Aggressionstraining, Therapie, Persönlichkeitsentwicklung – das alles verschaffte den Leuten doch nur bequeme Schreibtischjobs. Aber sie würde Mason trotzdem das Training empfehlen, schließlich erwartete man das von ihr. Allerdings würde sie ihr Eiergeld nicht darauf verwetten, daß etwas dabei herauskam.
Kapitel 2
»Oh, meine Liebe, sie wird mir so schrecklich fehlen! Sie hat sich immer die Zeit genommen, um zuzuhören ...«
»Ich weiß nicht, wo der Chor jetzt eine solche Pianistin finden will!«
»Gab es jemals eine bessere Nachbarin?«
Die Damen mit ihren weichen, rosigen, zerknitterten Gesichtern und den pastellfarbenen Tweedkostümen drängten sich wie ein Schwarm summender Bienen um sie. Laura, die viel zu dünn wirkte in ihrem schwarzen Wollkleid, lächelte unermüdlich und drückte die runzeligen, gichtigen Hände. Sie tätschelten sie bekümmert, stellten schließlich ihre Sherrygläser vorsichtig auf die Untersetzer, die die polierte Tischplatte schonen sollten, und verschwanden nach und nach. Noch während sie im grauen Nieselregen den Weg entlanggingen, murmelten sie einander ihre sanften Klagen zu.
Die Frau, die als einzige noch blieb, hatte schärfere Gesichtszüge; ihre lange Nase bebte leicht beim Sprechen, und ihre Augen hinter der goldgeränderten Brille blickten aufmerksam und neugierig. Sie wies auf ein Foto, das auf dem Flügel stand, den Schnappschuß einer lachenden jungen Frau, die im Profil mit ihrer Stupsnase und dem blonden Haar Laura sehr ähnlich sah.
»Es ist so schade, daß deine Schwester nie zurückgekommen ist – na ja, deine Halbschwester, sollte ich wohl besser sagen, aber das ist ja sowieso gleich, oder?« Man konnte ihr Zahnfleisch sehen, wenn sie lächelte.
»Ja«, sagte Laura.
»Es hätte der armen Jane so viel bedeutet. Du hörst wahrscheinlich auch nie von ihr, oder?«
»Nein.« Laura spürte, wie die Frau jeden Millimeter ihres Gesichtes musterte. Die tiefen Ringe unter ihren graublauen Augen und die aufgequollenen Lider vom vielen Weinen entgingen ihr sicher nicht. Entschlossen streckte sie in einer kalkulierten Geste die Hand aus. »Es war so lieb von Ihnen zu kommen, Mrs. Martin.«
Der Frau blieb gar nichts anderes übrig, als sich verabschieden zu lassen; es hatte doch auch seine praktischen Seiten, wenn man Psychologin war. Zögernd stellte Mrs. Martin ihr Sherryglas direkt auf die Rosenholzfläche des Klaviers, und dann ging auch sie.
Laura hatte Kopfschmerzen. Sie schloß die Tür hinter sich, dankbar dafür, daß die Anstrengung der Beerdigung vorbei war, als sie jedoch in das leere Wohnzimmer zurückkehrte, kam es ihr ohne das Summen der leisen Stimmen bedrückend still vor. In der Diele tickte die Standuhr, im Kamin knisterte das Feuer, das sie in einem vergeblichen Versuch, den Anlaß freundlicher zu gestalten, angezündet hatte. Lustlos räumte sie die Sherrygläser weg. Ihr eigenes war unberührt; sie hatte keinen Schluck von dem Zeug zu sich genommen, seit ihrem achten Lebensjahr nicht, als Dizzy eine Flasche aus dem Barschrank entwendet und ihr zwei Gläser voll zu trinken gegeben hatte. Laura war so schlecht geworden, daß ihre Mutter den Arzt kommen ließ, aber selbst da hatte sie nichts verraten. Sie hatte Dizzys Geheimnisse immer für sich behalten.
Die Küche war ordentlich aufgeräumt, so wie ihre Mutter sie hinterlassen hatte. Sie spülte die zarten Kristallgläser vorsichtig, trocknete sie ab und trug sie wieder ins Wohnzimmer, um sie an ihren angestammten Platz im Schrank zu stellen, ganz so, als wenn die nächste Person, die sie benutzen würde, nicht der Händler wäre, der das Haus ausräumen sollte.
Ticktack, ticktack. Sekunden, Minuten, Stunden, Jahre. Vergeudete Jahre. Laura saß im viktorianischen Lieblingssessel ihrer Mutter und blickte sich im Wohnzimmer um, in dem alles von einem ruhigen, friedlichen Leben mit Freundschaften und Hobbys sprach – das Klavier, der Stickrahmen, die Einladungskarten, die am Spiegel über dem Kamin steckten. Sie wußte, daß dies alles nur ein Trugbild war. Ihre kultivierte, elegante Mutter war von einer Verzweiflung erfüllt gewesen, die ebenso quälend war wie die der verzweifelten Frauen in New York, die zu Laura in die Therapie kamen.
Das Schlimmste in all diesen Jahren war das Nichtwissen gewesen. Laura sah sich selbst noch, eine magere Elfjährige mit staksigen Beinen, die niedergeschlagen auf der Treppe hockte, die Arme um die knochigen Knie geschlungen und angestrengt lauschend, weil ihre Eltern im Wohnzimmer mit einem fremden Mann redeten, der Dizzy finden sollte. Es tat so weh, daß ihre Schwester ihr nicht gesagt hatte, wohin sie gegangen war; sie wußte doch, daß sie Laura vertrauen konnte. Sie hätte sie nicht verraten.
Sie hatte Dizzy vergöttert. Dizzy – Diana – war neun Jahre älter als Laura, wunderschön, witzig und gelegentlich liebevoll zu ihrer kleinen Halbschwester. Ihr Vater hatte Frau und Kind verlassen und sich kurz darauf zu Tode gesoffen. Dizzy war so sehr seine Tochter, daß auch auf ihr Konto einige Dinge gingen, die ihre Mutter und Lauras Vater, der Anwalt war, in ein Wechselbad von Zorn und Sorge tauchten und Laura so zum Lachen brachten, daß ihr die Tränen über die Wangen liefen.
Dizzy hatte all die exotischen Dinge getan, nach denen Laura sich insgeheim sehnte, auch wenn sie es nie wagen würde, sie in die Tat umzusetzen. Ausgestattet mit einem Sekretärinnendiplom und der Fähigkeit, ein Spiegelei zu braten, war Dizzy mit dem Rucksack auf dem Rücken auf Weltreise gegangen und hatte sich auf australischen Rinderfarmen und südamerikanischen Ranches Arbeit gesucht. Sie war mit den Delphinen geschwommen und mit den Stieren in Pamplona um die Wette gelaufen. Eine Zeitlang hatte sie sich sogar einem Zirkus angeschlossen, bis die Absichten des Zirkusdirektors ihr zu ernsthaft wurden – Männer machten ihr immer den Hof. Nach Hause kam sie nur, wenn ihr mal wieder das Geld ausgegangen war.
Es war für alle nicht leicht gewesen, mit der erwachsenen und äußerst unabhängigen Dizzy unter einem Dach zu leben. Und eines Tages schließlich hatte es den ultimativen Streit gegeben, mit Brüllen und Türenschlagen und Tränen der Wut. Laura hatte sich herausgehalten und darauf gewartet, daß der Sturm sich verzog; sie konnte sich zwar nicht erinnern, jemals eine so schlimme Auseinandersetzung erlebt zu haben, aber irgendwann würden sich alle schon wieder beruhigen. Selbst als Laura entdeckt hatte, daß Dizzy gegangen war und lediglich eine Notiz zurückgelassen hatte, sie würde jetzt ihr eigenes Leben leben, hatte sie sich noch keine wirklichen Sorgen gemacht – und ihre Eltern wahrscheinlich auch nicht. Drei Wochen später hatte sie angerufen, ganz kurz nur, um zu sagen, es ginge ihr gut und sie habe einen Job, dann legte sie auf, ohne ihrer Mutter Gelegenheit zu geben, mehr als »Liebling ...« von sich zu geben.
Es war das letzte Wort, das sie mit ihr sprach. Jane Harvey war gestorben, nachdem sie fünfzehn Jahre lang mit der schrecklichen Alternative gelebt hatte, daß ihre Tochter entweder tot war oder für ihre Mutter so wenig übrig hatte, daß sie sie in dieser qualvollen Ungewißheit ließ.
Und es gab noch etwas Schlimmeres. Sechs Monate nach Dizzys Verschwinden hatte Laura auf der Treppe gesessen und belauscht, wie ihre Eltern mit einem fremden Mann über sie gesprochen hatten. Sie war damals alt genug, um zu wissen, daß er Privatdetektiv war. Die Polizei hatte kein Interesse an einer Zwanzigjährigen, die sich mit ihren Eltern gestritten und von zu Hause weggelaufen war. Sie hörte, wie er fragte, ob er ein Foto haben könne, und ihre Mutter antwortete, sie würde ihm eins holen. Schuldbewußt floh Laura eine Treppe höher, als die Tür aufging und ihre Mutter ins Arbeitszimmer trat, wo die Fotoalben aufbewahrt wurden.
Dann hörte Laura den Mann sagen: »Solange Ihre Frau weg ist, nur unter uns – Sie haben doch versucht, sie anzufassen, oder?«
Laura konnte ihren Vater zwar nicht sehen, aber als sie jetzt daran dachte, hatte sie Geoffrey Harveys Gesicht so deutlich vor Augen, als sei sie dabeigewesen – sein asketisches, kluges Gesicht, das er schockiert verzog. Er riß die Augen hinter seiner Hornbrille weit auf und fragte: »Ich, Mr. Wilkinson?«
Wilkinson wies mit dem Kopf auf das gerahmte Foto auf dem Flügel. »Sie war schon ein ganz schöner Schuß, was? Ich kann es Ihnen nicht verdenken ...« Laura erinnerte sich noch gut an den häßlichen Tonfall des Mannes, bevor Sekundenbruchteile darauf ihr Vater ein uncharakteristisches Wutgebrüll ausstieß.
»Verschwinden Sie sofort aus meinem Haus! Ich lasse mich doch nicht von Ihren gemeinen Unterstellungen beleidigen ...«
»Wie Sie wollen«, hörte Laura den Mann sagen, und als sie sich über das Geländer beugte, sah sie, wie er höhnisch grinsend ohne jede Eile aus dem Wohnzimmer schlenderte. Und sie sah, daß ihre Mutter wie erstarrt in der Tür des Arbeitszimmers stand, und da wußte sie, daß sie ebenfalls alles gehört hatte.
Ihr Vater knallte die Haustür hinter dem Besucher zu, dann drehte er sich um und erblickte seine Frau. Immer noch mit vor Zorn hochroten Wangen sagte er: »Es tut mir Leid, meine Liebe. Ich fand ihn sehr unangenehm. Du wirst jemand anderen engagieren müssen, wenn du es für nötig hältst.«
»Ja, natürlich«, erwiderte ihre Mutter, deren Stimme ein wenig bebte. »Ich ... ich fand ihn auch nicht gerade vertrauenerweckend.« Sie gingen wieder ins Wohnzimmer und schlossen die Tür; Laura vermutete, daß sie den Vorfall nie wieder erwähnten.
Rückblickend jedoch begann danach ihre Ehe – die in Lauras kindlicher Wahrnehmung glücklich war – langsam, fast unmerklich schlechter zu werden. Ihre Mutter brachte es anscheinend nicht mehr über sich, die kleinen intimen Gesten zu vollbringen, die jede Ehe zusammenhalten. Und so lebten sie fast wie Fremde unter demselben Dach, bis ihr Vater acht Jahre später starb, traurig und ohne das Verhalten seiner Frau jemals verstanden zu haben.
Laura hatte die Anschuldigung damals nicht geglaubt, und auch heute, wenn sie die Angelegenheit mit den kritischen Augen einer Therapeutin sah, hielt sie das Ganze für äußerst unwahrscheinlich. Dizzy hatte sich einfach das Auto ihrer Mutter genommen und war über Nacht weggeblieben; der heftige Streit, der darauf folgte, war eine plausible Erklärung dafür, daß sie wütend aus dem Haus gerannt war, wenn er auch ihr grausames Verschwinden für immer nicht rechtfertigte. Was ihre Mutter glaubte – nun ja, auch hier konnte Laura mit ihrem professionellen Blick die unterschwellige Versuchung erkennen, jemand anderem die Schuld zuzuschieben. Sie erinnerte sich noch gut daran, daß ihre Mutter nach Geoffrey Harveys Tod hoffnungsvoll gesagt hatte: »Vielleicht sieht Dizzy ja die Todesanzeige und meldet sich.« Das hatte sie natürlich nicht getan. Wie traurig doch der Gedanke war, daß der Tod von Lauras Vater für ihre Mutter vielleicht nur bedeutet hatte, daß ein Hindernis aus dem Weg geräumt worden war.
Hatte es später noch Versuche gegeben, sie zu finden? Laura wußte es nicht. Während ihrer kurzen Besuche aus den Staaten hatte Jane Harvey Dizzys Namen nie erwähnt, und auch Laura, die ihre Mutter auf keinen Fall aufregen wollte, hatte sich davor gehütet. Jetzt schämte sie sich ihrer Feigheit. Warum hatten sie nie über Dinge gesprochen, die wirklich wichtig waren? Laura hätte zum Beispiel auch gerne gewußt, ob ihre Mutter ihren Entschluß, in New York zu leben, als weiteren Verlust, eine weitere Zurückweisung empfunden hatte. Aber sie hatten nie darüber geredet. Ihre Mutter hatte sich nie beklagt, war immer nur heiter und tapfer gewesen, und Laura hatte auch nie gesagt: »Ich liebe dich, du fehlst mir, ich wünschte, du wärest nicht so weit weg.« Wenn sie es doch nur einmal ausgesprochen hätte, dann würde sie sich jetzt vielleicht nicht so schuldig fühlen.
Andererseits war das Schuldbewußtsein eine ihrer Schwächen. Ob ihre Schwester wohl immun gegen Gewissensbisse gewesen war? Hatte sie einfach ihre Familie aus ihren Gedanken verbannt? Hatte sie die Todesanzeige ihrer Mutter gesehen und sie ignoriert, weil sie glaubte, jetzt wäre es sowieso zu spät? Es gab so viele unbeantwortete, nicht zu beantwortende Fragen.
Als tot war sie nirgendwo gemeldet, zumindest nicht in England; Anwälte prüften zur Zeit Sterberegister in Übersee, während sie zugleich in allen größeren Zeitungen der Welt über Anzeigen nach Diana Warwick suchten. Die Testamentsvollstrecker waren sich mit Laura einig darüber gewesen, daß das Haus so schnell wie möglich verkauft werden sollte. Das Vermögen, das zu gleichen Teilen an beide Schwestern gehen sollte, war beträchtlich, und mit ihrem Anteil konnte Laura sich in aller Ruhe überlegen, was sie mit diesem neuen, leeren Leben anfangen wollte. Sie hatte sich in der letzten Zeit in den Staaten wie im Exil gefühlt, und es war eine bittere Ironie, daß sie sich nun auch hier, wo sie sich eigentlich zu Hause geglaubt hatte, fehl am Platz und entwurzelt fühlte.
Wenn wenigstens Dizzy dagewesen wäre! Bei der schrecklichen Aufgabe, die intimen Besitztümer ihrer Mutter durchzugehen, hätten sie gemeinsam über die Erinnerungen, die dabei aufstiegen, weinen und lachen können – obwohl das natürlich ein idealisiertes Bild war. Abgesehen von dem Glamour und der sorglosen Freundlichkeit konnte sie sich ja kaum noch an ihre Schwester erinnern!
Zweifellos war sie äußerst ichbezogen gewesen. Möglich war auch, daß die Scheidung ihrer Eltern die selbstzerstörerischen Anteile ihres Vaters in ihr zum Vorschein gebracht hatten. Das konnte sie anfällig gemacht haben für Alkoholmißbrauch oder, wenn man an ihre wagemutige Art dachte, sie auch zu Drogen oder sogar in die Prostitution geführt haben. Andererseits sah Laura Dizzy nicht als gefährdete Person, das paßte nicht zu ihr. Sie war rebellisch gewesen, nicht labil.
Und wo war sie? Glücklich und mit ihrem eigenen Leben beschäftigt und gleichgültig gegenüber dem Chaos, das sie im Leben ihrer Mutter, ihres Stiefvaters und ihrer Schwester angerichtet hatte? Selbst jetzt, nach all diesen Jahren, träumte sie immer noch von Dizzy – manchmal erschien sie ihr fröhlich und strahlend, wie sie gewesen war, und manchmal in einem Horrorkontext, aus dem Laura schweißgebadet und mit heftig klopfendem Herzen aufwachte. Danach kamen ihr immer die Tränen.
Gestern nacht erst hatte sie wieder von ihr geträumt, was nicht überraschend war – schließlich schlief sie in ihrem Kinderzimmer, in dem sie so oft wach gelegen und darauf gewartet hatte, daß Dizzy hereinkam und ihr von ihrer neuesten Eskapade berichtete. Sie hatte Laura die Hand auf den Mund legen müssen, damit sie nicht so laut kicherte. Letzte Nacht war es einer der Träume gewesen, die Laura insgeheim als schwarze Träume bezeichnete, voller Bedrohungen und ungewissem Entsetzen. Dizzy war in Gefahr, und es war kalt, so kalt; Laura war abrupt aufgewacht und hatte zitternd vor Kälte ihre Decke wieder über sich gezogen, die zu Boden geglitten war.
Oh ja, sie hatten alle unter der Situation gelitten. Trauer und Verlust verursachten solche Verzerrungen im menschlichen Leben.
Ärger und Wut stiegen in ihr auf, wenn sie daran dachte. Sie schnürten ihr fast die Kehle zu, und sie lockerte den grauschwarzen Seidenschal, den sie um den Hals trug. Nervös sprang sie auf und trat zu dem hübschen Walnußsekretär, in dem sich immer die Schreibutensilien befunden hatten, als Laura ein Kind war. Das war auch jetzt noch so: Karten und Notizpapier, Umschläge in allen Größen steckten in den Fächern. Sie versuchte, nicht zu lesen, was auf dem Block stand, den ihre Mutter immer für ihre Einkaufszettel genommen hatte und der witzigerweise überschrieben war mit »Chopin Liszt«. Sie zog ein paar Bögen Schreibpapier heraus und nahm sich einen Schreiber.
An Dizzy, Adresse unbekannt, begann sie.
»Die Masons?« sagte Angus Laird. »Oh ja, die Masons von Chapelton!
Es klang so, als ob er sich den Namen auf der Zunge zergehen ließe. Vielleicht war sie ja überempfindlich, wenn sie dachte, daß er es in Wirklichkeit genoß, daß sie auf seinen Wissensschatz zurückgreifen mußte.
Er schaltete sogar den Fernseher aus. Janet, die aus einer großen braunen Porzellankanne, die entweder noch aus Marjorys Kindheit stammte oder aber durch eine identische ersetzt worden war, Tee einschenkte, lächelte ihre Tochter verstohlen an und nickte leicht, wie um die Verschwörung zweier Frauen anzudeuten, die ihren Mann glücklich machten. Neutral erwiderte Marjory das Lächeln und ergriff ihre Tasse.
»Gab es in Chapelton mal irgendeine Wohltätigkeitsveranstaltung?« fragte sie. »Ich meine mich erinnern zu können, daß ich im Garten gespielt habe – da gab es so eine Art Labyrinth ...«
»Du meine Güte, komisch, daß du dich daran erinnerst!« rief Janet aus. »Du warst damals höchstens elf oder zwölf. Es war für Menschen in Seenot – Mrs. Mason war im Komitee, weißt du. Und du warst ganz aufgeregt wegen dieses Labyrinths – es war ein bißchen verwildert, glaube ich, und irgend jemand hat sich verirrt, und dann gab es Tränen, aber na ja, das ist immer so, wenn Kinder so aufgeregt sind, oder? Aber ich fand es schon eigenartig, so etwas im Garten zu haben, ich weiß noch, daß ich gedacht habe, daß es viel zuviel Arbeit macht ...«
Angus unterbrach seine Frau mitten im Satz. »Ich hatte eigentlich den Eindruck, Marjory, daß du Hintergrundinformationen haben wolltest. Aber wenn du natürlich lieber dem stundenlangen Geschwätz deiner Mutter zuhören möchtest ...«
»Nein, nein, natürlich nicht«, warf Janet mit rotem Kopf ein. »Das ist doch immer dasselbe mit mir – meine Mutter hat mich früher schon immer ein kleines Plappermaul genannt! Aber ich halte jetzt den Schnabel und sage kein Wort mehr!«
Angus fixierte Marjory, als wolle er sie herausfordern, ihre Mutter in Schutz zu nehmen, aber da sie schon seit langem akzeptiert hatte, daß die Beziehung ihrer Eltern – die nun schon weit über vierzig Jahre lang hielt – sie nichts anging, hielt auch sie »ihren Schnabel«.
Befriedigt fuhr ihr Vater fort: »So ganz sauber war die Familie noch nie. Es war der alte Edgar Mason, der die Farm nach dem Krieg gekauft hat – er hat irgendwo im Süden ein großes Unternehmen dafür verkauft, damit er hier Zuchtbullen halten und Farmer spielen konnte. Er war ganz verrückt nach Stieren, nachdem er mit diesem Schriftstellertyp da unten in Spanien gewesen war. Das Labyrinth, von dem ihr eben geredet habt, hat auch was mit Stieren zu tun – mittendrin steht irgend so eine dämliche Skulptur ...«
»Ja, ich weiß«, unterbrach Marjory ihn. »Der Minotaurus – halb Mensch, halb Stier.« Als sie den Gesichtsausdruck ihres Vaters sah, fügte sie rasch hinzu: »Griechische Mythologie. Entschuldigung«, und verstummte.
»Am Ende hatte der Alte den Verstand verloren. Es gab Gerüchte – die Leute reden ja viel, aber es war auch was dran, weil wir ein paarmal gerufen wurden, um ihn zu bändigen, weil er gebrüllt hat wie einer seiner Stiere. Er hat es auf diesen ausländischen Schnaps geschoben, den er als junger Mann getrunken hat, aber wenn du mich fragst, ist Jake nicht viel besser. Er ist doch damals sogar in die Zeitung gekommen, als er auf einen der Preisrichter bei der Royal Highland Show losgegangen ist, nur weil sein Stier nicht gewonnen hat. Und auch die Schwester, die mit dem blöden Namen ...«
»Brett?« Das war Conrads Mutter. Marjory sank das Herz, als sie dieser Aufzählung erblicher Störungen zuhörte.
»Genau. Blöd, wie ich gesagt habe. Und sie hatte auch einen schlechten Charakter. Mit ihrem ständigen Gekeife und Genörgel hat sie ihren Ehemann auf dem Gewissen, genau wie Jake auch seine Frau verloren hat, und das war eine richtige Dame. Es ist mir schleierhaft, was sie an ihm gefunden hat!«
»Ja, da hast du recht!« Janet blieb nie lange stumm. »Rosamond – sie war eine echt nette Frau. Und dann ist sie ihm einfach abgehauen, und ich habe nie wieder von ihr gehört. Und danach ist doch auch Jakes Sohn von zu Hause weggegangen – Max hieß er, aber ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist.«
Angus schnaubte. »Du liebe Güte, das war vielleicht ein verzogenes Balg! Da war was mit Drogen – er ist noch mal davongekommen, aber wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir ihn eingesperrt.«
Das bedeutete, daß Max Mason entweder mit Drogen dealte oder daß er als Teenager mal einen Joint geraucht hatte. Da sie Angus' Einstellung zu Drogen kannte, konnte Marjory das nicht unterscheiden. »Wie ist denn zur Zeit die Lage auf Chapelton? Conrad Mason – du weißt doch, daß er bei der Polizei ist? – gibt Chapelton als Adresse an.«
Sie hatte ihrem Vater nicht erklärt, warum sie etwas über die Masons wissen wollte, und als sie jetzt Conrads Namen erwähnte, hellte sich sein Gesicht auf. »Na, das ist mal ein guter Kerl!« sagte er billigend. »Ich weiß allerdings nicht, warum er seiner Mutter immer noch am Schürzenzipfel hängt. Der Alte hat das Haus aufgeteilt, als Jake geheiratet hat, und als die Tochter von ihrem Mann rausgeworfen wurde, kam sie wieder zu Hause angerannt und hat ihren und den Namen des Jungen in Mason geändert ...«
»Als ob es den Vater nie gegeben hätte«, murmelte Marjory. Das erklärte natürlich einiges.
»Ja, genau. Und da wohnt sie jetzt immer noch. Jake führt immer noch die Farm – er ist genauso bescheuert mit seinen verdammten Stieren wie sein Vater. Conrad aber – der ist aus dem richtigen Holz geschnitzt, das konnte man schon erkennen, als er noch feucht hinter den Ohren war. Er wird bestimmt bald befördert werden.« Dann fügte er verächtlich hinzu: »Das heißt, wenn sie das heutzutage bei echten Männern überhaupt noch dürfen und nicht nur bei Frauen und Weichlingen.«
Marjory hatte genug gehört, und sie mochte auch nicht mehr. Sie stand auf, ein bißchen stolz auf sich, weil sie so gleichmütig geblieben war, statt sich in eine bittere, fruchtlose Auseinandersetzung hineinziehen zu lassen. »Danke, Dad. Es ist immer ganz nützlich, ein paar Hintergrundinformationen zu bekommen. Ich muß jetzt nach Hause und Bill seinen Tee kochen.«
Angus zögerte, weil er offensichtlich schrecklich gerne erfahren wollte, warum sie das wissen mußte, sich jedoch nicht der Demütigung aussetzen wollte, aus Gründen professioneller Diskretion abgeschmettert zu werden. Statt dessen brummte er: »Ja, natürlich. Ist ja auch langsam Zeit.« Dann griff er nach der Fernbedienung, schaltete den Fernseher wieder ein, und es versetzte Marjory einen leichten Stich, als sie sah, wie sein Gesichtsausdruck und seine Augen, gerade noch lebhaft und interessiert, wieder glanzlos und stumpf wurden.
Janet begleitete ihre Tochter an die Haustür. »Warte einen Moment, Schätzchen. Ich habe heute gebacken und für Bill einen extra Rosinenkuchen gemacht. Ich packe ihn dir in die Dose.«
Die Dose war ein weitgereistes Behältnis, das regelmäßig leer von Mains of Craigie nach Kirkluce und von dort aus gefüllt wieder zurückgebracht wurde.
»Das ist sein Lieblingskuchen. Du verwöhnst ihn!« Lächelnd folgte Marjory ihrer Mutter in die Küche, in der es warm und gemütlich nach Kuchen duftete.
»Ich habe auch noch ein paar Scones und ein paar kleine Schokoladenplätzchen für die Kinder.«
»Sie kommen schnurstracks angerannt, wenn sie die Dose sehen. Danke, Mum.« Sie drückte ihrer Mutter einen Kuß auf die runde, weiche Wange.
Janet strahlte. »Du weißt doch, daß es mir Freude macht. Ich bin ja vielleicht nicht so klug wie du und dein Vater, aber ich kann doch behaupten, nicht die schlechtesten Scones zu backen.«
Marjory lachte. »Die besten. Ich hatte nie den Mut, in Konkurrenz zu dir zu treten, deshalb bin ich auch zur Polizei gegangen.«
Janet senkte die Stimme. »Es war schön, daß dein Dad heute so angeregt war, nicht wahr? Ihm fehlt die Polizei immer noch, weißt du, obwohl es im nächsten Sommer schon zehn Jahre her ist. Und er kann sich immer noch an alle Geschichten erinnern. Diese Masons – es gab eine Zeit, als ...«
Da Marjory eine der langwierigen Erinnerungen ihrer Mutter auf sich zukommen sah, sagte sie hastig: »Ich muß jetzt wirklich los. Cammie hat heute abend Rugbytraining ...
»Ja, natürlich, natürlich.« Aber als sie die Haustür erreicht hatten, fuhr Janet fort: »Was dein Vater allerdings nicht erwähnt hat, ist, daß die Männer in der Familie nicht nur aufbrausend sind, sondern auch besonders gut aussehen. Als Jake Mason ein junger Mann war ...« Sie kicherte mädchenhaft, und Marjory bekam einen flüchtigen Eindruck von der hübschen, koketten jungen Frau, die immer noch unter den Falten und der Dauerwelle steckte. »Von uns Frauen hat sich nie eine gewundert, warum Rosamond Mason ihn geheiratet hat. Und ich muß dir gestehen, wenn ich jünger gewesen wäre, hätte ich auch ein Auge auf ihn geworfen. Aber erzähl das bloß nicht deinem Vater!«
Als Laura ihre therapeutische Aufgabe beendet hatte, war das Feuer ausgegangen und draußen war es dunkel geworden. Sie reckte sich, ein wenig benommen von der stundenlangen anstrengenden Konzentration, schob die Blätter zusammen und las noch einmal, was sie geschrieben hatte. Es war gut: professionell, aber auch persönlich, genau auf den Punkt. Schade, daß Dizzy es nie zu sehen bekommen würde.
Nachdenklich hielt sie inne. In den Staaten hatte sie gelegentlich Zeitungsartikel geschrieben, warum sollte sie das hier nicht im Laptop in Form bringen und einer Londoner Zeitung anbieten? Es würde zumindest andere Familien mit ähnlichen Problemen interessieren, und vielleicht würde ja sogar jemand dazu gebracht, zum Hörer zu greifen ... Und es bestand immerhin die winzige Chance, daß dieser Jemand Dizzy wäre.
Plötzlich fühlte sie sich völlig erschöpft. Mühsam erhob sie sich. Morgen; darüber würde sie sich morgen den Kopf zerbrechen. Jetzt würde sie sich erst einmal ein Sandwich machen und sich mit einem Glas Wein in ihr Schlafzimmer zurückziehen, wo sie das unablässige Ticktack der Standuhr, das wieder so laut durch das stille Haus hallte, nicht mehr hörte.
Kapitel 3
Als das Telefon zum fünften mal innerhalb von zwei Stunden klingelte, wäre Laura beinahe nicht drangegangen. Ihre Fähigkeit, Einladungen freundlich und mit offensichtlichem Bedauern abzulehnen, wich langsam einer tiefen Erschöpfung.
Glücklicherweise hatte man sie am Tag nach der Beerdigung respektvoll in Ruhe gelassen. So hatte sie Zeit gehabt, ihren Artikel zu schreiben und ihn an die Sunday Tribune zu schicken. Was hatte sie schließlich schon zu verlieren?
Nachdem sie ihn zur Post gebracht hatte, hatte sie einen langen, schönen Spaziergang durch den Park des hiesigen Schlosses gemacht. Unter den Weiden lagen noch Flecken von nassem Schnee, und durch die kahlen Äste sah man die blaßgelben Steine des georgianischen Hauses schimmern. Zwar hatte nicht gerade die Sonne geschienen, aber die Wolken hatten einen hellen Rand, und irgendwo im Gebüsch zwitscherte ein Vogel in Erwartung des Frühlings.
Es fühlte sich an, dachte Laura verträumt, wie ein Strahl reinen, kalten Frühlingswassers nach dem schalen, chlorhaltigen Zeug, an das sie sich in den letzten Jahren gewöhnt hatte. Danach fühlte sie sich so erfrischt, daß sie sich der Aufgabe stellen konnte, mit der Wohnungsauflösung weiterzumachen. Sie hatte Angst davor, obwohl sie wußte, daß ihre Mutter ihre Angelegenheiten gut organisiert abgelegt und geordnet hatte.
Nur die Briefe ihrer Töchter nicht. Als Laura eine der Schreibtischschubladen aufzog, stockte ihr der Atem beim Anblick von Dizzys schwungvoller Handschrift mit den nachlässigen T-Strichen und den Kreisen statt der I-Punkte. Die Briefe trugen jedoch alle ausländische Briefmarken und stammten aus der Zeit vor Dizzys Verschwinden. Sie holte einen Brief aus dem Umschlag, steckte ihn dann jedoch ungelesen wieder hinein. Sie wollte nicht wieder dem Zauber ihrer Schwester erliegen. Es tat einfach zu weh. Ihre Mutter hatte ihr damals diese atemlosen, grammatikalisch sorglosen Ergüsse zu lesen gegeben, und sie konnten ihr jetzt nichts Neues mehr erzählen. Außerdem waren sie schon ganz zerschlissen vom ständigen Lesen; anscheinend hatte ihre Mutter immer wieder nach Hinweisen darin gesucht. Laura seufzte. Wahrscheinlich sollte sie die Briefe auch den Anwälten geben.
Ihre eigenen Briefe mit den amerikanischen Briefmarken stopfte sie ohne viel Federlesens in einen schwarzen Plastikmüllsack. Sie hatte auch keine Lust, sich mit der jungen Laura auseinanderzusetzen, die vor Begeisterung über ihren Mann, ihr neues Land und ihr neues Leben übersprudelte. Alles zerbrochene Träume.
Trübsinnig stieg sie die Treppe zum Schlafzimmer ihrer Mutter hinauf. Dieser Teil fiel ihr am schwersten: das Parfüm, das ihre Mutter immer benutzt hatte, Estée Lauders White Linen, hing noch in der Luft, und Laura hatte einen Kloß im Hals. Sie gab jedoch den Tränen nicht nach und machte sich entschlossen ans Aufräumen und Zusammenlegen. Fremde sollten die Sachen ihrer Mutter nicht durchwühlen.
Bei den Kleidern zögerte sie – es waren teure Kleidungsstücke, teilweise noch ganz neu – und fragte sich, ob ihre Mutter wohl gewollt hätte, daß sie sie an ihre Freundinnen verschenkte. Aber das würde einen ganzen Rattenschwanz von »wer bekommt was« nach sich ziehen, also verpackte sie besser alles in Tüten. Jeder Wohltätigkeitsbasar würde sich darüber freuen.
Schmuck – den konnte sie auch bei den Anwälten deponieren. Möbel. Sie betrachtete die geschwungene Regency-Kommode, den hübschen venezianischen Spiegel. Das Haus war voller wunderschöner Dinge, die ihre Eltern im Lauf der Jahre gesammelt hatten, aber sie hatte ja beschlossen, es zu verkaufen, und durch diese Entscheidung hatte sie sich äußerst effizient heimatlos gemacht. Sie würde die Möbel nirgendwo unterstellen können, solange sie keine neue Wohnung hatte, und bis jetzt hatte sie keine Ahnung, wo das sein sollte – auf dem Land wahrscheinlich, allerdings bestimmt nicht hier, wo sie überall von Erinnerungen verfolgt wurde. Das Problem war nur, daß sie ohne Wurzeln oder Verpflichtungen gar nicht wußte, wo sie überhaupt suchen sollte.
Als sie fertig war, war sie todmüde, und es war auch schon spät, aber zumindest lagen die schmerzlichsten Aufgaben jetzt hinter ihr, und sie konnte wieder nach vorne schauen. Kurz vor dem Einschlafen überlegte sie noch, daß sie sich vielleicht für eine Weile eine Wohnung in London mieten und alte Freundschaften neu beleben würde, während sie in Ruhe ihre nächsten Schritte bedachte.
Während des Mittagessens am nächsten Tag hatte der Plan Formen angenommen und war zu einer zwingenden Notwendigkeit geworden. Vier Freundinnen ihrer Mutter hatten sie besucht, wobei drei seelischen Beistand anboten und die vierte, die langnasige Mrs. Martin, ihr »helfen« wollte, die Garderobe ihrer Mutter aufzulösen („Ich weiß, wie traurig so etwas für die Familie sein kann, meine Liebe” ). Sie konnte kaum ihre Enttäuschung verbergen, als Laura ihr erklärte, das habe sie bereits erledigt.
Den ganzen Tag über klingelte das Telefon, und es waren nicht nur die Anwälte und Steuerberater, die Informationen brauchten, sondern auch Einladungen. Als Laura zu Bett ging, war sie sogar noch erschöpfter als am Tag zuvor, und auf der Liste, die sie auf ihren Nachttisch gelegt hatte, stand ganz oben »Wohnung suchen«.
Dieser Morgen hatte genauso angefangen (»Laura, meine Liebe, ich möchte dich am Sonntag zum Mittagessen einladen. Mein Enkel kommt zufällig aus London vorbei – er ist so ein netter Junge, und er macht sich so gut bei KPMG. Ihr habt sicher viel gemeinsam, und ein Nein lasse ich nicht gelten ...«). Nach dem vierten Anruf litt Laura unter Verfolgungswahn.