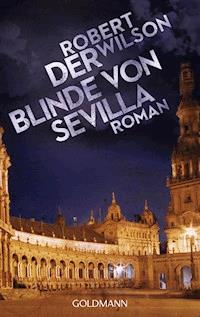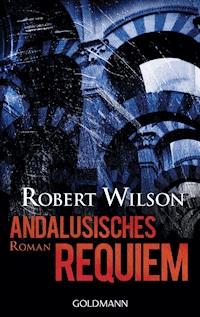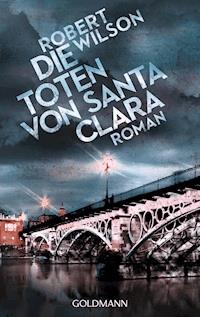9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Charles Boxer
- Sprache: Deutsch
Iago Melo ist kein Mann, dem man sich widersetzt. Der brasilianische Multimillionär weiß, was er will und wie er es bekommt. Ohne jeden Skrupel. Als seine Tochter Sabrina entführt wird, engagiert er zwar einen Unterhändler, spielt aber sein eigenes gefährliches Spiel. Denn ein Iago Melo darf keine Schwäche zeigen. Zum Glück hat er dabei die Rechnung ohne Charles Boxer gemacht, den angeheuerten Spezialisten aus Europa. Der tut alles, um Sabrina freizubekommen. Was er nicht ahnt, ist, dass er sich dabei tief in ein dicht gesponnenes Netz aus Politik und Rache verstrickt. Und dass am Ende auch seine eigene schmerzliche Geschichte eine wichtige Rolle spielen wird ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 643
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Iago Melo ist kein Mann, dem man sich widersetzt. Der brasilianische Politiker und Multimillionär weiß, was er will und wie er es bekommt. Dabei geht er ohne jeden Skrupel vor. Als trotz aller Vorsichtsmaßnahmen seine Tochter Sabrina entführt wird, engagiert er zwar der Form halber einen Unterhändler, spielt aber sein eigenes Spiel, auch wenn er damit Sabrinas Leben riskiert. Denn ein Iago Melo darf keine Schwäche zeigen.
Zum Glück hat er dabei die Rechnung ohne Charles Boxer gemacht, den angeheuerten Verhandlungsspezialisten aus Europa. Der tut alles, um Sabrina freizubekommen – auch gegen den Willen seines Auftraggebers. Was er nicht ahnt, ist, dass er sich dabei tief in ein dicht gesponnenes Netz aus Politik und Rache verstrickt. Und dass am Ende auch seine eigene schmerzliche Geschichte eine wichtige Rolle spielen wird …
Weitere Informationen zu Robert Wilson sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
Robert Wilson
WER LÜGEN SÄT
THRILLER
DEUTSCH VON KRISTIAN LUTZE
KAPITEL EINS
24. April 2014, 13.25 Uhr
Auf der Straße von der Universität São Paulo nach Jardim Rizzo, Brasilien
Sabrina Melo war auf ihrer Vespa im Sonnenschein zwischen zwei Schauern auf dem Heimweg zu ihrem Apartment in Jardim Rizzo und genoss die neue Freiheit von der sicherheitsfixierten Welt ihres reichen Vaters. Von dem Motorroller wusste er nichts. Sonst hätte es Riesenärger gegeben.
Fröhlich fuhr sie Schlangenlinien unter den tropfenden Bäumen, die die Straße zu ihrem neuen Zuhause säumten. Sie hatte sich immer eine Vespa gewünscht, seit sie als kleines Mädchen mit ihrer Mutter den Film Ein Herz und eine Krone gesehen hatte, in dem Audrey Hepburn und Gregory Peck auf einem solchen Motorroller Fußgänger erschreckten und auf der Flucht vor Polizisten durch Straßenmärkte und Cafés und vorbei an der Spanischen Treppe sausten.
Wegen des Regens musste sie auf einen Teil von Hepburns modischen Freiheiten verzichten und ein durchsichtiges Plastikcape sowie einen himmelblauen Helm tragen. Deshalb bemerkte sie auch den Chevrolet Corsa Sedan nicht, der ihr langsam folgte.
Plötzlich rannte vor ihr ein Mädchen, das sie aus ihrem Philosophieseminar kannte, zwischen den Bäumen auf die Straße, winkte und gestikulierte. Sabrina bremste, und das Hinterrad rutschte leicht weg. Sie stellte einen Fuß auf den Boden.
»Was ist los, Larissa?«, fragte sie.
»Meine Freundin Marta«, sagte Larissa, vergrub das Gesicht in den Händen und zeigte ins Gebüsch. »Sie haben sie da reingezerrt. Sie verprügeln sie. Ich glaube, sie wollen sie vergewaltigen. Sie haben mir die Handtasche weggenommen. Kannst du die Polizei anrufen?«
Sabrinas erster Gedanke war, dass Larissa keine gute Schauspielerin war.
Ihr zweiter Gedanke: Wenn sie ihre Freundin und ihre Handtasche hatten, warum hatten sie dann nicht auch Larissa ins Gebüsch gezerrt?
Für einen dritten Gedanken blieb ihr keine Zeit mehr, weil zwei Männer aus dem Wagen gestiegen waren und sie von hinten packten. Larissa riss die Vespa unter ihr weg. Der Wagen rollte an ihnen vorbei, und der Kofferraum klappte auf. Einer der Männer drückte Sabrinas Arme an ihren Körper, zog ihr die Beine weg und warf sie so hart in den Kofferraum, dass ihr die Luft wegblieb. Sie zogen ihr das Cape aus, zerrten die Umhängetasche von ihrer Schulter, fesselten ihr die Hände mit Handschellen hinter dem Rücken und die Knöchel an eine Seite des Kofferraums. Dann zogen sie ihr den Helm vom Kopf, verschlossen ihren Mund mit Klebeband, drückten den Helm wieder auf ihren Kopf und klappten das Visier zu. Sie sah nur weiße, gefletschte Zähne in einem verzerrten Gesicht, kräftige Schultern und dahinter den weiten blauen Himmel, bis sich die Klappe des Kofferraums dazwischenschob und sie in stickiger Dunkelheit zurückließ.
Der Wagen fuhr an, wendete mit blockierenden Reifen und raste zurück Richtung Hauptstraße.
Der Adrenalinschub, der in Sabrinas Adern pulsierte, ließ ihre Arme kalt werden. Die Innenseite ihrer Schenkel brannte, weil sie sich vor Angst in die Hose gemacht hatte. Man hatte sie so gefesselt, dass sie nicht einmal gegen die Kofferraumklappe schlagen oder treten konnte. In der Hitze und unter dem Helm mit heruntergeklapptem Visier wurde der Sauerstoff knapp, und sie musste sich mit aller Kraft zusammenreißen, um nicht zu hyperventilieren. Mit geschlossenen Augen konzentrierte sie sich auf ihre Atmung.
Von den unvorhersehbaren Bewegungen des Wagens, der im dichten Verkehr immer wieder bremste und hin und her schaukelte, wurde ihr schlecht. Schweiß sammelte sich um ihre Augen. Sie blinzelte dagegen an und blickte der Realität ins Auge – sie war entführt worden. Sie sah ihren Vater an seinem Schreibtisch sitzen und von seiner größten Angst erzählen und erinnerte sich an ihre blasierte Antwort: »Am besten taucht man in der Masse unter, papai, und ragt nicht heraus.«
Sie fuhren sehr lange, mehr als vier Stunden, lange genug, um vieles von ihrem Leben in jüngerer Zeit Revue passieren zu lassen. Ihre ersten sechs Wochen an der Universität von São Paulo waren eine Offenbarung gewesen. Sie mischte sich unter Menschen aus aller Welt und genoss es, nur eine in einer Masse junger Studenten zu sein, in der Mensa zu essen und die neuesten angesagten Clubs zu besuchen. Sie wurde nicht mehr jeden Tag von Sicherheitsleuten in einem gepanzerten Mercedes zur Schule gefahren und anschließend wieder in ihr von mit Stacheldraht und Elektrozäunen gekrönten Mauern geschütztes Zuhause gebracht, in dessen Garten bewaffnete Wachleute patrouillierten, sodass es jedes Mal einer militärischen Prozedur glich, das Haus zu verlassen und wieder zu betreten. Das Reisfleisch mit Bohnen in der Mensa war ihr lieber als die sternewürdigen Mahlzeiten, die der Koch ihres Vaters ihr servierte, und sosehr sie die Typen mochte, die sie beschützten, war es doch eine Erleichterung, ohne bewaffnete Aufpasser auszugehen.
Sie hatte versucht, vernünftig mit ihrem Vater zu reden. Sie führten lange Diskussionen über die Verteilung von Reichtum, Korruption und die Gewalt, die jenseits der von Kameras überwachten und verstärkten Mauern in einer krass ungerechten Welt zwangsläufig immer wieder ausbrach.
Bisweilen hatten sie erbittert gestritten und sich gegenseitig angeschrien, bis Türen geknallt wurden und Sabrina weinend auf ihrem Bett lag, während ihr Vater vor der Tür stand und flehte: »Ich liebe dich, querida. Bitte verzeih mir.« Am Ende hatte sie aufgegeben. Es war ihnen offenbar bestimmt, sich auf immer zu streiten.
Was sie indes nicht aufgegeben hatte, war der Kampf für ihre eigenen Rechte. Sie würde nicht unter der Obhut von bewaffneten Leibwächtern zur Universität gehen. Keine Helikopterflüge zu Seminaren. Kein Handlanger vor dem Vorlesungssaal. Sie wollte ein normales Studentenleben oder zumindest so normal, wie man es als Tochter eines Senators und eines der führenden Bankiers Brasiliens führen konnte.
Es hatte Kompromisse gegeben. Er wollte, dass sie in einer eleganten Wohngegend gegenüber der Universität mit Blick auf den Parque Villa-Lobos wohnte. Sie hatte sich geweigert, und sie hatten sich auf ein Apartment im zehnten Stock eines Wohnblocks in einer Mittelklassegegend im Süden der Universität geeinigt, mit bewaffneten Sicherheitsmännern in der Lobby, aber nicht auf jeder Etage. Sie hatte zugelassen, dass er eine Alarmanlage und eine Stahltür mit Holzfurnier und Sicherheitsschloss einbauen ließ, bei einem Panikraum jedoch die Grenze gezogen.
Der Wagen holperte von dem Asphalt auf eine Schotterstraße, die sie in die Realität zurückriss. Das beruhigende gleichmäßige Dröhnen wich dem Geprassel aufgewirbelter Steinchen und dem Holpern durch Pfützen und Löcher, bis der Wagen bockte wie ein Rind beim Rodeo, weil der Weg sich endgültig verlor. Wahrscheinlich brachte man sie in eine Favela am Stadtrand.
Der Wagen hielt. Türen wurden zugeschlagen. Durch den verschwitzten Schaumstoff des Helms drangen undeutlich Männerstimmen an ihr Ohr. Der Kofferraum wurde aufgeklappt. Sie sah nichts. Der Himmel war dunkel. Es war Abend. Die Männer hatten Taschenlampen.
»Halt die Augen geschlossen.«
Sie kniff sie fest zu, gehorsam wie ein Kind. Sie rissen ihr den Helm vom Kopf und setzten ihr eine Brille auf. Sie öffnete die Augen, doch die Gläser waren verklebt. Die Fesseln an ihren Füßen wurden gelöst, und sie wurde in ein Laken gewickelt und aus dem Kofferraum gehoben. Drei Männer trugen sie waagrecht zwischen sich. Sie hatten es nicht eilig. Eine Stimme vor ihnen rief, dass die Leute zurück in ihre Häuser gehen sollten. Sie spürte, dass sie sich in einem engen Durchgang befanden. Der Abwassergestank war so durchdringend, dass sie ihn trotz des Lakens um ihren Kopf riechen konnte.
Die Männer blieben kurz stehen, zwängten sich durch eine enge Öffnung und trugen sie eine Treppe hinunter. Eine quietschende Metalltür wurde geöffnet. Sabrina wurde auf eine Matratze geworfen, und das Laken, in das sie gewickelt war, wurde weggerissen.
»Sie hat sich vollgepisst.«
»Zieh ihr den Slip aus. Den schicken wir ihrem papai. Damit er weiß, dass wir sie haben.«
Hände griffen nach ihr. Wimmernd vor Angst strampelte sie mit den Beinen, sodass ihr Rock bis zur Hüfte hochrutschte. Mit dem rechten Fuß erwischte sie einen der Männer mit voller Wucht. Er stöhnte, und danach behandelten sie sie noch gröber. Sie packten ihre Füße und verdrehten die Knöchel, bis sie schrie, während einer ihren Slip über ihre langen Beine streifte. Als sie sie losließen, drehte sie sich auf den Bauch, und einer der Männer gab ihr einen heftigen Klaps auf den nackten Hintern. Sie jaulte trotz des Klebebands über ihrem Mund auf. Die Demütigung ließ ihr Tränen in die Augen schießen.
»Kein Mucks mehr, kapiert?«
Sie wurde allein gelassen in dem Gestank von ranzigem Palmöl und dem stechenden Geruch ihrer eigenen Angst. Die Männer zogen sich in einen Raum über ihrem zurück, wo ein Mann hustete. Sie sprachen ein paar Minuten miteinander und gingen wieder. Ein Fernseher wurde eingeschaltet, und laute Stimmen erhoben sich, eine Telenovela. In der Ferne bellte ein Hund. Eine Frau schrie und verstummte abrupt.
Der hustende Mann redete, gab Anweisungen. Flip-Flops klatschten auf den Boden und kamen nach unten in ihren Raum. Es waren zwei Männer, dem Akzent nach zu urteilen aus dem Norden.
»Scheiße, hast du den Handabdruck auf ihrem Arsch gesehen?«, fragte der eine lachend, als er ihre Plastikhandschellen durchschnitt. »Davon könnte man einen Fingerabdruck nehmen.«
Sabrina zog ihren Rock über die Schenkel.
»Nimm die Brille ab. Lass dich ansehen.«
Sie blickte auf zu zwei mageren Jungen in Shorts: Einer war ein Mischling mit einem hervorstehenden Bauchnabel, der andere hatte hellere Haut; eine seiner Brustwarzen war unter dem Narbengewebe einer üblen Verbrennung verschwunden. Sie trugen Sturmhauben, sodass man nur den Mund und die Augen sehen konnte. Sie waren jung, etwa in ihrem Alter. Bauchnabel-Boy murmelte vor sich hin. Brandnarben-Boy hatte eine Pistole, mit der er offensichtlich gern herumfuchtelte. Er beugte sich vor und riss das Klebeband von ihrem Mund.
»Sie ist hübsch«, sagte Bauchnabel-Boy, schob eine Hand in seine Shorts, packte seinen Schwanz, trat von einem Fuß auf den anderen und wippte im Rhythmus mit dem Kopf.
Brandnarben-Boy kniete sich auf die Matratze, fasste ihr Kinn und drehte ihren Kopf von links nach rechts. »Hübsche Ohren auch«, sagte er, drückte ihre Lippen zu einem Schmollmund zusammen und küsste sie.
Sie zuckte zurück und spuckte, sah ihm in die Augen und wünschte, sie hätte es nicht getan. Es war niemand zu Hause. Schwarze Pupillen unter schweren Augenlidern starrten zurück. Drogenbenebelt.
»Du wirst schon noch lernen«, sagte er und strich mit dem Lauf der Pistole über ihre Lippen, »nett zu sein.« Er schob den Lauf in ihren Mund, wo er gegen ihre Zähne stieß. Er drückte fester, bis sie den Mund weiter öffnete, und spannte die Waffe. »Wenn du mich nicht nett küsst, dann küsst du die Pistole, und die hat eine sehr harte Zunge. Hörst du, was ich sage?«
Blinzelnd signalisierte sie ihre Zustimmung. Er zog den Lauf langsam wieder heraus, zielte auf die Matratze und drückte ab. Sie zuckte zusammen, sank zur Seite, benommen von dem Knall. Bauchnabel-Boy hüpfte hysterisch lachend von einem Fuß auf den anderen, steckte die Finger erst ins rechte, dann ins linke Ohr und erklärte seinem Kumpel, er sei ein Motherfucker.
Sabrina betrachtete die beiden und verspürte eine stechende Furcht. Wilde Jungs, aufgeputscht mit Gott weiß was. Ihr Kinn zitterte. Ihr Hals bebte. Sie biss die Zähne zusammen.
Brandnarben-Boy streckte die Hand aus. Bauchnabel-Boy legte ein Messer hinein.
»Und welches ist dein Lieblingsohr?«, fragte er.
»Darüber habe ich noch nie nachgedacht«, erwiderte Sabrina. Die Antwort kam über ihre Lippen, bevor sie in ihrem noch immer von dem Schuss dröhnenden Kopf das Grauen begriff, das hinter der Frage lauerte.
»Denk schon mal drüber nach«, sagte er und hielt das Messer hoch. »Eins wirst du auf jeden Fall verlieren … vielleicht auch zwei, wenn dein papai nicht mit dem Geld rüberkommt. Also würde ich vorschlagen, dass du dein weniger liebstes Ohr als Erstes opferst.«
»Ich habe kein weniger liebstes Ohr«, sagte Sabrina.
»Nicht?«, fragte Bauchnabel-Boy erstaunt, und sein Kopf wippte nach vorn. »Die Letzte, die wir hatten, wusste es sofort, als hätte sie jahrelang darüber nachgedacht.«
»Vielleicht war eins ihrer Ohren offensichtlich hässlicher«, erwiderte Sabrina.
»Stimmt«, sagte Bauchnabel-Boy und kratzte sich das Gesicht unter seiner Sturmhaube. »Die war wie eine Hündin, die an einer Mango lutscht.«
»Möchtest du meine Meinung hören, a minha gatinha?«, fragte Brandnarben-Boy.
»Warum sollte ich deine Meinung hören wollen?«
»Wir sind die Chirurgen. Wenn du nett bist, schneiden wir dein rechtes Ohr ab. Wenn nicht, schneiden wir sie beide ab … jetzt sofort … auch wenn wir das zweite nicht brauchen.«
»Also gut«, erwiderte Sabrina. »Sag es mir.«
Er kniete sich wieder hin, packte ihr Kinn und betrachtete ihre Ohren eingehend wie ein Künstler für ein Porträt. Er strich über die Ohrläppchen mit dem kleinen goldenen Stecker. Mit rauen Fingern drückte er erneut ihre Lippen zusammen, setzte an, sie zu küssen, leckte jedoch stattdessen ihr Gesicht ab. Diesmal zuckte sie nicht zusammen.
»Es ist knapp, aber das rechte ist hübscher«, sagte er. »Ich nehme das linke zuerst, okay?«
»Ihr habt doch noch gar kein Geld von meinem Vater gefordert«, wandte Sabrina ein.
»Hey, sieh mal, er muss begreifen, dass wir es ernst meinen«, sagte Bauchnabel-Boy und kratzte sich am Hals. »Wenn er denkt, wir spielen nur Spielchen …«
»Die Typen mit dem Geld denken, sie hätten alle Macht, weißt du. Das ist nur eine klitzekleine Lektion«, sagte Brandnarben-Boy. »Wir auf den Straßen sehen die Dreckskerle in ihren Helikoptern, und wir springen und springen und springen …«
Und er sprang, als wollte er einen kleinen Vogel oder Schmetterling fangen. Bauchnabel-Boy fing wieder an, wie irre zu kichern.
»Und dann springen wir ein Stückchen höher«, sagte er, ließ seine geschlossene Hand sinken und spähte hinein, bevor er beide Arme ausbreitete, »und erwischen dich.«
Es klopfte an der Decke. Der Huster befahl sie zu sich. Brandnarben-Boy nahm ein Stück Plastikschnur und fesselte Sabrinas Handgelenke.
»Wir kommen mit einer Videokamera zurück, also sieh zu, dass du hübsch für uns bist, okay?«, sagte er und schob ihr mit den Zehen einen Plastikeimer hin. »Den kannst du benutzen, wenn du mal pissen oder kacken musst.«
Sie gingen.
Sabrina ließ sich gegen die Wand sinken und ertastete das Loch, das die Kugel in die Matratze geschlagen hatte. Sie bohrte den Finger hinein, zog das verbeulte Metallstück heraus und drückte es so fest, dass es einen Abdruck auf ihrer Handfläche hinterließ. Der Schmerz hielt die Tränen in Schach und beruhigte ihre brodelnden Eingeweide. Sie ließ den Blick durch den fensterlosen Raum schweifen, vier Wände aus unverputztem Backstein, der Mörtel in den Fugen dick wie Mayonnaise auf einem überladenen Sandwich. Von der Decke aus Betonstreben und weiterem roten Backstein baumelte eine einzelne nackte Glühbirne. Von einer Steckdose führte ein Kabel unter einer aus Metallresten zusammengenieteten Tür hindurch nach draußen, die in New York Ausstellungsstück in einer Galerie hätte sein können. Sabrina stand auf und stellte überrascht fest, dass sie nicht abgeschlossen war, stieß sie mit einem Fuß auf und blickte die steilen Treppen hinauf, eine zu der Tür zur Straße, die andere zu dem Raum über ihr. Diesen Typen war alles egal. Jeder Fluchtversuch war sowieso aussichtslos. Diese Kerle waren die Bosse der Favela, und die Angst der Bewohner roch stechender als die Abwässer, die über die Straßen flossen.
KAPITEL ZWEI
24. April 2014, 20.00 Uhr
Favela, São Paulo, Brasilien
Weißt du noch, was wir gesagt hatten, welches Ohr wir abschneiden wollten?«, fragte Brandnarben-Boy, sein Gesicht vor Sabrinas, die tränen- und schweißüberströmt den Kopf schüttelte. Schnodder strömte aus beiden Nasenlöchern, und ihre Brust bebte unter Schluchzern.
»Nicht, bitte nicht.«
Sie waren zurück – Brandnarben-Boy mit seinem Horrorgerede und sein Freund, der, offenbar zu irgendetwas wild entschlossen, murmelnd von einem Fuß auf den anderen tretend mit seiner Kamera hinter seinem Freund stand.
»Links oder rechts«, sagte Brandnarben-Boy und schnippte gegen ihre Ohren, »rechts oder links?«
Sabrina kniff die Augen zu und presste die Tränen heraus. »ICHWILLSIEBEIDEBEHALTEN«, platzte sie unkontrolliert los.
»Calma, minha gatinha, calma«, sagte Brandnarben-Boy und ging in die Hocke. »Jetzt weißt du, wo du bist.«
»Wo denn?«, fragte sie verwirrt und zitternd.
»Nicht in deiner perfekten Welt«, sagte Brandnarben-Boy und schnippte noch einmal hart gegen ihr Ohr. »In unserer Welt.«
»Also, ich bin ganz auf eurer Seite«, versuchte sie ihn von Mensch zu Mensch zu erreichen. »Es ist schrecklich, dass Millionen Menschen in Armut leben, während ein paar Tausend mehr haben, als sie für fünfzig Leben brauchen würden.«
»Lindo maravilhoso! Zu wissen, dass du in deinem schicken Haus hinter den hohen Mauern und elektrischen Zäunen für uns weinst, während wir in der Favela bis zum Hals in der Scheiße sitzen, macht mich so glücklich.«
»Ich habe nicht darum gebeten, reich zu sein.«
»Willst du arm sein wie wir? Willst du so leben? Wir sind ursprünglich aus dem Norden, und da haben sie gesagt, dass sie investieren und Jobs für uns schaffen wollen. Aber das Geld ist nie angekommen. Das Geld wandert immer zurück in die Taschen der Typen, die wissen, wo es herkommt. Das Geld sieht den Norden nicht einmal. Deshalb sind wir hierhergekommen, um Geld zu finden. Um es uns zu nehmen, das ist alles. Wir machen bloß das, was ihr auch macht.«
»Was ich mache?«
Sein Gesicht kratzend und unablässig vor sich hin murmelnd, versuchte Bauchnabel-Boy, die Kamera auf ein Stativ zu montieren. Brandnarben-Boy stieß ihn beiseite. Er war flink und clever. Er drehte den Sucher in ihre Richtung.
»Sag was Interessantes«, forderte er sie auf. »Ich will sehen, ob das Ding funktioniert.«
»Es gibt überall Korruption, nicht nur im Norden. Ich meine, man muss sich nur die Weltmeisterschaft ansehen. Ich kann nicht glauben, was für Unsummen für ein paar Fußballspiele verschwendet werden …«
»Nein, nein, gostosa, du sollst uns nicht zu Tode langweilen«, sagte Brandnarben-Boy. »Wir mögen Fußball. Wenn du so weiterredest, lass ich dich von meinem Freund hier ficken, dann hat dein papai eine nette Wichsvorlage. Das ist eine Entführung. Du musst Angst haben.«
Brandnarben-Boy hob die Waffe, richtete sie auf Sabrina und spannte sie. Bauchnabel-Boy hielt sich die Ohren zu und bleckte die Zähne. Schockiert von der Obszönität der letzten Bemerkung starrte Sabrina zitternd und mit Tränen in den Augen auf den Lauf der Pistole.
»Und jetzt sag was Interessantes.«
»Mir … mir fällt nichts Interessantes ein.«
Brandnarben-Boy schwenkte die Waffe und drückte ab. Die Kugel schlug neben Sabrinas Kopf in die Wand ein. Roter Backsteinstaub rieselte auf ihre feuchte Wange.
»Es tut mir leid, papai. Es tut mir so leid. Ich hätte auf dich hören sollen. Diese Typen werden mich umbringen. Sie sind verrückt. Gib ihnen, was immer sie verlangen. Gib es ihnen, oder sie werden mich umbringen.«
»Okay, schon besser, aber weißt du, ich glaube dir immer noch nicht. Es fühlt sich an, als würdest du schauspielern. Du denkst, wenn du das Richtige für mich sagst, kommst du hier raus. Was ich sehen will, ist echte Angst.«
Es klopfte von oben. Der Mann hustete. Dann klopfte es noch einmal. Bauchnabel-Boy ging zur Tür. Brandnarben-Boy befahl ihm zu bleiben, als wäre er ein Hund. Er drohte Sabrina mit dem Finger, machte eine wegwerfende Handbewegung und ging.
Nervös beäugte Sabrina Bauchnabel-Boy, vor dem sie mehr Angst hatte als vor dem anderen, weil er offensichtlich der Durchgeknalltere der beiden war. Er betrachtete sie, kratzte sich unter der Sturmhaube im Gesicht, murmelte vor sich hin und massierte die Vorderseite seiner ausgebeulten Shorts. Sie schluckte schwer.
»Willst du sehen?«, fragte er.
Sie schüttelte nur den Kopf, weil ihre Stimme versagte. Ihre Hände waren immer noch hinter dem Rücken gefesselt, sie trug keinen Slip, und ihr Rock war zu kurz. Sie setzte sich auf ihre Fersen und presste die Knie zusammen. Das Dröhnen in ihren Ohren klang wie der gruselige Soundtrack zu einem Horrorfilm. Er zog seinen Penis heraus. Er war riesig und angeschwollen. Er starrte lüstern aus seiner Sturmhaube, und seine Pupillen blitzten entzückt. Er war offensichtlich stolz auf seine Männlichkeit, die er in ihre Richtung schwenkte. Sie versuchte, eine ausdruckslose Miene aufzusetzen, um ihn weder zu erregen noch zu verärgern. Als er murmelnd einen Schritt auf sie zu machte, wandte sie den Blick ab, starrte ins Nichts und betete stumm. Sie schloss die Augen. Etwas Heißes presste gegen ihre Wange und ihre Lippen, drückte sie auseinander so wie Brandnarben-Boy zuvor mit dem Lauf der Waffe.
Die Flip-Flops kamen wieder die Treppe herunter. Bauchnabel-Boy machte zwei Schritte zurück und zog seine Shorts hoch. Brandnarben-Boy trat ein, sah die Erleichterung in ihrem Gesicht, ging zur Kamera, spulte die Aufnahme zurück und betrachtete die Eskapaden seines Kollegen. Dann herrschte er Bauchnabel-Boy laut an, der plötzlich wie ein schüchterner kleiner Junge wirkte. Brandnarben-Boy richtete die Pistole auf ihn, ließ ihn in einer Ecke niederkauern und drückte den Lauf der Waffe gegen seinen Kopf. Bauchnabel-Boy flehte wimmernd. Brandnarben-Boy ließ die Pistole unvermittelt sinken und schlug ihm mit dem Knauf zweimal auf den Kopf.
Mit heruntergeklapptem Kiefer beobachtete Sabrina die Szene. Es war ihr unbegreiflich, wie diese Leute miteinander auskamen. Brandnarben-Boy zog sie von der Matratze hoch, fasste ihr Kinn, wischte ihre Tränen mit dem Daumen ab und verschmierte dabei den Backsteinstaub. Verwirrt von seiner unerwarteten Zärtlichkeit blickte sie zur Decke und atmete tief durch.
»Ich brauche Wasser«, appellierte sie instinktiv an seine Hilfsbereitschaft.
Brandnarben-Boy gab eine Anweisung. Das Gesicht blutverschmiert von einer Platzwunde an der Stirn erhob sich Bauchnabel-Boy in seiner Ecke wie eine überdimensionierte Kakerlake und schlich hinaus.
»Er ist nicht ganz richtig da oben«, sagte Brandnarben-Boy und tippte sich an den Kopf.
»Was murmelt er die ganze Zeit?«
»Kill Whitey all night long«, sagte Brandnarben-Boy. »Er weiß nicht, was es bedeutet, er hat es bloß irgendwo aufgeschnappt.«
»Was ist mit ihm passiert?«
»Sein Vater hat zu viel getrunken und ihm wie blöde auf den Kopf geschlagen. Seine Mutter war krank und ist gestorben, oder ihr Mann hat sie umgebracht, ich weiß nicht. Dann wurde sein Vater in einem Streit erschossen. Jetzt nimmt er zu viele Drogen«, sagte Brandnarben-Boy. »Wie wir alle. Wenn du sehen würdest, was wir tun müssen, würdest du das auch machen.«
»Was müsst ihr denn tun?«
»Was man uns verdammt noch mal befiehlt«, erwiderte er wütend, und ihre Blicke trafen sich.
Sie hatte auf ein Zeichen von Menschlichkeit in seinen Pupillen gehofft, an dem sie sich festhalten konnte, aber da war nach wie vor nichts, nur glänzende schwarze Löcher. Sie begriff, dass er um sein Überleben kämpfte und alles tun würde, um sich an die Klippe zu klammern, und das machte ihr noch mehr Angst vor ihm.
Bauchnabel-Boy kam mit einer Flasche Wasser und einer Rolle Küchenpapier zurück. Der hustende Mann drehte die Seifenoper lauter. Brandnarben-Boy löste ihre Fesseln nicht, sondern hielt ihr die Flasche an die Lippen. Sie hatte ihn fragen wollen, wie er so schwer verletzt worden war, aber der Moment war vorbei. Bauchnabel-Boy blickte auf sie herab, als wäre sie für seine Demütigung verantwortlich. Er grinste nicht mehr. Sie wusste nicht, was in seinem Kopf vor sich ging, doch sie hörte, was er murmelte.
Brandnarben-Boy schraubte die Flasche wieder zu und stellte sie auf die Matratze. Er zog Sabrina auf die Knie und ließ sie in die Kamera blicken. Ihr Haar hing in Strähnen um ihr rot verschmiertes Gesicht. Er ging zurück zur Kamera und korrigierte Sabrinas Position.
»Du sollst nicht mich anschauen, sondern in die Kamera blicken. Nur dass es keine Kamera ist. Es ist dein papai. Du wirst ihn aus tiefstem Herzen anflehen, dass er das Geld bezahlen soll, dann kommst du hier raus. Hast du verstanden?«
Sabrina fing an zu weinen. Sie weinte, wie sie noch nie in ihrem Leben geweint hatte. An ihren Tränen war nichts Künstliches. Ihre Gefühle waren noch heftiger und unmittelbarer als die Trauer beim Tod ihrer Mutter. Es war ein kompletter Zusammenbruch, ausgelöst durch eine alles überwältigende Angst. Sie blickte an sich herab, ihre Schultern bebten, während sie versuchte, die Worte über die Lippen zu bringen. Sie kamen als ein schrilles, monotones Jammern heraus.
»Papai, papai, bitte, bitte hilf mir. Es tut mir so leid. Hilf mir einfach … bitte … Ich bin … die werden mich umbringen. Ich hatte noch nie solche Angst. Und ich vermisse dich. Ich liebe dich. Bezahl einfach das Geld. Was immer sie verlangen. Bitte. Es tut mir so leid. Bi-i-i-tte.«
Sie blickte auf und sah durch ihre Tränen verschwommen, dass Brandnarben-Boy Bauchnabel-Boy etwas reichte, bevor jener vortrat, ihren Kopf packte und ihr Gesicht in seinen Schritt drückte, wo der Gestank seiner animalischen Ausdünstungen am intensivsten war. Er zupfte mit Zeigefinger und Daumen an ihrem Ohr, und dann spürte sie eine stechende, federleichte Berührung an der Ohrmuschel und seinen Daumen auf ihrer Wange, während er schnitt und warme Flüssigkeit über ihren Hals strömte.
Er versetzte ihr einen Tritt, verächtlicher als er ein Tier behandeln würde, und sie wurde gegen die Wand geschleudert.
Sie schrie, nicht vor Schmerz, sondern vor Entsetzen darüber, was er getan hatte.
Die Zunge zwischen gelblichen, abgebrochenen Zähnen herausgestreckt, drehte Bauchnabel-Boy sich zu der Kamera um, hielt das abgetrennte Ohr hoch und wackelte damit, als würde er einem Verhungernden einen unerreichbaren Happen vor die Nase halten.
Brandnarben-Boy schaltete die Kamera ab, nahm das Messer und schnitt Sabrinas Handschellen durch. Er riss ein Stück Küchenpapier ab, wickelte das Ohr darin ein und steckte es in die Tasche. Dann packte er die Kamera zusammen, gab sie Bauchnabel-Boy und schickte ihn nach oben.
Sabrina drückte etwas von dem Küchenpapier an die Wunde. Ihr Mund stand offen, doch kein Laut drang heraus. Blut war auf ihr T-Shirt und den Bund ihres Rocks getropft. Sie blickte auf. Brandnarben-Boy stand da und ließ die Waffe an seinem Zeigefinger kreisen wie ein Revolverheld.
»Du musst ihn irgendwie sauer gemacht haben«, meinte er. »Ich hab ihm gesagt, er soll zum Beweis deiner Identität nur das Läppchen mit dem Ohrring abschneiden.«
»Warum habt ihr das getan?«, fragte sie zitternd, schluchzend und würgend. »Ihr hattet doch noch gar kein Geld von meinem Vater verlangt.«
»Ich tue bloß, was man mir befiehlt. Die sagen mir, wenn du das machst, sitzen diese Leute gerade und denken klar«, erklärte Brandnarben-Boy. »Jetzt glaubt dein papai bestimmt nicht mehr, dass wir nur Spaß machen. Wenn das endlose Gerede erst mal losgeht, denkt er vielleicht: ›Klar, wir können auch ewig über diesen Scheiß reden.‹ Jetzt weiß er, dass er handeln muss … ganz bestimmt.«
»Aber wie konntet ihr das tun? Ich verstehe das nicht. Ihr habt mein Ohr abgeschnitten, als wäre ich irgendein … nein, nein, das würdet ihr nicht mal einem Hund antun. Warum auch?«
»Wir sind anders«, sagte Brandnarben-Boy.
KAPITEL DREI
24. April 2014, 17.30 Uhr
Büro der LOST Foundation, Jacob’s Well Mews, London W1
Nach einem heftigen Regenschauer lag die Gasse in Dunkelheit. Boxer stand am Fenster seines Büros, wendete eine alte Betamax-Kassette in den Händen und dachte, dass die Düsternis des späten Nachmittags seiner Stimmung nicht mehr ganz entsprach. Er blickte auf die Straße hinunter, als eine blonde Frau zu ihm hochschaute und das Gebäude der LOST Foundation betrat. Er starrte auf die Privathäuser mit den verriegelten und mit weißen Sicherheitsrollläden geschützten Fenstern auf der anderen Straßenseite und dachte, dass in seinem Leben nach drei Monaten der Trauer irgendetwas passieren musste. Keine andere Frau. Dafür war er noch nicht bereit. Es war eher ein Gefühl, als wäre er zu lange unter Wasser gewesen und müsste nun wieder auftauchen.
Er drehte sich um, als er ein leises Klopfen an der Tür hörte.
»Du hast mir nicht erzählt, dass du einen Termin hast«, sagte Amy.
»Habe ich das?«, fragte Boxer, ging zurück zu seinem Schreibtisch und legte die Kassette in eine Schublade.
»Ich wollte nach einem weiteren spannenden Tag gerade nach Hause gehen.«
»Niemand hält dich auf.«
»Sie sagt, sie hätte dich letzte Woche angerufen und vereinbart, heute ins Büro zu kommen. Ihr Name ist Eiriol Lewis.«
»Eiriol Lewis?«, wiederholte er, und der ungewöhnliche Name half seiner Erinnerung auf die Sprünge. »Tut mir leid, ich habe vergessen, es im Kalender einzutragen.«
»Hast du eine Ahnung, worum es geht?«, fragte Amy. »Vielleicht sollte ich dabei sein.«
»Warum nicht?«, erwiderte er und trat an den Besprechungstisch.
Amy ging wieder hinaus und bat Eiriol Lewis herein, die eine kleine Holzkiste bei sich trug. Das Gesicht und der dürre Körper der Frau wirkten irgendwie zerschlagen. Eine Jeans hing von ihren knochigen Hüften, und unter ihrem Mantel ragten mitleiderregend spitze Schultern hervor, doch gleichzeitig strahlte sie eine gewisse Zähigkeit aus. In ihrem blassen, von schneeweißem krausen Haar gerahmten Gesicht konnte man in ihren hohen Wangenknochen unter großen eisblauen Augen Spuren ehemaliger Schönheit erkennen. Amy führte sie zum Tisch. Eiriol stellte die Kiste auf den Boden und gab Boxer die Hand. Amy goss Wasser in Gläser, legte ihr Notizbuch auf den Tisch und setzte sich.
»Wer ist sie?«, fragte Eiriol Lewis, als sie erkannte, dass Amy sich zu ihnen gesellte.
»Meine Tochter … Amy«, sagte Boxer. »Sie gehört zum Team.«
Amy streckte die Hand aus, die Eiriol ängstlich schüttelte.
»Was macht sie hier?«, fragte Eiriol und faltete ihre knochigen Hände. Manikürte Nägel mit schwarzem Gel-Lack konnten nicht verbergen, dass sie körperliche Arbeit verrichtete.
»Sie hilft mir, Vermisste zu finden«, sagte Boxer. »Wenn wir eine junge Person suchen, müssen wir uns oft in Kneipen, Clubs und Bars umhören, und das macht besser jemand, der in einer solchen Umgebung nicht auffällt.«
»Die Person, die ich suche, ist älter als ich, und ich bin einundvierzig.«
»Wie viel älter?«, fragte Amy und spielte mit ihrem Stift.
»Sie wollen sich doch keine Notizen machen, oder?«
»Nein, sie macht sich keine Notizen«, sagte Boxer. »Wir sind hier, um zuzuhören. Vielleicht schreibt Amy sich zwischendurch etwas auf, um Sie später danach zu fragen, damit Sie in Ihrem Erzählfluss nicht unterbrochen werden, und wie ich Ihnen bereits am Telefon erklärt habe, zeichnen wir die gesamte Unterhaltung auf. Das müssen wir aus juristischen Gründen.«
»Eiriol ist ein ungewöhnlicher Name«, sagte Amy. »Was bedeutet er?«
»Es ist Walisisch für ›verschneit‹«, antwortete sie und berührte ihr krauses weißes Haar. »Nicht besonders originell, ich weiß. Ich bin im Januar geboren. Es hat geschneit. Und das Haar war natürlich ein weiterer Grund.«
»Man hört gar keinen Akzent mehr.«
»Ich lebe seit meinem sechzehnten Lebensjahr in London«, sagte Eiriol. »Ich bin 1989 hergekommen.«
»Und wen suchen Sie?«, fragte Boxer.
»Ich suche meine Schwester, Anwen. Sie ist im Sommer 1979 spurlos verschwunden. Ich war damals sechs Jahre alt. Sie war zwanzig und studierte im zweiten Jahr Kunst an der Slade School. Sie hat mich angerufen und gesagt, sie würde zu unserem jährlichen Familienurlaub an der Küste von Pembrokeshire nach Hause kommen. Meine Eltern haben sie bei der Polizei als vermisst gemeldet. Wir haben nie wieder etwas von ihr gehört.«
»Und was hat die Polizei zum Zeitpunkt ihres Verschwindens ermittelt?«
»Rein gar nichts. Da hat mein Dad noch mehr rausbekommen«, sagte Eiriol. »Er war Lehrer. Er hat die ganzen Sommerferien damit zugebracht, sie aufzuspüren. Er ist zu ihrer Studentenbude irgendwo in der Holloway Road in London gefahren, wo er erfahren hat, dass sie das Haus, in dem sie zusammen mit ein paar anderen Studenten wohnte, mit der Absicht verlassen hatte, auf der A40 nach Wales zu trampen. Das berichtete er der Met, der Polizei von Thames Valley, Gloucestershire und Gwent. Nichts. Er ist zu den verschiedenen Punkten entlang der A40 gefahren, wo sich Tramper versammeln, und hat Anwens Foto herumgezeigt. Danach hat er es in der Gegenrichtung versucht, weil er dachte, dass er vielleicht jemanden treffen würde, der sie auf dem Weg aus London gesehen hatte und nun in die Stadt zurückkehrte. Nichts. Er hat Anwens Foto unter den regelmäßigen Trampern verteilt, ihnen seinen Namen, seine Adresse und Telefonnummer gegeben und sie gebeten, sich weiter umzuhören und Bescheid zu sagen, falls sie etwas erfuhren. Er hat sie bei jeder nur denkbaren Wohlfahrtsorganisation gemeldet, die irgendwas mit vermissten Personen zu tun hatte. Dann hatte er einen schweren Herzinfarkt, an dem er gestorben ist.«
Eine Böe wehte durch die Gasse. Eiriol stand nervös auf, zog ihre Jeans über die Hüften und setzte sich wieder.
»Ein plötzlicher Tod ist furchtbar«, sagte Boxer. »Für alle Hinterbliebenen.«
»Hat Ihre Mutter die Suche nicht fortgesetzt?«, fragte Amy.
»Meine Mutter ist an dem Verlust zerbrochen«, sagte Eiriol, »komplett zerbrochen. Anwen war ihr Liebling. Ich war ein Irrtum. Als dann Daddy so plötzlich gestorben ist, hat sie das über die Schwelle von der Depression zum Selbstmord getrieben. Sie hat eine Überdosis Schlaftabletten und Schmerzmittel genommen.«
»Wie alt waren Sie da?«, fragte Boxer.
»Als meine Mum gestorben ist? Acht.«
»Und wer hat sich um Sie gekümmert?«
Eiriol beugte sich vor und trank einen Schluck Wasser. »Ich bin zu Dads Bruder in Pontypool gekommen. Er war Bergarbeiter. Und, na ja, bis zum Bergarbeiterstreik 1984 war es okay. Dann ist alles auseinandergebrochen. Er hatte kein Einkommen und zwei eigene Kinder zu versorgen, also kam ich in Pflege … wenn man es so nennen kann.«
»Und was dann? Sie sind nach London abgehauen, als Sie sechzehn waren?«
Sie nickte, als ob sich hinter diesem kurzen Satz eine lange Geschichte verbergen würde, die sie ihm hätte erzählen können, wenn er zwei Leben lang Zeit übrig gehabt hätte.
»Hatten Sie damals vor, Anwen zu suchen?«, fragte Amy.
»Nein. Nach acht Jahren ohne jedes Zeichen von ihr ging es nur darum, aus dem Waisenhaus wegzukommen und in London unterzutauchen. Nicht dass mich irgendjemand gesucht hätte.«
»Was glauben Sie, was mit Ihrer Schwester geschehen ist?«, fragte Boxer.
»Ich glaube, jemand hat sie ermordet.«
»Sie wissen, dass LOST eine wohltätige Organisation ist, die sich dem Ziel verschrieben hat, vermisste Personen lebendig zu finden.«
»Ich weiß«, sagte Eiriol. »Sie haben mich gefragt, was meiner Meinung nach mit Anwen geschehen ist. Aber ich weiß es nicht mit Sicherheit. Sie könnte ebenso gut … nein, nein, sie ist tot. Da bin ich mir ziemlich sicher.«
»Und was glauben Sie, wie wir Ihnen helfen können?«, fragte Boxer.
»Ich weiß, es macht nicht den Eindruck, aber ich habe mein Leben im Lauf der Jahre in den Griff bekommen. Die erste Zeit in London war übel. Ohne Geld ist es schwer, das habe ich am eigenen Leib erfahren. Drogen und«, sie blickte Amy an, »was man machen muss, um sie zu bekommen. Wie viele Obdachlose bin ich bei Crisis gelandet, und die haben mich vom Rand des Abgrunds zurückgeholt, mir eine Unterkunft besorgt, eine Lehre als Klempnergesellin vermittelt, und so bin ich Heizungsmonteurin geworden. Ich hab eine Sozialwohnung in Holloway bekommen, bin zu City & Guilds gegangen und habe mich zur Heizungsingenieurin weiterqualifiziert.«
Amy blickte auf und zog die Brauen hoch.
»Beeindruckend«, sagte Boxer, fasziniert von ihrer Willenskraft. »Aber was führt Sie hierher?«
»Diese Kiste«, erklärte sie und tippte darauf. »Vor ein paar Jahren habe ich es geschafft, Kontakt zu meinen Cousinen aufzunehmen, den Zwillingstöchtern vom Bruder meines Vaters, die jetzt verheiratet in Wales leben. Die in Cardiff ist bei einem Umzug auf ein paar alte Sachen gestoßen, die sie aus dem Haus ihrer Eltern geräumt hatte. Dabei ist ihr aufgefallen, dass diese Kiste nichts mit ihrem Vater zu tun hatte. Sie war voll mit Notizbüchern meines Vaters und Fotos von Anwen. Also hat sie mir die Kiste geschickt, und letztes Jahr im November habe ich es endlich geschafft, sie durchzusehen.«
»Wie meinen Sie das?«, fragte Boxer, der diese Frau und ihre Art, ihr Unglück zu bewältigen, mochte.
»Vor ein paar Jahren bekam ich starke Depressionen. Genau wie meine Mum. Ich wollte nicht denselben Weg gehen wie sie, aber auch keine Antidepressiva nehmen. Also habe ich eine Therapie angefangen und aus eigener Tasche bezahlt. Es war das erste Mal, dass ich überhaupt über Anwens Verschwinden und alles gesprochen habe. Ich kann Ihnen sagen, es war verdammt traumatisch. Ich konnte es nicht glauben. Als ob es gestern passiert wäre. Manchmal habe ich in der Sitzung bloß eine Stunde lang geweint, mein Geld bezahlt und bin wieder gegangen. Die Sache mit Anwen … also, sie war nicht bloß meine Schwester.« Eiriol packte die Tischkante, blinzelte heftig gegen die Tränen an, die ihr in die Augen geschossen waren, und atmete tief durch. »Anwen hat sich um mich gekümmert, seit ich klein war, bis sie ausgezogen ist, um Kunst zu studieren. Meine Mum war dazu nicht imstande. Also hat Anwen die Mutterrolle übernommen. Als sie nach London gezogen ist, ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr ich mich darauf gefreut habe, dass sie nach Hause kommt. Und sie dann zu verlieren … es war, als hätte ich meine Mutter verloren, und ich bin in der Erinnerung nie dorthin zurückgekehrt, habe nie darüber gesprochen. Dad war auf seiner verzweifelten Suche. Mein Mum lag bei zugezogenen Vorhängen im Bett. Ich musste ganz allein mit dem Verlust zurechtkommen, und ich wusste nicht, wie. Ich habe es einfach irgendwo in meinem Unterbewusstsein vergraben, zusammen mit Dads Tod, dem Selbstmord meiner Mutter und allem anderen, was passiert ist. Aber wenn man das macht, holt es einen irgendwann wieder ein, und genau das ist geschehen …«
»War die Kontaktaufnahme mit Ihren Verwandten Teil Ihrer Therapie?«, fragte Boxer.
»Mein Therapeut meinte, das wäre eine gute Idee, und er hatte recht. Trotz aller Unterschiede verstehe ich mich gut mit meinen Cousinen. Sie waren sehr hilfsbereit. Dann haben sie mir die Kiste geschickt, und es war wie eine Prüfung. Ein paar Monate lang habe ich mich nicht getraut, mir den Inhalt anzusehen. Mein Therapeut hat mir geraten, mir Zeit zu lassen. Und das habe ich getan … bis zum letzten November. Dann bin ich ein ganzes Wochenende lang alles durchgegangen. Ich habe die Notizbücher gelesen, in denen mein Dad seine Gespräche und Gedanken festgehalten hat. Ich habe die Fotos von Anwen betrachtet, all ihre Zeichnungen, die Visitenkarten, die er hatte drucken lassen, um sie zu verteilen. Ich habe das Album mit Fotos von Pubs, Hotels, Hamburgerbuden, Rastplätzen und Tankstellen entlang der Strecke durchgeblättert. Er hat Naturwissenschaften unterrichtet und war es gewohnt, akkurat zu arbeiten, Listen zu führen, Experimente zu dokumentieren und so weiter. Für ihn war es eine Therapie. Es hat ihm geholfen, damit klarzukommen.«
»Wie war Ihre Beziehung zu Ihrem Vater?«, fragte Amy.
Eiriol zuckte die Achseln. »Wir waren uns sehr ähnlich. Wir hatten den logischen Verstand. Anwen war der musisch-künstlerische Typ. Sie konnte eigenwillige Verknüpfungen herstellen. Von ihr war er fasziniert. Ich war einfach nur da. Es gab kein Mysterium. Die meisten Zeichnungen in der Kiste waren Porträts von ihm. Ich hatte mitbekommen, wie Anwen sie angefertigt hatte, aber keine Ahnung, wo sie gelandet waren, bis auf die eine, die er hatte rahmen lassen. Sie waren alle da drin.« Sie öffnete die Kiste. »Und da war noch das«, sagte sie und hielt einen Brief hoch. »Er war ungeöffnet. Das Datum auf dem Poststempel ist der Todestag meines Vaters. Ich weiß nicht, warum er ungeöffnet geblieben ist, ich weiß nur, dass meine Mum völlig neben sich war. Es gibt tausend Möglichkeiten, was passiert sein könnte. Es war offensichtlich ein persönlicher Brief, nicht von einer Bank oder einem Versorgungsunternehmen, also hat irgendwer ihn wahrscheinlich einfach in die Kiste gesteckt.«
»Wie lange nach dem Verschwinden Ihrer Schwester ist Ihr Vater gestorben?«
»Etwas mehr als eineinhalb Jahre«, sagte Eiriol. »Und meine Mum hat nicht viel länger durchgehalten. Sie ist im September 1981 gestorben. Ich kam zurück von einer Klassenfahrt, ging hoch in ihr Schlafzimmer, und sie war schon kalt.«
Schweigen. Amy sah ihren Vater an, der gebannt zugehört hatte.
»Was stand in dem Brief?«, fragte er.
»Er war von einem Mann namens Tom Dyer. Er entschuldigte sich dafür, sich nicht früher gemeldet zu haben, weil er ein Jahr in Australien gewesen sei. Aus Oxford kommend hatte er in einer Jet-Tankstelle an der A40 ein Flugblatt gesehen und Anwen erkannt. Er sagte, sie hätten am Samstag, den 11. August 1979, um die Mittagszeit gemeinsam an dem Kreisverkehr in Wolvercote gestanden. Er war nach seinem Examen noch an der Oxford University geblieben und nun auf dem Heimweg zu seinen Eltern in Cheltenham. Anwen erzählte ihm, dass sie von einem Paar aus Clapham, das einen alten Freund in North Oxford besuchte, mitgenommen worden war. Jedenfalls verstanden die beiden sich gut und beschlossen, gemeinsam weiterzutrampen. Dann hielt ein zweisitziger grüner Sportwagen für Anwen. Die Gelegenheit war zu günstig, um sie abzulehnen. Er erinnerte sich, dass sie auf dem Beifahrersitz gekniet und ihm zum Abschied zugewinkt hatte, als der Wagen davonbrauste. Das war alles. Der Einzige, der sie gesehen hatte, und mein Vater hat ihn um einen Tag verpasst.«
»Kann ich den Brief lesen?«, fragte Boxer.
Amy sah ihn mit einem festen Blick an, der ihm bedeutete, dass er eine Grenze überschritt. Dieser Fall kam für sie nicht in Frage. Sie suchten ausschließlich nach Lebenden, nicht nach Toten. Als Eiriol ihm den Brief gab, schüttelte Amy leicht den Kopf. Boxer ignorierte sie und las den Brief. Der Himmel verdunkelte sich, wie aus dem Nichts kam ein böiger Wind auf, und ein schwerer Schauer prasselte auf die Gasse nieder.
»Sind Sie einem der Hinweise in dem Brief nachgegangen, oder haben Sie mit der Polizei darüber gesprochen?«, fragte Boxer.
»Ich hatte nie eine besonders gute Beziehung zur Polizei«, sagte Eiriol. »Wenn ich eine Polizeiwache betrete, passiert irgendwas in meinem Kopf. Ich werde laut und unhöflich, ein Relikt aus meiner frühen Zeit in London, als ich versucht habe, mit nichts zu überleben, und öfter mal wegen Ladendiebstahl und dergleichen festgenommen wurde.«
»Bei der Thames Valley Police gibt es eine Einheit für die Revision von Ermittlungen bei Kapitalverbrechen«, sagte Amy. »Hätten Sie etwas dagegen, wenn wir in Ihrem Namen mit den Leuten sprechen?«
»Ich glaube nicht, dass das zum jetzigen Zeitpunkt der richtige Ansatz wäre«, ging Boxer rasch dazwischen.
Amy beugte sich vor und starrte ihn mit ihren hellgrünen Augen wütend an. Er warf ihr einen warnenden Blick zu. Perplex lehnte sie sich auf ihrem Stuhl zurück, während er sich an Eiriol wandte.
»Wie haben Sie von der LOST Foundation erfahren?«, fragte er.
»Ihr Name stand im Januar im Evening Standard. Als diese Milliardärskinder entführt worden waren und Sie sie unversehrt befreit haben. In dem Artikel wurde erwähnt, dass Sie eine wohltätige Organisation für die Suche nach vermissten Personen betreiben. Als ich beschlossen habe, etwas wegen Anwen zu unternehmen, ist mir Ihr Name wieder eingefallen, ich habe Sie im Internet gefunden, und hier bin ich.«
»Sie wissen, dass es nicht leicht ist, fünfunddreißig Jahre zurückzugehen. Kein einziger der damals ermittelnden Beamten wird noch im Dienst sein.«
»Ich weiß. Ich muss das bloß für meinen Seelenfrieden tun. Damit ich mir sagen kann, dass ich es versucht habe.«
»Können Sie uns die Kiste überlassen?«, fragte Boxer. »Wir kopieren alles und schicken sie Ihnen zurück.«
»Was ist mit Bezahlung? Auf Ihrer Website stand, dass es kostenlos ist, aber Sie brauchen doch Geld für Ihre Auslagen.«
»Wir sind auf die Spenden zufriedener Klienten angewiesen.«
»Wie wäre es dann mit einer Art Vorabspende«, sagte Eiriol, zog einen weißen Umschlag aus der Tasche und schob ihn Boxer über den Tisch zu.
»Jetzt noch nicht«, erwiderte Boxer und schob ihn zurück. »Erst wenn wir fertig sind.«
Eiriol zuckte mit den Schultern. Boxer stand auf, verabschiedete sich von ihr und schickte sie mit Amy hinaus, damit die ihre Kontaktdaten aufnehmen konnte. Er öffnete die Kiste und las gerade noch einmal den Brief von Tom Dyer, als Amy zurückkam.
»Was hatte das denn zu bedeuten?«, fragte sie. »Hast du gerade aus einer Laune heraus beschlossen, sämtliche Grundsätze der LOST Foundation umzustoßen? Machen wir jetzt auch in Toten?«
»Nein«, sagte Boxer und biss sich auf die Unterlippe, während er mit seinen Gedanken rang. »Es war bloß die Neugier, die mit mir durchgegangen ist.«
»Was gibt es da neugierig zu sein?«, fragte Amy. »Vor fünfunddreißig Jahren stirbt eine Tramperin. Ende der Geschichte …«
»Es ist das Datum«, sagte Boxer. »Anwen ist drei Tage vor dem Tag verschwunden, an dem mein Vater verschwunden ist.«
»Ja, Dad, aber nicht am selben Tag, oder?«, fragte Amy. »Sie waren nicht im selben Teil des Landes. Dein Vater ist drei Tage später aus seinem Haus in London verschwunden.«
»Mein Vater war an dem Tag, an dem Anwen getrampt ist, in seinem Ferienhaus in Eastleach in den Cotswolds, direkt an der A40.«
»Na und?«, fragte Amy mittlerweile genervt. »Hatte er einen zweisitzigen grünen Sportwagen?«
»Nein«, sagte Boxer, »aber John Devereux, der Geschäftspartner meiner Mutter. Einen sehr auffälligen grünen Sportwagen. Und John wurde am frühen Montagmorgen, dem 13. August 1979, von der Putzfrau in seinem Haus in Bibury gefunden, wo er am späten Samstagabend, dem 11. August, ermordet worden war. Mein Vater war am selben Abend in seinem nur zehn Kilometer entfernten Ferienhaus, weshalb die Polizei ihn am 13. August anrief und ihm erklärte, dass man ihn am kommenden Tag befragen wolle. Dies war ihrer Vermutung nach der Grund, warum er am 14. August verschwunden ist und nie wieder gesehen wurde.«
KAPITEL VIER
24. April 2014, 19.20 Uhr
Boxers Wohnung, Belsize Park, London NW3
Boxer fuhr nach Hause, legte sich aufs Bett und dachte darüber nach, wie es sein konnte, dass Eiriol Lewis vor seiner Tür gelandet war. Er wusste, dass er sie hätte wegschicken sollen, doch irgendetwas an ihr hatte sein Innerstes berührt, hatte das trübe Wasser aufgewühlt und ihn zum Licht jenseits der schwankenden Oberfläche aufblicken lassen. Nachdem sie gegangen war, hatte er einen Freund in einer Produktionsfirma in Soho angerufen und einen Termin ausgemacht, um sich die alte Betamax-Kassette anzusehen, die er in den Händen gewendet hatte, als er Eiriol in der Gasse entdeckt hatte.
Seinem Gespür für die Synchronizität von Ereignissen war es auch nicht entgangen, dass sie Heizungsingenieurin war. Erst drei Monate zuvor hatte ein anderer Heizungsingenieur die Videokassette unter den Bodendielen eines Zimmers in seiner Wohnung entdeckt. Der Raum war früher, als die Familie noch das ganze Haus bewohnt hatte, das Arbeitszimmer seines Vaters gewesen. Das Päckchen war in der Handschrift seines Vaters an ihn adressiert. Darin befand sich ein Brief aus dem Mai 1979, drei Monate bevor sein Vater für immer verschwunden war.
Der Brief versprach ihm, dass er auf der Kassette die Antworten auf Fragen finden würde, die ihn fast ein Leben lang verfolgt hatten: Hatte sein Vater John Devereux getötet? Warum war er weggelaufen? Lebte sein Vater noch? Und wenn ja, warum hatte er nie versucht, Kontakt mit seinem Sohn aufzunehmen?
Eine dieser Fragen schien durch das Auftauchen eines Mannes beantwortet worden zu sein, der sich Conrad Jensen nannte. Er war der Kopf hinter der Entführung von sechs Milliardärskindern im Januar in London gewesen. Boxer war in die Suche nach den Geiseln verwickelt worden und hatte Jensen und die Kinder in einer entlegenen Region des Atlasgebirges aufgespürt, wo es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen war. Kurz bevor Conrad Jensen auf einem Crossbike in der eiskalten Nacht verschwunden war, hatte er Boxer zu dessen Verblüffung geraten, unter den Bodendielen des ehemaligen Arbeitszimmers nachzusehen, wo er eine Videokassette finden würde.
Das hatte Boxer in tiefes Grübeln gestürzt: War Conrad Jensen sein Vater, oder hatte er nur eine entscheidende Information benutzt, um ihn auf seine Seite zu ziehen?
Der Brief hatte ihn außerdem gewarnt, dass er, wenn er ein glücklicher Mann sei, besser daran täte, sich den Inhalt der Kassette nicht anzusehen, weil die Geschichte, die sie erzählte, zerstörerisch sei.
Boxer war bestimmt nicht der glückliche Mann, der er zu Beginn des Jahres gewesen war, nachdem er mit Isabel die Liebe seines Lebens verloren hatte, die mit ihrem gemeinsamen Kind schwanger gewesen war.
Das Kind, sein Sohn Jamie, hatte überlebt, und weil Boxer geglaubt hatte, sich nicht um ihn kümmern zu können, hatte er eine Adoption durch Isabels Tochter Alyshia arrangiert. Nun fragte er sich, ob das richtig gewesen war. Der Junge gab ihm Hoffnung, doch ihn zu sehen tat auch weh, und mittlerweile bereute er es, nicht die Verantwortung für ihn übernommen zu haben. Er hatte den Verdacht, dass es mit seiner eigenen Verzweiflung und Wut darüber zu tun hatte, von seinem Vater verlassen worden zu sein.
Es gab also einen Hoffnungsschimmer, doch er war alles andere als glücklich. Genau genommen steckte er noch in den Tiefen der Trauer fest, in der Schwebe an einem trüben und schlammigen Ort, wo es eigenartig schwerfiel, in Kontakt zu den eigenen Gefühlen zu kommen. Er fühlte sich immer mehr wie ein uralter Hecht mit atavistischem Überlebensinstinkt am Grund eines Teichs. Vielleicht fiel ihm hin und wieder ein silbernes Blitzen ins Auge, doch wenn er danach schnappte, musste er jedes Mal feststellen, dass es scharf und unerträglich schmerzhaft war. Er zuckte zurück vor den Augenblicken, in denen die Realität des Verlustes von Isabel unkontrolliert auf ihn einstürzte, bis er schluchzend am Boden lag. Wenn er hinterher mühsam gefasst wieder aufstand und sich umblickte, fragte er sich manchmal, wo er gerade gewesen war.
Er hatte nicht gearbeitet. In einem fragilen emotionalen Zustand sollte man keinen Job als Kidnapping-Consultant annehmen. Er hatte angefangen, regelmäßig ins Büro der LOST Foundation zu kommen, um seinem Leben eine Struktur zu geben. Er war sich bewusst, dass er außerdem in der Nähe seiner Tochter sein wollte, ohne ihr das Gefühl zu geben, dass sie sich zu sehr um ihn kümmern musste, weshalb er in letzter Zeit wieder unregelmäßiger erschienen war.
Nun hatte er beschlossen, den Stier bei den Hörnern zu packen. Er war sich nicht sicher, ob es der Blick aus Eiriols blauen Augen gewesen war, der den Entschluss ausgelöst hatte, aber als sie gegangen war, hatte er einen Energieschub gespürt, der ihn wieder ins Leben zurückgestoßen hatte. Er hatte erkannt, dass er die Kassette, wenn er es nicht über sich brachte, sie zu zerstören, irgendwann ansehen musste, deshalb würde er morgen die Produktionsfirma seines Freundes in Soho aufsuchen.
Was nicht bedeutete, dass er es durchziehen musste.
Er schüttelte den Kopf über sein endloses Zaudern.
Er trank Whisky, während er Pasta kochte und etwas Pesto hinzufügte. Dann öffnete er eine Flasche Rioja und aß und trank, ohne zu denken. Ein Freund rief an und lud ihn ein, am späteren Abend an einer Pokerpartie teilzunehmen. Er nahm an.
Die Karten lagen von Anfang gut für ihn, und um ein Uhr morgens war er mit sieben Riesen im Plus. Dann passierte etwas in seinem Kopf. Nicht direkt Trauer oder Erinnerungen an Isabel oder der Gedanke an ihre Abwesenheit. In einer Minute handelte er noch vollkommen kontrolliert und in der nächsten dann plötzlich nicht mehr. Es war ihm mit einem Mal scheißegal, was um ihn herum geschah. Die Wachheit der anderen Spieler, die mit den Fingern über den Rand ihrer Chips strichen und mit zuckenden Blicken auf Ticks und verräterische Zeichen ihrer Mitspieler lauerten, die Aufregung, wenn die Karten aufgedeckt wurden, die elektrische Spannung um den Tisch … alles war von Sinnlosigkeit durchzogen.
»Was willst du machen, Charlie?«, fragte der Mann neben ihm.
Boxer setzte, ohne nachzudenken, und hatte, ehe er sich’s versah, die sieben Riesen und zwei weitere wieder verloren. Er stand vom Tisch auf und lief im Nieselregen durch die dunklen Straßen nach Hause.
Erst als er sich ein T-Shirt und die Schlafanzughose anzog und sich in der Dunkelheit aufs Bett legte, begriff er den Ursprung seines Unglücks. Er drehte sich zur Seite und schlief ein, das Gesicht ins Kissen gedrückt.
Eineinhalb Stunden später wachte er mit trockenem Mund und pelziger Zunge auf. Er ging ins Bad, trank Wasser aus dem Hahn und hielt inne, als er aus dem Wohnzimmer ein Geräusch hörte. Er verließ das Bad und lauschte. Nichts. Seine einzige Waffe war unter den Bodendielen in der Küche versteckt, acht Meter entfernt. Er ließ den Blick durch den Raum schweifen und machte auf einem der Sessel die vagen Umrisse einer Gestalt aus. Er schaltete das Licht an.
Es dauerte einen Moment, bis er sie erkannte: Louise Rylance war ganz in Schwarz gekleidet, hatte die Beine übereinandergeschlagen und die Finger auf den Armlehnen des Sessels gespreizt. Ihr blondes Haar war verschwunden, stattdessen trug sie jetzt einen dunklen Pagenschnitt. Sie hatte abgenommen. Ihre Wangenknochen wirkten markanter, ihre Gliedmaßen länger. Sie sah ihn mit ihren hellgrauen Augen fest an.
Louise war als Geheimdienstoffizierin der britischen Armee im Irak gewesen, bevor sie und ihr Mann von Conrad Jensen engagiert wurden, eine der Entführungen der sechs Milliardärskinder in London Anfang des Jahres durchzuführen. Ihr Mann war bei dem Einsatz ums Leben gekommen, und als Boxer Louise zum letzten Mal gesehen hatte, wollte sie gerade untertauchen und eine neue Identität annehmen. Sie war seine einzige Verbindung zu Conrad Jensen; seit ihrem Anruf am 18. April, dem Tag, an dem sein neugeborener Sohn das Krankenhaus verlassen durfte, hatte er nichts mehr von ihr gehört.
»Ich mag es nicht, wenn Leute in meine Wohnung einbrechen … vor allem nicht, wenn ich zu Hause bin«, sagte Boxer eisig.
»Dann musst du vorsichtiger sein«, erwiderte sie. »Ich bezweifle, dass ich die Erste bin.«
»Das heißt?«
»Leute interessieren sich für dich«, erklärte Louise.
»Tun sie das?«
»In den ersten paar Monaten … bis weit in den März hinein bist du überwacht worden.«
»Von wem?«
»Vom MI5«, sagte Louise. »Hast du einen trinkbaren Kaffee?«
Boxer ging in die Küche, legte zwei Pads in die Maschine und machte zwei doppelte Espresso.
»Der britische Geheimdienst konnte sich meine Verbindung mit Conrad Jensen nicht erklären«, sagte Boxer, gab ihr den Kaffee und bedachte sie mit einem langen festen Blick, den sie unbeeindruckt erwiderte.
»Du hast ihnen also nichts von deiner Beziehung zu ihm erzählt?«, fragte Louise.
»Ich habe ihnen alles erzählt außer einer Kleinigkeit.«
»Dass er dein Vater ist?«
»Das weiß ich nicht mit Sicherheit.«
»Wirklich? Aber nun hast du gefunden, wonach zu suchen er dir aufgetragen hat …«
»Wenn du die Kassette meinst, die hatte ich schon vorher gefunden«, sagte Boxer. »Ich hatte Handwerker in der Wohnung, die die Bodendielen entfernt haben.«
»Hast du sie dir schon angesehen?«
»Noch nicht«, antwortete Boxer.
Louise nippte an ihrem Kaffee, blickte sich im Wohnzimmer um und registrierte jede Einzelheit: das Gemälde eines italienischen Geschäftsmanns aus dem 16. Jahrhundert, die Fotos von Amy, das Bücherregal mit einer großen Abteilung Elmore Leonard und Anthony Beevor, eine seltsame Karikatur von einem Riesen in einem Loch, der von kleinen Menschen gefüttert wird, zwei Teppiche auf dem Boden, ein afghanischer, ein pakistanischer. Ihr Blick schwenkte zurück zu ihm. »Warum nicht?«
»Ich war in Trauer, und der Kassette lag eine deutliche Warnung bezüglich meiner geistigen Gesundheit bei.«
»Das mit Isabel tut mir leid«, sagte Louise. »Ich habe gehört, dass es sehr plötzlich passiert ist. Und das Baby … Jamie? Wie geht es ihm?«
»Gut«, antwortete Boxer. »Du warst auch in Trauer. Um deinen Mann. Mein Beileid zu deinem Verlust.«
»Das hast du auch schon unmittelbar danach gesagt«, erwiderte Louise. »Was mich überrascht hat.«
»Daran kann ich mich nicht erinnern«, sagte Boxer. »Wie ist das Leben seitdem?«
»Schwer, viel schwerer, als ich erwartet habe.«
»Es nicht leicht, abgeschnitten von seiner Vergangenheit zu leben«, sagte Boxer. »Wer bist du übrigens jetzt?«
»Laura King. Irgendwie enttäuschend nach Louise Rylance. Ich mochte den Namen, und ich vermisse es, blond zu sein«, erklärte sie und berührte ihr schwarzes Haar mit ihren lackierten Nägeln. »Du hast eben gesagt, ›noch nicht‹. Heißt das, du wirst dir die Kassette ansehen?«
»Will Conrad das?«
»Das hat er nicht gesagt. Er wollte bloß wissen, ob du sie angeschaut hast und ob es irgendwelche Folgen hatte.«
»Hast du Conrad persönlich gesehen?«
»Nein.«
»Wie hat er Kontakt zu dir aufgenommen?«
»Ein altmodischer toter Briefkasten in Hampstead Heath«, sagte Louise. »Es war vorher verabredet, dass ich ihm Bescheid gebe, wenn ich vorbeikommen würde. Seine Antwort hat eine Woche gedauert.«
»Steht ihr in regelmäßigem Kontakt miteinander?«
»Wir kommunizieren, wenn es notwendig ist.«
»Conrad hat gemeint, du würdest dich melden, wenn es etwas für mich zu tun gebe«, sagte Boxer, setzte sich auf die Lehne des Sofas und stellte seinen Kaffee auf dem Tisch ab.
»Ich glaube, vorher will er wissen, ob du auf unserer Seite bist«, sagte Louise.
»Und wie deutest du unser bisheriges Gespräch?«, fragte er.
»Du klingst skeptisch.«
»Ich kann nicht behaupten, dass die CIA mir nach dem Showdown in Marokko in irgendeiner Form geholfen hat.«
»Vielleicht, um dich zu schützen.«
»Ich habe nach wie vor nur Conrads Wort, dass die CIA gegen eine rechtsextreme Fraktion in den eigenen Reihen kämpft.«
»Sein Wort wird durch deine Beziehung zu ihm untermauert. Er ist dein Vater.«
»In den letzten fünfunddreißig Jahren war er kein besonders toller Vater für mich«, entgegnete Boxer wütend, stützte die Hände auf die Lehnen ihres Sessels und hielt sein Gesicht dicht vor ihres. »Und schon vor unserer ersten Begegnung, die praktisch gleich wieder vorbei war, hat er mich manipuliert, damit ich seine Schlachten für ihn schlage.«
»Nicht direkt seine Schlachten.«
»Du weißt, was ich meine. Er hat mich nicht engagiert. Er hat mich in seinen Dunstkreis gelockt. Geradlinig geht anders. In meiner Branche mögen wir Klarheit und Ehrlichkeit, sonst kommen Menschen zu Tode«, sagte Boxer und stieß sich wieder von ihrem Sessel ab. Er ging durchs Zimmer und blieb hinter dem Sofa stehen.
»Welche Branche meinst du?«, fragte Louise mit einem spöttischen Lächeln. »Die Kidnapping-Consultant-Branche oder das Geschäft der extremen Vergeltung?«
»Letzteres hat sich aus Ersterem entwickelt.«
»Bist du dir da sicher?«
»Bei unserer letzten Begegnung hast du etwas ziemlich Vernichtendes zu mir gesagt.«
»Was denn? Ich kann mich nicht erinnern.«
»Du warst die Erste, die mich einen Psychopathen genannt hat.«
»Und noch lebt?«, fragte Louise und zog die Augenbrauen hoch.
Sie lachten.
»Ich habe in meiner Zeit im Irak eine Menge beschädigter Persönlichkeiten gesehen«, sagte sie. »Ich erkenne die Symptome: unter anderem die Fähigkeit, mit einem Lidschlag von menschlich auf mörderisch und wieder zurück zu schalten. Das könnte ich unter dem Stress von Straßenkämpfen bei knapp fünfzig Grad in Falludscha noch verstehen, aber mit unbewaffneten Gefangenen an einem grauen Nachmittag in Catford ist es nicht normal.«
»Ich wusste nicht, ob ihr für die Entführung meiner Tochter verantwortlich wart …«
»Mach dir nichts vor«, sagte Louise und warf ihm einen zornigen Blick zu. »Ich war dabei. Du warst bereit, uns einfach so umzubringen. Ich weiß nicht, was mit dir passiert ist, aber irgendwo unterwegs muss es einen psychischen Sprung über einen dunklen Abgrund gegeben haben.«
»Was machst du hier, Louise?«, fragte Boxer verärgert. »In der einen Minute rekrutierst du mich, in der nächsten stellst du gnadenlose Forderungen. Conrad hat gesagt, du würdest Informationen für mich haben. Aber alles, was ich als Antwort auf meine Fragen kriege, sind noch mehr Fragen.«
Er ging in die Küche und machte sich noch einen Kaffee.
»Und was ist mit dieser rechtsgerichteten Verschwörung innerhalb der CIA?«, fragte er, als er wieder zurückkam. »Glaubst du daran?«
»Ich war als Geheimdienstoffizier im Irak. In Bagdad. Ich habe gesehen, was vor sich ging.«
»Du meinst die Manipulation von geheimdienstlichen Informationen, um uns in den Krieg hineinzuziehen.«
»Nein, ich meine das Geld.«
»Das Geld?«, fragte Boxer. »Jeder weiß, dass es immer reichlich Geld für einen Krieg gibt und nie genug für ein Krankenhaus.«