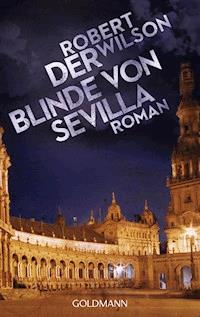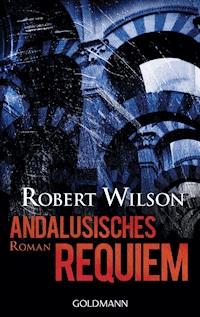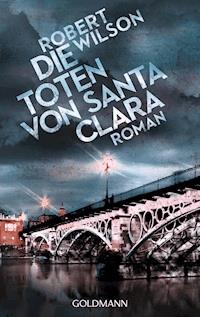8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Page & Turner
- Kategorie: Krimi
- Serie: Javier Falcón
- Sprache: Deutsch
Der 3. Fall für Inspektor Javier Falcón
Eine Bombenexplosion erschüttert Sevilla. Der Verdacht fällt sofort auf islamistische Fanatiker. Doch Inspektor Javier Falcón ist anderer Meinung: Ihn beschäftigt eine grausam verstümmelte Leiche, die am Tag vor der Explosion auf einer Mülldeponie gefunden wurde. Die zeitliche Nähe des augenscheinlichen Ritualmords und des Anschlags ist für Falcón kein Zufall. Als er den Toten endlich identifizieren kann, führt ihn die Spur zu den Drahtziehern eines infamen Komplotts, die nur ein Ziel kennen: ungeteilte Macht um jeden Preis ...
Das Böse trägt viele Masken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 857
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Buch
Angst herrscht in Sevilla, denn eine Bombenexplosion hat mehrere Gebäude in Schutt und Asche gelegt. Viele Tote und Verletzte – vor allem Kinder – sind als Opfer des Anschlags zu beklagen. Presse und Öffentlichkeit gehen sofort von einem islamistischen Terrorakt aus, doch Inspektor Javier Falcón zweifelt daran. Seine Gedanken kreisen immerzu um die furchtbar verstümmelte Leiche, die am Tag vor der Explosion auf einer Mülldeponie entdeckt wurde.
Die zeitliche Nähe des augenscheinlichen Ritualmords und der Detonation ist für Falcón kein Zufall. Und als er den Toten schließlich identifizieren kann, bestätigt sich sein Verdacht. Die neue Spur führt ihn zu den Hintermännern eines infamen Komplotts, die hinter der Maske von Reichtum, Wohlwollen und Anständigkeit nur ein Ziel kennen: ungeteilte Macht – um jeden Preis.
Autor
Robert Wilson, 1957 in England geboren, studierte an der Universität von Oxford. Zusammen mit seiner Frau lebt er abwechselnd in England, Spanien und Portugal. Spätestens seit dem Roman »Tod in Lissabon«, für den er den Gold Dagger Award und den Deutschen Krimi-Preis erhielt, wird er als »einer der besten Thrillerautoren der Welt« (The New York Times) gefeiert.
Inhaltsverzeichnis
Für Jane und meine Mutter und Bindy, Simon und Abigail
Kreisend und kreisend in immer weiteren Kreisen Versteht der Falke seinen Falkner nicht; Die Welt zerfällt, die Mitte hält nicht mehr; Und losgelassen nackte Anarchie, Und losgelassen blutgetrübte Flut, Das Spiel der Unschuld überall ertränket; Die Besten sind des Zweifels voll, die Ärgsten Sind von der Kraft der Leidenschaft erfüllt.1
W. B. YEATS The Second Coming
Und nun, was wird mit uns geschehen ohne die Barbaren? Diese Menschen, sie waren eine Art Lösung.
CONSTANTINE CAVAFY Waiting for the Barbarians
West End, London – Donnerstag, 9. März 2006
Und wie läuft’s in deinem neuem Job?«, fragte Najib.
»Ich arbeite für eine Frau namens Amanda Turner«, sagte Mouna. »Sie ist noch keine dreißig und schon Account Director. Und weißt du, was ich für sie mache? Ich buche ihren Urlaub. Das habe ich jedenfalls die ganze Woche getan.«
»Fährt sie irgendwohin, wo es schön ist?«
Mouna lachte. Sie liebte Najib. Er war so still und nicht von dieser Welt. Ihn zu treffen war, als stieße man auf eine Oase in der Wüste.
»Sie macht eine Pilgerfahrt«, sagte sie. »Kannst du dir das vorstellen?«
»Ich wusste nicht, dass Engländer Pilgerfahrten machen.«
Mouna war eigentlich sehr beeindruckt von Amanda Turner, aber Najibs Zustimmung war ihr noch wichtiger.
»Nun, es ist nicht direkt eine religiöse Sache. Ich meine, deshalb fährt sie nicht dorthin.«
»Wohin pilgert sie denn?«
»Nach Spanien, in die Nähe von Sevilla. Es nennt sich La Romería del Rocío«, antwortete Mouna. »Jedes Jahr versammeln sich Menschen aus ganz Andalusien in einem kleinen Dorf namens El Rocío. An dem Tag, den man Pfingstmontag nennt, tragen sie die Jungfrau aus der Kirche, und alle geraten aus dem Häuschen, singen und feiern, soweit ich weiß.«
»Das verstehe ich nicht«, sagte Najib.
»Ich auch nicht. Aber ich weiß, dass Amanda nicht zur Prozession der Jungfrau dorthin fährt«, sagte Mouna. »Sie fährt, weil es eine einzige große, vier Tage dauernde Party ist – trinken, tanzen, singen –, du weißt ja, wie die Engländer sind.«
Najib nickte. Er wusste, wie sie waren.
»Und warum hast du dafür die ganze Woche gebraucht?«, fragte er.
»Weil Sevilla komplett ausgebucht ist und Amanda jede Menge, wirklich jede Menge Sonderwünsche hat. Die vier Zimmer müssen alle in einem Hotel sein …«
»Vier Zimmer?«
»Sie fährt mit ihrem Freund, Jim ›Fat Cat‹ Maitland«, sagte Mouna. »Dann kommen noch ihre Schwester und deren Freund sowie zwei weitere Paare mit. Die Männer arbeiten alle bei derselben Firma wie Jim – Kraus, Maitland, Powers.«
»Was macht Jim denn in seiner Firma?«
»Es ist ein Hedgefonds. Frag mich nicht, was das heißt«, erwiderte Mouna. »Ich weiß nur, dass die Firma in dem Gebäude ist, das man ›Gherkin‹ nennt, und … rate mal, wie viel er im letzten Jahr verdient hat?«
Najib schüttelte den Kopf. Er verdiente nur sehr wenig Geld. So wenig, dass es ihm nicht wichtig war.
»Acht Millionen Pfund?«, verpackte Mouna die Antwort in eine Frage.
»Wie viel, hast du gesagt?«
»Ich weiß. Unglaublich, was? Der am schlechtesten bezahlte Mitarbeiter von Jims Firma hat im letzten Jahr fünf Millionen verdient.«
»Dann verstehe ich, warum sie so viele Sonderwünsche haben«, sagte Najib und nippte an seinem schwarzen Tee.
»Die Zimmer müssen also alle unter einem Dach sein. Sie wollen die Nacht vor der Prozession und die drei Nächte danach in Sevilla verbringen, dann eine Nacht in Granada und dann für zwei weitere Nächte nach Sevilla zurückkehren. Und das Hotel muss eine Garage haben, weil Jim seinen Porsche Cayenne nicht auf der Straße parken will«, sagte Mouna. »Weißt du, was ein Porsche Cayenne ist, Najib?«
»Ein Auto?«, fragte Najib und kratzte seinen Bart.
»Amanda nennt ihn immer Jims großen Stinkefinger gegen die globale Erwärmung.«
Najib verzog das Gesicht wegen ihrer unflätigen Sprache, und Mouna wünschte, sie wäre nicht so erpicht darauf gewesen, ihn zu beeindrucken.
»Es ist eine Art Geländewagen mit Allradantrieb«, fügte sie rasch hinzu. »Er fährt bis zu zweihundertzweiundfünfzig Stundenkilometer. Amanda sagt, man kann zusehen, wie die Nadel der Tankanzeige absackt, wenn er schneller als hundertsechzig fährt. Und sie fahren mit vier Autos. Dabei würden sie locker in zwei passen, aber es müssen vier sein. Ich meine, solche Leute kann man sich wirklich nicht vorstellen, Najib.«
»Oh, ich denke, ich kann es mir vorstellen«, sagte Najib. »Ich glaube schon.«
London City – Donnerstag, 23. März 2006
Er stand gegenüber der Einfahrt der Tiefgarage auf der anderen Straßenseite. Sein Gesicht war unter der speckigen Kunstfellumrandung der Kapuze seines grünen Parkas verborgen. Er ging auf und ab, die Hände tief in den Taschen vergraben. Einer seiner Sneaker löste sich auf, das Schuhband des anderen schlug gegen den ausgefransten Saum seiner ausgewaschenen Jeans, die an dem feuchten Trottoir zu saugen schien. Er murmelte vor sich hin.
Er hätte jeder Beliebige der Hunderte von Unsichtbaren sein können, die von der Stadt angelockt auf Fußhöhe in Unterführungen oder auf Pappkartons in Ladeneingängen vegetierten und wie verlorene Seelen im Schwebezustand des Purgatoriums unter den Lebenden und Sichtbaren dahintrieben, die ein reales Leben, Berufe, Kreditkarten und einen Liefertermin für jede verfügbare Ware hatten, einschließlich der Zeit.
Nur dass er gesehen wurde, so wie wir alle gesehen werden, weil wir alle zu Statisten und Kleindarstellern im endlos langweiligen Film des alltäglichen Lebens geworden sind. Am frühen Morgen war er häufig der Star eines Dokumentarfilms in körnigem Schwarzweiß, fast ohne Nebendarsteller, sodass nur die schnellen Wagen der frühen Händler und Fernost-Fondsmanager ein wenig Action boten. Wenn später die Sandwichläden aufmachten und Bankiers, Broker und Analysten die Straßen bevölkerten, reduzierte sich seine Rolle wieder auf »Lokalkolorit«, und er war häufig vom Datum oder den laufenden Zahlen verdeckt, die das Verstreichen der Zeit anzeigten.
Wie bei allen Schauspielern vor den allgegenwärtigen Überwachungskameras war sein Talent vollkommen vernachlässigungswert, sein Reality-TV-Potenzial würde unentdeckt bleiben, wenn sich nicht aus irgendeinem Grund herausstellte, dass seine Rolle entscheidend war und der Regisseur des alltäglichen Lebens plötzlich erkannte, dass er den Moment eingefangen hatte, in dem das kleine Mädchen zum letzten Mal gesehen, der junge Bursche weggeführt oder, wie es so häufig in Filmen geschah, Aktenkoffer ausgetauscht worden waren.
Aber eine solche Spannung gab es hier nicht.
Die einsame männliche oder weibliche (nicht einmal das war unter der Kapuze deutlich auszumachen) Gestalt bewegte sich manchmal mit, manchmal gegen die Flut der Statisten. Sie war ein Statist der Statisten, schlimmer noch als überflüssig, sie war im Weg. Und so ging es Stunde um Stunde, Woche für Woche, Monat auf… Er war nur einen Monat dort. Vier Wochen lang schlurfte er murmelnd über die Risse im Bürgersteig gegenüber der Einfahrt der Tiefgarage, dann war er verschwunden. Das Reality-TV ging ohne ihn weiter, ohne je zu erkennen, dass es etwas mehr als dreihundertsechzig Stunden einen Star des stummen Kinos im Blick gehabt hatte.
Eine Tonspur hätte auch nicht geholfen. Selbst wenn man in der ekelhaft speckigen Kapuze seines Parkas ein Mikrofon installiert hätte, wäre nichts klarer geworden. Es hätte nur das Gemurmel eines einsamen Irren eingefangen, der willkürlich Farbe, Modell und Kennzeichen von Fahrzeugen aufsagte sowie die Uhrzeit, zu der sie seinen Streifen Bürgersteig passierten. Ganz gewiss die zwanghafte Fixierung eines Verrückten.
Denn welche noch so hoch entwickelte Überwachungstechnik hätte erkennen sollen, dass die Augen aus der Höhle der Kapuze nur Fahrzeuge auswählten, die in die Tiefgarage gegenüber fuhren? Und selbst wenn es eine Technik gäbe, die diesen Zusammenhang hätte herstellen können, wäre sie auch in der Lage gewesen zu entdecken, dass dieser Strom uninteressanter Daten auf der Festplatte eines handgroßen Diktaphons in der Tasche des Parkas gespeichert wurde?
Nur in diesem Fall hätte man die Bedeutung dieses überflüssigen Individuums erkennen können, und der Regisseur des täglichen Lebens hätte sich, wenn er an jenem Morgen aufmerksam gewesen wäre, in seinem Stuhl vorbeugen und denken können: Hier haben wir einen künftigen Star.
EINS
Sevilla – Montag, 5. Juni 2006, 16.00 Uhr
Ein toter Körper ist nie hübsch. Selbst der talentierteste Bestatter und genialste Maquillage-Künstler kann einer Leiche kein Leben einhauchen. Aber manche Leichen sind hässlicher als andere. Sie sind von anderen Lebensformen übernommen worden. Bakterien haben ihre inneren Säfte und Ausscheidungen in schädliche Gase verwandelt, die sich in den Höhlungen des Körpers sammeln und unter der Haut ausbreiten, bis sie sich straff wie ein Trommelfell über die darunter fortschreitende Verwesung spannt. Der Gestank ist so übermächtig, dass er in das zentrale Nervensystem der Lebenden eindringt, bis er die Ekelgrenze übersteigt. Sie werden reizbar. Am besten meidet man die Nähe von Menschen, die zu dicht um eine Blähleiche stehen.
Für gewöhnlich hatte Inspector Jefe Javier Falcón ein Mantra, das in seinem Hinterkopf ablief, wenn er mit dieser Art Leiche konfrontiert war. Er konnte die Spuren aller möglichen Arten von Gewaltanwendung verkraften – Krater von Schusswunden, tiefe Messerstiche, Beulen von stumpfer Gewalt, Würgemale, Vergiftungsblässe –, aber diese Verwandlung durch Verwesung, die Aufblähung und der Gestank verstörten ihn in letzter Zeit. Er dachte, dass es nur die Psychologie des Verfalls sei, der Verstand war beunruhigt von der Aussicht auf das einzig mögliche Ende des Alters, aber dies war nicht die übliche Fäulnis des Todes. Es hatte etwas mit der Verwesung der Leiche zu tun – der Art und Weise, wie die Hitze ein schlankes Mädchen rasend schnell in eine kräftige Matrone verwandeln oder, wie im Fall dieser Leiche, die sie auf der Müllkippe außerhalb der Stadt ausgruben, einen normalen Mann wie einen Sumoringer aussehen lassen konnte.
Die Totenstarre war voll ausgeprägt, und die Leiche in einer höchst entwürdigenden Position zur Ruhe gekommen. Schlimmer noch als ein geschlagener Sumoringer, der aus dem Ring gestoßen kopfüber in der ersten Reihe der johlenden Zuschauer landet. Aber anders als der in seiner Scham durch das dicke Band seines mawashi geschützte Ringer, war dieser Mann nackt. Wäre er bekleidet gewesen, hätte er ein kniender, muslimischer Betender sein können (sogar sein Kopf wies gen Osten), doch das war er nicht. Und deshalb wirkte er wie jemand, der sich auf bestialische Gewalt gefasst macht, das Gesicht in das Kissen aus Verfall unter sich gedrückt, als könnte er die Schmach seiner ultimativen Schändung nicht ertragen.
Während Falcón die Szene betrachtete, fiel ihm auf, dass er nicht sein übliches Mantra abspulte, sondern abgelenkt war von etwas, das geschehen war, als man ihn wegen der Entdeckung der Leiche alarmiert hatte. Um dem Lärm des Cafés zu entkommen, in dem er seinen café solo getrunken hatte, war er rückwärts aus der Tür getreten und mit einer Frau zusammengestoßen. Sie hatten »Perdón« gesagt, einen erstaunten Blick gewechselt und waren dann beide erstarrt. Die Frau war Consuelo Jiménez. Seit dem Ende ihrer Affäre vor vier Jahren hatte Falcón sie nur vier- oder fünfmal kurz von weitem auf einer belebten Straße oder in einem Laden gesehen, und nun waren sie buchstäblich aufeinandergeprallt. Sie sagten nichts. Sie betrat das Café schließlich doch nicht, sondern verschwand schnell wieder im Strom der Einkaufenden. Aber sie hatte ihren Abdruck in ihm hinterlassen und den ihr gewidmeten, fest geschlossenen Schrein in seinem Herzen unvermittelt wieder geöffnet.
Zuvor war der Gerichtsmediziner behutsam durch den Müll gestapft, um zu bestätigen, dass der Mann tot war. Jetzt waren die Männer von der Spurensicherung bei der Arbeit, steckten alles, was von Interesse sein könnte, in Plastiktüten und entfernten es vom Ort des Geschehens. Der Gerichtsmediziner, der immer noch eine Gesichtsmaske und einen weißen Overall trug, stattete der Leiche einen zweiten Besuch ab. Seine Beobachtungen ließen seine Augen schmal werden. Er machte sich Notizen und ging dann zu Falcón, der neben dem diensthabenden Richter, Juez Juan Romero, ein wenig abseits stand.
»Eine offensichtliche Todesursache kann ich nicht erkennen«, erklärte er. »Er ist nicht daran gestorben, dass man ihm die Hände abgetrennt hat. Das ist erst nach seinem Tod geschehen. Seine Handgelenke waren mit einem sehr festen Druckverband bandagiert. Er hat keine Quetschungen am Hals, keine Schuss- oder Stichwunden. Er wurde skalpiert, aber ich kann keine schweren Schädelverletzungen ausmachen. Vielleicht ist er vergiftet worden, was ich jedoch an seinem Gesicht nicht erkennen kann, weil es mit Säure weggeätzt wurde. Der Todeszeitpunkt liegt etwa achtundvierzig Stunden zurück.«
Bei jeder einzelnen verheerenden Enthüllung blinzelte Juez Romero. Er hatte seit mehr als zwei Jahren nicht mehr mit einer Mordermittlung zu tun gehabt, und von den wenigen Mordfällen, die er überhaupt bearbeitet hatte, war er nicht auf ein solches Ausmaß von Brutalität gestoßen.
»Offenbar wollte man, dass man ihn nicht erkennt«, stellte Falcón fest. »Gibt es am übrigen Körper irgendwelche besonderen Erkennungsmerkmale?«
»Dafür muss ich ihn ins Labor bringen und säubern. Er ist von oben bis unten verdreckt.«
»Gibt es sonst irgendwelche Spuren an der Leiche?«, fragte Falcón. »Er muss in einem Müllwagen transportiert worden sein, um hier zu landen. Da wird es doch irgendwelche Spuren geben.«
»Nicht, soweit ich erkennen kann. Vielleicht hat er unter der Schmutzschicht Hautabschürfungen. Brüche oder Risse an inneren Organen kann ich erst feststellen, wenn ich ihn im gerichtsmedizinischen Institut seziert habe.«
Falcón nickte. Juez Romero unterschrieb den levantamiento del cadáver, und der Gerichtsmediziner und seine Leute überlegten, wie sie einen in dieser Position erstarrten Toten in einen Leichensack und auf eine Bahre bekommen sollten. Die Tragödie nahm Züge einer Farce an. Man wollte die Leiche samt Fäulnisgasen möglichst wenig erschüttern. Schließlich öffneten die Männer den Leichensack auf der Bahre und hievten die Leiche in ihrer demütig kauernden Position hinein. Sie zerrten die Stumpen der Handgelenke und die Füße in den Leichensack und zogen den Reißverschluss über dem nach oben gereckten Hinterteil zu. Diese zeltartige Konstruktion trugen sie zum Leichenwagen, beobachtet von einem Trupp städtischer Arbeiter, die sich versammelt hatten, um die letzten Momente des Dramas zu verfolgen. Alle lachten und wandten sich ab, als einer von ihnen darüber witzelte, »bis in alle Ewigkeit in den Arsch gefickt zu werden«.
Tragödie, Farce und jetzt noch Vulgarität, dachte Falcón.
Die Männer von der Spurensicherung beendeten ihre Suche in unmittelbarer Umgebung der Leiche und trugen ihre eingetüteten Fundstücke zu Falcón.
»Wir haben in der Nähe des Toten einige Umschläge mit Adressen gefunden«, sagte Felipe. »Drei tragen denselben Straßennamen. Das sollte Ihnen helfen, die Stelle zu finden, wo der Leichnam abgelegt wurde. Wir vermuten, dass er in dieser Körperhaltung erstarrt ist, weil er in Embryonalstellung auf dem Boden eines Müllcontainers gelegen hat.«
»Außerdem sind wir uns ziemlich sicher, dass er in das hier eingewickelt war«, erklärte Jorge und hielt einen Plastiksack mit einem schmutzigen weißen Laken hoch. »Wir haben Blutspuren vermutlich von seinen abgetrennten Händen gefunden und werden das später abgleichen …«
»Als ich ihn gesehen habe, war er nackt«, sagte Falcón.
»Es gab eine offene Naht, die sich vermutlich in dem Mülllaster geöffnet hat«, meinte Jorge. »Das Laken hat sich an einem Stumpen verfangen.«
»Der Pathologe hat gesagt, dass die Handgelenke gut abgebunden waren und die Hände erst nach dem Tod abgetrennt wurden.«
»Und zwar ganz sauber«, ergänzte Jorge. »Nicht einfach abgehackt, sondern mit chirurgischer Präzision.«
»Das hätte jeder halbwegs vernünftige Metzger hingekriegt«, sagte Felipe. »Aber er wurde skalpiert und das Gesicht mit Säure weggeätzt… Was halten Sie davon, Inspector Jefe?«
»Er muss irgendetwas Besonderes gehabt haben, dass man sich so viel Mühe gegeben hat«, antwortete Falcón. »Was ist in dem Müllbeutel?«
»Gartenabfälle«, sagte Jorge. »Wir nehmen an, dass die Leiche damit bedeckt wurde.«
»Jetzt beginnen wir mit einer Durchsuchung der weiteren Umgebung«, sagte Felipe. »Pérez hat mit dem Baggerführer gesprochen, der die Leiche gefunden hat. Dabei war von einer schwarzen Plastikplane die Rede. Vielleicht haben sie darauf nach seinem Tod die chirurgischen Eingriffe vorgenommen, ihn dann in das Leichentuch eingenäht, in den Müllsack gesteckt und deponiert.«
»Und Sie wissen ja, wie wir für Fingerabdrücke schwarzes Plastik lieben«, meinte Jorge.
Falcón notierte die Adressen auf den Umschlägen; dann trennten sie sich. Er ging zurück zum Wagen und streifte die Gesichtsmaske ab. Sein Geruchssinn war noch nicht so weit gegen den Gestank des städtischen Mülls abgestumpft, dass er sich nicht in seiner Kehle festgesetzt hätte. Das beharrliche Baggergeräusch übertönte die Schreie der Aasvögel, die dunkel am weißen Himmel kreisten. Selbst für eine empfindungslose Leiche war dies ein trauriger letzter Ort.
Subinspector Emilio Pérez saß auf dem Kofferraum eines Streifenwagens und plauderte mit einem weiteren Mitglied der Mordkommission, Cristina Ferrera. Pérez war gut gebaut und hatte das südländisch gute Aussehen eines Leinwandhelden der 1930er Jahre. Er schien zu einer komplett anderen Gattung Mensch zu gehören als die kleine, blonde und recht unscheinbare junge Frau, die vor vier Jahren aus Cádiz zur Mordkommission gekommen war. Aber während Pérez in Gebaren und Mentalität zu einer gewissen Trägheit neigte, war Ferrera fix, gedankenschnell und hartnäckig. Falcón nannte ihnen die Adressen von den Umschlägen, erstellte eine Liste von Fragen, die er gestellt wissen wollte und die Ferrera für ihn wiederholte, noch bevor er geendet hatte.
»Sie haben ihn in ein Leichentuch eingenäht«, sagte er zu Cristina Ferrera, als sie zum Wagen gingen. »Sie haben seine Hände sorgfältig abgetrennt, sein Gesicht weggeätzt, ihn skalpiert, aber dann in ein Tuch eingenäht.«
»Vermutlich glauben sie, ihm so einen gewissen Respekt erwiesen zu haben«, meinte Ferrera. »Wie auf See oder bei Massenbestattungen nach einer Katastrophe.«
»Respekt«, wiederholte Falcón. »Nachdem sie ihm kurz zuvor ihre ultimative Missachtung demonstriert haben, indem sie ihm sein Leben und seine Identität genommen haben. Der Tat haftet etwas Rituelles und Brutales an, finden Sie nicht?«
»Vielleicht sind die Täter religiös«, sagte Ferrera und hob ironisch eine Braue. »Sie wissen ja, viele Gräuel sind im Namen Gottes begangen worden, Inspector Jefe.«
In einem seltsam gelblichen Licht fuhr Falcón zurück in die Innenstadt von Sevilla. Über die Sierra de Aracena hatten sich gewaltige dunkle Wolken zusammengeballt, die von Nordwesten auf die Stadt zurückten. Im Radio warnte man vor heftigen Gewittern am Abend. Wahrscheinlich würde es der letzte Regen vor dem langen heißen Sommer werden.
Anfangs glaubte er, dass es der physische und psychische Schock durch den Zusammenstoß mit Consuelo am Morgen war, der ihn nervös machte. Aber vielleicht war es auch eine Veränderung des atmosphärischen Drucks oder ein Rest von Gereiztheit vom Anblick der aufgeblähten Leiche auf der Müllkippe. Doch als er an einer roten Ampel hielt, merkte er, dass das Gefühl tiefer ging. Sein Instinkt sagte ihm, dass das Ende einer alten Ordnung gekommen war und etwas ominöses Neues begann. Die unidentifizierbare Leiche war wie eine Neurose, die sich aus einem noch größeren verborgenen Grauen hässlich in das Bewusstsein der Stadt drängte. Und dieses größere Grauen mit seinem Potential, Köpfe zu verdrehen, Seelen zu bewegen und Leben zu verändern, machte ihm Angst.
Als er nach einer Reihe von Treffen mit Richtern im Edificio de los Juzgados in die Jefatura zurückkam, war es kurz nach sieben. Der Geruch von Regen lag schwer wie Metall in der ionisierten Luft. Das Donnergrollen klang noch weit entfernt, aber am Himmel war eine verfrühte Dämmerung aufgezogen, und zuckende Blitze erschreckten den Betrachter wie ein knapp verpasster Tod.
Pérez und Ferrera warteten in seinem Büro. Ihre Blicke folgten ihm, als er ans Fenster trat, als die ersten schweren Tropfen gegen die Scheibe klatschten. Zufriedenheit war ein seltsamer menschlicher Zustand, dachte er, als ein Lichtstrahl den Parkplatz erleuchtete. Gerade wenn das Leben langweilig und der Wunsch nach Veränderung unwiderstehlich wurde, ergriff einen eine unbekannte finstere Lebenskraft, und der Verstand zuckte taumelnd in den alten Zustand zurück, der ihm unvermittelt wie die Seligkeit vor dem Sündenfall erschien.
»Was haben Sie herausgefunden?«, fragte er, wandte sich vom Fenster ab und ließ sich auf seinen Stuhl fallen.
»Sie haben uns keine Todeszeit genannt«, erwiderte Ferrera.
»Tut mir leid. Die Schätzung war vor achtundvierzig Stunden.«
»Wir haben die Müllcontainer gefunden, in die die Briefumschläge geworfen wurden. Sie stehen in der Altstadt an der Ecke einer Sackkasse und der Calle Boteros, zwischen der Plaza de la Alfalfa und der Plaza Christo de Burgos.«
»Wann werden die Container geleert?«
»Jeden Abend zwischen elf und Mitternacht«, antwortete Pérez.
»Wenn er also, wie der Médico Forense sagt, irgendwann am Samstagabend, dem dritten Juni, gestorben ist«, sagte Ferrera, »hätte man die Leiche wahrscheinlich kaum bis drei Uhr am Sonntagmorgen entsorgen können.«
»Wo sind die Müllcontainer jetzt?«
»Wir haben sie zur Untersuchung auf Blutspuren zur Spurensicherung geschickt.«
»Aber da könnten wir Pech haben«, bemerkte Pérez. »Felipe und Jorge haben eine schwarze Plastikplane gefunden, in die die Leiche ihrer Vermutung nach eingewickelt war.«
»Konnte sich irgendeiner der Leute, deren Adressen auf den gefundenen Umschlägen stehen, daran erinnern, eine schwarze Plastikplane auf dem Boden eines Containers gesehen zu haben?«
»Als wir sie befragt haben, wussten wir noch nichts von einer schwarzen Plastikplane.«
»Natürlich nicht«, sagte Falcón und stellte fest, dass er sich nicht auf die Details des Falls konzentrierte, sondern noch immer seinem vorherigen Unbehagen nachhing. »Warum glauben Sie, dass die Leiche um drei Uhr morgens entsorgt wurde?«
»Samstagabend in der Gegend um die Alfalfa … Sie wissen doch, was da los ist… die ganzen Jugendlichen in den Bars und auf den Straßen.«
»Wenn es so belebt ist, warum hat man dann überhaupt diese Müllcontainer gewählt?«
»Vielleicht kennen die Täter diese Container«, antwortete Pérez. »Sie wussten, dass sie in einer dunklen stillen Sackgasse parken konnten und wann die Container geleert wurden. Sie konnten planen. Die Leiche abzuladen, würde nur ein paar Sekunden dauern.«
»Gibt es Wohnungen mit Blick auf die Container?«
»Die Wohnungen in der Sackgasse klappern wir morgen ab. Die Wohnung mit der besten Sicht liegt ganz am Ende, aber dort war niemand zu Hause.«
Ein langer zuckender Blitz, gefolgt von einem gewaltigen Donnerkrachen, riss den Himmel über ihren Köpfen auf. Alle duckten sich instinktiv, und die Jefatura versank in Dunkelheit. Sie tasteten nach einer Taschenlampe, während draußen der Regen gegen das Gebäude klatschte und in Wellen über den Parkplatz wehte. Ferrera stützte eine Taschenlampe an ein paar Akten, und sie lehnten sich zurück. Weitere Blitze ließen sie blinzeln, und das Bild des Fensterrahmens brannte sich in ihre Netzhaut. Die Notgeneratoren im Keller sprangen an, die Lampen erwachten flackernd wieder zum Leben. Falcóns Handy vibrierte auf dem Schreibtisch: eine SMS vom Gerichtsmediziner, der ihm berichtete, dass die Autopsie abgeschlossen sei und er am nächsten Morgen um halb neun Zeit hätte, die Ergebnisse zu erörtern. Falcón schickte ihm eine Antwort und erklärte, ihn am nächsten Tag gleich als Erstes treffen zu wollen, bevor er das Handy wieder auf den Tisch warf und an die Wand starrte.
»Sie wirken ein wenig angespannt, Inspector Jefe«, meinte Pérez, der die Angewohnheit hatte, das Offensichtliche festzustellen, weshalb Falcón dazu neigte, ihn zu ignorieren.
»Wir haben eine nicht identifizierte Leiche, die sich möglicherweise auch nicht identifizieren lässt«, sagte Falcón in dem Versuch, seine Gedanken zu ordnen und Pérez und Ferrera ein Ziel für die weitere Ermittlungsarbeit zu geben. »Was glauben Sie, wie viele Menschen an diesem Mord beteiligt waren?«
»Mindestens zwei«, entgegnete Ferrera.
»Ermordung, Skalpierung, Wegätzen der Gesichtszüge mit Säure … ja, warum haben sie seine Hände abgetrennt, wenn sie seine Fingerabdrücke genauso gut mit Säure hätten wegätzen können?«
»Irgendwas an seinen Händen muss von Bedeutung sein«, folgerte Pérez.
Falcón und Ferrera wechselten einen Blick.
»Denken Sie weiter, Emilio«, sagte Falcón. »Jedenfalls war die Tat vorsätzlich und geplant, und es war wichtig, dass die Identität des Opfers unbekannt bleibt. Warum?«
»Weil sie auf die Mörder weist«, sagte Pérez. »Die meisten Opfer werden von Menschen getötet, die –«
»Oder?«, fragte Falcón. »Wenn es keinen offensichtlichen Zusammenhang gibt?«
»Die Identität des Opfers und beziehungsweise oder das Wissen um seine besonderen Fähigkeiten könnte eine geplante zukünftige Operation gefährden«, erwiderte Ferrera.
»Gut. Und nun erklären Sie mir, wie viele Personen wirklich erforderlich waren, um die Leiche in einem dieser Container zu deponieren«, sagte Falcón. »Für einen Menschen von normaler Größe sind sie etwa brusthoch, und die ganze Aktion muss binnen Sekunden über die Bühne gehen.«
»Drei, die sich um die Leiche kümmern, und zwei als Wachposten«, sagte Pérez.
»Wenn man den Container über den Kofferraum des Wagens neigt, könnte man es auch zu zweit schaffen«, spekulierte Ferrera. »Und jeder, der um diese Zeit die Calle Boteros entlangkommt, ist ein randalierender Betrunkener. Vielleicht brauchte man noch einen Fahrer im Wagen. Höchstens drei.«
»Drei oder fünf, was sagt Ihnen das?«
»Es ist eine Bande«, bemerkte Pérez.
»Und was macht diese Bande?«
»Drogenhandel«, antwortete er. »Die Hände abschneiden, das Gesicht wegätzen …«
»Aber Drogendealer nähen ihre Opfer normalerweise nicht in Leichentücher ein«, entgegnete Falcón. »In der Regel erschießen sie sie, und wir haben keine Schusswunde gefunden … nicht einmal eine Stichwunde.«
»Es wirkte nicht wie eine Hinrichtung«, meinte Ferrera, »eher wie eine bedauerliche Notwendigkeit.«
Falcón trug ihnen auf, gleich am nächsten Morgen, bevor alle zur Arbeit gegangen waren, noch einmal die Wohnungen mit Blick auf die Müllcontainer abzuklappern. Sie sollten herausfinden, ob einer der Container mit einer schwarzen Plastikplane ausgelegt gewesen war und ob jemand am Sonntagmorgen gegen drei Uhr einen Wagen in der Nähe gesehen oder gehört hatte.
Im Labor der Spurensicherung hatten Felipe und Jorge die Tische an die Wand geschoben und die schwarze Plastikplane auf dem Boden ausgebreitet. Auch die beiden großen Container aus der Calle Boteros standen bereits zugeklebt in einer Ecke. Jorge saß vor einem Mikroskop, während Felipe auf allen vieren auf der Plastikplane hockte und seine Spezialvergrößerungsbrille trug.
»Die Blutflecken auf dem weißen Tuch und der schwarzen Plane stammen nachweislich von dem Opfer. Wir hoffen, dass wir bis morgen früh auch die Bestätigung durch die DNA-Analyse haben«, führte Jorge aus. »Es sieht so aus, als hätte man ihn mit dem Gesicht nach unten auf die Plane gelegt, um die postmortale Operation durchzuführen.« Er nannte Falcón die auf der Plane gemessenen Abstände zwischen einem Speichelflecken, mehreren Blutflecken sowie zwei Schamhaaren, die alle der Körpergröße des Opfers entsprachen.
»Die haben wir auch zur DNA-Analyse gegeben«, sagte er.
»Was ist mit der Säure in seinem Gesicht?«
»Das muss anderswo gemacht und abgespült worden sein. Wir haben keinerlei Spuren gefunden.«
»Irgendwelche Fingerabdrücke?«
»Keine, nur der Abdruck eines Schuhs im oberen linken Quadranten«, antwortete Felipe. »Jorge hat das Profil als das eines Trainingsschuhs von Nike identifiziert, der von Tausenden von Menschen getragen wird.«
»Schafft ihr es heute Abend noch, euch die Container anzusehen?«
»Wir gucken mal rein, aber wenn das Opfer gut eingepackt war, mache ich mir keine großen Hoffnungen, Blut- oder Speichelspuren zu finden«, sagte Felipe.
»Haben Sie die Vermisstenanzeigen überprüft?«, fragte Jorge.
»Bis jetzt wissen wir nicht einmal, ob er ein Spanier war«, erwiderte Falcón. »Ich treffe morgen früh den Médico Forense. Hoffen wir, dass er irgendwelche besonderen Kennzeichen gefunden hat.«
»Sein Schamhaar war dunkel«, sagte Jorge grinsend. »Und er hatte die Blutgruppe 0 positiv… falls das weiterhilft.«
»Weiter so mit eurer phantastischen Arbeit«, sagte Falcón.
Es regnete noch immer, wenngleich nach dem wilden Chaos des ersten Gusses jetzt beinahe frustrierend pedantisch. Falcón erledigte abwesend ein wenig Papierkram, bevor er sich vom Computer abwandte und auf das Spiegelbild in dem dunklen Fenster seines Büros starrte. Das Neonlicht zitterte. Wieder prasselte eine Salve von Regentropfen gegen die Scheibe, wie eine Hand voll Kieselsteine, mit der ein Irrer auf sich aufmerksam machen wollte. Falcón war überrascht über sich selbst. In der Vergangenheit hatte er in seinen Ermittlungen immer großen Wert auf wissenschaftliche Methoden gelegt, war stets erpicht auf Obduktionsberichte und Laborergebnisse der Spurensicherungen gewesen. Inzwischen hörte er mehr auf seine Intuition. Er versuchte sich einzureden, dass das ein Zeichen von Erfahrung war, aber manchmal kam es ihm wie Faulheit vor. Das Vibrieren seines Handys riss ihn aus seinen Gedanken: eine SMS von seiner aktuellen Freundin Laura, die ihn zum Abendessen einlud. Als er auf das Display blickte, rieb er unwillkürlich den Arm, mit dem er im Eingang des Cafés Consuelos Körper berührt hatte. Er zögerte. Warum war auf einmal alles so viel komplizierter geworden? Er würde ihr von zu Hause aus antworten.
In dem Regen floss der Verkehr nur langsam. Im Radio wurde von der erfolgreichen Parade der Jungfrau von Rocío berichtet, die am selben Tag stattgefunden hatte. Falcón überquerte den Fluss und fädelte sich auf der Rampe ein. An einer roten Ampel machte er sich, ohne viel nachzudenken, eine Notiz, bog dann rechts in die Calle Reyes Católicos und fuhr weiter in das Gassenlabyrinth, wo er in einem riesigen Haus wohnte, das er vor sechs Jahren geerbt hatte. Er parkte zwischen den Orangenbäumen, die die Einfahrt zu dem Haus in der Calle Bailén säumten, stieg jedoch nicht aus. Wieder rang er mit seinem Unbehagen, und diesmal hatte es mit Consuelo zu tun – und mit dem, was er am Morgen in ihrem Gesicht gelesen hatte. Sie waren beide überrascht gewesen, aber in ihren Augen hatte er nicht nur den Schock des Wiedersehens erkannt. Sie hatte gequält ausgesehen.
Er stieg aus dem Wagen und trat durch die kleine, in das mit Messing beschlagene Eichentor eingelassene Tür in den Innenhof, wo die marmornen Pflastersteine noch vom Regen glänzten. Ein blinkendes Licht jenseits der Glastür zu seinem Arbeitszimmer sagte ihm, dass er zwei Nachrichten auf dem Anrufbeantworter hatte. Er drückte auf den Knopf, blieb im Dunkeln stehen und blickte durch den Säulengang auf die Bronzestatue des laufenden Jungen in der Mitte des Brunnens. Die Stimme seines marokkanischen Freundes Yacoub Diouri erfüllte den Raum. Er begrüßte Javier auf Arabisch, bevor er in perfektes Spanisch wechselte. Er wollte auf dem Weg nach Paris am kommenden Wochenende einen Zwischenstopp in Madrid einlegen und fragte, ob sie sich treffen könnten. War das ein Zufall oder eine schicksalhafte Koinzidenz? Er hatte Yacoub Diouri, einen der wenigen Männer, die ihm nahestanden, nur wegen Consuelo Jiménez kennen gelernt. Das war das Problem mit der Intuition, man begann zu glauben, dass alles bedeutsam war.
Die zweite Nachricht stammte von Laura, die immer noch wissen wollte, ob er an diesem Abend zum Essen kam; nur sie beide. Darüber musste er lächeln. Seine Beziehung zu Laura war keineswegs exklusiv. Sie hatte andere männliche Freunde, die sie regelmäßig traf, was ihm gut gepasst hatte … bis es jetzt aus keinem erkennbaren Grund plötzlich anders geworden war. Paella und eine Nacht mit Laura kamen ihm unvermittelt lächerlich vor.
Er rief sie an und sagte, dass er es nicht zum Essen schaffen, jedoch später auf einen Drink vorbeischauen würde.
Im Haus gab es auch nichts Essbares, weil seine Haushälterin angenommen hatte, dass er ausgehen würde. Er hatte den ganzen Tag noch nichts Vernünftiges zu sich genommen. Die Leiche auf der Müllkippe hatte seine Pläne fürs Mittagessen durchkreuzt und ihm bis auf Weiteres den Appetit verdorben. Aber jetzt verspürte er Hunger. Er machte einen Spaziergang. Die Straßen glänzten vom Regen und waren voller Menschen. Er dachte nicht darüber nach, wohin er ging, bis er sich auf der Rückseite der Kirche Omnium Sanctorum wiederfand und sich eingestehen musste, dass er in Consuelos neuem Restaurant essen würde.
Der Kellner brachte ihm die Speisekarte, und er bestellte sofort. Das pan de casa wurde schnell serviert; hauchdünn geschnittener Schinken auf einem Toast mit Salmorejo. Dazu genoss er ein Bier. Plötzlich kühn nahm er eine seiner Visitenkarten und schrieb auf die Rückseite: Ich esse hier. Vielleicht möchtest du dich auf ein Glas Wein zu mir setzen. Javier. Als der Kellner mit den revueltos de setas, Rührei mit Pilzen, zurückkam und ihm ein Glas roten Rioja einschenkte, gab Javier ihm die Karte.
Eine Weile später brachte der Kellner kleine Lammkoteletts und schenkte Wein nach.
»Sie ist nicht da«, sagte er. »Ich habe die Karte auf ihren Schreibtisch gelegt, damit sie weiß, dass Sie hier waren.«
Falcón wusste, dass er log. Das war einer der wenigen Vorteile am Beruf eines Ermittlers. Er aß die Koteletts und kam sich dumm vor, weil er an die Koinzidenz des Augenblicks geglaubt hatte. Er nippte an seinem dritten Glas Wein und bestellte einen Kaffee. Um zwanzig vor elf war er wieder auf der Straße. Er lehnte sich an die Mauer gegenüber dem Eingang ihres Restaurants und dachte, dass er sie vielleicht beim Herauskommen erwischen würde.
Als er geduldig so dastand und wartete, ging ihm vieles durch den Kopf. Es war schon erstaunlich, wie wenige Gedanken er seit dem Ende seiner Therapie vor vier Jahren auf sein Innenleben verschwendet hatte.
Als er seine einsame Wacht eine Stunde später aufgab, wusste er genau, was er tun wollte. Er war entschlossen, seine oberflächliche Beziehung mit Laura zu beenden, und wenn seine Arbeitswelt es zuließ, würde er alles daran setzen, Consuelo in sein Leben zurückzuholen.
ZWEI
Sevilla – Dienstag, 6. Juni 2006, 2.00 Uhr
Consuelo Jiménez saß im Büro ihres Hauptrestaurants im Herzen von La Macarena, dem alten Arbeiterviertel von Sevilla. Sie war nervös, woran auch die drei kleinen Gläschen The Macallan, die sie sich um diese Tageszeit zu trinken angewöhnt hatte, nichts änderten. Dass sie am Morgen mit Javier zusammengestoßen war, hatte auch nicht geholfen, und das Wissen, dass er keine zehn Meter entfernt von ihrem momentanen Sitzplatz zu Abend aß, hatte alles noch schlimmer gemacht. Seine Karte lag vor ihr auf dem Schreibtisch.
Sie erkannte ihren eigenen körperlichen und geistigen Zustand mit erschreckender Klarheit. Sie war kein Mensch, der nach einem tiefen Fall in ein Tal der Verzweiflung die Kontrolle verloren und sich unbewusst in eine Orgie der Selbstzerstörung gestürzt hatte. Dafür war sie zu gewissenhaft und zu distanziert. So distanziert, dass sie manchmal das Gefühl hatte, auf ihren eigenen blonden Schopf hinabzublicken, unter dem ihr Verstand durch die Trümmer ihres Innenlebens taumelte. Es war ein überaus seltsamer Zustand: körperlich für ihr Alter in guter Verfassung, geistig immer noch ganz auf ihr Geschäft konzentriert, wie immer gepflegt und elegant gekleidet, aber… wie sollte man es ausdrücken? Sie hatte keine Worte für das, was in ihrem Innern vor sich ging. Sie konnte es nur mit einem Bild aus einem Fernsehbericht über die globale Erwärmung beschreiben: Tragende Elemente der primitiven Struktur eines urzeitlichen Gletschers waren in einem ungewöhnlich heißen Sommer geschmolzen und gewaltige Eismassen ohne jede Warnung mit einem langgezogenen Grollen in einen See am Fuß des Gletschers gestürzt. Als sie das Gefühl überkam, ihre eigenen Organe würden ins Leere fallen, hatte sie eine Vorahnung dessen, was mit ihr selbst geschehen könnte, wenn sie nicht bald etwas unternahm.
Sie führte das Whiskyglas zum Mund und stellte es wieder auf den Tisch. Es war, als gehörte ihre Hand nicht zu ihr.
Sie war dankbar für das flüchtige Brennen des Alkohols, weil es sie daran erinnerte, dass sie noch ein empfindungsfähiges Wesen war. Sie spielte mit der Visitenkarte, drehte sie immer wieder um und rieb mit dem Daumen über den eingeprägten Namen und Titel. Ihr Geschäftsführer klopfte und kam herein.
»Wir sind jetzt fertig«, sagte er. »In fünf Minuten schließen wir ab. Hier gibt es nichts mehr zu tun … Sie sollten nach Hause gehen.«
»Einer der Kellner hat gesagt, dass der Mann, der am Abend hier war, draußen gewartet hat. Sind Sie sicher, dass er weg ist?«
»Ganz sicher«, antwortete der Geschäftsführer.
»Ich verlasse das Gebäude durch die Seitentür«, sagte sie und bedachte ihn mit einem harten, professionellen Blick.
Er zog sich zurück, und es tat Consuelo leid. Er war ein guter Mensch, der wusste, wann andere Menschen Hilfe brauchten, und auch, wann sie diese Hilfe nicht annehmen konnten. Was Consuelo bewegte, war viel zu persönlich, um es sich in einem halbstündigen Gespräch zwischen Inhaberin und Geschäftsführer von der Seele zu reden. Es ging nicht um unbezahlte Rechnungen oder schwierige Gäste. Es ging um … alles.
Sie wandte sich wieder der Visitenkarte zu, die einer Psychologin namens Alicia Aguado gehörte. Mit dieser Frau hatte Consuelo in den vergangenen anderthalb Jahren sechs Termine vereinbart und war zu keinem erschienen. Sie hatte jedes Mal einen anderen Namen genannt, aber Alicia Aguado hatte ihre Stimme vom ersten Anruf an erkannt. Natürlich. Sie war blind, und die Blinden bildeten ihre anderen Sinne aus. Bei den letzten beiden Malen hatte Alicia Aguado gesagt: »Wenn Sie das Gefühl haben, mich sehen zu müssen, rufen Sie unbedingt an. Ich werde Sie jederzeit einschieben – am frühen Morgen oder am späten Abend. Seien Sie versichert, dass ich immer für Sie da bin, wenn Sie mich brauchen.« Das hatte Consuelo schockiert. Alicia Aguado wusste Bescheid. Selbst Consuelos eisigster und geschäftsmäßigster Ton hatte noch ihre Hilfsbedürftigkeit verraten.
Ihre Hand griff nach der Flasche und goss das Glas noch einmal voll. Der Whisky stieg ihr in den Kopf. Sie wusste, warum sie gerade diese Psychologin konsultierte: Alicia Aguado hatte Javier Falcón behandelt. Der Zusammenprall mit ihm auf der Straße hatte sie daran erinnert. Aber woran genau? An die »Kurzaffäre«, die sie mit ihm gehabt hatte? So nannte sie das, was zwischen ihnen gewesen war, und von außen sah es auch so aus – ein paar Tage mit gutem Essen und wildem Sex. Dann hatte sie es beendet, weil… Sie wand sich auf ihrem Stuhl, als sie daran dachte. Welchen Grund hatte sie ihm genannt? Weil sie hoffnungslos verloren war, wenn sie sich verliebte? Weil sie sich in einen anderen Menschen verwandelte, wenn sie sich auf eine Beziehung einließ? Was auch immer, sie hatte sich etwas ausgedacht, worauf es keine Antwort gab, sich geweigert, ihn zu treffen oder seine Anrufe entgegenzunehmen. Und nun war er wie eine zusätzliche Motivation wieder aufgetaucht.
In den kurzen Augenblicken, in denen sie nicht wie eine Besessene arbeitete, machte sich seit neuestem ein weit beunruhigenderes Phänomen bemerkbar, das sie nicht ignorieren konnte. Wenn sie am Ende eines Tages abgelenkt oder müde war, dachte sie an Sex. Aber er war kein willkommener Gast, sondern eher ein mitternächtlicher Eindringling. Sie malte sich ständig neue, leidenschaftliche Affären mit Fremden aus. Ihre Phantasien tendierten zunehmend zu groben, potenziell gefährlichen Männern und nahmen regelrecht pornographische Züge an, wobei sie stets im Mittelpunkt der unvorstellbarsten Aktivitäten stand. Sie hatte Pornographie immer gehasst, weil sie sie sowohl abstoßend tierisch als auch langweilig fand, aber egal wie sehr sich ihr Verstand auch dagegen wehrte, sie spürte ihre Erregung: Speichel im Mund und ein Gefühl, das ihr die Kehle zuschnürte. Und nun passierte es wieder, sogar in einem Moment, in dem ihr Bewusstsein eigentlich anderweitig beschäftigt war. Sie stieß ihren Stuhl zurück, warf Aguados Visitenkarte in ihre Handtasche, schnappte sich ihre Zigaretten und zündete sich eine an. Hektisch rauchend lief sie in ihrem Büro auf und ab.
Diese Phantasien widerten sie an. Warum dachte sie solchen Schund? Warum nicht an ihre Kinder? An ihre drei geliebten Jungen Ricardo, Matías und Darío, die zu Hause von einem Kindermädchen behütet schliefen. Behütet von einem Kindermädchen! Nachdem Raúl, ihr Mann und Vater der Kinder, ermordet worden war, hatte sie sich geschworen, ihnen ihre ganze Aufmerksamkeit zu widmen, damit sie das Fehlen eines Elternteils gar nicht spürten. Und wo war sie gelandet? Sie saß in ihrem Büro und dachte ans Vögeln, während ihre Kinder in der Obhut einer anderen Frau zu Hause schliefen. Sie war es nicht wert, eine Mutter zu sein. Sie riss ihre Handtasche so heftig vom Schreibtisch, dass Javiers Karte zu Boden fiel.
Sie wollte im Freien sein und die regensaubere Luft atmen. Weil sie fünf oder sechs Gläschen The Macallan getrunken hatte, lief sie zu Fuß bis zur Basilica Macarena, um dort ein Taxi zu nehmen. Dabei musste sie an der Plaza del Pumarejo vorbei, wo den ganzen Tag bis tief in die Nacht ein Haufen Betrunkener und Drogensüchtiger herumlungerte. Die Plaza lag unter einem Dach von Bäumen, die von dem Gewitter am frühen Abend noch tropften. In ihrer Mitte erhob sich eine Plattform mit einem geschlossenen Kiosk auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hatten sich unweit der mit Rollläden verrammelten Bodega de Gamacho gut ein Dutzend Penner versammelt.
Die Luft strich kühl um Consuelos nackte, vom Whisky leicht taube Beine. Sie hatte nicht daran gedacht, wie auffällig ihr pfirsichfarbenes Seidenkostüm im Licht der Straßenlaternen wirken würde. Sie ging hinter dem Kiosk vorbei über den Bürgersteig vor dem alten Palacio del Pumarejo. Ein paar aus der Gruppe standen aus Flaschen trinkend um einen Wortführer herum, während andere benommen auf den Bänken herumlungerten.
Die sehnige Gestalt in der Mitte mit dem bis zum Bauchnabel offenen Hemd kam Consuelo bekannt vor. Seine Bemerkungen gegenüber seinem widerwärtigen Publikum klangen wie eine Rede; er verfügte über die rhetorische Gabe eines Politikers. Er hatte ein hageres, pockennarbiges Gesicht, seine Haare waren lang und schwarz, und seine Augenbrauen stießen in spitzem Winkel auf seine Nase. Sie wusste, warum die Gruppe so an seinen Lippen hing, und das hatte nichts mit dem Inhalt seiner Rede zu tun. Es waren die leuchtenden hellgrünen Augen, die unter seinen dunklen Brauen verborgen aus einem dunklen Gesicht starrten und jeden verunsicherten, auf den ihre Blicke fielen. Sie vermittelten den Eindruck eines Mannes, der schnell mit dem Messer zur Hand war. Er trank billigen Wein aus einer Flasche, die er, einen Finger in ihrem Hals, neben seinem Körper baumeln ließ.
Als Consuelo vor einem Monat an einer roten Ampel darauf gewartet hatte, die Straße zu überqueren, hatte er sich von hinten angeschlichen und ihr so unglaubliche Obszönitäten ins Ohr geflüstert, dass die Worte wie ein Messer in ihren Kopf stießen. Consuelo hatte laut protestiert. Aber im Gegensatz zu den üblichen Tätern, die sofort in der Menge der Einkaufenden untergetaucht wären, ignorierte er sie, trat ganz dicht an sie heran und brachte sie mit einem Blick seiner grünen Augen und einem Zwinkern, das sie glauben ließ, er wüsste etwas über sie, das sie selbst nicht wusste, zum Schweigen.
»Deine Sorte kenne ich«, hatte er gesagt und mit der Zunge einen Mundwinkel berührt.
Seine Unverfrorenheit hatte ihr die Stimme verschlagen. Das und der widerliche kleine Kuss, den er auf den Hals gedrückt hatte.
Abgelenkt von diesen Erinnerungen war Consuelo immer langsamer geworden und schließlich stehen geblieben. Einer der Penner entdeckte sie und wies mit dem Kopf in ihre Richtung. Der Redner trat auf das Geländer zu, hielt die Flasche hoch und ließ sie an seinem Zeigefinger baumeln.
»Wie wär’s mit einem Drink?«, fragte er. »Gläser haben wir leider nicht, aber du darfst mir den Wein von den Fingern lecken, wenn du willst.«
In der Gruppe, in der sich auch einige Frauen befanden, erhob sich gurgelndes Gelächter. Erschrocken setzte Consuelo ihren Weg fort. Der Mann sprang von der Plattform. Die Stahlkappen seiner Schuhe knallten auf das Kopfsteinpflaster. Er versperrte ihr den Weg und begann eine extrem anzügliche Sevillana mit jeder Menge Hüftstöße zu tanzen. Die anderen Penner klatschten dazu einen Flamencorhythmus.
»Komm, Doña Consuelo«, sagte er. »Ich will sehen, wie du dich bewegst. Du siehst aus, als hättest du ein ordentliches Paar Beine.«
Sie war entsetzt, ihn ihren Namen sagen zu hören. Panik ergriff sie und löste eine seltsame Erregung aus. Ihre Oberschenkelmuskeln zitterten, wirre Gedanken wirbelten in ihrem Kopf herum. Wie, zum Teufel, hatte sie sich in eine derartige Situation begeben können? Sie fragte sich, wie rau seine Hände waren. Er sah kräftig aus – potenziell gewalttätig.
Die schiere Perversion ihrer Gedanken brachte sie in die Realität zurück. Sie musste weg von ihm. Sie bog in eine Seitenstraße und lief schneller, als ihre Absätze auf dem Kopfsteinpflaster es erlaubten. Er folgte ihr mit entspannt klackenden Schritten.
»Verdammt noch mal, Doña Consuelo, ich habe dich nur um einen Tanz gebeten«, rief er ihr, die Anrede ironisch betonend, nach. »Und jetzt lockst du mich in diese dunkle Gasse. Himmel noch mal, wo bleibt deine Selbstachtung, Frau. Du solltest mir deine Bereitschaft nicht gleich so deutlich zeigen. Wir haben uns ja kaum kennen gelernt, ja noch nicht mal miteinander getanzt.«
Consuelo hastete schnell atmend weiter. Sie musste nur zum Ende der Straße gelangen und links gehen, dann hatte sie die Tore der Altstadt erreicht, wo jede Menge Autos und Fußgänger unterwegs waren… und von dort ein Taxi zurück in ihr wirkliches Leben in ihrem Haus in Santa Clara. Links tat sich eine weitere Gasse auf, durch die sie die Lichter der Hauptstraße zwischen den Gebäuden hindurchschimmern sah. Sie sprintete los, aber die Pflastersteine waren nass und rutschig, und sie verlor den Halt. Sie wollte schreien, als seine Hand schließlich ihre Schulter packte, aber es war wie in diesen Träumen, in denen man, wenn man mit seinem Schrei die ganze Nachbarschaft wecken müsste, nur ein ersticktes Wimmern herausbringt. Er drängte sie an eine Mauer, deren weiße Farbe abblätterte, als ihre Wange sie berührte. Ihr Herz pochte wie wild.
»Hast du mich beobachtet, Doña Consuelo?«, fragte er, und sein Gesicht tauchte über ihrer Schulter auf, sodass sein weinsaurer Atem ihr in die Nase stieg. »Hast du heimlich nach mir Ausschau gehalten? Vielleicht ist dein Bett… nach dem Verlust deines Mannes nachts ein bisschen kalt.«
Ihr Atem stockte, als er seine Hand zwischen ihre nackten Beine schob. Sie war rau. Reflexartig presste sie ihre Schenkel zusammen. Er schob seine Hand mit Gewalt bis zu ihrer Scham. Eine Stimme in ihrem Kopf schalt sie für ihre Dummheit. Ihr Herz schlug ihr bis zum Hals, während ihr Verstand stumm schreiend nach Worten suchte.
»Wenn Sie Geld wollen…«, flüsterte sie gegen die abblätternde Farbe.
»Na ja«, meinte er, »wie viel hast du denn? Ich bin nicht billig, musst du wissen. Speziell für die Art Sachen, auf die du stehst.«
Er nahm ihr die Handtasche von der Schulter, öffnete sie und fand ihr Portemonnaie.
»Hundertzwanzig Euro!«, sagte er angewidert.
»Nehmen Sie sie«, flüsterte sie mit erstickter Stimme.
»Danke, vielen herzlichen Dank«, erwiderte er und ließ die Handtasche fallen. »Aber das reicht nicht für das, was du willst. Morgen bringst du den Rest mit.«
Er drängte sich an sie, und sie spürte seine obszöne Erektion an ihrem Po. Sein Gesicht tauchte wieder über ihrer Schulter auf, und er küsste sie auf den Mundwinkel, wobei sich der Gestank von Wein und Tabak und seine bittere kleine Zunge zwischen ihre Lippen schoben.
Als er sich von der Mauer abstieß, sah sie aus dem Augenwinkel einen kleinen goldenen Ring an seinem Finger aufblitzen. Er trat einen Schritt zurück und kickte ihre Handtasche ein Stück die Straße entlang.
»Verpiss dich, du Nutte«, sagte er. »Bei dir wird mir schlecht.«
Die Stahlkappen entfernten sich. Consuelos Herz schlug noch immer bis zum Hals. Sie blickte in die Richtung, in die er verschwunden war, verwirrt über ihr unverhofftes Entkommen. Das leere Kopfsteinpflaster schimmerte gelb im Licht der Laternen. Sie stieß sich von der Wand ab, hob ihre Handtasche auf und rannte rutschend und humpelnd die Gasse hinunter bis zur Hauptstraße, wo sie ein Taxi heranwinkte. Sie setzte sich auf den Rücksitz. Die Lichter der Stadt glitten über ihr blasses Gesicht. Ihre Hände zitterten so stark, dass sie es nicht schaffte, die Zigarette anzuzünden, die sie sich in den Mund gesteckt hatte. Schließlich gab ihr der Fahrer Feuer.
Zu Hause fand sie in ihrem Schreibtisch Bargeld, um ihn zu bezahlen. Dann rannte sie nach oben und sah nach ihren schlafenden Jungen, bevor sie in ihr Zimmer ging, sich auszog und im Spiegel betrachtete. Er hatte keine Spuren auf ihr hinterlassen. Trotzdem duschte sie endlos und seifte sich immer wieder neu ein.
Im Bademantel kehrte sie an ihren Schreibtisch zurück, saß mit einem Gefühl von Übelkeit und Kopfschmerzen in der Dunkelheit und wartete auf die Dämmerung. Sobald ihr die Uhrzeit halbwegs akzeptabel erschien, rief sie Alicia Aguado an und bat um einen Notfalltermin.
DREI
Sevilla, Dienstag, 6. Juni 2006, 2.00 Uhr
Esteban Calderón war nicht dienstlich unterwegs. Der weltgewandte und erfolgreiche Staatsanwalt hatte seiner Frau Inés erklärt, dass er bis spät im Büro zu tun haben und dann mit einer Gruppe junger Staatsrichter aus Madrid zu Abend essen würde, die sich zu einem Lehrgang in der Stadt aufhielten. Er hatte spät im Büro zu tun gehabt und war zu dem Abendessen gegangen, hatte sich jedoch früh entschuldigt und folgte nun seinem kleinen Lieblingsumweg entlang der Plaza San Marcos zum »Penthouse der Phantasien« mit Blick über die Santa-Isabel-Kirche. Normalerweise genoss er es, am Rand der kleinen erleuchteten Plaza eine Zigarette zu rauchen und aus der Dunkelheit auf den Brunnen in der Mitte und das massive Portal der Kirche zu blicken. Das beruhigte ihn nach einem langen Tag mit Polizisten und Staatsanwälten und hielt ihn auch von einigen Lokalen gleich um die Ecke fern, in denen seine Kollegen verkehrten. Wenn man ihn dort sah, würde Inés davon erfahren, und er müsste sich unangenehmen Fragen stellen. Außerdem brauchte er einen Moment, um seine sexuelle Erregung zu zügeln, die jeden Morgen begann, wenn er beim Aufwachen an die langen kupferbraunen Haare und die Mulattenhaut seiner kubanischen Geliebten Marisa Moreno dachte, die in dem Penthouse wohnte, das er von seinem Platz aus gerade noch sehen konnte.
Seine halb gerauchte Zigarette erlosch zischend in einer Pfütze, in die er sie geschnippt hatte. Er zog sich das Jackett aus. Eine leichte Brise wehte ein paar Wassertropfen von den Orangenbäumen auf seinen Rücken, und die unvermittelte Kälte ließ seinen Atem stocken. Er blieb im Schatten der Kirchenmauern, bis er in die Dunkelheit der schmalen Straße eintauchte. Als sein Finger über dem obersten Klingelknopf schwebte, ließ ihn eine Flut von Gedanken und Empfindungen zögern: List und Lüge, Ehebruch, Angst, Sex und Taumel. All das machte ihn unschlüssig, und er hatte plötzlich das Gefühl, auf der Schwelle einer großen Veränderung zu stehen. Was tun? Über den Rand treten oder zurückweichen. Er schluckte dicken, von seiner zu schnell gerauchten Zigarette bitteren Speichel hinunter. Der sinnliche Schauer der kalten Regentropfen auf seinem Rücken erreichte die Nerven an der unteren Wirbelsäule. Das Unbehagen verflog. Plötzlich fühlte er sich wieder lebendig, und sein Schwanz pulsierte in der Hose. Er drückte auf den Klingelknopf.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!