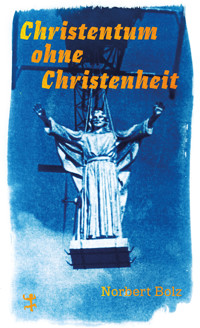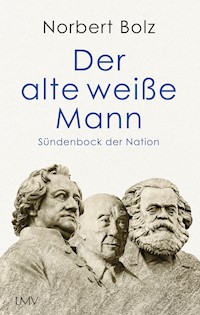2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: REDLINE
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Vieles verdanken wir dem Spielen: Kultur, Kreativität, Lebensfreude. Vom Lotto über Spiele-Apps auf dem Handy bis hin zum sportlichen Wettkampf – es gibt heute unzählige Möglichkeiten, unserem Spieltrieb nachzugehen. Norbert Bolz zeigt dem Leser anschaulich die verschiedenen Arten von Spielen – beliebte wie umstrittene – und ihre meist positiven Auswirkungen auf uns. Er belegt, warum Fußball, Glücksspiele und Social Games uns stark machen. Neue Entwicklungen wie das Phänomen der »Gamification« – man löst reale Probleme, indem sie in Spiele transformiert werden – machen deutlich, warum das Spielen so lebenswichtig ist. Wer nicht spielt, ist krank bietet einen einzigartigen Einblick in die geheimnisvolle Welt des Spielens und zeigt, wie faszinierend und unersetzlich es für jeden Einzelnen ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Norbert Bolz
Wer nicht spielt, ist krank
Warum Fußball, Glücksspiel und Social Games lebenswichtig für uns sind
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
1. Auflage 2014
© 2014 by Redline Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH,
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung, vorbehalten. Die Übersetzung ist in Absprache mit dem Verlag und dem Autor für nicht kommerzielle Nutzung möglich. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Matthias Michel, Wiesbaden
Umschlaggestaltung: Maria Wittek, unter Verwendung von shutterstock.com
Satz: EDV-Fotosatz Huber/Verlagsservice G. Pfeifer, Germering
Druck: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany
ISBN Print 978-3-86881-571-9
ISBN E-Book (PDF) 978-3-86414-692-3
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-86414-693-0
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.redline-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Imprints unter
www.muenchner-verlagsgruppe.de
Inhalt
Vorwort
I. Wie geht es dem Homo ludens heute?
Für eine fröhliche Wissenschaft des Spiels
Wer nicht spielt, ist krank
Warum wir in einem Gefühlsvakuum leben
Die Lust am befreiten Unsinn
Warum der Krieg gegen die Glücksspiele scheitert
Was heißt eigentlich »Spielsucht«?
Die Spielverderber aus Politik und Wissenschaft
II. Warum uns Spiele faszinieren
Die Funktionslust des Spielens
Wer schlägt Bayern München?
Der Spieler lebt in zwei Welten zugleich
Die vier Grundformen: Glücksspiel, Wettkampf, Schauspiel, Angstlust
Die Tiefe des Spiels liegt auf seiner Oberfläche
Die leidenschaftliche Verpflichtung durch die Regel
Im Spiel werde ich durch Bindung frei
Warum Spielverderber schlimmer sind als Falschspieler
III. Lob der Zufallsspiele
Der Sex-Appeal des Zufalls
Der absolute Glücksfall
Warum Menschen gegen Automaten spielen
Der Verlierer ist kein Versager
Das Erlebnis schlechthin
Der Jackpot ist die unendliche Chance
Wir wollen betrogen werden
IV. Das Asyl der großen Gefühle
»Das dritte, fröhliche Reich des Spiels«
Wo die großen Gefühle inszeniert werden
Je bequemer das Leben, desto lustloser
Ohne Angst gefährlich leben
Das Spiel ist nicht der Gegensatz zu Ernst
Wie Spielfreude entsteht
V. Sport, Spiel, Spannung
Heroische Männlichkeit aus zweiter Hand
Im Sport findet der Kampf um Anerkennung statt
Der Sport rettet den Körper
Das Spiel ist das Paradies des Wesentlichen
VI. Wir tauchen in die Bildschirme ein
Jeder könnte der Star sein
Wirklicher als die Wirklichkeit
Der Spaß am Exhibitionismus und Voyeurismus
Die Simulation ist das massendemokratische Erlebnis
»Du sollst spielen!«
Der Computer ist das Universalspielzeug
VII. Das Spiel bricht in die Wirklichkeit ein
Die ganze Welt ist eine Bühne
Die Spieltheorie und das Gefangenendilemma
Was heißt Gamification?
Serendipität oder die Freude am X
Warum es Spaß macht, im Kasino des Kapitalismus zu arbeiten
Der Krieg ist ein Computerspiel
VIII. Das elfte Gebot
IX. Was Sie getrost vergessen können
X. Was Sie unbedingt lesen sollten
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Vorwort
Wer nicht spielt, lebt nicht.
Alles, was wirklich wertvoll ist, verdanken wir dem spielenden Menschen: Kultur, Kreativität und Lebensfreude. Früher wussten wir das, und erst als das 19. Jahrhundert die Religion der Arbeit predigte, haben wir es vergessen. Der Komfort der Wohlstandsgesellschaft hat dann vollends die Lust aus unserem Leben ausgetrieben. Hinzu kommt heute eine puritanische Lustfeindlichkeit der Politik, die auch noch unser Privatleben regulieren möchte, weil sie glaubt, besser zu wissen, was gut für uns ist. Indem wir spielen, revoltieren wir gegen diesen Paternalismus.
Spiele faszinieren, weil sie uns ins Paradies des Wesentlichen entführen. Das Wesentliche aber ist nicht das Nützliche! Der Spielplatz ist eine gehegte Lebenswelt, in der alles mit rechten Dingen zugeht. Die Spielregel garantiert eine gute Ordnung, in der man immer genau weiß, was zu tun ist. Und deshalb ist die Spielwelt »besser« als die Wirklichkeit. Faszinierend sind Spiele, weil man als Spieler total fokussiert ist und völlig in ihnen aufgehen kann. Sie bieten das absolute Erlebnis des erfüllten Augenblicks und setzen die großen Gefühle frei, die wir im Alltag gar nicht mehr unterbringen können. Die Spielfreude zeigt uns den Weg zum Glück.
Es ist eine weitverbreitete Dummheit, die aus einer Verkennung der menschlichen Natur entspringt, das Spielen nur im Kontext von »Gesundheit« oder »Lernen« zu diskutieren. Natürlich kann es gesund sein, wenn man Tennis spielt. Und natürlich kann man auch etwas lernen, wenn man World of Warcraft spielt. Aber es geht im Spielen doch um etwas ganz anderes, nämlich um Lebensfreude. Das kann man sich am besten an den Glücksspielen klarmachen. Sie sind spezifisch menschlich. Im Glücksspiel sind alle Menschen gleich, sie lassen sich vom Sex-Appeal des Zufalls faszinieren.
Diese Themen behandle ich in den ersten vier Kapiteln. Die letzten Kapitel greifen die drei Motive auf, die mich dazu gebracht haben, dieses Buch zu schreiben.
Da ist, erstens, meine eigene Spielbegeisterung. Ich bin eigentlich für jedes Spiel zu haben, bei dem es um Siegen und Verlieren geht, und vor allem bin ich ein leidenschaftlicher Fußballfan. Deshalb habe ich dem Sport ein eigenes Kapitel gewidmet, das eigentlich ein Aufruf ist: Rettet die Natur des Menschen!
Da ist, zweitens, die Forschungsarbeit meiner Assistentin Johanna Lange. Sie hat sich auf ein medienwissenschaftliches Gebiet konzentriert, das ich lange sträflich vernachlässigt habe, nämlich die Computerspiele. Dass es hier nicht nur um eine Freizeitbeschäftigung, sondern um ein völlig neues Verhältnis zur Welt geht, habe ich erst durch sie begriffen.
Und da ist, drittens, eine wahrhaft kulturrevolutionäre Bewegung, die sich »Gamification« nennt. Hier verwischen sich die Grenzen zwischen Spielwelt und Alltagswirklichkeit. Man versucht, reale Probleme zu lösen, indem man sie in Spiele verwandelt. Das gilt für die Wirtschaft und die Bildung, aber auch für das Militär.
Dieser Einbruch des Spiels in die Wirklichkeit wird dem spielenden Menschen wieder die Aufmerksamkeit verschaffen, die ihm die moderne Welt vorenthalten hat. Dazu will ich einen ersten Anstoß geben. Die fröhliche Wissenschaft des Spiels, die ich hier biete, ist eine Theorie der Lebensfreude. Und die einfache Botschaft dieses Buches lautet: Wenn du gerne spielst – tu es mit gutem Gewissen!
I. Wie geht es dem Homo ludens heute?
Für eine fröhliche Wissenschaft des Spiels
Spielen ist der reinste Ausdruck von Lebensfreude. Millionen kreuzen jede Woche »ihre« Zahlen auf dem Lottoschein an, Gameshows beherrschen das Fernsehprogramm, Computerspiele haben Hollywood den Rang abgelaufen und einer der Schlüsselbegriffe unserer Zeit lautet »Gamification«; ich komme am Ende dieses Buches noch ausführlich darauf zurück. Das Spielen ist allgegenwärtig – schon ein Smartphone genügt dazu. Hunderttausende strömen regelmäßig in die Stadien der Fußballbundesliga, und wenn die Nationalmannschaft antritt, schaut mindestens die halbe Nation zu. Was das bedeutet, ist klar: Die Leute wollen spielen und Spiele sehen. Denn das Spiel ist das große Stimulans des Lebens.
Homo ludens heißt »der spielende Mensch«. Ich behalte den lateinischen Ausdruck bei, nicht aus akademischem Imponiergehabe, sondern weil seine Gegenspieler ebenfalls beeindruckende lateinische Namen bekommen haben. Da ist, erstens, der Homo oeconomicus, also der vollständig informierte, Kosten und Nutzen abwägende, rational entscheidende Marktteilnehmer, der auf die Gesetze von Angebot und Nachfrage reagiert. Und da ist, zweitens, der Homo sociologicus, das heißt der Mensch als Träger sozial vorgegebener Rollen, der Schauspieler auf der Bühne des Alltags, dessen Verhalten von den Erwartungen der anderen gesteuert wird und der sich zeitlebens in den Netzen der sozialen Kontrolle verstrickt. Meine These lautet nun ganz einfach: Lebensfreude ist nicht die Sache des Homo oeconomicus oder des Homo sociologicus, sondern des Homo ludens. Und wer nichts von den Freuden des Lebens versteht, versteht die Natur des Menschen nicht.
Ich denke, es gehört zu den unbestreitbaren Lebenserfahrungen, dass Menschen, die keinen Sinn für Spiele haben, oftmals die Liebenswürdigkeit fehlt. Schon vor einem halben Jahrhundert hat der erste bedeutende Medientheoretiker, der Kanadier Marshall McLuhan, sogar erklärt: Eine Gesellschaft ohne Spiele versinkt in die »Zombie-Trance« eines leeren, automatischen Funktionierens. Und wenn wir daraus auftauchen wollen, müssen wir spielen. Nur die Spielfreude zeigt den Weg zum ganzen Menschen. Diese These geht bekanntlich auf Friedrich Schillers Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen zurück und sie scheint mir aktueller denn je. Dass der Mensch nur ganz Mensch ist, wenn er spielt, wird heute mit dem Begriff »Immersion« bezeichnet. Gemeint ist die Magie des totalen Involviertseins. Es handelt sich hier also nicht einfach um eine Freizeitbeschäftigung. Spielst du noch Spiele oder lebst du sie schon? Ich werde in den Schlussabschnitten dieses Buches am Beispiel der Computerspiele zeigen, wie die Magie der Immersion gegen die »Zombie-Trance« des gesellschaftlichen Funktionierens eingesetzt werden kann.
Nun könnte man eigentlich erwarten, dass die ungeheure Bedeutsamkeit des Spielens für das Leben der Menschen von den Politikern respektiert und von den Wissenschaftlern analysiert wird. Das Gegenteil ist aber der Fall. Die Wissenschaft nimmt Spiele nicht ernst, oder sie produziert einen Alarmismus der »Suchtgefahr«. Die Kulturkritik jammert über die spätrömische Dekadenz von »Brot und Spiele«. Und die Politik bekämpft die Glücksspiele – um doch als Monopolist zugleich dabei abzukassieren, indem er sie entweder betreibt oder doch zumindest dadurch zusätzliche Abgaben kassiert. Warum das so ist, lässt sich leicht erklären. Wer in der Politik die Aufmerksamkeit der Wähler gewinnen will, muss Probleme erfinden. Wer in den Medien hohe Quoten erzielen will, muss Katastrophen ankündigen. Wer sich in den Wissenschaften Forschung finanzieren lassen will, muss Alarm rufen. Es ist deshalb heute unendlich wichtig, dass einige Journalisten sich noch in der Tradition der Aufklärung verstehen und einige Universitätsprofessoren noch der Versuchung widerstehen, als Gefälligkeitswissenschaftler in den Dienst der Warner und Mahner zu treten.
Kurzum: Journalisten sollten nicht belehren, sondern berichten. Wissenschaftler sollten nicht alarmieren, sondern analysieren. Auf die Politiker komme ich gleich noch ausführlich zu sprechen.
Vielleicht findet die Wissenschaft deshalb keinen Zugang zur Welt des Spiels, weil sich jedes Spiel klar vom Ernst des Lebens abgrenzt. Es scheint dabei nur um Freizeitbeschäftigung und Unterhaltung zu gehen. Nun ist es zwar richtig und trivial, dass man in der Freizeit spielt und dass Spiele unterhaltend sind. Doch das führt uns nicht zum Kern der Sache. Warum uns Spiele faszinieren, wird nur klar, wenn wir die Untersuchung tiefer anlegen – und zwar mindestens so tief, wie das der holländische Kulturhistoriker Johan Huizinga mit seinem Buch Homo Ludens (1938) und der französische Philosoph und Soziologe Roger Caillois mit seinem Buch Les jeux et les hommes (1958; dt.: »Die Spiele und die Menschen«) versucht haben. Es sagt übrigens schon fast alles über das Verhältnis der Wissenschaft zur Welt der Spiele, dass seither keine relevante Monografie mehr zu unserem Thema erschienen ist.
Ich will mit diesem Buch eine fröhliche Wissenschaft des Spiels bieten. Das ist deshalb schwierig, weil es offenbar eine Aversion des begrifflichen Denkens gegen die spielerische Fantasie gibt. Der Philosoph Eugen Fink meint sogar: »Der spielende Mensch denkt nicht und der denkende Mensch spielt nicht.« Das ist sicher nicht ganz richtig, benennt aber doch ein wichtiges Problem. Der Philosoph will in der Regel nichts vom Spiel wissen. Und der Spieler braucht keine Philosophie, denn wer spielt, muss sich nicht rechtfertigen. Aber es gibt doch ein paar bedeutsame Ausnahmen, auf die ich gleich zu sprechen kommen werde. Bei der Ankündigung einer fröhlichen Wissenschaft denkt der gebildete Leser natürlich sofort an Nietzsche. Und tatsächlich glaube ich, dass Nietzsches Philosophie funktioniert – nämlich als Theorie des Spiels. Seine berühmten Thesen über die ewige Wiederkehr des Gleichen, die Unschuld des Werdens und die Oberflächlichkeit aus Tiefe machen alle einen guten Sinn, wenn man sie auf den Homo ludens bezieht.
Wer nicht spielt, ist krank
Die Psychoanalyse wollte nicht nur den neurotischen Einzelnen analysieren, sondern auch eine Pathologie des Zivilisationsprozesses insgesamt bieten. Und hier ist Sigmund Freuds Studie aus dem Jahre 1930 über das Unbehagen in der Kultur immer noch unübertroffen. Die Studie sollte wohl ursprünglich »Das Unglück in der Kultur« heißen, und dieser Titel wäre treffender gewesen. Es geht darin nämlich nicht bloß um das »Nebenprodukt« Unbehagen, sondern um das eigentliche Resultat des Zivilisationsprozesses. Auf der Suche nach den Gründen für das Unglück in der Kultur hat Freud vor allem die Triebunterdrückung herausgearbeitet. Das klingt heute, im Zeitalter der sexuellen Freizügigkeit, vielleicht nicht mehr so überzeugend wie im Wien des frühen 20. Jahrhunderts. Ich werde den Akzent aber auf ein anderes Motiv legen, nämlich auf das, was der Paläoanthropologe Rudolf Bilz »Stimulationsverarmung« genannt hat. Wir sind so unglücklich, weil es uns an Erregung fehlt. Oder anders formuliert: Es fehlt uns heute weder an Triebfreiheit noch an Wohlstand, sondern an innerer Motivation.
In einem sich über Jahrhunderte erstreckenden Zivilisationsprozess haben Aufklärung und Wissenschaft die Welt entzaubert. Und wir ertragen es nur, in dieser entzauberten Welt zu leben, weil es Unterhaltung gibt. Politische Sicherheit, technischer Fortschritt und wirtschaftlicher Wohlstand haben die Welt langweilig gemacht. Und wir ertragen es nur, in dieser langweiligen Welt zu leben, weil es Unterhaltung gibt. Entertainment ist also die große Kompensation, die uns das Leben lebenswert macht. Und im Zentrum der Unterhaltung steht das Spiel. Das ist die Ausgangsthese meiner Überlegungen.
Jeder kennt das Krankheitsbild, das dem Unglück in der Kultur entspricht: die Depression. Und es gibt kein besseres Heilmittel gegen die Depression als die Spielfreude. Die Spiele-Designerin Jane McGonigal sagt: Niemand ist immun gegen Langeweile und Einsamkeit, Angst und Depression. Spiele können diese Probleme lösen. Umgekehrt bedeutet das aber: Wer nicht spielt, ist krank. Oder er wird krank. Der amerikanische Soziologe William I. Thomas hat vier fundamentale Wünsche unterschieden, die unser Leben antreiben: Abenteuer, Sicherheit, Anerkennung und Antwort. Das Spiel erfüllt alle diese Wünsche. Den Wunsch nach Abenteuer erfüllt der Thrill, die Aufregung, sei es im Computerspiel, sei es im Glücksspiel. Den Wunsch nach Sicherheit erfüllt das Spiel durch seine strengen Regeln und klaren Grenzen. Den Wunsch nach Anerkennung erfüllt der Wettkampf. Und den Wunsch nach Antwort erfüllt das Spiel durch das unmittelbare Feedback, das wir nach jedem Spielzug bekommen. Spielen ist eine Handlung, die sich selbst belohnt.
Der Auszug aus der entzauberten Welt führt heute nicht mehr nach Utopia, sondern ins Abenteuerland der Spiele, und das heißt heute vor allem in die Welt der Glücksspiele und der Computerspiele. Das wird von den Kulturkritikern gerne als Eskapismus, als feige Fluchtbewegung gebrandmarkt. Aber gegen diese Eskapismus-Kritik gibt es zwei starke Argumente. Erstens: Wer spielt, verschont die Wirklichkeit. Ich schließe hier an eine pfiffige Marx-Parodie des skeptischen Philosophen Odo Marquard an, der selbst ein Homo ludens des Geistes war. Die Kulturkritiker haben die Welt immer nur verschieden interpretiert – es kommt darauf an, sie zu verschonen. Indem wir spielen, verschonen wir die Wirklichkeit. Und zweitens: Es gibt nichts Subversiveres als spielerische Leichtigkeit. Schauen wir uns nur einmal die Welt des Feuilletons an, auf Deutsch »Blättchen« und so die Leichtigkeit schon im Namen tragend. Ironie und Selbstironie sind Spielformen des Geistes, die der stumpfen Prosa der Warner und Mahner turmhoch überlegen sind. Wer von den 68ern ist denn heute noch lesbar? Nur der Homo ludens Hans Magnus Enzensberger, der schon damals die ironische Freiheit hatte, mit dem Marxismus zu spielen. Und heute trösten uns über die puritanische Tristesse der politischen Korrektheit nur die spielerisch leichten Federn von Henryk M. Broder in der Welt, Jan Fleischhauer im Spiegel und Michael Klonovsky im Focus.
Warum wir in einem Gefühlsvakuum leben
Einer der spannendsten Ansätze zu einer Neubewertung des spielenden Menschen stammt von dem Psychologen Karl Bühler. In seinem 1918 erschienenen Buch über die geistige Entwicklung des Kindes gibt es einen Abschnitt mit dem Titel »Genießen, Spielen, Schaffen«. Das ist eine außerordentlich interessante Dreiteilung. Das Genießen entspricht in unserem Alltag offenbar dem Konsum und das Schaffen der Arbeit. Wie aber steht es mit dem Spielen? Ich entwickle aus Bühlers Dreiteilung eine einfache These: Das 19. Jahrhundert war das Zeitalter des Produzenten. Das 20. Jahrhundert war das Zeitalter des Konsumenten. Das 21. Jahrhundert wird das Zeitalter des Spielers sein. Diese These stütze ich auf zwei Beobachtungen. Erstens: Die moderne Welt ist für die meisten Menschen offenbar nur durch Unterhaltung zu ertragen. Und zweitens: Das Spiel dringt heute als Kreativitätspotenzial in die Wirklichkeit ein. Zum Verständnis unserer Gesellschaft brauchen wir eine Theorie des Spielens. Die Ökonomen haben die Produzenten analysiert, die Trendforscher haben die Konsumenten analysiert. Nun ist es an der Zeit, sich dem Spieler verstehend zu nähern.
Auch wenn wir zu unserem Thema sehr viel von den Anthropologen lernen können und das Spielen ohne Zweifel zu den großen menschlichen Universalien gehört, so ist die kulturelle Bedeutsamkeit des Spiels in der Geschichte doch großen Schwankungen unterworfen. Und es gibt wohl keinen größeren Gegensatz in der Bewertung des Spielens als den zwischen der Welt des Adels und dem Puritanismus. Der Soziologe Max Weber hat das in seinem Hauptwerk über Wirtschaft und Gesellschaft sehr klar herausgearbeitet. Für die feudale Lebensführung war Spielen von größter Bedeutung, nämlich nicht als bloßer Zeitvertreib, sondern als eine Art Training, das den ganzen Organismus lebendig und geschmeidig hielt. Im adligen Spiel waren Körper und Seele, Geist und Materie noch nicht getrennt.
Die entscheidende Einsicht Max Webers ist die, dass in der Moderne jede Rationalisierung des Lebens versucht, das Spiel auszuschalten. Der spielmäßigen Lebensführung des Adligen tritt nun die rationale Fachschulung des Bürgers gegenüber. Und seither gilt das Spiel als »Gegenpol alles ökonomisch rationalen Handelns«, und das heißt eben als unnütz und als Luxus. Den Zangenangriff von Reformation und Kapitalismus konnte die adlige Spielform des Lebens nicht überstehen. Den lustfeindlichen Puritanern verdankt unser Kapitalismus ja seinen »Geist«. Mit ihnen beginnt dann eine »im denkbar weitgehendsten Maße in alle Sphären des häuslichen und öffentlichen Lebens eindringende, unendlich lästige und ernst gemeinte Reglementierung der ganzen Lebensführung«. So Max Weber. Für den puritanischen Tyrannen damals wie heute erscheint also das Spielen als bloße Zeitvergeudung und damit als schwerste Sünde.
Die Puritanismus ist tatsächlich der Schlüssel zu unserem Problem. Werfen wir einen Blick in das bereits 1977 erschienene, aber immer noch lesenswerte Buch des Sozialwissenschaftlers Albert O. Hirschman über die Entstehung des Kapitalismus. Das schlanke Werk trägt den präzisen Titel The Passions and the Interests (dt.: »Leidenschaften und Interessen«). Hirschman hat nämlich das Erfolgsgeheimnis des Kapitalismus in den puritanischen Lebenstechniken gefunden, die die Leidenschaften (passions) zum Selbstinteresse (interests) rationalisieren. Das Buch schmückt ein Kupferstich aus der Emblemata Politica des Stechers und Verlegers Peter Iselburg aus dem Jahre 1617. Er zeigt ein von einer eisernen Zange umfasstes Herz und trägt die lateinische Aufschrift »Affectus Comprime«. Zu Deutsch etwa: Bezwinge die Leidenschaft! Und genau darum geht es. Der puritanische Kapitalismus hat den Menschen »eindimensional«, nämlich berechenbar gemacht, indem er ihn zwang, seine Triebe und Neigungen einem strengen Selbstregiment zu unterwerfen.
Hirschman spricht geradezu von einem Exorzismus des vollen, »ganzen« menschlichen Lebens. Die Welt ist dadurch leer und langweilig geworden, und seither leben wir in einem Gefühlsvakuum. Das haben wir als Preis der Moderne akzeptieren müssen. Aber wir konnten es nur akzeptieren, weil uns die Kultur künstliche Paradiese der großen Leidenschaften angeboten hat. Der Zivilisationsforscher Norbert Elias hat in diesem Zusammenhang von einer lustvollen und kontrollierten Aufhebung der Kontrolle über die Gefühle gesprochen. Das heißt, die Erregung bleibt im Rahmen des Spiels. Die Lust des Spielens entsteht durch einen kontrollierten Kontrollverlust. Ich komme darauf noch ausführlich zurück.
Unsere Gefühle und Leidenschaften sind unendlich viel älter als die Zivilisation. Stellen wir uns also einmal die Fragen: Wo sind unsere Gefühle zu Hause? Wo ist unsere evolutionäre Heimat? Die Antworten auf diese Fragen geben nicht die Historiker und Sozialwissenschaftler, sondern unsere Spiele. Jedes Spiel weckt die reinen, starken Gefühle, die wir in der modernen Gesellschaft nicht mehr ausleben können. Die große Erregung hat es heute gleich mit zwei mächtigen Feinden zu tun. Da ist, erstens, die Kulturtechnik der Selbstkontrolle, die das Alltagsleben rationalisiert und gerade in der Quantified-Self-Bewegung einen gespenstischen Extremwert erreicht. In Massendemokratien gibt es kein Handeln mehr, sondern nur noch Verhalten. Deshalb ist die Wirtschaft zum dominierenden sozialen System geworden und die Statistik zur wichtigsten Wissenschaft. Dieses Thema ist mittlerweile gut erforscht. Wer hier mehr erfahren möchte, sollte die Analysen von Max Weber, Albert O. Hirschman und Norbert Elias, aber auch die Arbeiten des französischen Philosophen Michel Foucault und des österreichischen Journalisten Rudi Klausnitzer lesen. Da ist, zweitens, der Staat mit seiner Forderung von Regulierung und Normung, die in den letzten Jahrzehnten immer deutlicher paternalistische Züge angenommen hat. Dieses Thema ist leider weniger gut erforscht, und deshalb werde ich gleich ein paar Thesen dazu entwickeln.
Die Lust am befreiten Unsinn
Kinder spielen mit gutem Gewissen, Erwachsene nicht. Zwar sind die Menschen von Spielen fasziniert und sie sehen auch gerne anderen bei Spielen zu. Aber auf die Spielfreude fällt meistens der Schatten des schlechten Gewissens. Sollte ich nicht, statt mich in mein Computerspiel zu vertiefen, ein gutes Buch lesen? Verplempere ich nicht meine Zeit, wenn ich zur Skatrunde gehe? Und wem wäre es nicht peinlich, wenn er beim Verlassen eines Automatenkasinos auf Geschäftskollegen träfe? Unsere Haltung zum Spiel ist zweideutig. Einerseits verbinden wir das Glück der Kinder mit dem Spielen, andererseits halten wir spielende Erwachsene leicht für kindisch oder gar suchtgefährdet. Man wird zum ernst zu nehmenden Erwachsenen offenbar genau in dem Maße, in dem man sich von der Welt der Spiele entfernt. Wer spielt, tut etwas Überflüssiges und verhält sich damit nicht ökonomisch und rational.
Die Rechtfertigung, die unsere Gesellschaft dem Erwachsenen, der Lust am Spiel hat, allenfalls anbietet, lautet: Spielen dient der Erholung vom Stress des Alltags. Das ist natürlich richtig. Doch dieses Argument gibt dem Spielen nicht das gute Gewissen zurück und es kann auch nicht erklären, warum wir von Spielen fasziniert sind. Ich will in diesem Buch ganz anders an das Thema herangehen und überlegen, wie sich das lustvolle Spielen gegen die Kritik der »vernünftigen« Menschen behaupten kann. Als Motto könnte ein Wort von Sigmund Freud dienen, der einmal die Wirkung des Witzes als »die Lust am befreiten Unsinn« definiert hat. Der Witz ist nämlich auch ein Spiel. Er bietet die Lust eines Spiels mit Wörtern und Gedanken, das völlig von Kritik entlastet ist. Deshalb sind die Feinde des Spiels meist auch völlig humorlos. Lachen ist nämlich ein Spiel mit der Grenze, die das Spiel von der Wirklichkeit trennt. Man erkennt die Spielverderber, Regulierer und Puritaner deshalb auch untrüglich daran, dass sie so gut wie nie lachen.
Spielen tut gut. Es geht nicht darum, Geld zu gewinnen oder etwas zu lernen. Das Geld, das man beim Wetten, am Geldspielautomaten oder beim Skat gewinnen kann, ist nur ein Symbol für den Sieg. Und wenn wir etwa im Zusammenhang mit Computerspielen doch von Lerneffekten sprechen, dann handelt es sich immer nur um Lernen als Nebeneffekt. Ausgerechnet der asketische Philosoph Immanuel Kant hat es in seiner Kritik der Urteilskraft am besten ausgedrückt: Das Spiel ist vergnüglich, weil es die »Munterkeit des Gemüts« befördert. Ja, Kant geht so weit, zu sagen, dass man im Spiel das Gefühl der Gesundheit genießt.
Das Spiel ist wahrhaft universal. Man findet es in jeder Epoche und jeder Kultur. Es versetzt uns in einen von jedem Punkt des Alltags aus erreichbaren Ausnahmezustand der Ekstase von Spaß und Spannung. Und zu Recht schreibt Johan Huizinga: »Das Spiel lässt sich nicht verneinen.« Selbst die Puritaner mussten es in irgendeiner Form zulassen, allerdings zumeist in einer »hygienischen« Variante: als Sport. Deshalb werde ich dem Wettkampfsport ein eigenes Kapitel widmen und deutlich machen, dass es dabei nicht primär um »Leibesertüchtigung« geht.
Warum der Krieg gegen die Glücksspiele scheitert
Meine jüngste Tochter geht noch zur Schule, und ich helfe ihr zuweilen bei Mathematik und Altgriechisch. Für sie sind das lästige Hausaufgaben, für mich ist es ein Spiel. Denn es macht einfach Spaß, mathematische Probleme zu lösen und grammatische Strukturen zu entdecken – solange man nicht in die Schule muss. Die Aufgaben fordern mich heraus, ohne mich zu überfordern. Als ich selbst Schüler war, haben mich dieselben Aufgaben gequält. Wie ist das möglich? Was mich von meiner Tochter und den Workaholic vom »entfremdeten« Arbeiter unterscheidet, ist die spielerische Haltung. Wenn es mir gelingt, diese spielerische Haltung einzunehmen, dann macht die Lösung einer quadratischen Gleichung genauso viel Spaß wie die Lösung eines Sudoku-Rätsels – oder die Formulierung dieses Satzes! Diese spielerische Haltung kennen die meisten allerdings nur noch im Hobby, das sie in ihrer »Freizeit« genießen. Man gönnt sich dann die unnütze Beschäftigung. Im Hobby protestiert der Homo ludens gegen den Homo oeconomicus.
Jeder Spieler ist ein Gegenspieler des puritanischen Kults der Arbeit. Was Arbeit zur »entfremdeten« Arbeit macht, ist nicht die kapitalistische Ausbeutung, sondern der Mangel an Stimulation und dass sie der Freizeit gegenübersteht. Dagegen ist Arbeit, die Spaß macht, spielerisch. Darauf werde ich am Ende dieses Buches noch ausführlicher eingehen. Halten wir nur jetzt schon fest, dass eine Arbeit, die Spaß macht wie ein Spiel, tatsächlich den Beruf wieder in eine Berufung verwandeln kann, und eben nicht nur in einen Job. Dieser Gedanke ist ein Stachel im Fleisch der Arbeitsmoral. Der Homo ludens ärgert den Homo oeconomicus. Letzterer stellt auf dem Markt eine rationale Kosten-Nutzen-Kalkulation an, und für die fleißige und gewissenhafte Arbeit, die er leistet, bekommt er einen angemessenen Lohn. Der Homo ludens dagegen ist weder an Marktgesetzen noch an Arbeitsmoral orientiert. Der Gewinn des Spiels ist nämlich das genaue Gegenteil des Lohns der Arbeit. Den Lohn hat man sich durch harte Arbeit verdient, der Gewinn belohnt das Wagnis, das ich eingegangen bin. In der Welt des Spiels muss man also Bill Clinton widersprechen: »It’s not the economy, stupid!« Oder um es mit Fjodor Dostojewskis berühmtem Spieler zu sagen: »Oh, nicht um das Geld war es mir zu tun!« Es geht um die Möglichkeit eines Wunders. Mit einer Drehung des Rades, mit einer Ziehung des Loses, mit einem Würfelwurf kann sich alles ändern.
Der Homo ludens ärgert aber nicht nur den Homo oeconomicus. Er ärgert auch die Priester der Sozialreligion. Die Puritaner genauso wie die Universitätsmarxisten sehen in der Arbeit den einzigen Weg zum Lebenssinn. Deshalb ist für sie die »Erlebnisgesellschaft«, die der Soziologe Gerhard Schulze schon vor zwei Jahrzehnten in einem immer noch lesenswerten Bestseller beschrieben hat, ein großes Ärgernis. Der Homo ludens sorgt hier nämlich für eine Wiederverzauberung der entzauberten Welt. Er sucht nach Faszinationswerten und Gelegenheiten, verführt zu werden. Man denke auch an das Erregungs- und Betäubungsbedürfnis, das die allgegenwärtige Popmusik befriedigt. In der Erlebnisgesellschaft dreht sich alles um Spiel und Unterhaltung, Glück und Zufall, Wettkampf und Ekstase.
Obwohl die Wirtschaft von dieser Welt des Spiels lebt und der Staat enorme Steuereinnahmen daraus generiert, dominiert die puritanische Kritik des Spiels die veröffentlichte Meinung. Man sorgt sich um den armen jungen Mann, der sein weniges Geld am Automaten verspielt, und um den reichen, dem beim Computerspiel die »digitale Demenz« droht. Im paternalistischen Wohlfahrtsstaat wird das Spielen nur akzeptiert, wenn es erzieherisch oder hygienisch wirkt. Schon für Aristoteles hatte das Spielen gerade nichts mit kulturell wertvoller Muße zu tun. Seiner Argumentation im 8. Buch seiner Politik könnten sich die heutigen Priester der Sozialreligion gut anschließen: Der mühevoll Arbeitende braucht die lustvolle Erholung des Spiels, um seine Seele zu »lockern«. Aber der Staat muss das Spiel genau kontrollieren, damit es als eine Art Arznei angewendet wird – gewissermaßen in homöopathischer Dosierung.
Michel Foucault hat einmal von der abendländischen Welt gesagt, der Ursprung ihrer Moral sei »die tragische Abtrennung der glücklichen Welt der Lust«. Das gilt gerade auch für das moralische Urteil über das Spiel – und vor allem über das wichtigste, weil spielerischste aller Spiele: das Glücksspiel. Am Automaten zu spielen wird von den Moralaposteln unserer Zeit ähnlich eingestuft wie das Rauchen, das Trinken von Alkohol oder die schnelle Befriedigung existenzieller Bedürfnisse im Fast-Food-Restaurant oder im Swingerklub. Nun will ich hier nicht einfach die Vorzeichen umdrehen. Natürlich ist jedem die Freiheit zuzugestehen, ein lustfeindlicher Puritaner zu sein und über Glücksspieler, besonders Automatenspieler, die Nase zu rümpfen. Aber ein echt liberaler Politiker müsste hier, wie im ähnlichen Fall von Fast Food und Alkohol, sagen: Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Die McDonald’s-Werbung trifft den entscheidenden Punkt: »Ich liebe es!« Und das genügt.
Es gibt Leute, die gerne an Automaten spielen. Es gibt Leute, die Menüs schnell, groß und fettig mögen. Mein Onkel hat Weihnachtsgebäck mit Senf gegessen. Es gibt Fußballfans, die stundenlange Busfahrten auf sich nehmen, um ihre Mannschaft in Feindesland verlieren zu sehen. In Berlin treffe ich ständig auf Menschen, die blaue Haare und ein Dutzend Piercings haben. Man sagt dann: Über Geschmack lässt sich streiten. Man könnte aber genauso gut sagen: Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Es macht nämlich keinen Sinn, über Geschmacksfragen zu diskutieren, als ob es hier »richtig« oder »falsch« geben könnte.
Das, was die Paternalisten als Sucht und Sünde bekämpfen, ist für einen echten Liberalen Geschmackssache und Konsumgewohnheit. Ich schließe mich hier der Einschätzung von Gary S. Becker, dem Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften des Jahres 1992, an. Für Becker ist der Geschmack ein Verhaltensaxiom des Menschen, das nicht diskutiert werden kann. Jeder maximiert sein Wohlbefinden nach eigenem Gutdünken, und niemand hat sich hier einzumischen, solange er damit das Wohlbefinden der anderen nicht gefährdet. Alles andere ist illiberal. Aber diese illiberale Haltung ist längst zur offiziellen Politik geworden. Nicht nur bei den Grünen, sondern quer durch die Parteien hindurch breitet sich eine puritanische Politik der Freude aus. Man will uns das richtige Leben vorschreiben. Wir sollen vegetarisch essen, nur stilles Wasser trinken, in Maßen Sport treiben und regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung gehen. Das ist der heimliche Hedonismus der Regulierer und Gesundheitsapostel: über die Lust der anderen zu entscheiden.
Dass hier Wasser gepredigt und Wein getrunken wird, zeigt treffend die politische Kritik des Glücksspiels. Mit populistischer Wortgewalt, deretwegen in früheren Epochen Höllenprediger bei den einen berühmt und bei den anderen berüchtigt waren, prügeln Politiker, sekundiert durch allgegenwärtige Experten, auf das Automatenspiel ein, wobei sie fein säuberlich zwischen den Automaten unterscheiden, die von Unternehmern in Spielhallen, und denen, die von staatlichen Spielbanken in ihren eigenen Etablissements betrieben werden. Die einen, nämlich die von privaten Unternehmern aufgestellten, sollen die gefährlichen und die in der staatlichen Spielbank sollen die weniger gefährlichen sein. Eigentlich verhält es sich genau umgekehrt. Die privat betriebenen Automaten hat der Gesetzgeber so streng reguliert, sodass es ihnen unmöglich ist, dem vormaligen Gattungsbegriff der »Einarmigen Banditen« gerecht zu werden und die Spieler »auszurauben«. Ganz anders die Glücksspielautomaten in den staatlichen Spielbanken. An ihnen kann man spielend Haus und Hof verlieren. Warum sie besser sein sollen als ihre zahmen Verwandten in Spielhallen, scheint den Kritikern selbstverständlich. Der eigentliche Gewinner im Glücksspiel ist der Staat selbst, der sehr gut daran verdient. Und die Kritik ist bei Lichte betrachtet nichts anderes als Heuchelei und soll über diesen Sachverhalt hinwegtäuschen. Begründet wird das Verbot von bestimmten Glücks- und Gewinnspielen bekanntlich mit dem Hinweis auf den Verbraucherschutz. Dahinter steht das Credo jedes Paternalisten: Der Bürger weiß nicht, was gut für ihn ist! Zwar gibt es nach wie vor eine Menge Lotterien, aber deren Gewinnerzielungsstreben wird von der Politik mit einem guten Zweck versehen und damit gerechtfertigt. So wird die Welt des Spiels moralisch gespalten. Der geachtete Spieler kauft mit Sinn und Bedacht ein Los für einen guten Zweck. Der verachtete Spieler wirft sinnlos sein Geld in einen Automaten. Sinnlos, weil der Automat nicht in einer staatlichen Spielbank, sondern in einer privaten Spielhalle steht.
Wenn man die Moral von der Geschicht’ weniger staatstreu formuliert, kommt man rasch zu einem ganz anderen Ergebnis: Das Staatsmonopol auf Glücksspiele, die den Spielern übrigens ziemlich schlechte Gewinnchancen bieten, ist unmoralisch. Nicht besser steht es mit der politischen Begründung, der Staat habe die Aufgabe, den gefährlichen Spieltrieb der Menschen zu kanalisieren. Dieses »Kanalisierungs«-Argument ist genau besehen nur eine sehr schwache, durchsichtige Rationalisierung der Monopolstellung des Staates. Gerade die Spielerinteressen werden ja durch das Staatsmonopol geschädigt. Würde man die Lotterien nämlich daraus entlassen, so würden die Gewinnausschüttungen deutlich steigen – nicht zuletzt wegen des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs der Anbieter.
Also schon wegen des massiven Eigeninteresses des Staates ist die Glücksspielwelt nicht wirklich in ihrer Existenz bedroht. Und im Internet können wir heute bereits eine Globalisierung des Glücksspiels beobachten. Dieses globalisierte Las Vegas im Cyberspace, das ungeheure Wachstumsraten zeigt, lockt mit der Chance astronomischer Gewinne. Da das Ganze in einer juristischen Grauzone stattfindet, hat der Staat kaum Chancen, sich, wie bisher üblich, auf dem Weg der Besteuerung an den Gewinnen zu beteiligen. Daran wird sich wohl auch in Zukunft nichts ändern. Deshalb müsste der Staat eigentlich froh sein, dass es überhaupt noch gut funktionierende, profitable Spielhallen gibt. Und die Politiker müssten begreifen, dass staatliche Restriktionen des Glücksspiels nicht die Zahl der Glücksspieler reduzieren, sondern lediglich dafür sorgen, dass die Spieler sich in die Unbelangbarkeit des Internets flüchten.