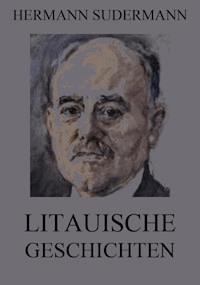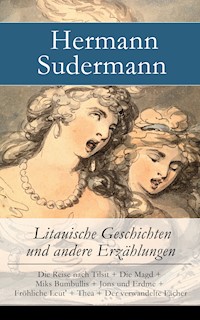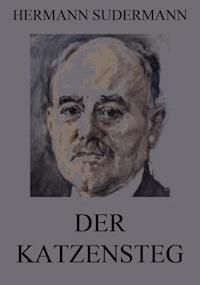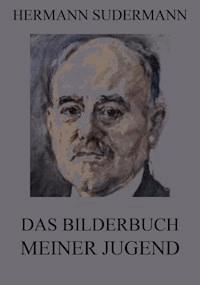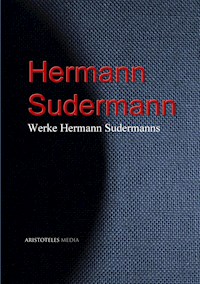
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: aristoteles
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Diese Sammlung der Werke von Hermann Sudermann, des berühmten deutscher Schriftstellers und Bühnenautors enthält: Frau Sorge Der Katzensteg Der verwandelte Fächer und zwei andere Novellen Hermann Sudermann als Erzähler Der verwandelte Fächer. Fröhliche Leut' Thea. Phantasien über einem Teetopf Die Magd Die Reise nach Tilsit Eine litauische Geschichte Jolanthes Hochzeit Jons und Erdme Miks Bumbullis
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Hermann Sudermann
WerkeHermann Sudermanns
Frau Sorge
Roman
Meinen Eltern Zum 16. November 1887
Frau Sorge, die graue, verschleierte Frau, Herzliebe Eltern, Ihr kennt sie genau, Sie ist ja heute vor dreißig Jahren Mit Euch in die Fremde hinausgefahren, Da der triefende Novembertag Schweratmend auf nebliger Heide lag Und der Wind in den Weidenzweigen Euch pfiff den Hochzeitsreigen. –
Als Ihr nach langen, bangen Stunden Im Litauerwalde ein Nest gefunden Und zagend standet an öder Schwelle, Da war auch Frau Sorge schon wieder zur Stelle Und breitete segnend die Arme aus Und segnete Euch und Euer Haus Und segnete die, so in den Tiefen Annoch den Schlaf des Nichtseins schliefen.
Es rann die Zeit. – Die morsche Wiege, Die jetzt im Dunkel unter der Stiege Sich freut der langverdienten Rast, Sah viermal einen neuen Gast. Dann, wenn die Abendglut verblichen, Kam aus dem Winkel ein Schatten geschlichen Und wuchs empor und wankte stumm Erhobenen Arms um die Wiege herum.
Was Euch Frau Sorge da versprach, Das Leben hat es allgemach In Seufzen und Weinen, in Not und Plage, Im Mühsal trüber Werkeltage, Im Jammer manch' durchwachter Nacht Ach! so getreulich wahrgemacht. Ihr wurdet derweilen alt und grau.
Und immer noch schleicht die verschleierte Frau Mit starrem Aug' und segnenden Händen Zwischen des Hauses armen vier Wänden, Vom duftigen Tische zum leeren Schrein, Von Schwelle zu Schwelle aus und ein, Und kauert am Herde und bläst in die Flammen Und schmiedet den Tag mit dem Tage zusammen.
Herzliebe Eltern, drum nicht verzagt! Und habt Ihr Euch redlich gemüht und geplagt Ein langes, schweres Leben lang, So wird auch Euch bei der Tage Neigen Ein Feierabend vom Himmel steigen.
Wir Jungens sind jung – wir haben Kraft, Uns ist der Mut noch nicht erschlafft, Wir wissen zu ringen mit Not und Müh'n, Wir wissen, wo blaue Glücksblumen blüh'n; Bald kehren wir lachend heim nach Haus Und jagen Frau Sorge zur Tür hinaus.
1
Gerade als das Gut Meyhöfers sich unter dem Hammer befand, wurde Paul, sein dritter Sohn, geboren.
Das war freilich eine schwere Zeit!
Frau Elsbeth mit ihrem vergrämten Gesicht und ihrem wehmütigen Lächeln lag in dem großen Himmelbette, neben sich die Wiege des Neugeborenen, ließ die Augen unruhig umherschweifen und horchte auf jegliches Geräusch, das vom Hofe und aus den Wohnzimmern in ihre traurige Wochenstube drang. – Bei jedem verdächtigen Laut fuhr sie empor, und jedesmal, wenn eine fremde Männerstimme sich hören ließ oder ein Wagen mit dumpfem Rollen dahergefahren kam, fragte sie, in heller Angst die Pfosten des Bettes umklammernd:
»Ist's soweit? Ist's soweit?«
Niemand gab ihr Antwort. Der Arzt hatte streng befohlen, jede Aufregung von ihr fernzuhalten, aber er hatte nicht bedacht, der gute Mann, daß dieses ewige Hangen und Bangen sie tausendmal härter quälen mußte als die schrecklichste Gewißheit.
Eines Vormittags – am fünften Tage nach der Geburt – hörte sie ihren Mann, den sie in dieser bösen Zeit kaum einmal zu Gesicht bekommen, mit schwerem Fluchen und Seufzen im Nebenzimmer auf und nieder gehen. – Auch ein Wort konnte sie verstehen, ein einziges Wort, das er immer aufs neue wiederholte, das Wort: »Heimatlos!«
Da wußte sie: Es war soweit.
Sie legte die matte Hand auf das Köpfchen des Neugeborenen, der mit einem ernsthaften Gesicht still vor sich hin dröselte, und weinte in die Kissen hinein. Nach einer Weile sagte sie zu der Dienstmagd, welche den Kleinen wartete:
»Bestell dem Herrn, ich möchte ihn sprechen.«
Und er kam. – Mit seinen dröhnenden Schritten trat er vor das Bett der Wöchnerin und sah sie an mit einem Gesicht, das in seiner erzwungenen Unbefangenheit doppelt verzerrt und verzweifelt dreinschaute.
»Max«, sagte sie schüchtern, denn sie hatte immer Angst vor ihm, »Max, verheimliche mir nichts – ich bin ja ohnehin auf das Schlimmste gefaßt.«
»Bist du?« fragte er mißtrauisch, denn er erinnerte sich an die Warnung des Arztes.
»Wann müssen wir hinaus?«
Als er sah, daß sie so ruhig dem Unglück ins Auge schaute, glaubte er fürder nicht nötig zu haben, ein Blatt vor den Mund zu nehmen, und wetternd brach er los:
»Heute – morgen – ganz wie es dem neuen Herrn gefällt! – Nur durch seine Barmherzigkeit sind wir noch hier – und wenn es ihm so paßt, können wir diese Nacht auf der Straße logieren.«
»So schlimm wird es nicht sein, Max«, sagte sie, mühsam ihre Fassung bewahrend, »wenn er erfährt, daß erst vor ein paar Tagen ein Kleines eingekehrt ist...«
»So – ich soll wohl betteln gehen bei ihm – was?«
»Oh, nicht doch. Er tut's von selbst. Wer ist es denn?«
»Douglas heißt er – stammt aus dem Insterburgischen trat sehr breitspurig auf, der Herr, sehr breitspurig – hätt' ihn am liebsten vom Hof gejagt.«
»Ist uns was übriggeblieben?« Sie fragte es leise und zögernd und sah dabei auf den Neugeborenen nieder, hing doch von der Antwort vielleicht sein junges, schwaches Leben ab.
Er brach in ein hartes Lachen aus. »Ja, ein Trinkgeld – volle zweitausend Taler.«
Sie seufzte erleichtert auf, denn ihr war zumute gewesen, als hörte sie schon das fürchterliche »Nichts« von seinen Lippen schwirren.
»Was sollen uns zweitausend Taler«, fuhr er fort, »nachdem ihrer fünfzig in den Sumpf geschmissen sind? Soll ich etwa in der Stadt eine Gastwirtschaft aufmachen oder mit Knöpfen und Bändern handeln? Du hilfst vielleicht noch mit, indem du in vornehmen Häusern nähen gehst, und die Kinder verkaufen Streichhölzchen auf den Straßen – hahaha!«
Er wühlte sich in den schon graumelierten, buschigen Haaren und stieß dabei mit dem Fuße gegen die Wiege, daß sie heftig hin- und herschwankte.
»Wozu ist das Wurm nun geboren?« murmelte er düster, dann kniete er neben der Wiege nieder, begrub die winzigen Fäustchen in den Höhlungen seiner großen roten Hände und redete zu seinem Kinde: »Wenn du gewußt hättest, Junge, wie schlecht und niederträchtig diese Welt ist, wie die Unverschämtheit darin siegt und die Rechtlichkeit zugrunde geht, du wärst wahrhaftig geblieben, wo du warst. – Was wirst du für ein Schicksal haben? – Dein Vater ist ein Stück Vagabund, ein Abgewirtschafteter, der sich mit Weib und drei Kindern auf der Straße herumtreibt, bis er einen Ort gefunden hat, wo er sich und die Seinen vollends zugrunde richtet...«
»Max, sprich nicht so – du brichst mir das Herz«, rief Frau Elsbeth weinend und streckte die Hand aus, um sie auf den Nacken des Mannes zu legen, aber diese Hand sank kraftlos hernieder, ehe sie ihr Ziel erreichte.
Er sprang empor – »Du hast recht – genug mit dem Jammern! – Freilich, wenn ich jetzt allein wäre, ein Junggeselle wie in den früheren Tagen, dann ging ich nach Amerika oder in die russischen Steppen, dort wird man reich – ja, dort wird man reich –, oder ich spekulierte an der Börse – heute Hausse, morgen Baisse –, hei, da ließe sich Geld verdienen, aber so – gebunden, wie man ist...«, er warf einen kläglichen Blick auf Weib und Kind, dann wies er mit der Hand zum Hofe hinaus, von wo die lachenden Stimmen der zwei Älteren hereintönten.
»Ja, ich weiß wohl, daß wir dir jetzt eine Last sein müssen«, sagte die Frau demütig.
»Rede mir nicht von Last!« erwiderte er polternd. »Was ich sagte, war nicht bös gemeint. Ich hab' euch lieb – und damit basta! Es fragt sich jetzt nur, wohin? Wäre wenigstens dieses Neugeborene nicht, so ließen sich die Wechselfälle eines ungewissen Daseins eine Zeitlang ertragen. Aber nun – du krank – das Kind der Pflege bedürftig – zu guter Letzt bleibt uns nichts übrig, als irgendein Bauerngut zu kaufen und die zweitausend Taler als Anzahlung zu geben. Heißa, das kann ein Leben werden – ich mit dem Bettelsack, du mit dem Ranzen – ich mit dem Spaten, du mit dem Milcheimer...«
»Das wäre noch nicht das Schlimmste«, sagte die Frau leise.
»Nein?« er lachte bitter. – »Na, dir kann geholfen werden. Da ist zum Beispiel Mussainen zu verkaufen, das klägliche Moorgrundstück draußen auf der Heide.«
»Oh, warum gerade das?« sagte sie zusammenschauernd.
Er verliebte sich sofort in seinen Gedanken.
»Ja, das hieße den Kelch bis auf die Hefe leeren. Im Angesichte stets die verflossene Herrlichkeit – denn du mußt wissen, das Herrenhaus vom Helenenthal glänzt dort geradewegs in die Fenster – ringsum Moor und Brachland an die zweihundert Morgen – vielleicht ließe sich manches urbar machen – Pionier der Kultur könnte man werden. Und was würden die Leute dazu sagen? Der Meyhöfer ist ein ganzer Kerl – würden sie sagen; er schämt sich seines Unglücks nicht, ja er betrachtete es gewissermaßen mit Ironie. Pah, wahrhaftig! Ironisieren soll man sein Unglück – das ist die einzig erhabene Weltbetrachtung – pfeifen darauf soll man! – – Und er stieß einen gellenden Pfiff aus, so daß die kranke Frau im Bette emporfuhr.
»Verzeih, mein Liebchen«, bat er, ihre Hand streichelnd, plötzlich in der rosigsten Stimmung, »aber hab' ich nicht recht? – Pfeifen soll man darauf. Solange man nur das Bewußtsein hat, ein redlicher Mann zu sein, kann man jedes Ungemach mit einer gewissen Wollust ertragen. Wollust ist das richtige Wort. – Das Grundstück ist jeden Tag zu verkaufen, denn der Besitzer hat sich vor kurzem in eine reiche Wirtschaft hineingeheiratet und läßt das alte Gerümpel nun vollends brachliegen.«
»Überleg's dir erst, Max«, bat die Frau in heller Angst.
»Was soll das Zaudern helfen?« erwiderte er heftig. »Diesem Herrn Douglas dürfen wir nicht zur Last liegen, etwas Besseres können wir mit unseren lumpigen 2000 nicht beanspruchen – also frisch zugegriffen...«
Und ohne daß er sich die Zeit nahm, der kranken Frau Lebewohl zu sagen, eilte er von dannen.
Wenige Minuten später hörte sie seinen Einspänner zum Hoftore hinausrollen.
Am Nachmittag desselben Tages wurde ihr ein fremder Besuch gemeldet. – Eine schöne, vornehme Dame sei in einer glänzenden Equipage auf den Hof gefahren und begehre der kranken Herrin eine Wochenvisite abzustatten.
Wer es denn sei? – Sie habe ihren Namen nicht nennen wollen.
»Wie seltsam!« dachte Frau Elsbeth, aber da sie in ihrem Kummer ein wenig an himmlische Sendungen zu glauben begann, so sagte sie nicht nein.
Die Tür öffnete sich. Eine schlanke, zart gebaute Gestalt mit feinen, weichen Gesichtszügen trat schwebenden Schrittes an das Bett der Wöchnerin. Sie ergriff ohne weiteres eine ihrer Hände und sagte mit einer sanften, leise verschleierten Stimme.
»Ich habe meinen Namen verschwiegen, liebe Frau Meyhöfer, denn ich fürchtete, nicht angenommen zu werden, wenn ich ihn vorher nannte. Und am liebsten möchte ich auch jetzt ungekannt bleiben. Ich muß leider annehmen, daß Sie mich nicht mehr mit Wohlwollen betrachten werden, wenn Sie wissen, wer ich bin.«
»Ich hasse keinen Menschen auf der Welt«, erwiderte Frau Elsbeth, »geschweige denn einen Namen.«
»Ich heiße Helene Douglas«, sagte die Dame leise und drückte die Hand der Kranken fester.
Frau Elsbeth fing sofort an zu weinen, die Besucherin aber, als ob sie eine alte Freundin gewesen wäre, schlang den Arm um ihren Hals, küßte sie auf die Stirn und sagte mit ihrer leisen, tröstlichen Stimme: »Seien Sie mir nicht gram. Das Schicksal hat es gewollt, daß ich Sie in diesem Hause verdränge, aber schuld habe ich nicht daran. Mein Mann hat mir eine Überraschung bereiten wollen, denn der Name dieses Gutes stimmt mit meinem Vornamen überein. Meine Freude war sofort verschwunden, als ich hörte, unter welchen Verhältnissen er es erworben und wie gerade Sie, liebe Frau Meyhöfer, in dieser doppelt schweren Zeit haben leiden müssen. Da zwang es mich denn, mein Herz zu erleichtern, indem ich Sie persönlich um Verzeihung bäte für den Kummer, den ich Ihnen bereitet habe und noch bereiten werde, denn Ihre Leidenszeit ist ja noch nicht vorüber.«
Frau Elsbeth hatte, als ob dies so sein müßte, den Kopf an der Fremden Schulter gelegt und weinte still vor sich hin.
»Und vielleicht kann ich Ihnen auch ein wenig nützen«, fuhr diese fort, »mindestens dadurch, daß ich einen Teil Bitterkeit von Ihrer Seele nehme. Wir Frauen pflegen uns besser zu verstehen als die harten, heftigen Männer einander. Die gemeinsamen Leiden, die auf uns lasten, führen uns näher. Und vor allen Dingen eins: Ich habe mit meinem Manne gesprochen und bitte Sie in meinem und in seinem Namen, dieses Haus so lange als Eigentum zu betrachten, als es Ihnen irgend beliebt. Wir bringen den Winter meistens in der Stadt zu und haben zudem noch ein zweites Gut, das wir durch einen Verwalter bewirtschaften lassen wollen. Sie sehen also, daß Sie uns in keiner Weise stören und höchstens einen Gefallen erweisen, wenn Sie noch ein halbes Jahr und darüber hier schalten und walten wie bisher.«
Frau Elsbeth dankte nicht, aber der tränenfeuchte Blick, den sie zu der Fremden erhob, war Dank genug.
»Jetzt seien Sie wieder heiter, liebste Frau«, fuhr diese fort, »und wenn Sie für die Zukunft Rat und Hilfe brauchen, bedenken Sie, daß hier jemand ist, der viel an Ihnen gutzumachen hat. – Und welch ein prächtiges Kind« – sie wandte sich nach der Wiege hin –, »ein Junge oder ein Mädel?«
»Ein Junge«, sagte Frau Elsbeth mit einem schwachen Lächeln.
»Findet er schon Geschwister in dieser Welt? – Aber was frag' ich! Die beiden strammen kleinen Kerle draußen, die mich am Wagen empfingen – darf ich sie näher kennenlernen? – Nein, hier nicht«, wehrte sie hastig ab – »es könnte Sie noch mehr erregen. Später! Später! – Vorerst interessiert uns dieser kleine Weltbürger.«
Sie beugte sich über die Wiege und nestelte das Wickelzeug zurecht.
»Er macht schon eine ganz altkluge Miene«, sagte sie scherzend.
»Die Sorge hat an seiner Wiege gestanden«, erwiderte Frau Elsbeth leise und schwermütig, »daher hat er das alte Gesicht.«
»Oh, nicht abergläubisch sein, meine Beste«, erwiderte die Besucherin. »Ich habe mir sagen lassen, daß Neugeborene in ihren Zügen oft etwas Greisenhaftes tragen. Das verliert sich bald.«
»Gewiß haben auch Sie Kinder?« fragte Frau Elsbeth.
»Ach, ich bin ja eine so junge Frau!« – erwiderte die Besucherin und errötete dabei. »Kaum sechs Monate verheiratet. – Aber –«, und sie errötete noch tiefer.
»Gott stehe Ihnen bei in Ihrer schweren Stunde«, sagte Frau Elsbeth, »ich werde für Sie beten.«
Das Auge der Fremden wurde feucht. »Dank, tausend Dank«, sagte sie. »Und lassen Sie uns Freundinnen sein! Ich bitte Sie recht herzlich! – Wissen Sie was? Nehmen Sie mich zur Patin für diesen Ihren Jüngsten und erweisen Sie mir den gleichen Liebesdienst, wenn der Himmel mich segnet...«
Die beiden Frauen drückten sich stumm die Hände. Ihr Freundschaftsbund war geschlossen...
Als die Besucherin sie verlassen hatte, sah Frau Elsbeth mit einem scheuen, traurigen Blick in die Runde. »Es war noch eben so hell, so sonnig hier«, murmelte sie, »und ist jetzt wieder so dunkel geworden.«
Nach einer kleinen Weile kamen die beiden Ältesten trotz der Abwehr der Wärterin mit hellem Jubel in das Krankenzimmer gestürzt. Ein jeder hielt eine Zuckertüte in der Faust.
»Das hat uns die fremde Dame geschenkt«, jauchzten sie.
Frau Elsbeth lächelte. »Pst, Kinder«, sagte sie, »ein Engel ist bei uns gewesen.«
Die beiden kleinen Burschen machten ängstliche Augen und fragten: »Mama, ein Engel?«
2
So wurde Frau Douglas Pauls Taufpatin.
Wohl war Meyhöfer nicht wenig ungehalten über die neue Freundschaft, denn »das Mitleid der Glücklichen brauche ich nicht«, pflegte er zu sagen, aber als die milde, freundliche Frau zum zweiten Male auf dem Hof erschien und ihm gut zuredete, wagte er nicht länger nein zu sagen.
Auch in den ferneren Verbleib auf der alten Heimstätte willigt er – freilich mit Widerstreben – ein. Die Wirtschaft Mussainen, die er in der Tat noch an demselben Tage käuflich erstanden hatte, war in so desolatem Zustande, daß ein Verweilen darin während der kalten Herbsttage für Weib und Kind gefährlich schien. Vor allem mußten die notwendigsten Reparaturen besorgt und Zimmermann, Maurer und Töpfer herbeigeholt werden, ehe an einen Umzug zu denken war.
Nichtsdestoweniger sah sich Frau Elsbeth durch den Eigensinn ihres Mannes gezwungen, lange bevor die Herrichtung der neuen Wohnung vollendet war, in dieselbe überzusiedeln.
Als nämlich eines Tages ein Inspektor des neuen Herrn mit einer Anzahl Arbeiter auf dem Hofe erschien und in seinem Auftrage bescheiden um Unterkunft bat, erklärte er dessen Handlungsweise für eine ihm geflissentlich angetane Schmach und war entschlossen, keinen Tag länger auf dem Boden zu verweilen, der einst sein Eigentum gewesen. –
Es war ein kalter, trüber Novembertag, als Frau Elsbeth mit ihren Kindern dem alten, lieben Hause Valet sagte. – Ein feiner Sprühregen rieselte, alles durchnässend, vom Himmel. In grauen Nebel eingehüllt, öde und trostlos lag die Heide vor ihren Blicken.
Das Jüngste an der Brust, die beiden älteren Kinder weinend um sich her, so bestieg sie den Wagen, der sie dem neuen und ach so düsteren Schicksal entgegenführte.
Als sie zum Hoftor hinausrollten und der kalte Heidewind ihnen mit eisigen Ruten ins Gesicht peitschte, da fing auch das Kleine, das solange still und friedlich dagelegen, kläglich zu weinen an. Sie hüllte es fester in ihren Mantel und beugte sich tief auf das kleine, zitternde Körperchen nieder, um die Tränen nicht zu zeigen, die ihr unaufhaltsam über die Wangen rollten.
Nach einer halben Stunde Fahrt auf den lehmigen, regendurchweichten Wegen erreichte der Wagen sein Ziel. Fast hätte sie laut aufgeschrien, als sie das neue Heimwesen in seiner Trostlosigkeit und seinem Verfalle vor ihren Blicken liegen sah.
Langgestreckte, aus Lehm und Heidekraut aufgeführte Wirtschaftsgebäude – ein sumpfiger Hof – ein niedriges, mit Schindeln gedecktes Wohnhaus, von dessen Wänden der Kalk stellenweise abgebröckelt war und die nackte Mauer bloßlegte – ein verwilderter Garten, in dem die letzten traurigen Reste des Sommers, Astern und Sonnenblumen, neben halbverwesten Küchenkräutern wucherten, ringsum ein grell angestrichener Zaun, dem man vor seinem Ende noch eine letzte Ölung gegeben zu haben schien – das war der Ort, an welchem die Familie des abgewirtschafteten Gutsbesitzers fortan zu hausen hatte.
Das war der Ort, an welchem der kleine Paul heranwuchs, welchem die Liebe seiner Kindheit, die Sorge seines halben Lebens galt... Er war in seinen ersten Jahren ein gar zartes, siechendes Geschöpf, und in mancher Nacht zitterte die Mutter, daß das matte Lämpchen seines Lebens verlöschen werde, ehe der Morgen graute. Dann saß sie in dem düsteren, niederen Schlafzimmer, die Ellbogen auf die Kante des Bettchens gestützt, und starrte mit brennenden Augen auf das magere Körperchen nieder, welches ein Krampf schmerzhaft zusammenzerrte.
Aber er überstand alle die Krisen der ersten Kindheit, und mit fünf Jahren war er, wenn auch schwächlich an Gliedern und blaß, fast welk im Gesicht – die alten Züge hatte er richtig beibehalten –, ein gesunder Knabe, auf dessen Emporkommen man Hoffnungen setzen konnte.
In dieselbe Zeit fallen seine frühesten Erinnerungen.
Die erste, die er sich in späteren Jahren vielfach zurückrief, war folgende: Das Zimmer ist halbdunkel. An den Fenstern blühen die Eisblumen, und rötlich dringt der Schein des Abendrots durch die Gardinen. Die älteren Brüder sind Schlittschuhlaufen gegangen, er aber liegt in seinem Bett, denn er muß früh schlafen gehen, und neben ihm sitzt die Mutter, die eine Hand um seinen Hals gelegt, die andere auf der Kante der Wiege, in welcher die beiden kleinen Schwesterchen schlafen, die der Storch vor einem Jahr gebracht, beide an ein und demselben Tage.
»Mama, erzähl mir ein Märchen«, bittet er.
Und die Mutter erzählte. Was, daran erinnert er sich nur dunkel, aber es war darin von einer grauen Frau die Rede, welche in allen trüben Stunden die Mutter besucht hatte, eine Frau mit bleichem, hagerem Gesicht und dunkeln, verweinten Augen. Sie war wie ein Schatten gekommen und wie ein Schatten gegangen, hatte die Hände über der Mutter Haupt gebreitet, ungewiß, ob zum Segen oder zum Fluche, und allerhand Worte gesprochen, die auch auf ihn, den kleinen Paul, Bezug hatten. Es war darin von einem Opfer und einer Erlösung die Rede gewesen, aber die Worte vergaß er wieder, wahrscheinlich, weil er noch zu dumm war, sie zu verstehen. AbereinerSache erinnerte er sich ganz genau: Während er, schier atemlos vor Grauen und Erwartung, den Worten der Mutter lauschte, sah er plötzlich die graue Gestalt, von der sie sprach, leibhaftig an der Tür stehen – ganz dieselbe mit ihren erhobenen Armen und ihrem blassen, traurigen Gesicht. Er verbarg den Kopf im Arm der Mutter – sein Herz pochte, der Atem fing an, ihm zu fehlen, und in Todesangst mußte er aufschreien: »Mama, da ist sie, da ist sie!«
»Wer? Die Frau Sorge?« fragte die Mutter.
Er antwortete nicht und fing zu weinen an.
»Wo denn?« fragte die Mutter weiter.
»Dort in der Tür«, erwiderte er, sich aufrichtend und ihren Hals umklammernd, denn er hatte große Angst.
»O du kleiner Dummrian!« sagte die Mutter. »Das ist ja Papas langer Reisemantel.« Und sie holte denselben her und hieß ihn Futter und Oberzeug betasten, damit er's ganz genau wüßte, und er gab sich darein, aber innerlich war er nur um so fester überzeugt, daß er die graue Frau von Angesicht zu Angesicht gesehen.
Und nun wußte er auch, wie sie hieß.
»Frau Sorge« hieß sie.
Aber die Mutter war nachdenklich geworden und ließ sich nicht bewegen, das Märchen zu Ende zu erzählen. Auch in späteren Zeiten nicht. Mochte er sie noch so flehentlich bitten.
Von dem Vater hatte er aus jenen Jahren nur eine dunkle Erinnerung bewahrt. Ein Mann mit großen Wasserstiefeln, der die Mutter schalt und die Brüder prügelte und ihn selbst zu übersehen pflegte. Nur bisweilen fing er einen scheelen Blick auf, der ihm nichts Gutes zu bedeuten schien. Manchmal, besonders wenn er in der Stadt gewesen war, hatte sein Gesicht eine dunkelrote Farbe wie ein überheizter Kessel, und sein Gang lief kreuz und quer von einer Diele auf die andere. Dann spielte sich immer dieselbe Geschichte ab:
Zuerst liebkoste er die beiden Zwillinge, die er ganz besonders in sein Herz geschlossen hatte, und schaukelte sie auf seinen Armen, während die Mutter dicht dabeistand und mit angstvollem Blick alle seine Bewegungen verfolgte; dann setzte er sich zum Essen, stöckerte ein wenig in den Schüsseln herum und schob sie dann beiseite, indem er den »Fraß« pauvre und unschmackhaft nannte, riß auch wohl Max oder Gottfried eins mit der Gerte über den Nacken, war auf die Mutter böse und ging schließlich hinaus, um mit den Knechten Händel anzufangen. Weithin hallte dann seine wetternde Stimme über den Hofraum, so daß selbst der Karo an seiner Kette den Schwanz zwischen die Beine kniff und sich in den hintersten Winkel seiner Bude zurückzog. – Kehrte er nach einer Weile in das Zimmer zurück, so war seine Stimmung meistens von Zorn in Verzweiflung umgeschlagen. Er rang die Hände, klagte über das Elend, in dem er hier hausen müßte, und sprach zu sich selber von allerhand großen Dingen, die er unternommen haben würde, wenn nicht dies oder das ihn verhindert hätte, und wenn Himmel und Erde nicht miteinander verschworen wären, ihn zugrunde zu richten. Dann trat er wohl ans Fenster und schüttelte die Faust nach dem weißen Hause hin, das aus der Ferne so freundlich herüberblickte.
Ja, dieses weiße Haus!
Der Vater schalt darauf, er runzelt die Brauen, wenn nur sein Blick nach jener Richtung hinschweifte, und er selbst, er hatte es so lieb, als wenn ein Stück seiner Seele dort weilte. Warum? Er wußte es selbst nicht. Vielleicht nur, weil die Mutter es liebte. Auch sie stand ja gar oft am Fenster und schaute darauf hin, aber sie runzelte nicht die Brauen, o nein! – ihr Gesicht wurde weich und wehmütig, und aus ihren Augen strahlte eine Sehnsucht, so inbrünstig, daß ihm, der still daneben stand, gar oft ein Schauer heiß über den Nacken lief.
War doch sein kleines Herz von ganz derselben Sehnsucht erfüllt! Erschien ihm doch, so lange er denken konnte, jenes Haus als der Inbegriff alles Schönen und Herrlichen! Stand es doch, wenn er die Lider zudrückte, allezeit vor seinen Augen, schlich es sich doch selbst in seine Träume hinein!
»Bist du schon einmal in dem weißen Hause gewesen?« fragte er eines Tages die Mutter, als er seine Wißbegier nicht länger zügeln konnte.«
»O ja, mein Sohn«, erwiderte sie, und ihre Stimme klang traurig und unsicher.
»Oft, Mama?«
»Sehr oft, mein Junge. Deine Eltern haben einmal dort gewohnt, und du bist dort zur Welt gekommen.«
Seitdem war ihm das »Weiße Haus« dasselbe, was dem Menschengeschlecht das verlorene Paradies...
»Wer wohnt denn jetzt in dem weißen Haus?« fragte er ein andermal.
»Eine schöne, freundliche Frau, die alle Menschen liebhat und dich ganz besonders, denn du bist ja ihr Patenkind.«
Ihm war zumute, als ergösse sich eine unendliche Fülle von Glück über sein Haupt. Er war so aufgeregt, daß er zitterte.
»Warum fahren wir denn nicht zu der schönen, freundlichen Frau?« fragte er nach einer Weile.
»Papa will's nicht haben«, erwiderte sie, und ihre Stimme hatte einen eigentümlichen scharfen Klang, der ihm auffiel.
Er fragte nicht weiter, denn des Vaters Wille galt als ein Gesetz, dessen Gründen niemand nachzuforschen hatte, aber an diesem Tage knüpfte das Geheimnis des weißen Hauses ein neues Band zwischen Mutter und Sohn. – Öffentlich durfte nicht von ihm gesprochen werden. Der Vater wurde wütend, sobald man seine Existenz nur andeutete, und auch die Brüder mochten mit ihm, dem Jüngsten, nicht gern darüber reden; wahrscheinlich fürchteten sie, daß er's in seiner Dummheit wiedersage. Aber die Mutter, die Mutter vertraute ihm!
Wenn sie miteinander allein waren – und sie waren während der Schulzeit fast immer allein –, dann öffnete sich ihr Mund und mit dem Munde das Herz, und das weiße Haus stieg aus ihren Erzählungen immer höher und leuchtender vor seinen Augen empor. Bald kannte er jedes Zimmer, jede Laube im Garten, den grünumbuschten Weiher mit der spiegelnden Glaskugel davor und die Sonnenuhr auf der Terrasse; man denke, eine Uhr, auf welcher die liebe Sonne selbst die Stunden anzeigen mußte. Welch ein Wunder!
Er hätte mit geschlossenen Augen auf Helenenthal umhergehen können und sich dennoch nicht verirrt.
Und wenn er mit Klötzchen spielte, dann baute er sich ein weißes Haus mit Terrassen und Sonnenuhren – zwei Dutzend auf einmal! –, grub Teiche in den Sand und befestigte Murmelsteine auf kleinen Pfählen, um die Glaskugeln anzudeuten. Aber freilich, spiegeln taten sie nicht.
3
Zu derselben Zeit faßte er den Plan, dem weißen Hause einen Besuch abzustatten. Ganz auf eigene Faust. Er verschob es auf den Frühling, als aber der Frühling kam, fand er nicht den Mut dazu. Er verschob es auf den Sommer, aber auch dann kamen allerhand Hindernisse dazwischen. Einmal hatte er einen großen Hund allein auf der Wiese umherstreichen sehen – wer konnte wissen, ob es nicht ein toller war? –, und ein andermal war ihm der Bulle mit gesenkten Hörnern auf den Leib gerückt.
»Ja, wenn ich groß sein werde wie die Brüder«, so tröstete er sich, »und in die Schule gehe, dann werde ich mir einen Stock nehmen und den tollen Hund totschlagen, und den Bullen werd' ich bei den Hörnern fassen, daß er mir nichts tun kann.«
Und er verschob es auf das nächste Jahr; denn dann sollte er beginnen, in die Schule zu gehen, ganz wie die großen Brüder.
Die großen Brüder waren Gegenstand seiner Anbetung. Zu werden wie sie, erschien ihm das letzte Ziel menschlicher Wünsche. Auf Pferden reiten, auf großen wirklichen, nicht bloß auf hölzernen, Schlittschuh laufen, schwimmen ganz ohne Binsen und Schweinsblasen und Vorhemdchen tragen, weiße, gestärkte, die mit Bändern um den Leib befestigt werden, ach, wer das könnte! Aber dazu muß man erst groß sein, tröstete er sich. Diese Gedanken behielt er ganz für sich, der Mutter mochte er sie nicht sagen, und den Brüdern selbst – oh, die machten sich sehr wenig mit ihm zu schaffen. Er war ein solcher Knirps in ihren Augen, und wenn die Mutter bestimmte, daß sie ihn irgendwohin mitnähmen, waren sie unwillig, denn dann mußten sie auf ihn achtgeben und um seiner Dummheit willen die schönsten Streiche aufgeben. Paul fühlte das wohl, und um ihren bösen Gesichtern und noch böseren Püffen auszuweichen, sagte er meistens, er wolle lieber zu Hause bleiben, mochte ihm auch noch so weh ums Herz sein. Dann setzte er sich auf den Pumpenschwengel, und während er sich leise hin- und herschaukelte, träumte er von den Zeiten, da er's den Brüdern gleichtun wollte.
Auch im Lernen. – Und das war keine Kleinigkeit, denn beide, Max sowohl wie Gottfried, saßen als die Ersten in ihrer Schule und brachten zu den Feiertagen stets sehr schöne Zeugnisse mit nach Hause. Wie schön die waren, ersieht man daraus, daß sie ihnen von dem Vater je einen Silbergroschen, von der Mutter eine Honigstulle eintrugen.
An einem solchen Freudentag hörte er den Vater sagen: »Ja, wenn ich die beiden Ältesten in eine gute Schule geben könnte, da würde was aus ihnen werden, denn sie haben ganz meinen aufgeweckten Kopf, aber Bettler, wie wir sind, werden wir sie wohl auch zu Bettlern erziehen müssen.«
Paul dachte viel darüber nach, denn er wußte bereits, daß Max zum Feldmarschall und Gottfried zum Feldzeugmeister geboren sei. Es hatte sich nämlich einmal ein Ruppiner Bilderbogen mit Abbildungen der österreichischen Armee in das Heidehaus verirrt, und an diesem Tage waren die Brüder einig geworden, die beiden höchsten Würden der Generalität unter sich zu verteilen, während ihm, dem Jüngeren, eine Unterleutnantsstelle zufallen sollte. Seitdem war allerdings eine Periode gekommen, in welcher der eine den Beruf zum Trapper, der andere zum Indianerhäuptling in sich fühlte, aber Pauls Gedanken blieben an jenen goldgestickten Uniformen haften, mit welchen die hölzernen Speere und die aus Lumpen zusammengeflickten Sandalen, wie sie die Brüder beim Spielen trugen – die letzteren nannten sie »Mokassins« –, keinen Vergleich aushalten konnten. Auch warum sie später wieder Naturforscher und Superintendenten werden wollten, blieb ihm unverständlich – die Neu-Ruppiner Bilder waren doch das beste.
Zu derselben Zeit begannen die Zwillinge gehen zu lernen. Käthe, die ältere – sie war um dreiviertel Stunden früher zur Welt gekommen –, machte den Anfang, und Grete folgte ihr drei Tage später nach.
Das war ein bedeutungsvolles Ereignis in Pauls Leben. Plötzlich stand er gebannt in einem Kreis von Pflichten, der ihn so bald nicht wieder freilassen sollte.
Niemand hatte ihm aufgetragen, die ersten Schritte der kleinen Schwestern zu bewachen, aber so selbstverständlich es stets gewesen, daß er seine Schuhe schon am Abend putzte und die der Brüder dazu, daß er sein Röckchen viereckig zusammengefaltet zu Kopfenden des Bettes niederlegte und die beiden Strümpfe kreuzweise darüber, daß er nie einen Flecken ins Tischtuch machte und daß er vom Vater einen Denkzettel erhielt, wenn das Unglück einem der Brüder passierte, so selbstverständlich war es auch, daß er sich fortan der kleinen Schwestern annahm und mit altkluger Sorge über ihren tollkühnen Steh- und Gehkunststücken wachte.
Er kam sich so wichtig in diesem neuen Amte vor, daß selbst die Sehnsucht nach der Schule geringer wurde, und hätte er allenfalls noch – pfeifen können, das Maß seiner Wünsche wäre voll gewesen.
Ja, pfeifen können, wie Jons, der Knecht, oder auch nur wie die älteren Brüder, das war nun das Ziel seiner Träume, der Gegenstand unaufhörlicher Studien. Aber er mochte noch so viel den Mund spitzen und noch so viel die Lippen anfeuchten, um sie geschmeidig zu machen, kein Ton kam zum Vorschein. Ja, wenn er die Luft einzog, dann ging es allenfalls – einmal war es ihm sogar gelungen, die ersten vier Töne von »Ist ein Jud' ins Wasser gefallen« hervorzubringen, aber jeder zünftige Pfeifer weiß, daß die Luft zum Munde hinausgestoßen werden muß, und das gerade war es, was er nicht lernen konnte.
Auch hierin tröstete er sich mit dem Gedanken: »Wenn ich erst groß sein werde.«
Die Weihnachten dieses Jahres brachten eine Freudenbotschaft. Von der »guten Tante« aus der Stadt, einer Schwester seiner Mutter, traf eine Kiste ein mit allerhand schönen und nützlichen Sachen, Bücher und Hemdenzeug für die Brüder, Kleidchen für die Schwestern und für ihn ein Samtrock, ein wirklicher Samtrock, mit Husarenschnüren und großen blanken Knöpfen. – Das war eine Freude! – Aber die allerschönste Bescherung stand erst in dem Briefe, welchen die Mutter mit Tränen der Rührung und der Freude vorlas. Die gute Tante schrieb, daß sie aus dem letzten Brief »Elsbeths« ersehen habe, wie es ihres Mannes höchster Wunsch sei, den beiden ältesten Knaben eine bessere Schulbildung zu geben, und daß sie sich infolgedessen entschlossen habe, dieselben zu sich ins Haus zu nehmen und sie das Gymnasium auf eigene Kosten durchmachen zu lassen. Die Brüder jauchzten, die Mutter weinte, der Vater rannte in der Stube umher, fuhr sich mit der Hand durch die Haare und murmelte aufgeregte Worte.
Er saß derweilen ganz still am Bettchen der Schwestern und freute sich innerlich.
Da kam die Mutter zu ihm heran, barg das Antlitz in seinen Haaren und sagte: »Wirst du es auch einmal so gut haben, mein Junge?«
»Ach der!« sagte der Vater. »Der kapiert ja nichts.«
»Er ist noch so jung!« erwiderte die Mutter, seine Wangen streichelnd, und dann zog sie ihm den schönen Samtrock an; den durfte er, weil's Feiertag war, bis zum Abend anbehalten. Und auch die Brüder kamen und herzten ihn, teils, weil ihnen das Herz so voll von Freude war, teils des schönen Samtrockes wegen. So gut waren sie niemals zu ihm gewesen.
Ja, das waren Weihnachten!
Und als der Frühling sich näherte, ging's an ein großes Nähen und Sticken für die Aussteuer. Paul durfte beim Zuschneiden behilflich sein, die Elle halten und die Schere zureichen, und die Zwillinge lagen auf der Erde und wühlten in der weißen Leinwand. Die Brüder wurden ausgestattet wie zwei Prinzen. Nichts wurde vergessen. Selbst Schlips bekamen sie, die hatte die Mutter aus einer alten Taftmantille zurechtgeschneidert.
Die Brüder waren in dieser Zeit ungeheuer stolz. Sie spielten bereits die Herren, jeder auf seine Weise. Max drehte sich Zigaretten, indem er Knaster aus des Vaters Tabakskasten in kleine Papiertüten schüttete, welche er an dem breiten Ende in Brand steckte, und Gottfried setzte sich eine Brille auf, welche er in der Schule für sechs Hosenknöpfe erstanden hatte.
»Gefall' ich dir so?« fragte er, vor Paul hin und her stolzierend, und da dieser »ja« sagte, wurde er abgeküßt; hätte er »nein« gesagt, würde er einen Katzenkopf bekommen haben.
Gleich nach Ostern fuhren die beiden Brüder ab. Das gab viel Tränen im Hause. Als aber der Wagen zum Hoftor hinausgerollt war, da preßte die Mutter ihr tränenüberströmtes Gesicht gegen Pauls Wange und flüsterte:
»Du bist lange vernachlässigt worden, mein armes Kind; jetzt sind wir wieder zu zweien wie vordem.«
»Mama, au Tuß!« schrie die kleine Käthe, die Ärmchen ausreckend, und ihre Schwester tat desgleichen.
»Ja, ihr seid ja auch noch da!« rief die Mutter, und heller Sonnenschein leuchtete über ihr blasses Angesicht.
Und dann nahm sie jede auf einen Arm, trat mit ihnen ans Fenster und schaute lange nach dem weißen Hause hinüber.
Paul steckte den Kopf zwischen den Falten ihres Kleides hervor und tat desgleichen.
Die Mutter senkte den Blick zu ihm herab, und als er seinem altklugen Kinderauge begegnete, errötete sie ein wenig und lächelte. Aber keines sprach ein Wort.
Als der Vater aus der Stadt zurückkam, verlangte er, daß Paul anfangen sollte, in die Schule zu gehen.
Die Mutter wurde sehr traurig und bat, ihn doch noch ein halbes Jahr daheimzulassen, damit sie sich nicht allzusehr nach den beiden Ältesten bange, sie wolle ihn selber unterrichten und weiterbringen, als der Lehrer es vermochte. Aber der Vater wollte nichts davon wissen und schalt sie eine Tränenliese.
Paul bekam einen Schreck. – Die Sehnsucht nach der Schule, die ihn früher stets erfüllt hatte, war ganz verschwunden; freilich, jetzt waren ja auch die Brüder nicht mehr da, denen er nachzueifern hatte.
Am nächsten Tag nahm der Vater ihn bei der Hand und führte ihn ins Dorf hinüber, dessen erste Häuser etwa zweitausend Schritt von dem Meyhöferschen Grundstück entfernt lagen. Immerhin ein tüchtiges Stück Weges für einen so kleinen Burschen.
Aber Paul hielt sich wacker. Er hatte so große Furcht, vom Vater Schläge zu bekommen, daß er bis an das Weltende marschiert wäre.
Die Schule war ein niedriges, strohbedecktes Gebäude, nicht viel anders wie ein Bauernhaus, aber daneben standen allerhand hohe Stangen mit Leitern und Gerüsten.
»Daran werden die faulen Kinder aufgehängt«, erklärte der Vater.
Pauls Angst erhöhte sich noch, als aber der Lehrer, ein freundlicher alter Mann mit weißen Bartstoppeln und einer fettigen Weste, ihn zu sich aufs Knie nahm und ihm ein schönes, buntes Bilderbuch zeigte, da wurde er wieder ruhig, nur die vielen fremden Gesichter, die von den Bänken her nach ihm hinstarrten, schienen ihm nichts Gutes zu bedeuten.
Er erhielt den letzten Platz und mußte zwei Stunden lang Grundstriche auf die Schiefertafel malen.
In der Zwischenpause kamen die großen Jungen an ihn heran und fragten nach seinem Frühstücksbrot, und als sie sahen, daß es mit Schlackwurst belegt war, nahmen sie es ihm fort. Er ließ sich das ruhig gefallen, denn er glaubte, es müsse so sein. Beim Nachhausegehen prügelten sie ihn, und einer stopfte ihm Nesseln in den Halskragen. Er glaubte, auch das müsse so sein, denn er war ja der Kleinste, aber als er die Häuser des Dorfes hinter sich hatte und einsam auf der sonnbeglänzten Heide daherging, da fing er zu weinen an. Er warf sich unter einem Wacholderbusch nieder und starrte zum blauen Himmel in die Höhe, wo die Schwalben hin und her schossen.
»Ach, wenn du doch auch so fliegen könntest! « dachte er – da fiel das weiße Haus ihm ein.
Er richtete sich auf und suchte es mit den Augen. Wie das verzauberte Schloß, von welchem die Mutter in ihren Märchen zu erzählen wußte, strahlte es zu ihm herüber. Die Fenster glitzerten wie Karfunkelsteine, und die grünen Büsche wölbten sich ringsum wie eine hundertjährige Dornenhecke.
In seinen Schmerz mischte sich ein Gefühl des Stolzes und des Selbstbewußtseins. »Du bist nun groß«, sagte er sich, »denn du gehst ja in die Schule. Und wenn du jetzt die Wanderschaft antreten wolltest, kann niemand etwas dagegen haben.« Und dann kam wieder die Angst über ihn. Der böse Bulle und die tollen Hunde – man kann ja nicht wissen. Er beschloß, sich die Sache bis zum nächsten Sonntag zu überlegen.
Aber das weiße Haus ließ ihm fortan keine Ruhe. Jedesmal, wenn er über die Heide ging, fragte er sich, was denn eigentlich an jenem Wege Schlimmeres wäre als an dem nach der Schule. Freilich, die Fahrstraße – die lief durch einen dunklen Fichtenwald, und in solchen Wäldern hausen allerhand Zwerge und Hexen, auch Wölfe kommen nicht selten darin vor, wie die Geschichte vom Rotkäppchen zeigt, aber wenn er quer über die Wiese ging, dann behielt er das Heimathaus stets in den Augen und konnte des Rückweges sicher sein.
Der Gang erschien ihm wie eine Ehrenpflicht, die er jetzt, da er »groß« sei, zu erfüllen habe, und wenn die Angst aufs neue in ihm erwachte, schalt er sich einen Feigling. Dies Wort galt in der Schule als eine große Beschimpfung.
Als der Sonntag kam, war er entschlossen, die Fahrt zu wagen. Er schlich sich um den Zaun herum und lief, so rasch er laufen konnte, über die väterlichen Wiesen in der Richtung nach dem weißen Hause zu.
Dann kam ein Zaun, der mit leichter Mühe zu überklettern war, und dann ein Stück fremden Heidelandes, auf dem er noch nie gewesen. Aber auch hier gab es nichts Gefährliches. Das Heidekraut glänzte im Sonnenschein, die welken Katzenpfötchen knisterten zu seinen Füßen, ein warmer Wind strich ihm entgegen. Er versuchte zu pfeifen, aber er mußte noch immer die Luft einziehen, um einen Ton zu erzeugen. Darüber schämte er sich, und ein kleinmütiges Gefühl bemächtigte sich seiner.
Dann kam ein sumpfiges Moor, das wiederum seinem Vater gehörte. Derselbe sprach oft davon, er ging mit dem Gedanken um, Torf darin zu stechen, aber er wollte die Sache nur im großen beginnen, und dazu fehlten ihm die nötigen Gelder.
Paul sank bis an die Knöchel im Sumpfe ein, und jetzt erst kam er auf den Gedanken, daß er die neuen Stiefel vielleicht beschmutzen würde. Er erschrak, denn er erinnerte sich der Worte der Mutter: »Schone sie sehr, mein Junge, ich habe sie von meinem Milchgelde abgespart.« Auch den schönen Samtrock trug er, weil es eben Sonntag war. Er besah die glänzenden Seidenschnüre und war einen Moment unschlüssig, ob er nicht lieber umkehren sollte, nicht des Samtrockes wegen, nein, nur um die Mutter nicht zu betrüben.
»Aber vielleicht komme ich doch heil hindurch«, so tröstete er sich und begann weiterzulaufen. Der Boden wogte unter seinen Füßen, und bei jedem Schritte ertönte ein quatschender Laut, wie wenn man den Schlegel aus dem Butterfasse zieht.
Dann kam er an ein schwarzes Brachwasser, an dessen Rande weißhaarige Küchenschellen blühten und auf dem, wie Grünspan glitzernd, eine Lösung von Eisen herumschwamm. Er ging ihm vorsichtig aus dem Wege, geriet zwar vollends in den Morast, kam aber schließlich doch wieder ins Trockene. Die Stiefel waren zwar zuschanden, aber vielleicht ließen sie sich an der Pumpe heimlich abwaschen.
Er schritt weiter. Die Lust zum Pfeifen war ihm vergangen, und je größer das weiße Haus aus den Gebüschen in die Höhe stieg, desto beklommener wurde ihm zumute. Schon konnte er eine Art von Wall unterscheiden, welcher die Bäume umgab, und durch eine Lücke im Laubwerk sah er ein langes, niedriges Gebäude, welches er aus der Ferne nie bemerkt hatte. Dahinter noch eins, und in einer schwarzen Höhle eine hohe Flamme, die hin und her züngelte. Das mußte eine Schmiede sein – aber sollte die selbst am Sonntage arbeiten?
Eine unerklärliche Lust zu weinen ergriff ihn, und während er blindlings weiterlief, stürzten ihm die Tränen aus den Augen.
Plötzlich sah er einen breiten Graben vor sich, bis zum Rande mit Wasser gefüllt. Er wußte wohl, daß er nicht hinüberkommen würde, aber der Trotz zwang ihn, zum Sprunge auszuholen, und im nächsten Augenblick schlug das dicke, schmutzige Wasser über ihn zusammen.
Bis auf die Knochen durchnäßt, mit einer Schicht von Morast und Algen umgeben, kam er wieder ans Land zurück.
Er versuchte die Kleider trocknen zu lassen, setzte sich auf den Rasen und schaute nach dem weißen Hause hinüber. Er war ganz mutlos geworden, und als ihn gar sehr zu frieren begann, ging er traurig und langsam nach Hause zurück.
4
Der Sommer, der nun folgte, brachte dem Hause Meyhöfers eitel Kummer und Not. Der frühere Besitzer hatte seine Hypothek gekündigt, und es war keine Aussicht vorhanden, daß irgend jemand die nötige Summe leihen würde.
Meyhöfer fuhr wöchentlich wohl drei-, viermal in die Stadt und kam am späten Abend betrunken nach Hause. Manchmal blieb er auch die Nacht über fort.
Frau Elsbeth saß derweilen aufrecht in ihrem Bette und starrte in die Dunkelheit. Paul erwachte oft, wenn er ihr leises Schluchzen hörte. Dann lag er eine Weile mäuschenstill, denn er mochte es nicht merken lassen, daß er wach war, aber schließlich fing auch er zu weinen an.
Dann wurde wieder die Mutter still, und wenn er gar nicht aufhören wollte, stand sie auf, küßte ihn und streichelte seine Wange, oder sie sagte:
»Komm zu mir, mein Junge.«
Alsdann sprang er auf, schlüpfte in ihr Bett, und an ihrem Halse schlief er wieder ein.
Der Vater prügelte ihn oft. Er wußte selten, warum, aber er nahm die Schläge hin wie etwas, das sich von selbst verstand.
Eines Tages hörte er, wie der Vater die Mutter schalt.
»Weine nicht, du Tränensack«, sagte er, »du bist bloß dazu da, um mir mein Elend noch größer zu machen.«
»Aber Max«, antwortete sie leise, »willst du den Deinen verwehren, dein Unglück mit dir zu tragen? Müssen wir nicht um so enger zusammenhalten, wenn es uns schlechtgeht?«
Da wurde er weich, nannte sie sein braves Weib und belegte sich selber mit bösen Schimpfnamen.
Frau Elsbeth suchte ihn zu beruhigen, bat ihn, Vertrauen zu ihr zu haben und tapfer zu sein.
»Ja, tapfer sein – tapfer sein!« schrie er, aufs neue in Ärger geratend. »Ihr Weiber habt klug reden, ihr sitzt zu Hause und breitet demütig die Schürze aus, damit euch Glück oder Unglück in den Schoß falle, wie's der liebe Himmel beschert; wir Männer aber müssen hinaus ins feindliche Leben, müssen kämpfen und streben und uns mit allerhand Gesindel herumschlagen, geht mir mit euren Mahnungen! Tapfer sein, ja, ja – tapfer sein!«
Darauf schritt er dröhnenden Schrittes zum Zimmer hinaus und ließ den Wagen anspannen, um seine gewöhnliche Wanderfahrt anzutreten.
Als er wiedergekommen war und seinen Rausch ausgeschlafen hatte, sagte er:
»So – jetzt ist auch die letzte Hoffnung dahin. Der verfl... Jude, der mir das Geld zu 25 Prozent vorschießen wollte, erklärt, er wolle nichts mehr mit mir zu tun haben. – Na, dann läßt er's bleiben... Ich hust' auf ihn... Und zu Michaelis können wir richtig betteln gehn, denn diesmal bleibt uns nicht so viel wie das Schwarze unterm Nagel. Aber das sag' ich dir – diesmal überleb' ich den Schlag nicht – ein Kerl von Ehre muß auf sich halten, und wenn ihr mich eines schönen Morgens oben am Sparren baumeln seht, dann wundert euch nicht.«
Die Mutter stieß einen entsetzlichen Schrei aus und klammerte die Arme um seinen Hals.
»Na, na, na«, beruhigte er sie, »es war so schlimm nicht gemeint. Ihr Weiber seid doch allzu klägliche Geschöpfe... Ein bloßes Wort schmeißt euch um!«
Scheu trat die Mutter von ihm zurück, aber als er hinausgegangen war, setzte sie sich ans Fenster und schaute ihm angstvoll nach, als ob er sich schon jetzt ein Leids antun könnte.
Von Zeit zu Zeit lief ein Schauern durch ihren Körper, als friere sie...
In der Nacht, die diesem Tage folgte, bemerkte Paul erwachend, wie sie aus ihrem Bette aufstand, einen Unterrock überwarf und an das Fenster trat, von welchem aus man das weiße Haus sehen konnte. Es war heller Mondenschein – vielleicht schaute sie wirklich hinüber. – Wohl zwei Stunden lang saß sie da – unverwandt hinausstarrend. – Paul rührte sich nicht, und als sie mit Beginn der Morgendämmerung vom Fenster zurückkam und an die Betten ihrer Kinder trat, drückte er die Augen fest zu, um sich schlafend zu stellen. Sie küßte zuerst die Zwillinge, die umschlungen nebeneinander ruhten, dann kam sie zu ihm, und wie sie sich zu ihm herabbeugte, hörte er sie flüstern: »Gott, gib mir Kraft! Es muß ja sein.« Da ahnte er, daß etwas Außergewöhnliches sich vorbereitete.
Als er am andern Nachmittag aus der Schule heimkehrte, sah er die Mutter in Hut und Mantille, ihrem Sonntagsstaat, in der Laube sitzen. Ihre Wangen waren noch bleicher als sonst, die Hände, die in dem Schoße lagen, zitterten.
Sie schien auf ihn gewartet zu haben, denn als sie ihn nahen sah, atmete sie erleichtert auf.
»Willst du fortgehen, Mama?« fragte er verwundert.
»Ja, mein Junge«, erwiderte sie, »und du sollst mit mir kommen.«
»Ins Dorf, Mama?«
»Nein, mein Junge...« ihre Stimme bebte – »ins Dorf nicht – du mußt dir die Sonntagskleider anziehen – der Samtrock freilich ist verdorben – aber aus der grauen Jacke hab' ich die Flecken ausgemacht – die geht noch – und die Stiefel mußt du dir wichsen – aber rasch –«
»Wohin werden wir denn gehen, Mama?«
Da schloß sie ihn in die Arme und sagte leise:
»Ins weiße Haus!«
Er fühlte, wie ein heißer Schreck ihn überrieselte; der Jubel, der aus dem Herzen emporquellen wollte, erstickte ihn fast, er sprang auf den Schoß der Mutter und küßte sie stürmisch.
»Aber du mußt niemandem etwas davon sagen«, flüsterte sie, »niemandem – verstehst du?«
Er nickte wichtig. Er war ja ein so kluger Mann. Er wußte, um was es sich handelte.
»Und nun zieh dich um – rasch!«
Paul flog die Treppe zur Kleiderkammer empor – und plötzlich! – auf welcher Stufe es war, ist ihm niemals klargeworden –: ein langgezogener, schriller Ton quoll aus seinem Munde; da war kein Zweifel mehr – er konnte pfeifen – er probierte es zum zweiten, zum dritten Mal – es ging vorzüglich!
Als er im vollsten Staate zur Mutter zurückkehrte, rief er ihr jubelnd entgegen: »Mama, ich kann pfeifen« und wunderte sich, daß sie so wenig Verständnis für seine Kunst an den Tag legte. Sie nestelte nur ein wenig seinen Kragen zurecht und sagte dabei: »Ihr glücklichen Kinder!«
Dann nahm sie ihn bei der Hand, und die Wanderschaft begann. Als sie den dunklen Fichtenwald erreichten, in dem die Wölfe und die Kobolde hausten, war er soeben mit den Studien zu »Kommt ein Vogel geflogen« fertig geworden, und als sie wieder aufs freie Feld kamen, konnte er sicher sein, daß »Heil dir im Siegerkranz« nichts mehr zu wünschen übrigließ.
Die Mutter schaute mit trüben Lächeln auf ihn nieder, jeder schrille Ton ließ sie zusammenfahren, sie sagte aber nichts.
Das »Weiße Haus« stand nun ganz nah vor ihnen. Er dachte nicht mehr an die neue Kunst. Das Schauen nahm ihn gänzlich gefangen.
Zuerst kam eine hohe rote Ziegelmauer mit einem Torweg darin, auf dessen Pfosten zwei steinerne Knöpfe saßen, dann ein weiter, grasbewachsener Hofraum, auf dem ganze Reihen von Wagen standen und den in einem ungeheuern Viereck langgestreckte, graue Wirtschaftsgebäude umgaben. – In der Mitte lag eine Art Sumpf, der von einer niedrigen Weißdornhecke umgeben war, und in welchem eine Schar von schnatternden Enten sich herumsielte.
»Und wo ist das weiße Haus, Mama?« fragte Paul, dem das alles gar nicht gefiel.
»Hinter dem Garten«, erwiderte die Mutter. Ihre Stimme hatte einen eigentümlich heiseren Klang, und ihre Hand umklammerte die seine so fest, daß er beinahe aufgeschrien hätte.
Jetzt bogen sie um die Ecke des Gartenzauns, und vor Pauls Blicken lag ein schlichtes, zweistöckiges Haus, das von Lindenbäumen dicht umschattet war und das wenig oder gar nichts Merkwürdiges an sich hatte. Auch lange nicht so weiß erschien es wie aus der Ferne.
»Ist es das?« fragte Paul gedehnt.
»Ja, das ist es!« erwiderte die Mutter.
»Und wo sind die Glaskugeln und die Sonnenuhr?« fragte er. Ihn wandelte plötzlich eine Lust zum Weinen an. Er hatte sich alles tausendmal schöner vorgestellt; wenn man ihn auch um die Glaskugeln und die Sonnenuhr betrogen hätte – es wäre kein Wunder gewesen.
In diesem Augenblick kamen zwei kohlschwarze Neufundländer mit dumpfem Bellen auf sie zugestürzt. Er flüchtete sich hinter das Kleid der Mutter und fing zu schreien an.
»Caro, Nero! « rief eine feine Kinderstimme von der Haustür her, und die beiden Unholde jagten, ein freudiges Geheul ausstoßend, sofort auf die Richtung der Stimme los.
Ein kleines Mädchen, kleiner noch als Paul, in einem rosageblümten Röckchen, um welches eine Art schottischer Schärpe geschlungen war, erschien auf dem Vorplatz. Sie hatte lange goldgelbe Locken, die mit einem halbkreisförmigen Kamme aus der Stirn zurückgestrichen waren, und ein feines, schmales Näschen, das sie etwas hoch trug.
»Wünschen Sie Mama zu sprechen?« fragte sie mit einer zarten, weichen Stimme und lächelte dazu.
»Heißest du Elsbeth, mein Kind?« fragte die Mutter zurück.
»Ja, ich heiße Elsbeth.«
Die Mutter machte eine Bewegung, wie um das fremde Kind in ihre Arme zu schließen, aber sie bezwang sich und sagte:
»Willst du uns zu deiner Mutter führen?«
»Mama ist im Garten – sie trinkt eben Kaffee –«, sagte die Kleine wichtig, »ich möchte Sie um den Giebel herumführen, denn wenn wir auf der Sonnenseite die Stubentür aufmachen, kommen gleich so viel Fliegen herein.«
Die Mutter lächelte. Paul wunderte sich, daß ihm das zu Hause noch niemals eingefallen war.
Sie ist viel klüger als du, dachte er.
Nun traten sie in den Garten. Er war weit schöner und größer als der auf Mussainen, aber von der Sonnenuhr war nirgends etwas zu entdecken. Paul hatte eine unbestimmte Vorstellung davon, wie von einem großen goldenen Turme, auf dem eine runde, funkelnde Sonnenscheibe das Zifferblatt bildete.
»Wo ist denn die Sonnenuhr, Mama?« fragte er.
»Die werd' ich dir hernach zeigen«, sagte das kleine Mädchen eifrig.
Aus der Laube trat eine hohe, schlanke Dame mit einem blassen kränklichen Gesicht, auf welchem der Schimmer eines unsagbar milden Lächelns ruhte.
Die Mutter stieß einen Schrei aus und warf sich laut aufweinend an ihre Brust.
»Gott sei Dank, daß ich Sie einmal bei mir habe«, sagte die fremde Dame und küßte die Mutter auf Stirn und Wangen. »Glauben Sie, jetzt wird alles gut werden – Sie werden mir sagen, was Sie drückt, und es müßte seltsam zugehen, wenn ich nicht Rat wüßte.«
Die Mutter wischte sich die Augen und lächelte.
»Oh, es ist ja nur die Freude«, sagte sie, »ich fühle mich schon so frei, so leicht, da ich in Ihrer Nähe bin – ich habe mich so sehr nach Ihnen gebangt.«
»Und Sie konnten wirklich nicht kommen?«
Die Mutter schüttelte traurig den Kopf.
»Arme Frau!« sagte die Dame, und beide sahen sich mit einem langen Blick in die Augen.
»Und dies ist am Ende gar mein Patenkind?« rief die Dame, auf Paul hinweisend, der sich an das Kleid der Mutter klammerte und dabei an seinem Daumen sog.
»Pfui, nimm den Finger aus dem Munde«, sagte die Mutter, und die schöne, freundliche Frau hob ihn auf ihren Schoß, gab ihm einen Teelöffel voll Honig – »als Vorgeschmack«, sagte sie – und fragte ihn nach den kleinen Geschwistern, nach der Schule und allerhand sonstigen Sachen, auf die zu antworten gar nicht schwer war, so daß er sich schließlich auf ihrem Schoße beinahe behaglich fühlte.
»Und was kannst du denn schon alles, du kleiner Mann?« fragte sie zu guter Letzt.
»Ich kann pfeifen!« erwiderte er stolz.
Die freundliche Frau lachte ganz laut und sagte: »Nun, dann pfeif uns einmal eins!«
Er spitzte die Lippen und versuchte zu pfeifen, aber es ging nicht – er hatte es wieder verlernt.
Da lachten sie alle, die freundliche Frau, das kleine Mädchen und selbst die Mutter; ihm aber stiegen vor Scham die Tränen in die Augen, er schlug mit Händen und Füßen um sich, so daß die Dame ihn von ihrem Schoß gleiten ließ, und die Mutter sagte verweisend:
»Du bist ungezogen, Paul!«
Er aber ging hinter die Laube und weinte, bis das kleine Mädchen an ihn herantrat und zu ihm sagte: »Ach geh, das mußt du nicht tun. – Unartige Kinder mag der liebe Gott nicht leiden.« Da schämte er sich wieder und rieb sich die Augen mit den Händen trocken.
»Und jetzt will ich dir auch die Sonnenuhr zeigen«, fuhr das Kind fort.
»Ach ja, und die Glaskugeln«, sagte er.
»Die sind schon lange zerbrochen«, erwiderte sie, »in die eine ist mir im vorigen Frühling ein Stein hineingeflogen, und die andere hat der Sturm runtergeschmissen.« Und dann zeigte sie ihm die Plätze, auf denen sie gestanden hatten.
»Und dies ist die Sonnenuhr«, fuhr sie fort.
»Wo?« fragte er, sich erstaunt umsehend. Sie standen vor einem grauen, unscheinbaren Pfahl, auf dem eine Art von Holztafel angebracht war. Das Kind lachte und sagte, das wäre sie ja.
»Ach, pfui doch!« erwiderte er unwillig. »Du machst mich zum Narren.«
»Warum soll ich dich zum Narren machen?« fragte sie. »Du hast mir ja nichts zuleide getan.« Und dann behauptete sie noch einmal, das wäre die Sonnenuhr und nichts anderes; und sie wies ihm auch den Zeiger, ein armseliges, verrostetes Stück Blech, welches aus der Mitte der Tafel hervorragte und seinen Schatten gerade auf die Zahl sechs warf, die mit anderen zusammen auf der Tafel angebracht war.
»Ach, das ist zu dumm«, sagte er und wandte sich ab.
Die Sonnenuhr im Garten des weißen Hauses war die erste große Enttäuschung seines Lebens. – – –
Als er mit seiner neuen Freundin zur Laube zurückkehrte, traf er dort noch einen großen, breitschultrigen Herrn mit zwei mächtigen Bartzipfeln, der einen graugrünen Jägerrock trug und aus dessen Augen Funken zu sprühen schienen.
»Wer ist das?« fragte Paul, sich furchtsam hinter seiner Freundin verbergend.
Sie lachte und sagte: »Das ist mein Papa; du, vor dem brauchst du keine Angst zu haben.«
Und sie sprang hell aufjubelnd dem fremden Mann auf den Schoß.
Da dachte er bei sich, ob er wohl jemals wagen würde, seinem Papa auf den Schoß zu springen, und schloß daraus, daß nicht alle Väter sich glichen. Der Mann im Jägerrock aber streichelte sein Kind, küßte es auf beide Wangen und ließ es auf seinen Knien reiten.
»Sieh – Elsbeth hat einen Gespielen bekommen«, sagte die fremde, freundliche Dame und wies nach Paul hinüber, der, im Laubwerk verborgen, scheu in die Laube hineinschielte.
»Immer ran, mein Junge!« rief der Mann fröhlich und schnalzte mit den Fingern.
»Komm – hier auf dem anderen ist noch Platz für dich«, rief das Kind, und als er mit einem fragenden Blick nach der Mutter sich furchtsam näher schlich, ergriff ihn der fremde Mann, setzte ihn auf das andere Knie, und dann gab's ein keckes Wettreiten.
Er hatte nun alle Furcht verloren, und als frischgebackene Flinzen auf den Tisch gesetzt wurden, hieb er wacker ein.
Die Mutter streichelte sein Haar und hieß ihn, sich nicht den Magen verderben. Sie sprach sehr leise und sah immer vor sich nieder auf die Erde. Und dann durften die beiden Kinder in die Sträucher gehen und sich Stachelbeeren pflücken.
»Heißt du wirklich Elsbeth?« fragte er seine Freundin, und als diese bejahte, sprach er seine Verwunderung aus, daß sie denselben Namen habe wie seine Mutter.
»Ich bin doch nach ihr getauft«, sagte das Kind, »sie ist ja meine Patin.«
»Warum hat sie dich denn nicht geküßt?« fragte er.
»Ich weiß nicht«, sagte Elsbeth traurig, »vielleicht mag sie mich nicht.«
Aber daß sie den Mut nicht gehabt hatte, daran dachte keines von beiden. – – –
Es fing schon an, dunkel zu werden, als die Kinder zurückgerufen wurden.
»Wir müssen nach Hause«, sagte die Mutter.
Er wurde sehr betrübt, denn jetzt fing es ihm gerade zu gefallen an.
Die Mutter rückte ihm den Kragen zurecht und sagte: »So, nun küß die Hand und bedank dich.«
Er tat, wie ihm befohlen, die freundliche Frau küßte ihn auf die Stirne, und der Mann im Jägerrock hob ihn hoch in die Luft, so daß er glaubte, er könne fliegen.
Und nun nahm die Mutter Elsbeth in den Arm, küßte sie mehrere Mal auf den Mund und Wangen und sagte: »Möge der Himmel einst an dir vergelten, mein Kind, was deine Eltern an deiner Patin getan.«
Eine schwere Last schien von ihrer Seele abgewälzt; sie atmete freier, und ihr Auge leuchtete.
Elsbeth und ihre Eltern begleiteten sie beide bis an das Hoftor; als die Mutter dort noch einmal Abschied nahm und dabei allerhand von Vergeltung und himmlischem Segen stammelte, fiel ihr der Mann lachend ins Wort und sagte, die Geschichte wäre nicht der Rede wert, und es lohnte sich nicht der Mühe des Dankes.
Und die freundliche Frau küßte sie herzlich und bat sie, recht bald wiederzukommen oder wenigstens die Kinder zu schicken.
Die Mutter lächelte wehmütig und schwieg.
Elsbeth durfte noch ein paar Schritt weiter mitkommen, dann verabschiedete sie sich mit einem Knicks.
Paul wurde es schwer ums Herz, er fühlte, daß er ihr noch etwas zu sagen habe, daher lief er ihr nach, und als er sie eingeholt hatte, raunte er ihr ins Ohr:
»Du – und ich kanndochpfeifen.« – – –
Als Mutter und Sohn den Wald betraten, brach die Nacht gerade herein. Es war pechrabenschwarz ringsum, aber er fürchtete sich nicht im mindesten. Wäre jetzt ein Wolf des Weges gekommen, er würde ihm schon gezeigt haben, was 'ne Harke ist.
Die Mutter sprach kein Wort; die Hand, welche die seine umklammert hielt, brannte, und der Atem kam laut, wie ein Seufzer, aus ihrer Brust.
Und als sie beide auf die Heide hinaustraten, stieg der Mond bleich und groß am Horizont empor. Ein bläulicher Schleier lag über der Ferne. Thymian und Wacholder dufteten. Hier und da zirpte ein Vögelchen am Boden.
Die Mutter setzte sich auf den Grabenrand und schaute nach dem traurigen Heimwesen hinüber, dem all ihre Sorge galt. Dunkel ragten die Umrisse der Gebäude in den Nachthimmel empor. Aus der Küche schimmerte einsam ein Licht.
Plötzlich breitete sie die Arme aus und rief in die stille Heide hinein: »Ach, ich bin glücklich!«
Paul schmiegte sich fast ängstlich an ihre Seite, denn nimmer noch hatte er einen ähnlichen Ruf von ihr vernommen. Er war so sehr an ihre Tränen und ihren Kummer gewöhnt, daß ihm dieser Jubel ganz unheimlich erschien.