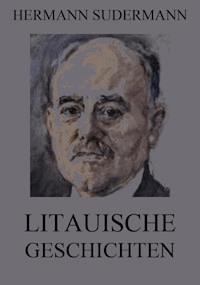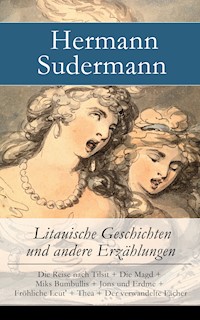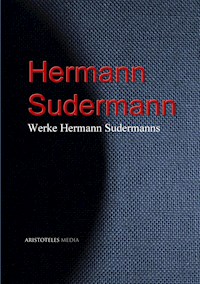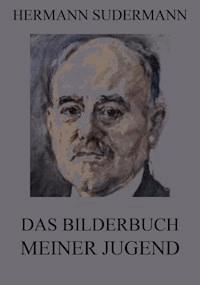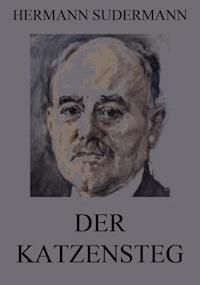
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sudermanns historischer Roman spielt zur Zeit des Krieges gegen die Franzosen unter Napoleon. Als die Soldaten in ihre ostpreußische Heimat zurückkehren ist darunter auch der Freiherr von Schranden, dessen Vater mit den Franzosen kooperiert hatte. Schon bald beginnen die Anfeindungen und Probleme innerhalb der Dorfgesellschaft ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Katzensteg
Hermann Sudermann
Inhalt:
Hermann Sudermann – Biografie und Bibliografie
Der Katzensteg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Schluß
Der Katzensteg, H. Sudermann
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849637378
www.jazzybee-verlag.de
Hermann Sudermann – Biografie und Bibliografie
Schriftsteller, geb. 30. Sept. 1857 zu Matzicken (Kreis Heydekrug) in Ostpreußen, verstorben am 21. November 1928 in Berlin. Aus einer alten holländischen Mennonitenfamilie stammend, absolvierte das Gymnasium in Tilsit und studierte 1875–79 an den Universitäten Königsberg und Berlin Geschichte, Literatur und moderne Philologie. Er entschloß sich unter manchen innern und äußern Bedrängnissen, sich der Literatur zu widmen, war eine Zeitlang in der Redaktion eines kleinen Volksblattes beschäftigt, zu andrer Zeit Hauslehrer beim Dichter Hans Hopfen. In diesem ersten Jahrzehnt seiner literarischen Tätigkeit schrieb S. eine große Zahl von Novellen, die nicht beachtet, und Dramen, die nicht gespielt wurden. Erst mit dem außerordentlichen Erfolg seines bürgerlichen Schauspiels »Ehre« (1888), womit er sich der naturalistischen Richtung anschloß, ohne ihre äußersten Konsequenzen zu ziehen, änderte sich seine literarische Stellung so sehr zu seinem Vorteile, daß er nun in die erste Reihe der zeitgenössischen Dichter vorrückte. Zunächst förderte dieser Erfolg die Verbreitung seiner Erzählungen und Romane: »Frau Sorge« (Berl. 1888), »Der Katzensteg« (das. 1889), »Im Zwielicht«, zwanglose Geschichten (das. 1890), »Jolanthes Hochzeit«, Novelle (das. 1893), »Es war« (das. 1894), die bisher in vielen Auflagen erschienen sind. Trotz seiner großen Erfolge als Erzähler verlegte S. das Schwergewicht seiner dichterischen Arbeit in die dramatische Produktion, und er schrieb das Trauerspiel »Sodoms Ende« (1890), ferner die Schauspiele: »Heimat« (1893), »Die Schmetterlingsschlacht« (1894), »Das Glück im Winkel« (1895), die drei Einakter »Teja«, »Fritzchen« und »Das ewig Männliche« (vereint u. d. T.: »Morituri«, 1896), »Johannes« (1898), »Die drei Reiherfedern« (1899), »Johannisfeuer« (1900), »Es lebe das Leben« (1902), das Lustspiel »Sturmgeselle Sokrates« (1903), »Stein unter Steinen« (1905), »Das Blumenboot« (1905), die vier Einakter: »Rosen« (1907). Auch diese Werke haben hohe Auflagen erlebt und sind über die meisten deutschen, zum Teil auch über ausländische Bühnen gegangen; sie zeichnen sich durch sehr gewandte Technik aus, greifen auch interessante Probleme auf; aber S. weiß zu diesen nicht entschieden Stellung zu nehmen, er erzeugt nur Augenblickswirkungen, erschaut das Leben nicht in seiner Tiefe mit den Augen des echten Dichters und verletzt oft das feinere ästhetische Gefühl durch Darstellungen ungesunder Erotik. Vgl. Brandes, Menschen und Werke (3. Aufl., Frankf. 1900); Litzmann, Das deutsche Drama (4. Aufl., Hamb. 1897); Grotthuß, Probleme und Charakterköpfe (4. Aufl., Stuttg. 1904); Bulthaupt, Dramaturgie des Schauspiels, Bd. 4 (5. Aufl., Oldenb. 1907); S. Friedmann, Das deutsche Drama des 19. Jahrhunderts in seinen Hauptvertretern, Bd. 2 (Leipz. 1903); W. Kawerau, Hermann S. (2. Aufl., das. 1899); Landsberg, Hermann S. (Berl. 1901 u. ö.); H. Schoen, H. S., poète dramatique et romancier (Par. 1905); Axelrod, Hermann S., eine Studie (Stuttg. 1907).
Der Katzensteg
1
Der Friede war geschlossen. Die Welt, mit welcher der Korse ein halbes Menschenalter hindurch Fangball zu spielen gewagt, hatte sich wiedergefunden. –
Zerschunden, zerfetzt, aus tausend Wunden blutend, mit Schlachtfeldern besät wie mit eiternden Schwären, halb Kirchhof und halb Trümmerstätte – so fand sie sich wieder.
Aber die Menschheit, die jüngst befreite, ahnte nichts von dem eigenen Jammer. – War der Boden, aus dem ihr Brot entsproß, auch mit Blut gedüngt – nun wohl! – so trug er fortan um so reichere Frucht; hatten Kugel und Bajonett auch ihre Reihen gelichtet, was tat's? – so fanden die Übrigbleibenden Raum, die Ellenbogen aufzustemmen. – Man konnte sich doch wieder regen in dem locker gewordenen Menschenknäuel.
Ein einziger Jubelschrei von Gibraltars Felsen bis zum Nordkap hallte den Himmel auf. – An jedem Glockenstrange hing ein zappelnder Bursche, von jedem Altar, aus jedem Kämmerlein erscholl ein Dankgebet. – – – Die Trauernden verkrochen sich, ihre Klage erstickten die Lobgesänge, ihre Tränen sog die Erde mit demselben Gleichmut ein, mit dem sie die Blutstropfen der Gefallenen in sich aufgenommen hatte.
Zur schönen Maienzeit waren in Paris die Friedensartikel unterzeichnet worden – – In den Blutlachen blühten die Lilien, und aus den Rumpelkammern holte man die blutgetränkten Lilienbanner. – Die Bourbonen krochen aus den Winkeln hervor, in die Robespierres Rasiermesser sie gejagt hatte, wischten sich die schlaftrunkenen Augen aus und fingen flott zu regieren an. Vergessen hatten sie nichts, gelernt nur eine schöne neue Vokabel aus Talleyrands Entout-cas-Fibel! Sie lautete: Legitimität.
Die übrige Welt hatte zuviel mit sich zu tun, hatte zu viel an Siegeskränzen zu winden und Pokale zum Willkomm zu kredenzen, als daß sie sich um diese Farce kümmern konnte.
Gerötet vom Fieber der Erwartung, starrte ein jedes Auge gen Westen, woher sie kommen mußten, die Helden, die lorbeergekrönten, sie, die um der heiligen Scholle willen, um Weib und Kind, um Recht und Vaterland den Feuerschlünden des korsischen Dämons Leib und Leben dargeboten hatten. – In seine hintersten Höhlen hinein hatten sie ihn verfolgt, bis er geknebelt zu ihren Füßen gelegen.
Just hatten die deutschen Eichen sich neu begrünt, gewärtig, alsbald mit Lachen geplündert zu werden, da begannen die Sieger heimzukehren.
Voran – in frohen, zwanglosen Schwärmen – der Stolz, die Blüte des Vaterlandes, die Söhne der Reichen, die als freiwillige Jäger mit eigenem Pferd und eigenen Waffen in den heiligen Krieg gezogen waren.
Ihr Weg durch Deutschland war ein einziger Reigen rauschender Feste. Wohin sie kamen, traten sie auf Rosen; die schönsten Jungfrauen wollten von ihnen geliebt, die edelsten Weine wollten von ihnen getrunken sein.
Hinter ihnen her ergoß sich ein Strom von Kosaken über die deutschen Gefilde. Vor einem Jahre, als sie gleich einer Furienschar hinter den halbtotgehetzten Resten der großen Armee einhergejagt waren, hatte Deutschland sie jubelnd als Befreier begrüßt, Magistrate hatten sie in feierlichem Zuge eingeholt, Hymnen waren zu ihrem Preise gedichtet worden, und blauäugig-germanische Sentimentalität war übergeflossen zugunsten ungewaschener Tatarenmäuler.
Auch jetzt wurden sie pflichtschuldigst gefeiert, aber die Sehnsucht der Deutschen schaute über sie hinweg, als wären sie nur die Schatten derer, die noch kommen sollten.
Und endlich kamen auch sie – die Männer des Volks, sie, die kein andres Kapital als ihr nacktes Leben besessen hatten, um es dem Vaterlande anheimzugeben. Ein Schall wie von geborstenen Trompeten ging vor ihnen her – träge Staubwolken schleppten sich hinterdrein.
Nicht hoch und herrlich, wie die Phantasie der Heimgebliebenen sie sich ausgemalt, ein Strahlendiadem über dem Haupte, den wallenden Mantel gleich einer Toga um den stolzen Leib geschlagen – stumpf und dumpf wie abgetriebene Gäule, schmutzig und zerlumpt, von Ungeziefer strotzend, die Bärte von Staub und Schweiß zusammengeklebt, so kehrten sie heim. – Hier einer, der, bleich und abgezehrt wie ein Schwindsüchtiger, nur mühsam einen Fuß vor den andern schob, dort einer, der vertiert und gierig in die Runde blickte, den Widerschein von Brand und Glut im trüben Flackern des Auges, die knotigen Fäuste noch immer von Mordlust zusammengekrampft. Nur hie und da leuchtete der reine Glanz hochherziger Rührung aus tränenerfülltem Auge, nur hie und da falteten über dem Kolben sich zwei Hände dankbar zum Gebet....
Aber willkommen waren sie alle. – Und so verroht und versteinert hatte noch niemanden das blutige Rächergewerbe, daß nicht Tränen und Küsse ihm zum Labsal wurden und die Ahnung wiederkehrender reinerer Zeit in seiner Seele aufdämmern ließen.
Freilich ganz mit einem Male ließen die aufgestachelten Leidenschaften sich nicht zur Ruhe bringen. – Die Faust, die bisher das Schwert geführt, braucht Zeit, um sich wieder an die Pflugschar oder das Richtmaß zu gewöhnen, und nicht jedermanns Sache ist es, die wilde Ungebundenheit des Biwaks am frommen Herdfeuer zu vergessen. – –
Wie nach jedem Friedensschlusse gab's drum auch Anno vierzehn für Deutschland eine tolle Zeit. Das Jahr, dessen Name zu uns, den Spätgeborenen, wie ein großer Akkord aus Lobgesängen, Orgelrauschen und Glockenklang herübertönt, sah mehr an Gewalttat und Verbrechen als irgend eines vorher oder später. Besonders wild gebärdete die entfesselte Bestie im Manschen sich in jenen Distrikten, in denen vor dem Kriege der Übermut der Franzen in seiner ganzen mörderischen Lustigkeit gehaust hatte, und am wildesten da, wo der Blutgeruch von Schlachtfeldern, der Feuergleisch von angezündeten Wohnstätten auch die Sinne der Heimgebliebenen mit wüsten Bildern erfüllt hatten, wo gar heimlicher Verrat und tückische Feigheit noch immer ungesühnt nach Rache schrien. Fast schien es, als ob der aufgewühlten Vaterlandsliebe die Ströme jüngst geflossenen Blutes noch nicht genügten, die Schmach des vergangenen Jahrzehntes abzuwaschen. Man konnte ja nicht ahnen, daß der korsische Geier, der in seinem Inselkäfig gefangen saß, schon den eisernen Schnabel wetzte, um die Gitterstäbe zu durchfeilen, und daß noch manche Ader voll quillenden Blutes sich öffnen sollte, ehe er gänzlich zur Ruhe kam. –
2
An einem der letzten Augusttage dieses merkwürdigen Jahres saß in der Sommerstube eines ansehnlichen Bauerngehöfts eine Gesellschaft von jüngeren Männern um den eichenen Eßtisch herum, der in seiner ganzen Breite mit irdenen Bierkrügen und rundbauchigen Schnapsflaschen besetzt war. Der Tabaksqualm, der zwischen den Ritzen der Pfeifendeckel hervorquoll, hüllte die heißen, von Branntwein und Begeisterung leuchtenden Gesichter in seine blaugrauen Wolken.
Es waren jüngst heimgekehrte Vaterlandsverteidiger, die in kriegerischen Erinnerungen schwelgten.
Alle trugen sie den unverkennbaren Zug von Familienähnlichkeit, den gleiche Geburt, gleiche Sitten und gleiche Gedankenbildung auch Blutsfremden aufprägen. Der Krieg hatte ihre derben, ehrlichen Gesichter verwildert und mit Schrammen und Schmarren übersät. Zwei oder drei hatten den Arm noch in der Binde ruhen, und kaum einer war schon zu dem schweren Entschlusse gekommen, den schwarzverschnürten Jägerrock an den Nagel zu hängen.
Es waren Freibauern des Dorfes Heide, zerstreut wohnend und doch nachbarlich verbunden – etliche, die noch unter der Fuchtel des Vaters standen, andre, die bereits in den Besitz des Hofes eingerückt waren. Sie hatten niemals gefront und gescharwerkt, die großen Umwälzungen, welche die Steinschen Gesetze vor wenigen Jahren dem Bauernstande gebracht, hatten auf sie keinen Einfluß gehabt, und als im vorigen Frühling der Heerruf des Königs durch die Lande gegangen, waren sie stolz wie Herrensöhne mit eigenen Waffen und auf eigenem Pferde in die Reihen der freiwilligen Jäger eingerückt, mochte darob auch das letzte Saatkorn zu Markte gewandert sein.
Nur einer unter ihnen, der, welcher auf dem einzigen Polsterstuhle des Hauses, einem schmutzigbraunen, vielfach zerschlissenen Ungeheuer, saß und als der einzige eine Flasche roten Weines vor sich stehen hatte, gehörte augenscheinlich andern Lebenskreisen an.
Er hatte ein bleiches, etwas gelblich getöntes Gesicht von feinen, weichgeschnittenen Formen, braune, düstere Augen und lange, schwarze Wimpern, die beim Niedersinken tiefe Schattensegmente auf die schmalen Wangen warfen. Wiewohl er der jüngste von allen schien – er konnte das zweiundzwanzigste Jahr kaum überschritten haben –, sah er aus wie einer, der mit der Lust dieses Lebens abgeschlossen hat. Eine trotzige Energie thronte auf der faltenfreien Stirn, und in den bläulichen Augenhöhlen lag etwas wie ein alter Gram. –
Er trug einen grauen Rock, der in den Achseln zu enge schien, und darunter ein blauwürfliges Wollenhemd mit zerzaustem Gefältel und einer Reihe von Perlmutterknöpfen. Das einzig Militärische an ihm war die Feldmütze mit dem Landwehrkreuz, die er in den Nacken zurückgeschoben hatte, offenbar, weil der harte Lederschirm auf die kaum verharschte Narbe drückte, die sich als glühender Streif aus dem dunklen Gelock quer über die hohe Stirn zog.
Aller Augen hingen an ihm. – Jedes Wort wollte vorerst von ihm vernommen sein. –
Neben ihm saß ein junger, kräftiger Bursch, wenig älter als er, der mit zärtlicher Besorgnis ihn unaufhörlich beobachtete – der Wirt des Hauses ohne Zweifel. Er hatte die rechte Schläfe weiß bepflastert. Lachend und kühn guckte das rotwangige, runde Gesicht unter dem blonden Haarwalde hervor, der mit seinem wirren Gelock noch Hals und Nacken umrahmte.
»Aber du trinkst ja nicht, Leutnant!« ermunterte er ihn, die Flasche näher an ihn heranschiebend, »du bist an unser Bier nicht gewöhnt und an den Schnaps noch weniger – brauchst dich drum gar nicht zu genieren, das rote Zeug zu saufen, das mir gestohlen werden kann. – Reich sind wir nicht, das weißt du, aber so viel haben wir doch, daß, wenn du bei uns bleiben willst, täglich bis an dein Lebensende solch eine Flasche für dich parat stehen soll. Nicht wahr, Jungens?«
Jubelnd stimmten die andern bei und drängten sich herzu, mit ihren Krügen und Schnapsgläsern an sein halbzerbrochenes Weinglas anzustoßen.
Ein Leuchten dankbarer Freude glitt über das düstere Gesicht.
»Ich hab's wohl gewußt«, sagte er, »daß ich bei euch eine Heimat finden würde – sonst wär' ich auch nicht eingekehrt.«
»Noch schöner!« rief der Wirt. »Haben wir uns deshalb Blutsbruderschaft geschworen vor der ersten Schlacht – in der Kirche damals – in dem verfluchten Nest – dessen Namen ich nie behalten kann?« –
»Dannigkow hieß das Nest«, erwiderte der junge Fremde, den man »Leutnant« anredete.
»Weißt's noch so gut«, erwiderte der Wirt, »und hättest am Ende daran denken können, dich an uns vorbeizuschleichen? – Hatten wir dich deshalb zu unserem Offizier gewählt und waren dir blindlings nachgesprengt immer ins Dickste 'rin? – Blut und Tod, das leimt zusammen, Baumgart, und drum schere dich den Teufel um die Welt und bleib bei uns.«
»Schwatz kein dummes Zeug, Alterchen«, erwiderte der Leutnant und blies nachdenklich gegen den purpurnen Spiegel des Weins.
Aber jener ließ sich nicht abweisen.
»Du kannst sicher sein«, fuhr er fort, »daß wir dir nie mit neugierigen Fragen zu Leibe rücken werden. Wir sind ja von jeher gewohnt, dich als ein Stück Geheimnis zu betrachten. Wenn wir andern beim Biwakfeuer lagen und uns von Haus und Hof, von Mutter und Vater, von Suff und Liebschaften erzählten, dann kniffst du alleweil den Mund zusammen, akkurat wie du's jetzt wieder tust. Faßte sich einer aber ein Herz und fragte dich, wo du her wärst und was du sonst getrieben hättst, dann standst du auf und gingst ab ... Da gewöhnten wir uns denn das Fragen ab und dachten: Er mag wohl was ausgefressen haben, was ihm das Leben verleidet hat.... Schließlich, was geht's uns an? Ein guter Kamerad warst du, das Zeugnis geben wir dir – und mehr als das, der Bravste, der Tapferste, der ... na, kurz und gut: hättst du einem von uns befohlen: geh, hack dir die rechte Hand für mich ab – wahrhaftig, ohne Murren hätt' er's getan. – Red' ich die Wahrheit, Jungens?«
Ein Rufen des Beifalls ging rings um die Tafelrunde.
»Hört endlich auf«, sagte der junge Leutnant, die Jubelnden von sich wehrend. »Ihr lobt mich ja in Grund und Boden hinein.« –
»Der hinkende Bote kommt nach!« fuhr der Hausherr fort. – »Wir sind auch gehörig unzufrieden mit dir gewesen. Du weißt wohl noch, wie das kam. Es war während des Waffenstillstandes, kurz nachdem wir uns mit den Litauern unter dem tollen Platen und den Bülowschen vereinigt hatten. Da ließest du eines Abends Ronde machen und erklärtest uns: ›Jungens, ich muß euch verlassen – – fragt nicht, warum? – Aber glaubt mir, ich kann nicht anders – die Landwehr braucht Offiziere. Es ist keine Ehre, von den freiwilligen Jägern zur Landwehr überzuspringen, aber ich geh' zur Landwehr.‹ – War's nicht so, Baumgart?«
Der junge Leutnant nickte, und um seine Lippen spielte ein Zug aufquellender Bitterkeit.
»Wir sahen, wie dir dabei das Wasser in den Augen stand, sonst wär' wohl einer oder der andre mit der Frage gekommen: Ist das der Dank für das Vertrauen, welches wir dir geschenkt haben, daß du uns jetzt verläßt, jetzt gerade, wo wir den Platenschen zeigen wollen, was 'ne echte und rechte Franzosenhetze ist? – Und drum ließen wir dich ohne Widerrede ziehen, wenn uns auch das Herz dabei geblutet hat. – Keiner hat später noch einen Ton über dich erfahren, so viel wir auch nachfragen taten, aber das können wir dir versichern: noch monatelang haben wir allabendlich von dir gesprochen und uns den Kopf zerbrochen, was dich wohl fortgetrieben haben möchte und was du wärst und dergleichen sonst, so daß diejenigen, die später zu uns stießen und dich nicht gekannt hatten, meinten, das ewige Gerede von dir sei ihnen langweilig und wir hätten besser getan, mit dir zusammen zu den Schmutzfinken von der Landwehr zu kapitulieren. Siehst du, so haben wir an dir gehangen, und dafür willst du uns schon nach ein paar Tagen den Rücken kehren! Vom Marnestrom bis hinter die Weichsel ist ein weiter Weg, wenn man ihn einsam und zu Fuße macht, und deine Wunden knurren auch noch immer. Drum ruh dich aus und erzähl uns nach und nach, wie's dir bei den Graubärten eigentlich ergangen ist und wie es kam, daß du in Gefangenschaft gerietst – denn du und gefangen, das muß ja ein absonderlicher Zufall gewesen sein.«
Er blickte mit naivem Stolze auf das Eiserne Kreuz hernieder, das zwischen den Fangschnüren seines Rockes erschimmerte. Es war ihm zum Lohne dafür geworden, daß er sich einst, ohne den dargebotenen Pardon anzunehmen, mit Schwabenstreichen aus einem Knäuel französischer Husaren herausgehauen hatte.
Die Brust des jungen Landwehrleutnants war jeden Schmuckes bar. Als gegen Ende des Feldzuges die große Flut von Dekorationen sich über die siegreichen Krieger ergoß, hatte er sich wahrscheinlich schon in Gefangenschaft befunden. –
Ein peinliches Gefühl des Zurückgesetztseins, der Scham vielleicht, mochte in ihm sein Spiel treiben. Er rückte die Landwehrmütze in die Stirn zurück, und den Stuhl mit einem gewaltsamen Ruck nach hinten schiebend, als dulde es ihn nicht länger in den Lotterpolstern, sagte er: »Ich dank' euch für die gute Absicht, aber ich muß nach Königsberg, mich beim Kommando zu melden.«
»Da wirst du lange suchen müssen«, entgegnete einer, der den rechten Arm in einer schwarzen Binde trug, ein krausköpfiger Gesell mit glänzend braunen Augen. »Weißt du denn nicht, daß die Landwehr gleich nach ihrer Rückkunft entlassen worden ist?«
»Selbst der Stab soll sich auslösen«, fügte ein andrer hinzu.
»So muß ich mein Heil bei der Generalkommission versuchen«, entgegnete Leutnant Baumgart. »Ich habe mehr Ursache als jeder andre, dafür zu sorgen, daß meine Abschiedspapiere in guter Ordnung sind. Das glaubt mir. Mir soll keiner nachsagen dürfen, daß ich mich heimlich aus der Armee herausgeschlichen habe. Also kurz und gut: Gibt's morgen Fahrgelegenheit auf der Königsberger Landstraße?«
Ein Sturm der Entrüstung erhob sich. Man drängte auf ihn ein, man umfaßte seine Hände, man schloß einen Kreis um ihn, als gelte es, ihn schon im nächsten Augenblick am Entweichen zu verhindern.
»Bleib wenigstens so lange, daß das Fest, das wir dir zu Ehren geben wollen, nicht ins Wasser fällt«, ließ sich Karl Engelbert, der junge Wirt, vernehmen, als der Lärm ein eigen Wort verstattete.
Baumgart fuhr mit hastiger Bewegung nach dessen Sitze herum.
»Mir zu Ehren?... Ihr seid toll geworden!«
»Da hilft kein Wehren mehr!« entgegnete ihm jener. »Die Sache ist schon längst gedrechselt. Vor drei Tagen, gleich nachdem du hier hereingeschneit warst, hab' ich den Johann Radtke auf die Wanderschaft geschickt mit 'ner Liste von all den freiwilligen Jägern, die im Kreise zu Hause sind, denn wir haben hier Leute aus sechs oder acht Regimentern – vor allem sollt' er nach Schranden, wo der Merckel wohnt – der bei den Platenschen gestanden hat und dann gleicherweis' zur Landwehr gegangen ist. Aber bei dem hat's 'nen Sinn gehabt, weil sie ihm dort erst das Leutnantspatent zugesichert hatten.«
Baumgart war bei Nennung des Namens sichtlich zusammengefahren, aber sofort hatte er sich gefaßt, und halb vorgebeugt, mit klammerndem Griffe die rohen Lehnenknäufe seines Sessels umfassend, hörte er schweigend an, was der gutmeinende Freund ihm über die werdende Ruhmesfeier zu berichten wußte ... Er widersprach nicht mehr, vielleicht weil ein offner Widerstand ihn nutzlos dünkte, aber in dem unruhigen Seitwärtsblinzeln seines Auges lag etwas wie ein Fluchtgedanke.
Den Freunden, deren aufgewühltes Blut in der Heimat noch immer nicht zur Ruhe kommen wollte, war jeder Anlaß recht, der sie über die Dumpfheit schlichter Werkeltage, in die sie zu versinken drohten, und war's für etliche Stunden, hinaushob. Sie besprachen mit großer Wichtigkeit die Rückkehr ihres Vertrauensmannes, der schon am Vormittag von dem fünf Meilen entfernten Schranden her erwartet wurde.
»Bin doch neugierig«, sagte Peter Negenthin, der mit der schwarzen Binde, »was die Schrandener mit ihrem saubern Gutsherrn angefangen haben!«
Der Leutnant Baumgart horchte auf.
»Den roten Hahn haben sie ihm schon längst aufs Dach gesetzt«, versetzte ein andrer, »seit fünf Jahren soll er zwischen den schwarzen Brandmauern hausen wie ein Uhu.«
»Warum baut er denn sein Schloß nicht wieder auf?« fragte ein dritter. »Warum? Weil die Bauern und Bürger drunten im Dorf jeden zuschanden prügeln, der für ihn arbeiten kommt. Einmal hat er sich Tagelöhner aus dem Masurschen verschreiben lassen, hat gedacht, weil sie kein Deutsch verstehen, werden sie bei ihm aushalten – da hat's denn in den Schenken unten 'ne regelrechte Schlacht gegeben, und – schupp, schupp! – sind die Polacken wieder abgeschoben. Seitdem macht er nicht einmal Miene mehr, seine Länder zu beackern.«
»Wovon lebt er denn?«
»Was geht's uns an?... Mag er verhungern!«
Mitten in das Gelächter des Hasses, das dieser wenig barmherzige Wunsch bei den Söhnen des Landes hervorrief, trat, dampfend und schweißbedeckt von hastigem Ritte, der ausgesandte Bote, ein kurzer, gedrungener Bursche mit blondem, schlichtem Haupthaar, das gelb und glänzend wie ein neues Strohdach auf sein feistes, von der Sonne krebsrot gekochtes Gesicht herabfiel.
Bevor er zu reden anhub, griff er nach der großen Steinkanne, die in der Mitte des Tisches stand, und mit beiden Fäusten ihren weitausgeschweiften Bauch umklammernd, sog er sich an ihrem Rande fest, bis sie ihm mit Gelächter vom Munde gerissen wurde.
Unter allerhand Possen und Fratzen stattete er Bericht ab.
Das große Fest war von vornherein gesichert. – Allen im Kreise juckte die Haut nach Tanz und Suff und Feuerwerk, und wenn sich's so machte, zur Feier der deutschen Einigkeit auch nach einer gediegenen Prügelei; nur über den Ort, an dem das alles vor sich gehen sollte, hatte noch Zwiespältigkeit geherrscht. – Vor allem begehrten die Schrandener, der Leutnant Merckel voran, daß der Schrumm bei ihnen gefeiert würde.
»Warum? Jungens, das ist eine Bande – die Schrandener. Ganz aus dem Häuschen vor Freude – sauft und tollt den ganzen Tag. Immer Bein' in die Höchte. – Warum? Weil sie sich verschworen haben, ihren Baron, den Vaterlandsverräter, der sie verschimpfiert hat in alle Ewigkeit – wißt ihr, was sie dort für einen Choral in der Kirche singen seit sieben Jahren:
Unser gnäd'gen Herrn von Schrunden, Der uns bedeckt mit Schimpf und Schanden, Der uns gemacht zu Hohn und Spott, Schlag mit der Pest, o Herre Gott! –
Das singen sie dort allsonntäglich, und nun, wie ihr Gebet halbwegs erhört worden ist, haben sie sich verschworen, ihn hinter dem Zaun vermodern zu lassen.«
Erregte Fragen drangen von allen Seiten auf ihn ein. »Ist er tot, der Hund? – hat der Teufel ihn endlich geholt?«
Mitten in das Lärmen drang ein knackender, prasselnder Laut. Die Hand des jungen Baumgart hatte die Lehne des Sessels so heftig umklammert, daß das morsche Holz mitten durchgebrochen war. Er selbst saß blaß und regungslos und starrte den Sprecher mit weitgeöffneten Augen an, ohne des Übels, das er dem alten Erbstück angetan, gewahr zu werden.
Und der lustige Johann Radtke fuhr fort: »Sie werden ihn wohl glücklicherweise zu Tode geärgert haben – wenigstens hat der Schlag ihn gerührt, als sie ihm gerade den Katzensteg zerstören wollten. Leutnant, hast du je vom Katzensteg gehört?« Der stierte immer noch zu ihm empor und sprach kein Wort. Seine Zähne hatten sich in die Unterlippe eingebissen. Wie versteinert saß er da.
»Der Katzensteg ist nämlich der Weg, auf dem der Baron Anno sieben die Franzosen, die das Schloß Schranden besetzt hielten, den Preußen in den Rücken geführt hat. Von dem Schrandener Überfall wirst du doch wohl gehört haben – der steht ja in jedem Kalender.«
Der Leutnant nickte ein paarmal langsam vor sich hin, wie einer wohl tut, der verurteilt ist, sich in ohnmächtiger Ergebung mit seinem Schicksal abzufinden.
»Vor ihren sehenden Augen ist er umgesunken«, erzählte Johann Radtke weiter, »der Schaum hat ihm vorm Mund gestanden – und sein feinslieber Schatz, die Tischlerstochter aus dem Dorf, die mit ihm lebt, hat sich über den Leichnam geworfen. – Wer weiß, was sie sonst noch damit angefangen hätten in ihrer blut'gen Wut.«
»Und nun wollen sie ihn nicht begraben lassen, sagst du?« warf der gutmütige Karl Engelbert mit bedenklichem Kopfschütteln darein. »Ist denn das erlaubt in einem christlichen Staat?«
Johann lachte verschmitzt.
»Die Schrandener halten zusammen wie die Kletten, und wenn sich keiner die Hand beschmutzen will, so 'nen Hundsfott zu Grab zu tragen, kann man's ihnen nicht übelnehmen.«
»Aber wenn's der Obrigkeit zu Ohren kommt?«
»Obrigkeit – hahaha! – Der alte Merckel ist ihre Obrigkeit, und der hat gemeint, seinetwegen wär' der Schindanger noch – – –« Ein Schrei voll Not und Qual, wie aus erstickender Kehle, hieß ihn verstummen. Aufgerichtet, weiß wie der Kalk an der Wand, stand der junge Leutnant da, die Arme mit geballten Fäusten halb abwehrend, halb drohend gegen ihn ausgestreckt. An seinen bläulichen Lippen hing ein Blutstropfen und rann, eine leuchtende Furche hinter sich ziehend, langsam auf das Kinn herab.
Ein Stammeln, tonlos, kaum verständlich, kam aus seinem Munde, aber wer es verstanden hatte, erstarrte in bleichem Entsetzen.
»Hör auf«, hatte er gesagt, »hör auf!... Es ist mein Vater.«
3
Der Mond stand hoch am Himmel und ergoß seinen stillen, bläulichen Schein weithin über die schlafende Heide. – Die Erlengruppen im Moor trugen Kränze von Licht, und von den schlanken, weißstämmigen Birkenbäumchen, die in endloser Reihe den breiten, geraden Fahrweg einfriedeten, ging ein Flimmern und Leuchten aus, daß es aussah, als ob der Weg fernab zwischen silbernen Schranken sich verlöre.
Schweigen weit und breit. Die Vögel waren längst verstummt. Spätsommerfriede, der Friede gesättigt ersterbenden Daseins lag auf der weiten Flur. Kaum daß eine Grille vom Grabenrande her sich hören ließ, kaum daß eine aufgescheuchte Feldmaus mit leise schwirrendem Pfeifen durch die hohen Halme glitt.
Mit Ränzel und Knotenstock schritt einsam ein Wandersmann des Weges daher, unbekümmert um den Zauber der mondgetränkten Landschaft vor sich hinstarrend.
Der junge Leutnant war's, der nach der Heimat zog, den geächteten Vater zu begraben.
Der Gastfreund hatte ihm sein Staatsfuhrwerk aufdrängen wollen, hatte ihm dann, da alles Bitten nutzlos gewesen war, für eine weite Strecke zu Fuß das Geleite gegeben und ihm zum Abschiede hoch und heilig versichert, die Blutsbrüderschaft, die einst beschworene, werde bestehen bleiben, den Sünden der Väter zum Trotze, und er dürfe auf ihn und seine Nachbarn zählen jetzt und für alle Zeit ...
Anstatt ihm wohlzutun, war ihm der gutgemeinte Trost wie Hohn ins Ohr gedrungen. Was von »Sünden der Väter« mitten darein klang, empfand er als Schimpf, ihm selber angetan, einen Schimpf, den er stillschweigend hinnehmen mußte, weil gegen die Schmach, die der Vater ihm als Erbe auf die Schultern geladen hatte, ein Auflehnen nicht möglich war.
Und in finsterem Hinbrüten ließ er die Bilder dessen, was geschehen, an sich vorüberziehen. –
Er hatte den Vater nie geliebt. Der war ein rauher, gewaltsamer Mann gewesen, der die Bauern peitschte, von dessen Lachen und von dessen Schelten das Haus in gleicher Weise erzitterte und vor dem er selber nicht mehr galt als etwa der Teckel, der ihm, wenn er gut gelaunt war, in die Absätze beißen durfte und den er im nächsten Augenblick mit einem Fußstoß weit in die Lüfte schleuderte. Die knorrige, kleine Gestalt, das gelbe, breitknochige Gesicht mit dem kohlschwarzen Knebelbart und den kleinen, funkelnden grauen Augen hatte ihm, so weit er zurückdenken konnte, als Schreckbild gegolten. Seine Mutter hatte er nie gekannt. Sie war wenige Jahre nach seiner Geburt langem Siechtum zum Opfer gefallen. Drunten im Dorf erzählte man sich, der Baron habe sie mit seinem Zorn und seiner Liebe zu Tode gequält.
In der düsteren, hochgewölbten Galerie, dort, wo von den steinernen Wänden die Schritte so schauerlich widerhallten und wo einen selbst im heißesten Sommer ein Frösteln anwandelte, hatte als das letzte einer langen, gespensterhaften Reihe ihr Bild gehangen. Das Bild einer zarten, verkümmerten Frau mit schmalen, blutleeren Lippen und halbgeschlossenen Lidern, die in Schwäche und Mutlosigkeit niedergesunken schienen.
Gar manche unbewachte Stunde lang hatte der Knabe einst vor diesem Bilde gestanden und sehnsüchtig gewartet, daß diese Lider sich erhöben, damit auch in sein junges, einsames Leben ein Strahl der Mutterliebe fiele. Aber mochte er auch in heißem Gebete die Hände falten, mochte er tränenüberströmt in herzklopfendem Bangen dem Augenblicke der Belebung entgegenharren, müd und schläfrig wie immer, schon halb verfallen der großen Ruh, fuhren die Augensterne fort, mit ihrem fremdartig metallischen Schimmer auf ihn herniederzustarren, bis er verzweifelt sich losriß und von dannen stürzte.
Neben dem Bilde der Mutter hing ein ander Bild, in seiner Art nicht minder beachtenswert als jenes – das Porträt eines strahlend schönen, schwarzlockigen Weibes, das im Begriff ist, zu Pferde zu steigen. Ein Dolman von rotem Samt, goldverschnürt, mit Wieselpelz umrandet, fällt ihr über die linke Schulter, in der rechten Hand, die ein langer, faltiger Stulpenhandschuh bedeckt, schwingt sie die Reitgerte, als wollte sie sie auf die Schulter eines Übeltäters niedersausen lassen. – Ein dämonischer Lebenswille glüht und blitzt in diesen Augen, die kühn und gebieterisch in die Ferne schauen, erwartend, daß alles, was da nahe, sich ihrer Gnade anheimgebe.
So hatte die alte Großmutter, die mit ihrem Keifen und Schelten, ihrem Krückstock, ihren Likörgläsern und Tabatieren unheimlich und hexenhaft in die frühesten Erinnerungen des jungen Mannes hineinspukte, in ihrer Jugend ausgesehen. Sie war der Unstern des Hauses geworden, denn sie, die vor ihrer Hochzeit am sächsisch-polnischen Hofe eine hochgefeierte Schönheit gewesen war, hatte dem Vater die Liebe zum Polenlande schon mit der Milch ihrer Brüste zu trinken gegeben, so daß er, der Edelmann von deutschem Namen und ordensritterlicher Herkunft, mitten in einer deutschen Gegend lebend, das Deutschtum zu verleugnen anfing und sein Herz an die todgeweihte Sache der Polen hängte. – Wohl war es ein deutsches Fräulein gewesen, mit dem er an den Altar getreten war, aber er hatte sich nicht entbrechen können, seinem ersten und einzigen Sohne einen polnischen Namen anzuhängen, mit dem er nun in einer Zeit überreizter Vaterländlerei, wie mit einem Erbübel behaftet, umherlief. –
Aber was bedeutete der unschuldige Name Boleslav, verglichen mit jener ungeheuren Schmach, die der Vater in seiner grimmerfüllten Polenliebe sich und seinem Geschlechte angetan hatte!
Nun war er tot, und »mit den Toten soll man nicht hadern«, sagte der Sohn jenes Vaters zu sich, aber in demselben Augenblicke überkam ihn mit ganzer Gewalt das Bewußtsein der Schandentafel, die er mit sich schleppte, wo er ging und stand, und von der keine Macht der Erde ihn je befreien konnte. Klagend und anklagend streckte er die Arme zu dem bläulich leuchtenden, mattgestirnten Himmel empor, als wolle er Rechenschaft von der Seele des Vaters heischen, die sich irgendwo in fernen Welten verkrochen.
Dann kam mit jähem Rückschlag ein weicheres Empfinden über ihn.
Er warf sich am Grabenrande in das taufeuchte Gras und preßte die Hände vors Gesicht. Ihm war einen Augenblick lang, als könne er weinen, aber seine Lider blieben heiß und trocken. Zu schwer lastete der ahnende Druck dessen, was ihm bevorstand, auf seinem Gemüte. Er bedachte, wie grauenvoll verdüstert und verzerrt er in wenigen Stunden wiederfinden würde, was einst gebadet im Lichte sonniger Kindheit vor ihm gelegen hatte.
Denn auch ihm, dem einsamen, mutterlosen Knaben hatte sie geschienen, die Kindheitssonne. Undank, Frevel wär's gewesen, das zu leugnen.
Durch Feld und Wald hatte er streifen dürfen, frei, ungebunden durch Essensstunde und Schlafenszeit, wie nur ein Räuber im böhmischen Walde oder ein Trapper in Arkansas, denn um sein Kommen und Gehen kümmerte sich niemand. – Wenn der Maiwind über das Zittergras strich und die gelben Falter von Blume zu Blume glitten, dann durfte er zwischen Halmen und Blüten auf dem Rücken liegen und zum blauen Himmel starren, solange es ihm gefiel – vom Morgen bis in die Nacht hinein, falls ihn nicht hungerte – es ging niemand was an. Und wenn es ihm behagte, mit dem Schäfer auf die Heide hinauszuwandern, sich aus dessen Schnappsack mit Schwarzbrot zu nähren und seinen Durst im Triftgraben zu löschen, so fand auch hiergegen niemand was einzuwenden.
Um das Schloß herum, das von seinem Hügel weit in das Land hinaussah, schlang sich in fast geschlossener Schleife mit steilen, umbuschten Ufern und lauschigen Standplätzen der blinkende, fröhliche Fluß. Dort gab es immer etwas Neues. – Bald führten die Knechte die Pferde zur Schwemme, bald wusch der Gerber seine Felle, oder es galt, die Jungen beim Angeln, die Mädel beim Baden zu belauschen ... Des Abends, wenn die Sonne hinter den Erlenstämmen drüben verschwunden war, trat das Wild aus dem nahen Walde hervor, kletterte vorsichtig die steile Böschung hinab und leckte mit schlürfender Zunge das heißbegehrte Naß. Da galt es, schweigend dazuliegen und halbe Stunden lang keine Zehe zu rühren, denn beim geringsten Laut war das märchenhafte Bild davongestoben wie ein Sturmwind. Und wenn nun gar der Mond am Himmel aufstieg und ein Netz von silbernen Maschen über die Wellen breitete – wenn die Erlenbüsche dreinschauten wie weißverschleierte Prinzessinnen und die lustigen Mägde drüben auf der Bleiche ihre traurigen Lieder sangen, dann gab es nichts Herrlicheres auf der Welt, als sich in dem Blätterdickicht zu vergraben und, umgeben von tanzenden Mondlichtern, in den Morgen hineinzuträumen.
Er ließ die Hände vom Gesichte sinken und starrte mit wirren Augen um sich. Das Mondlicht schlief auf den weißen Feldern, nur die Schatten der Bäume, unter denen er saß, reckten sich mit ihren Zacken und Erkern finster und drohend in das Bild lächelnden Friedens hinein. Ein klägliches Geschrei, wie der Jammerlaut eines weinenden Kindes, erhob sich in der Ferne. Ein Junghäschen war's, das sich in den Ackerfurchen verirrt haben mochte und nun hungernd nach der Mutter schrie, ahnungslos, daß jeder Klageruf seinen Mördern als Wahrzeichen diente.
Die Not der Kreaturen durchschauerte ihn. Er erhob sich und wanderte weiter dem düsteren Ziele zu. Auch seine Erinnerungen schritten vorwärts.
Es kam die Zeit, da der alte Pfarrer ihn in die Schule nahm und das weiße Haus zwischen den Nußbäumen seine zweite Heimat wurde. Das Vagabundieren hatte nun ein Ende, denn der graue Feuerkopf hielt strenge Ordnung unter seinen Schülern.
Es waren ihrer zehn oder zwölf, Kinder von Bürgern und besser gestellten Handwerkern, Knaben und Mädchen durcheinander. – Mit den Bauerskindern kam er natürlich nicht zusammen. – Die wuchsen auf wie das liebe Vieh, denn der Lehrer, welchen der Vater für sie eingesetzt hatte, ein ehemaliger Kämmerer, der durch den Trunk unbrauchbar geworden war, trieb sich während der Schulstunden in den Schenken umher.
Aus der Schar seiner Kameraden ragte vor allem Felix Merckel hervor, der Sohn des Gastwirts aus dem Dorfe unten, ein unbändiger Bursche, der schon mit zehn Jahren lange Stiefel tragen und nach der Scheibe schießen durfte – und der mit seinen Fäusten die ganze Schule im Bann hielt. Auch Boleslav, der zwei Jahre jünger war als er und dessen stillerer Natur jenes breite, protzige Drauflosleben gewaltig imponierte, verfiel seinem Einfluß, soweit das Selbstbewußtsein des Herrensohnes und die scheue Ehrfurcht, die sie alle, selbst Felix, ihm entgegenbrachten, es erlaubte.
Felix wurde sein Lehrmeister in allen Künsten, die knabenhafte Ritterlichkeit sich zu eigen macht. Er lehrte ihn Schwimmen, Rudern, Vogelstellen, Feuerwerkmachen, Kaninchen schießen, selbst, wie man abends und zur Kirchenzeit die Gärten der armen Bauern plündert, offenbarte er ihm. Und obwohl das Obst, das er allstündlich im eigenen Garten pflücken durfte, tausendmal süßer und saftiger war als das holzige Zeug, das er heimlich und auf halsbrechenden Kletterwegen gewann, so hätte er es doch nicht übers Herz gebracht, diesen Raubzügen fernzubleiben. Hinterher freilich faßte ihn eine quälende Scham, und meistens trug er den Leuten am andern Morgen hundertfältig ins Haus zurück, was ihnen abends geraubt worden. – Nichtsdestoweniger begegnete er finsteren Mienen und tückischem Lächeln, denn des Vaters Faust lag schwer auf dem armen Gesindel, das damals dem Gute noch fronen und scharwerken mußte ... Was war natürlicher, als daß der Haß, den der Vater gesät hatte, für den Sohn zu einstiger Ernte üppig ins Kraut schoß?...
Die Gestalten der andern Gefährten, der Mädchen insbesondere, waren in seiner Erinnerung zu Nebel zerflossen.
Bis auf eine natürlich.
Ihr Bild schimmerte mit sanftem Sternenscheine durch das Herzeleid, das allgemach sein ganzes Dasein wie mit schwarzen Grabtüchern umhüllt hatte und das selbst der heilige, sühnende Krieg nicht hatte von ihm nehmen können. Ihr Bild hatte ihn in die Schlacht geleitet und war nicht von ihm gewichen, als er, an schwerer Verwundung daniederliegend, langsam in den Tod hinüberzudämmern glaubte. – In der Sehnsucht nach ihr floß das ohnmächtige Glücksverlangen zusammen, das er sich immer noch nicht abgewöhnen konnte. Als ob die Missetat des Vaters ihm den Weg zum Glücke nicht unwiderruflich zerstört hätte.
Wie diese Liebe in seiner Brust herangewachsen war, so mächtig, daß sie eines Tages die ganze Welt mit ihrem Abglanz erfüllte, er wußte es selbst nicht.
Das blonde, kühle Pfarrerstöchterlein, das über keinen Graben zu setzen wagte, selbst wenn er ausgetrocknet war, das immer so furchtbar frisch gewaschen aussah und beim Versteckspiel sich nicht an den Kleidfalten wollte festhalten lassen, »weil sie ausreißen könnten«, war ihm als Kind eigentlich immer fremd geblieben. Manchmal, wenn sie allein miteinander waren und Helene ihm die Herrlichkeiten ihrer Puppenstube zeigte, wo selbst die Wischläppchen gestickte Ränder und eine Namenschiffre trugen, schien es, als wollten sich ihre Herzen enger aneinanderschließen, aber meist benahm er sich dann in seinem freudigen Ungestüm roh und ungeschickt, denn ihr sanfter Tadel erinnerte ihn alsbald, daß er die Schranken durchbrochen, die ihre Freundschaft ihm gesetzt hatte.
Dann pflegte er gekränkt und beschämt von dannen zu gehen und ihr fernzubleiben, bis ihn nach etlichen Tagen ihr mildes, verzeihendes Lächeln wieder an ihre Seite rief. – Er zögerte nicht, denn es war eine lichte Hoheit in ihrem Wesen, die ihn stets wieder in ihren Bannkreis zog.
Felix war diese Anhänglichkeit ein Greuel. Er nannte Helene eine Zierliese und ärgerte sie, wo er nur konnte. Sie ihrerseits hatte eine unnachahmliche Art, mit gerümpftem Näschen über die Achsel hinweg scheinbar auf ihn niederzusehen, wiewohl er einen Kopf länger war als sie, und nur, wenn er's zu arg trieb, ging sie weinenden Auges, ihn beim Vater zu verklagen.
Mit zwölf Jahren verließ Boleslav die Heimat, da die Verwandten seiner Mutter, die dem altpreußischen Beamtenadel angehörten, sich erboten hatten, seine Erziehung zu leiten. Der Vater mochte froh sein, ihn loszuwerden, denn der Lebenswandel, den er seit dem Tode seiner Gattin führte, war nicht dazu angetan, von einem Paar kluger, fragender Kinderaugen mit angeschaut zu werden. Von seinen Reisen in die Hauptstadt brachte er allemal fremde Weiber mit sich aufs Schloß, und manche halb aufgeblühte Knospe, die im heimischen Erdreich aufgewachsen war, fiel seinen Wünschen anheim. Nicht, daß er dies schamlos und öffentlich als frevlerisches Gewerbe betrieben hätte, er liebte nur, sich keinen Zwang aufzuerlegen, und schließlich war, was er tat, nichts wie sein gutes Herrenrecht, das ihm von Traditions wegen verbrieft war und dessen Ausübung im Grunde niemanden wundernahm – wenn nicht den Knaben, der nicht allzuselten Zeuge verliebter Anfälle und tränenreicher Anklagen geworden war.
Auch sonst geschah mancherlei auf dem Schlosse, was für sein Auge schlechterdings nicht geeignet schien. Es kam just die Zeit, in welcher der Heerruf des großen Napoleon das elend geknebelte und zerfleischte Polentum aus der Agonie emporriß. – Unheimliche Regungen des neubelebten Kadavers wurden beobachtet, so weit die polnische Zunge ihre Zischlaute erklingen ließ, und schienen sich selbst nach den rein deutschen Gegenden Ostpreußens fortzupflanzen.
Auf Schloß Schranden kehrten von Zeit zu Zeit geheimnisvolle Fremde ein mit schlanken, schmiegsamen Gestalten und scharfgeschnittenen, hohlen Gesichtern, die auf kleinen Wägelchen eilends das Dorf durchkreuzten und bei Nacht und Nebel wieder verschwanden.
Die Post brachte vielfach versiegelte Briefe mit russischen Stempeln, und des Vaters Arbeitskabinett blieb oft wochenlang vor jedermann verschlossen. Er selbst war finster und schweigsam geworden, ging umher wie im Traume, und die Striemen auf den Rücken seiner Knechte fingen an sich zu entfärben.
Um diese Zeit also geschah's, daß Boleslav zu den Königsberger Verwandten übersiedelte. Jahre ruhigen, wohlbewachten Werdens und Reifens folgten einander. Die Witwe des vormaligen Kanzlers versah Mutterstelle bei ihm, die vornehmsten Häuser der Stadt standen ihm offen.
Bilder und Gestalten der Heimat begannen zu erbleichen. Gelegentliche Besuche des Vaters zeigten ihm nur, wie fremd er ihm geworden war.
Da kam der fürchterliche Winter, in dem die Kriegsfurie die altpreußischen Provinzen verwüstete und der Siegesschritt Napoleonischer Kohorten zwischen Weichsel und Memel widerhallte.
Hinter Königsbergs armseligen Wällen hatten Scharen flüchtiger Provinzler vor dem andringenden Feinde Schutz gesucht. Jedes Haus war mit Menschen vollgestopft bis zum Giebel, und auf den Straßen loderten die Biwakfeuer im Freien kampierender Soldaten.
Mitten in diesem Kriegslärm, zwischen Trommelwirbel und Wehgeschrei, war es Boleslav vergönnt, den Traum der ersten Liebe zu durchträumen.
Er war jüngst sechzehn Jahre alt geworden, und ein vielversprechendes Primanerbärtchen schimmerte bereits, wie mit Kohle angemalt, auf seiner Oberlippe. Er kannte die Oden, die Horaz an Chloe und Lydia gedichtet, auswendig, und was der jüngst verstorbene Friedrich Schiller für Laura gefühlt hatte, war ihm kein Geheimnis mehr.
Eines Januarabends, als er, aus dem Kneiphöfischen Gymnasium heimkehrend, über den Schloßplatz strich, wo russische und preußische Ordonnanzen durcheinander jagten, sah er für einen Augenblick zwei große, blaue Augen fragend und freundlich auf sich gerichtet. Er fühlte sich rot werden, und als er wagte, sich umzuschauen, waren die Augen verschwunden. Am Abend darauf geschah dasselbe – beim dritten Male fand er den Mut, ein wenig besser aufzupassen, und sah, daß zu jenen Augen ein zartes, blondes Angesicht gehörte mit schlankem Näschen und einem Paar blasser, zierlich geschwungener Lippen, die ihn gar holdselig und ermunternd anlächelten. Dies Angesicht erinnerte ihn an ein altes Altarbild im Dome, darstellend die Jungfrau Maria in einem schönen Garten voll steifer Lilien und kurzgestielter Purpurrosen. – Auch an jemand anders erinnerte ihn das Angesicht. Er wußte nur nicht, an wen.
Und wie er darüber noch mit sich zu Rate ging, überzogen die zarten Wangen des Jungfräuleins sich mit rosiger Glut, und die zierlichen Lippen lispelten: »Boleslav – bist du es?«
Nun freilich war er des Zweifelns ledig, und jubelnd rief er: »Helene – Helene – du?«
Hätte sie ihn nicht gar züchtig von sich abgewehrt, er würde sie auf dem weiten Schloßplatze, inmitten kichernder Dirnen und skandalierender Soldaten, an seine Brust gezogen haben. Und als sie nebeneinander in ein stilleres Gäßchen bogen, erzählte sie ihm, daß ihr Vater sie beim Anrücken des Feindes hierher gesandt habe, damit ihr kein Leids von ihm geschehe, und daß sie nunmehr bei einer alten Tante hause, die in einem Stift für unverehelichte Pfarrerstöchter eingekauft sei und gute Tage habe. Sie benutze die Zeit fleißig, um französische und Musikstunden zu nehmen, denn sie wolle sich dem Vater einstmals bei seinem Lehramte hilfreich erweisen, da sie doch wohl keinen Mann bekommen werde.
Das alles erzählte sie in einer sanften, altklugen Art, die ihm gewaltigen Respekt einjagte, und sah ihn dabei von der Seite mit einem ruhigen, zufriedenen Lächeln an. – Von seinem Vater wußte sie nichts zu sagen – er habe sehr grimmig ausgesehen, als sie ihm das letztemal begegnet sei, auch sei sie schon lange ohne Nachricht von Hause, weil dort der Franzos sich eingenistet habe und Nachrichten nicht herüberkämen, aber der Felix Merckel sei hier, den habe sie unlängst getroffen, er sei bei einem Getreidehändler in der Lehre und benehme sich wie ein großer Herr. Der werde gewiß kein gutes Ende nehmen, wenn er schon als Lehrling Zigarren rauche und türkische Halstücher trage.
Zum Schlusse gab sie ihm die Erlaubnis, sie am Freitag bei ihrer Tante aufzusuchen, denn der Freitag sei im Stift der Tag, an welchem Fremde eingelassen würden. –
Als sie mit ihren trippelnden Schritten von dannen ging, leise in den schlanken Hüften sich wiegend, war ihm zumute, als habe die Jungfrau Maria aus jenem Altarbilde ihn mit ihrer holdseligen Erscheinung begnadet und kehre nun wieder zu ihren Lilien und Purpurrosen zurück.
Am Freitag darauf zog er die Klingel des Stifts. – Zwar zwischen Lilien und Purpurrosen fand er sie nicht, aber zwischen einem Fuchsia- und einem Geranienstocke, deren matte, verstaubte Blätter sie gar lieblich umrahmten. Die Glut des Winterabends fiel durch die beeisten Fenster und breitete rosige Schleier über ihr Angesicht. Vielleicht war's auch die Freude des Wiedersehens, die sie erröten ließ. – Die Tante, ein zahnloses, rostiges Altjüngferchen, mit Schönheitsflecken und einem gepuderten Toupet, erschöpfte sich in Komplimenten, gab dem vornehmen Besuch aus einer schönen englischen Porzellanschale Schokolade zu trinken und verschwand dann, als hätte die Erde sie verschlungen.
Oh, welch eine Reihe wonniger, sonniger Freitage das war, die damit ihren Anfang nahm! – Die Krieger zogen zur Schlacht und kehrten wieder – er sah sie nicht. – Die Donner von Eylau hallten über die Stadt – er hörte sie nicht. Manchmal, wenn er zum Himmel aufschaute, war's ihm, als läge er tief, tief unten im blauen Meer und die Welt, in der er sonst gelebt, nähme erst jenseits jenes azurnen Gewölbes ihren Anfang.
Daß er noch mitten in ihr steckte, wurde ihm eines Sonntagnachmittags klar, als die Tür seines stillen Giebelzimmers, wo er träumend über seinen Büchern saß, aufgerissen wurde und mit anspruchsvollem Lärm ein junger Himmelsstürmer, den er nicht kannte, hereingepoltert kam.
»Hurra, mein Junge!« schrie der, die Arme nach ihm ausbreitend, »seit einem Jahr such' ich dich wie Feinliebchens Busennadel und kann dich nicht finden. Erst das fromme, blonde Kind, die Helene, hat mich auf den Weg gebracht.«
Er war's wirklich, der tolle Felix, und das türkische Halstuch, von dem die Geliebte gesprochen hatte, flatterte in zwei genialischen Zipfeln über beide Schultern hinweg.
Die Begrüßung wurde von seiten Boleslavs herzlicher erwidert, als er selbst vor wenig Wochen für möglich gehalten hätte; aber seit ihm durch Helene die alte Heimat aufs neue lieb und lebendig geworden, war auch der einstige Freund seinem Herzen wieder nahegerückt.
Der nahm ohne viel Umstände auf dem Ruhebette Platz, und indem er sich in den ledernen Polstern streckte, betrachtete er staunend den behaglichen Raum, der ihm als Verkörperung üppigsten Prunkes erscheinen mochte.