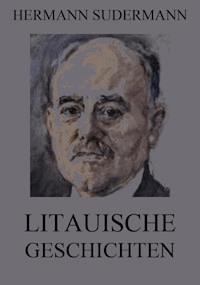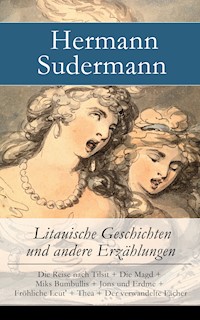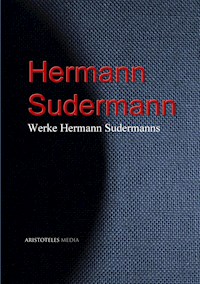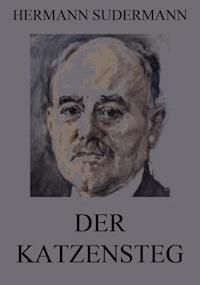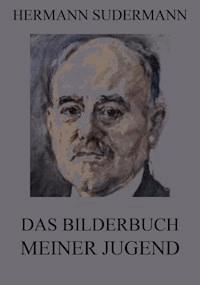Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die 'Ausgewählten Erzählungen von Hermann Sudermann' bieten einen faszinierenden Einblick in das Leben der deutschen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Sudermanns literarischer Stil zeichnet sich durch seine präzise Beobachtungsgabe und seinen einfühlsamen Umgang mit den Figuren aus. Seine Erzählungen spiegeln die sozialen Verhältnisse und politischen Spannungen der damaligen Zeit wider, wobei er Themen wie Liebe, Eifersucht und gesellschaftliche Konventionen auf subtile Weise behandelt. Die Sprache ist klar und poetisch, was Sudermanns Meisterschaft im Erzählen unterstreicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ausgewählte Erzählungen von Hermann Sudermann
Books
Inhaltsverzeichnis
Der verwandelte Fächer und zwei andere Novellen
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
Hermann Sudermann, der am 30. September 1917 ins siebente Jahrzehnt seines erfolgreichen Lebens eintrat, stammt aus dem ostpreußischen Matziken, aus einer religiös eifrigen Mennonitenfamilie; eines Brauers Sohn. In Tilsit besuchte er das Gymnasium, eine kurze Apothekerlehrzeit blieb eine Episode; in Königsberg hat er studiert. 1877 übersiedelte der tatenfrohe junge Mensch in die Reichshauptstadt, die ihn nicht wieder losließ. Er fertigte ein Berliner Wochenblatt fast allein vom ersten bis zum letzten Stück, er schuf Skizzen und Novellen – und hoffte auf sein Glück. Am 27. November 1889 wurde dann im Berliner Lessingtheater der Dramatiker Sudermann geboren mit dem Vollerfolg seines sozialen Tendenzstückes »Ehre«. Seither war er literarisch frei, er wurde wirtschaftlich unabhängig, sein Name war berühmt ...
Sudermann, der im Gegensatz zu Gerhart Hauptmann seine Bühnenstoffe aus sich selber schöpft, ohne Anleihen bei der Weltliteratur, meistert seine Motive bühnengerecht. Er weiß, ein bildsamer Empfänger französischer Anregung für dramaturgische Kunstgriffe, dem Theater sein Recht zu geben in Schürzung und Lösung des dramatischen Knotens, mit der Verteilung von Licht und Schatten, mit allen Mitteln der Illusion, nicht zuletzt in den wirksamen Aktschlüssen. Stets bleibt er bedacht auf die schlagende, zugespitzte Sprache des Epigrammatikers, die Sudermanns Bühnenwerke auch in Buchform zeitlos im Wert erhält als geistreiche Lektüre. Innerhalb dreißig Jahren vollendete dieser schaffensfreudige, durch keinen Widerspruch zu lähmende Dramatiker ein Viertelhundert Ein- bis Fünfakter von wechselndem Wert und mit bewegter Bühnengeschichte; ihre Gesamtwirkung hat in Sudermann den stärksten Dramatiker Deutschlands erwiesen. Ich nenne aus der langen Reihe anhaltender Erfolge: »Sodoms Ende«, »Heimat«, »Morituri«, »Das Glück im Winkel«, »Johannes«, »Johannisfeuer«, »Stein unter Steinen«, »Die gutgeschnittene Ecke«.Sämtliche Werke Hermann Sudermanns erschienen im Verlage der I. G. Cottaschen Buchhandlung Nachfolger, Stuttgart und Berlin.
Sudermann als Präsident des von ihm begründeten Goethebundes wie als eifriger Förderer des Kulturbundes Deutscher Gelehrter und Künstler suchte und fand stets in Friedenszeiten und in den Kriegsjahren die lebendige Fühlung mit seinem Volk, dessen großen Angelegenheiten er dient. Ein bei aller Weltgewandtheit schlichter Mann, der die Gediegenheit liebt, der Phrase und dem Pathos abhold, hat er sich sein fruchtbares Leben, von Leiden nicht unangetastet, selbstsicher aufgebaut im Schutz eines echten Familienglückes, streng gegen sich, verständnisbereit für alles, was die bunte, tolle Welt bevölkert und bewegt; ein ritterlicher Mensch, ein Volksfreund, ein Dichter.
Wir gehen dem Erzähler Sudermann nach.
Ein weltvergessener Ton schwingt durch des Dichters ersten, sich durchsetzenden Roman von 1887: »Frau Sorge«. Paul Meyhöfer, der leidende Held der Erzählung, sagt der jede Freude beschattenden, jeden Nerv entnervenden Frau Sorge, die sich schon zum alten Faust durchs Schlüsselloch schleicht und ihn anhaucht, daß er erblindet, die Lebensfehde an. Der schwerblütige Grübler, der in dem Alltag dahindämmert, ohne seiner selbst bewußt zu werden, der hilflos verwundert die andern genießen sieht – dieser Pflichtknecht mit dem wackern Herzen reißt das ihn fliehende Glück an sich: als der hassende Vater, dem Frau Sorge im Genick sitzt, den schönen Gutshof, der einst sein war, im trunkenen Wahn anzünden will, da rettet Paul seiner Geliebten ihren Besitz, indem er seine eigene bescheidene Habe dem Untergang weiht. Der weithin leuchtende Flammenschein zwingt den Vater heim. Das Gericht will Paul freisprechen; aber der Brandstifter bekennt sich zu seiner Tat. Er geht ins Gefängnis, doch in seinem Innern leuchtet helles Licht! Er wandert diesem ihm aufstrahlenden Lichte zu, es hat ihn nicht als Irrlicht genarrt. Bei aller Treue in der Schilderung des armseligen Hofes, den die Familie mit dem früheren Paradiese vertauschen muß, liegt ein feiner Silberglanz über der romantischen Erzählung. Und in dem äußeren und inneren Erleben entschleiert sich allgemeines Menschenlos.
Der »Katzensteg« von 1889 (als Film 1915, als Volksstück in vierzehn Bildern 1917) ist eine in ihrem Wirklichkeitsdrang reife Erzählung, deren Held Boleslav sich schuldlos in den Kampf um die Ehre seines adligen Geschlechts verstrickt sieht und in Trotz sein Recht verficht. Der alte Freiherr von Schranden, der Napoleons Franzosen über den Katzensteg den Preußen in den Rücken jagte, hat den Fluch an seinen Namen geheftet. Die Acht der Bevölkerung trägt der Erbe, doch er knirscht. Er kämpfte in dem Freiheitskrieg (unter fremdem Namen) mit, den Tapfern schmückt das Eiserne Kreuz. Den Bauern bleibt er der Verfemte. Hat der unversöhnliche Pfarrer eifernd den Verwilderer seiner Gemeinde aus den Lebendigen gestrichen, so weigert er dem Sohn das ehrliche Begräbnis seines vaterlandlosen und sittenlosen Vaters. Im Ringen um das Aufatmen seiner Seele ersteht dem edelblütigen Manne der Versucher in der eigenen Brust: mit ihm haust in der Ruine des angestammten Schlosses Regine, des Alten Dirne, die aus früher Schändung in ihrer Verwahrlosung, hundetreu im Dienst, zum Menschen erwacht; der Schloßherr fühlt Zuneigung zu dem natürlichen Bundesgenossen seines unnatürlichen Daseins. Aber er behauptet sich auch in diesem Strauß des Herzens. Er fällt im neuausbrechenden Kriege. Alle Gestalten dieses von Leben durchtränkten Romans stehen fest auf ihren Füßen, der Gegensatz der Menschen wird schlagend hervorgetrieben, und der das dreizehnte Kapitel der Geschichte schrieb, da die Flamme des Gerichts Gottes am Einzelschicksal in der verräucherten Dorfschenke aufblitzt, der trägt das Mal des Berufenen.
»Jolanthes Hochzeit« (1892) erzählt, wie ein keckes Mädel ihren alten Jahrgang nur heiratet, um in die Nähe des jungen Geliebten zu kommen – vielmehr, der gutartige Freiherr von Hankel auf Ilgenstein gibt sein komisches Erlebnis selber mit männlicher Gelassenheit zum besten, als ihm und der kleinen Zecherrunde der Wein mundet. Der Stoff ist locker, aber er wird mit Sprühgeist heruntererzählt, und man kommt vor angespanntem Zuhören kaum zu Atem. Ist man kein prüder Sittenrichter, so freut man sich am Schluß der mit deutlichen Anspielungen gepfefferten Schnurre für Herrenabende, daß die Jugend zur Jugend sich durchfindet; denn was der Gott der Liebe nicht zusammengefügt hat, das soll der Mensch scheiden ... Die moussierende Frische in dem Bericht des genasführten Hagestolz, der schließlich dankbar ist, vor den anstrengenden Veränderungen des Ehelebens bewahrt zu bleiben, hat Salonluft und gelegentlich Stallduft an sich; robuste Weltgesundheit spricht aus ihr und eine schmucklose Geradheit der durchschnittlichen Haltung des Lebens und Lebenlassens.
»Es war«, Sudermanns Roman von 1894, schildert überzeugend die Macht der Vergangenheit, die drohend ihr Haupt erhebt, nachdem der lebenswillige Mensch seine Schuld verschollen, sein Unrecht begraben wähnt. Die beiden tüchtigen Novellen des früher entstandenen Bandes »Geschwister« (1888) gehören einem verwandten Stoffkreise an. Der zur Freiheit sittlicher Selbstbestimmung berufene Erdensohn soll und muß ankämpfen wider die Erinnerungsbilder, die ihn schrecken. Der Ostelbier Leo von Sellenthin in »Es war« stellt sich dem Freund, mit dessen Gattin er ein Verhältnis einging, zum Zweikampf und schießt ihn nieder. Er flieht in die Welt, nachdem er seinem Freund Ulrich auf dessen feierliche Frage versicherte, nichts sei zwischen ihm und jener Frau, was nach menschlichem und göttlichem Recht unstatthaft sei. Der junkerliche Kraftkerl tobt sich in den Pampas von Südamerika aus, Ulrich heiratet Leos Geliebte, die Witwe des Duellopfers. Leo, nach mehreren Jahren heimkehrend, ist entschlossen, nichts zu bereuen und seine Pflicht zu tun. Jedoch die Vergangenheit spukt in seinem Blut und spreizt sich in seiner Umwelt; er geht der schönen Sünderin abermals ins Netz. Er wird von neuem schuldig: schuldig gegen sich selber, gegen den Freund, gegen die Seinen. Die Stoffindung ist so vortrefflich wie die Durchgestaltung glänzend; die charakterologische Begründung indes weist Lücken auf, die durch künstliche Mittelglieder nur scheinbar geschlossen sind. Die seelische Überzeugungskraft der weiblichen Gestalten – Felizitas, Johanna, Herta – bleibt zurück hinter der unbeirrbaren Beobachtungsgabe und der Lust am Erzählen.
Sudermanns Roman von 1908: »Das Hohe Lied« ist trotz seiner 635 Druckseiten eine Studie; den Darsteller dieser weitschichtigen Verhältnisse reizte es, einem Mädchentypus während der Entwicklungsjahre nachzuforschen, die Lili Czepanek mit dem lockern Musikantenblut im Leibe in wirbelnde Lebensformen zu stellen und mit der Freude des Seelenanatomen die einzelnen Zuckungen, Windungen, Temperaturen zu beobachten und zu verzeichnen. Der peinliche Stoff wird mit Sudermanns Glanz und Schmiß bewältigt; der Leser wandert im Verlauf der fünfundvierzig Kapitel, die in der Stadt und auf dem Lande spielen und Kabinettstücke der Widerspiegelung von Menschen und Zuständen bieten, durch eine Bildergalerie. Nicht jeder Vorwurf erfüllt uns einen Wunsch, jedoch hat der Künstler seine Stoffwahl frei; und das Zeugnis dürfte kein Unbefangener ihm weigern: Lilis verwickelter Werdegang, das Hohelied des weiblichen Naturtriebs, ist eine hohe Schule der Lebensweisheit, in der man niemals auslernt; literarisch ein in allen Feuern lockendes Prachtstück.
Ist es in alten Tagen ehrwürdige Volkssitte gewesen, von den Männern des Stammes an ihren Geburtsfesten öffentlich Kraftproben zu heischen, um durch deren Bestehen ihre Tüchtigkeit zu erhärten und die Ehre der Gemeinschaft zu erhöhen: als Mann von sechzig Jahren bringt Hermann Sudermann mit seinen »Litauischen Geschichten« (1917) der Heimat den reinsten Erweis seiner gesammelten Kraft als der Summe seines wohlvollbrachten schaffenden Lebens und seiner herzlichen Treue. Denn die hier vereinten vier Erzählungen bilden sein reifstes Dichtwerk, das an die Jugenddichtung von der gestrengen Fee Frau Sorge innerlich anknüpft. Der Erdgeruch dieser Meisternovellen ist würzig; die Gestaltung der Seele dieser einfachen Menschen und der Natur, der sie entsteigen und die sie fest umklammert hält, erscheint vollendet. Aus der Not und Wende der gewaltigen Gegenwart ward ein Heimatschatz gehoben, der ein kulturgeschichtliches Mal bedeutet für die Zeiten. Sudermanns Wucht des Stils ist ein leidenschaftliches, gebändigtes Feuer, seine Symbolik völlig unsentimental, seine Weise biblische Einfalt. Bedurfte es eines bündigen Beleges, wie wenig die Wanderung durch die Welt diesen Gesellschaftskritiker unterhöhlt und entwurzelt habe – diese Geschichten aus Litauen sind des Zeuge! Litauische Bauern, Elendleute im Moor, Kätner und Mägde sind die Träger der schreckhaften, spukhaften und scherzhaften Ereignisse, Liebe und Haß rütteln an den Dämmen und reißen sich wild ihren Weg, Erdsegen glänzt auf den erdhaften Gestalten; der Himmel Litauens ist ausgespannt. Wie aufschlußreich entwickelt sich in »Ions und Erdme« die ursprüngliche Kultur, die sich Schritt vor Schritt tastet mit erwachenden Sinnen; tiefdringend gibt der Erzähler diesen triebhaft vor sich hinlebenden Menschen das unverlorene Geleit ihres Götterglaubens mit, so daß Litauen nicht nur landschaftlich bis in seine verborgenen Reize unser Mitbesitz wird, sondern zugleich als Gewinn, als Sorge und Sorgelöserin um unsere Seele wirbt.
Aus zwei Novellenreihen des Dichters schöpfen unsere drei Erzählungen, mit denen die Universal-Bibliothek zu Ehren ihrer Nummer 6000 Hermann Sudermann in ihren internationalen Bücherschatz aufnimmt. Den zwanglosen Geschichten »Im Zwielicht« (1887) entstammt »Der verwandelte Fächer«. Ein kleines Feuerwerk über die Arterhaltung der Geschlechter und ihre Waffen aus der Schatzkammer der Natur leitet zu der Spezies der Tenorsänger und zu Frau Lillys tragikomischer Episode mit ihrem berühmten »Schwarm« über. So weltlaunig und scharfäugig schlenderte der junge Sudermann einst durch die Salons und durch die Straßen der Großstadt! – Von den sieben Stücken der reiferen Sammlung »Die indische Lilie« (1911), die manchen künstlerischen und menschlichen Wert festhält, erfreut die zarte Weihnachtsskizze »Fröhliche Leut'«. Das Fest der Familie trotzt dem Tod; die Mutter und Gattin feiert es lebendig gegenwärtig mit, ob sie schon der andern Welt zugehört. Die Grenzlinie der Sentimentalität wird mit Takt gemieden. Und »Thea«! Diese Phantasien über einem Teetopf wissen uns in ihren sechs Kapiteln unseres Dichters Leben und Wesen zu entschleiern. In dieser Bilderreihe, der Beichte eines Poeten, baut sich organisch die Weltanschauung des gütigen Optimismus, welche diese wurzelechte und kerngesunde Persönlichkeit sich erworben hat. Aus Jugenddruck und ehrlichem Sichemporraffen aus den nächtlichen Zirkeln der literarischen Müßiggänger wie der Salondrohnen wird der Entschluß geboren: Ich gehe mich suchen. Das kostet Kampf; dieses Stirb und Werde weckt Selbsterkenntnis und Menschenkenntnis. Körperliche Krisen fehlen dem Lebensgange nicht – der Dichter liegt in seinem Sarge, er prüft sich durch einen Schimmer der herben Gruftphilosophie, Kritiker und Verehrer lassen sich hören, bis er dem schönen, ernsten Leben zurückgegeben »im reifenden Weltwissen rätselratend« sich über Sturzacker, Strauchwerk, Springquellen und Eisschrunden auf die standhaltende Erde rettet. Von Illusionen frei, den Idealen getreu, schreitet der Dichter aus dem deutschen Osten frohgemut ins Abendrot, seines Weges gewiß.
Charlottenburg 1918.
Theodor Kappstein.
Sie sind träumerisch, sind zerstreut – Sie trällern eine Melodie leise vor sich hin. Noch einmal, wenn ich bitten darf!
»Am stillen Herd – zur Winterzeit!«
Ich danke, ich weiß genug. Daher also hatten Sie gestern in der Oper keinen Blick für Ihren gehorsamsten Diener? Unser blondlockiger Walter Stolzing hat's Ihnen angetan.
Schauen Sie rasch in den Spiegel – dieses Erröten kleidet Sie wunderbar. Doch daß gerade ein Held des hohen c es ist, der es hervorzauberte, das will mir nicht gefallen!
Warum ich in so spöttischem Tone von den Tenoristen rede, fragen Sie? Oh, verkennen Sie mich nicht!
Ich bin auf der Stelle bereit, jedem Tenorsänger zu bescheinigen, daß ich ihn persönlich als die höchste Blüte der Männlichkeit, einen gewissermaßen aus der Allgemeinheit herausdestillierten Idealmann anerkenne.
Ich scherze nicht – wahrhaftig! Ich will's Ihnen beweisen – naturwissenschaftlich – echt Nordau'sch. Hören Sie zu: Das vornehmlichste Attribut des männlichen Geschlechtes – wir können das beim Menschen sowohl wie im gesamten Tierreich beobachten – ist die Gefallsucht.
Der Mann, weit mehr als das Weib, will gefallen und muß gefallen. Der Trieb der Arterhaltung bringt es mit sich, daß ein jeder im Wettkampfe um die Gunst des Weibes die Palme für sich zu erringen strebt.
Die Gunst des Weibes ist die Achse, um die das Weltenrad sich dreht. Um ihretwillen hat sich die Natur mit ihren leuchtendsten Farben geschmückt, um ihretwillen ertönt die Stimme alles Lebendigen in holden Harmonien, und um ihretwillen ist der Riesenkampf entbrannt, der erst erlöschen wird, wenn die Welt zur Ruhe des Eises erstarrt.
Wundern Sie sich nicht. Das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Bei Darwin und Häckel steht's geschrieben.
Alles Schöne in der Natur ist ein Spiel der männlichen Gefallsucht – und vieles Furchtbare ist es auch. Diese Gefallsucht, durch die im Tierreich – ich könnte ebensogut auch auf das Pflanzenreich exemplifizieren, doch das würde zu weit führen – das männliche Wesen sich seinem künftigen Gesponse bemerkbar zu machen und seine Mitbewerber zu verdrängen sucht, äußert sich in drei Eigenschaften: erstens Farbenglanz, zweitens Gesangskunst, drittens Kampfesmut.
Vom Paradiesvogel bis zum Pavian und bis zum Husarenleutnant sehen wir das ewig Männliche in herrlichster Farbenpracht erstrahlen, während das Weibchen in Bescheidenheit seines inneren Wertes daneben verschwindet.
Von der Zikade bis zum Auerhahn und zum Troubadour macht sich das Männchen durch mehr oder minder wohllautenden Gesang bemerkbar, während das Weibchen sich in selbstbewußtes Schweigen hüllt.
Vom wilden Wasserkäfer bis zum brünstigen Hirsche und zum göttergleichen Achill werden um des Weibes Besitz die fürchterlichsten Kämpfe geführt, während dieses ruhig daneben sitzt und abwartet, wer von den Kämpfenden übrigbleibt. Hinterher läßt es sich dann von Homer und Offenbach noch ansingen. –
Wie meinen Sie? Der Hunger, nicht die Liebe, sei die Haupttriebfeder zu dem ewigen Kampfe in der Natur? Sie haben recht, ganz recht. – Allein wenn eines Tages die Liebe aufhörte, so würde ein jedes Geschöpf sich fragen: Wozu soll ich dieses lumpige Leben noch leben? Und falls es nun nicht imstande ist, sich durch Schreiben pessimistischer Bücher die Zeit zu vertreiben, so muß es jedem Dank wissen, der sich die Mühe nimmt, es aufzufressen. Der Kampf wäre mithin aus der Welt geschafft. – – –
Das geschilderte Verhältnis zwischen Mann und Weib gilt so weit, als wir unverfälschtem Naturwalten gegenüberstehen; erst in unserer verrotteten Hyperkultur scheint es sich umzudrehen. Wo die Eheschließung Schwierigkeit macht und drüben die Gefahr naheliegt, als alte Jungfer zu sterben, da beginnt das Werben des Weibes um den Mann, da legt man Rot auf, da schmückt man sich mit Turnüre oder Chignon und lernt durch Verhüllen sich enthüllen, da spielt man das Gebet der Jungfrau, da lernt man sogar fechten, wie das Beispiel der Pariser Damen beweist.
Doch kehren wir zur Natur und zum werbenden Mannwesen zurück! Von den drei Eigenschaften, durch die man die Gunst des Weibes gewinnt, wurde dem einzelnen meistens nur eine zuteil – in seltenen Fällen schenkte ihm eine verschwenderische Laune der Natur deren zwei, wie das Beispiel des Husarenleutnants beweist.
Nun denken Sie sich aber einmal einen Mann, dem sämtliche drei als Waffen im Kampfe der Liebe mitgegeben wurden! Die Weiberherzen müssen ihm in Legionen zufliegen, die Ziffer seiner Erfolge muß eine schwindelerregende sein, in Berlin allein vielleicht mehr als tausend und drei.
Und ein solches Phänomen, in der ganzen Natur- und Menschengeschichte einzig dastehend, ist der Tenor.
Schon an Farbenpracht kommt ihm keiner gleich. Wer von uns anderen Männern darf es wagen, sich in silberner Rüstung, wie sie die Schwanenritter tragen, von den Frauen bewundern zu lassen? Wer sonst noch darf in wattierten, rosaseidenen – doch schweig still, mein Herze!
An Gesangskunst – na, das versteht sich von selbst; – und was den Kampfesmut anbetrifft, so – bitte, lächeln Sie nicht, meine Freundin! – kein Bayard, kein Cid hat so viel Heldentaten aufzuweisen wie er! Endet der erbitterte Kampf, den er allabendlich mit seinen Nebenbuhlern führt – dieselben pflegen Bariton zu singen und schwarze Trikots zu tragen – nicht immer mit der moralischen Niederlage der letzteren, auch wenn er, der Edle, dabei elendiglich zugrunde geht? Erduldet er nicht selbst den Flammentod mit dem größten Vergnügen, meistens sogar im Dreivierteltakt?
So – und nachdem ich diesen letzten Trumpf ausgespielt habe, werden Sie hoffentlich nicht mehr zweifeln, daß wir in dem Tenoristen in der Tat den Idealmann verkörpert finden, und sollte er selbst von dem seinem Berufe verbrieften Privilegium: angeborener Dummheit froh zu sein, einen mehr als polizeilich erlaubten Gebrauch machen. Doch diese Dummheit mag gerade als ein Attribut des Idealmannes gelten.
Was aber leider diesem idealen Manne gänzlich zu mangeln pflegt, das ist der Sinn für ideale Liebe; und wehe der seraphisch gestimmten Frauenseele, die in dem Menschen wiederzufinden meint, was der Sänger in so zarten Tönen versprach! Psyche mag froh sein, wenn sie sich noch mit versengten Flügeln aus dem Bereiche des Lichtes rettet, das ihr angezündet ward!
Da muß ich Ihnen doch gleich eine kleine Geschichte erzählen, die Geschichte eines Fächers, die hier hineinpaßt und zudem einen denkwürdigen Anhang zu Ovids Metamorphosen bildet!
Eine der Frauen, für die ich von altersher schwärme, ist Frau Lilly X. X. – bitte, strengen Sie sich nicht an, Sie kennen sie nicht – die Gattin eines westfälischen Eisenindustriellen, der den preiswürdigen Einfall gehabt hatte, sich mit Hinterlassung einer halben Million in ein besseres Jenseits zu entfernen. – Sein Tod war die erste Liebenswürdigkeit seines Lebens. – Frau Lilly kam nach Berlin in die große Welt wie eine verwunschene Prinzessin, die bislang in einem Rauchfang gesessen. Sie brachte die Gewohnheit mit, über ihre Arme zu hauchen, als wolle sie noch immer Kohlenstäubchen entfernen. Im übrigen war sie rein, rein bis in die geheimsten Winkel ihres Herzens. – – Ein scharmantes, kleines Persönchen mit schmalen, weißen Händen, großen, sehnsüchtigen, blauen Augen und einem dunkelbraunen Strudelkopf.
Sie saß und wartete auf die – Liebe.
Wir alle machten ihr den Hof, aber wir waren ihr nicht gut genug. Wir seien allzu leichte Ware, meinte sie, nur unsere Ansprüche wögen schwer.
»Er soll mein Schicksal werden, wie ich das seine,« sagte sie mir einmal mit schwermütigem Augenaufschlag, »aber er muß die Kraft haben, zu entsagen, wie ich sie haben werde.« – Sie seufzte tief auf.
Ich auch. – Und darauf lachte der eine den anderen aus.
Zu derselben Zeit begab es sich, daß ein berühmter Sänger zu einem kurzen Gastspiel in Berlin erschien. Die ganze Frauenwelt jubelte ihm entgegen und zitterte doch vor ihm; denn die Glorie wildester Don-Juan-Romantik umgab seine Gestalt, und nimmer noch, hieß es, hätte ein Weib dem Sturmlauf seines Werbens widerstanden. – Man kennt das wonnige Grausen, mit dem eine überreizte Frauenphantasie dem Erscheinen eines solchen Messias entgegenträumt, man weiß, wie ansteckend dieses Fieber wirkt.
Auch Frau Lilly ward von dem allgemeinen Rausch ergriffen, und sie noch heftiger als die anderen, denn in ihrer Seele vereinigte sich die leise Sehnsucht des liebebedürftigen Weibes mit den furchtsamen Schauern des neugierigen Kindes.
Wonnetrunken kam sie aus der Oper zurück, wo sie ihn in all seiner Herrlichkeit, von Jauchzen empfangen, mit Lorbeer überschüttet, zum erstenmal erblickt hatte.
Zwei Tage darauf erhielt sie von einer Freundin, die ein glänzendes Haus machte, ein Einladungskärtchen, das neben der lithographierten Formel in einer Ecke die mit Bleifeder gekritzelten Worte trug: »Er wird da sein.«
Sie hüllte die wogende Brust in einen Frühlingshauch von Spitzen, sie nestelte mit zitternder Hand die duftigsten Rosen in das widerspenstige Gelock. Hold und verschüchtert wie ein Nixenkind, das zum erstenmal die oberirdische Herrlichkeit erschaut, betrat sie den Ballsaal.
Er war noch nicht gekommen. Man fürchtete sogar, er werde im letzten Momente absagen lassen. Männer wie er können sich das erlauben. – Atemlos harrend saß sie da – und so die anderen alle.
Gegen ½ 11 Uhr ging ein freudiges Beben durch den Saal. Aus dem Vorzimmer war Kunde gekommen. – Die Tür öffnete sich. – Er war es! Sein müder Blick überflog nachlässig den Saal, die Wirtin zu suchen, die er kaum kannte. Eine byronische Locke fiel düster dräuend auf seine durchfurchte Stirn. – Ein leiser exotischer Duft ging von ihm aus.
»Er ist es – er ist mein Schicksal,« flüsterte Frau Lilly und senkte den feuchten Blick in ihren Schoß; denn sie konnte seinen Anblick kaum ertragen.
Er verschwand nach einem der einsamen Gemächer. Es verlohnte sich nicht für ihn, die Zeit mit Konversation zu vergeuden.
Eine Weile später hieß es: »Er wird singen.« – »O Gott,« seufzte Frau Lilly, »wie werd' ich das ertragen?«
Er erschien wieder auf der Bildfläche. Seine bläulich behandschuhte Hand glitt nervös über die Schläfen, wobei die düstere Locke tiefer auf die Brauen herabsank. Offenbar kopierte er Rubinstein.
Er begann. Es war die Tostische Wimmerarie: »Vorrei morir«, die er gewählt hatte, dieselbe, durch die Mierzwinski später so reiche Triumphe erntete. – Eine Welt unendlichen Leides strömte aus seinem Munde. Die Töne drangen auf die Nerven der Weiber, wie die Geißeln, mit denen die Flagellanten in wollüstigem Schmerze sich peitschten. In ihnen lag der wilde Aufschrei des Glückheischenden – der letzte Hauch des selig Sterbenden lag in ihnen. – Auf der Stirn des Sängers stand der Jammer Laokoons geschrieben. Sein umflortes Auge suchte im Saale umher, als müßte es sich an etwas anklammern, bevor es brach. – Und siehe da! es blieb auf Frau Lillys lieblichem Figürchen haften.
Ein heißer Schauer fuhr ihr den Wirbel hinab.
»Vorrei morir«, wiederholte sie traumverloren. Ihr Auge hatte den Heiland erschaut – nun konnte sie sterben.
Als es zur Tafel ging, kam die Wirtin des Hauses zu ihr heran, und mit der Rührung der Wohltäterin ihre Hand drückend, flüsterte sie ihr zu: »Bedanke dich, Lilly, du wirst zu seiner Linken sitzen.«
Ich führte sie. Es war kein Genuß, das kann ich Sie versichern; denn ich blieb heute Luft für sie. – Ihr Auge verschlang jede seiner Mienen, sie zehrte von dem Windhauch, den seine Ärmel hervorbrachten.
Er zog die Handschuhe aus und warf sie nachlässig in ein leeres Kristallglas. Ein Panzer von Diamanten funkelte an seiner langen, mattgelben Hand. Zwischen den Fingern saßen kleine Puderrestchen, die er liebevoll auf der Hautfläche verrieb.
Er war einsilbig. – Das sind große Männer immer.
Dann und wann warf er der Wirtin ein Kompliment zu, wie man einem Hündchen ein Knöchelchen zuwirft. Sie nagte glückselig daran.
Frau Lilly geruhte er zu übersehen.
Desto eifriger beschäftigte er sich mit seinem Teller. Die Hummerpastete hatte seinen vollen Beifall, – von dem Lammrücken nahm er zweimal, – bei dem Anblick der Forellen flog ein erster Schimmer der Freude über sein düsteres Antlitz, – und die Poularden gewannen ihn vollends dem Leben wieder. Dazwischen goß er den alten Chambertin in Strömen hinab.
Endlich fiel ein milderer Blick auch auf Frau Lilly.
»Hatte mein Lied Ihren Beifall?« fragte er sie mit der Miene eitles Mannes, der die Lösung des Welträtsels beabsichtigt.
»Oh – wie kann ich Ihnen danken?« stammelte sie.
»Danken Sie mir nicht,« fiel er ihr ins Wort, die Hand vertraulich auf ihren Arm legend – ich war nun bereits anderthalb Jahre mit ihr befreundet und hatte mir eine solche Geste noch nie erlauben dürfen – »Sie waren es, die mich begeisterte, und wenn ein Hall meines innersten Empfindens in meinem Gesange nachzitterte, so habe ich es Ihnen zu danken.« Er sprach es ruhig und geläufig, wie man etwas Auswendiggelerntes hersagt.
Ich überließ nun Frau Lilly ihrem Schicksal. Sie hatte den Sänger zu fesseln gewußt; denn nach der Tafel zog er sie in eine dämmerige Nische, wo er wohl eine halbe Stunde mit ihr plauderte.
Bald darauf und lange vor Schluß des Festes brach er auf.
»Wahrscheinlich hat er noch in etlichen Boudoirs zu tun,« raunte ein bissiger Freund mir zu, als er ihn im Vorzimmer verschwinden sah.
Am anderen Vormittag ließ Frau Lilly mich rufen und erzählte mir glückstrahlend, was in der Nische vorgegangen.
Sie hatte eine merkwürdige Seelenharmonie zwischen ihr und dem Sänger entdeckt. In der Auffassung der Liebe als Schicksal war er durchaus ihrer Ansicht gewesen, und die Theorie des Entsagens gar hatte er womöglich noch strenger ausgebildet als sie selber.
Ich dachte mir mein Teil, hütete mich aber, es auszusprechen. Oh, hätte ich nur nicht so feinfühlig sein wollen!
Das Ende vom Liede war gewesen, daß er vor lauter Begeisterung ihren Fächer, mit dem er gerade spielte, in die Tasche gesteckt und nicht mehr hatte herausgeben wollen.
»Was nun tun?« fragte sie in scheinbarer Hilflosigkeit, während die Freude über den an ihr verübten Raub ihr verräterisch aus den Augen sprühte.
»Das Beste wird sein,« meinte ich halb im Scherze, »Sie schreiben ihm, daß er Ihnen das corpus delicti persönlich wiedergebe.«
Sie erglühte bis in den Nacken hinein. Der Gedanke war ihr augenscheinlich nicht mehr neu.
Gleich darauf verabschiedete sie mich. Als ich sie später einmal nach dem Fächer fragte, wurde sie verlegen und wich der Antwort aus. Wohl zwei Monate vergingen, ehe ich das rätselhafte Ereignis erfuhr, das der Ärmsten manche Stunde friedlichen Schlafes gekostet hatte.
Der Gedanke, daß sie den Fächer wieder haben müßte um jeden Preis, war ihr fortan nicht mehr aus dem verliebten Köpfchen gewichen. Selbst ihre gekränkte Frauenwürde führte die Sophistin ins Feld, um von sich selber die Erlaubnis zu einem Stelldichein zu erbetteln. Endlich faßte sie einen heroischen Entschluß und schrieb ihm in sein Hotel folgende Zeilen:
»Mein Herr!
Ich bitte Sie, mir mein Eigentum zurückzugeben. Zu diesem Zwecke werde ich Sie am Sonnabend um 12 Uhr in dem linken Oberlichtsaale des Museums erwarten.
Lilly X.«
Sie sehen hieraus, wie naiv sie noch war! Einen Mann, wie ihn, nach dem Museum hinzubestellen, wo die Backfische und die Studenten sich ihre Rendezvous geben!
Halb betäubt vor Angst saß sie zur bestimmten Frist auf dem Rundsofa in der Mitte des Saales und starrte nach der Tür.
Er ließ wohl eine Viertelstunde auf sich warten; doch das gehörte sich so. Endlich erschien er, in einen kostbaren Biberpelz gehüllt, ein blauseidenes Cachenez vor dem Munde. Er sah unwirsch aus und schien es eilig zu haben...
Sein Blick glitt durch den Saal und blieb zweifelnd auf ihr haften. Er mußte kurzsichtig sein, denn er fixierte hinterher noch zwei andere Damen; und wäre sie ihm nicht mit einem schwachen Lächeln zu Hilfe gekommen, er wäre vielleicht an ihr vorübergegangen.
Nun trat er mild lächelnd auf sie zu und ergriff ihre Hand.
»Mein geliebtes Kind!« sagte er.
Die Knie wankten ihr vor Schreck und Scham. Wo nahm er das Recht her zu solcher Anrede?
Darauf sah er sie wieder mit jenem seltsam prüfenden, zweifelnden Blicke von der Seite an, wie jemand tut, der einen anderen in seinem Gedächtnis unterzubringen sucht.
»Es war etwas dunkel,« sagte er dann leise, fast zärtlich, wie um diesen Blick zu entschuldigen.
Sie sah erstaunt zu ihm empor. »Ja, es war etwas dunkel in der Nische,« entgegnete sie verschämt.
Er lächelte. Sie verstand das Lächeln nicht; aber es lag etwas darin, das sie erröten machte.
»Oh, ich war glücklich!« sagte er dann und drückte ihr verständnisinnig die Hand.
Sie war aufgestanden; er aber setzte sich dicht vor ihr auf dem Ledersofa nieder und – streckte die Beine aus.
Diese Bewegung erinnerte sie an ihren verstorbenen Gemahl. Es lag in der Tat etwas von der Ungeniertheit eines Ehemannes darin. Ihr wurde sehr unbehaglich zumute, und sie errötete aufs neue.
Und wiederum sah sie seinen prüfenden Blick auf sich gerichtet. Diesmal schüttelte er sogar den Kopf.
»Ist das heiß hier,« sagte er dann, knüpfte den Pelz auf und zog die Handschuhe ab. Dabei fiel ihm einer von seinen Brillantringen zur Erde. Er bückte sich phlegmatisch.
»Den darf ich nicht verlieren,« sagte er, »er ist ein teures Andenken von der Fürstin ...« Er hielt inne und lächelte eitel.
Sie erschrak. Unmöglich! Sie mußte sich verhört haben.
Er drehte den Ring langsam an den Gelenken hinunter und beäugelte auch die anderen.
»Sehen Sie diesen hier –« sagte er. Sie unterbrach ihn hastig; vielleicht hätte sie sonst ein interessantes Seitenstück zu der Karl Moorschen Erzählung von den vier Ringen zu hören bekommen.
»Kennen Sie unsere Galerie bereits?« fragte sie.
»Nein,« erwiderte er und hielt die Hand vor den Mund, wie um ein Gähnen zu unterdrücken.
»Es ist mir tief schmerzlich, meine teuerste Frau,« fuhr er nachlässig fort; aber was ihm tief schmerzlich war, sollte sie nie erfahren, denn plötzlich hielt er inne und griff mit der Hand nach seiner Kehle, wobei zwei gurgelnde Töne zum Vorschein kamen.
»Oh – ich bin wieder belegt,« sagte er dann, »und heute soll ich singen. Dieser Temperaturwechsel – ich muß machen, daß ich fortkomme, sonst werde ich stockheiser.«
Darauf erhob er sich und langte mit seiner Rechten in die weite Tasche seines Pelzes, aus der er einen weißen, viereckigen Karton hervorzog, der mit einer rosaseidenen Schnur umwunden war. Einen Augenblick zögerte er – noch einmal jener zweifelnde Blick, – dann, wie sich zu raschem Entschlusse aufraffend, flüsterte er mit vielsagendem Lächeln: »Und hier ist, was Sie wünschten.«
Mechanisch nahm sie das Päckchen an sich. Sie wagte kaum mehr sich zu rühren, so unheimlich war ihr zumute.
Er ergriff zum Abschied ihre Hand.
»Wie gern möchte ich Sie auf die Stirn küssen, mein geliebtes Kind,« flüsterte er.
»Um Gottes willen!« schrie sie auf.
»Aber es sind Leute da,« fuhr er mit ruhigem Lächeln fort. »Auf Wiedersehen heut in der Oper – nicht wahr?«
Damit eilte er hinaus.
Wie versteinert starrte sie ihm nach. »Warum behandelte er mich so?« stammelte sie. Wie gern hätte sie sich beglückt gefühlt, aber das Weinen war ihr nah. Vollends betäubt schlich sie nach Hause.
Dort öffnete sie das Kästchen.
Berauschender Blumenduft stieg daraus empor. Obenauf fiel ihr ein Zettel ins Auge, auf dem die Worte standen?: »Ewige Erinnerung an die Stunde des Glücks.«
Und unter dem Zettel, auf dunkelroten Rosen gebettet, lag statt des Fächers – – – ein Hausschlüssel.
Fröhliche Leut'
Inhaltsverzeichnis
Der Weihnachtsbaum, der in der Ecke stand, neigte sich bedenklich nach vorne, weil man diejenige Seite, die sich den Wänden zukehrte und die deshalb schwer zu erreichen war, nicht so reichlich behängt hatte, daß sie den schatzbeladenen Zweigen der vorderen Hälfte das Gleichgewicht hätte halten können.
Papa bemerkte es und schalt. »Was würde Mama sagen, wenn sie das sähe? Du weißt, Brigit, daß Mama solche Nachlässigkeit nicht liebt. Wenn der Baum uns umfällt, müssen wir uns die Augen aus dem Kopfe schämen.«
Und Brigit wurde feuerrot, kletterte noch einmal auf die Stehleiter und befestigte, die Arme weit hinüberreckend, allerhand, was sie gerade noch erraffen konnte, auf der Wandseite, die sie, weil daran doch nichts zu sehen war, in der Tat ein wenig stiefmütterlich bedacht hatte.
Und dann erst konnten die Lichter angezündet werden.
»Nun wollen wir auch noch die Geschenke durchsehen,« sagte Papa. »Welcher ist Mamas Teller?«
Brigit zeigte ihn.
Diesmal war Papa zufrieden. »Gut, daß du so viel Marzipan daraufgelegt hast,« sagte et, »denn sie muß ja immer was zum Verschenken haben,« und dann prüfte er das schöne, blanke Safetyschloß, das daneben lag, und ließ die Finger liebkosend über die harten Fächer der Chamäropspalme gleiten, die Mamas Bescherungsplatz überschattete.
»Das Blumenglas hast du ihr gemalt?« fragte er.
Brigit bejahte. »Es ist ausschließlich für Rosen,« sagte sie, »und die Farben sind eingebrannt und ganz und gar wetterbeständig.«
»Was die Jungens ihr gemacht haben,« meinte Papa, »können sie ihr ja dann selber bringen. Mamas Geschenke hast du auch hingelegt?«
Gewiß hatte sie sie hingelegt. Für Fritz ein Fischnetz mit Holzgabeln zum Aufhängen und ein zehnklingiges Universalmesser, – für Artur eine Hobelbank mit Trittbrett und auswechselbaren Eisen und außerdem noch ein hochbordiges Hansaschiff mit einem goldhaarigen Meerweib als Gallionfigur.
»Das Meerweib wird Effekt machen,« sagte Papa und lachte.
Brigit hatte noch etwas auf dem Herzen. Sie steckte die kleinen, festen Arbeitshände unter den Schürzenlatz, der sich über der noch flachen Brust ein wenig sackte, und wippte auf den Absätzen hin und her.
»Ich will's dir nur gleich verraten,« sagte sie; »dir schenkt sie auch etwas.«
Papa wurde sehr hellhörig. »Was denn?« fragte er und revidierte seinen Bescherungsplatz, auf dem sich jedoch neben Brigits Handarbeit – über die hatten sie schon gesprochen – nichts Bemerkenswertes vorfand.
Brigit lief eiligst zu der entgegengesetzten Ecke des Saales und zog unter dem Klavier einen etwa zwei Fuß hohen, in Papier gehüllten Kasten hervor, der sich für seine Größe merkwürdig leicht in die Höhe heben ließ.
Und als die Papierbogen gefallen waren, kam ein Holzkäfig mit einem großen, bunten Vogel zum Vorschein, dessen Gefieder schillerte, als hätten Himmelblau und Sonnengold sich darinnen gefangen.
»Eine Mandelkrähe!« rief Papa, die Hände zusammenschlagend, und um seinen Mund zuckte die Freude. »So ein seltener Vogel! Und den schenkt sie mir?«
»Ja,« sagte Brigit. »Er hing im Herbst eines Morgens in der Drosselschlinge. Der Magazinverwalter hat ihn so lange aufbewahrt. Und weil er so schön und sozusagen eine Art von Paradiesvogel ist, darum schenkt sie ihn dir.«
Papa streichelte ihren Blondkopf, und sie war wieder rot bis an die Haarwurzeln.
»So, und nun wollen wir die Jungens rufen,« sagte er.
»Erst laß mich die Schürze ablegen,« rief sie, nestelte die Stecknadeln los und warf das häßliche schwarze Ding unter das Klavier, wo vorhin der Vogelkäfig seinen Platz gehabt hatte.
Nun stand sie in ihrem weißen, blauschleifigen Einsegnungskleide da und machte ein liebliches Schnäuzchen.
»Du hast recht daran getan,« sagte Papa. »Mama liebt die dunklen Farben nun einmal nicht ... Alles soll licht und froh sein um sie herum.«
Und dann durften die Jungen hereinkommen.
Sie hielten die Prunkbogen ihrer Weihnachtsgedichte ängstlich in beiden Händen und scheuerten sich an den Türpfosten.
»Munter, munter!« sagte Papa, oder glaubt ihr, euch wird heute der Kopf abgerissen?«
Und dann nahm er sie in beide Arme und knutschte sie ein wenig, so daß Arturs Gedichtbogen von rechts oben nach links unten einen Knick bekam.
Das war nun freilich ein Malheur, aber Papa tröstete, er wolle es schon verantworten, er sei ja selber schuld daran.
Herr Brüggemann, der lange Hauslehrer, steckte nun auch die Nase herein. Er hatte den feierlichen Predigtrock an, nickte vor sich hin wie ein Begräbnisgast und sagte mit einem kleinen Schnüffeln durch die Nase dreimal nacheinander: »Ja, ja ... Ja, ja ... Ja, ja.«
»Was seufzen Sie denn so gottsjämmerlich, Sie alte Tränenweide?« lachte Papa. »Hier sind wir fröhliche Leute! Was, Brigit?«
»Natürlich sind wir das,« lachte Brigit zurück, »und hier, Herr Kandidat, ist auch Ihr Weihnachtsteller.«
Und sie führte ihn zu seinem Platze, wo ein kleines kalbledernes Portemonnaie verschämt unter den Pfefferkuchen hervorsah.
»Dies schenkt Ihnen Mama,« fuhr sie fort und reichte ihm ein schwarzes, flaches Buch mit dickem Goldschnitte; »es sind ›Die drei Wege zum Frieden‹, die Sie doch immer so geliebt haben.«
Der Kandidat zerdrückte ein Tränlein der Rührung, aber bald darauf schielte er wieder nach dem kleinen Portemonnaie hinüber. Dieses war der vierte Weg zum Frieden, denn er hatte alte Kneipschulden.
Auch die Hausbeamten durften nun hereinkommen. Voran Frau Pönsgen, die Wirtschafterin, die mit ihren krummen, rissigen Händen einen Porzellantopf mit Alpenveilchen trug.
»Das ist für Mamachen,« sagte sie zu Brigit, und Brigit nahm ihr den Topf aus der Hand und führte auch sie zu ihrem Teller. Da gab es viele gute Sachen, unter anderen ein gestricktes, braunes Leibchen, wie sie es sich schon lange gewünscht hatte, denn in der Küche blies von Osten her durch die Fensterritzen ein böser Zugwind.
Frau Pönsgen sah es ebenso rasch, wie Herr Brüggemann sein Portemonnaie gesehen hatte. Und als Brigit sagte: »Das ist natürlich von Mama,« da wunderte sie sich nicht im mindesten. Sie wußte aus ihrer fünfzehnjährigen Dienstzeit: das Beste kam immer von Mama.
Die beiden Jungen wollten inzwischen ihre Herzenslast los sein und standen um Papa herum, um ihm ihre Gedichte aufzusagen.
Er, der mit den Inspektoren zu tun hatte, beachtete sie vorerst nicht, dann aber wurde er sich über seine Versäumnis klar und nahm ihnen lachend und bedauernd die Bogen aus den Händen.
Fritz stellte sich in Positur, und Papa tat desgleichen, aber als er die Überschrift gelesen hatte: »Seinen lieben Eltern zum Weihnachtsfeste,« besann er sich eines Besseren und sagte: »Das wollen wir lieber bis nachher lassen, wenn wir bei Mama sind.«
Nun durften die Jungen gleich zu ihren Weihnachtstellern gehen. Und da ihre Freude sich noch in seligem Erstarren barg, trat Papa hinter sie, schüttelte sie im Genick und sagte: »Werdet ihr wohl fröhlich sein, ihr Banditen ... Was soll Mama denken, wenn ihr nicht fröhlich seid?«
Da löste sich der Bann, unter dem sie sich bisher befunden hatten. Fritz hängte das Schleppnetz auf die Gabeln, und als Artur auf seinem Schiffe gar noch eine »Barkasse« und eine »Pinasse« entdeckt hatte, da schlug das Gefühl unermeßlichen Reichtums in hellem Jubel über ihnen zusammen.
Wie das nun aber so geht. Kaum hatten sie alle ihre Herrlichkeiten durchstöbert, da lenkte sich ihr Begehren auch auf das, was ihnen nicht gehörte.
Artur hatte das schöne blanke Schloß entdeckt, das zwischen Mamas und seinem eigenen Teller lag. Wem es zukam, blieb ungewiß. Ein ziemlich sicheres Gefühl sagte ihm zwar, daß er nichts damit zu schaffen hätte, aber anderseits: was sollte Mama mit so einem Sicherheitsschloß anfangen, das übrigens, wenn man sich nicht sehr irrte, von einem Bramahmodell herstammte? Oh! Man war nicht umsonst im tiefsten Innern Mechanikus mit Leidenschaft und von Beruf.
Nun kam als zweiter Sachverständiger Fritz herzu. Der wieder hielt es für ein kombiniertes Chubbschloß. Was natürlich ein haarsträubender Unsinn war. Aber Fritz redete ja manchmal ins Blaue hinein.
Wie dem auch sein mochte, dieses Schloß war entschieden von allem das Schönste. Und wenn man den Schlüssel zurückschnappen ließ, dann gab es einen leisen, langsam verklingenden Ton, als säße in dem stählernen Leibe ein Geist, der die Harfe schlug.
Schnapp – ting! Schnapp – ting!
Aber da kam auch schon Papa und machte der Freude ein Ende. »Was fällt euch ein, ihr Schlingel?« schalt er scherzend. »Anstatt der armen Mama etwas zu Weihnachten zu schenken, nehmt ihr ihr noch das bißchen weg, was sie bekommen hat.«
Da schämten sie sich nicht schlecht. Und Artur meinte verlegen: sie hätten selbstverständlich was für Mama, aber sie hätten es draußen im Korridor gelassen, um es gleich mitzunehmen, wenn man zu ihr ginge.
»Holt es nur immer herein,« sagte Papa, »damit es um ihren Teller herum nicht so mager aussieht.«
Sie liefen eilig hinaus und brachten ihre Geschenke getragen.
Fritz hatte für sie eine Blumentopfmanschette gesägt, aus sechs Teilen bestehend, jeder mit dem anderen durch kunstvolle Scharniere verbunden. Aber das bedeutete gar nichts, verglichen mit Arturs Luftfenster, das aus Roßhaarsträhnen sorgsam geflochten war und sich zum äußeren Rahmen in jeden beliebigen Winkel stellen ließ.
Papa freute sich sehr. »Nun können wir uns schon allenfalls vor ihr sehen lassen,« meinte er. Und dann erklärte er ihnen auch den Mechanismus des Schlosses, und daß es den Zweck habe, die Blumen der lieben Mama in bessere Hut zu nehmen, denn schon öfters seien von ihren Lieblingsrosen einige weggekommen, was sich nur durch Anwendung von Nachschlüsseln erklären ließe.
»So – und nun wollen wir endlich zu ihr gehen,« schloß er. »Sie wird schon lange auf uns warten. Und fröhlich wollen wir dabei sein! Denn Fröhlichsein ist die Hauptsache, sagt Mama ... Hol uns die Schlüssel, Brigit, zum Gitter und zur Kapelle.«
Und Brigit holte die Schlüssel zum Gitter und zur Kapelle.
Thea. Phantasien über einem Teetopf
Inhaltsverzeichnis
1
Inhaltsverzeichnis
Sie ist eine Fee und ist auch keine ... Doch meine Fee ist sie gewiß. –
Nur wenige Male während meines Lebens ist sie mir erschienen in Augenblicken, da ich sie am wenigsten erwartete. –
Wenn ich sie halten wollte, war sie verschwunden.
Und dennoch hat sie oft in meiner Nähe geweilt. Ich fühlte sie im Hauch des Winterwindes, der über die sonnigen Schneefelder dahinstrich – ich atmete sie im Reif der Morgenfrühe, der glitzernd meinen Bart bedeckte – ich sah den Schatten ihres Leibes riesengroß über den dunstig schwarzen Winterhimmel gleiten, der friedlich wie die Hoffnungslosigkeit über der nachmittäglichen Dämmerung der glanzlos weißen Gefilde hing – ich hörte das Wispern ihrer Stimme in den Tiefen des glitzernden Kessels, den die bläuliche Spiritusflamme wie ein Kranz von Irrlichtern umtanzte. –
Aber von den wenigen Malen, da sie leibhaftig vor mir stand – immer wechselnd an Gestalt und dennoch stets dieselbe – mein Schicksal, meine Zukunft, wie sie werden sollte und nicht ward, meine Angst und meine Zuversicht, mein guter und mein böser Stern – von diesen Malen will ich euch erzählen.
2
Inhaltsverzeichnis
Es war vor vielen, vielen Jahren an einem Spätabend zur Epiphaniaszeit.
Draußen wirbelte der Schnee. – Wie endlose Mottenschwärme kamen die Flocken an die Fensterscheiben geflattert, stießen lautlos gegen das Glas und glitten dann senkrecht, als hätten sie beim Anprall ihr Flügelpaar zerbrochen, zur Erde nieder.
Die Lampe, die alte Augenverderberin, mit dem blanken Messingfuße und dem grünen, ausgefransten Schirme, stand auf dem Tische. Das Öl in ihrem Leibe gurgelte in ehrbarer Pflichterfüllung. – Auf ihrem Dochte sammelten sich die Schlacken, wie ein ausgebrannter Scheiterhaufen anzusehn, über dem ein müdes Feuer in sich zusammenkriecht.
Drüben in dem zerschlissenen Polsterstuhle war meine Mutter gemächlich eingenickt. Der Strickstrumpf, halb ihren Händen entglitten, lag auf der blaugeblümten Schürze. – Der Wollenfaden schnitt eine tiefe Furche in die geborstene Haut ihres Zeigefingers. – Eine der Nadeln wippte in kühnen Schwingungen hinter dem Ohre.
Der Samowar mit dem runden Bauche und dem blitzblanken Schornstein war auf dem Nebentische stehengeblieben. – Von Zeit zu Zeit wirbelte eine kleine, blaßbläuliche Dampfwolke von ihm empor, und ein zarter Holzkohlendunst umspielte kitzelnd meine Nase.
Vor mir aufgeschlagen lag des feinen Sallust Catilinarische Verschwörung. Aber was ging Sallust mich an? Dort steht er schon bereit – drüben auf dem Bücherbrette lachend und lockend in seinem goldgeschmückten Gewände, er, »Münchhausen«, der erste Roman meines Lebens.
Noch zehn Zeilen, dann war ich frei. – Ich wühlte die beiden Fäuste in die Hosentaschen hinein, denn mich fror. Noch zehn Zeilen! –
Sehnsüchtig starrte ich meinem Freunde entgegen.
Und siehe da! Was die Stümperkunst des Buchbinders geschaffen hatte – plumpe Arabesken von Weinblättern, die sich um geborstene Säulen ranken, eine aufgehende Sonne in der Mitte mit einem Spinnennetz von Strahlen ringsherum, – es beginnt plötzlich sich auszudehnen in Höhe und Breite, bis es das ganze Zimmer erfüllt. – Die Weinblätter schütteln sich im Morgenwinde, ein leises Rieseln läßt die Säulen erbeben, und höher und höher steigt die Sonne vom Boden empor. – Als ein Reigen tanzender Fackeln schießen ihre Strahlen durcheinander, ihre flimmernden Arme strecken sich, als wollten sie die Welt erfassen und an sich ziehn, sie im Sonnenschoße zu begraben. – Und ein Brausen erhebt sich in den Lüften, dumpf und atemholend wie ferner Orgelklang, es schwillt zum Drommetengetön, grell aufzuckendes Zymbalklingen mischt sich darein – –
Da springt der Sonnenleib weit auf – eine Flamme in bläulichem Phosphorglanze zischt heraus, und auf dieser Flamme steht hochaufgerichtet mit fliegendem Chiton ein weißes, goldhaariges Weib, Schwanenflügel im Nacken, eine Harfe in der Hand. – –
Wie sie mich sieht, lacht sie hell auf. Töricht, kindisch, ungezogen klingt dies Lachen, und wahrlich! ein Kindermund ist es, dem es entquillt. In herausfordernder Tollheit gucken die blauen Unschuldsaugen mich an. Die prallen Wangen erglühen in kecker Lebensfreude. – Alle guten Geister, wie kommt dieser Kindskopf auf solchen Götterleib? – Nun wirft sie die Harfe auf die Wolken, hockt auf den Saiten nieder, putzt sich mit dem linken Flügel behende das Näschen und ruft mir zu: »Komm, schlittre mich!« –
Mit offenem Munde starr' ich sie an. Dann raff ich all meinen Mut zusammen und stammle: »Wer bist du?«
»Ich heiße Thea,« kichert sie.
»Und wer bist du?« frag' ich noch einmal.
»Wer ich –? – Ach, dummes Zeug! – Komm, schlittre mich – oder nein, du kannst ja nicht fliegen – ich werde dich schlittern – das geht schneller.«
Und sie erhebt sich. Herr des Himmels, welche Gestalt! Wie stolz die Hüften sich wölben über dem lässig gesunkenen Gürtel, wie edel Hals und Busen sich vermählen, in Linien, wie sie nie ein Künstler zu erfassen vermocht.
Sie aber ergreift mit ihren schlanken Fingern das blaue, goldgewirkte Band, das den Hals der Harfe umschlingt, und macht eine Gebärde, als stelle sie sich zum Ziehen bereit vor einen Schlitten.
»Komm!« ruft sie noch einmal.
Ich wage nicht, zu widerstehn. Linkisch hock' ich auf den Saiten nieder.
»Ich – werd' sie – durchtreten!« stammle ich.
»Du Knirps!« lacht sie. »Was glaubst du wohl, wie leicht du bist! – Und nun halt dich fest...«
Kaum hab' ich Zeit, mit beiden Händen das goldene Geländer zu umklammern, da hör' ich dicht vor mir ein Rauschen. – Die mächtigen Flügel falten sich auseinander, mein Schlitten schwebt und schwankt in den Lüften – und vorwärts – aufwärts geht's in sausendem Fluge.
Schon liegt tief unter mir die Elternhütte. – Kaum, daß ihr Licht den Weg zu meinen Höhen findet. – Flockengewirbel umkreist meine Stirn. – Im nächsten Augenblicke ist es verschwunden. – Morgenrot bricht durch die Nacht. – Ein warmer Wind streicht mir entgegen und weht durch die Saiten, daß sie leise zittern und klagen wie ein schlafendes Kind, an dessen Seele ein Traum von Verlassensein vorüberzieht.
»Schau hinab!« ruft meine Fee, ihr lachendes Köpfchen zu mir wendend.
Da seh' ich, in Frühlingsglanz gebadet, einen weiten Teppich von Wäldern und Hügeln, von Matten und Seen endlos unter mir ausgebreitet. – Grünsilbern leuchtet's zu mir empor – kaum daß mein Blick die Fülle der Wunder zu ertragen vermag. –
»Es ist ja Frühling geworden!« sag' ich bebend.
»Willst du hinunter?« fragt sie.
»Ja, ja!«
Da gleiten wir auch schon hinab. –
»Rate, was das ist!« sagt sie. –
Ein altes, halbverfallenes Schloß hebt seine granitnen Mauern hoch vor mir empor ... Tausendjähriger Efeu wölbt sich über den Giebeln ... Schwarzweiße Schwalben schießen längs den Dächern dahin ... Ringsherum erhebt sich in lieblichem Dickicht blühender Weißdorn, um wehende Spiräenbüschel geschlungen ... Wilde Rosen tauchen aus dem Dunkel empor, fromm leuchtend wie Kinderaugen, und schlaftrunken läßt ein Holunderbaum seine Zweige auf sie niedersinken. – –
Am Rande der alten Terrasse, dort wo in zerbrochenen Urnen breitblätterige Kletten wuchern, wird es lebendig. Eine Mädchengestalt, schlank und biegsam, einen großen altmodischen Strohhut auf dem Haupte, ein Flortüchlein kreuzweise um Hals und Hüfte geschlungen, ist aus dem morschen, eisenbeschlagenen Tore getreten. Sie trägt ein weißes Bündelchen unter dem Arme und schaut prüfend nach rechts und links, wie einer, der auf die Wanderschaft will. –
»Sieh sie dir an,« sagt meine Freundin. –
Da fällt es wie Schuppen von meinen Augen.
»Das ist Lisbeth!« juble ich auf, »die nach dem Oberhofe geht.« –
Und kaum hab' ich den Oberhof genannt, da dringt es lieblich wie Bratenduft in meine Nase. – Rauchwolken wälzen sich mir entgegen, trübe Flammen zucken daraus empor. Da brätelt's und da kocht's, und hochauf spritzt das siedende Fett! Wunder auch! Man will ja Hochzeit feiern.
»Möchtest du auch das Richtschwert sehn?« fragt meine Freundin.
Ein geheimnisvoller Schauder rinnt mir über den Leib. – »Ich möcht' schon,« sag' ich, ängstlich. –
Ein Husch – ein leises Klirren – und eine enge, kahle Kammer hat sich um uns geschlossen ... Nun ist es wieder Nacht, und auf den grauen Bretterwänden tanzen die Mondlichter.
»Schau her,« flüstert meine Freundin und weist auf eine plumpe, alte Truhe.
Ihr lachendes Gesicht ist streng und feierlich geworden. Ihr Leib scheint noch zu wachsen. Hehr und herrlich, eine Richterin, steht sie vor mir.
Ich recke den Hals, ich schiele in die Truhe. –
Da liegt es – leuchtend und still, das alte Schwert. Ein Mondenstrahl gleitet an der Schneide entlang – eine lange, starre Linie ziehend. Doch was bedeuten die dunklen Flecke, die sich wie Höhlen in das glatte Metall hineingefressen haben? –
»Das ist Blut,« sagt meine Freundin und kreuzt die Arme über der Brust. –
Mich fröstelt's, aber meine Blicke sind wie festgewachsen an dem schreckensvollen Gebilde.
»Komm,« sagt Thea.
»Ich kann nicht!«
»Willst du's haben?«
»Wie – das Schwert?«
Sie nickt.
»Aber darfst du's denn verschenken? Gehört es dir?«
»Ich darf alles, und mir gehört alles.«
Das Grauen packt mich mit eisiger Faust. Aber ich kann nicht anders: »Gib's mir!« ruf' ich schaudernd.
Der eherne Blitz zuckt empor und legt sich kalt und feucht in meine Arme. Mir ist, als begänne das Blut daran aufs neue zu fließen. –
Meine Arme erstarren, das Schwert entsinkt ihnen und fällt auf die Saiten nieder. Die fangen winselnd zu klirren an. – Fast wie Angstschreie klingt ihr Getön. –
»Nimm dich in acht!« ruft meine Freundin; »das Schwert kann sie zerreißen. – Das ist schwerer als du!« –
Wir stiegen in die Mondnacht hinaus. Doch geht es lange nicht mehr so schnell wie kurz vorher. Meine Freundin keucht, und die Harfe schwankt auf und nieder wie ein Papierdrache, wenn er in Gefahr ist, umzuschlagen. –
Aber ich achte nicht darauf. Denn etwas sehr Drolliges nimmt meine Sinne gefangen.
An dem Monde, der als goldene Scheibe zwischen Wolkeninseln daherschwimmt, ist etwas lebendig geworden. Etwas Schwarzes, Zwiegespaltenes zappelt an seiner unteren Seite hin und her. Ich sehe schärfer zu und entdecke ein Paar bespornter Reiterstiefel, in denen zwei mäßig gerade, dünne Beine stecken. Das Reitleder auf ihrer Innenseite ist alt und abgescheuert und schimmert in stumpfem, mißfarbenem Glanze.
»Seit wann marschiert der Mond auf zwei Beinen durch die Welt?« frag' ich mich und fange zu lachen an.
Und plötzlich erscheint auf der entgegengesetzten Seite ebenfalls etwas Schwarzes – das wackelt drollig nach rechts und nach links. – Ich strenge mein Auge an und erkenne – erkenne meines alten Freundes Münchhausen verzwickten Schnauz- und Knebelbart. – Er hat mit seinen langen, dürren Fingern die Kanten der Mondscheibe umklammert und lacht, lacht, daß ihm schier der Atem auszugehen droht. –
»Ich will hinauf,« ruf' ich meiner Freundin zu. –
Sie wendet sich um. Ihr Kinderantlitz hat sich nun vollends in ernste Madonnenzüge gewandelt. Um Jahre scheint sie gealtert. – – Wie Klänge von geborstenen Glocken hallen die Worte mir ans Ohr: »Wer ein Richtschwert bei sich trägt, kann nicht zum Monde hinauf.«
Mein Knabentrotz empört sich. »Ich will aber zu meinem Freunde Münchhausen.«
»Wer ein Richtschwert bei sich trägt, hat keinen Freund.«
Ich springe auf, will an der Leine zerren – da schlägt die Harfe um – ich stürz' ins Leere – das Richtschwert über mich – senkrecht bohrt es sich in meinen Leib – ich stürze – ich stürze –
»Ja doch,« sagt meine Mutter. »Warum rufst du so ängstlich? Ich wache ja schon!« Und ruhevoll nimmt sie die Stricknadel hinter dem Ohre fort, sticht sie in den Knäuel und wickelt den angefangenen Strumpf gemächlich drum herum – – –
3.
Inhaltsverzeichnis
Sechs Jahre vergingen – dann begegnete mir Thea wieder. Diesmal war sie so gnädig gewesen, ihre Heimat Avalun zu verlassen, um auf dem Theater der Universitätsstadt, in der ich studienhalber soff und paukte, das Fach der Naiven zu übernehmen.
Auf ihren roten Pantöffelchen hüpfte sie nach Bachstelzenart über die Bretter – sie ließ die kurzen Mullfähnchen in den verwegensten Schwenkungen um sich herumwehen – sie trug schwarzseidene Zwickelstrümpfe, die sich über dem zarten Knöchel in einer höchst angenehmen Bogenlinie schwellten und unter dem Knie in dem gefältelten Rocksaum ein allzu frühes Ende nahmen, – sie drehte sich zwei dralle Backfischzöpfe, an deren blauen Seidenschleifen sie zu kauen liebte, wenn die ihrem Fache angemessene Schüchternheit sie übermannte – sie sog an den Fingern, sie streckte die Zunge aus, sie quiekte, miaute, rümpfte die Nase – und wie sie erst lachte! – Es war jenes süße, gezierte, lasterhafte Soubrettenlachen, das mit einer Tonleiter beginnt und in einem Turteltaubengurren endet. –
Den will ich sehn unter uns, den sie mit all den hergebrachten Mätzchen ihres Faches nicht in einen Zustand verliebten Wahnsinns versetzt hätte ... Den will ich kennen, der in den Tiefen seiner Kollegienmappe nicht ein halbes Dutzend glutvoller Oden vergraben hatte, vergraben wie den gigantischen Schmerz in seiner Heldenseele. –
Und eines Nachmittags erschien sie plötzlich auf der Schlittschuhbahn. – Sie trug eine glänzende Plüschjoppe, mit Sealskin besäumt, und eine Tschapka, die keck auf dem linken Ohre saß. – In dem rotblonden Wirrhaar, das ihre Wangen umrahmte, hatte sich der Reif wie ein Demantstaub festgesetzt, und an dem geröteten Näschen, das unwirsch in der Kälte schnupperte, hing ein lichtes Tröpflein. –
Nachdem sie dem Schlittschuhschnaller eine kleine Szene gemacht hatte, in der die Kosenamen »Trottel« und »Fratz« ihren süßen Lippen entflohen, hub sie zu laufen an. – Ein Kind, das allzu früh dem Gängelbande entlassen wurde, kann es besser. –
Wir dummen Jungen standen dösig umher und glotzten sie an. – In uns schwoll die Gier, ihr zu helfen, zur Raserei empor, aber als sie mit einem Schmollmäulchen hilfesuchend die Arme nach uns ausstreckte, wichen wir zurück wie vor dem bösen Feinde. Nicht einer fand den Mut, das unerhörte, übermenschliche Glück, nach dem ihn hungerte seit Monaten bei Tag und bei Nacht, schlichtweg in Empfang zu nehmen. –
Und dann plötzlich – bei einer furchtsamen Schwenkung – verhakte sie sich, stolperte, kippte erst nach vorne und hierauf nach hinten über und sank zu guter Letzt dem Schüchternsten und Verliebtesten von dieser Bande geradeswegs in die Arme.
Und der war ich!
Ja, der war ich! Noch heute ballen sich mir die Fäuste vor Wut, wenn ich bedenke, es hätte ein anderer sein können.
Von denen, die zurückblieben, als ich sie im Triumph von hinnen führte, war nicht ein einziger, der mich nicht kalt lächelnd hätte ermorden mögen.
Unter der Wucht der Worte, die sie lächelnd an mich Unwürdigen verschwendete, schlug ich stumm und errötend die Augen nieder. Dann lehrte ich sie die Füße setzen und produzierte mich selbst in meinen kühnsten Bogen; auch erzählte ich ihr, daß ich Student im zweiten Semester sei, und während die Glut mir aufs neue in die Wangen schoß, fügte ich flüsternd hinzu, daß ich ein Dichter werden wolle. –
»Ach, wie nett!« rief sie aus. »Sie dichten gewiß auch jetzt schon?«
Das täte ich freilich. Ich hätte sogar ein Drama unter der Feder, das die Schicksale des Troubadours Bernard de Ventadour freirhythmisch behandelte. –
»Ist da auch für mich eine Rolle drin?« fragte sie.
»Nein,« erwiderte ich. »Aber das schadet nichts. Ich mache eine 'rein.«
»O wie lieb von Ihnen!« rief sie. »Und wissen Sie was? Das müssen Sie mir vorlesen. Ich kann Ihnen dann mit meiner Bühnenerfahrung zur Seite stehn.«
Eine Woge von Glück, unter der ich zu ersticken drohte, ergoß sich über mich.
»Ich habe auch – an Sie – Gedichte – gemacht,« stammelte ich, von jener Woge fortgerissen.
»Guck mal da!« sagte sie ganz freundlich, anstatt mich zu ohrfeigen. »Die müssen Sie mir schicken.«
»Sehr wohl« ...
Und dann geleitete ich sie bis vor ihre Tür, während in angemessener Entfernung wie ein Rudel Wölfe meine Freunde hinter uns herstrichen. – –
Die erste Hälfte der Nacht brachte ich äugelnd vor ihrem Fenster, die zweite Hälfte dichtend an meinem Tische zu, denn ich wollte die Sammlung rasch noch um einige Perlen vermehren. – Mit Morgengrauen schob ich das Kuvert, das prall war wie eine Trommel, in den Postkasten, dann führte ich meinen brennenden Kopf auf den Wällen spazieren.
Am Nachmittage kam ein veilchenfarbenes Briefchen, das sehr erregend duftete und statt des Siegels eine von einer Fackel durchbohrte goldene Lyra trug. – Es enthielt folgende Zeilen:
»Lieber Dichtersmann!
Ihre Verse sind gar nicht so übel, nur etwas zu feurig. – Ich möchte nun ganz eilig auch das Drama hören. Meine alte Duenna geht heute abend aus. Ich werde allein zu Hause sein und mich langweilen. Drum kommen Sie um sieben Uhr zum Tee. Aber Ihr Ehrenwort, daß Sie's niemandem verraten, sonst hat Sie nicht mehr ein klein wenig lieb
Ihre Thea.«
So hatte sie geschrieben, ich kann's beschwören, sie, meine Fee, meine Muse, meine Egeria, sie, zu der ich anbetend emporschauen wollte bis zu meinem letzten Atemzug.
Ich revidierte und korrigierte und rezitierte rasch einige Szenen meines Dramas, ich strich ein halbes Dutzend überflüssiger Personen und erfand ein neues Dutzend hinzu.
Um halb sieben machte ich mich auf den Weg. – Milchiger Eisdunst lag in der. Luft. Vor jedem der mir Begegnenden flutete eine Wolke gefrierenden Atems daher.
An einem Blumenladen blieb ich stehn.
Alle Schätze der Maienzeit lagen dort ausgebreitet auf der schwarzsamtnen Terrasse. Da waren Veilchenbeete und Maiglöckchenbüsche, da war auch ein Strauß langgestielter Teerosen, lässig von einem violetten Seidenbande zusammengehalten.
Ich seufze laut auf – ich weiß schon warum.
Und dann zähl' ich meine Barschaft: Acht Mark und siebzig Pfennige. – Sieben Biermarken dazu, aber die stehen ja leider nur im Bereiche meiner Kneipe in gutem Kurse – fünfzehn Pfennige das Stück.
Endlich fass' ich mir ein Herz und trete in den Laden.
»Was kostet der Rosenstrauß dort?« flüstere ich, denn laut zu reden wag' ich nicht, teils aus Schüchternheit, teils des Geheimnisses wegen.
»Zehn Mark,« sagt die dicke alte Verkäuferin, läßt die Stechpalmblätter, die sie auf dem Schoße hält, gemächlich in eine irdene Schüssel sinken und schickt sich an, den Strauß aus dem Fenster zu holen. –
Ich werde blaß vor Schrecken. Mein erster Gedanke ist: Lauf zur Kneipe und such die Marken in bar Geld zu wechseln, denn zu pumpen gibt's heute nichts, zwei Tage vor dem Ersten.
Da holt es vom Turm her dumpf zum Schlage aus.
»Kann ich ihn nicht etwas billiger haben?« stammle ich mit halberstickter Stimme.
»Nanu – auch noch!« sagt sie beleidigt. »Es sind zehn Rosen drinne – die kosten jetzt eine Mark das Stück. Das Seidenband is schon gar nicht gerechnet.«
Ich will trostlos den Laden verlassen, aber die alte Verkäuferin, die ihre Kunden kennt und hinter meinem Stammeln und meinem Flüstern schon längst den Liebesroman hat hervorgucken sehn, fühlt ein menschliches Rühren.
»Man kann ja 'n paar von de Rosen 'rausnehmen,« sagt sie. »Wieviel möchten Sie denn schließlich dranwenden, junger Herr?«
»Acht Mark und siebzig Pfennige,« will ich Unbedachter antworten, da fällt mir zur rechten Zeit noch ein, daß ich ja ein Trinkgeld für ihre Zofe – Damen vom Theater haben zur Bedienung immer Zofen – übrigbehalten muß, falls die mich später zur Tür herausläßt. – »Sieben Mark,« erwidere ich drum.
Mit ruhiger Würde nimmt sie vier von den Rosen heraus, und ich, demütig und eingeschüchtert, wage nicht, mich zu wehren. –
Aber mein Strauß ist noch immer üppig und voll, und ich darf mir sagen, daß ein werbender Prinz keinen schöneren zu spenden vermöchte.
Fünf Minuten nach sieben steh' ich vor ihrer Tür.
Daß mir der Atem stockt, daß ich nicht wage anzuklopfen, daß der Rosenstrauß meinen zitternden Händen zu entsinken droht, das brauch' ich nicht zu erzählen, das ist jedem selbstverständlich, der in seiner Jugend jemals mit Feen von Theas Art zu tun hatte.
Wie ich dennoch in ihr Zimmer gekommen bin, ist mir bis heutigestags unklar geblieben, aber schon seh' ich sie mir lachend entgegeneilen und ihr Antlitz ohne weiteres in dem Blumenschwall vergraben.
»Oh, Sie Verschwender!« ruft sie und reißt mir den Strauß aus der Hand, um damit vor dem Spiegel auf- und niederzutänzeln. Und dann nimmt sie plötzlich eine ernsthafte Miene an, und mich an einem Knopfe meines Überrockes näher an sich heranziehend, sagt sie: »So – und zum Lohne dürfen Sie mir einen Kuß geben.«
Ich hör's und fass' es nicht. Mir ist, als wolle mein Herz mir zum Halse emporsteigen, aber dicht vor mir blühen ihre Lippen, und ich bin tapfer und küsse sie.
»Brr,« sagt sie, »Ihr Bart hängt ja ganz voll Reif.«
Mein Bart! Ihr Götter im Himmel habt's gehört! Ganz ernsthaft und würdig hat sie von meinem Bart gesprochen.