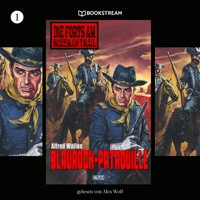Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Western Legenden (Historische Wildwest-Romane)
- Sprache: Deutsch
Der Scout Roy Catlin brachte Tom Calhoun und seine Familie mit einem Auswanderertreck nach Texas. Jetzt wird er in Arizona Zeuge, wie die Butterfield-Postkutschen-Linie weitere Pioniere und Siedler nach Arizona bringt. Dieses Land wurde aber den Chiricahua-Apachen vertraglich zugesichert. Männer wie der skrupellose John Ward und der engstirnige Offizier Bascom entzünden die Fackel eines Aufstandes, der die kommenden Jahre das Land erschüttern wird. Selbst der Chiricahua-Apache Cochise, der einst an ein friedliches Zusammenleben zwischen Weiß und Rot glaubte, kann diese verhängnisvolle Entwicklung nicht mehr aufhalten. RIO CONCHO Band 6 der historischen Familiensaga von Alfred Wallon
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In dieser Reihe bisher erschienen:
9001 Werner J. Egli Delgado, der Apache
9002 Alfred Wallon Keine Chance für Chato
9003 Mark L. Wood Die Gefangene der Apachen
9004 Werner J. Egli Wie Wölfe aus den Bergen
9005 Dietmar Kuegler Tombstone
9006 Werner J. Egli Der Pfad zum Sonnenaufgang
9007 Werner J. Egli Die Fährte zwischen Leben und Tod
9008 Werner J. Egli La Vengadora, die Rächerin
9009 Dietmar Kuegler Die Vigilanten von Montana
9010 Thomas Ostwald Blutiges Kansas
9011 R. S. Stone Der Marshal von Cow Springs
9012 Dietmar Kuegler Kriegstrommeln am Mohawk
9013 Andreas Zwengel Die spanische Expedition
9014 Andreas Zwengel Pakt der Rivalen
9015 Andreas Zwengel Schlechte Verlierer
9016 R. S. Stone Aufbruch der Verlorenen
9017 Dietmar Kuegler Der letzte Rebell
9018 R. S. Stone Walkers Rückkehr
9019 Leslie West Das Königreich im Michigansee
9020 R. S. Stone Die Hand am Colt
9021 Dietmar Kuegler San Pedro River
9022 Alex Mann Nur der Fluss war zwischen ihnen
9023 Dietmar Kuegler Alamo - Der Kampf um Texas
9024 Alfred Wallon Das Goliad-Massaker
9025 R. S. Stone Blutiger Winter
9026 R. S. Stone Der Damm von Baxter Ridge
9027 Alex Mann Dreitausend Rinder
9028 R. S. Stone Schwarzes Gold
9029 R. S. Stone Schmutziger Job
9030 Peter Dubina Bronco Canyon
9031 Alfred Wallon Butch Cassidy wird gejagt
9032 Alex Mann Die verlorene Patrouille
9033 Anton Serkalow Blaine Williams - Das Gesetz der Rache
9034 Alfred Wallon Kampf am Schienenstrang
9035 Alex Mann Mexico Marshal
9036 Alex Mann Der Rodeochampion
9037 R. S. Stone Vierzig Tage
9038 Alex Mann Die gejagten Zwei
9039 Peter Dubina Teufel der weißen Berge
9040 Peter Dubina Brennende Lager
9041 Peter Dubina Kampf bis zur letzten Patrone
9042 Dietmar Kuegler Der Scout und der General
9043 Alfred Wallon Der El-Paso-Salzkrieg
9044 Dietmar Kuegler Ein freier Mann
9045 Alex Mann Ein aufrechter Mann
9046 Peter Dubina Gefährliche Fracht
9047 Alex Mann Kalte Fährten
9048 Leslie West Ein Eden für Männer
9049 Alfred Wallon Tod in Montana
9050 Alfred Wallon Das Ende der Fährte
9051 Dietmar Kuegler Der sprechende Draht
9052 U. H. Wilken Blutige Rache
9053 Alex Mann Die fünfte Kugel
9054 Peter Dubina Racheschwur
9055 Craig Dawson Dunlay, der Menschenjäger
9056 U. H. Wilken Bete, Amigo!
9057 Alfred Wallon Missouri-Rebellen
9058 Alfred Wallon Terror der Gesetzlosen
9059 Dietmar Kuegler Kiowa Canyon
9060 Alfred Wallon Der lange Weg nach Texas
9061 Alfred Wallon Gesetz der Gewalt
9062 U. H. Wilken Dein Tod ist mein Leben
9063 G. Michael Hopf Der letzte Ritt
9064 Alfred Wallon Der letzte Mountain-Man
9065 G. Michael Hopf Die Verlorenen
9066 U. H. Wilken Nächte des Grauens
9067 Dietmar Kuegler Die graue Schwadron
9068 Alfred Wallon Rendezvous am Green River
9069 Marco Theiss Die Mathematik des Bleis
9070 Ben Bridges Höllenjob in Mexiko
9071 U. H. Wilken Die grausamen Sieben
9072 Peter Dubina Die Plünderer
9073 G. Michael Hopf Das Gesetz der Prärie
9074 Alfred Wallon Tag der Vergeltung
9075 U. H. Wilken 5000 Dollar für seine Leiche
9076 Lee Roy Jordan Wo Chesterfield geht
9077 U. H. Wilken Knie nieder und stirb
9078 A. Wallon Der Tod des Falken
9079 L. R. Jordan Viva Chesterfield
9080 D. Kuegler Verdammten von Shenandoah
DER TOD DES FALKEN
RIO CONCHO NO.06
WESTERN LEGENDEN
BUCH 78
ALFRED WALLON
Dieses Buch gehört zu unseren exklusiven Sammler-Editionen
und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.
In unserem Shop ist dieser Roman auch als E-Book lieferbar.
Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt. Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.
Copyright © 2025 Blitz Verlag, eine Marke der Silberscore Beteiligungs GmbH, Mühlsteig 10, A-6633 Biberwier
Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati
Umschlaggestaltung: Mario Heyer
Logo: Mario Heyer
Satz: Gero Reimer
Alle Rechte vorbehalten
www.Blitz-Verlag.de
ISBN: 978-3-68984-306-9
9078 vom 26.03.2025
INHALT
Cochise soll sterben
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Der Tod des Falken
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Historische Anmerkungen zum vorliegenden Roman
Alfred Wallon
COCHISE SOLL STERBEN
Kapitel 1
Einsam zog der Bussard am stahlblauen Himmel seine Kreise, während die beiden bronzefarbenen Krieger hinunter in die weite Ebene blickten und die Weißen beobachteten, die unweit der Quelle ein großes Holzhaus bauten. Sie schufteten wie die Besessenen, und das schon seit vielen Tagen. Und sie nahmen alle nur erdenklichen Mühen auf sich, mit schweren Pferdegespannen das für den Bau der Station benötigte Holz aus den Dragoon Mountains zu holen und es dann hier an Ort und Stelle zu verarbeiten.
„Sie sind so zahlreich wie die Sandkörner in der Gila-Wüste“, sagte der jüngere zu dem älteren Apachen. „Und wir sehen einfach zu, wie sie immer weiter in unsere Heimat eindringen und alles an sich reißen. Ich glaube, was Geronimo sagt. Die Weißen sind wie eine Plage, die man ausrotten muss, bevor sie über unser Volk kommt!“
Der Ältere wandte jetzt den Kopf und blickte den hitzköpfigen Krieger lange an, bevor er schließlich das Wort ergriff. Man sah ihm sofort die Würde und die Autorität an, die er ausstrahlte. Obwohl sein langes Haar bereits erste graue Strähnen aufwies, so war sein Körper der eines Kriegers, der zu kämpfen verstand. Sein Name war Cochise, und er war der Häuptling der Chiricahua.
„Naiche, du bist jung und heißblütig“, sagte er dann zu seinem Sohn, der ihn mit drei weiteren Kriegern auf diesem Ritt begleitet hatte. Die anderen Apachen warteten weiter drüben bei den roten Felsen, während es sich Naiche nicht nehmen ließ, seinem Vater zu der Stelle zu folgen, von wo man das Treiben der Weißen am besten beobachten konnte.
„Die Weißen sind zahlreich“, fuhr Cochise nun fort. „Aber sich gegen sie zu stellen, das würde den Untergang unseres Volkes bedeuten, mein Sohn. Nein, wir dürfen nicht gegen sie kämpfen. Es soll Frieden herrschen.“
„Frieden!“, stieß Naiche erbost hervor. „Hast du denn vergessen, wie viele schon von uns gestorben sind? Sie wollen unser Land, und sie werden es bekommen, wenn wir uns nicht zu wehren versuchen. Ich bin ein Krieger, der seinen Weg gehen muss, Vater.“
„Es ist ein Weg, der in den Tod führen wird, Naiche“, erwiderte Cochise mit sichtlichem Bedauern in der Stimme. Weil er wusste, dass es außer Naiche noch viele andere junge Krieger seines Stammes gab, die alle Weißen aus den Dragoon Mountains vertreiben wollten. „Ich liebe mein Volk, genau wie du auch. Aber welche Chance hat ein junger Baum in einem Sandsturm, wenn seine zahlreichen Wurzeln schon zersplittert sind? Er wird fallen eines Tages. Auch Mangas Coloradas weiß das, und deswegen will auch er den Frieden mit den Weißen.“
„Mangas Coloradas ist alt und schon müde“, antwortete Naiche und winkte ab. „Aber Geronimo hat nicht vergessen, was die Weißen uns angetan haben. Der Tag wird kommen, wo alle auf seine Stimme hören werden. Das wird der Tag sein, wo auch ich ihm folge, Vater!“
Die letzten Worte Naiches hatten etwas Endgültiges an sich. Das spürte Cochise, und deshalb begriff er, dass es nicht leicht sein würde, die vielen jungen Krieger zu beruhigen. Denn je weiter die Weißen in Richtung Apache Pass vordrangen, umso mehr fühlten sich die Völker der roten Stämme bedrängt. Und die Stimme des Mannes, der in Zeiten des Friedens einst den Namen Gokhlayeh getragen hatte, gewann immer mehr an Kraft bei den Chiricahua.
Aber solange Cochise der Häuptling seines Stammes war, würde er alles tun, um ein friedliches Zusammenleben zwischen Rot und Weiß zu garantieren. Denn nur so konnten beide voneinander lernen, ohne Hass und Vorurteile. Auch wenn das für viele junge Krieger Feigheit bedeutete!
Naiche bemerkte, dass seine Worte Cochise sehr trafen. Aber das kümmerte ihn nicht. Zumindest nicht in diesem Moment.
„Heute bauen sie nur eine Station für ihre Wagen auf Rädern“, fuhr Naiche fort. „Aber mit den Wagen kommen andere Weiße ins Land, und es werden noch mehr Forts in den Bergen errichtet. Sie sind dabei, uns von allen Seiten einzukreisen, Vater. Jeder weiß das und begreift es.“
„Die Weißen haben mein Wort, und das gilt auch noch“, antwortete Cochise. „Wenn ich es breche, dann ist wirklich Krieg in der Apacheria, Naiche. Aber ich denke nicht nur an das, was heute ist, sondern auch an die Zukunft unserer Kinder. Sie sind es, die mit den Weißen zusammenleben müssen. Und je eher sie das verstehen, umso besser ist es.“
„Ich will es nicht verstehen“, antwortete der junge Chiricahua-Apache kopfschüttelnd. „Es ist der Weg des Kriegers, der mein Leben und das vieler anderer bestimmt. So war es schon immer, und so wird es immer sein. Die Weißen werden schon sehr bald aus den Bergen wieder verschwinden. Denn sie sind keine Krieger wie wir!“
Naiche war stolz, und die Wildheit seiner Jugend sprach aus ihm. Selbst wenn ihm sein Vater jetzt sagen würde, dass Naiche sich sehr irrte, hätte der es nicht akzeptiert. Und so wie Naiche dachten noch viele Krieger der Chiricahua-Apachen.
„Ich habe dich hierher mitgenommen, damit du erkennst, dass wir nur weiterkommen, wenn wir in Frieden leben, mein Sohn“, sagte Cochise nun zu Naiche. „Ich erwarte nicht, dass du dies jetzt schon verstehst, aber du darfst nicht vergessen, was ich dir gesagt habe. Es wird der Tag kommen, wo wir nicht mehr wählen können, sondern uns dem Willen anderer fügen müssen. Und wenn dieser Tag da ist, sollten wir vorbereitet sein.“
Er brauchte nur seinen Sohn kurz anzusehen, um zu erkennen, dass Naiches Augen vor Wut aufblitzten. Natürlich war Naiche noch jung und besaß nicht die Weisheit und Erkenntnis eines Mannes in Cochises Alter. Denn sonst hätte er längst erkannt, dass in diesem Land alles im Umbruch begriffen war.
Seit die Weißen vor einigen Jahren nach Arizona gekommen waren, hatten sie sich immer mehr ausgebreitet. Ansiedlungen waren entstanden, nachdem die Soldaten zuvor ihre Forts am Rande der Apacheria errichtet hatten.
Zuerst hatten sie nur diejenigen schützen wollen, die in der Erde nach dem gelben Metall wühlten, das für die Weißen einen unermesslichen Wert zu besitzen schien. Aber dann waren andere gekommen, die den Boden aufbrachen und Zäune bauten. Menschen, die sich nicht mehr vertreiben lassen würden!
All dies hatte Cochise längst erkannt und wusste, dass es nur noch einen einzigen Weg gab, um überleben zu können: Sein Volk musste mit den immer zahlreicher werdenden Weißen in Frieden leben. Denn die Weißen waren es, denen die Zukunft gehörte, und nicht das Volk der Apachen. Das war ein Gedanke, der Cochise mehr als nachdenklich stimmte.
„Lass uns auf die Jagd gehen, Vater“, riss die Stimme Naiches den Häuptling der Chiricahua-Apachen aus seinen trüben Gedanken. „Ich habe genug gesehen von den Weißen. Jetzt will ich jagen für meine Familie.“
Cochise nickte und wandte sich seufzend ab. Er folgte seinem Sohn, und als die beiden sich wieder zu den wartenden Kriegern gesellten, registrierte Cochise deren Blicke sofort. Es waren Blicke voller Hass und Zorn. Cochise ahnte, dass sein Traum von einem dauerhaften Frieden in diesem Land noch sehr lange brauchen würde, bis er sich eines Tages bewahrheitete. Hoffentlich erlebte er diesen Tag noch!
Die Krieger schwangen sich auf die Rücken der Pferde und ritten los. Weiter hinauf in die höheren Regionen der zerklüfteten Berge. Hier begann die Apacheria, die Heimat von Cochises Volk, das noch nie zuvor ein Weißer betreten hatte. Aber wie lange noch würde es dauern, bis sich das änderte?
* * *
Der einsame Reiter zügelte seinen Morgan-Hengst in der Nähe eines Arroyos und blickte zum hitzeflimmernden Horizont. Schweißperlen standen auf seiner Stirn, als er nach der Canteenflasche am Sattelhorn griff und den Verschluss aufschraubte. Er feuchtete seine Bandana kurz an und strich dann damit dem Pferd über die Nüstern, um dem Tier so wenigstens etwas Erleichterung zu verschaffen. Anschließend nahm der Mann selbst einen kleinen Schluck, spülte langsam seine Mundhöhle aus, bevor er das Wasser die trockene Kehle hinunterrinnen ließ.
Er blickte wieder zum Horizont, im Glauben, bald Fort Buchanan zu erreichen. Aber er hatte sich getäuscht, denn es sah ganz danach aus, als wenn er es bis zum Einbruch der Dunkelheit nicht mehr schaffen würde, ans Ziel zu kommen. Also blieb ihm nach Lage der Dinge wohl nichts anderes übrig, als hier draußen sein Camp aufzuschlagen. Und das war nicht ganz ungefährlich, denn er wusste um die Gefahren in diesem Teil des Arizona-Territoriums.
Der Name des Mannes war Roy Catlin. Er hatte Texas vor einigen Wochen verlassen, um seinen bereits begonnenen Weg nach Süden fortzusetzen. Er wollte nach Mexiko, um dort für einige Zeit zu bleiben und das Leben zu genießen. Denn selbst in Texas spürte man diesen unseligen Bürgerkrieg, der die ganze Nation gespalten hatte.
Es war nicht Roy Catlins Krieg, und deswegen hatte er kurzerhand beschlossen, die nächsten Wochen und Monate in Mexiko zu verbringen. Wenigstens so lange, bis absehbar war, dass sich ein Ende dieser immer gewalttätiger werdenden Auseinandersetzungen abzeichnete.
Roy Catlin verstaute die Canteenflasche am Sattelhorn und ritt dann weiter. Er dirigierte das Tier auf eine Gruppe von Felsen zu, die genügend Schutz boten, um hier die Nacht über bleiben zu können. Denn es war nicht ungefährlich für einen Weißen, allein hier draußen die Nacht zu verbringen. Die Dragoon Mountains waren nur wenige Meilen entfernt, und in diesen Bergen lebten die Apachen. Krieger, die schon oft die Grenze nach Mexiko überquert hatten, um dort zu rauben und zu plündern. Die Mexikaner waren ihre Erzfeinde, schon seit vielen Generationen. Und der Gedanke, womöglich auf Chiricahua- oder Mimbreño-Krieger zu stoßen, beunruhigte selbst einen Mann wie Roy Catlin.
Deshalb hatte er auch versucht, weites und offenes Land zu meiden, so gut das möglich war. Natürlich hatte dies so manchen Umweg gekostet, und dieser Tatsache hatte er es zu verdanken, dass er heute nicht in den sicheren Quartieren von Fort Buchanan schlafen konnte, sondern stattdessen sein Camp in der Einsamkeit einer von Sandsteinfelsen zerklüfteten Landschaft aufschlagen musste.
Roy Catlin führte sein Pferd zu einigen Fettholzbüschen, sattelte es ab und wickelte die Zügel um die Sträucher. Plötzlich hörte er dumpfe Hufschläge. Sofort riss er sein Gewehr an sich und eilte weiter nach vorn. Ein Gedanke jagte den anderen, während er den Horizont beobachtete und schließlich den Reiter sah, der direkt aus der Sonne zu kommen schien. Kein Apache, sondern ein Weißer!
Auch wenn er innerlich aufatmete, dass er nicht mit Apachen zu rechnen brauchte, so blieb Roy Catlin dennoch misstrauisch und hielt das Gewehr im Anschlag. Zumal der Reiter sich langsam aber sicher der Stelle zwischen den Felsen näherte, wo sich Catlin verborgen hielt.
Gespannt wartete der schwarzhaarige große Mann ab, was weiter geschah. Jetzt zügelte der andere Mann sein Pferd, stieg schließlich aus dem Sattel und untersuchte den Boden. Er schien wohl die Fährte des Morgan-Hengstes entdeckt zu haben und schlussfolgerte daraus, dass sich Roy Catlin hier irgendwo in der Nähe aufhalten musste.
„Suchen Sie vielleicht mich?“, fragte Catlin unvermittelt und trat jetzt mit vorgehaltenem Gewehr aus seiner Deckung, richtete den Lauf genau auf die Brust des Mannes, der zusammenzuckte und sich dann ganz langsam umdrehte.
Der Mann war in Catlins Alter, aber etwas untersetzt und stoppelbärtig. Er hielt beide Arme weit von sich gestreckt und machte nicht die geringsten Anstalten, nach seiner Waffe zu greifen.
„He, Mister, ich bin weiß Gott ein friedliebender Mensch!“, kam es nun krächzend über seine Lippen. „Sie können das Gewehr ruhig herunternehmen. Oder sehe ich vielleicht aus wie ein skalphungriger Apache?“
„Weshalb folgen Sie mir?“, stellte Catlin nun die Gegenfrage, ohne auf die Bemerkung des Mannes einzugehen. „Nun los, reden Sie schon, ich warte!“
Sein Tonfall ließ den anderen unwillkürlich eine Spur bleicher werden. Er schluckte, bevor er zu einer Antwort ansetzte.
„Mister, ich heiße Bill Anderson“, stieß er hastig hervor. „Ich bin Scout in Fort Buchanan und auf einem Routineritt. Vor einer knappen Stunde stieß ich auf Ihre Fährte und beschloss, ihr zu folgen. Weil ich natürlich wissen wollte, was ein Pferd mit beschlagenen Hufen hier in dieser Gegend verloren hat. Oder gehören Sie vielleicht zu der Sorte Menschen, die nicht wissen, dass man mit Apachen rechnen muss?“
Roy Catlin erwiderte im ersten Moment überhaupt nichts. Aber zumindest trugen die Worte Andersons dazu bei, dass sich seine Anspannung wenigstens zum Teil legte. Er ließ den Gewehrlauf sinken und sah dabei, wie der Scout erleichtert aufatmete.
„Wie weit ist es bis nach Fort Buchanan?“, wollte er dann von Anderson wissen. „Das ist nämlich mein Ziel. Sieht aber ganz so aus, als wenn ich das heute nicht mehr schaffe.“
„Heute?“ Anderson grinste. „Mister, ich weiß zwar nicht, von woher Sie kommen. Aber das Fort ist noch einen guten halben Tagesritt entfernt. Sie kennen sich wohl nicht besonders aus hier?“
„Eigentlich bin ich auf dem Weg nach Mexiko“, erwiderte Catlin, ging auf Anderson zu und streckte seine Hand aus. „Ich heiße übrigens Roy Catlin.“
„Ist mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen“, erwiderte der Armeescout. „Auch wenn ich im ersten Moment damit gerechnet habe, dass Sie mir eine Kugel verpassen. Sie sind wohl ein ziemlich misstrauischer Bursche, wie?“
„Ich bin nur vorsichtig“, erwiderte Catlin. „Das hat mir schon öfters aus brenzligen Situationen geholfen.“ Er blickte kurz hinter sich, wo er seine Decken ausgebreitet hatte. „Steigen Sie ab und machen Sie es sich bequem, wenn Sie wollen.“
Anderson schüttelte kurz den Kopf. „Da wüsste ich schon was Besseres“, sagte er. „Wenn Ihr Pferd noch fünf Meilen schafft, dann bekommen Sie eine warme Mahlzeit und dazu noch ein sicheres Quartier für die Nacht. Was halten Sie davon, Catlin?“
„Eine ganze Menge“, erwiderte dieser. „Also gibt es doch noch andere Weiße hier?“
„Wie man’s nimmt“, antwortete Anderson mit einem Achselzucken. „Wir reiten zur Ranch von John Ward. Sie liegt ganz in der Nähe des Apache Passes.“
Catlin, der währenddessen schon seinen Sattel genommen und ihn dem Morgan-Hengst aufgelegt hatte, hielt unwillkürlich inne, als er das hörte.
„Ich weiß, was Sie jetzt sagen wollen“, kam ihm der Scout zuvor. „Das ist wirklich verdammt nahe bei den Apachen, aber Ward hat man bis jetzt kein Haar gekrümmt. Liegt wohl daran, dass seine Frau Jesusa einen Bastard von einem Apachen bekommen hat. Der lebt bei ihnen auf der Ranch, und deswegen sind sie alle noch am Leben. Weil die Roten den jungen Felix wohl als einen der ihren ansehen. Na ja, davon kann man halten, was man will. Ich für meinen Teil sehe die Apachen lieber aus großer Entfernung. Auch wenn ich schon fast ein Jahr für die Armee arbeite, so fühle ich noch immer die Gänsehaut, wenn ich Apachen aufspüre.“
Er wartete geduldig ab, bis Catlin den Sattelgurt festgezurrt und seine wenigen Habseligkeiten in einer Deckenrolle verstaut und dann festgebunden hatte. Dann saß Catlin auf und nickte Anderson zu. Gemeinsam ritten die beiden Männer nach Westen, während die Sonne als glühender Feuerball am Horizont unterging.
* * *
„Comanchen, das sind verdammt gefährliche Halunken“, meinte Anderson, als er von Catlin erfuhr, dass drüben in Texas die Menschen in Angst und Schrecken lebten. „Aber sie sind nichts gegen diese Apachenhunde, Mann. Richtig blutrünstige Kerle sind das, ich traue ihnen nicht über den Weg. Selbst, wenn es heißt, dass dieser Cochise mit den Leuten von der Butterfield Overland Line ein Friedensabkommen geschlossen hat.“
In kurzen Sätzen berichtete er Catlin, dass die Postkutschenlinie entlang ihrer Route durch das Arizona-Territorium Stationen errichten ließ. Sogar in der Nähe des Apache Pass, der direkt ins Land der Chiricahua führte. Und das nur, weil Cochise es duldete.
„Dieser James Wallace muss lebensmüde sein“, meinte Bill Anderson und spuckte einen Strahl braunen Tabaksaft aus. „Ich für meinen Teil halte es für verdammt riskant, eine Station direkt vor der Nase der Chiricahua zu bauen. Schließlich sind nicht alle so zahm wie dieser Cochise. Wenn ich da nur an den wilden Geronimo denke, dann wird mir übel.“
Selbst Catlin kannte den Namen dieses furchtlosen Kriegers, der schon einmal einen Krieg mit den Weißen begonnen hatte und jetzt nur durch das diplomatische Verhalten Cochises Frieden hielt. Aber ob dies eine dauerhafte Sache war, das konnte zu diesem Zeitpunkt niemand mit Sicherheit sagen.
„Sehen Sie, da wären wir schon!“, rief Bill Anderson auf einmal und zeigte auf eine Stelle weiter unterhalb der Anhöhe, die er und Catlin jetzt erreicht hatten. „Da liegt John Wards Ranch!“
Catlins Blicke folgten Andersons Hinweis. Mit gemischten Gefühlen ließ er seine Blicke über das recht heruntergekommene Anwesen schweifen. Das eigentliche Ranchhaus hatte längst einen neuen Anstrich nötig, und der dicht danebenstehende Schuppen sah so aus, als würde er schon beim nächsten Sandsturm zusammenfallen wie ein Kartenhaus. Nicht gerade ein idyllisches Zuhause für eine Frau und einen kleinen Jungen, dachte Catlin, als er an Andersons Seite auf die Ranch zuritt.
Die Ankunft der beiden Reiter schien man auf der Ranch offensichtlich schon bemerkt zu haben. Denn noch bevor Catlin und der Armeescout ihre Pferde unweit des Hauses zügelten, öffnete sich die Tür und ein hagerer, blassgesichtiger Mann mit einem verwaschenen Hemd trat heraus. In der Hand hielt er eine großkalibrige Sharpsflinte, mit der er auf die beiden Reiter zielte.
„Das ist weit genug!“, rief er mit lauter und schriller Stimme. „Was habt ihr auf meiner Ranch verloren?“
„Verdammt, Ward, nun nimm endlich die Flinte runter!“, rief ihm Anderson zu. „Oder bist du so kurzsichtig, dass du nicht mehr erkennst, wen du vor dir hast?“
„Bill Anderson?“, kam es jetzt zögernd von dem hageren Ward zurück. Er musste blinzeln, weil er genau in die untergehende Sonne blickte. „Bist du das, du alter Hundesohn? Wer zum Teufel ist der Kerl neben dir?“
Das war alles andere als eine freundliche Begrüßung, dachte Catlin. Am liebsten wäre er doch draußen bei den Felsen geblieben und hätte dort eine zwar unbequeme, dafür aber umso ruhigere Nacht verbracht. Höflichkeit Fremden gegenüber schien dieser Ward jedenfalls nicht zu kennen.
„Das ist Roy Catlin, Ward!“, erwiderte nun Bill Anderson an Catlins Stelle. „Wir beide sind auf dem Weg nach Fort Buchanan und dachten, dass du vielleicht für uns noch ein Plätzchen zum Schlafen übrig hast.“
Was John Ward daraufhin erwiderte, konnten weder Catlin noch Anderson genau hören. Aber er nickte schließlich, ließ den Lauf der Flinte sinken und deutete den beiden Reitern an, abzusteigen.
„Ward ist ein bisschen mürrisch, weil es hier draußen ziemlich einsam ist“, meinte Anderson. „Aber ansonsten kann man mit ihm auskommen.“
Eigentlich wollte Anderson noch mehr sagen, brach dann aber mitten im Satz ab, als er einen kleinen Jungen aus der Scheune kommen sah, der zwei Eimer trug, deren Gewicht ihm offensichtlich sehr zu schaffen machte. John Ward sah das auch, und seine blassgesichtigen Züge verwandelten sich plötzlich in eine Grimasse des Zorns.
„Nun beeil dich endlich, Felix!“, herrschte er den Jungen an, sodass dieser zusammenzuckte und noch unsicherer wurde. „Deine Mutter wartet schon auf die Milch!“
Der Junge, dessen Haut einen bronzefarbenen Ton hatte, nickte nur heftig und beeilte sich jetzt. Allerdings achtete er in diesem Augenblick nicht auf eine unebene Stelle direkt vor seinen Füßen. So kam es, wie es kommen musste. Er geriet ins Stolpern, und einer der beiden Milcheimer entglitt seinen Fingern. Mit einem scheppernden Geräusch fiel der Eimer zu Boden, und Sekundenbruchteile später entleerte sich sein kostbarer Inhalt im Sandboden.
„Also, das ist doch ...“, keuchte Ward, als er sah, was gerade geschehen war. Sofort eilte er auf den Jungen zu, der sich gerade hochrappeln wollte, und packte ihn am Kragen des schmutzigen Hemdes. „Du gottverdammter Idiot!“, schrie er ihn an und verabreichte ihm dann zwei schallende Ohrfeigen. „Dich werde ich lehren, die kostbare Milch einfach zu verschütten! Kannst du denn nicht aufpassen, du Apachenbastard?“
Er ignorierte den Schmerzensschrei des Jungen und ohrfeigte ihn stattdessen gleich noch einmal. Roy Catlin sah das und wollte schon eingreifen. Denn er konnte natürlich nicht zusehen, wie dieser Kerl den kleinen Jungen einfach schlug.
Aber noch bevor er etwas unternehmen konnte, tauchte plötzlich eine Frau in der Haustür auf, die Wards Wutausbruch natürlich mitbekommen hatte. Sie eilte auf Ward zu und riss dessen Arm zur Seite.
Das geschah alles so plötzlich, dass John Ward selbst überrascht wurde. Der kleine Felix nutzte den Moment und eilte zu seiner Mutter, um bei ihr Schutz zu suchen. Ängstlich und zornig zugleich blickte er zu dem Mann, der ihn geschlagen hatte, während ihm dicke Tränen die Wangen herunterliefen. Seine Mutter, eine verhärmt wirkende Mexikanerin, redete jetzt heftig auf Ward ein. Es schien sie nicht zu kümmern, dass Catlin und Bill Anderson nun Zeugen dieser Auseinandersetzung wurden.
Ward dagegen war das umso peinlicher. Er stieß nur einen Fluch aus und winkte heftig ab, während die Frau und der Junge ins Haus gingen. Erst dann wandte er sich wieder den beiden Männern zu.
„Man hat’s nicht leicht, wenn man sich um einen Bastard kümmern muss“, sagte er zu Anderson, als wolle er sich dafür entschuldigen, was er gerade getan hatte. „Der Kerl wird mit jedem Tag frecher und verstockter. Da ist ab und zu mal eine harte Hand nötig. Denn der Junge muss so früh wie möglich lernen, wer hier das Sagen hat. Aber er hat wildes Blut in sich, schlechtes Blut.“
Er spuckte verächtlich aus. Damit schien für ihn die Sache wohl erledigt zu sein. Er nickte Catlin und Anderson zu, ihm in den Stall zu folgen.
„Bringt eure Pferde in die beiden letzten Boxen“, forderte er sie auf. „Wenn ihr die Tiere versorgt habt, könnt ihr ins Haus kommen. Jesusa hat ein gutes Stew gekocht. Das reicht für uns alle.“
Er wandte sich ab und ging mit schlurfenden Schritten hinüber zum Ranchhaus, öffnete die Tür und schlug sie ziemlich laut hinter sich zu. Wenige Augenblicke später hörten Catlin und Anderson hitzige Stimmen. Der Streit war offensichtlich bereits wieder im Gange. Anderson bemerkte den Blick Catlins, dem nicht gleichgültig war, wie John Ward seine Familie behandelte.
„Das geht uns beide nichts an“, sagte er dann knapp. „Vergessen Sie, was gerade geschehen ist, Catlin.“
„Das ist leichter gesagt als getan“, erwiderte dieser daraufhin, während er seinen Hengst in der Box absattelte und ihn dann mit einer Handvoll Stroh abrieb. „Es war keine gute Idee, hierherzukommen.“
Er konnte zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht wissen, dass sich dies auf tragische Weise bewahrheiten sollte.
* * *
Sie kamen lautlos in der Nacht. Geschmeidige untersetzte Gestalten, deren blauschwarze Haare im lauen Nachtwind wehten, als sie ihre Pferde über die Hügel trieben. Unweit der Stelle, wo sich John Wards Ranch befand, zügelten sie ihre Pferde und ließen einen Krieger bei den Tieren zurück, während die fünf anderen geduckt durch das verdorrte Gras schlichen. Ihr Ziel war die Ranch des weißen Mannes und der Junge, der dort lebte.
Der kräftige Anführer des Kriegertrupps konnte es gar nicht erwarten, das zu tun, was er schon längst hätte tun sollen. Der Junge trug sein Blut in sich, war zur Hälfte ein Pinal-Apache. Und jetzt verlangte die Stimme des Blutes, dass der Junge zu seinem Stamm kam, und zu seinem Vater Santiago!
Es war eine Nacht, wo der Mond von Wolken verhüllt war und erst in einigen Tagen wieder zu sehen sein würde. Leise huschten die Krieger durch die Nacht, schlichen sich an den Stall heran, wo sich die Pferde befanden. Drei der Krieger öffneten das Stalltor und waren schon wenige Sekunden später im Dunkel verschwunden, und dabei verursachten sie nicht ein einziges Geräusch.
Die beiden anderen Krieger warteten auf das Zeichen ihrer Gefährten, bevor auch sie zuschlugen. Und dieses Zeichen kam bereits wenige Minuten später.
* * *
Roy Catlin schlief unruhig in dieser Nacht. Er wälzte sich wiederholt auf dem Strohlager im Stall hin und her, bis er schließlich die Augen öffnete. Nur wenige Schritte entfernt von ihm vernahm er das leise, aber gleichmäßige Schnarchen von Bill Anderson. Der Scout schlief tief und fest, und Catlin beneidete ihn fast dafür.
Er setzte sich auf und lauschte in die Nacht, denn er glaubte, gerade etwas gehört zu haben: Ein leises Geräusch, das sich dem Stall näherte. Im ersten Moment dachte er, dass er sich getäuscht hatte, doch dann hörte er es schon wieder. Es waren leise, fast katzenhafte Schritte, und schon wenige Sekunden darauf bemerkte Catlin, wie sich irgendjemand vorn an der Stalltür zu schaffen machte. Sofort stieß er den schnarchenden Anderson an und riss ihn deshalb ziemlich unsanft aus dem Schlaf.
„Was zum Teufel ...“, entfuhr es dem Armeescout in ziemlich mürrischem Ton, bevor ihn Catlin noch daran hindern konnte.
„Still“, raunte ihm Catlin zu, während er selbst seine Waffe aus dem Holster zog. „Ich glaube, wir kriegen Besuch.“
Nun hatte auch Anderson begriffen, was ihm Catlin klarmachen wollte. Der letzte Rest der Müdigkeit verflog, und auch Anderson hatte nun seine Waffe griffbereit. Die beiden Männer schliefen ganz hinten im Stall, wo sich auch das Stroh für die Pferde befand. Genau dort hatten sie ihre Decken ausgebreitet und hörten jetzt außer dem unruhigen Schnauben der Tiere auch noch etwas anderes. Schritte von Menschen!
Im selben Moment bemerkte er plötzlich eine hastige Bewegung in unmittelbarer Nähe. Von einem unguten Gefühl getrieben, riss er seine Waffe hoch. Aber genau in diesem Moment sprang ihn plötzlich jemand an und riss ihn zu Boden. Catlin roch die Wildheit, die von ihm ausging, und sah die schemenhaften Konturen seines Feindes im Halbdunkel, das in der Scheune herrschte.
„Apachen!“, hörte er Andersons krächzende Stimme, der Sekunden später auch schon von einem zweiten Gegner angegriffen und zu Boden gerissen wurde. Catlin konnte nicht mehr erkennen, was jetzt geschah, denn er hatte alle Hände voll zu tun, um sich selbst zu wehren.
Der Apache, mit dem er es zu tun hatte, war ein Mann, der Bärenkräfte besaß. Die Hand des Kriegers umschloss die Revolverhand Catlins, versuchte, ihm die Waffe zu entreißen, während er gleichzeitig mit der anderen Hand nach Catlin stieß. Er fühlte, wie etwas Scharfes seine linke Schulter traf und dort einen brennenden Schmerz auslöste.
Gleichzeitig gelang es Catlin, den Abzug seines Revolvers zu betätigen. Der Schuss bellte im Dunkel des Stalls hart und trocken auf. Catlin hörte, wie sein Gegner plötzlich zusammenzuckte und leise aufstöhnte. Er nutzte diesen Moment, um sofort nachzusetzen.
Aber genau jetzt fiel ihn ein zweiter Apache von hinten an und versetzte ihm einen Hieb mit der Faust, der Catlin zur Seite taumeln ließ. Er prallte mit dem Kopf gegen einen der Holzpfosten des Stalls und sank dann benommen zu Boden.
Wie aus ganz weiter Ferne hörte er drüben beim Ranchhaus plötzlich die schrille Stimme der Mexikanerin. Eine Stimme voller Furcht und Hilflosigkeit!
Catlin versuchte, sich aufzurappeln, schaffte das aber nicht, weil in seinem Schädel ein Heer kleiner Teufel gerade einen Höllentanz veranstaltete. Er sah undeutlich, wie jemand hastig davonrannte. Sekunden später fielen draußen zwei Schüsse. Pferde wieherten laut auf, und Catlin wusste, dass er jetzt gleich seinen Morgan-Hengst verlieren würde, wenn er nichts unternahm.
Auch wenn die farbigen Schleier vor seinen Augen viel zu langsam wichen, so schaffte er es dennoch, sich aufzurappeln. Die Waffe, die er im Kampf gegen den Apachen hatte fallen lassen, lag zum Glück nur wenige Inches von ihm entfernt. Er nahm sie hastig an sich und stolperte dann hinaus aus dem Stall.
Er sah, wie zwei der Krieger die Pferde der Butterfield Overland Line bereits aus dem Corral geholt hatten, während ein anderer Apache den kleinen Felix vor sich aufs Pferd zerrte. Diese Schweinehunde waren ins Haus eingedrungen und hatten ihn geraubt. Der Himmel mochte wissen, was sie mit Ward angestellt hatten, denn drüben vom Ranchhaus her vernahm Catlin nur die Hilferufe der Frau.
Die Krieger hatten offensichtlich nicht mehr damit gerechnet, dass einer der beiden Weißen aus dem Stall noch Gegenwehr leistete. Deshalb kam Catlins Eingreifen jetzt völlig überraschend für sie.
Er zielte mit seiner Waffe auf den Apachen, der den Morgan-Hengst und das Pferd Andersons aus dem Stall geholt hatte. Allerdings war Catlin in diesen Sekunden immer noch so geschwächt, dass er den Gegner nicht tödlich traf.
Als der Schuss aufbellte, erwischte seine Kugel den Apachen nicht voll, sondern verwundete ihn nur leicht an der Schulter. Der Krieger schrie erschrocken auf, als ihm klar wurde, dass der Weiße doch zäher war, als er ursprünglich angenommen hatte.
Das war der Moment, wo nun auch drüben vom Ranchhaus her ein Schuss fiel. Catlin hörte John Wards fluchende Stimme und wusste, dass nun auch er in den Kampf eingreifen wollte. Allerdings konnte er nicht mehr verhindern, dass die Apachen einen großen Teil der Butterfield-Pferde bereits an sich gerissen hatten. Ganz zu schweigen von dem Jungen, den sie in einer geradezu todesmutigen Aktion plötzlich aus dem Haus und praktisch vor den Augen seiner Mutter entführt hatten.
Damit schienen sie wohl all das erreicht zu haben, was sie ursprünglich beabsichtigt hatten. Denn jetzt ritten sie fast fluchtartig davon, trieben die gestohlenen Pferde vor sich her und wirbelten solch eine Staubwolke auf, dass Catlins weitere Schüsse ihr Ziel nicht mehr fanden. Er fluchte, weil er die Entführung des Jungen nicht mehr hatte verhindern können. Zwar war es ihm gelungen, seinen Hengst und das Tier Andersons aus den Händen der Gegner zu entreißen. Aber was hatte das schon zu bedeuten?
„Verdammt!“, hörte er hinter sich die zornige Stimme Andersons, der jetzt aus der Scheune hinkte und sich das linke Bein hielt, wo ihn offensichtlich ein Messerstich getroffen hatte. „Diese elenden Bastarde!“
„Sie haben den Jungen“, sagte Catlin zu dem Scout, als dieser neben ihm stand und nun auch sah, dass die Gegner alle Pferde bis auf zwei im Corral gestohlen und fortgetrieben hatten. Der Hufschlag der davon preschenden Apachenpferde war nur noch ganz leise zu hören und verhallte schließlich Sekunden später in der Nacht.
Catlin hörte das laute Schluchzen der Frau und war wütend auf sich selbst, weil er die Entführung gerne verhindert hätte. Aber die Gegner hatten ihn so geschickt ausgetrickst, dass er praktisch überrumpelt worden war. Genau wie Anderson.
John Ward kam jetzt ebenfalls mit dem Gewehr in der Hand aus dem Haus gestürmt und ignorierte das laute Schluchzen der Frau an der Haustür. Stattdessen galt sein ganzes Interesse dem Corral, in dem nur noch zwei Pferde standen.
„Mein Gott!“, entfuhr es ihm, als er erkannte, dass der größte Teil der Tiere von den Apachen weggetrieben worden war. „Jetzt bin ich ruiniert!“
Jesusa Martinez trat einen Schritt auf John Ward zu, suchte Schutz und Trost bei ihm, aber der blassgesichtige Rancher schüttelte die Frau ab, als sei sie ihm jetzt lästig geworden.
„Halt den Mund, Jesusa!“, fuhr er sie mit schneidender Stimme an. „Deinem Bastard habe ich es zu verdanken, dass ich jetzt pleite bin. Die Butterfield Overland Line hat mir viel Geld bezahlt, dass ich zugestimmt habe, hier ihre Pferde unterzubringen. Diese Ranch hier sollte einmal eine Station werden, genau wie die von John Wallace. Und nun? Was soll ich den Leuten sagen, wenn sie kommen und ihre Pferde haben wollen? Sie werden denken, dass ich nicht genügend aufgepasst habe. Verdammt, du sollst endlich still sein, du mexikanische Schlampe!“
Die Frau zuckte zusammen, als habe Ward sie geschlagen, und wandte sich dann hastig ab. Wenige Sekunden später war sie dann auch schon im Haus verschwunden.
„Das ist also der Frieden, den uns dieser Hund Cochise versprochen hat!“, richtete Ward nun das Wort an den Armeescout Anderson. „Wir können von Glück sagen, dass wir überhaupt noch am Leben sind!“
Anderson hatte während des kurzen Streites zwischen Ward und Jesusa Martinez das Messer eines der Krieger am Stalleingang gefunden, das dieser wohl verloren haben musste. Während Ward seine anklagenden Worte an ihn richtete, inspizierte Anderson das Messer und blickte ziemlich nachdenklich drein.
„Das muss nichts mit Cochise und den Chiricahua-Apachen zu tun haben, Ward“, sagte er dann zu dem Rancher. „Auf jeden Fall ist das hier ein Pinal-Messer.“
„Ach, diese Rothäute sind doch alle gleich!“, erwiderte Ward daraufhin verächtlich. „Die stecken doch alle unter einer Decke. Auf jeden Fall bin ich nicht bereit, das hinzunehmen. Ich reite nach Fort Buchanan, und zwar auf der Stelle! Das ist eine Sache, die die Armee was angeht. Ich will meine Pferde wiederhaben, sonst kann ich mir gleich einen Strick nehmen.“
Dass er auf den Halbblutjungen gar nicht zu sprechen kam, zeigte Roy Catlin sehr deutlich, was Ward von Felix hielt. Ihn kümmerte auch nicht der Schmerz der Mutter, denn er dachte nur an seine gestohlenen Pferde und die Probleme, die er deswegen mit der Butterfield Overland Line bekommen würde.
„Jesusa!“, rief er dann zum Haus hinüber. „Pack mir ein paar Sachen zusammen. Ich reite jetzt nach Fort Buchanan. Ich weiß noch nicht, wann ich wieder zurückkomme!“
„Wollen Sie Ihre Frau allein hier zurücklassen, Ward?“, wandte sich Catlin nun an den Rancher. „Schließlich könnten die Apachen wiederkommen.“
„Jesusa hat einen Apachenbastard zur Welt gebracht, Mister“, antwortete Ward schroff. „Das macht sie zu einer von denen. Keine Sorge, ihr wird schon nichts geschehen. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass man sie mitnimmt. Und selbst wenn: Was kümmert es mich?“
So viel Gefühllosigkeit hatte Catlin selten erlebt. Aber solche Menschen wie John Ward gab es, und deren verachtendes Verhalten war für die das Normalste auf der Welt. Roy Catlin fragte sich, wie es die Mexikanerin überhaupt mit ihm so lange ausgehalten hatte.
„Was starren Sie mich so an, Catlin?“, fragte Ward den großen Mann in provozierendem Ton. „Es ist schließlich nicht Ihre Existenz, die auf dem Spiel steht, oder?“
Catlin lag eine heftige Bemerkung auf der Zunge, beschloss dann aber, gar nichts darauf zu erwidern. Denn mit einem Sturkopf wie John Ward konnte man ohnehin kein vernünftiges Wort reden.
„Wir kommen mit, Ward“, sagte Anderson schließlich. „Ich muss dem Colonel das Messer zeigen, das ich gefunden habe. Das wird ihn ganz bestimmt interessieren.“
Eine knappe Viertelstunde später hatten die Männer ihre Pferde gesattelt und waren bereit zum Aufbruch. Die Mexikanerin kam aus dem Haus und warf John Ward einen flehenden Blick zu. Roy Catlin verstand genügend Spanisch, um mitzubekommen, dass Jesusa Martinez den hageren Rancher inständig bat, alles zu tun, damit Felix wieder zu ihr zurückkam.
Je länger Catlin aber darüber nachdachte, umso mehr zweifelte er daran, ob das Ward überhaupt recht war, wenn ihm die Armee einen Halbblutjungen zurückbrachte, für den er dann noch sorgen musste!
Kapitel 2
Die Sonne war schon längst hinter den fernen Hügeln aufgegangen und überzog das karge Land mit ihren wärmenden Strahlen. Der helle Morgentau, der noch auf den Chollakakteen hing, wurde von der Sonne gierig aufgesogen, und es sah danach aus, als ob es auch heute sehr heiß werden würde.
Die Männer hatten einen scharfen Galopp hinter sich, als schließlich am Horizont Fort Buchanan auftauchte. Catlin sah die Mauern des Forts, die ganz aus Sandstein errichtet waren und in der Einsamkeit dieser kargen Landschaft irgendwie verloren wirkten. Es musste eine Hölle für die Soldaten sein, hier ihren Dienst zu verrichten.
Die Soldaten, die oben auf den Mauern standen und von dort das Land bis zum Horizont überblicken konnten, hatten die drei Reiter natürlich schon längst bemerkt. Das schwere Tor wurde für sie geöffnet, und wenige Minuten später hatten die Männer den Innenhof des Forts erreicht.
„Ich will den kommandierenden Offizier sprechen!“, rief John Ward einem Sergeant zu, der auf ihn zukam. „Jetzt sofort, es ist wichtig!“
„Colonel Davis ist seit gestern Nachmittag in Tucson, Mister“, erfuhr Ward dann von dem Sergeant. „Es herrscht Krieg zwischen Nord und Süd, und da ist hier alles ziemlich durcheinandergeraten.“
„Das interessiert mich nicht!“, unterbrach ihn Ward wütend. „Die Apachen haben heute Nacht meine Ranch überfallen und unseren Jungen entführt. Ich verlange, dass die Armee diese roten Bastarde sofort verfolgt. Die Tiere der Butterfield Overland Line haben die Hunde ebenfalls gestohlen!“
Der Sergeant blickte jetzt fassungslos drein. „Kommen Sie mit, Mister“, forderte er dann John Ward auf. „Lieutenant Bascom ist im Moment der kommandierende Offizier hier. Er wird sich sehr dafür interessieren, was Sie ihm zu sagen haben.“
„Das will ich auch hoffen“, brummte Ward missmutig und stieg hastig aus dem Sattel. Er folgte dem Sergeant hinüber zu einem Steinbau, der wohl das Offiziersquartier darstellen sollte. Eine armselige Unterkunft!
„Warten Sie doch, Ward!“, rief ihm Catlin hinterher. „Anderson und ich kommen mit. Schließlich haben wir beide auch was zu der ganzen Sache zu sagen!“