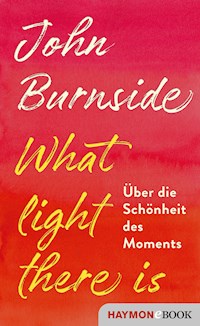
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
JOHN BURNSIDES HYMNE AUF DIE MAGIE DER VERGÄNGLICHKEIT: EINBLICK IN EINEN SCHARFEN GEIST UND EINE EMPFINDSAME SEELE. John Burnside – ein virtuoser Verehrer des Flüchtigen Für eine Sekunde nur ist er da, flackert auf, offenbart und entzieht sich uns wieder: der Augenblick. Er berührt uns in Form einer möglichen, aber nie geliebten Liebe, in der Anmut einer Schneeflocke, die sich sogleich auf unserer Haut in Wasser verwandelt, oder als kostbare Erinnerung gebannt in einer Fotografie. Betörend schön wirkt das Was-gewesen-Wäre auf uns, fesselt uns das Unwiederbringliche und verlockt uns das, was wir nicht festhalten können. "Entscheidend war immer der Moment im Augenblick des Vergehens. Der Moment, der Moment, der Moment – auf nichts sonst kommt es an. Der Moment war vorbei, ehe irgendwer von uns ihn ergreifen konnte, und doch blieb er, während er uns zwischen den Fingern zerrann, lebendig, kaum noch da und zugleich unauslöschlich." Ein betörend schönes Buch über die Faszination des Vergänglichen John Burnside – Autor von Werken wie "In hellen Sommernächten" und "Lügen über meinen Vater" – war einer der bedeutendsten Schriftsteller der europäischen Gegenwartsliteratur. 2019 stand er mit "Über Liebe und Magie" an der Spitze der SPIEGEL Bestseller-Liste und der SWR-Bestenliste. In "What light there is" macht er uns die Magie der Vergänglichkeit begreifbar: Er lässt uns teilhaben an den intensiven Wahrnehmungen seiner Kindheit, führt uns in das Innenleben eines Antarktis-Forschers im Angesicht des Todes und sinniert über das Verschwinden der Stille in unserer rastlosen Zeit. In persönlichen Erinnerungen, Reflexionen und anmutig-sinnlicher Sprache macht uns der Lyriker und Romancier unserer eigenen Endlichkeit bewusst und lädt ein zum Innehalten und Staunen. Eine beglückende Verneigung vor dem Zauber des Moments im Augenblick seines Erlöschens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Noch ein Ortder sein letztes Lichtwie ein Netz auswirftüber nichts
Mark Strand*
Ich wurde in einem Land flinker Ströme und flacher Flüsse geboren: kräftige Wasserbänder, süß und dunkel vom Moor gespeist; quirlige Bäche, die durch Birkenhaine und von Strahlgras und Heide gesäumte Felder plätschern; breite Läufe aus den Bergen, klar wie Fensterglas, die das mittige Tal queren, bis sie auf die Städte treffen, zu seicht und zu alt, um viel Leben zu beherbergen, ganz anders als die betulicheren, nachdenklicheren Ströme inmitten von Hügellandschaften und Wäldern, fruchtbare aibhnichean, die ihre Ladung Schlick und Kraut über fischäugige Kiesel und wassergeglättete Puddingsteine tragen, während sie sich behäbig aufs Meer zuwinden. Als Kind watete ich durch die Rinnsale und schwamm in den Tümpeln rund um unsere sterbende Bergarbeiterstadt, wusste aber, wo sich helles Fließgewässer zu plötzlicher Dunkelheit beschleunigte oder wo irrläufige Unterströmungen durch alte Schwimmlöcher pulsten und die Sorglosen mit sich in wuchtige Fluten rissen oder unter Wasser zogen, bis sie nach Luft japsend wieder auftauchten oder, schlimmer, auf immer in den dunkelsten Läufen von Materie und Zeit verschwanden. Mit zehn Jahren kannte ich alle tiefen Stellen, die weiten Schwarzwasserflächen, die sich unvermutet dort auftaten, wo man am wenigsten mit ihnen rechnete, und denen kaum ein Taucher widerstehen konnte, obwohl es dort vor Schlingen und Fallen wimmelte, verstockt und aussätzig bis in ihre tiefsten Tiefen, voller Verhaue aus verklapptem Draht und obsoleten Maschinen, die unter der Oberfläche dräuten wie die rostigen Stufen geheimer Flusskatakomben. Folglich konnte es kaum überraschen, dass selbst an diesen Orten scheinbar friedlicher, unschuldig wirkender Gewässer Jahr für Jahr eine Handvoll Leichen aus der tückischen Strömung geborgen wurde, Hautsäcke voller Knochen und gelber Körpersäfte, die man auf Friedhöfen zwischen den Hügeln inmitten von Schafen und Krähen zur Ruhe bettete, weit fort von den Geistern, die in Flüssen hausen. Manche der Toten waren Kuhhirten, manche Jungen, für die ein nachmittägliches Abenteuer böse geendet hatte, einige darunter zweifellos auch Selbstmörder. Doch nur wenige dieser ertrunkenen Seelen wurden auf den Friedhöfen begraben, die entlang der Flüsse und Meeresarme liegen, denn diese Begräbnisstätten sind seit Jahrhunderten für jene reserviert, die keine andere Wahl hatten, als es Tag für Tag mit der Unbill der Strömung aufzunehmen, den Fischern, Fährleuten und Lotsen also, denen es das größte Glück bedeutete, in weiß bezogenen Betten und im Blick derer zu sterben, die für sie Engel waren oder die sie doch dafür hielten.
Über ihren fest verankerten Gräbern kippen – der langsamen Tide der Schwerkraft gehorchend – schwere, verwitterte Steinbrocken in wilde Schieflagen; und jeder Stein zeigt einen gemeißelten Kopf, ureigen, weitäugig und entschieden unmenschlich; ich zweifle keinen Moment daran, dass diese Steinmetzarbeiten sowohl für jene, die sie anfertigten, wie auch für ihre christlichen Herren vorwiegend einen wahrhaftigen, von den Heiligen Schriften anerkannten Engel zeigen sollten. Soweit sich jene Handwerker aber noch der Erde verhaftet sahen, soll heißen, soweit sie sich noch als entschiedene Heiden verstanden, blieben diese Figuren namenlos, verweigerten sich jeglicher Beschreibung und waren immun gegen die Schmeicheleien der Gebete. Auch wenn sie nur monochrome, in Stein gemeißelte Reliefs sind, verkörperten sie für die ursprünglichen Bewohner dieser Landstriche doch etwas Wildes, Elementares; zugleich ungezügelt, aber auch im tiefen Brunnen der nobilissima viriditas verankert, im vornehmsten Grün, und nur so weit personifiziert, dass man sie sich vorzustellen vermochte, dabei versinnbildlichten sie in Wahrheit jene göttlichen Ereignisse – Verben, keine Substantive; Prozesse, keine Figuren –, die den grundlegendsten aller Wechsel bewirken, den vom Tod zum Leben und vom Leben zum Tod, sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum (wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit).
Über diese heiligen Orte, ob in Fife oder Perthshire, spannt sich nichts als der weite Himmel, eine riesige Kuppel, auf der sich die sichtbaren Sterne zu Konstellationen ordnen, tierischen, menschlichen und mythischen; dabei sind dies keine fixen Konfigurationen, keine Gegebenheiten wie Ebbe und Flut, die Jahreszeiten oder der Chor zur Morgendämmerung; die Fantasie hat sie ins Leben gerufen, will sagen, sie wurden entdeckt – und während manche in jenem Sternbild, das wir heute Löwe nennen, eben einen Löwen ausmachten, sahen andere, die vor langer Zeit hier lebten, darin einen Hund und nannten die Anordnung folglich – Cú – gleich dem Hund, der in den alten Geschichten vom jungen Cúchulainn erschlagen wurde (wie auch der Löwe in den griechischen Mythen von Herakles erschlagen wird). Gewiss war dies einer der Anfänge der Kunstfertigkeit in unseren Landstrichen, die Klassifizierung der Tagengel und des nächtlichen Himmels, das Deuten der Flusswinde und das Hineinlesen von Schwanenleibern und Bogenschützen in hohe Sternenwirbel, von Figuren, die es vorher nicht gegeben hatte und die nur auf ihre Entdeckung gewartet hatten. Von da war es bloß noch ein kleiner Schritt, überall Ord-nung auszumachen, so dass wir angesichts welcher Mysterien auch immer, das, was uns fehlte, aus luftigem Nichts heraufbeschwören konnten. Zum Beispiel die heidnischen Engel: Sind das kreatürliche Geister, die mit dem Wind heranwehen, um die Toten in jene Zeit zu begleiten, die da kommen wird? Oder sollen sie über etwas wachen, das man den Lebenden besser nicht vollends offenbart? Denn in aller Fairness: Wir dürfen uns vom Gemeißelten nicht täuschen lassen, zumindest nicht hinsichtlich dessen, was es besagen soll. Jene, die diese ernst blickenden, abweisenden Gesichter in den Stein schlugen, hätten ebenso vertraute, körperliche Begleiter ins Jenseits schaffen können (zu jung gestorbene Schwestern, verwandelt in freundliche Heilige; ein Lieblingsonkel, der für diesen einen Tag zurückkehrt, um sich jener Verblichenen anzunehmen, denen wir verziehen haben). Aus irgendwelchen Gründen aber entschieden sich meine heidnischen Vorfahren gewissenhaft und immer wieder für diese windgeformten Geister, fast, als hätten sie Prosperos Worte an Ariel im fünften Akt von Der Sturm vorhergeahnt:
Auch meines soll’s.
Hast du, der Luft nur ist, Gefühl und Regung
Von ihrer Not? und sollte nicht ich selbst,
Ein Wesen ihrer Art, gleich scharf empfindend,
Leidend wie sie, mich milder rühren lassen?1
Natürlich ist es angebracht, uns unsere Stellvertreter nicht allzu liebenswert zu denken, denn die Zeit, die da kommen mag, wird, was immer sonst, keine Zeit des Trostes und der Ruhe sein, sondern eine schwierige Zeremonie des Übergangs. Ebenso wahr ist, dass die christlichen Herren, die den Ureinwohnern ihr Land stahlen, alsbald Systeme der Rechtsprechung und brutaler Vergeltung schufen, die dem heidnischen Denken zuwider gewesen sein müssen, Systeme, die man, kaum war die Orthodoxie mit dem Gift des Presbyterianismus injiziert – was für diesen Teil des Landes allgemein zutraf –, rücksichtslos auf dem Fels von Vorherbestimmung und Hierarchie errichtete. Es hatte den Anschein, als hätte dieser neue, monotheistische Gott, oberster Würfelspieler, der er war, von Anfang an entschieden, wer gerettet und wer der ewigen Hölle überantwortet werden sollte – nichts ließ sich daran ändern. Göttliche Vorherbestimmung. Was für ein elendes Konzept für dieses Land, in dem die alten heidnischen Geister gerechter vom barmherzigeren System der Unvermeidlichkeit regiert worden waren. Heute, hoffnungslos vernebelt vom Gewäsch der unheiligen Schrift, vermögen wir zwischen beiden kaum mehr zu unterscheiden – und doch liegen sie so weit auseinander, wie es weiter kaum ginge. Einst, da wir alle unserer wahren Natur folgten, stand es uns frei, das zu werden, was unweigerlich aus uns wurde; nachdem jedoch die christlichen Herren über uns gekommen waren, sahen wir uns verdammt, das zu werden, was wir immer, schon vor unserer Geburt, gewesen sind.
Ich habe an verschiedenen Orten gelebt, wollte nie mehr als nur einige zarte Wurzeln schlagen, und an den meisten Orten habe ich mich durchaus wohl gefühlt – kam vielmehr solcherart mit meinen Nachbarn aus, dass sie mir nicht über die Maßen präsent schienen, während ich es mich angelegen sein ließ, jenes einstige wie künftige Land zu bewohnen, das ich mit ihnen teilen musste. Ich weiß, wenn ich dies so formuliere, riskiere ich, wie ein Misanthrop zu klingen (was ich, im üblichen Wortsinne, glaube ich, nicht bin), doch wird mir jeder honorige Beobachter gewiss darin beipflichten, dass einzelne Exemplare der Spezies Mensch zu wahrhaft wundersamen Dingen fähig sind, sie als Ganzes aber beileibe keinen segensvollen Einfluss auf die Umwelt ausübt, sei es in kleineren wie in größeren Zusammenhängen. Ein Beispiel: An einem meiner Wohnorte (einem kleinen Fischerdorf am Firth of Forth) pflegten meine Nachbarn, die roten Ziegelmauern ihrer Räucherkammern und Ställe mit einer dicken Schicht schwarzem Teer zu übertünchen. Anfangs glaubte ich, sie wollten auf diese Weise den Stein vor den harschen Salzwinden schützen, die vom Meer heranwehten; erst viel später erfuhr ich, dass sie das warme, sinnliche Rot der Ziegel verdecken wollten, ein derart wohltuendes, lebensbejahendes Rot, dass einige Gemeindemitglieder in früherer Zeit es für unziemlich hielten – damals, in jener guten alten christlichen Ära, in der man Gemeinderäte allein wegen ihrer schieren Freudlosigkeit wählte. Diese Überreste des Puritanismus sind nur schwer zu ertragen, weit schlimmer noch ist aber die lächerliche Vorstellung von Glück – ob in diesem oder im nächsten Leben –, die diese Subspezies christlicher, in dieser Landesgegend so prächtig gedeihenden Glaubensrichtung zu bieten hat. Allen Vergnügungen im Leben abzuschwören, sogar auf Grundlegendes wie Farben und Wärme zu verzichten, und dies allein im Austausch für die vage Hoffnung auf ein Jenseits, das nichts so sehr wie dem Wartezimmer eines Zahnarztes gleicht, mag zugleich abstoßend im Geiste und auf schillernde Weise pervers wirken; darauf aber zu beharren, dass der Morgenchor der Vögel oder die Stille im Wald nach frischem Schneefall nichts weiter als eine Ablenkung vom Göttlichen seien (ein Schleier gleichsam, mit dem Gott höchstselbst die wesentliche Tatsache seiner so separaten wie insgesamt abstrakten Heiligkeit verbirgt), ist für mich ein hanebüchenes Beispiel für die Glorifizierung von Engherzigkeit und Beschränktheit.
Nicht, dass meine Nachbarn in dem kleinen Küstendorf zu jener Zeit, in der ich dort wohnte, besonders religiös gewesen wären, ganz im Gegenteil, denn obwohl sie sich jeden Sonntag beflissentlich in ihren Kirchen versammelten, war die Raffgier ihrer Habsucht in der restlichen Woche wahrhaft erstaunlich, nicht zuletzt, weil es in vielen Fällen nur um Unbedeutendes ging. Engherzigkeit war in dieser Gemeinde eine Lebensart, Heuchelei eine von allen praktizierte, aber nur von wenigen zur Vollendung gebrachte Kunst – und diese wenigen wurden dafür mit den erbärmlichsten Ehren bedacht. Gemeinderat. Bürgermeister. Vorstandsmitglied im örtlichen Entwicklungsfonds. Hatten sie ihre Posten aber erst einmal inne, wurde rasch deutlich, dass sie es für ihr unausgesprochenes Recht hielten, alles, was sie an Fördergeldern auftreiben konnten, für ihre kleinen Lieblingsprojekte abzuzweigen, falls es nicht direkt auf die eigenen Sparkonten floss. Unnötig zu erwähnen, dass es für Gott in ihren Geschäften keinen Platz gab, und dass sie den Jesus, der die Geldverleiher aus dem Tempel trieb, längst vergessen hatten, obwohl sie entschieden die alten, freudlosen Gewohnheiten des unnachgiebigen Calvinismus pflegten; und Freunde, die in jener Gegend geblieben sind, haben mir versichert, dass die Verkaufszahlen für Bitumen bis auf den heutigen Tag recht beachtlich sind.
Als ich mein Haus an der Küste bezog, hatte ich längst meine mir im Unterricht eingebläute, sepiagetönte Vision von hienieden aufgegeben. Eigentlich war ich schon im dritten Jahr Religionsunterricht zu dem keineswegs überraschenden Schluss gekommen, dass es sich bei Religion dieses Schlags um eine Art Psychose handelte, war doch leicht nachzuvollziehen, warum eine auf unverrückbare Macht in der vergänglichen Welt basierende Gesellschaft einen Himmel erfand, der aus einer bloßen Verlängerung dieser Macht im Jenseits bestand. Natürlich konnte es da auch nicht überraschen, dass eine autokratische Religion auf ein persönliches Weiterleben nach dem Tod beharrt, wohingegen egalitärere, polytheistische Glaubenssysteme von einer allumfassenden Lebensenergie ausgehen, die im Kreislauf bleibt, um in einer Vielfalt von Formen und Gestalten stetig wiederzukehren. Wirklich bizarr aber finde ich, wie offenkundig unattraktiv der monotheistische Himmel trotz Gottes vermeintlicher ›Gegenwart‹ ist.
Dennoch bringt es wenig, die heidnische Welt heute zu loben, so lange, nachdem sie tief unter einem Berg von Hokuspokus und geistlosen Schmeicheleien begraben wurde (auch wenn ich mir wünschte, wir hätten einige wenige ihrer umweltfreundlichen Konzepte beibehalten; schließlich kann wohl niemand leugnen, dass der Heilige Hain für unsere Atmosphäre weit besser war als eine altmodische viktorianische Kirche mit maroden Sanitäranlagen). Wir können nicht zurück, weder in die heidnische noch in sonst irgendeine andere frühere Welt; die Vergangenheit ist vorbei. Trotzdem mag es nützlich sein, darauf hinzuweisen, dass eine westliche Welt – statt in ihrem kolonialen Amoklauf jede Kultur zu bekehren, wie es das Christentum tat, oder in geradezu kindischer Manier ganze Wälder und Ozeane zu vernichten, wie es der Mammon macht – dass also eine westliche Welt, die ein wenig heidnischer geblieben wäre, ein Ort sein könnte, an dem es sich besser leben ließe – und die einen auf den Tod in der klassischen Manier der Ars Moriendi vorbereitete, einer Kunst, die meine kleine Meditation nachzuahmen strebt. Sich nicht mit Versprechungen auf Unsterblichkeit darauf vorzubereiten, auch nicht mit Glanz und Gloria aufgeblasener Wichtigtuer, sondern so, wie Walt Whitman es beschrieb:
Nun zu dir, Tod, und dir,
bittere Umarmung der Sterblichkeit,
es ist müßig zu versuchen,
mich in Angst zu versetzen.
Zu seinem Werk schreitet der
Geburtshelfer ohne Wimpernzucken,
Ich sehe die Ältestenhand drücken
empfangen stützen,
Ich ruhe an den Schwellen
wunderbarer elastischer Türen
Und achte auf den Auslass,
achte auf Erleichterung und Entweichen.
Nun zu dir, Leichnam, ich denke,
du bist guter Dünger,
aber das beleidigt mich nicht,
Ich rieche die weißen Rosen,
süßduftend und wachsend …2
Der Jakscha fragte: »Wer begleitet den Menschen in den Tod?« Judhischthira antwortete: »Dharma allein begleitet die Seele auf ihrer einsamen Reise nach dem Tod.«
Mahabharata
Ich erinnere mich an die Verblüffung, die ich empfand, als ich zum ersten Mal miterlebte, wie jemand starb. Der Mann lag vor The Maple Leaf, einem Pub, auf dem Boden, Blut strömte aus einer Wunde am Hals: Jemand hatte ihm im verregneten Schatten aufgelauert und ihn erstochen, kurz zuvor, eine Minute oder so, ehe ich am Ende eines alkoholschweren, leicht desperaten Abends durch die Tür nach draußen taumelte; und jetzt, während wir – zwei, drei (einander Fremde) – uns über ihn beugten und ihm neugierig ins Gesicht starrten, starb er auf eine Weise, die geradezu willentlich falsch wirkte. Tausendmal hatte ich in Filmen den geschauspielerten Tod gesehen, Tode der traditionellen Kriegsschreie gellenden und vom Pferd stürzenden Indianer, um gar nicht erst von den Toden der erotisierten Art zu reden, wenn etwa die doch eher züchtige fotogene Blondine anmutig zu Boden sinkt während der Killer ihren hübschen schlanken Hals loslässt oder auch die angeblich realistischeren, im Grunde aber nur sensationslüsternen Tode der 1970er-Welle, die uns fotogene Leute in Zeitlupe zeigte, wie sie à la Bonnie and Clyde in tausend Stücke zerschossen wurden; das hier dagegen passte so überhaupt nicht zu dem solcherart überlieferten Wissen. Seither habe ich weitere Tode gesehen (am stärksten betroffen machte mich jener nach einem tödlichen Autounglück auf einer einspurigen Brücke im ländlichen Northamptonshire, bei dem ein junger Mann ins Grau glitt, während ich mich fragte, was ich ihm sagen oder wie ich ihm Trost spenden konnte) und begriffen, dass die meisten Tode, selbst die infolge von Gewalteinwirkung, weniger dramatisch, weniger markant, gleichsam weniger eindeutig ereignisreich sind als jene, die auf der großen Leinwand gezeigt werden. Was ich bislang darüber weiß, legt eher nahe, dass das Sterben meist unbedeutender vonstattengeht, als ich angenommen habe, ein Übergang vom Jetzt zum Gleich, das Treppenfenster offen, irgendwer im Park ruft nach einem Kind, einem Hund, am Haupttor der Ahorn buttriggelb, ein Hartriegel riskiert eine Rotvariante, an die niemand denkt, während ein Leben in die Herbstluft versickert, in den Meereswind, den Regenschauer und zugleich ins gewöhnliche Tagesgeschehen, ein kleines Drama, das seinen Lauf nimmt, »indessen irgendwower am Futtern ist oder öffnet grad wo ein Fenster oder schlendert gelangweilt wohin«3, wie W. H. Auden es lakonisch formulierte.
Allerdings rede ich hier vom Tod und nicht vom Sterben. Bei dem Tod geht es um einen spezifischen Augenblick in der Zeit; er ist, was andere von außen sehen, so wie Trunkenheit die unschöne, äußerliche Manifestation eines Zustandes ist, den der Trunkene selbst als zutiefst ekstatisch erfahren mag, gar als dionysische Vereinigung mit dem Kosmos. Als Außenstehende begannen, die Wirkungen von Peyote auf die Teilnehmer heiliger Riten zu beobachten, notierten sie sichtbare Anzeichen körperlichen Unbehagens wie einen trockenen Mund, Hautrötungen und Erbrechen. Was sie nicht sahen, war, was im Kopf der Teilnehmer vorging, die Veränderungen, die diese ›Droge‹ in ihnen auslöste. Um das zu erfahren, musste man sie selbst nehmen, worüber Aldous Huxley schrieb: »Der Mann, der durch die Tür in der Wand zurückkehrt, wird nie wieder ganz derselbe Mann sein, der hinausgegangen ist. Er wird klüger sein, unsicherer, glücklicher, doch weniger selbstzufrieden, bescheidener im Eingeständnis seiner Ignoranz, doch fähiger, die Beziehung der Wörter zu den Dingen zu verstehen, der systematischen Analyse zum unauslotbaren Mysterium, das er auf immer vergebens zu verstehen sucht.«4 Ähnliches lässt sich über den Tod sagen. Was Außenstehende sehen, was im Bericht des Arztes steht, ist das eine, was aber in Kopf und Seele des Menschen geschieht, der seine sterbliche Hülle verlässt, ist etwas, worüber wir nichts wissen. Zweifellos gibt es ein Maß vorhersagbaren Leids, das von anderen festgestellt werden kann, und es mag durchaus auch Momente klarsichtiger Kommunikation geben. Ins Licht oder in die Dunkelheit aber geht jeder von uns allein. Vielleicht lässt sich über diesen Prozess am einfachsten sagen, dass der Tod vorwiegend ein Fall für die Statistik ist, das Sterben hingegen eine Kunstform – zumindest könnte es so sein.
Zugleich kann mein Sterben nur eine Kunst sein, wenn ich





























