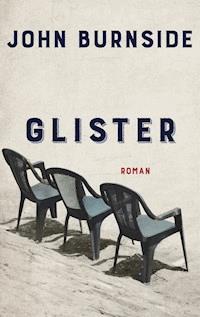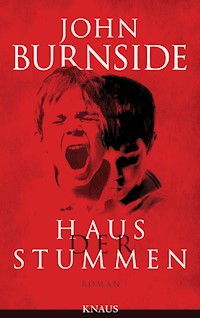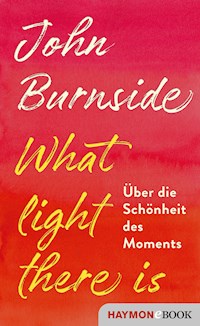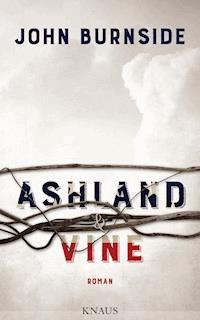10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Das autobiografische Projekt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Von Kritikern und Lesern gefeiert: nach »Lügen über meinen Vater« der zweite Band von Burnsides autobiografischer Reihe
Nach Jahren des Vorsatzes, niemals so zu werden wie sein Vater, muss sich John Burnside eingestehen, dass er den gleichen Weg eingeschlagen hat wie der Mann, den er zutiefst verachtet: Drogen, Alkohol und die Weigerung, Verantwortung zu übernehmen, haben ihn an den Rand des Wahnsinns gebracht. Ganz unten angekommen, beschließt er, wieder für ein Leben zu kämpfen, das diesen Namen wirklich verdient. Er möchte werden wie alle anderen. John Burnside erzählt von dem schwierigen Weg, sich mit seinen inneren Dämonen zu versöhnen — radikal ehrlich und überaus berührend.
»Ich glaube, dass es sich bei John Burnside tatsächlich um den größten Schriftsteller unserer Tage handelt.« Matthias Brandt (in »Das literarische Quartett«)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 411
Ähnliche
Über das Buch:
In seinem autobiografischen Bericht Lügen über meinen Vater erzählt der schottische Lyriker und Romancier John Burnside schonungslos von seiner schwierigen Kindheit, Jugend und Adoleszenz. Das Buch wurde zum Bestseller. Wie alle anderen ist die Fortsetzung. Zu Beginn des Buches ist Burnside drogenabhängig und offiziell als schizophren diagnostiziert. Nach Jahren des Vorsatzes, nur nicht zu werden wie sein Vater, muss er sich eingestehen, dass er genau den gleichen Weg zur Hölle eingeschlagen hat wie der Mann, den er zutiefst verachtet: Drogen, Alkohol, Lügen und die systematische Weigerung, für sich und sein Handeln Verantwortung zu übernehmen. Ganz unten angekommen, beschließt Burnside, ein »bürgerliches« Leben zu führen, zu sein wie alle anderen. Radikal ehrlich erzählt der Autor von seinem langen gewundenen Weg in die Normalität. Es ist die Literatur, die ihn schließlich rettet.
Über den Autor:
John Burnside, geboren 1955 in Schottland, ist einer der profiliertesten Autoren der europäischen Gegenwartsliteratur. Der Lyriker und Romancier wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Corine-Belletristikpreis des ZEIT-Verlags, dem Petrarca-Preis und dem Spycher-Literaturpreis. Im Knaus Verlag sind bisher von ihm sein autobiografischer Bericht Lügen über meinen Vater und die Romane DieSpur des Teufels, Glister, In hellen Sommernächten sowie Haus der Stummen erschienen.
John Burnside
Wie alle anderen
Aus dem Englischen vonBernhard Robben
Knaus
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel »Waking up in Toytown« bei Jonathan Cape, London
Die Zitate stammen aus: Augustinus, Bekenntnisse, 7. Buch, 1. Kapitel, Leipzig 1888, Übersetzung von Otto F. Lachmann; Robert Louis Stevenson, Memoirs of Himself, London 1912, S. 25; Muriel Rukeyser, Theory of Flight, New Haven, 1935.
Die Kapitelüberschrift »I Dreamed I Saw St. Augustine« ist der Titel eines Songs von Bob Dylan.
Copyright © der Originalausgabe John Burnside 2010
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016 beim Albrecht Knaus Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung und -illustration: Sabine Kwauka
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-17981-6V002
www.knaus-verlag.de
Dieses Buch ist in faktischer Hinsicht so akkurat, wie es die Erinnerung zulässt. Die Darstellung mancher Personen, vorallem jener mit einem Hang zum Mord, wurde zu ihrem Schutz abgewandelt.
Mein Herz schrie heftig gegen all die Truggebilde, und mit einem Schlag versuchte ich, den mich umwirbelnden Schwarm von Unlauterkeit aus dem Blick meines Geistes zu vertreiben.
Augustinus von Hippo
Zur schlimmsten Folge aber zählt jene zweifelhaftem Tun angedichtete Romantik, die das heranwachsende Kind glauben lässt, nichts sei so glorreich, wie im Ausüben einer verblüffend verruchten Tat vom Tod dahingerafft zu werden. Wohl nie wieder werde ich mich für etwas so begeistern wie damals, als ich in meiner Kindheit um seiner selbst willen tat, was ich für sündhaft hielt.
Robert Louis Stevenson
Fliegen ist unerträglicher Widerspruch.
Muriel Rukeyser
Schlusswort (I)
Vor Kurzem, als ich noch verrückt war, fand ich mich in der seltsamsten Irrenanstalt wieder, die ich je gesehen hatte. Natürlich sind alle Irrenanstalten ein wenig seltsam, doch der Saal, in dem ich mich in besagtem Moment aufhielt, erinnerte mich an einen gewissen Typ Kirche, an einen jener Orte, an denen man meint, jeden Augenblick erscheine Gott oder einer seiner Lakaien mit der Frohen Botschaft, einem Vorgeschmack auf den Weltuntergang oder beidem. Die Patienten waren vorwiegend Männer mittleren Alters, nur am Gartenfenster saß in einem Rollstuhl ein Tattergreis, das Gesicht eingefallen, die Haut am Kopf überstraff gespannt, der zauselige graue Bart mit Eigelb betupft. Frauen sah ich keine, also war ich wohl auf einer Art Krankenstation, nur lag ich nicht im Bett, war nicht mal in der Nähe eines Bettes, und mir schien es früher Nachmittag zu sein, wenn die Patienten doch eigentlich irgendwo in einem Aufenthaltsraum Bibelverse aus Seifenopern heraushören, sich Invasionen von Aliens ansehen oder über die Flure schlurfen und den Feuerlöschern und Acrylbildern an der Wand die Siebenerreihe vorlesen sollten.
Irgendwas stimmte nicht. Ich habe sicher drei, vier Stunden in dem Saal gesessen, mich gefragt, wie ich dort hingekommen war, und darauf gewartet, dass hoffentlich bald jemand begriff, welcher Fehler ihnen unterlaufen sein musste. Niemand kam, nichts wurde korrigiert. Man gab mir nicht mal Medikamente. Irgendwas stimmte ganz und gar nicht. Diese Patienten gehörten beschäftigt; sie hätten etwas mit den Händen machen, womöglich irgendwo in einem Kunstraum therapeutisch werkeln sollen, doch hielten sie sich hier in diesem merkwürdigen Vestibül auf, hockten auf stapelbaren Stühlen und brabbelten in ihre Morgenmäntel. Und ich war bei ihnen und redete mit den Toten – was ich, wie mir nun klar wurde, bis zu ebendem Moment getan hatte, als ich aufsah und begriff, wo ich war –, hatte mit einem Geist geredet, der mir gegenüber saß, eben noch, direkt hier, dem Geist einer Frau, die den Kopf leicht abwandte, deren Blicke mich mieden. Wer war sie? Erst vor einer Minute hatte ich mit ihr geredet, und sie hatte zugehört, selbst aber nichts gesagt und mich nicht angesehen, hatte nur mit abgewandtem Kopf hin und wieder leicht genickt. Wir waren eine ganze Weile so zusammen gewesen, doch nun war sie plötzlich fort, und ich saß in diesem Saal mit all den Männern, und irgendwas stimmte ganz und gar nicht.
Ich richtete mich auf meinem Stuhl auf und sah mich um, die anderen regten sich kurz, passten ihre Positionen an, was typisch für einen Ort wie diesen ist: Einer bewegt sich, und alle anderen bewegen sich entsprechend, wahren die Balance im Saal. Ich wartete, bis wieder Ruhe eingekehrt war, dann wandte ich den Kopf und entdeckte an der Tür einen Pfleger auf einem Stuhl, keine zwei, drei Meter entfernt. Er war ein noch junger Mann in dunkelblauem Pullover und schwarzen Jeans, und er sah aus, als wäre er gerade von draußen hereingekommen; er hatte etwas Grünliches, eine leichte Kühle an sich. Vielleicht war er ja tatsächlich gerade von draußen hereingekommen, weshalb ich ihn zuvor nicht bemerkt hatte; jetzt saß er jedenfalls auf seinem Plastikstuhl, den Hals ein wenig gereckt, die Ellbogen auf die Knie gestützt. Er las ein Buch, eine alte Klassikerausgabe von Penguin, Aufzeichnungen aus dem Kellerloch.
»Hallo?«, sagte ich.
Er musterte mich mit einem Blick, der gutmütiges Wiedererkennen auszudrücken schien, gab aber keine Antwort.
Ich ruckelte mich auf meinem Stuhl zurecht, woraufhin der Saal ebenfalls ruckelte, was der Pfleger aber offenbar nicht bemerkte. »Ich glaube, ich bin bei der Medikamentenausgabe vergessen worden«, sagte ich.
Mit einem schiefen Lächeln schüttelte er den Kopf. »Ich weiß«, erwiderte er. »Sie haben es mir schon gesagt.«
»Was?«
»Dass Sie bei der Medikamentenausgabe vergessen wurden«, antwortete er. »Das haben Sie mir schon gesagt.« Er lächelte nicht mehr, wirkte aber entspannt, als er auf seine Armbanduhr schaute. »Das war vor gut zehn Minuten.«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein.«
»Doch.«
»Das war ich nicht«, sagte ich, »das muss jemand …«
»Na ja, egal«, sagte er. »Ist nicht so wichtig. Jedenfalls wurden Sie nicht übergangen, okay?«
Ich nickte. Er hatte natürlich recht. Mir waren meine Medikamente verabreicht worden. Nur fühlte es sich an, als hätte ich keine genommen. Was wiederum bedeutete – und der Gedanke kam mir so plötzlich wie eine Erleuchtung, wodurch der Saal stärker denn je an eine Kirche erinnerte –, dass es für mich keinen Grund gab, hier zu sein. Denn warum sollte ich hier sein, wenn die Medikamente nicht wirkten? Warum sollte ich mit all diesen Männern mittleren Alters, diesem sarkastischen jungen Kerl mit seinem Penguin-Taschenbuch und dem schrecklich alten Mann mit Dotter im Bart in diesem Saal sein, wenn ich auch woanders sein könnte? Mir war zwar nicht klar, wo dieses Woanders sein könnte, doch wusste ich, dass es ein Woanders gab. Warum sollte ich also nicht dahin gehen? Jetzt?
Ich schaute an mir herab. Ich trug Kleider, die ich kannte, und war nicht voll mit Dreck, Kotze oder Blut. Ich trug ein Hemd, eine Jeans und ein Paar Wanderstiefel. Ich sah aus, als wäre ich den Tag über unterwegs gewesen und wartete nun an einem Provinzbahnhof auf den Zug. Normal war ich nicht, doch war auch nichts offensichtlich Unnormales an mir. Säße ich im Warteraum irgendeiner Regionalbahn und jemand käme herein, um auf denselben Zug zu warten, hätte der mir dann angesehen, dass ich ein Irrer war? Sicher nicht.
Ich stand auf.
Der Pfleger hob den Kopf, behielt sein Buch aber in der Hand. Ich warf ihm einen raschen Kein-Problem-muss-nur-aufs-Klo-Blick zu, und er las weiter in seinem Dostojewski. Mein Kopf war jetzt völlig klar: Ich befand mich in keiner Geschlossenen, also konnte ich tun, was ich wollte, und um jede Aufregung zu vermeiden, würde ich einfach gehen, denn wenn ich erwähnte, dass ich gehen wollte, würden sie mich warten lassen, bis mich ein Arzt untersucht hatte, ehe ich auf eigene Verantwortung entlassen wurde, und dann würden sie mir zureden, würden sich genötigt fühlen, mir zu sagen, dass ich gerade erst aufgenommen worden war – ich war mir ziemlich sicher, dass ich gerade erst aufgenommen worden war –, dass ich folglich gegen ihren medizinischen Rat handelte und so weiter und so fort, und all das wollte ich nicht über mich ergehen lassen. Außerdem bestand kein Grund zu der Annahme, dass diese Irrenanstalt anders als die anderen war, in denen ich gewesen bin, was hieß, dass ich nach draußen gehen und mich auf dem Gelände frei bewegen konnte. Das wiederum bedeutete, niemand würde sich viel dabei denken, wenn ich zur Außentür ging – falls ich allerdings tatsächlich erst kürzlich aufgenommen worden war, würde man mich im Auge behalten, schließlich war ich ein neuer Patient, und die standen unter Beobachtung, sofern man sie nicht gleich völlig ausknockte, damit sie den ersten therapeutischen Schlaf schliefen, der so wichtig dafür war, dass gewöhnliche Nullachtfünfzehn-Irre wie ich den Pfad der allmählichen, doch vollständigen Erholung einschlugen. Und so weiter.
Inzwischen ging ich über den Flur. Es war ein langer Flur, die Wand auf der einen Seite mit Holz verkleidet, auf der anderen bodentiefe Fenster, durch die ich das Gebüsch in dem für diese Art Anstalt so typischen, viktorianischen Park sehen konnte, finster, feucht und mit wässrigem Sonnenlicht betüpfelt. Wie aus dem Nichts ertönte plötzlich eine Stimme.
»Alles in Ordnung, John?«
Es war die Stimme einer Frau, und sie klang freundlich. Nicht einmal beunruhigt, nur als wollte sie sich vergewissern, dass ich nicht durcheinander war oder mich verirrt hatte. Lächelnd drehte ich mich um. Die Frau stand in einer Tür, an der ich gerade vorbeigegangen war: klein, mittleres Alter, dicksohlige Tennisschuhe, graue Hose und weiße Bluse. Irgendwas an ihr schien mir vertraut, doch kam ich nicht darauf, was es war.
»Ich dachte, ich mache einen Spaziergang«, sagte ich, »solange die Sonne noch scheint.«
Sie nickte. »Ja gut«, sagte sie, »aber gehen Sie nicht zu weit.«
Meine Hand zuckte unwillkürlich hoch, als wollte sie sich ein irres Winken gestatten, doch es gelang mir, sie wieder unter Kontrolle zu bringen. »Mach ich nicht«, sagte ich, drehte mich immer noch lächelnd wieder um und ging ohne Eile weiter, nur ein Mann, der an einem warmen Sommernachmittag aus keinem besonderen Anlass einen Spaziergang macht.
* * *
Wo ich heute wohne, führt eine Straße am Haus vorbei über die Hügelkuppe zum Dorf und dem dahinterliegenden Meer. Es ist eine schmale Straße mit Bäumen an einer Seite, Feldern auf der anderen, und da ich nicht über den Hügel schauen kann, gleicht sie der Straße in dem Traum, den ich seit Kindertagen habe, der Straße, die ins Jenseits führt – manchmal aber, in einem gewissen Licht, erinnert sie mich auch an jene Straße, über die ich an dem Tag damals ging, an dem ich meine letzte Irrenanstalt in der festen Gewissheit verließ, dass mir jemand nachkommen und mich zurückholen würde. Ich bin lange gelaufen, und ich muss sagen, es hat mir gutgetan. Das tut es meistens.
Als ich noch richtig verrückt war, litt ich an sogenannter Apophänie, ein Zustand, ein Unbehagen, näher beschrieben von Klaus Conrad, dem Spezialisten für Schizophrenie, der den Begriff prägte und darunter das grundlose Sehen von Verbindungen verstand, begleitet von der besonderen Empfindung abnormer Bedeutsamkeit. Mit anderen Worten: Man sieht Muster, wo keine sind, hört Stimmen im allgemeinen Grundrauschen, sieht Gott oder den Teufel im letzten Rest Fertignudeln. Normalen Menschen erlaubt diese Fähigkeit, die Welt zu verstehen und eine bescheidene, begrenzte sowie hoffentlich von anderen geteilte Ordnung zu finden, nach der sich leben lässt. Für den Apophäniker dagegen bedeutet sie eine wilde, gnadenlose Suche nach der einen allumfassenden Ordnung, nach einer Hypernarrative, einem Jenseits, doch findet er letztlich meist nur eine Flutwelle unverständlicher, überwältigender Details: die ganze Welt auf einmal, deren Geschnatter pausenlos in einem Geiste widerhallt, der Ruhe nur im Vergessen finden kann. Ich leide noch heute darunter, kann jetzt aber nicht mehr sagen, ich gehörte zu jenen, die eine Windbö irrtümlich für den Heiligen Geist halten. Ich leide zudem an gelegentlichen Anfällen von Schlaflosigkeit, und wenn es so weit ist, besteht meine bevorzugte Heilmethode darin, ins Dunkel und auf die Straße zu gehen, als ob ich irgendwohin wandern wollte. Im Großen und Ganzen schlafe ich heute besser als früher, aber es gibt immer wieder Zeiten, in denen ich den alten Rhythmen der Schlaflosigkeit verfalle, und dann bleibt die Straße meine beste Kur. Nachts herrscht dort kaum Verkehr; ich kann draußen im Mondlicht stehen und der Stille lauschen – und wenn es denn tatsächlich so etwas wie eine jenseitige Ordnung gäbe, wenn das Jenseits wirklich existierte, dann sähe der Weg dorthin ganz ähnlich aus: eine Straße, eine Weide, ein Streifen Dämmerlicht am Zaun und vielleicht noch ein Fuchs auf seiner ersten Morgenrunde durchs weiß bestäubte Gras.
Übrigens glaube ich tatsächlich immer noch, dass es ein Jenseits gibt. Heute Morgen, bei erstem Sonnenlicht, erhaschte ich erneut einen Blick darauf, als ich durch den überfrorenen Wald nach Hause ging, die Hagebutten weich vom unverhofften Tauwetter, und um mich herum eine Stille, die ich zu fühlen meinte, plötzlich und so bedacht wie der angehaltene Atem eines Chors, ehe das Kyrie angestimmt wird. Ich war im Dunkeln aufgestanden und meiner Paradiesstraße gefolgt – Frau und Kinder schliefen noch – und war seit Wochen, wie mir schien, zum ersten Mal wieder allein draußen und so glücklich wie schon lange nicht mehr, dachte an die Kohlereviere meiner Kindheit, an die Tage in der Irrenanstalt und sah die Erinnerungen langsam zu einer Vergangenheit schrumpfen, die mir nicht mehr wie die meine vorkam, zu einer Vergangenheit der Geschichtsbücher, der Fernsehdokumentationen. Die Vergangenheit der Memoiren, ordentlich, in sich abgeschlossen, mit Anmerkungen versehen und dem Fluss der Zeit entzogen. Ich erinnerte mich an den Hof, in dem ich als Kind gespielt hatte, an den Wald mit seinen Trümmern und Ziegelsteinen, erinnerte mich daran, als sei es etwas, das ich mir auf einer langen Busfahrt ausgedacht hatte, um die Zeit zu vertreiben. Und ich sah jene, mit denen ich an Sonntagnachmittagen oft zusammengesessen hatte, sah ihre Augen und die Finger, mit denen sie Cornedbeefsandwiches hielten oder sich Tee in Porzellantassen einschenkten, Tassen, die ich als das Kind, das ich damals war, zugleich unvergänglich fand und unfassbar zart. Porzellan. Das Wort haben sie gern wiederholt, die Tanten, erwachsenen Vettern und Nachbarn: Porzellan, etwas selten Schönes und Fragiles in ihrem Leben, die auf den Rand jeder Untertasse gemalten Rosen, das Innere jeder Tasse, unglaublich klar und eigenartig besänftigend, dabei hatten wir alle entsetzliche Angst, solange das Geschirr auf dem Tisch stand, Angst davor, dass etwas passieren könnte, dass ein Stück aus dem Service – ganz sicher ein Hochzeitsgeschenk oder das, was in jener Gegend als Erbstück galt – zerbrechen oder einen Schaden nehmen könnte. Ich kannte diese Menschen, wie ich die Etiketten auf den Cornedbeefdosen kannte oder die rosafarbenen, grünblättrigen Muster auf Tassen und Untertassen; sie waren mir ebenso vertraut und waren ebenso vergänglich. Manchmal, wenn Tante Sall oder meine Cousine Madeleine mir ein Stück Kuchen anbot und ich, nachdem ich mir mit einem Seitenblick die Erlaubnis der Mutter geholt hatte, meinen Teller nahm und ihn hochhielt, um ein dickes Stück Obst- oder Marzipantorte zu empfangen, verziert mit abertausend Tupfern schneeweißem Zuckerguss, überfiel mich der entsetzliche Gedanke, dass sie alle – meine Mutter, meine Tanten, meine Cousinen – bald tot sein würden, und dass ich nicht wusste, wohin der Tod sie bringen würde. Obwohl ich damals noch zutiefst religiös war, ein katholischer Bub, der daran dachte, Priester zu werden, hatte ich die Aussicht auf den Himmel aufgegeben, teils weil mir so offensichtlich schien, dass er nur zu unserem Trost ersonnen war, größtenteils aber, weil ich – wenn ich mir ausmalte, wie er sein mochte – stets an die Wäscherei hinter Tante Margarets Haus denken musste, grauweiß, niedrige Decke und trist, die Luft wabernd vom schweren Geruch nach Waschpulver und Stärke. Ich weiß noch, wie mir einmal auf einem Spaziergang mit meiner Mutter der Gedanke kam, dass die Toten wieder zu Erde werden, nicht nur ihre Körper, auch die Seelen, dieses unbeschreibliche Gewebe aus Erinnerungen und Wissen, das sie, wie ich wusste, alle ausnahmslos besessen haben mussten, und ich meinte auf dem Gesicht meiner Mutter den grünlichen Schatten dessen zu erkennen, was kommen würde, eine alte, dunkle Schwere wie auf dem Regenwasser, das sich in der Steinzisterne draußen bei den Wassersilos sammelte. Und doch war da auch eine gewisse Süße, ein Hauch von Maiglöckchen und frisch gemähtem Rasen. Der Eindruck hielt nur einen Moment vor, aber mir blieb die Erinnerung daran bis heute, ich habe sie nie ganz aufgegeben, denn so lachhaft es auch scheinen mag, über das Jenseits zu reden, gehört es doch auch zu der Geschichte, die ich erzählen muss, wenn ich mich vergewissere, wer ich bin. Es ist kein Jenseits im üblichen Sinn, aber eine Geschichte, mit der ich mich abfinden kann, liegt ihr doch die Erkenntnis zugrunde, dass die Toten nicht bei uns bleiben und nicht über unser Leben als Erwachsene wachen, wie sie während unserer Kindheit über uns gewacht haben; sie dauern nicht einmal in wiedererkennbarer Gestalt fort, auch wenn die Welt fortdauert und mit ihr etwas von dem, was sie waren. Manchmal fragt mich mein Sohn, was ich von alldem halte, und ich denke an den wässrigen grünen Schatten auf dem Gesicht meiner Mutter, erwähne ihn aber nie. Ich rede von Ideen und Vorstellungen, Mythen und Erinnerungen, kann ihm aber nicht sagen, woran ich wirklich glaube, dass nämlich beide, die Toten, die einst zu uns gehörten, und der Irre, der ich einst war, hinter einer Darstellung verschwinden, die Jahr um Jahr immer mehr einer Geschichte gleicht. Ich kann keine Worte finden, das andere zu erzählen, was ich in dieser Angelegenheit weiß, dass nämlich die Toten, die wir einst kannten, die aber nie die unseren waren, Tote, die nie irgendwem gehörten, nicht einmal sich selbst, auf immer weiterexistieren, zumindest ein Teil von ihnen, dass sie endlos im Regen aufgehen, in den Blättern und jungen Tieren, die im ersten Morgengrauen jagen. Ich will das nicht Himmel nennen oder Jenseits, da es nicht richtig wäre, es zu benennen, so wie es für mich nicht richtig wäre, meinem Sohn zu sagen, dass ich ihn nie verlasse, und doch gehört es zu dem, was ich weiß, an einem Morgen wie diesem, da die Toten zu Nichts vergehen und die Erinnerungen ans Verrücktsein, die ich für die meinen hielt, in einem anonymen Ereignisgewebe aufgehen. Es gibt eine fachspezifische Bezeichnung dafür, für jenen Zustand, in dem alle Erinnerungen – meine eigenen, die geliehenen, die erfundenen wie auch jene, die mir eingepflanzt wurden, ob mit oder ohne meine Zustimmung – gleichwertig sind, gleich real oder irreal. Manche nennen es post-memory, ein Phänomen, das wir uns leicht erklären können, indem wir über den uns umgebenden Ozean an Informationen reden, über all die Bilderfluten und Erzählungen, doch glaube ich nicht, dass dies genügt. Die bekannten Toten ziehen sich in Geschichten zurück und gesellen sich zu jenen, die wir niemals kannten, damit die Welt fortbestehen und sie selbst weiterziehen können in die Welt, die da kommt – und als ich an diesem Morgen den Hügel hinaufging, konnte ich sie um mich herum spüren, wie sie beiseiterückten, um der Zukunft Platz zu machen, so wie ich schließlich auch spürte, dass mein altes Ich aus den Tagen der Irrenanstalt, das wie ein fahler Schatten bei mir geblieben war, zerbröselte und sich in Luft auflöste.
* * *
In der Anfangszeit des Fernsehens gab es eine spätabendliche Sendung namens Das Schlusswort. Ich meine mich an einen Mann zu erinnern, womöglich ein Priester, der unmittelbar zum Zuschauer redete und Worte des Trostes und der Inspiration spendete, Worte, die andeuteten, dass der Welt eine zutiefst verlässliche Ordnung innewohnte. Das Schlusswort war eine heimelige, leicht rührselige Werbung für eben diese Ordnung, die besagte, wenn man sich in die Hände von jemandem – oder etwas – begab, das klüger und etablierter war als man selbst, dann käme Ordnung ins Leben, so wie es Weihnachten wurde und die Feiertage kamen, was von uns, den Kunden, nichts weiter als stille Akzeptanz verlangte. Es war eine Sendung, die meine Mutter gern sah, weniger wegen der darin zum Ausdruck gebrachten religiösen Ansichten als vielmehr wegen jener sanften Überzeugung, die der Sprecher ausstrahlte, ein Glaube, nicht streitsüchtig oder selbstzufrieden, weder presbyterianisch noch katholisch, eher etwas, das mehr mit Ingwerkeksen und Ceylon-Tee als mit Theologie an sich zu tun hatte. Ich bezweifle keineswegs, dass es mit Ingwerkeksen und Tee mehr auf sich hat als mit der Theologie, vor allem dann, wenn Porzellantassen dabei im Spiel sind, doch als ich an diesem Morgen durch den Wald ging, um mich herum alles still und weiß, erfasste mich ein seltsam nostalgisches Verlangen nach dem Gott meiner Kindheit – und wenn nicht nach dem Gott, dann nach dem Heiligen Geist, jenem, der wie ein Vogel aussah, wenn er sich denn überhaupt die Mühe machte, eine Gestalt anzunehmen. Der spätabendliche Priester hat ihn nur selten erwähnt, ein Glücksfall, wenn man es recht bedenkt. Stattdessen drehten sich seine Sendungen um die alltäglichen Herausforderungen des Lebens in dieser Welt, um Probleme im Umgang mit anderen Menschen, in der Ehe und so weiter, was bedeutete, dass ich den Heiligen Geist ganz für mich allein hatte, mein ureigenes Mysterium, das ich mit hinaus auf die Felder und in den Wald nehmen konnte, eine Subtilität im Schatten der Wassersilos oder der dachlosen Scheune am Ende der Old Perth Road – und während ich am besagten Morgen auf den Hügel stieg, nahm ich an, dass Er oder Es mich immer noch begleiteten und mit mir durch die frostige Welt streiften, eine animalische Präsenz trotz katechistisch versicherter Unsichtbarkeit, mein beharrlicher Begleiter auf dem Weg zum Jenseits des Hier und Jetzt.
Surbiton
Hi. Ich heiße John, und ich bin Alkoholiker.«
So, jetzt war es raus. Ich hatte es gesagt. Seit Wochen hatte ich geplant, es zu sagen, und jetzt war es so weit. Nichts Originelles, nichts Außergewöhnliches, bloß der Standardsatz, die vorgeschriebene Formel, die ich auch von denen gehört hatte, die vor mir dran gewesen waren, laut ausgesprochen und pflichtschuldigst anerkannt. Bloß jetzt, da ich es gesagt hatte, merkte ich, dass irgendwas nicht stimmte. Etwas war nicht so, wie es sein sollte. Dem, was ich gesagt hatte, fehlte es an Gewicht, an Bedeutsamkeit, und niemand in dem hohen braunen, ziemlich melancholischen Saal war gänzlich überzeugt – ich am wenigsten. Ich sah es ihren Gesichtern an: Ich hatte es noch nicht geschafft, täuschte vor, damit es sich anhörte als ob, schwindelte vielleicht auch nur, denn eigentlich hätte ich längst so weit sein müssen, oder nicht? Ich hätte längst eine Art Perspektive erlangen, mich selbst in neuem Licht sehen und vom Gesehenen gedemütigt sein sollen, gedemütigt und so beschämt, dass ich mich laut zu Wort meldete und vielleicht eine höhere Macht in mein Leben ließ, mit dem ich allein nicht fertigwurde, was mehr als offensichtlich war. Doch ich hatte mich nicht laut zu Wort gemeldet, hatte nichts in mein Leben gelassen, und während der letzten Wochen, sogar Monate, war mein Schweigen ohrenbetäubend gewesen.
Nicht, dass ich mir keine Mühe gegeben hätte. Ich war zu den Treffen gegangen, Tag für Tag: Montags und donnerstags saß ich hier in diesem Saal, mittwochs und sonntags in einem anderen braunen, von den Quäkern zur Verfügung gestellten Saal, dienstags, freitags und samstags in einem mausig müffelnden Kirchengebäude in Guildford. Ich mochte diese braunen Säle, und ich mochte die Leute, die zu den Treffen kamen, um ihre Geschichten zu erzählen und an die Neuankömmlinge Kaffee und Kekse zu verteilen. Sie waren dankbar und freundlich, konnten ohne jede Verlegenheit über die »höhere Macht« reden, und ich hatte sie in vielerlei Hinsicht gern, nur wusste ich, dass ich nicht dazugehörte. Ich tat so als ob. Alle wussten es – und alle wussten, dass ich es wusste. Ich hatte mich zu Wort gemeldet, mehr auch nicht. Was ich gesagt hatte, mochte durchaus stimmen, doch so, wie ich die Worte sagte, machte ich sie zur Lüge.
»Hi, John.«
Und da war sie, die Standarderwiderung. Zwölf, vielleicht auch fünfzehn Stimmen im Chor, die auf typische Weise antworteten, ganz nach Vorschrift. Sie wussten, dass es mir an Glauben fehlte, aber sie machten unbekümmert weiter, wollten mich auf dem Weg der Besserung sehen – kaum waren die Worte jedoch gesagt, fühlte ich mich traurig, nicht meinetwegen, sondern ihretwegen. Denn was ich gesagt hatte, war falsch.
Hi. Ich heiße John, und …
Woran lag’s? Wo steckte der Fehler? Wo die Lüge? Lag es am legeren Hi? Hätte ich etwas anderes sagen sollen? Hallo? Guten Abend? Entschuldigt die Störung, aber …?
Oder lag es daran, dass mir ein solch uneingeschränktes Eingeständnis nicht behagte? Denn sobald die nüchterne Feststellung über meine Lippen gekommen war …
Ich heiße John, und ich bin Alkoholiker …
… begriff ich, dass ich von Anfang an auf jenes kleine, doch bedeutsame, erlösende Wörtchen aber gewartet hatte.
Hi. Ich heiße John, und ich bin Alkoholiker, andererseits aber…
Vielleicht auch:
Hi. Ich heiße John, und ich bin Alkoholiker, gewissermaßen. Auch ein Junkie, wenn man es genau nimmt. Und wenn Not am Mann ist, schlucke ich eigentlich alles…
Nein.
Ich hatte die Worte gesagt und an der richtigen Stelle aufgehört, hatte aber an etwas anderes gedacht – und es nicht ganz geschafft. Dabei hatte ich eigentlich nur getan, was ich schon mein Leben lang tat, hatte den auswendig gelernten Text aufgesagt, den die Situation erforderte:
Credo in unum Deum.
Tut mir leid, ich tu’s nie wieder.
Natürlich liebe ich dich.
* * *
Da waren wir also in diesem langgezogenen, holzverkleideten und ein bisschen zu trockenen Raum, der wie eine überdimensionierte Pfadfinder-Versammlungshalle aussah, die Fenster hoch und schmal, die Wände in warmem Hellbeige gestrichen, die Möbel alt, voller Kerben und Dellen. Nichts in diesem Saal war grässlich braun, doch herrschte Braun vor, das traurige Braun von Krankenhausfluren oder eines Pfarrhauses, das Braun öffentlicher Gebäude, in denen Menschen kommen und gehen und aus Liebe oder dem Wunsch nach Selbstverbesserung tun, was sie eben tun. In einer Ecke köchelte Wasser in einer großen Kanne vor sich hin, und nach einer Stunde standen wir auf und tranken Nescafé aus angeschlagenen Tassen, während die älteren Männer, jene, die schon seit acht, zehn oder gar zwanzig Jahren nüchtern waren, Zucker verteilten und Kekse sowie erbauliche Pamphlete. Am Ende des offiziellen Treffens saß ich allein da, stumm und ein wenig beschämt, als sich Harry, ein großer Mann mit Pferdegesicht, zu mir setzte. Lange hockte er einfach nur da, Gesicht und Hände weich und so entspannt, wie sie es vermutlich auch gewesen wären, hätte er es mit einem verirrten Kind zu tun oder mit einem im Gewächshaus gefangenen Vogel.
»Lass dir Zeit«, sagte er.
Erst habe ich ihn nicht angesehen, dann aber doch. Mir kam ein Gedanke, eine Erinnerung, noch undeutlich, eine Erinnerung an lang Vergangenes. Ich nickte, sagte aber kein Wort.
»Du wirst mir nicht glauben, wenn ich dir sage, dass es einfacher wird«, sagte er, »aber glaub mir, es wird einfacher.«
Wieder nickte ich. Die Erinnerung war jetzt vollständig zurückgekehrt, und ich hing ihr nach, folgte ihr in einen anderen braunen Raum, einen von früher, der sich aber kaum von jenem unterschied, in dem wir mit unserem Kaffee saßen, den Keksen und Selbstgedrehten. Es war zur Zeit der Tuberkulose gewesen. Ich musste meine Lunge röntgen lassen, und alle hatten Angst, da man TB kannte und wusste, was das hieß. Warum ich zur Untersuchung musste, weiß ich nicht mehr und kann mich auch nicht an die Symptome erinnern, unter denen ich gelitten haben dürfte, aber ich war da, in meiner Erinnerung, stand in dem braunen Raum und wartete darauf, dass man sich um mich kümmerte. Und ich weiß, dass ich glücklich war, dass mir dieser braune Raum gefiel und dass ich den Geruch mochte, den Geruch nach schalem Staub und Franzbranntwein, und dass ich mir über das mögliche Ergebnis der Untersuchung nicht die geringsten Sorgen machte. Ich glaube, ich wünschte mir zu sterben, nicht unbedingt so schön wie ein romantischer Held in einem Buch, doch durchaus mit einem Minimum an Farbe und Genugtuung. Ich war fünfzehn, wenn ich mich recht erinnere. Ich mochte Mussorgsky, ausländische Literatur, die Farbe Braun, und ich war keine sonderlich angenehme Gesellschaft.
Endlich wurde ich zur Ärztin gerufen. Sie untersuchte mich aufmerksam, wollte sich wohl ein Bild von meiner Verfassung machen, vielleicht aber war dies auch nur die letzte Untersuchung, die bestätigte, dass ich doch nicht an der Schwelle zum Tod stand – und dann stellte sie mir Fragen, die mit Tuberkulose gar nichts zu tun hatten, übrigens auch nicht mit irgendwas anderem. Ich glaube, sie spürte, dass ich in Schwierigkeiten steckte, oder sie war neugierig, vielleicht auch besorgt, jedenfalls versuchte sie, den Finger auf etwas zu legen, und ich war mir plötzlich meiner schäbigen Kleider bewusst, der Armut, meiner umfassenden Unreife. Sie war ziemlich hübsch, diese Ärztin, und es machte mir zu schaffen, dass sie hübsch war, denn sie wirkte dadurch so unnahbar, so sehr Teil einer fernen, privilegierten Welt.
»Du magst also Bücher?«
Ich sah sie an, ihre Frage verwirrte mich. »Ja, ich mag Bücher. Wieso?«
Sie lächelte und zeigte auf das dicke gebundene Buch in meiner Anoraktasche. Ich hatte es ganz vergessen, ein Buch aus der Bibliothek, mitgenommen für den Fall, dass ich stundenlang in einem Wartezimmer sitzen musste. D. H. Lawrence. Ein Band der alten Ausgabe mit den dunkelgrünen Einbänden, welcher genau, habe ich vergessen. »Ich bin neugierig«, sagte sie mit einem Hauch von Betonung auf neugierig. »Gehört Lawrence zu deinen Lieblingsautoren?«
Ich sah sie wieder an. Ich war fünfzehn Jahre alt und kannte niemanden, den ich mochte, mit ihr aber wollte ich in ihre Welt zurückkehren und tun, was man dort so tat: mir einen Gin Tonic genehmigen, über Kinofilme reden, zum Abendessen in ein französisches Restaurant gehen und früh nach Hause kommen, um sich stundenlang in einem Zimmer im oberen Stock irgendwo in den Vorstädten zu lieben, die Gardinen halb zugezogen, sodass alles – die Sessel, das Bett, die Bilder an den Wänden – vom orangefarbenen Licht der Straßenlaternen in ein staubiges Gold getaucht wurde. Ich sah sie an und wollte ihr sagen, na klar, Söhne und Liebhaber ist schließlich ein Klassiker, tat es aber nicht, denn in Wahrheit hatte mir das Buch gar nicht gefallen, und ich war ganz allgemein ziemlich enttäuscht von D. H. Lawrence. Ich schätze, ein Teil von mir wusste, dass ich zu jung und unerfahren war, um ihn begreifen oder in all seinen psychologischen und sexuellen Feinheiten verstehen zu können, nur fühlte ich mich zu meiner Enttäuschung auch berechtigt. Es war meine Enttäuschung, und selbst wenn ich den Grund dafür nicht kannte, wusste ich, dass sie irgendwie angebrachtwar. Ich schüttelte den Kopf. »Weiß nicht«, sagte ich. »Ich glaube, ich hatte mehr erwartet.«
Da stieß sie ein seltsames kleines Lachen aus, ein freundliches, nachsichtiges Lachen, was dennoch nichts daran änderte, dass ich ein wenig sauer auf sie war, denn sie hatte mich durchschaut, natürlich hatte sie das, hatte das Wesentliche aber trotzdem nicht begriffen. Denn ich war keineswegs der frühreife Arbeiterjunge, für den sie mich hielt. Ich war nicht ganz der naive Autodidakt, den sie gern in mir gesehen hätte, und ich war längst nicht so unschuldig oder so belesen, wie es den Anschein haben mochte. In Wahrheit entstammte ich mit meiner feierlichen Gleichgültigkeit gegenüber dem Tod und meinen Träumen von Blut und Leinen einer völlig anderen Sorte Roman, einer hoffnungsloseren, tristeren Erzählung. Ich wollte nicht so gebildet sein, dass ich die Feinheiten von D. H. Lawrence verstand, wollte ein Zimmer am Ende eines braunen Flurs mit Blick auf Straßenbäume und das purpurne Licht der Laternen. Ich wollte, dass die Zeit stehen blieb, wollte auf immer bei der Betrachtung einer kleinen, begrenzten Zerstörungstat verweilen, einer Wunde etwa oder einer in die Länge gezogenen Folter, meiner eigenen oder der eines anderen, das war egal. Die eigene oder ihre, ich meine: Was bedeutete dagegen schon, dass D. H. Lawrence mich enttäuschte?
Und plötzlich hatte ich sie. Das war die Anrede, die ich gesucht hatte, vorhin, als ich mein Stück aufsagte. Folgendes hätte ich sagen sollen: Guten Abend, ich heiße John, und ich weiß, Alkohol trinkt man nicht aus Vergnügen; ich weiß auch, wer trinkt, der genießt das nicht, als würde er Tee trinken oder flirten. Alkohol ist ein Ersatz für was anderes, nur kann ich ihn nicht aufgeben, denn täte ich es, erinnerte ich mich an dieses andere, und dieses andere ist ein unerträgliches und zugleich unmögliches Verlangen. Das Einzige aber, das mich davon abhält, an dieses Verlangen zu denken, ans braune Zimmer mit dem purpurnen Licht am Ende des dunklen Flurs, ist ein Drink, und was auch geschieht, welche Idiotien ich mir auch zumute, nichts ist so schlimm und so betörend wie dieses Zimmer…
Kein Wort davon habe ich gesagt. Ich ging weiterhin zu den Treffen und versuchte, mich davon zu überzeugen, dass ich es schaffen würde, denn es zu schaffen wäre der erste Schritt auf dem Weg in ein normales Leben gewesen, und das war es, was ich wollte: ein normales Leben, nüchtern, frei von Drogen, von Träumen, mit einträglicher Arbeit. Wie alle anderen wollte ich sein, ein Hausbesitzer, Steuerzahler, ein Name im Wahlregister, ein unauffälliger, alltäglicher Typ, der Nachbar von nebenan, an dessen Namen man sich nie erinnern kann, ein Mann, der anderen aus dem Weg geht, im Grunde aber okay ist. Kurz gesagt, ich wollte aufs Angenehmste betäubt sein, comfortably numb. Das war Anfang der Achtziger: Höhepunkt des konservativen Rückschlags. Das große Bild war mit einem Mal schmerzlich grau geworden, alle Parteien von morgen schienen an ihr Ende gelangt zu sein, und mir waren die Alternativen ausgegangen. Als einzige Hoffnung blieb, in die Normalität zu verschwinden und zu hoffen, dass mir niemand aus der alten Welt in diesen Tunnel folgte.
Also zog ich in die Vorstadt.
Ich zog in die Vorstadt, weil ich bewusst leben, mich nur mit den wesentlichen Dingen des Lebens auseinandersetzen und zusehen wollte, ob ich das nicht zu lernen vermochte, was es mich lehren konnte, um nicht auf dem Sterbebett einsehen zu müssen, dass ich nicht gelebt hatte. Ich wollte die Ordnung, die andere Menschen zu haben schienen, wollte die nicht-apophänische Ordnung eines normalen Lebens. Ein normales Leben als normaler Mensch – in Surbiton oder einer ähnlichen Gegend.
Die Idee war lächerlich, aber eigentlich blieb mir nichts anderes übrig. Sechs Monate vor dem Treffen der Anonymen Alkoholiker war ich aus meinem ureigenen Tollhaus gerettet worden, und um nicht wieder dahin zurückzudriften, beschloss ich zu verschwinden, wie eine in Ungnade gefallene Figur aus einem viktorianischen Roman im Nebel der Chatham Docks verschwindet, um Jahre später im Fernen Osten oder in den Strafkolonien wieder aufzutauchen. Anders als meine literarischen Vorbilder begab ich mich jedoch nicht nach Siam oder in den Maschinenraum eines Ozeandampfers. Ich ging nach Surrey; und ich hatte dabei Büroarbeit im Sinn, Tee, Hecke schneiden, Kreuzworträtsel und Ovomaltine. Mit anderen Worten, ich dachte an Surbiton. Kein Über-die-Stränge-Schlagen mehr, kein Hausen in besetzten Häusern oder Billigzimmern, kein Leben vom Lohn eines Küchengehilfen, stets am Rande einer Strömung, die mich zurück in eine Nervenheilanstalt im grünen Gürtel oder ins anonyme Himmelblau der Notaufnahme führte, stets auf der Suche nach dem perfekten Deal, der in einem Nebel aus süßem Wein und Barbituraten oder mit dem flüchtigen Glück verschreibungspflichtiger Betäubungsmittel endete.
Es war nicht das Leben, das meine Mutter sich für mich gewünscht hätte; es war nicht mal das Leben, das ich mir selbst gewünscht hätte. Ich war hier einfach angespült worden, aus Schwäche und Gleichgültigkeit, und zumindest zu Beginn war es eigentümlich angenehm, sogar ganz wunderbar. Schon im Laufe der letzten zwei, drei Jahre dieses vergeudeten Jahrzehnts war mir klar geworden, dass mein Leben in die falsche Richtung lief, und als mir die Idee mit Surbiton kam, schwankte ich zwischen Häme und Entsetzen, zwischen der spontanen Lust an der Selbstauslöschung und der Furcht davor, in einer beengten, schäbigen Bude mit der falschen Sorte von Leuten und ohne Ausweg zu enden. Während all der Zeit hatte ich mir gesagt, es müsse aufhören. Seit mein Leben im frühen Teenageralter aus der Spur gelaufen war, sagte eine Stimme in meinem Kopf immer und immer wieder, ich müsse mich zusammenreißen, eine vernünftige Stimme, die zu meinem Unglück jedoch genau wie die Stimmen all derer klang, denen ich seit jeher misstraute – die Stimmen der Nonnen, Lehrer und Sozialarbeiter, deren undankbare Aufgabe es war, sich mit Menschen wie mir abgeben zu müssen. Die Stimme redete endlos auf mich ein, ihr guter Rat aber fiel auf taube Ohren, und eine Zeit lang glaubte ich, es würde sich nie etwas ändern, doch dann, am Ende einer langen Periode des Herumtreibens, sah ich mich im Spannungsfeld zwischen dem, was ich für meine ureigene Variante von Geistesklarheit hielt, und einem trügerischen, paranoiden Gnadenzustand, eine psychische Belastung, die sich letztlich nur in einer Nervenheilanstalt ertragen ließ. Ich wusste, der einzige Weg, eine Ewigkeit vor Panoramafenstern, vollgepumpt mit Chlorpromazin und geschmacklosem, mit Kleie garniertem Frühstück zu vermeiden, bestand darin, allem, was ich kannte, zu entfliehen und als neuer Mensch neu anzufangen. Als ein Mensch wie alle anderen.
Also schmiedete ich meinen Plan – auch wenn Plan ein ziemlich großspuriges Wort für jene Reihe von Ereignissen ist, in denen ich eine eher unbedeutende Rolle spielte. Denn wie jeder Pennbruder weiß, kommt eine Zeit, in der nichts entschieden werden kann, in der alles von der Gnade abhängt – und auch wenn ich es noch nicht wusste, hatte ich diesen Punkt nun erreicht. Zumindest glaube ich das heute. Meine Erinnerung an jene Zeit ist ziemlich schwammig, und ich kann nicht vollständig nachvollziehen, wie ich schließlich einen klaren Kopf bekam. Ich erinnere mich nur an ein Zimmer, an das aber so präzise, dass es mir gar nicht wie eine Erinnerung vorkommt, eher etwa wie der Film, den ich gestern Abend gesehen habe, oder wie ein Foto aus einer Zeitschrift, auf dem mir die zentrale Figur seltsam vertraut zu sein scheint, auch wenn sie nicht ganz die ist, deren Name mir als Erstes in den Sinn kommt. Diese zentrale Figur ist mir vertraut wie ein Schauspieler aus einem alten Schwarzweißfilm, sähe ich ihn aus dem Zusammenhang genommen, etwa wie er in meiner Heimatstadt die Straße überquerte oder in einem Café an der High Street die Rechnung zahlte. Farley Granger zum Beispiel, John Garfield oder jener schniefende Möchtegern-Erpresser, mit dem sich Humphrey Bogart eine Weile in einem alten Film von Howard Hawks herumschlagen muss. Da dies aber nun eine Geschichte ist, die ich erzähle – und da ich sie erzähle, nicht er –, kann ich hinnehmen, dass die zentrale Figur in dieser Szene eine Version meiner selbst oder doch jemand ist, der ich zu sein pflegte. Kaum habe ich dies allerdings gesagt, kommt es mir falsch vor, so offenkundig ist der, an den ich mich erinnere, ein Schauspieler oder Betrüger, jemand, der eine Rolle spielt, und selbst diese Rolle, die Figur, die er vorgibt, ist nicht der Mensch, an den ich denke, wenn ich heute versuche, das Bild dessen heraufzubeschwören, der ich damals war.
Letztlich umgibt alles in dieser Szene eine Aura des Fiktiven, auch wenn ich weiß, dass es sich tatsächlich mehr oder weniger wie in meiner Erinnerung abgespielt hat. In dem schäbigen Zimmer, das ich vor meinem geistigen Auge sehe, hockt die mir ähnliche Person auf einem ungemachten Bett und starrt in einen einfachen, fast bodenlangen Spiegel, den man, um die Illusion von mehr Raum zu erzeugen, an der Wand direkt gegenüber des einzigen Fensters angebracht hat. Das Zimmer ist klein, das Mobiliar neu, Überflüssiges fehlt – nur das Bett, der Spiegel und in der hintersten Ecke ein Furnierschrank, der zu dieser untypischen Gelegenheit mit Klarglasflaschen vollgestellt ist, Klarglas, kein grünes, kein braunes Glas, und alle sind fast bis zum Rand mit derselben, süßlich riechenden, dunkelgoldenen Flüssigkeit gefüllt, wie sie sich auch in dem gut ein Dutzend Flaschen findet, die in präzisen Abständen ums Bett gestellt wurden. Bei der Flüssigkeit handelt es sich um eine Mixtur aus Blut, Honig, Alkohol, Olivenöl und Urin; die Flaschen sind offen, Korken oder Schraubverschlüsse fehlen, nur eine einzelne Feder schwebt in heikler Balance auf jedem Flaschenhalsrand. Fällt eine Feder, verfliegt der Zauber, deshalb ist es wichtig, dass jede einzelne liegen bleibt, denn dieser Zauber wurde sorgsam heraufbeschworen, den Mann auf dem Bett zu schützen, der nackt ist und im Moment zwar keine Angst hat, aber kürzlich etwas sah, das – auch wenn es nur im privaten Vorführraum seiner dementen Fantasie geschah – ihn so erschreckte, dass er es seit zwei Tagen nicht wagt, sich aus dem wirren Knäuel der klammen, schmuddeligen Bettwäsche zu befreien. Rückblickend weiß ich heute nicht mehr genau, was ihn dermaßen erschreckt hat. Auch wenn ich er bin oder einmal war, kann ich mich nicht an jenen spezifischen Albtraum erinnern, doch dem zufolge, was ich noch weiß, war der Mann auf dem Bett während der ganzen Zeit wach – allem Anschein nach wach und zugleich vollkommen davon überzeugt, dass das, was er sah, real war.
An diesem Moment in meiner Erinnerung ist der Mann trotz des Albtraums ruhig, nur ohne inneren Frieden. Er hat das Ende jeder möglichen Gedankenkette erreicht und ist daraufhin verstummt. Er wartet, mehr nicht. Wartet, resigniert, bereit aufzugeben. Die Albtraumvisionen sind verblasst, und jetzt halten ihn die Nachwehen umfangen. Er sieht aus dem Dunkel um sein Bett keine Dämonen und Tiere mehr aufflammen, spürt die Würmer nicht länger, die Löcher in sein Fleisch bohrten oder seine Haut mit dem Filigran des Verfalls zierten. Er hört niemanden mehr unten auf der Straße schreien, ein ferner Klang, dem er stundenlang angestrengt lauschte, obwohl er nichts sehnlicher wünschte, als dass er aufhörte. Jetzt sind er und die Welt endlich still, jetzt ist er erschöpft, wenn auch unfähig zu schlafen, unfähig, auch nur die Augen zu schließen. Er weiß, das Ende der Welt naht, doch trotz oder vielleicht gerade wegen seiner Erschöpfung, überrascht ihn die Einsicht, dass es ein langsames, gar sanftes Ende und nicht die Katastrophe sein wird, mit der er gerechnet hatte, kein après moi le déluge, nur ein allmähliches Dahinvegetieren – über Wochen, Monate, auch Jahre ein langsamer, körperlicher Verfall, bis nichts mehr übrig ist. Er weiß es, weil er es wie in einer Vision gesehen hat.
Heute, im Nachhinein, fällt es schwer zu verstehen, was diesem Moment vorausging oder welch eigenwillige Logik das Handeln jenes Menschen in den Stunden bestimmte, die zu seiner Selbstaufgabe führte. Ich glaube, als er das Projekt mit den Flaschen begann, wollte er einen Bann verhängen, der die Welt vor der Auflösung bewahrte; er wollte alles zusammenbinden, dafür sorgen, dass es hielt. Später dann, nachdem er sich mit der Unvermeidlichkeit der Katastrophe abgefunden hatte, begriff er wohl, dass das, was er getan hatte, keinen Schutz vor der kommenden Auflösung bot – die ihrer Bestimmung nach allumfassend sein würde –, sondern nur davor, sie mitansehen zu müssen. Er rechnete nämlich nicht mit jener gewaltsamen Apokalypse, wie sie auf Gemälden des neunzehnten Jahrhunderts dargestellt wird, eine Erde, die auf Gottes Befehl hin zerbirst, woraufhin die ganze Natur ins Leere stürzt; nein, er sieht ein langsames Verwesen, ein stilles, doch quälendes Vergehen ins Nichts. Ein Mann wacht auf und geht von Zimmer zu Zimmer, sucht nach den Kindern, die er am Abend zuvor ins Bett steckte, oder nach der Frau, die vielleicht nur duscht oder in der sonnenhellen Küche ein zeitiges Frühstück einnimmt. Kinogänger treten blinzelnd aus einer Matineevorstellung ins Tageslicht, und die Stadt, wie sie sie kannten, ist fast vollständig verschwunden, nur einige struppige Bäume und eine Straßenlaterne, ein paar verwehte Laken oder zerbrochenes Geschirr verraten, dass es sie einmal gegeben hat. Auf diese Weise endet die Welt, nicht mit einem Knall, sondern mit einem kaum wahrnehmbaren Wimmern – und eben das entsetzt ihn, nicht die Tatsache, dass alles enden wird, sondern dass der Zusammenbruch so allmählich vonstattengeht, erst hier, dann anderswo dies zerfällt, dann das, während die restliche Maschinerie weiterhin funktioniert. Die Welt war dem Untergang geweiht – das wusste er –, nur hatte er nicht mit der Grausamkeit eines lang hingezogenen Schreckens gerechnet, in dessen Verlauf sich die Opfer so lebhaft der Geschehnisse bewusst sein würden. Er hatte nicht geglaubt, sie würden einer nach dem anderen langsam und schmerzlich dahinsiechen, nicht bloß geistig und seelisch, sondern auch physisch: Fett, Muskeln und Knochen verrotten über Stunden oder auch Tage, bis am Ende nur noch ein letztes Aufheulen vor Schmerz, vor Wut und Schrecken jener zu hören ist, die übrig bleiben und wissen, dass es ihnen früher oder später gleichfalls bestimmt ist, den lang währenden, offenkundig sinnlosen Zerfall zu erdulden, einen Zerfall, der so vollständig sein wird, dass er nicht nur diese, sondern auch jede künftige Welt auslöscht. Das Jenseits. Und ich fürchte, das macht ihm am stärksten zu schaffen, jenem Menschen, der ich einmal war, dass nämlich wie alles andere auch das Jenseits nicht fortdauern wird, dass er nie das Licht eines neuen Tages erblickt, an dem die Toten darauf warten, uns wie Platzanweiser bei einer Hochzeit zu begrüßen, um uns zu den reservierten Plätzen zu führen, während der Organist sich setzt und die Gemeinde für alle Ewigkeit verstummt.
* * *
Nun traf es sich aber, dass die Welt nicht endete. Und dass mich jemand besuchen kam, war reiner Zufall – jemand, mit dem ich mich einige Tage zuvor noch gestritten hatte –, reiner Zufall war es auch, dass ein Bewohner des anonymen Miethauses an diesem Tag blaumachte. Das Wetter war schön, wenn ich mich recht erinnere: ein lauer, sonniger Vormittag mitten im ungewöhnlich warmen Frühling. Vielleicht war der pflichtvergessene Nachbar auch nur deshalb noch da, weil die Pubs noch nicht geöffnet hatten, als die unerwartete Besucherin an die Tür klopfte und er sie einließ. Sie war noch nie zuvor im Haus gewesen. Ich wollte nicht, dass die wenigen Freunde, die mir geblieben waren, mich in diesem schmierigen, halb verfallenen Labyrinth von Einzimmerwohnungen sahen, in dem es nach Imbiss und drei Tage alten Milchtüten stank, die man zum Versauern auf die oberen Fensterbänke gestellt hatte. Unter normalen Umständen hätte ich sogar verärgert reagiert, war aber nicht recht fähig, meine gewohnt griesgrämige Laune an den Tag zu legen oder eine Erklärung für meine Lage vorzubringen. Ich ließ folglich zu, dass sie mich einsammelte und fortbrachte. Das Zimmer habe ich nie wieder gesehen. Meine Freundin – eine rationale, ziemlich störrische, berufstätige Frau Mitte vierzig – rief andere Freunde an, die ich missbraucht und auf meinem Weg zurückgelassen hatte, und mit einer Großzügigkeit, über die ich noch heute staune, taten sie sich zusammen, um mich aus dem Loch zu ziehen, in das ich mich hineinmanövriert hatte. Vierzehn Tage später war ich bis auf Weiteres in einer sauberen, hellen Wohnung voll mit Büchern und Bildern untergebracht, saß am Fenster, blickte auf einen langgezogenen Vorstadtgarten mit Rosen und Apfelbäumen und schmiedete Pläne, die sich irgendwie um Surbiton drehten.
Surbiton - ein Kürzel für einen Ort, den es fast gibt, eine einfachere Welt aus Herbstblättern, Bussen und einem Haus in einer Seitenstraße, in dem ein Mann sauber und wahrhaftig leben kann – natürlich allein mit seinen Büchern, der Musik und nicht einmal einer siamesischen Katze zur Gesellschaft. Ich sah das Haus regelrecht vor mir, sah mich als dieser Mann – und an jenem warmen Nachmittag im Frühling, als ich am Fenster saß und in den Garten schaute, hatte ich plötzlich eine Vision vom Rest meines Lebens, eine überaus deutliche Vision: Ich würde zu einem dieser Einzelgänger werden, die überall in den Vorstädten und Marktflecken dieses Landes ihr Leben wie ein Uhrwerk lebten, ein von perfekter, banaler – will sagen normaler – Routine festgelegtes Dasein: aufstehen, zur Arbeit gehen, nach Hause kommen, ein Buch lesen, fernsehen, zu Bett gehen, aufstehen. Und jeden Tag würde ich es wieder genauso halten; am Samstag dann würde ich daheim bleiben, kochen und putzen, oder ich würde ins Kino gehen – nicht in dieses große Multiplex in der Hauptstraße, sondern in irgendein altes Flohkino in einem noch nicht gentrifizierten Viertel nahe des Bahnhofs, in ein altes Ritz oder Alhambra, das von einem schwulen Pärchen übernommen und renoviert wurde, um sonntagnachmittags sechs, sieben Stunden hintereinander Filme von Fassbinder oder Kurosawa zu zeigen, Marathonsessions der Werke unterschätzter Größen mit wenigen, bittersüßen Pausen für Tee und selbst gemachte Lebkuchen. Ich würde mein Leben in jenem gesteigerten Zustand führen, den Andy Warhol meint, wenn er seinen Lesern rät, jeden Tag dasselbe zu tun, auf genau dieselbe Weise und in derselben Reihenfolge. Selbst beim Essen würde ich mich wie Andy an die Routine halten. Und die ganze Zeit über wäre es mir bewusst, wenn ich von einem Zimmer ins andere gehe, eine Lampe anmache oder nach einem Holzlöffel greife, um die Suppe umzurühren, die ich mir auf dem Herd warm mache, Campbells Hühnersuppe zum Beispiel.