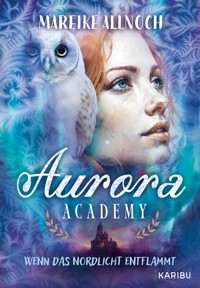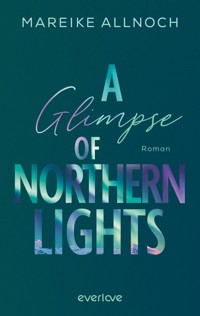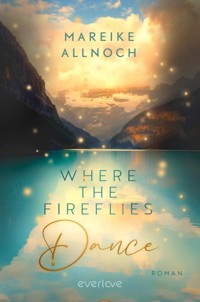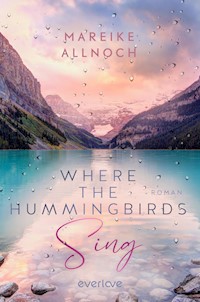
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine wildromantische Liebe vor der traumhaften Kulisse der kanadischen Rocky Mountains! Ein Jahr in einem Chalet-Resort nahe des traumhaften Lake Louise im Banff-Nationalpark arbeiten! Aufgeregt reist die 20-jährige Hamburgerin Lily nach Kanada. Sie ist begeisterte Fotografin, hat ihre Kamera stets dabei und hofft auf tolle Naturaufnahmen, insbesondere von Kolibris. Als sie auf den verschlossenen Ranger Ben trifft, fühlt sie sich sofort zu ihm hingezogen. Aber Ben hat mit seiner Vergangenheit zu kämpfen und Lilys Zeit in den Rocky Mountains ist begrenzt. Sie weiß, sie sollte sich besser nicht in den attraktiven Kanadier verlieben ... doch es ist längst um sie geschehen. Atmosphärisch, romantisch, mitreißend: Mareike Allnochs New-Adult-Dilogie mit Sehnsuchts-Setting Kanada und den Themen Naturschutz und Work-and-Travel ist die perfekte Lektüre für Leser:innen von Carina Schnell und Kira Mohn. Die Lake-Louise-Reihe: Band 1: Where the Hummingsbirds Sing Band 2: Where the Fireflies Dance
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Text bei Büchern mit inhaltsrelevanten Abbildungen und Alternativtexten:
Text bei Büchern mit inhaltsrelevanten Abbildungen ohne Alternativtexte:
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.everlove-verlag.de
Wenn dir dieser Roman gefallen hat, schreib uns unter Nennung des Titels »Where the Hummingbirds Sing« an [email protected], und wir empfehlen dir gerne vergleichbare Bücher.
© everlove, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2023
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Ben
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
Ben
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
Ben
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
Ben
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
Ben
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
Ben
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
Ben
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
Epilog
Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für meinen Bruder Jan.
Bobbele, ohne dich wäre die Lake-Louise-Reihe vielleicht nie in dieser Form entstanden. Ich hab dich lieb.
Prolog
Wassertropfen glitzerten auf seiner Haut und seinen langen Wimpern. Die Strahlen der Sonne ließen den Bergsee in türkisfarbenem Glanz erstrahlen.
Er blickte gedankenverloren ins Leere und bemerkte nicht einmal, wie ich meine Kamera auf ihn richtete und versuchte, diesen besonderen Moment einzufangen.
Meine Leidenschaft für das Fotografieren bekam ich bereits als kleines Kind von meinem Vater in die Wiege gelegt. Die Fotografie gab mir die Möglichkeit, flüchtige Ereignisse, die kaum länger anhielten als der Flügelschlag eines Kolibris, festzuhalten und zu etwas Kostbarem zu machen. Sie gab mir den Raum, Gefühle auszudrücken, die in diesem Augenblick lagen.
Mir gefiel der Gedanke, in die Rolle einer unsichtbaren Beobachterin zu schlüpfen. Für mich hatte die Entstehung eines Fotos etwas mit Magie zu tun, die sich nicht so einfach in Worte fassen ließ.
Mich interessierten Motive, die in der Regel übersehen wurden, unscheinbar wirkende Augenblicke. Zum Beispiel der Morgentau, der in einem Spinnennetz funkelte, oder die ersten Sonnenstrahlen, die sich in einer Pfütze brachen. Der Ausdruck eines Menschen, wenn er sich unbeobachtet fühlte und sich die Emotionen in seinem Gesicht widerspiegelten.
Echt und wahrhaftig.
Oftmals sagte ein Foto mehr als tausend Worte, Menschen dachten in Bildern.
Mein Vater erzählte mir immer wieder gerne die Geschichte, wie er als Hobbyfotograf meine Mutter auf einer Party kennengelernt und es wortwörtlich bei ihm klick gemacht hatte. Eine einzige Aufnahme, und es war um ihn geschehen.
Er hatte mal zu mir gesagt, dass man mit der Kamera die Macht besaß, in die Seele eines Menschen zu blicken. Seine Sorgen, seine Ängste, seine geheimen Sehnsüchte zu erkennen.
Als Kind hatte ich nicht verstanden, was er damit meinte.
Doch dann trat er in mein Leben.
Sein Bild brannte sich in meinem Gedächtnis fest und ließ mich nicht mehr los.
Ich sah seinen Schmerz, seine zerbrochene Seele. Und dennoch war da dieses Leuchten, das an die Oberfläche wollte und gegen die dunklen Schatten ankämpfte. Er war ein Bild aus tausend Nuancen.
Und vielleicht faszinierte er mich genau aus diesem Grund vom ersten Moment an: Er war perfekt unperfekt.
1. Kapitel
»Sicherheitshinweis! Lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt …«, hallte die Durchsage durch das Flughafenterminal. Ich hatte meinen Koffer bereits am Check-in-Schalter aufgegeben, und mein Blick schweifte zu der großen Anzeigetafel, auf der mein Flug angezeigt wurde.
Nervosität breitete sich in meinem Bauch aus. Ich schluckte schwer und drehte mich zu meinen Eltern und meinem jüngeren Bruder Flynn um. Es war an der Zeit, sich zu verabschieden. Und ich hasste fast nichts mehr als Abschiede.
Tränen schimmerten in den Augen meiner Mutter. Bei dem Anblick zog sich mein Herz schmerzhaft zusammen. Es war das erste Mal, dass ich für so lange Zeit von zu Hause fort sein würde. Von Hamburg, meiner Familie und meiner besten Freundin Rieke.
Leider hatte Rieke heute nicht mit zum Flughafen kommen können, da sie anlässlich der goldenen Hochzeit ihrer Großeltern mit der gesamten Familie in der Lüneburger Heide war.
Als hätte sie geahnt, dass ich an sie dachte, vibrierte mein Handy und zeigte eine eingegangene Nachricht an.
Ich öffnete unseren Chatverlauf bei Whatsapp. Rieke hatte ein Foto von uns beiden geschickt, auf dem wir wilde Grimassen zogen. Darunter stand:
Du fehlst mir jetzt schon. Hab einen guten Flug und melde dich, wenn du über den großen Teich bist. Ich hab dich lieb!
Gerührt schickte ich ihr ein großes Herz zurück, bevor ich das Handy wieder in meine Hosentasche schob.
Ich dachte an die Monate nach meinem Abitur zurück, in denen ich gejobbt hatte, um mir diesen Auslandsaufenthalt überhaupt finanzieren zu können. Immerzu hatte ich mir in den schillerndsten Farben ausgemalt, wie meine Reise nach Kanada wohl aussehen würde.
Doch jetzt, da ich inmitten meiner Familie am Flughafen stand, hatte ich gemischte Gefühle, die sich zwischen Vorfreude, Neugierde, Unsicherheit und Angst bewegten.
Mein Vater kam auf mich zu und drückte mich an sich. »Ich bin mir sicher, dass dieses Jahr ein ganz besonderes für dich wird, Lily!«
Als er mich nach einer Weile ein Stück von sich schob, lächelte er mir aufmunternd zu.
Auf der Wange meiner Mutter zeichneten sich verdächtige Mascara-Spuren ab.
»Ach, Mist«, schniefte sie. »Ich hatte mir fest vorgenommen, nicht zu weinen. Erst wenn du weg bist.«
»Sie ist doch nicht aus der Welt, Bille«, meinte mein Vater sanft und strich meiner Mutter, die mit vollem Namen Sybille hieß, beruhigend über den Arm. »Deine Tochter fliegt nach Kanada, nicht auf den Mond.«
»Aber es fühlt sich verdammt danach an«, entgegnete meine Mutter theatralisch und zog mich in eine feste Umarmung. »Du wirst uns fehlen.«
»Ihr werdet mir auch fehlen, Mama«, nuschelte ich mit erstickter Stimme.
»Warum musstest du dir denn auch ein Land aussuchen, in dem es Bären gibt? Hätte es nicht ein Ziel mit weniger gefährlichen Tieren sein können? Irland oder Schottland zum Beispiel? Schafe sind doch auch nett …«, überlegte meine Mutter laut.
»Nett ist die kleine Schwester von scheiße«, sagte mein Bruder Flynn plötzlich, und wir alle drei starrten ihn verblüfft an.
»Von wem hast du das denn?« Das Entsetzen stand meiner Mutter ins Gesicht geschrieben.
»Mein Freund Lasse hat das gesagt.«
Meine Mutter schüttelte fassungslos den Kopf. Ich ging in die Hocke und sah zu Flynn auf, seine blauen Kulleraugen blickten eindringlich auf mich.
»Pass mir gut auf Mama und Papa auf. Meinst du, du schaffst das?«
Flynn nickte. »Na klar, immerhin bin ich doch schon sechs Jahre alt«, antwortete er mit felsenfester Stimme.
»Ach, komm her, mein Wuschel.« Ich nahm Flynn so fest in den Arm, als wollte ich ihn nie wieder loslassen, und atmete den Duft seines Shampoos ein. Flynn roch nach seinem Lieblingsshampoo, einer Mischung aus Zitronen und Orangen. Und nach Zuhause.
Ich würde diesen Geruch vermissen. Mein Hals wurde eng.
»Wie wäre es noch mit einem Abschiedsfoto zur Erinnerung?«, schlug ich vor, rappelte mich auf und tastete nach meiner eisblauen Umhängetasche, in der sich meine gleichfarbige Polaroidkamera befand. Ich hatte sie damals als Geschenk zu meinem bestandenen Abitur bekommen, seitdem trug ich sie fast immer bei mir. Man konnte schließlich nie wissen, wann einem ein toller Schnappschuss ins Auge sprang.
»Au ja!«
Flynn hechtete mit einem begeisterten Aufschrei vor mich, meine Eltern stellten sich – einer links, einer rechts – neben mich.
Ich streckte die Kamera mit langem Arm von mir, damit auch die ganze Familie aufs Bild passte.
»Und lächeln, bitte!«
Die Polaroid surrte.
Flynn grinste auf dem Foto so breit, dass seine Zahnlücke zum Vorschein kam, meine Mutter hatte ihr Gesicht meinem Vater zugewandt, der wiederum mit seinen Fingern in der Luft herumfuchtelte, als würde er eine Fliege verscheuchen. Und ich? Ich glänzte vor lauter Aufregung wie eine Christbaumkugel am Weihnachtsabend.
Darf ich vorstellen: Familie Hartmann in Aktion!
Soweit ich mich erinnern konnte, hing in unserem Haus in Hamburg-Harburg kein einziges normales Familienfoto, irgendwer tanzte jedes Mal aus der Reihe. Aber was war schon normal?
Perfekt war noch nie ein Zustand gewesen, der mich beschrieb, und das war auch gut so.
Lächelnd und mit einem Anflug von Wehmut verstaute ich das Foto in meinem ausgefransten Portemonnaie und ließ die Polaroid wieder in der Umhängetasche verschwinden.
»Ich melde mich, sobald ich gelandet bin«, versprach ich und schulterte meinen Kamerarucksack, der Platz für meine Spiegelreflex, meine Objektive und meinen Laptop bot. An der Seite befand sich eine Halterung für ein Stativ.
Als ich mich in die Schlange für die Sicherheitskontrolle einreihte, sah ich mich ein letztes Mal nach meiner Familie um.
Mama, Papa und Flynn standen Arm in Arm in der Abflughalle und winkten mir zu.
Mit feuchten Augen hob ich die Hand zum Abschied.
2. Kapitel
Ich fühlte mich wie gerädert, als ich nach einem vierzehnstündigen Flug einschließlich eines Umstieges in Amsterdam endlich in Calgary landete. Mir war kalt, ich war übermüdet, und vermutlich hatte ich mit meinen zerzausten Haaren mehr Ähnlichkeit mit einer Vogelscheuche als mit einem menschlichen Wesen. Den ganzen Flug über hatte ich kein Auge zugetan, da der ältere Herr neben mir so laut und noch dazu mit offenem Mund geschnarcht hatte, dass das halbe Flugzeug bestens unterhalten worden war. Weder mein Ohropax noch die kraftvollen Songs von Pink, die mit voller Lautstärke aus meinen Kopfhörern schallten, hatten dagegen ankämpfen können.
Und – war das etwa Sabber auf meinem Pullover? Ich wollte mir lieber nicht ausmalen, von wem dieser stammte. Angeekelt verzog ich den Mund, beschloss jedoch, mich von solchen Kleinigkeiten nicht runterziehen zu lassen. Selbst dann nicht, als mein Koffer der letzte war, der mutterseelenallein seine Runde auf dem quietschenden Gepäckband drehte.
Suchend sah ich mich in der großen Ankunftshalle um, zahlreiche Menschen strömten an mir vorbei, und irgendjemand rempelte mich unsanft an.
Aber von Nell, der Tochter der Browns, fehlte jede Spur.
Ich war vor einem halben Jahr durch eine Internetanzeige der Familie Brown zufällig auf das Lake Louise Chalet Resort inmitten des Banff-Nationalparks gestoßen, für das eine Stelle als »Chalet Girl« ausgeschrieben war. Trotz meiner anfänglichen Zweifel, ob es nicht ratsamer wäre, meinen Auslandsaufenthalt mit einer Organisation im Rücken zu planen, hatte ich mich letztendlich dagegen entschieden und mich stattdessen auf eigene Faust bei besagtem Chalet Resort beworben. Alles, was ich im Internet über die Hotelanlage und Lake Louise fand, hatte mich begeistert.
Ich kannte Nell und ihren Bruder Luke, die beide etwa in meinem Alter waren, von meinen Bewerbungsgesprächen über Skype. Die Geschwister machten von Beginn an einen sympathischen Eindruck. Mr und Mrs Brown hatte ich bisher nur auf Fotos gesehen.
Ich verglich das Familienporträt der Browns auf meinem Handy mit den Menschen um mich herum, allerdings ähnelte kein Gesicht auch nur ansatzweise dem von Nell. Dabei hatte sie mir noch vor wenigen Tagen geschrieben, dass sie mich abholen würde.
Ob sie mich vergessen hatte? Oder hatte sie sich möglicherweise eine falsche Ankunftszeit notiert? Eher unwahrscheinlich.
Ich grübelte. Die anfängliche Vorfreude, die mich bis eben noch nervös mit den Füßen hatte auf- und abwippen lassen, wich einem Gefühl von Anspannung. So hatte ich mir den Start in mein persönliches Kanadaabenteuer nicht vorgestellt. Ein ungutes Grummeln breitete sich in meinem Magen aus.
Zur Beruhigung (und um mich wach zu halten) holte ich mir bei Starbucks einen Caramel Frappuccino, setzte mich mit dem Becher in der Hand auf meinen Koffer und wartete.
Währenddessen schrieb ich in unsere Familien-Whatsapp-Gruppe, die den äußerst kreativen Namen »We are Family« trug, dass ich gut in Calgary gelandet war. Die Info, dass ich immer noch darauf wartete, abgeholt zu werden, verkniff ich mir, da meine Mutter sich nur Sorgen gemacht hätte.
Rieke schickte ich ebenfalls eine kurze Message, bevor ich mein Handy wieder in meine Hosentasche gleiten ließ.
Nell war nach wie vor nirgends zu sehen. Mit meinem Frappuccino in der Hand ging ich mehrere Male in der großen Halle auf und ab, checkte immer wieder mein Telefon und blickte mich suchend um. Andere Passagiere eilten an mir vorbei Richtung Ausgang. Nur ich wusste nicht, wohin mit mir.
Nach einer halben Ewigkeit blieb ein Mann neben mir stehen und fragte, ob er mir weiterhelfen könne. Ich rang mir ein möglichst überzeugendes Lächeln ab, schüttelte den Kopf und bedankte mich.
Vermutlich sah ich genauso verloren aus, wie ich mich gerade fühlte. Abermals zog ich mein Handy nervös aus meiner Jeanshose und tippte auf das Display, der Bildschirm leuchtete hell auf. Leider hatte ich weder einen verpassten Anruf noch eine ungelesene Nachricht. Von meinen Eltern und Rieke kam auch kein Lebenszeichen.
Ein Pling ließ mich hoffnungsvoll aufblicken, aber es war lediglich mein Telefonanbieter, der mir mitteilte, dass ich mich nun in Kanada befand. Vielen Dank für den Hinweis, Blitzmerker.
Ich seufzte und blickte auf meine Armbanduhr. Mittlerweile waren anderthalb Stunden seit meiner Landung vergangen.
Ganz ruhig bleiben, Lily, redete ich mir gut zu. Bestimmt handelte es sich nur um ein Missverständnis, das sich schnell aufklären ließ. Ich scrollte durch das Adressbuch in meinem Handy, suchte Nells Kontakt und wählte die entsprechende Nummer.
Mit meinen Fingerspitzen trommelte ich ungeduldig gegen den Kaffeebecher, bis auf ein Tuten tat sich am anderen Ende der Leitung allerdings nichts.
Eine Möglichkeit hatte ich noch.
Ich rief in Google die Homepage des Lake Louise Chalet Resorts auf. Kurz zögerte ich, dann wählte ich die auf der Seite angegebene Telefonnummer.
Das Leerzeichen ertönte, aber auch dort hob niemand ab. Frustriert ließ ich das Handy in meiner Hand sinken. Das konnte doch alles nicht wahr sein!
Was machte ich denn jetzt bloß?
Ich kaute nachdenklich auf meiner Unterlippe. Ich würde hier gewiss keine weitere Minute Däumchen drehen! Entschlossen schulterte ich meinen Rucksack, tastete nach meiner Umhängetasche mit der Polaroid und pfefferte meinen leeren Kaffeebecher in einen der Mülleimer. Dann straffte ich meinen Rücken, schnappte meinen Koffer und ging damit Richtung Ausgang.
3. Kapitel
Ein angenehm sommerlicher Juniwind blies mir entgegen, als ich ins Freie trat. Ich blieb stehen, schloss die Augen und reckte mein Gesicht der Sonne entgegen, deren Strahlen wärmend über meine Haut tanzten.
»Lily?«
»Ja?« Ich blinzelte verwirrt und drehte mich um – und sah in zwei grüne Augen, die mich an einen schimmernden Bergsee erinnerten. Dieses Grün war von einer solchen Intensität, dass mir der Atem stockte. Dunkelblondes, wuscheliges Haar umrahmte sein markantes Gesicht, in dem sich feine Bartstoppeln abzeichneten, und ich ertappte mich selbst dabei, wie ich den Typen vor mir ein paar Sekunden länger als nötig musterte. Als ich mir dessen bewusst wurde, stieg mir augenblicklich die Hitze in die Wangen.
Ich räusperte mich verlegen.
»Ben Montgomery«, antwortete mein Gegenüber kurz angebunden. »Ich hatte ohnehin in Calgary zu tun, da haben mich die Browns gebeten, dich abzuholen. Im Resort sind alle Hände voll zu tun, sodass sie es selbst nicht geschafft hätten, rechtzeitig hier zu sein.«
Ich verkniff mir den Kommentar, dass auch bei ihm von rechtzeitig wohl kaum die Rede sein konnte, wenn man bedachte, dass ich bereits seit zwei Stunden am Flughafen wartete. Aber mit einer Entschuldigung brauchte ich wohl gar nicht erst zu rechnen.
Letztendlich siegte meine Erleichterung darüber, mich nicht allein zum Lake Louise Chalet Resort durchschlagen zu müssen. Daher sah ich ausnahmsweise über Bens Zuspätkommen hinweg.
»Wie hast du mich erkannt?«, fragte ich irritiert.
Ben deutete wortlos auf meinen meerblauen Koffer mit der Aufschrift »Ahoi Hamburg«, darunter befand sich ein Anker. Offensichtlicher hätte ich die Liebe zu meiner Heimatstadt nun wirklich nicht präsentieren können.
Ob ich dem Typen trauen konnte? Einen besonders gefährlichen Eindruck machte er nicht auf mich.
Fahr nie mit Fremden mit. Lass dich nicht von anderen Leuten anquatschen. Hör immer auf dein Bauchgefühl, hatte ich prompt die warnende Stimme meiner Mutter im Kopf. Schnell brachte ich sie zum Schweigen.
»Was ist, kommst du? Ich stehe im Halteverbot«, drängelte Ben und wirkte genervt, unruhig trat er von einem Fuß auf den anderen. Bevor ich überhaupt die Chance hatte, etwas zu erwidern, hatte er sich bereits in Bewegung gesetzt.
Da mir wohl oder übel keine andere Wahl blieb und ich mir kein unverschämt teures Taxi bestellen wollte, folgte ich Ben seufzend.
Ich beschloss, dass ein Axtmörder oder ein Entführer sicherlich nicht solch verboten schöne Augen haben konnte, und beruhigte mich selbst mit diesem Gedanken. Meine letzten Zweifel warf ich in dem Moment über Bord, als ich sah, dass Nell mir geschrieben hatte.
Hey, Lily, leider schaffe ich es nicht, zum Flughafen zu kommen. Ben wird dich abholen. Und lass dich von seinem mürrischen Gehabe nicht einschüchtern, der ist harmlos. ;) Wir sehen uns später, ich freu mich auf dich!
Nell
Ob sie in einem Funkloch gesteckt hatte, weshalb die Nachricht erst jetzt ankam? Na ja, was soll’s, immerhin wusste ich nun, dass Ben weder ein Axtmörder noch ein Entführer war.
Schmunzelnd steckte ich mein Handy weg, während mein Blick auf Bens breiten Rücken fiel.
Er verlangsamte seine Schritte schließlich vor einem olivfarbenen Pick-up, der definitiv schon bessere Zeiten gesehen hatte. Die Räder waren schlammverkrustet, und über den Lack zogen sich einige Schrammen.
Ben nahm mir meinen Koffer ab und hievte ihn auf die offene Ladefläche des Pick-ups. Ich betete, dass mein Gepäck die Fahrt überstehen würde.
Nachdem wir beide im Wageninneren Platz genommen hatten, ließen wir den Flughafen und das geschäftige Treiben langsam hinter uns.
Schweigend saßen wir nebeneinander im Auto, Bens Blick war konzentriert auf den Straßenverkehr gerichtet. Sehr gesprächig schien er nicht zu sein.
Ich betrachtete ihn möglichst unauffällig aus dem Augenwinkel.
Er trug ein kariertes Hemd, unter dem sich ein durchtrainierter Oberkörper erahnen ließ. Mein Blick fiel auf seine Hände. Sie waren kräftig und noch dazu gepflegt, die Venen traten ausgeprägt hervor. Seine Haut war sonnengebräunt, was vermuten ließ, dass er viel Zeit im Freien verbrachte. Er hatte wirklich schöne Hände.
In Bens Nähe hatte ich plötzlich das Gefühl, dass sich meine gesamten Englischkenntnisse der letzten Schuljahre auf ein Minimum reduziert hatten, denn die Worte, die sich in meinem Kopf formten, rollten mir diesmal nicht so mühelos über die Lippen wie sonst. Dabei fielen mir Fremdsprachen leicht, Französisch und Englisch hatten zu meinen Lieblingsfächern gezählt.
»Und du kommst auch aus Lake Louise?«, fragte ich wenig originell, um die unangenehme Stille zwischen uns zu überbrücken. Gedanklich verpasste ich mir einen Schlag gegen die Stirn. Hätte mir nicht etwas Geistreicheres einfallen können?
»Hmm«, machte Ben lediglich, keine Regung war in seinem Gesicht festzustellen.
Ich durchforstete mein Gehirn krampfhaft nach einem unverfänglichen Gesprächsthema, fand aber keines. Alles klang wie gezwungener Small Talk.
Normalerweise hatte ich keine Schwierigkeiten, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen, leider erwies sich Ben als besonders harte Nuss. Nicht mal ein winziges Lächeln umspielte seine Lippen.
»Und du bist ein Freund der Browns?«, hakte ich nach.
»So in der Art.«
Ich versuchte es noch ein paarmal, doch ich musste Ben jedes Wort förmlich aus der Nase ziehen.
Irgendwann gab ich auf. Es war offensichtlich, dass er nicht in Plauderlaune war. Genauso gut hätte ich mich auch mit einem Stein unterhalten können.
Als wollte er weiteren Fragen aus dem Weg gehen, drehte Ben zu allem Überfluss auch noch das Radio auf, und zwar in einer solchen Lautstärke, dass sich jede weitere Unterhaltung erübrigt hatte.
Alles klar, schon verstanden.
Eigentlich hätte er mir genauso gut ins Gesicht schreien können: »Ich hab keinen Bock auf dich!«
Mir egal, versuchte ich mir einzureden, auch wenn es an meinem Ego kratzte, dass Ben mir die kalte Schulter zeigte. Hatte ich ihm irgendetwas getan? Erst ließ er mich stundenlang am Flughafen sitzen, und jetzt besaß er nicht einmal den Anstand, Konversation zu betreiben? Meine Güte, ich hatte ihn doch nicht gefragt, ob er mich heiraten wollte!
Er hätte wenigstens aus Höflichkeit so tun können, als fände er mich nicht vollkommen uninteressant!
Wir fuhren aus Calgary hinaus, den Trans-Canada Highway entlang, und die Hochhäuser, die soeben noch das Landschaftsbild geprägt hatten, verschwanden aus meinem Sichtfeld. Stattdessen säumten dichte Wälder den Wegesrand, und ich erblickte die ersten glitzernden, schneebedeckten Berge. Die Rocky Mountains!
Ich lehnte meinen Kopf aus dem offenen Fenster und genoss den Fahrtwind in meinen Haaren.
»Wow, ist das schön!«, platzte es aus mir heraus. In echt sahen die Rocky Mountains noch viel imposanter aus als auf Fotos.
Ich wollte das Wasser und die salzige Elbluft in Hamburg keinesfalls missen, trotz allem hatten Berge schon immer eine ungemeine Anziehungskraft auf mich ausgeübt. Für mich verkörperten die wilden Gipfel ein Gefühl von grenzenloser Freiheit.
Bei dem Panorama, das sich mir bot, hätte ich am liebsten sofort meine Spiegelreflexkamera aus den Tiefen meines Rucksacks befördert und wild drauflosgeknipst. Eigentlich fand man mich immer mit einer Kamera vor, sei es nun mit meiner Spiegelreflex, meiner Polaroid oder zur allergrößten Not auch meiner Handykamera. Die Spiegelreflex hatte ich mir im Alter von siebzehn Jahren endlich von meinem lang ersparten Taschengeld kaufen können, und sie war seitdem zu einer treuen Begleiterin geworden.
Verträumt blickte ich in die Landschaft und konnte mich an der Postkartenidylle gar nicht sattsehen.
Kurz hinter Banff bog Ben auf eine Straße ab, die vom Trans-Canada Highway abzweigte und weniger befahren war. Im Gegensatz zum Highway war diese Straße nicht eingezäunt.
Ein massives Holzschild, das einen Grizzlybären zeigte, zog an mir vorbei und verriet mir, dass wir uns inzwischen auf dem Bow Valley Parkway befanden, an dem sich parallel ein türkis schimmernder Fluss, der Bow River, entlangschlängelte. Das wusste ich nur, weil ich mir in den letzten Tagen vor meiner Abreise die Umgebung genauestens auf Google Maps angesehen und eingeprägt hatte. Vielleicht hätte ich jedoch mehr Zeit damit verbringen sollen, zu googeln, mit welchen Tricks man einen mürrischen Kanadier zum Reden brachte. Das hätte mir immerhin eine schweigsame Autofahrt erspart.
Die Straße folgte dem Verlauf des Flusses und führte uns durch eine Tallandschaft. Zahlreiche Picknickplätze luden dazu ein, eine Rast zu machen und die eindrucksvolle Naturkulisse auf sich wirken zu lassen.
An den Ausgangspunkten von Wanderwegen waren Informationstafeln angebracht, die die Besonderheiten von Flora und Fauna dieser Bergregion erläuterten.
Hinter jeder Kurve, die die Straße vollführte, wartete eine neue landschaftliche Attraktion, und ich hätte nicht wenig Lust gehabt, anzuhalten, um ein paar Fotos zu machen.
Ich konnte es kaum erwarten, in den kommenden Wochen und Monaten inmitten der Rockies die unberührte Natur zu erkunden. Es wunderte mich nicht, dass Kanada für viele Menschen das Land der Hoffnung und der Freiheit war. Für mich war es der Beginn eines großen Abenteuers.
Ich erschrak mich beinahe zu Tode, als plötzlich wenige Meter vor uns von rechts ein Tier aus dem dichten Geäst brach und über die Fahrbahn preschte.
Ben trat das Bremspedal durch, die Reifen quietschten, und mein Kopf flog nach vorne.
Ich hörte, wie mein Koffer auf der Ladefläche mit voller Wucht gegen die Fahrerkabine krachte. Na toll …
Wenigstens war ich geistesgegenwärtig genug gewesen, den Kamerarucksack und die Umhängetasche auf meinem Schoß festzuhalten.
Mit laut klopfendem Herzen starrte ich dem Tier hinterher, das hocherhobenen Hauptes und mit mächtigem Geweih über den Asphalt stolzierte und einen Augenblick später auf der anderen Seite im Schutz der Bäume verschwunden war.
»Was war das?«
»Elk« war der englische Begriff, den Ben mir schließlich um die Ohren schleuderte. Es dauerte einen Moment, bis mir wieder einfiel, dass der Begriff »elk« keinesfalls einen Elch meinte (das wäre »moose« gewesen), sondern einen Wapiti, eine Hirschart, die in Kanada beheimatet war.
Wie gut, dass ich vor meinem Abflug noch mal ein paar englische Vokabeln durchgegangen war.
»Pass auf, dass du nicht zu redselig wirst«, spottete ich, worauf Ben – wie erwartet – nicht einging.
Ich drehte mich zu ihm um und war überrascht, dass er mich eindringlich musterte. War da etwa der Anflug eines Lächelns auf seinen Lippen zu erkennen? Seine Mundwinkel zuckten, gleich darauf war davon nichts mehr zu sehen. Stattdessen richtete Ben seinen Blick wieder nach vorne.
Zu meinem eigenen Erschrecken bahnte sich jedoch ein viel größeres Problem als Bens beharrliches Schweigen an, denn meine Blase meldete sich zu Wort. Und die vielen Schlaglöcher, über die der Pick-up regelmäßig rumpelte, machten es keinesfalls besser. Wieso hatte ich bloß einen großen Caramel Frappuccino getrunken?
So ein Mist!
Unruhig rutschte ich auf meinem Sitz hin und her. »Wie weit ist es noch bis nach Lake Louise?«, fragte ich.
Ben schaltete das Radio ab. »Etwa fünfzig Kilometer«, antwortete er, ohne seine Augen von der Straße zu nehmen.
Fünfzig Kilometer?! Meine Blase würde keinen einzigen mehr aushalten. Wenn Ben nicht gleich eine Raststätte ansteuerte, dann konnte ich für nichts mehr garantieren.
»Kommt bald eine Tankstelle?«
Er schüttelte den Kopf und verzog keine Miene. »Wir sind mitten in der Wildnis, hier kommt erst einmal weit und breit nichts.«
O Gott!
»Ich … ähm … ich müsste mal auf die Toilette«, stotterte ich verlegen.
Ben sagte nichts, sondern brachte den Wagen nach wenigen Metern am Fahrbahnrand zum Stehen und deutete auf den dichten Wald vor uns.
»Du hast die Wahl: Entweder du hältst bis Lake Louise durch, was in etwa noch eine knappe Stunde dauern wird, oder du nimmst mit der Natur Kanadas vorlieb.«
Den hochgezogenen Augenbrauen nach zu urteilen, rechnete er vermutlich damit, dass eine Großstadtpflanze aus Hamburg sich zu fein dafür wäre, aber da kannte er mich schlecht.
Herausfordernd funkelte ich ihn an, stieg aus und schlug die Autotür geräuschvoll hinter mir zu. Dann stützte ich mich mit meinen Armen auf dem Fensterrand ab.
»Denk nicht mal daran, zu gucken.«
Ben lachte höhnisch. »Wovon träumst du nachts?«
Ich tat so, als hätte ich seinen Kommentar überhört.
»Ach, und pass auf, wo du hinläufst. Hier in der Gegend gibt es Schwarzbären und Grizzlys. Ganz besonders am Bow Valley Parkway.«
Bären?!
Panisch ließ ich meinen Blick von links nach rechts schnellen. Zuerst war ich schon gewillt, mich wieder ins Auto zu setzen, doch dann riss ich mich zusammen.
Ben wollte mich nur verunsichern, und den Gefallen, mich von seinem Gerede beeindrucken zu lassen, würde ich ihm bestimmt nicht tun.
4. Kapitel
Mit meiner Polaroidumhängetasche über der Schulter schlug ich zielstrebig und mit selbstbewussten Schritten einen schmalen Trampelpfad ein, der den Anschein erweckte, als würde er lediglich von Wildtieren und nicht von Wanderern genutzt werden. Dichtes, meterhohes Gras wuchs am Wegesrand, und ich hatte Mühe, mich durch das Gestrüpp zu kämpfen.
Obwohl ich mich nicht ein einziges Mal umschaute, spürte ich Bens Blicke nur allzu deutlich auf mir, und ein Schauer jagte meinen Rücken hinab. Dieser Typ hatte etwas an sich, was mich völlig aus der Fassung brachte.
Ich lief tiefer in den Wald hinein, der überwiegend aus verschiedenen Nadelbäumen bestand. Sonnenstrahlen brachen durch die Kronen vereinzelter Laubbäume hindurch und ließen den Wald in allen erdenklichen Farben strahlen. Das helle Licht tauchte die Blätter in ein sattes Grün.
Nachdem ich meine Blase erleichtert hatte und meine Hose wieder hochzog, vernahm ich das Knacken von Ästen hinter mir. Wie in Zeitlupe drehte ich mich um – und mich traf fast der Schlag.
Keine zehn Meter von mir entfernt stand ein Elchbulle, dessen gigantisches Geweih äußerst angsteinflößend aussah. Ich unterdrückte den Schrei, der panisch aus meiner Kehle brechen wollte. Wie erstarrt stand ich da und rührte mich keinen Millimeter von der Stelle. Meine Augen hafteten an dem großen Tier vor mir.
Okay, jetzt nur die Ruhe bewahren, redete ich mir gut zu. Bloß keine falsche Bewegung machen.
Hatte ich nicht erst letztens in einem Fernsehbericht gehört, dass Elche mitunter sehr aggressiv werden konnten?
Bisher hatte das Tier mich jedoch nicht bemerkt. Es kaute genüsslich auf einem Zweig herum und vergrub sein Maul in den Ästen.
Nachdem ich meine ersten Schocksekunden überwunden hatte, ging ich langsam in die Hocke und beobachtete den Elch aufmerksam. Auch wenn ich nach wie vor einen Heidenrespekt hatte (insbesondere vor den riesigen Schaufeln!), schien keine Gefahr von dem Tier auszugehen. Meine Faszination siegte gegenüber der Angst.
Ich konnte es nicht glauben, dass ich mich direkt an meinem ersten Tag in Kanada Auge in Auge mit einem Elch wiederfand. Einem Elch! Mein Vater würde vor Neid erblassen, wenn ich ihm das erzählte. Vorausgesetzt, der Elch würde nicht noch Müsli aus mir machen.
Mein Puls beruhigte sich langsam wieder, und ich studierte die Bewegungen des Tieres. Seine kräftigen Ohren wackelten munter, und seine Schmolllippen erweckten den Anschein, als würde es lächeln.
Was für ein stolzes Wesen!
Plötzlich ärgerte es mich, dass ich meine Spiegelreflexkamera nicht griffbereit hatte, da diese in meinem Rucksack auf dem Beifahrersitz von Bens Pick-up lag. Dann musste halt meine Polaroid herhalten.
Möglichst leise zog ich die handliche Sofortbildkamera aus der Tasche und blickte durch den Sucher. Lustigerweise sah der Elch genau in dem Augenblick in die Linse, als ich abdrückte. Das mir so vertraute Rattern ertönte, und kurz darauf betrachtete ich zufrieden den Schnappschuss mit dem unverwechselbar weißen Rand in meiner Hand. Beinahe anmutig reckte der Elch seinen Hals in die Höhe.
»Lily?«, wehte plötzlich Bens Stimme zu mir herüber. Wahrscheinlich fragte er sich schon, ob ich im Wald verloren gegangen war. Oder ob es ein Bär auf mich abgesehen hatte.
Da ich den Elch nicht beunruhigen oder gar verscheuchen wollte, verharrte ich schweigend in meiner Position und gab keinen Laut von mir.
»Lily?« Mittlerweile war Ben sehr nah. Als er mich im Gebüsch hocken sah, runzelte er die Stirn. »Ist alles in Ordnung? Hast du den Mount Everest überquert, oder wieso hat das so lange gedauert?«
Ich hielt den Zeigefinger an meine Lippen, um ihm zu signalisieren, dass er leise sein sollte, und deutete auf den Elch. Ben folgte meinem Blick und hielt abrupt inne.
Ein überraschtes »Oh« rollte über seine Lippen, bevor er sich wieder zu mir umdrehte.
»Mach kleine Schritte und entferne dich langsam von dem Tier. Es wird dir nichts tun, vertrau mir.«
Hä? Es dauerte einen Moment, bis die Bedeutung von Bens Worten richtig bei mir ankam. Dachte er etwa, ich hätte mich hier versteckt und er müsste mich jetzt beschützen? Leider hatte ich nicht die Gelegenheit, dies richtigzustellen, da Ben unerwartet nach meiner Hand griff, mich sanft, aber bestimmt von dem Elch wegdirigierte und dabei das Tier wachsam im Auge behielt. Es verschwand schließlich vollständig aus meinem Blickfeld, und Ben machte erst halt, als wir wieder Asphalt unter unseren Füßen hatten und am Auto angekommen waren.
Dabei stellte ich fest, dass wir den ganzen Weg über Händchen gehalten hatten. Als Ben mich losließ, war ich fast enttäuscht.
»Elche sind eigentlich harmlose Tiere, du musst lediglich auf die richtigen Zeichen achten«, erklärte Ben. »Sie greifen in der Regel nur an, wenn sie erschrocken sind oder sich in die Enge getrieben fühlen. Das kannst du meist an unruhigem Hufscharren, Kopfschütteln oder Schnauben ausmachen. Und bei Bullen in der Brunftzeit und Müttern mit ihren Kälbern ist Vorsicht geboten.«
»Ich hatte keine Angst vor dem Elch, falls du das denkst«, antwortete ich, ohne mit der Wimper zu zucken, und verschwieg dabei, dass mir das Tier zunächst einen ordentlichen Schreck eingejagt hatte. Das musste ich Ben nun wirklich nicht auf die Nase binden. Zumal ich das Gefühl nicht loswurde, dass er mich spätestens seit meiner Frage nach einer Tankstelle mitten in der Pampa als ein verwöhntes Stadtkind abgestempelt hatte, und in diesem Glauben wollte ich ihn auf keinen Fall lassen.
»Und deshalb hast du dich die ganze Zeit über im Gebüsch verschanzt und nicht einmal auf mein Rufen reagiert?«, konterte Ben.
»Ich wollte das Tier noch eine Weile beobachten. Immerhin bekommt man einen Elch nicht alle Tage zu Gesicht. In Hamburg laufen die jedenfalls nicht rum.«
Ben starrte mich an. »Du wolltest den Elch beobachten?«, wiederholte er meine Worte langsam und betonte dabei jede Silbe so deutlich, als wäre ich nicht ganz bei Trost. »Aus einer Distanz von gerade mal fünf Metern?«
Angesichts Bens fassungslosem Unterton kamen mir nun doch Zweifel. Vielleicht hatte ich die potenzielle Gefahr in der Situation wirklich unterschätzt und mich von dem harmlosen Aussehen des Elchs täuschen lassen?
»Jeder halbwegs vernünftige Mensch hätte das Weite gesucht«, sagte Ben mit Nachdruck.
Ich zuckte mit den Schultern und funkelte Ben herausfordernd an. »Ich bin aber nicht jeder.«
»Das nächste Mal reicht auch ein einfaches Danke. Immerhin habe ich dir eben aus der Klemme geholfen«, entgegnete Ben schnippisch.
Ich lächelte ihn zuckersüß an. »Danke, lieber Ben. Bei dir reicht das nächste Mal auch eine einfache Entschuldigung, wenn du mal wieder zwei Stunden zu spät kommst.«
Das schien ihm tatsächlich den Wind aus den Segeln zu nehmen, und ich weidete mich an seinem perplexen Gesichtsausdruck. Er brummelte irgendwas Unverständliches in seinen Dreitagebart hinein, was man mit viel Wohlwollen als ein »Sorry« interpretieren konnte.
Ben deutete auf die Polaroid. »Und was hat es mit der Kamera auf sich? Bist du damit tatsächlich pinkeln gewesen?«
»Man weiß nie, was einen an der nächsten Ecke erwartet, und dort verbergen sich oft die besten Fotomotive – wie man sieht«, rechtfertigte ich mich und hielt ihm das Elch-Foto unter die Nase, das ich schließlich samt der Sofortbildkamera wieder in der dazugehörigen Umhängetasche verstaute.
Ben schüttelte verwundert den Kopf. »Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal jemanden mit so einem Retroteil durch den Wald habe stapfen sehen. Die meisten Touristen achten nicht auf ihre Umgebung, sondern interessieren sich nur für ihr Smartphone, mit dem sie alles dokumentieren müssen.« Seine Stimme war voller Verachtung.
»Ich mag Augenblicke, die wahrhaftig sind.« Ich lächelte. »Und Polaroids haben für mich eine besondere Magie.«
»Magie?« Ben zog die Nase kraus, was süß aussah. »Jemand wie du ist mir echt noch nicht untergekommen.«
War das jetzt ein Kompliment oder eine Beleidigung?
»Tja, wie bereits gesagt: Ich bin nicht jeder. Ich bin ein Einzelstück – wie ein Polaroid.« Ich grinste amüsiert, was Ben vollends aus dem Konzept zu bringen schien.
»Was ist?«
»Das war das erste Mal, dass du mehr als nur ein paar Worte mit mir gewechselt hast.« Mein Lächeln wurde noch ein bisschen breiter.
Bens grüne Augen funkelten im Licht der Sonne wie Smaragde, goldene Sprenkel tanzten um seine Pupillen. Sein Haar leuchtete honigfarben.
Für einige Zeit sahen wir uns schweigend an. Die Vögel zwitscherten melodisch in den Fichten und Kiefern, und der Wind fuhr mir sanft durch das Haar. Ich strich mir eine Strähne aus der Stirn.
Plötzlich wurde Bens Gesicht wieder starr wie eine Maske. Lediglich in seinen Augen blitzte etwas auf, das mich erschreckte. Etwas Dunkles, das ich nicht recht deuten konnte. Es kam mir so vor, als hätte sich ein Schatten über seine Seele gelegt.
»Wir sollten weiter, die Browns fragen sich sicher schon, wo du bleibst«, entschied Ben, seine Stimme hatte wieder diesen kühlen Unterton angenommen.
Der Rest der Fahrt verlief schweigend, keiner von uns beiden sagte noch ein Wort. Ich beobachtete Ben aus dem Augenwinkel. Seine Gesichtszüge wirkten hart, und seine Kiefermuskeln arbeiteten so stark, dass ich befürchtete, gleich das Geräusch von knackenden Knochen zu vernehmen.
Hatte ich etwas falsch gemacht? Aber was?
Ich konnte mir Bens distanziertes Verhalten und seinen abrupten Stimmungswechsel nicht erklären.
5. Kapitel
Ben
Es war eigentlich nicht meine Art, mich wie ein Arschloch zu verhalten. Und Lily hatte mir nichts getan.
Doch eben, als ich in ihr Gesicht geblickt hatte, war es, als stünde Morgan wieder vor mir. Es war dieses Lächeln, das mich vollkommen aus dem Takt brachte. Der Wind, der sanft durch ihr Haar gestrichen war.
Dieser Moment hatte mich an vergangene Zeiten erinnert. An eine Zeit, in der auch ich einmal Freude und Glück verspürt hatte.
An manchen Tagen fühlte ich mich nur noch wie eine leere Hülle. Der Ben Montgomery, den es einst gegeben hatte, war schon lange fort. Wenn ich morgens in den Spiegel schaute, dann war mir die Person darin fremd.
Es machte mich unfassbar wütend, dass Morgan noch immer diese Kontrolle über mich hatte. Dass sie nach all der Zeit nach wie vor meine Gedanken und Gefühle in Beschlag nahm und dass ich zuließ, mich davon in einen endlosen Sturm ziehen zu lassen.
Ich krallte meine Hände um das Lenkrad, als könnte ich die ungezügelten Emotionen in meinem Inneren dadurch zähmen. Doch während ich versuchte, mich auf die Fahrbahn vor mir zu konzentrieren, spürte ich, wie mein Blick immer wieder zu Lily wanderte.
Sie war hübsch auf eine natürliche Art. Mit geradezu kindlicher Begeisterung starrte sie aus dem Fenster und betrachtete die vorbeiziehende Natur. Dabei umspielte ein leichtes Lächeln ihre Mundwinkel, während sie ihre Polaroidkamera fest im Griff hatte – als hätte sie Sorge, ein gutes Fotomotiv verpassen zu können.
Lily war anders, als ich es erwartet hatte. Und genau das passte mir nicht in den Kram.
Vielleicht, weil es mir einfacher gefallen wäre, sie unsympathisch zu finden, wenn sie das Klischee von einem oberflächlichen Stadtkind bedient hätte.
Doch leider war Lily so ziemlich das Gegenteil davon. Sie schien bodenständig, naturbegeistert – und noch dazu verdammt though.
Allein, wenn ich an die Szene mit dem Elch zurückdachte … Dieses Bild würde sich vermutlich für immer in meiner Erinnerung festbrennen.
Als man mir im Resort gesagt hatte, dass ich eine junge Frau aus Deutschland vom Flughafen abholen sollte, hatte ich sicherlich mit allem gerechnet. Aber nicht mit einem blonden Engel, der bereits an seinem ersten Tag in Kanada Todessehnsucht verspürte und mit einer Retrokamera im Gebüsch hockte, um auf Tuchfühlung mit einem Elch zu gehen.
War sie sich der Gefahr denn überhaupt nicht bewusst gewesen? Vermutlich nicht, so ahnungslos, wie sie mich aus ihren großen Augen angesehen hatte.
Irgendwie süß.
Ich konnte nicht verhindern, dass sich meine Lippen zu einem Lächeln kräuselten, doch gleich darauf verbot ich mir diesen Moment der Schwäche.
Ich wollte sie nicht süß finden, und auf keinen Fall wollte ich mir Gedanken über sie machen. Das führte zu nichts.
Langsam solltest du es doch echt besser wissen, Ben! Lernte ich denn nie dazu?
Abermals breitete sich Wut in mir aus. Eine leise Stimme in meinem Kopf sagte mir, dass es nicht fair war, meine aktuelle Gefühlslage auf Lily zu projizieren.
Aber mit Wut konnte ich besser umgehen als mit anderen Empfindungen. Daher beschloss ich, dass es besser war, wenn ich Lily einfach im Resort absetzte und wir danach getrennte Wege gingen.
Und es war auch besser, wenn sie mich für einen gefühlskalten Ignoranten hielt. Zumindest redete ich mir das ein, während ein winziger Teil von mir Bedauern bei diesem Gedanken verspürte.
Vielleicht hätte ich sie sogar ehrlich mögen können, schoss es mir durch den Kopf.
Vielleicht, wenn wir uns zu einem anderen Zeitpunkt begegnet wären.