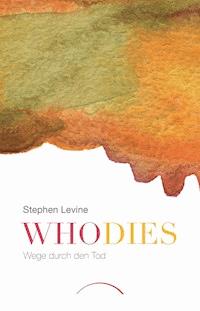
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: J. Kamphausen Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Levine ermutigt uns im ersten Teil des Buches, unsere eigenen Gedanken, Ängste, Sorgen und unser Verlangen - ohne zu bewerten - zu erforschen und unser Herz für uns selbst zu öffnen. So erkennen wir, wie wir durch unseren eigenen Widerstand gegen das, was ist, uns unsere eigene Hölle schaffen. Im zweiten Teil des Buches erfahren wir hilfreiche Unterstützung für unsere Arbeit mit leidenden Menschen: Bei der Begleitung Kranker und Sterbender lösen sich die Hindernisse zwischen unseren Herzen auf, wenn wir uns der Einzigartigkeit des Anderen gegenüber öffnen und Gedanken und Bewertungen loslassen. Dieses Buch ist eine wertvolle Hilfe für alle auf ihrem Lebensweg, seien sie erkrankt oder gesund, für "Helfer" oder "Betroffene". 'Wege durch den Tod' ist das erste Buch, das uns zeigt, wie die Beschäftigung mit dem Prozess des Sterbens uns für die Unermesslichkeit des Lebens öffnet. Stephen Levine führt uns einfühlsam und voller Poesie auf den Weg des vollkommenen Gewahrseins am Lebens, um uns für alles vorzubereiten, was unerwartet auf uns zukommen kann: Trauer oder Freude, Verlust oder Bereicherung, Tod oder ein anderes neues Lebenswunder.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 614
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Copyright Original: Titel: Who dies, Stephen Levine, 1982Published by arrangement withDoubleday, a division of Batam DoubledayDell Publishing Group, Inc.
Stephen LevineWho dies
© Kamphausen Media GmbH, Bielefeld 1995, [email protected]
www.kamphausen.media
Übersetzung: Matthias WendtBearbeitung: Hans-Jürgen Zander, Marion MeierSatz : Werner LangeCovergestaltung: Christiane Kurschildgenunter Verwendung eines Bildes von ©Liliia - stock.adobe.comeBook Gesamtherstellung: Bookwire GmbH, Frankfurt a. M.
Neuauflage 2018
ISBN Print: 978-3-95883-309-8ISBN eBook: 978-3-95883-312-8
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diesePublikation in der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Funk,Fernsehen und sonstige Kommunikationsmittel,fotomechanische oder vertonte Wiedergabe sowie desauszugsweisen Nachdrucks vorbehalten.
Stephen Levine
WHO DIES
Wege durch den Tod
Inhalt
Vorwort
Danksagung
Einleitende Worte des Autors
Die Anerkennung des Todes
Geboren werden
Sei bereit
Der durstige Geist
Modelle
Himmel und Hölle
Erledigte Geschäfte
Trauer
Sterbende Kinder
Mit dem Schmerz arbeiten
Auf den Tod zugehen
Mit dem Sterben arbeiten
Der Brief einer Freundin
Wer stirbt?
Die Kontrolle aufgeben
Heilen/Sterben- Der große Balanceakt
Selbstmord
Bestattung
Ramana Maharshi (1879 - 1950)
Stadien des Sterbens
Bewußtes Sterben
Der Moment des Todes
Die Erforschung der postmortalen Erfahrung
Meditation nach dem Tod
Das Endspiel
Anhang
Bibliographie
Musikliste
Index
Ich widme dieses Buch meiner Frau und spirituellen Partnerin Ondrea, die mir bei der Erarbeitung dieses Manuskriptes Seite für Seite Beistand geleistet hat und deren Liebe mich wieder und wieder daran erinnert, den denkenden Geist loszulassen und in das Herz hineinzusterben.
Vorwort
Vor nicht allzu langer Zeit hatte ich zum ersten Mal seit meinem eigenen Eintritt ins Leben teil an einer Geburt. Indem ich mit der Mutter atmete, den Kopf des Kindes erscheinen sah und das gesamte Geschehen von Augenblick zu Augenblick miterlebte, wurde es mir möglich, ein Ur-Element in meinem eigenen Wesen zu berühren. Ich lachte und weinte, empfand Angst, teilnahmsvollen Schmerz und tiefe Freude. Ich stand am Tor der Existenz und spürte wie nie zuvor die Verbundenheit meiner menschlichen Natur mit der übrigen Schöpfung, die ihre Zyklen von Sommer und Winter, Werden und Vergehen durchläuft. Jeder Moment war erfüllt von ehrfurchtgebietender Gnade und einer Ahnung des lebendigen Geistes. Es war ein Ritual, in dem ich meine tiefsten Gefühle für die menschliche Gemeinschaft wiederentdeckte.
Doch über die Geburt hinaus ist nun auch der Tod ins Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt. Erst in den letzten zehn Jahren ist unter dem Einfluß der bahnbrechenden Arbeit von Cecily Saunders mit ihrer Hospiz-Bewegung in Großbritannien und Elisabeth Kübler-Ross in den Vereinigten Staaten ein sehr viel humaneres Milieu für jene geschaffen worden, die den Sterbeprozeß erleben. Einen weiteren Anstoß erfuhr diese Bewegung durch die wachsende Erkenntnis der Ärzteschaft, daß ihre Technologien der Lebenserhaltung und Intensivpflege hinsichtlich ihres angemessenen Gebrauchs dringend einer tiefergehenden Erforschung bedürfen - einer Erforschung unserer Menschlichkeit. Wenn eine Person, die sich offenkundig dem Tode nähert, in eine sterile Umgebung gebracht wird, die sie von der Familie, den Freunden, Kindern und Liebsten, sowie von ihrer vertrauten Umgebung trennt, dann ist dies eine besonders barbarische Art und Weise, unser Schuldbewußtsein und unsere Furcht vor dem Tod zu tilgen und uns dabei einzubilden, wir hätten mit dem Einsatz der Techniken und sterilen Mechanismen unserer Zeit „alles getan, was wir konnten”.
Die neue Hospiz-Bewegung zielt darauf ab, dem Individuum während des Sterbeprozesses eine freundliche, entlastende und zwanglose Umgebung zur Verfügung zu stellen. Man leistet Hilfestellung bei der Regelung verschiedener Angelegenheiten, steht der trauernden Familie zur Seite und kümmert sich um die täglichen Bedürfnisse des Patienten.
Ihren vielleicht wichtigsten Beitrag leistet die Bewegung jedoch, indem sie alle Beteiligten zunehmend erkennen läßt, daß das Sterben tatsächlich „eine dringliche Angelegenheit” ist. Wie erfrischend wirken diese Impulse, nachdem die Menschen, die dem Tod entgegengehen, in der Vergangenheit von einer regelrechten Verschwörung allgemeiner Todesablehnung umgeben waren!
Doch so bewundernswert diese aufkeimende Bewegung auch sein mag, sie repräsentiert nur die ersten zögernden Schritte in eine Transformation unserer Beziehung zum Sterbeprozeß. Sie sieht den Tod noch immer als „verhängnisvoll” an und betrachtet ihre Tätigkeit als einen Versuch, das Beste aus einer widrigen Situation zu machen. Diese Bewegung wurzelt noch in der Verneinung - zwar nicht in der Verneinung des Todes, aber in der Verneinung unserer eigenen Intuition.
Von der um Objektivität bemühten Wissenschaft erfahren wir, daß wir aus unserem Körper bestehen, einem Produkt der Darwinschen Evolution, das aus einer zufälligen Verkettung molekularer Gase hervorgegangen ist und dessen Wachstum und Zerfall vom genetischen Code der DNS diktiert wird. Folglich ist der Tod das Ende. Doch im kollektiven Unbewußten (so der Jungsche Terminus) der menschlichen Spezies läßt uns ein intuitives Wissen ahnen, daß diese „objektive” Definition nicht die Ganzheit dessen umfaßt, was wir sind. Wir haben uns eingeredet, daß das Leben eher von unserem Intellekt als von unserer Intuition gesteuert werden muß, und daß wir folglich nur das anzuerkennen brauchen, von dem wir wissen, daß wir es wissen. Intuitive Weisheit erfüllt dieses Kriterium jedoch nicht. Sie scheint einem Bereich zu entspringen, der jenseits des rationalen, objektiven Verstandes liegt, und so haben wir weitgehend geleugnet, was sie uns sagt - obwohl doch alle großen Weltreligionen und viele profunde Philosophen in eben jener tieferen Weisheit verwurzelt waren.
In jüngerer Zeit indessen scheinen intuitive Erkenntniswege an Legitimität gewonnen zu haben. So sagte Albert Einstein von der Quelle seiner Inspiration zur Relativitätstheorie: „Zu einem Verständnis dieser fundamentalen Gesetze des Universums gelangte ich nicht durch meinen rationalen Verstand”. Er wurde eines anderen Erkenntnisprozesses gewahr, auf den schon zuvor Philosophen wie William James aufmerksam gemacht hatten, der hinsichtlich des Universums an Realitäten von Erkenntnismethoden sprach, die so lange verborgen bleiben, bis wir sie anerkennen.
Wenn unsere Kultur erst einmal die Intuition zu würdigen beginnt, wird sie dem Zweifel entgegenwirken, der die Intuition normalerweise ihrer Macht beraubt, und unsere Sicht auf die Welt wird sich weitgehend verändern. Unter diesen Veränderungen steht unsere Einstellung zum Tod an erster Stelle. Es gibt einen Aspekt in uns - man könnte ihn „Sein”, „Bewußtsein”, „reinen Geist” oder „Ich” nennen - der hinter allen sichtbaren Phänomenen (dem Körper, den Emotionen, den Sinnen, dem denkenden Verstand) liegt, die in der Matrix von Zeit und Raum erscheinen. Wir ahnen, daß selbst dann, wenn wir im Tod unseren Körper verlassen, dieser tiefere Teil unseres Seins unbeeinflußt bleibt. Mit dieser grundlegenden Veränderung unserer Identität und unseres Selbstverständnisses wird der Tod von einem furchteinflößenden Feind, einer Vernichtung, einem verhängnisvollen Irrtum des Universums umgewandelt in eine weitere Transformation, die wir durchlaufen, ein Abenteuer, das alle anderen Abenteuer übertrifft, eine Öffnung, einen unvorstellbaren Augenblick des Wachstums, einen Schritt auf eine neue Stufe.
Vielleicht entspricht das in etwa dem Gefühl der ersten Weltentdecker, nachdem die Theorie, daß die Erde flach sei und man über ihren Rand stürzen könne, durch das sphärische Konzept unseres Planeten ersetzt worden war. Welchen Mut muß diese Theorie freigesetzt haben, daß sie den Forschungsreisenden erlaubte, furchtlos ins Unbekannte zu fahren!
Die meisten Menschen erleben lediglich ein intuitives „Aufblitzen” oder kurze Momente der Einsicht in die verborgene Natur des Selbst, denen sich fast augenblicklich die Wiederbehauptung der Vorherrschaft unserer gewohnten Denkweisen anschließt. Wenn wir also von unserer umfassenden, intuitiven Weisheit profitieren wollen, müssen wir jene tiefergreifende Art des Erkennens in uns entwickeln. Dies geschieht, indem wir lernen, zuzuhören: Wenn wir zum Beispiel, wie die Quäker sagen, der „stillen, leisen Stimme im Innern” zuhören - wenn wir den Mustern, Gesetzen und Harmonien des Kosmos lauschen, dessen Bestandteil wir sind - wenn wir in der feinen Balance eines ruhigen, meditativen Geistes und eines offenen, liebevollen Herzens zuhören. Dieser Aufgabe müssen wir uns alle widmen, die Lebenden und die Sterbenden, die Heilkundigen und die Patienten. Unser Dienst füreinander muß in eben dieser Arbeit an uns selbst verwurzelt sein. Es ist dieses Streben nach Vertiefung unserer Anerkennung des intuitiven Herz-Geistes, welche die gerade erst dem Tode geöffnete Tür ins Licht führen läßt und nicht in eine noch größere Dunkelheit.
Vor einigen Jahren fragte ich Stephen Levine, ob er das Sterbe-Projekt der Hanuman Foundation leiten wolle. Dieses Projekt zielt darauf ab, einen Kontext für den Sterbeprozeß zu schaffen, dessen zentraler Schwerpunkt in der Arbeit aller Beteiligten an sich selbst liegen soll - seien sie nun Heilende, Helfer, Familien oder die mit dem Tod konfrontierten Personen selbst. Dieses gemeinschaftliche Bemühen hat sich für die Transformierung des Sterbeprozesses in einen Prozeß umfassenden, liebevollen Wachstums als überaus förderlich erwiesen.
Und nun entstand aus Stephens Arbeit in diesem Projekt das Buch WER STIRBT?-WEGE DURCH DEN TOD. Weil es in unserer kollektiven, intuitiven Weisheit gründet, die aus einem achtsamen, ruhigen Geist geschöpft wurde, hebt es sich aus der Überfülle von Büchern heraus, welche die neue Sterbebewegung hervorgebracht hat. Dieses Buch widmet sich den zahlreichen Aspekten des Sterbeprozesses mit erfrischender Einsicht, mit Offenheit und Unbeschwertheit. Es lädt uns ein, den „Tatsachen” klar und ohne Wertung ins Auge zu sehen. Es nimmt dem unglaublichen Melodrama, das „Tod” genannt wird, seine schreckensvolle Macht und ersetzt die Furcht vor ihm durch stilles, einfaches und teilnahmsvolles Verständnis.
Stephen Levine ist Poet, langjähriger Praktiker buddhistischer Meditation und Meditationslehrer. In enger Zusammenarbeit mit seiner Frau Ondrea dient er voller Hingabe denen, die dem Tod gegenüberstehen. In diesem Buch integriert er die Gebiete seiner Sachkenntnis in einer Form, die zuweilen klassische Proportionen annimmt. Ich würdige dies Bemühen und lade Euch ein, am Reichtum dieses Geschenkes teilzuhaben.
In Liebe
Ram Dass
Danksagungen
Es gibt einfach keine Worte, die meiner Dankbarkeit für die Jahre des Lernens und der Zusammenarbeit mit meinem lieben Freund Ram Dass Ausdruck verleihen können. Gleichwohl ist dieses Buch letztlich in hohem Maße das Resultat seiner beständigen Ermutigung und Liebe.
Aus dieser Arbeit sprechen die Stimmen und Herzen vieler großartiger Lehrer und Lehrerinnen:
Viele der nicht namentlich gekennzeichneten Zitate in diesem Buch sind den Lehren von Sri Nisargadatta entlehnt (dessen Name in freier Übersetzung etwa „Herr Natürlich” lautet), dem ich zwar nicht persönlich begegnet bin, dessen Werke in Gestalt seiner beiden Bände I Am That* auf diese Forschungsarbeit jedoch einen tiefen Einfluß hatten.
Auch die Lehren und die Gegenwart von Neem Karoli Baba (bekannt als Maharajji) und Ramana Maharshi durchdringen dieses Kompendium mitgeteilter Erfahrung, und das gleiche gilt für die Jahre der Beschäftigung mit der buddhistischen Praxis und Lehre.
Meine enge Verbindung mit Joseph Goldstein und Jack Kornfield haben ebenfalls auf diese Übermittlung eingewirkt.
Auch die Jahre der gemeinsamen Lehrtätigkeit mit Elisabeth Kübler-Ross, in welche die Anfänge dieses Werkes zurückreichen, wie auch die bis heute zwischen uns bestehende herzliche Freundschaft dürfen an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben.
Dieses Buch ist ebenso ein Ergebnis der Hingabe und geistigen Klarheit jener, die ich durch ihren Sterbeprozeß begleitet habe, wie es auch geprägt ist von den Lehren spiritueller Freunde und Freundinnen, die mich mit ihrem Wohlwollen und ihrer durchdringenden Klarsicht beschenkten, um mich auf den Pfad des Verstehens zu führen.
Was nun folgt, ist ein Gewebe vieler Jahre der spirituellen Praxis und des Austausches mit sterbenden Patienten, das in verschiedenen Workshops und Retreats auf Tonband festgehalten und anschließend in die schriftliche Form übertragen wurde. Und ohne die liebevolle Unterstützung von Jakki Walters, Jean Thompson und Al Strickland würde ich mich wohl noch heute durch die Seiten des ersten Kapitels kämpfen.
Stephen Levine
* Ist in einer einbändigen deutschen Ausgabe unter dem Titel „Ich bin“ im Context Verlag erschienen.
Einleitende Worte des Autors
Wenn Du dieses Buch liest,
dann lausche ihm
mit Deinem Herzen.
Mache es zu einem Spiegel
Deiner eigenen wahren Natur.
Rationales Begreifen
ist die elementare Verlockung des Verstandes.
Stoße vor zur Wahrheit
jenseits des Verstandes.
Die Brücke dorthin ist die Liebe.
Die Anerkennung des Todes
Heute starben annähernd 200.000 Menschen. Einige starben durch einen Unfall. Andere durch Mord. Einige starben an übermäßigem Essen. Andere sind verhungert. Einige starben noch im Mutterleib. Andere an Altersschwäche. Einige verdursteten. Andere ertranken. Jeder starb seinen Tod, wie er ihm bestimmt war. Manche starben voller Hingabe, mit offener Seele und friedvollem Herzen. Andere starben in Verwirrung, an einem Leben leidend, das ungelebt blieb, an einem Tod, den sie nicht annehmen konnten.
Es ist so, wie Lewis Thomas in seinem Buch TheLives ofa Cell schrieb: „Die Todesanzeigen in den Zeitungen unterbreiten uns die Nachrichten unseres Dahinsterbens, während uns die kleiner gedruckten Geburtsanzeigen am Rand der Seite darüber informieren, wie wir ersetzt worden sind. Aber dies vermittelt uns keinen Begriff von der Unermeßlichkeit dieser Waagschalen. Drei Milliarden von uns leben auf der Erde, und diese ganzen drei Milliarden stehen auf der Liste derer, die innerhalb dieser Lebensspanne sterben müssen. Die gewaltige Sterblichkeit, die in jedem Jahr etwas mehr als 50 Millionen Menschen umfaßt, vollzieht sich in relativer Heimlichkeit…“*
„In weniger als einem halben Jahrhundert werden jene, die uns ersetzen, die Zahlen mehr als verdoppelt haben. Angesichts dieser sterbenden Menschenmassen ist es kaum zu erwarten, daß wir jene Heimlichkeit werden wahren können. Wir werden die Vorstellung aufgeben müssen, daß der Tod eine Katastrophe oder etwas Widerwärtiges sei, daß man ihn besiegen oder auch nur verdrängen könne. Wir werden mehr über den Kreislauf des Lebens im übrigen Weltall und über unsere Beziehungen zu diesem Prozeß lernen müssen. Alles, was ins Leben tritt, scheint nur ein Ersatz für das zu sein, was stirbt - Zelle für Zelle”.
Wir leben in einer Gesellschaft, die es gewohnt ist, den Tod zu leugnen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum sich viele Menschen zum Zeitpunkt ihres Sterbens so verwirrt und belastet fühlen. Wie auch die Sexualität ist der Tod etwas, worüber man nur hinter vorgehaltener Hand spricht. Wir fühlen uns schuldig, weil wir sterben müssen, und wissen nicht, wie wir leben sollen. All unsere Lebensweisen bündeln sich im Brennpunkt des Todes.
Diejenigen, die in den sogenannten „materialistischen Gesellschaften” leben, deren Technologien den Erwerb vieler Güter erlauben und den Überlebenskampf weitgehend erleichtern, und in denen der Selbstwert am Reichtum gemessen wird, tendieren vielleicht etwas stärker dazu, sich selbst mit dem Körper zu identifizieren. Unsere Gesellschaft gibt jedes Jahr Milliarden von Dollar für Kosmetika, Hüfthalter, Toupets, Schönheitsoperationen und Haartönungen aus und verdrängt auf diese Weise die Lektionen, die der Verfall des Körpers für uns bereithält. In einer Welt, zu deren häufigsten Qualen der Hungertod zählt, geben die USA sogar mehr als vierhundert Millionen Dollar jährlich für Schlankheitskuren aus.
Wir beobachten den körperlichen Verfall, die altersbedingten Stoffwechselveränderungen, den Bauchansatz in der Lebensmitte, das Nachlassen des Leistungsvermögens und der Muskelkraft, das Ergrauen der Schläfen, den Haarausfall - wie könen wir leugnen, daß der Körper unweigerlich verfällt? Wir erleben den Verlust geliebter Menschen, wir sehen, daß die uns bekannte Welt in ständiger Wandlung begriffen ist, daß wir letztlich nur der Stoff der Geschichte sind - wie können wir den Tod ignorieren?
Wie oft werden wir zum Beispiel dazu ermutigt, über die Beschwerden einer Grippe als Vorbereitung auf den Tod zu meditieren, als Möglichkeit, den Widerstand gegen das Leben aufzulösen? Unablässig um Befriedigung ringend, halten wir uns entweder für glücklich oder für unglücklich, nehmen aber von den Lehren der Unbeständigkeit kaum Notiz.
Kaum einmal nutzen wir eine Krankheit als Gelegenheit, um unser Verhältnis zum Leben zu erforschen oder unsere Angst vor dem Tod zu ergründen. Krankheit wird als Unglück betrachtet. Wir halten fest am Maßstab der blühenden Gesundheit und der Pepsi-Cola-Vitalität. Nur wenn wir gesund bleiben, glauben wir, daß es uns gut geht. Doch wie sollen wir bei dieser starren Vorstellung von dem, was annehmbar ist, lernen, uns dem Unerträglichen zu öffnen? Was versetzt uns in die Lage, das Unbekannte mit der Offenherzigkeit und dem Mut zu betreten, die dem Leben erst seine Fülle geben?
Im Leichenhaus legen wir dem Tod Rouge auf. Selbst im Sarg streiten wir noch unsere Vergänglichkeit ab.
Zu Hause in unserem Lieblingssessel lesen wir in der Zeitung, daß bei einem Hotelbrand in Cleveland fünf Menschen umgekommen sind und daß ein Busunglück auf der Autobahn zehn Todesopfer gefordert hat. Daß dreitausend Menschenleben bei einem Erdbeben in Italien vernichtet wurden. Daß Nobelpreisträger in ihrem Labor starben. Und Mörder auf dem elektrischen Stuhl. Wir haben teil an den „Nachrichten für die Überlebenden” und werden in unserer Vorstellung bestärkt, daß „alle sterben, nur ich nicht”. Einfach dazusitzen und vom Tode anderer zu lesen, bescheinigt uns, daß wir überlebt haben, daß wir unsterblich sind. Das Unglück anderer füllt einen großen Teil der ersten Seite und erzeugt die Illusion, daß wir Glück haben. Selten lassen wir uns von Todesnachrichten zu der Erkenntnis leiten, daß alle Dinge unbeständig sind, daß sie Wandlungen durchlaufen, die wir nicht kontrollieren können.
Und doch liegt in der Anerkennung der Unbeständigkeit der Schlüssel zum eigentlichen Leben. Die Konfrontation mit dem Tod bewirkt in uns eine tiefgreifende Einstimmung auf das Leben, von dem wir glauben, daß wir es beim Verlöschen des Körpers verlieren werden. Aber worauf gründet sich dieses Gefühl von Präsenz, von zeitlosem Dasein, auf dessen Anfang wir uns nicht besinnen und dessen Ende wir nicht absehen können? Wir glauben nur deshalb, daß wir sterben, weil wir glauben, daß wir geboren wurden. Wir mißtrauen jenem inneren Gefühl der Endlosigkeit und der Grenzenlosigkeit.
Unser Leiden entsteht, wenn wir uns darauf fixieren, wie etwas hätte sein können, hätte sein sollen oder hätte sein müssen. Kummer ist ein Bestandteil unserer täglichen Existenz. Doch selten nehmen wir Notiz von jenem Leid in unserem Herzen, das jemand einmal „ein unergründliches Weinen, ein Trauern um alles, was wir zurückgelassen haben” genannt hat.
Als sich eine Freundin der Zeit erinnerte, in der sie erfuhr, daß ihr Krebs im Endstadium sei, sagte sie: „Im Endstadium zu sein bedeutete nur, daß ich endlich anerkannte, daß der Tod eine Wirklichkeit ist. Es bedeutete nicht, daß ich in einem halben Jahr oder auch nur eher als der Arzt sterben würde, der mir diese Prognose gerade gestellt hatte. Es bedeutete einfach, daß ich anerkannte, daß ich überhaupt sterben würde”. In einer auf materiellen Gewinn gegründeten Gesellschaft, die in der Identifikation mit dem Körper lebt, die die Gesundheit so überaus hoch einschätzt und den Tod so ungemein fürchtet, ist es oft schwer zu verstehen, daß der Tod etwas Natürliches und für den Fortbestand der inneren und äußeren Lebensprozesse sogar unabdingbar ist.
Im ägyptischen Totenbuch finden wir lange Schilderungen, wie der Geist des Verstorbenen in die Unterwelt hinabsteigt und dem großen Richter begegnet, der das Herz gegen eine Feder aufwiegt. Es ist die Feder der Wahrheit. Und man fragt sich, wessen Herz wohl leicht genug ist, um gegen die Wahrheit aufgewogen zu werden.
Fünfundsiebzig Prozent der Bevölkerung vollziehen ihren letzten Atemzug in einem Pflegeheim oder Krankenhaus. Die meisten sterben in Einrichtungen, in denen der Tod als Feind betrachtet wird. Ich habe viele gesehen, die dem Tod in physischer und geistiger Isolation begegnen mußten und kaum eimal dazu ermutigt wurden, sich über ihre Einbildungen und Ängste hinaus zu öffnen. Sie waren im Herzen und in der Seele abgeschnitten von den geliebten Menschen, die diese kostbaren Augenblicke vielleicht mit ihnen hätten teilen können. Unfähig, ihrer inneren Natur zu vertrauen, vom eigentlichen Leben getrennt, schritten sie in schmerzvoller Unsicherheit und Verwirrung in andere Bereiche des Seins hinein.
Ich habe viele gesehen, die sich verzweifelt an einen rasch degenerierenden Körper klammerten und auf ein unbegreifliches Wunder warteten, gepeinigt von tiefem Verlangen nach einer Erfüllung, die sie im Leben nie gefunden hatten. Und ich bin auch jenen begegnet, deren Tod alle inspirierte, die um sie versammelt waren. Sie strömten in ihrem Sterben eine so große Liebe und Anteilnahme aus, daß alle Zurückgebliebenen noch Wochen später von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt waren.
Nur wenige haben an ihrem Leben so umfassend teil, daß der Tod keine Bedrohung für sie darstellt, daß er nicht der grimmige Sensenmann ist, der hinter der dunklen Fensterscheibe lauert. Die meisten kämpfen gegen den Tod an, wie sie gegen das Leben angekämpft haben, und sie ringen um einen Halt, um eine gewisse Kontrolle über den unaufhörlichen Strom der Veränderung, der diese Ebene der Existenz kennzeichnet. Wenige sterben in Vollkommenheit. Die meisten führen ein Leben voller Einseitigkeit und Unsicherheit. Die meisten denken, daß der Körper ihnen gehört. Wenige erkennen ihn als nur vorübergehend gemietete Wohnung, aus der sie schließlich wieder ausziehen müssen. Diejenigen, die sich selbst nur als Reisende im Körper betrachten, sind eher dazu fähig, ihn einfach loszulassen.
In unserer Kultur betrachten wir das Leben, als wäre es eine gerade Linie. Je länger diese Linie, desto mehr glauben wir gelebt zu haben, desto vollkommener meinen wir zu sein und desto weniger schrecklich stellen wir uns den Endpunkt vor. Der Tod junger Menschen wird als tragisch angesehen und erschüttert viele in ihrem Glauben. Doch in der indianischen Kultur z.B. verläuft das Leben nicht linear, sondern in einem Kreis, der sich mit den Übertrittsriten etwa zur Zeit der Pubertät schließt. Von dieser Zeit an wird man als eine Ganzheit angesehen, die sich nach außen hin entfaltet. Aber wenn sich der „Ring” erst einmal geschlossen hat, stirbt man, egal wann der Tod eintritt, immer im Zustand der Vollkommenheit. Der weise Indianer Crazy Horse sagte einmal: „Heute ist ein guter Tag zum Sterben, denn es gibt nichts,was meinem Leben noch fehlt.” Die indianische Kultur sieht die Ganzheit nicht in der Dauer der gelebten Zeit, sondern in der Fülle, in der man die Ganzheit eines jeden Augenblicks erlebt.
Anders als in unserer Gesellschaft, die die Vorbereitung auf den Tod kaum unterstützt, wird dem Sterbenden in der indianischen Kultur oft ein natürlich geformter Kristall gereicht, der als Meditationsobjekt benutzt wird. Wenn man lange auf die Kanten im Inneren des Kristalls blickt, an denen durch Lichtbrechung prismatische Regenbogenlinien entstehen, projiziert man sein Bewußtsein in diesen Regenbogen hinein und läßt alles los, was den Geist davon abhält, sich in seiner Ausrichtung selbst zu transzendieren. Im Augenblick des Todes wird man in den Regenbogenkörper hineingeführt und fließt voller Ruhe und weise vorbereitet aus der zeitlichen Form heraus.
Das Maß des Leidens scheint für diejenigen um vieles geringer zu sein, die ihr Leben in jener Ganzheit führen, die den Tod mit einschließt. Ich meine nicht etwa ein morbides Beschäftigtsein mit dem Tod, sondern vielmehr ein Verweilen in der von Liebe erfüllten Gegenwart, ein Leben, das auf jeden einzelnen kostbaren Moment ausgerichtet ist. Ich treffe nur wenige, die sich durch ihre Teilhabe am Leben auf den Tod vorbereitet haben. Und wenige sind es, die ihr Herz und ihren Geist erforscht haben, um auf alles, was kommen mag, optimal vorbereitet zu sein, sei es Tod oder Krankheit, Kummer oder Freude.
Wer ist auf den Tod vorbereitet? Wer hat so umfassend gelebt, daß er in der Vorstellung seines Nichtseins keine Bedrohung sieht? Denn nicht nur die Vorstellung vom Tod ist es, die uns erschreckt. Es ist das Unbekannte, vor dem wir zurückweichen.
Wie oft ähneln wir dem übel zugerichteten Kind auf der ersten Seite der Los Angeles Times, das von einer mitleidigen Aufseherin behutsam aus dem Raum getragen wird, aber seine Hände über ihre Schultern hinweg ausstreckt nach einer auf der anderen Seite des Raums zwischen zwei Polizisten stehenden Frau und ihr zuruft: „Mama, Mama!” - einer Frau, die festgenommen wurde, weil sie diesem Kind Verbrennungen und Knochenbrüche zufügte! Wie viele greifen lieber zurück auf die ihnen vertraute Hölle, als sich dem Unbekannten zu öffnen und die Geduld und Wärme in sich zu erwecken, welche unser Herz weit genug für uns selbst und alle anderen macht?
In manchen Gesellschaften führt der Tod den ganzen Stamm oder die ganze Familie zu einer feierlichen Würdigung der sich ständig wandelnden Schöpfung zusammen. Der tiefe spirituelle Kontext, in den dieser Hingang eingebettet ist, ermöglicht es vielen Anwesenden, während solcher Feierlichkeiten tiefgreifende Erfahrungen ihres eigenen wahren Wesens zu machen. In diesen Gesellschaften stellt der Tod eine immer wiederkehrende Gelegenheit dar, sich von den Illusionen des Lebens zu lösen, den Realitäten ins Auge zu blicken und sich allen anderen liebevoll zu öffnen.
In der hebräischen Kultur wie auch in der indischen Gesellschaft entledigt man sich des Körpers meist innerhalb von vierundzwanzig Stunden. In der jüdisch-orthodoxen Tradition praktiziert man eine Woche lang das Schiwa-Sitzen und betrauert den Verlust mit Wehklagen und Gebeten, respektiert aber dennoch das Hinscheiden des anderen und wünscht diesem Wesen Gutes, welches Neuland es auch immer betreten mag. In Indien wird der Leichnam von der Familie in einer Sänfte zum Einäscherungsplatz getragen. Mit dem Chanten von “Ram Nam Satya Hey” (Gottes Name ist Wahrheit) trägt die Familie den Toten auf dem ersten Teil der Strecke so, daß sein Kopf noch auf das Zuhause weist, das er gerade verlassen hat. Auf halbem Wege zum Bestattungsplatz wird die Sänfte herumgedreht, so daß das Haupt nicht länger dem soeben verlassenen Leben zugewandt ist, sondern dem, was da kommen wird. Auf dem Einäscherungsplatz wird der Körper im Kreis der Familie auf einen großen Holzstapel gelegt, mit Blumen und Räucherwerk bedeckt und dem Feuer übergeben. Wenn der Verstorbene der Familienvater war, rührt der älteste Sohn, sobald der Körper auseinanderzufallen beginnt, mit einem großen Stock in den brennenden Knochen und stößt, wenn nötig, beherzt in den Schädel seines Vaters hinein, so daß dessen Geist voller Freude in die Sphären emporsteigen kann, die ihn erwarten mögen.
In Mexiko wird im November „La dia de la Muerte” gefeiert, der Tag der Toten. Die Kinder kaufen Papierskelette und befestigen Feuerwerkskörper daran, um sie auseinanderzusprengen, oder sie essen Bonbons in der Form von Totenschädeln, während die Eltern das Wesen der Schöpfung feiern, indem sie in den an jede kleine Stadt angrenzenden Friedhöfen Picknick machen.
Ich habe Menschen getroffen, die erst durch ihr Sterben völlig zum Leben erweckt wurden und auf etwas zu vertrauen begannen, von dem sie spürten, daß es fortbestehen und vom Tod des Körpers nicht berührt werden würde. Und ich bin jenen begegnet, die sich nach einem furchtsamen Leben dem Moment des Todes mit einer neuen Offenheit näherten, die ihnen ein Gefühl der Vollendung schenkte, wie sie es vorher kaum gekannt hatten.
Ich traf Menschen zur Zeit ihres Todes, die sich in ihrem Schmerz und in ihrer Angst so verschlossen hatten, daß sie denen, die sie am meisten geliebt hatten, nicht einmal Lebewohl sagen konnten. Hier waren so viele Geschäfte unbereinigt geblieben, daß alle Anwesenden des Kontaktes beraubt waren, den sie sich ersehnten.
Ich bin auch jenen begegnet, die ausriefen „Oh Gott - nicht ich!”, als sie die Todesprognose hörten, und die nach einigen Monaten tiefer Selbstbesinnung still ihre Augen schlossen und „Süßer Jesus” flüsterten, als sie starben.
* Neuere Zahlen sprechen von einer Weltbevölkerung von über fünf Milliarden Menschen, und die gegenwärtige jährliche Sterblichkeitsrate liegt bei etwa 80 Millionen.
Geboren werden
Wenn wir an unseren Tod denken, sehen wir uns von lieben Freunden umgeben in einem Zimmer liegen, das von heiterem Frieden erfüllt ist, weil nichts mehr gesagt werden muß, weil alle Geschäfte erledigt sind. Unsere Augen strahlen vor Liebe, und während ein letztes Flüstern unergründlicher Weisheit (vielleicht zum Thema der Vergänglichkeit des Lebens) unsere Lippen bewegt, lassen wir uns ins Kissen zurücksinken. In einem ausgedehnten „Ahhh…” entfährt uns der letze Atemzug, und wir erheben uns sanft in das Licht.
Aber was geschieht, wenn sich just in dem Moment, in dem du „Ahhh…” machen willst, deine Lebensgefährtin zu dir herunterbeugt und dir gesteht, eine Affäre mit deinem besten Freund gehabt zu haben? Oder wenn dein Kind wütend ins Zimmer platzt und sagt: „Du bist schon immer ein Hohlkopf gewesen, hör’ doch endlich auf, uns was vorzumachen!” Würde dein Herz nicht zuschlagen wie eine steinerne Tür, würde sich dein Geist nicht vor Verwirrung und Selbstzweifeln überschlagen, würdest du nicht versuchen, dich um jeden Preis zu rechtfertigen, würdest du dich nicht in schmerzlicher Zustimmung in dir selbst verkriechen?
Wie können wir in Ganzheit sterben, wenn wir unser ganzes Leben in solcher Zersplitterung gelebt haben? Wie können wir, wenn wir sterben, unser Herz ganz weit für das Mysterium der Schöpfung öffnen, wenn sich unser Leben in der schönen Vorstellung erschöpfte, die der Geist von sich selbst hat? Wo werden wir Zuflucht finden? Woher wird das Vertrauen in die Vollkommenheit des Augenblicks kommen, wenn wir so oft vor dem, was wir fürchteten, zurückgewichen sind?
Es ist schwierig, sich ein bewußtes Sterben vorzustellen, wenn uns klar wird, wie unvollständig wir uns fühlen und wie sehr uns das Leben eingeschüchtert hat. Es ist fast so, als wären wir nie ganz geboren worden, denn so vieles in uns haben wir verdrängt und unter die Oberfläche gedrückt, so vieles in uns haben wir hinausgeschoben. So oft haben wir „wegen ungünstiger Witterung” aufgehört zu fragen, wer wir sind - weil es zu schmerzhaft war, tiefer in uns selbst einzudringen.
Wir sprechen davon, in Ganzheit zu sterben, und zugleich wird uns klar, daß es Aspekte in uns gibt, die niemals völlig ans Licht gekommen sind. Wir erkennen, wie in uns vieles unterdrückt worden ist und sich noch nicht geboren fühlt, wie sehr wir dem Leben ausweichen. Es ist, als hätten wir noch nie so ganz den Grund des Daseins berührt, als hätten wir mit den Füßen noch nie richtig in der Gegenwart gestanden. Immer zögern wir, tasten uns vorsichtig weiter und warten auf den nächsten Moment.
Wenn wir unsere Angst vor dem Tod erforschen, erkennen wir in ihr eine Angst vor dem nächsten Augenblick, über den wir keine Kontrolle haben. Eine Angst vor der Unbeständigkeit selbst, vor dem nächsten unbekannten, sich wandelnden Augenblick des Lebens.
Um ganz geboren zu werden, um unsere Ganzheit entfalten zu können, müssen wir aufhören, das Leben hinauszuschieben. In dem Maß, in dem wir das Leben vor uns herschieben, verdrängen wir auch den Tod. Wir leugnen Tod und Leben in einem Atemzug.
Es gibt so vieles in uns, von dem wir nichts wissen wollen. So viel Angst und Zorn, so viel Schuldbewußtsein, Selbstmitleid und Verwirrung, so viele Selbstzweifel und schwache Ausreden liegen in uns verborgen. Angesichts der bizarren Beharrlichkeit des Konflikts verschiedener Wertsysteme in unserem Geist kann es eigentlich nicht verwundern, daß wir uns so unvollständig fühlen. Eben noch sagte der Geist: „Nimm dir ein großes Stück!” - und im nächsten Moment sagt er: „Das hätte ich nicht gemacht, wenn ich Du wäre.” Kein Wunder, daß wir so verdreht, so zerspalten sind, und uns vor demjenigen zu schützen suchen, der zu sein wir uns fürchten. Wir wagen es nicht, unseren Geist mit irgendjemandem zu teilen, und seien wir es selbst. Wir erschrecken vor dem, der wir vielleicht sein könnten, erschrecken davor, nicht geliebt zu werden oder aufgrund der Irrwege unserer Gedanken nicht liebenswert zu sein.
Solche Geisteszustände kommen und gehen unaufhörlich und ungefragt, und von manchen wünschen wir uns, sie würden nie wiederkehren. Sie tun es aber, und so sehen wir uns wieder um Kontrolle ringen, um unsere Angst zu unterdrücken, und fühlen die Übelkeit in uns aufsteigen, die unsere enorme Unsicherheit und Abscheu vor uns selbst erzeugt.
Diese beharrliche Ausschaltung der Bewußtwerdung unerwünschter Geisteszustände gibt uns ständig das Gefühl der Bedrohung. Gleichzeitig schauen wir bedauernd drein und sagen: „Das kann ich doch gar nicht sein, diese Angst ist nicht das, was ich eigentlich bin. Ich bin nicht dieser Zorn. Dieser Selbsthaß und diese Schuldgefühle können mit mir nichts zu tun haben.” Aber dies alles ist vorhanden. Und du fragst dich, wer du wirklich bist. Wie kannst du offen sein für das, was du leugnest und wovon du glaubst, daß es irgendwie nicht existiert, obwohl es doch vorhanden ist?
Wir wünschen, wir wären anders als wir sind, und darin besteht unsere Hölle, unser Widerstand gegen das Leben.
Haben wir das Ende unseres Lebens erreicht, blicken wir zurück auf unsere Teilhabe und fragen uns, wie wir vollständig sterben können, wenn wir unser Leben in einer solchen Gespaltenheit gelebt haben. Wir fragen uns, wer es jenseits all unserer Selbstprojektionen eigentlich ist, der stirbt.
Es ist fast so, als bestünden wir nur noch aus dem zerbrochenen Abbild unseres ursprünglichen Wesens. Unser Erleben der Welt gleicht dem Blick in einen Spiegel, der von einem großen Stein zertrümmert wurde, in hundert Scherben zersprungen ist und uns die einheitliche Realität als zersplittertes Spiegelbild präsentiert, das wir für wirklich halten. Wenn wir diese zerbrochene Realität betrachten, stellen wir bestürzt fest, daß bestimmte Teile des Spiegelbildes nicht das zeigen, was wir eigentlich sehen oder in den Augen der anderen darstellen wollen. „Ich will nicht, daß jemand etwas von meiner Begierde merkt. So etwas dürfte ich eigentlich gar nicht kennen. So etwas vermutet man bei mir nicht. Niemand ist so verrückt wie ich.” Also nehmen wir eine Scherbe weg. „Ach, ich bin doch arm dran. Wenn die anderen nur wüßten, was für ein Leben ich hatte! Naja, sie wissen es nicht.” Und wieder wird ein Element entfernt. Du bemerkst deine Gier, deine Eigennützigkeit, die sexuellen Phantasien, das Konkurrenzstreben und die Verwirrung deines Geistes. Und du fängst an, diese Elemente herauszupflücken. Denn es sind inakzeptable Wesenszüge der Person, für die man dich deiner Meinung nach hält.
Ich selbst glaube, es ist zweckmäßiger und eigentlich auch zutreffender, wenn wir nicht „mein Geist” sagen, sondern „der Geist”.
Denn wenn du ihn als „meinen Geist” bezeichnest, fängst du an, so viele Elemente zu entfernen, daß dieser zerbrochene Spiegel, wenn du in ihn hineinblickst, nur sehr wenig von dem widerspiegelt, was wirklich existiert. Er zeigt nur jene Eigenschaften, die du als den projizieren möchtest, der du bist. Er eliminiert alles übrige und verschweigt deine Ganzheit. Wir glauben, daß wir etwas zu verbergen hätten. Doch dieser Selbstschutz ist unser Gefängnis. Stelle dir vor, du müßtest in den nächsten vierundzwanzig Stunden eine Kappe tragen, die all deine Gedanken verstärkt, so daß jeder im Umkreis von hundert Metern alles hört, was dir durch den Kopf geht. Stelle dir vor, dein Geist wäre ein Rundfunksender, so daß jeder „deine” Gedanken und Phantasien, „deine” Träume und Ängste mithören könnte. Wärst du nicht ängstlich und verlegen, wenn du deine Wohnung verläßt? Würdest du es der Angst vor deinem eigenen Geist noch erlauben, dich von den Herzen der anderen zu isolieren? Sicherlich würde kaum jemand an solch einem Experiment teilnehmen wollen - aber stelle dir einmal vor, wie befreiend es eigentlich wäre, nichts mehr verbergen zu müssen. Und welches Wunder es wäre, wenn du feststellen würdest, daß auch die anderen diese Verwirrungen und Phantasien, diese Unsicherheiten und Zweifel in ihrem Geist umhertragen! Wie lange würde der urteilende Geist wohl brauchen, um seine Verklammerung zu lösen, um die Illusion der Besonderheit zu durchschauen, um ein wenig amüsiert die Verrücktheit des Geistes aller Menschen zu erkennen, die Verrücktheit des Geistes selbst?
Wir brauchen nichts zu leugnen, um heil und ganz zu sein.
Wir meinen, wir hätten etwas zu verlieren, und die Bestärkung dieses Gefühls, daß es etwas zu beschützen gäbe, schneidet uns vom Leben ab und hinterläßt in uns eine zerbrochene Realität, durch die wir unsere Natürlichkeit ausdrücken wollen. Doch das Leben gerät in Verwirrung, wenn wir die Wahrheit ausklammern. Und wir fragen uns, wie wir, unabhängig davon, was in unserem Geist in Erscheinung tritt, unser ganzes Wesen in unser Leben und in unseren Tod einbeziehen können. Denn wir müssen erkennen, daß sich unser Herz, wenn wir bestimmte Eigenschaften in uns selbst nicht wahrhaben wollen, immer dann verschließt, wenn diese Eigenschaften erscheinen.
Wir fragen uns: Wie kann ich die Offenheit meines Herzens bewahren, wenn ich unangenehme Dinge erlebe, wenn ich meinen Egoismus, meine Angst, meine Schuldgefühle und meine Zweifel so deutlich erkenne? Kann ich mich dem Augenblick auch dann noch öffnen, wenn mein Geist fast nur von Verwirrung beherrscht wird? Oder muß ich in irgendeine Richtung ausweichen? Wir haben wenig Erbarmen mit uns selbst. Wir verbarrikadieren das Herz und fühlen uns allein in einer feindlichen Welt. Nur selten verzichten wir auf ein Urteil und räumen uns selbst einen Platz in unserem Herzen ein. Mangelt es uns so sehr an Mitgefühl für dieses Wesen, dessen Leid wir in unserem Herzen spüren? Müßte uns, wenn wir uns ohne Selbstmitleid völlig zu unserem Schmerz bekennen, nicht eine teilnahmsvolle Sorge um unser eigenes Wohlergehen erfassen? Der Zwang zum Rückzug, zur Maskierung, macht aus sich selbst heraus das Leben zur Hölle. Er erzeugt Widerstand. Und wir verbringen einen großen Teil unseres Lebens in dieser Hölle.
Zorn erfüllt den Geist, und wir geraten in Verwirrung. „Als spiritueller Mensch dürfte ich eigentlich nicht zornig werden. Ich glaube, so spirituell bin ich gar nicht. Ich darf diesen Zorn nicht zeigen.” Aber die Wahrheit dieses Augenblicks ist der Zorn, und wenn wir ihn verdrängen, wenn wir so tun, als wäre er nicht vorhanden, dann haben wir wieder ein Stück Freiheit eingebüßt, eine Widerspiegelung unserer eigenen Wirklichkeit und Nicht-Wirklichkeit. Denn wir kennen das Wesen des Zornes nicht, obwohl wir ihn vielleicht tausendmal erfahren haben. Ebensowenig kennen wir das Wesen der Angst oder des Zweifels - denn wenn diese mentalen Zustände in Erscheinung treten, nutzen wir sie nicht als Möglichkeit zur Erforschung, sondern empfinden sie als eine Notlage, als eine Bedrohung für unser Selbstbild. Wenn wir die Straße entlanggehen und einer Bedrohung gewahr werden, geschieht es sehr selten, daß wir direkt auf sie zugehen. Statt dessen versuchen wir zur einen oder anderen Seite auszuweichen, dem nächsten Augenblick zu entkommen, zu entfliehen. Wir wollen flüchten in die Sicherheit einer künstlichen Realität, eines zerbrochenen Wesens, in dem wir uns irgendwie geborgen fühlen. Wir versuchen ständig, vor der Wahrheit zu fliehen. Wir fürchten uns vor dem weiten Raum des Erforschens, fürchten uns davor, daß die Wahrheit des Augenblicks uns verletzen könnte, und wagen es nicht, uns den Tatsachen zu öffnen. Wir wollen die Welt gefangenhalten, die Realität kontrollieren und ein Abbild unser selbst aus ihr machen.
Es ist dieses Streben nach Kontrolle, worin ein großer Teil unseres Leidens wurzelt. Es ist das Bemühen, die Freuden der Vergangenheit zurückzurufen und die Zukunft vor den Schmerzen unerfüllter Sehnsüchte zu verbarrikadieren. Aber die Ereignisse entziehen sich auf eine sehr direkte Weise unserer Kontrolle. Jetzt nehmen sie diesen Verlauf und im nächsten Moment einen anderen. Und manchmal besteht die Wahrheit darin, daß sich Zorn, Angst oder Gier im Geist erheben, daß Lust oder Unwissenheit ihn erfüllt. All das ist in Ordnung, denn auch diese Zustände stellen Gelegenheiten dar, um tiefere Einsichten zu gewinnen, um über eine Gleichsetzung dieser Zustände mit unserem gesamten Sein hinauszuwachsen.
Aber wenn es nicht in Ordnung ist, daß diese Zustände erscheinen, dann ziehst du dich aus der Gegenwart zurück, schauspielerst dein Leben statt dich ihm zu öffnen - mit jeder Person,die du triffst, im Leugnen der Wahrheit verschworen. Ihr tut so, als hättet ihr beide festen Halt unter den Füßen, und keiner will die Haltlosigkeit des anderen wahrhaben. Es ist das soziale Spiel. Denn einzugestehen, daß ihr beide die Wahrheit eures Wesens versteckt, wäre unhöflich - wie es gleichermaßen unhöflich wäre, verärgert oder entsetzt zu sein. Wir fürchten uns davor, daß die anderen uns nicht mehr lieben würden, wenn wir aufrichtig wären und wenn sie wüßten, was in unserem Geist vorgeht.
Der Zorn ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir unsere Erfahrungen vor uns selbst verstecken. Für viele Menschen stellt er einerseits ein äußerst inakzeptables Phänomen und andererseits eine sehr impulsive Verhaltensweise dar. Doch wenn uns der Zorn zur Erforschung anregt, wird er eher zu einer Meditation über das Leben als zu einer Ablenkung von ihm - dann wird das Flucht-Syndrom, der Widerstand gegen das Leben erkennbar, und wir hören auf, uns zu verstecken. Wir beginnen uns ins Licht zu erheben.
Der Geist vergleicht sich selbst mit Vorstellungen von Buddha oder Jesus, mit Heiligen und selbstlosen Wesen, von denen wir gelesen haben. Und er stellt fest, daß er diesem Vergleich nicht standhält. Der Geist verdammt sich selbst dafür, das zu sein, was er ist, und gleichzeitig weicht er davor zurück, sich fallen zu lassen in die grenzenlose Freiheit, die ihn von seiner Knechtschaft entbinden würde. Wie das übel zugerichtete Kind, das man behutsam von seiner grausamen Mutter fortträgt, schreit der Geist schmerzerfüllt nach dem, was er zurückläßt, voller Furcht davor, was ihn erwartet. Für den Geist ist selbst die Hölle angenehmer und attraktiver als das Unbekannte.
Wir legen uns den Geistesinhalt, den Zorn und die Zweifel, die Angst und den Unwillen schwer zur Last. Und es ist eben dieser Akt der Bewertung, der das Urteilsstreben des Geistes aufrechterhält und uns das Gefühl vermittelt, von uns selbst und allen anderen isoliert zu sein. Er taxiert uns ständig nach unserem Benehmen und nach unserem Beteiligtsein und tritt selten lange genug in den Hintergrund, als daß wir mit unserer Erfahrung verschmelzen, als daß wir uns mit dem Leben vereinen könnten.
Ich bin einigen sehr klarsichtigen Wesen begegnet, doch ich glaube, ich habe niemanden getroffen, der völlig frei von Zorn gewesen wäre. Keinen Zorn zu kennen bedeutet, daß wir keine Verlangen haben, keine Modelle davon, wie die Dinge sein sollten oder sein müßten. Ohne Verlangen gibt es keine Frustration. Ohne Frustration gibt es keinen Zorn. (Doch auch dies ist nur ein Modell, das, wenn wir an ihm festhalten, zu Frustration und Verwirrung führen kann.) Wenn der Geist an nichts, aber auch an gar nichts haftet, dann gibt es auch keinen Zorn. Unser Zorn gleicht einer Art automatischer Zündung, die einsetzt, wenn unsere Vorstellung von den Dingen durch die Realität eingeengt wird.
Unsere Modelle, unsere Vorstellungen davon, wer wir sind und wie die Welt vermeintlich ist, erschaffen einen Käfig. Jedes Konzept wird zu einem Gitter, das die Erkenntnis der Wahrheit blockiert. Jede Vorstellung , die wir von den Dingen haben, begrenzt unsere Fähigkeit, sie so zu erfahren, wie sie wirklich sind. Wir können nicht über unsere Vorstellung von der Welt hinausgelangen, um so tatsächlich mit der Welt in Berührung zu kommen. Wenn wir uns über unsere Modelle und Vorstellungen hinausbewegen, sehen wir uns bedroht und abwehrbereit. In der Konfrontation mit einer Realität, die sich unserem Selbstbild widersetzt, schafft unsere Sicherheit Verwirrung und Bestürzung. Wir wissen nicht, wer wir sind, weil das, wofür wir uns halten, nur in unseren Vorstellungen und alten Modellen besteht. Die Welt konfrontiert uns ständig mit der Wahrheit. Wir ziehen uns ständig zurück. Unsere Erfahrung ist Schmerz.
Einer Realität gegenüber, die das Bild, das wir uns von den Dingen gemacht haben, nicht bestätigt, geraten wir in Panik. Wir wollen uns verstecken. Ich bin oft mit Menschen zusammen, die im Sterben liegen und sich trotzdem noch zu verstecken suchen. Ich vermute, daß viele Menschen sterben, ohne ihr Versteck zu verlassen. Sie gehen mit dem Tod und mit dem Leben immer noch so um, als spiele es sich außerhalb von ihnen ab. Sie gehen mit ihrem Zorn, ihrer Angst und ihren zwischenmenschlichen Problemen in einer Weise um, als würde dies alles von außen kommen, als wären sie Opfer ihrer Gefühle und Gedanken und nicht einfach der Raum, in dem sich dieses ganze Geschehen entfaltet. Wir ziehen es vor, die Wirklichkeit gegen die Sicherheit unseres Käfigs einzutauschen. Ganz gleich, wie klein er ist. Ganz gleich, wieviel Schmerzen uns dieser Rückzug aus dem Leben bereitet.
Man kann unsere Angst vor dem Tod unmittelbar mit unserer Angst vor dem Leben gleichsetzen. Wenn wir ans Sterben denken, denken wir, daß wir etwas verlieren, welches wir „Ich” nennen. Wir möchten dieses Etwas um jeden Preis bewahren, obwohl wir nicht einmal genau wissen, ob sich dieses „Ich” noch auf etwas anderes als nur eine Vorstellung bezieht, die sich offenbar ständig ändert. Wir befürchten, wir würden im Tod unser „Ich” oder unsere „Ich-Heit” verlieren. Und wir stellen fest, daß das Gefühl einer Absonderung vom Leben und einer Angst vor dem Tod umso ausgeprägter ist, je stärker diese Vorstellung von einem „Ich” entwickelt ist. Je mehr wir diese Vorstellung zu bewahren versuchen, desto weniger erfahren wir, was jenseits von ihr liegt. Je mehr wir investiert haben, um etwas zu bewahren, das „mir” gehört, desto mehr haben wir zu verlieren und desto weniger öffnen wir uns der tieferen Wahrnehmung dessen, was stirbt, dessen, was wirklich existiert. Je mehr wir das Leben verstecken oder maskieren oder hinausschieben, desto mehr fürchten wir den Tod.
Indem wir dieses kostbare „Ich” schützen, schieben wir das Leben beiseite, um uns anschließend über seine Sinnlosigkeit zu wundern.
Solange wir noch etwas zu verbergen haben, können wir nicht frei sein. Solange wir die Inhalte des Geistes als Feind betrachten, sind wir eingeschüchtert und glauben, es gäbe etwas Besonderes in uns, das nicht in Ordnung ist. Wir erkennen nicht, daß der Geist lediglich das Resultat früherer Konditionierung und nichts Besonderes ist. Daß all diese von uns so sehr gefürchteten Geisteszustände eigentlich wieder in unseren Acker eingepflügt werden und zu einem Dünger für weiteres Wachstum umgewandelt werden können. Doch um diese Stoffe kompostieren und in fruchtbaren Dünger für unser Wachstum verwandeln zu können, müssen wir beginnen, uns selbst in unserem Herzen Raum zu geben. Wir müssen beginnen, das Mitempfinden zu entwickeln, das dem Augenblick seine freie Entfaltung im klaren Licht des Gewahrseins und ohne den geringsten Aufschub der Wahrheit gestattet.
Eigentlich sind wir auf uns selbst oft wie auf ein Puzzle bezogen, aus dem viele Teile entfernt worden sind. Wir starren auf das völlig entstellte und verwirrende Bild, das wir konstruiert haben, und wir sind irritiert.
Wir betrachten unser Puzzle, sehen nur die Einzelteile, nur die zerteilte und bruchstückhafte Oberfläche des Geistes und fragen uns: „Wer bin ich eigentlich wirklich?” Indem wir uns so auf unsere Zerbrochenheit einstellen und uns mit ihr identifizieren, bekommen wir Angst vor uns selbst. Aber wenn wir es uns gestatten, tiefer zu dringen, daran arbeiten, diese Dinge anzuerkennen und uns von unserer Voreingenommenheit und unserem Versteckspiel zu lösen, dann verschleiern die Bruchstücke nicht mehr das gesamte Bild. Es ist, als würden wir unter die Oberfläche eines sturmgepeitschten Sees tauchen und in eine Stille gelangen, die von den Bewegungen der Oberfläche nicht berührt wird.
Wir dringen allmählich durch das Chaos der Oberfläche und stellen fest, daß das ganze kalte Büfett mit seinen Schuld-, Zorn- und Angstgefühlen, das der Geist dort abgestellt hat, nichts ist, vor dem wir uns fürchten müssen. Wir glauben, daß diese verdrängten Dinge unsere eigentliche Identität ausmachen. Doch indem wir beginnen, diese Eigenschaften anzuerkennen, sie uns bewußt zu machen und uns ihnen mit ein wenig Anteilnahme an der menschlichen Verfassung, in der wir uns sehen, zu öffnen, können wir tiefer eintauchen in das, was sich unter dieser scheinbar stabilen Realität verbirgt. Solange wir bestimmte Aspekte in uns selbst nicht wahrhaben wollen, können wir nicht durch die Oberfläche dringen. „Selbsterkenntnis - das sind schlechte Nachrichten”, sagte ein Freund. Und ein tibetischer Lehrer sagte vom Eindringen in diese Schicht verdrängten Materials: „Es ist wirklich eine Beleidigung nach der anderen.” Die meisten Menschen haben Angst davor, sich mit all dem Stoff zu konfrontieren, den sie unterdrückt haben, weil sie immer noch glauben, daß er identisch mit dem sei, was sie sind. All diese verbotenen Geisteszustände, die wir unter die Oberfläche des Gewahrseins geschoben haben, um unser Selbstbild zu schützen, erschrecken uns.
Und doch erkennen wir, daß wir nichts verdrängen müssen. Wenn wir etwas verdrängen, von dem wir glauben, daß es inakzeptabel sei, schieben wir es unter die Schwelle des Bewußtseins. Und mit diesem Akt der Verdrängung versklaven wir uns selbst. Wir haben das Leben wieder einmal hinausgeschoben. Nichts kann aus diesem Gefängnis der Dunkelheit freikommen, solange es nicht ins Licht des Gewahrseins gebracht wird. Die Verdrängung schiebt die Dinge aus dem Gewahrsein hinaus, und ein Zugriff auf sie ist nicht mehr möglich. Die uns motivierenden Neigungen sind zwar noch immer vorhanden, aber wir haben keinen Zugang mehr zu ihnen. Also müssen wir ein Gefühl nach dem anderen anerkennen und es ohne Bewertung oder Furcht in in klarer Bewußtheit lassen, wo es als das betrachtet werden kann, was es ist: ein zeitweiliger,überraschend unpersönlicher Zustand des Geistes, der uns durchfließt. Daß wir in einer unlösbaren Situation gefangen seien, daß das Leben eine Strafe sei anstelle eines Geschenks, haben wir uns nur eingebildet.
Immer dann, wenn wir uns als „Ich” mit dem Zorn oder mit Zweifeln oder Schuldgefühlen identifizieren, verdrängen wir diesen Geisteszustand und können nicht tiefer eindringen. Immer, wenn du irgendetwas „Ich” nennst, ist dies der Punkt, an dem du stehenbleibst. Es ist der Punkt auf der Tiefenskala, den du erreichst. Es ist der Punkt, an dem du den Fahrstuhl verläßt. Aber wenn du dem Zorn gegenüber offen bleibst und den Zorn zuläßt, dringst du tiefer ein. Du beginnst den Raum zu erfahren, in dem diese Dinge entstehen und wieder vergehen. Du beginnst den Raum zu erfahren, in dem der Zorn dahinfließt. Dieser Moment ist kein Moment des Zorns, sondern ein Moment klarer Bewußtheit. Und dann hörst du auf, dich selbst mit dem Zorn zu identifizieren. Du beobachtest ihn, verlierst dich aber nicht in ihm.
Wir hören allmählich damit auf, diese verschiedenen Qualitäten des Geistes für das Ich" zu halten und fangen an, uns dem Raum, der Ganzheit zu öffnen, in der sich die Ereignisse vollziehen: Es ist ein wertfreier, überaus teilnahmsvoller Raum, zu dem uns das Herz Zugang gewährt, und der die Objekte des Geistes weder umklammert noch verdammt. Dieser Raum ist die Essenz des Geistes selbst. Er nennt sich nicht „Susanne” oder „Frank” oder „Ondrea” oder „Ich”. Er ist einfach. Es ist der Raum der Ist-Heit selbst. Er ist der Ursprung dessen, worauf wir uns beziehen, wenn wir sagen: „Ich bin.” Er ist das Gewahrsein, das wir irrtümlich „Ich” nennen.
Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, nach außen zu schauen, daß wir vergessen haben zu fragen, wer es eigentlich ist, der schaut.
Wir haben so selten teil an unserer natürlichen Weiträumigkeit, daß wir zu der Meinung gelangt sind, wir selbst seien all das, was aus dem Geist hervorgeht. Wenn unsere Verwirrung den Geist erfüllt, schrumpfen wir zu einem unvollständigen Puzzle von Dingen zusammen. Wir verlieren unsere natürliche Weiträumigkeit. Wenn wir ans Sterben denken, glauben wir, den zu verlieren, der wir sind. Wir denken, wir könnten nicht mehr dieses oder jenes sein, für das wir uns halten. Doch wenn wir sehr aufmerksam sind, bemerken wir, daß wir immer dann, wenn wir sagen „ich bin dies” oder „ich bin das”, in gewissem Maß das Gefühl haben, zu lügen. Daß immer dann, wenn sich das „Ich bin” des reinen Seins an diesem oder jenem in der Welt verhaftet, ein Gefühl von Unwahrheit, von Unvollständigkeit vorhanden ist, ein Gefühl der Verschleierung der vollen Wirklichkeit. Wenn wir sagen „ich bin glücklich” oder „ich bin traurig”, „ich bin klug” oder „ich bin schön”, dann erkennen wir, daß all die Dinge, die wir mit diesem „ich bin” verbinden, in ständiger Veränderung begriffen sind - daß wir in diesem Moment glücklich sind und im nächsten stolz, daß wir im folgenden Moment diesen Stolz bewerten und im nächsten verlegen sind - daß wir uns dann wieder erinnern und auf das „ich bin” besinnen und von vorn beginnen, um uns anschließend schon wieder in „diesem” oder „jenem” zu verlieren, mit dem wir das „Ich bin” des reinen Seins so oft verbinden. „Ich bin dies” oder „ich bin das” fühlt sich irgendwie unwahr an. Denn es gibt in diesem Universum des Wandels keine Bezeichnung, die über längere Zeit hinweg auf mich zutreffen würde, und nichts, von dem ich sagen kann, daß ich es bin, umfaßt die ganze Wahrheit. Eigentlich haben wir die meiste Zeit das Gefühl, wir würden vorgeben, jemand anders zu sein - einfach indem wir so tun, als würden wir überhaupt etwas darstellen. Aber wenn wir einfach sagen „ich bin”, werden wir gewahr, daß da nur Raum, nur Sein ist - daß dieses „Ich” sich nicht auf etwas Isoliertes, auf etwas außerhalb von uns selbst oder auch nur auf den Körper oder auf den Geist bezieht. Da ist einfach ein Gefühl von Gegenwart, von Sein. Wenn du sagst „ich bin”, und wenn ich sage „ich bin”, dann beziehen wir uns auf dasselbe Sein. Wir beziehen uns auf das Sein selbst. Aller Menschen „Ich” ist dasselbe „Ich”. Es erfährt nur dann eine Isolation und beschwört Religionskriege herauf, wenn wir ein „Dies” oder „Das” damit verbinden. Wenn du sagst „ich bin dies”, dann geht die Universalität des Seins verloren. Wenn du sagst „ich bin diese Freude oder diese Angst oder dieser Geist oder dieser Körper”, wird die Wahrheit zerschmettert wie der Spiegel, den der Stein zerschlägt. Das Eine ist in das Viele zerbrochen.
Wir versuchen ständig, jemand oder etwas zu werden. „Ich bin dies” drückt die Vorstellung aus, daß ich nicht „das” bin. Wie aber wirst du, wenn Neid oder Angst oder Schuldgefühle den Geist erfüllen, diese Wesenszüge mit deinem Selbstbild vereinbaren? Kannst du dich von jenem eingebildeten Selbst lange genug lösen, um dich den Inhalten des Augenblicks öffnen zu können, ganz gleich, welche es sind? Kannst du dich dem öffnen und über das hinausgelangen, was Zorba der Grieche „die ganze Katastrophe” nennt? Denn es kann ja nur dann eine Katastrophe geben, wenn es etwas zu vermeiden gilt. Wirst du, wenn Eifersucht oder Neid in dir aufkommen, dein Herz offenhalten, diese Verhärtung im Geist genauer erforschen und erkennen, welche Isolation diese bedrükkenden Emotionen erzeugen können und wie rasch diese Zustände die Vorstellung eines „Ich” herbeiführen? Wir überschreiten die Emotionen sehr selten, weil wir glauben, wir müßten sie entweder ausdrücken oder unterdrücken, und weil wir nie begreifen, daß wir der weite Raum des Seins selbst sind.
Warum kannst du, wenn du die zwanghafte Reaktion des Geistes auf seine Inhalte erkennst, kein Mitgefühl mit diesem Wesen empfinden, das zeitweise in solchem Schmerz gefangen ist? Betrügen wir uns nicht selbst, wenn wir uns selbst fast alles Mitgefühl verwehren? Wir behandeln uns selbst so, wie wir eine andere Person nie behandeln würden. Irgendwie glauben wir, es sei in Ordnung, wenn wir so mit uns umgehen; denn wir haben das Gefühl dafür, wer wir sind, verloren. Wir haben vergessen, daß auch wir die Wahrheit sind.
Diese Vergeßlichkeit verursacht großen Schmerz. Und dieser ist es, auf den wir uns meist beziehen, wenn wir von unseren Sorgen sprechen. Er resultiert aus dem Verlust der Verbindung mit unserem ursprünglichen Wesen. Wir haben so vieles verdrängt, haben so viele unserer Eigenschaften als inakzeptabel und beängstigend eingestuft, daß wir sie, sobald sie in Erscheinung treten, unterdrücken und die enstehende wirre Masse nur allzu leicht für unsere „verborgene Identität” halten. Diese Empfindungen stehen in so starkem Widerspruch zu unseren Modellen, daß sie unserem Käfig nur noch weitere Gitterstäbe hinzufügen. Jede einzelne Verdrängung macht den Käfig enger.
Wir fördern die Unwissenheit, indem wir uns bemühen, jede Berührung des Gewahrseins mit den tieferen Schichten unserer „Industriemüll-Deponie” zu unterbinden.
Daß dort unser „wahres Wesen” liegen könnte, macht uns Angst, denn wir verstehen nicht, auf welche Weise Zorn oder Angst oder Eifersucht uns zur lebendigen Wahrheit führen können. Du erfährst es nicht aus dem, was ich dir sage oder was Krishnamurti oder Buddha oder Jesus dir sagt. Du mußt dich selbst entdecken. Denn du bist die Wahrheit. Und niemand anders als du selbst kann dich zu ihr führen. Buddha, Jesus, Krishna und Rand McNally hinterließen ihre Straßenkarten. Aber die Reise auf der Straße mußt du selbst antreten. So wie die Freundin, welche einen Zen-Meister bat, er möge ihr die Lehren erteilen, die ihr bei der Befreiung von den oberflächlichen Träumen der Isolation und der Angst helfen würden. Sie sagte: „Ich bin hergekommen, um Wissen über den Pfad zu erlangen.” Nachdem der Zen-Meister einen Moment geschwiegen hatte, deutete er in liebevoller Strenge auf sie und sagte: „Du bist der Pfad!”
Wenn dir allmählich klar wird, daß du selbst der Pfad bist, daß das ganze Leben nichts anderes ist als eine Reflexion des Geistes, dann bietet sich dir mit jeder neuen Erfahrung die Gelegenheit, dich aus dem Gefängnis zu befreien. An diesem Punkt beginnst du zu verstehen, daß das Leben die Möglichkeit zur Ganzheit bietet, zur Eröffnung der Wahrheit. Du beginnst zu forschen: „Was schließt mich von dieser essentiellen Weite des Daseins aus? Wer bin ich wirklich?”
Es gibt in Thailand einen Meditationsmeister namens Achaan Chaa, der in jungen Jahren Mönch geworden war, weil er einfach nur verstehen wollte, was dieser Körper bedeute und wer er selbst wirklich sei. Er wollte, wie er sagte, „nur so viel” verstehen, nur diesen einen Moment des sich entfaltenden Daseins. Nachdem er einige Jahre praktiziert hatte, kamen ihm Gerüchte zu Ohren, daß es im Norden Thailands einen Meditationsmeister gäbe, der in dem Ruf stünde, keinen Zorn zu kennen. Man mache sich klar, worauf das hinweist. Es weist auf einen Geist hin, der an nichts haftet. Auf einen Menschen, der sich so weit in Einklang mit seinem ursprünglichen Wesen gebracht hat, daß er kein Objekt des Geistes, auch nicht den Zorn, als das betrachtet, was er selbst wirklich ist. Er identifiziert sich nicht mit irgendetwas, das getrennt von der Wahrheit in Erscheinung tritt.
Als er von diesem großen Lehrer hörte, verließ er das Kloster, in dem er praktiziert hatte und machte sich auf den Weg, um diesen Lehrer zu fragen, ob er sein Schüler werden dürfe. Etwa anderthalb Jahre verbrachte er bei dem Lehrer, und dieser Mann schien sich niemals zu ärgern. Sehr beeindruckend! Als er dann eines Tages in der abgewinkelten Küche stand, in der die beiden arbeiteten, sah er, ohne daß ihn der Lehrer sehen konnte, wie ein Hund in den Raum kam und auf den Küchentisch sprang, um sich dort einen Leckerbissen zu schnappen. Der Meditationsmeister blickte sich nach beiden Seiten um und stieß den Hund vom Tisch. Da war sie, die Lehre für Achaan Chaa! Welche Qual, welche unbeschreibliche Erbarmungslosigkeit muß damit verbunden sein, aus welchen Gründen auch immer vorzutäuschen, daß das, was im Geist existiert, gar nicht vorhanden ist! Und doch nehmen wir eben diese Exekution an uns selbst vor, wenn wir vortäuschen, etwas zu sein, das wir nicht sind - nur teilweise geboren, nur teilweise lebendig, erstaunt darüber, wie schwer das Leben ist.
Wenn wir eine Ganzheit sein wollen, das Leben völlig leben und völlig sterben wollen, dann dürfen wir nichts leugnen. Es heißt, daß die Indianer eine Tradition hatten, die sie „Verschlinger der Unreinheiten” nannten: An einem hochheiligen Tag, der Sonnenwende entsprechend, setzte sich der Schamane, der weise Mann des Stammes, mit jedem einzelnen Mitglied des Stammes zusammen und empfahl ihm etwa folgendes: „Laß einen Gedanken oder ein Gefühl in deinen Geist treten, von dem du möchtest, daß niemand sonst davon weiß - irgendeine Vorstellung oder Phantasie, irgendetwas, das du für abwegig oder verabscheuenswert hältst und wovon du glaubst, daß du es unterdrücken und verbergen mußt.” Oft war jene Person so erschrocken, daß sie kaum fähig war, einen solchen Gedanken in sich zuzulassen, aus Angst, daß er ihr heimlich entschlüpfen und gehört werden könne - daß jemand das schreckliche Innenleben ihres Geistes belauschen könne. Aber der Schamane ermutigte die Person dazu, sich einzugestehen, wie schrecklich es für sie war, sich selbst zu entblößen, verwundbar zu sein, auf die Ganzheit zuzugehen. Und nach einer Weile sagte er: „Sage mir diesen Gedanken jetzt.” Und der Gedanke oder die Vorstellung wurde ausgesprochen und zwischen ihnen geteilt. Und das Dunkel, in dem er zurückgehalten worden war, wurde vom Licht des Vertrauens und Mitgefühls dieses Augenblicks erhellt. Und jeder erkannte von neuem, wie wenig es zu schützen galt und wieviel Raum das Herz für all die Schlängelpfade des Geistes hat. Ein Lehrer drückte es so aus: „Der Geist erschafft den Abgrund, das Herz überquert ihn.”
Doch wenn sich Geist und Herz verschlossen haben, kann es hilfreich sein, sich ganz ruhig hinzusetzen und der folgenden Übung zu widmen.
LASS DEN GEIST IM HERZEN SCHWEBEN
(Dies ist eine geleitete Meditation. Man kann sie einem Partner ganz langsam vorlesen und auch allein mit ihr arbeiten.)
Mache dir irgendeinen inakzeptablen Gedanken bewußt. Einen Gedanken, von dem du möchtest, daß niemand von ihm weiß.
Laß ihn einfach existieren.
Begleite ihn aber mit Deinem Mitempfinden.
Fühle, wie sich der Geist um diesen Gedanken zusammenzieht, wie er ihn aus dem Dasein verdrängen möchte. Erkenne, wie der Geist vor sich selbst zurückschreckt. Fühle die Struktur der Angst. Erkenne den Spiegel, vor dem wir unser Leben führen.
Nimm jetzt diesen Gedanken und laß ihn, anstatt ihn mit Ablehnung und Anspannung zu umschließen, frei im Geiste schweben. Laß ihn einfach vorhanden sein.
Gestatte diesem Gedanken, als eine geistige Wahrnehmung erfahren zu werden.
Fühle seine Dichte, seine scharfen Kanten.
Laß es allmählich zu, daß dieser Gedanke in dein Herz hinabsinkt. Führe diese Wahrnehmung durch die Kehle hinunter und in deinen Körper hinein. Laß sie inmitten deiner Brust im Herzen zur Ruhe kommen. Laß den Gedanken dort einfach sich selbst denken. Überlasse ihn der Weite, in der alles Raum hat und nichts bewertet wird.
Mag es der Gedanke an Masturbation, Homosexualität, Gewalt, Angst oder Unehrlichkeit sein. Welcher Gedanke es auch sei, von dem du glaubst, daß ihn der Geist nicht akzeptieren könne - laß ihn sanft in die außergewöhnliche Offenheit des Herzens hineinsinken, wo er in Wärme und Geduld aufgenommen wird.
Die natürliche Weite des Herzens schließt nichts aus. Teilnahmsvoll erlebt sie jeden Gedanken einfach als eine weitere Bewegung im Geist, als ein weiteres Gefühl.
Erfahre dies jetzt, und schwebe in diesem sanften Mitgefühl dahin. Erkenne das Gefängnis, das die Angst im Geiste bildet. Komm hinaus in die Wärme und Liebe deines wahren Wesens.
Was gibt es zu fürchten?
Was ist den Preis der Gefangenschaft des Selbstschutzes wert?





























