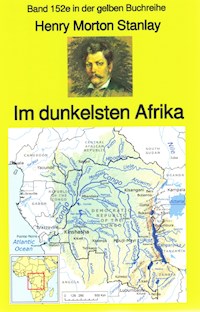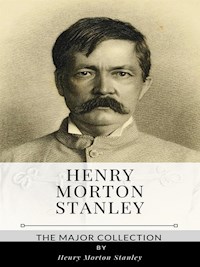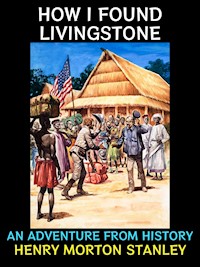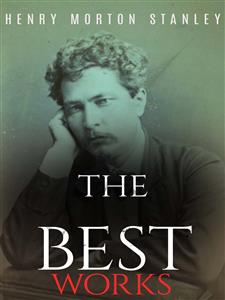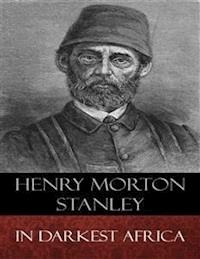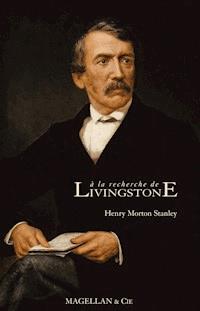Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Erdmann in der marixverlag GmbH
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Als der junge Reporter Henry Morton Stanley 1869 von seinem exzentrischen New Yorker Verleger ins Pariser Grand Hotel bestellt wird – wo er seinen Chef im Schlafanzug vorfindet –, ahnt er nichts vom gigantischen Ausmaß des abenteuerlichen Auftrags, der sein Leben verändern wird. Seine Mission, koste es was es wolle: von Sansibar aus an der Spitze eines hundertköpfigen Suchtrupps ins Innere des "Schwarzen Kontinents" vordringen, um den verschollenen Afrikaforscher David Livingstone zu finden. Der Gewaltmarsch durch Dschungel und Savanne fordert seinen Tribut: ein Großteil von Stanleys Begleitern desertiert, meutert oder fällt Tropenkrankheiten zum Opfer. Nach acht lebensgefährlichen Monaten findet er am 10.11.1871 im kleinen Dorf Ujiji am Tanganjikasee endlich den von vielen bereits Totgesagten. Stanleys trocken-ironische Begrüßungsformel – "Dr. Livingstone, nehme ich an?" – geht in die Geschichte ein. Der junge Reporter rettet dem berühmten Afrikaforscher das Leben und dank Livingstones Einfluss entwickelt sich Stanley später selbst zum renommierten Afrikaforscher. Egal ob man heute Stanleys Route auf der Suche nach Livingstone folgt oder die vielen Stationen von Livingstones Expeditionen entdeckt – überall findet man atemberaubende Natur, deren einzigartige Schönheit in Natur- und Nationalparks gewürdigt und geschützt wird. Von den von Livingstone entdeckten Victoriafällen in Sambia – heute UNESCO Weltnaturerbe – bis zu den Nationalparks – Gombe-Stream und Mahale Mountains – am Tanganjikasee: traumhafte Natur pur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 517
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Henry Morton Stanley
WIE ICH LIVINGSTONE FAND
Reisen und Entdeckungen in Zentral-Afrika
Herausgegeben von Heinrich Pleticha
Henry M. Stanley
INHALT
Livingstone und Stanley – Begegnung als Schicksal
Einleitung
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Karte eines Teils von Ostafrika
Worterklärungen
Quellen und Literatur
LIVINGSTONE UND STANLEY – BEGEGNUNG ALS SCHICKSAL
»Dr. Livingstone, I presume?«
Kaum ein anderer Satz aus den Reisewerken der Entdecker ist so populär geworden wie diese steife Frage des jungen Journalisten Henry Morton Stanley am Freitag, dem 10. November 1871, bei seiner ersten Begegnung mit dem berühmten Afrikaforscher David Livingstone in Udschidschi, einem Sklavenhändlerdorf am Ostufer des Tanganikasees. 236 Tage war Stanley unterwegs gewesen und hatte in dieser Zeit von der ostafrikanischen Küste aus gut tausend Kilometer zurückgelegt, um im Auftrag eines amerikanischen Zeitungsverlegers den im Herzen Afrikas verschollenen Livingstone zu suchen.
Man kann sich kaum größere Gegensätze vorstellen als die beiden Männer, die an diesem abgelegenen Fleck der Erde zusammentrafen: der achtundfünfzigjährige erschöpfte und schwerkranke Arzt, der, ohne es zu ahnen, nun schon am Ende seiner Forscherlaufbahn stand, und der einunddreißigjährige energische Journalist, der über keinerlei Erfahrungen als Afrikareisender verfügte und völlig unbekümmert in dieses Abenteuer gezogen war. Für den einen war die Begegnung ein letzter Lichtblick in einer schwierigen Lage, für den anderen sollte sie zum Schicksal werden, sollte ihn entscheidend verändern und prägen und ihn auf seine eigentliche Bestimmung als Forscher verweisen. Nur eines hatten diese beiden Männer gemeinsam, beide stammten sie aus einfachsten Verhältnissen und hatten sich ihren Weg nach oben, der zugleich ein Weg in den dunklen Erdteil war, ebenso mühsam wie energisch erkämpfen müssen1.
David Livingstone wurde am 29. März 1813 in Blantyre in der Nähe von Glasgow in Schottland geboren. Er stammte aus einer alten Bauernfamilie, doch hatte schon der Großvater seinen kleinen Besitz verkauft und sich in der Hoffnung auf bessere Lebensbedingungen Arbeit in einer der damals gerade aufblühenden Baumwollspinnereien gesucht. Der Vater verdiente sein Geld als Teekrämer, die Mutter musste mehr schlecht als recht die Kinder versorgen. Kein Wunder also, dass David schon mit zehn Jahren in die Fabrik geschickt wurde, um durch seinen kleinen Verdienst zur Verminderung der familiären Sorgen beizutragen. Der Junge war aber nicht gewillt, sich mit diesem Schicksal abzufinden. Für einen Teil des ersten Wochenverdienstes kaufte er sich ein Lehrbuch der lateinischen Sprache. Nach der Arbeit besuchte er von acht bis zehn Uhr eine Feierabendschule, die von den Fabrikbesitzern eingerichtet worden war. Dann studierte er daheim bis Mitternacht weiter, obgleich er um sechs Uhr früh schon wieder mit der Fabrikarbeit beginnen musste. Nebenbei verschlang er in seiner Lesewut alle Bücher, die er nur auftreiben konnte, besonders naturwissenschaftliche Werke und Reiseliteratur.
Schließlich reifte in ihm der Plan, als Missionar nach China zu gehen. Es war kennzeichnend für Livingstones praktische Einstellung, dass er zugleich beschloss, sich eine solide medizinische Ausbildung zu verschaffen, um für den erstrebten Beruf besser geeignet zu sein. So kaufte er sich einige ältere medizinische Werke und setzte mit ihrer Hilfe zuerst einmal sein Selbststudium fort. Eine Lohnaufbesserung nach einigen Arbeitsjahren ermöglichte es ihm, im Sommer genug für den Unterhalt der Familie zu verdienen und im Winter an der Universität Glasgow Vorlesungen über Medizin und Theologie zu besuchen. Auf Empfehlungen einiger Freunde schloss er sich einer konfessionell nicht gebundenen Missionsgesellschaft in London an, die den strebsamen jungen Mann unterstützte, der schließlich seine medizinischen Studien erfolgreich abschloss. Sein Plan, nach China zu gehen, scheiterte allerdings an den politischen Verhältnissen, da der sogenannte Opiumkrieg dort jede missionarische Tätigkeit verhinderte. Dafür lenkte der Missionar Robert Moffat (1795–1883), einer der besten Kenner Südafrikas, Livingstones Aufmerksamkeit auf das noch weitgehend unerschlossene Gebiet. Dieser nahm die Anregung dankbar auf und reiste 1840 nach Afrika.
Die folgenden Jahre verbrachte er zuerst als Arzt und Missionar auf der Station Moffats, dessen Tochter er 1844 heiratete. Zusammen mit ihr zog er nördlich in das Landesinnere und gründete 1847 eine neue Missionsstation in Kolobeng. Die dort lebenden Buren zwangen ihn aber, seine Tätigkeit wieder aufzugeben, und deshalb entschloss er sich 1849 zu einer ersten größeren Entdeckungsreise durch die Kalahari, um den Ngamisee zu suchen, von dessen Vorhandensein er Kenntnis erhalten hatte. Als er ihn tatsächlich entdeckte, war das ein beachtenswerter Erfolg für den damals in der wissenschaftlichen Welt noch völlig unbekannten Missionar, der zugleich sein Leben von Grund auf verändern sollte; denn von nun an widmete er sich in zunehmendem Maß der wissenschaftlichen Forschung. Da die Kenntnis des südlichen Afrika um die Mitte des 19. Jahrhunderts noch ausgesprochen dürftig war, entschloss er sich 1852 zu einer großen Reise, die ihn berühmt machte2.
Er zog erst am Sambesi aufwärts, überquerte dann die Wasserscheide zum Kongo, wandte sich nach Nordwesten und erreichte schließlich nach erheblichen Strapazen Ende Mai 1854 die portugiesische Niederlassung Loanda an der Atlantikküste. Die Reise war zwar ein wesentlicher Beitrag zur Erforschung Afrikas, doch bewies sie gleichzeitig, dass sich im Gegensatz zu Livingstones Vermutung die verfolgte Route nicht praktisch nutzen ließ. Kurz entschlossen kehrte er deshalb auf dem fast gleichen Weg wieder zurück und wandte sich im November 1855 nach Osten, um dem Sambesi abwärts bis zum Indischen Ozean zu folgen. Gleich zu Beginn dieses neuen Reiseabschnitts entdeckte er die großen Wasserfälle des Sambesi, die er nach seiner Königin Victoriafälle benannte. Ende Mai 1856 erreichte er die Ostküste des Erdteils und hatte damit innerhalb von vier Jahren als erster europäischer Reisender das südliche Afrika durchquert.
In den Jahren zwischen 1858 und 1864 unternahm er acht kleinere, weniger beachtete Reisen, auf denen er den Unterlauf des Sambesi genauer erforschte. 1864 bereitete er dann im Auftrag der Königlichen Geographischen Gesellschaft ein neues großes Unternehmen vor, bei dem er das Rätsel der Nilquellen lösen wollte. Schon 1858 hatten Richard F. Burton und John H. Speke von Ostafrika aus das zentralafrikanische Seengebiet erreicht und den Tanganika- und den Victoriasee entdeckt, doch war es ihnen nicht gelungen, die Trennung der Flusssysteme von Nil und Kongo zu klären. Livingstone plante, an ihre Erfolge anzuknüpfen. Er zog 1865 von der Ostküste bis zum Njassasee und an dessen Westufer vorbei nach Norden, bis er im April 1867 das Südende des Tanganikasees erreichte. Von hier aus wandte er sich westwärts zum Merusee und kam im Juli 1868 an den Bangweolosee. Von da aus kehrte er wieder nach Norden zurück, wo er in Udschidschi, das wir in dem folgenden Text näher kennenlernen, Nachschub an Lebensmitteln und Medikamenten vorzufinden hoffte. Aber diese Vorräte waren gestohlen worden. Statt daraufhin die an sich schon langdauernde und erfolgreiche Expedition abzubrechen und auf dem bekannten Karawanenweg an die Ostküste zurückzukehren, beschloss er, trotz aller Schwierigkeiten erneut in das Gebiet westlich des Sees vorzustoßen und dort die Flusssysteme zu erkunden.
Livingstone war zu diesem Zeitpunkt der Lösung des Problems sehr nahe, wenn er auch seine Aufmerksamkeit zu stark auf mögliche Quellflüsse des Nils konzentrierte und die Möglichkeit einer Verbindung dieser Flüsse mit dem Kongo außer Acht ließ. Immerhin gelangte er westwärts bis Njangwe (Nyangwe), einem wichtigen Stützpunkt der Sklavenhändler am Lualaba, den er für den Oberlauf des Nils hielt. Unruhen der Eingeborenen und Intrigen der Sklavenhändler verhinderten eine Weiterfahrt flussabwärts und damit die Erkenntnis, dass es sich hier um einen der Quellflüsse des Kongo handelte, wie erst neun Jahre später Stanley beweisen sollte. So aber kehrte er nach Udschidschi zurück. Seine lange Abwesenheit und Aussagen von Eingeborenen hatten in Europa das Gerücht von seiner Ermordung aufkommen lassen und schwere Besorgnis ausgelöst. Deshalb sandte der New Yorker Zeitungsverleger James Gordon Bennett im November 1869 den jungen Reporter Henry Morton Stanley auf die Suche nach Livingstone.
Dieser hieß eigentlich John Rowlands und wurde 1841 als uneheliches Kind einer Magd und eines kurz zuvor verstorbenen Landwirts in dem kleinen Dorf Denbigh, unweit Liverpool, geboren. Not und tiefstes Elend zeichneten die Kindheit des kleinen John, der von niemandem geliebt, von allen aber als Last empfunden und dementsprechend umhergestoßen wurde. Mit siebzehn Jahren hielt er es schließlich nicht mehr daheim in England aus und ging als Schiffsjunge nach Amerika. In New Orleans fand er Unterkunft bei einem Kolonialwarenhändler, der den aufgeweckten Jungen schließlich als Pflegesohn annahm und ihm auch seinen Namen – Henry Stanley – gab. Aber schon 1861 starb der Pflegevater, und der nun zwanzigjährige Stanley war wieder auf sich selbst gestellt. Während des Sezessionskrieges kämpfte er als Freiwilliger in der Armee der Südstaaten, diente dann in der Flotte der USA und versuchte sich schließlich als Journalist. Er bewies Begabung und Wagemut, ging erst nach Kleinasien und dann als Kriegsberichter des »New York Herald« nach Abessinien. Sein Verleger schätzte die Fähigkeiten des jungen Mannes richtig ein, und so kam es zu jener Szene, die Stanley in der Einleitung dieses Buches schildert.
Stanley mag in seinem Bericht die nachfolgende Suche und nicht zuletzt auch seine eigenen Verdienste daran journalistisch etwas aufgebauscht haben. Zudem hatte er ein gutes Gespür für wirkungsvolle Effekte, und gewiss war es auch nicht so schwierig, Livingstone aufzufinden; denn die Nachrichtenverbindungen arabischer Händler funktionierten vorzüglich. Aber er hat mit der ihm eigenen anerkennenswerten Energie diese Reise zu einem Zeitpunkt verwirklicht, zu dem seine Landsleute unnötig zögerten, und er hat damit dem kranken und erschöpften Livingstone im entscheidenden Augenblick noch einmal eine Überlebenschance verschafft. Dass sie dieser nicht oder, besser gesagt, in einem anderen Sinne nutzte, als man normalerweise erwartet hätte, lag im Charakter des zähen Schotten begründet, der den Rettungsanker nicht ergriff, sondern in dem für ihn typischen Pflichtbewusstsein ausharrte und trotz seiner Erschöpfung die einmal gestellte wissenschaftliche Aufgabe lösen wollte.
Wie ernst die Lage für Livingstone in den Tagen unmittelbar vor dem Eintreffen Stanleys geworden war, geht aus seinen eigenen Tagebuchaufzeichnungen hervor, die in ihrer Nüchternheit zugleich ein interessantes Gegenstück zu Stanleys dramatischer Schilderung bilden:
»23. Oktober.3 – Bei Tagesanbruch nach Udschidschi aufgebrochen. Daselbst von allen Arabern … begrüßt. Ich bin bis zum Skelett abgemagert, da aber hier täglich Markt gehalten wird und alle Arten heimischer Lebensmittel feilgeboten werden, so hoffte ich, gute Verpflegung und Ruhe würden mich bald wieder herstellen; am Abend kamen jedoch meine Leute und meldeten mir, Shereef habe alle meine Waren verkauft. Diese Nachricht wurde durch Moenyeghere bestätigt, der mir sagte: ›Wir protestierten dagegen, er ließ aber von 3000 Ellen Kattun keine einzige übrig, ebenso wenig von den 700 Pfund Perlen eine Schnur.‹ Das war eine sehr niederschlagende Kunde. Ich hatte mich entschlossen, falls ich keine Leute in Udschidschi bekommen könne, daselbst zu warten, bis Begleiter für mich von der Küste her eintreffen würden, aber dass ich dort als Bettler warten sollte, hatte ich nicht mit in Berechnung gezogen, und ich fühlte mich sehr unglücklich bei diesem Gedanken …
24. Oktober. – Meine Waren sind an Shereefs Freunde für bloß nominelle Preise verkauft worden. Seyed bin Majid, ein guter Mann, schlug vor, sie sollten mir zurückgegeben und Shereef das Elfenbein abgenommen werden; sie wollten sie aber nicht wieder zurückgeben, obschon sie wussten, dass sie gestohlen waren … In meiner Verlassenheit kam ich mir vor wie der Mann, der von Jerusalem nach Jericho ging und unter die Räuber fiel; ich konnte aber nicht hoffen, dass Priester, Levit oder ein guter Samariter von irgendeiner Seite käme … Als jedoch meine Niedergeschlagenheit den höchsten Grad erreicht hatte, war der gute Samariter wirklich dicht bei mir. Eines Morgens kam Susi gerannt und rief mir, nach Atem schnappend, schon von ferne zu: ›Ein Engländer! Ich sehe ihn!‹ Damit stürzte er wieder fort und ihm entgegen. Die amerikanische Flagge an der Spitze einer Karawane verkündete die Nationalität des Fremden. Warenballen, zinnerne Badewannen, große Kessel, Kochtöpfe, Zelte usw. ließen mich denken: ›Das muss ein sehr gut ausgestatteter Reisender sein und nicht einer, der mit seinem Witz zu Ende ist wie ich.‹ (28. Oktober) Es war Henry M. Stanley, der reisende Korrespondent des New York Herald, den James Gordon Bennett jun. mit einem Kostenaufwand von über 4000 Pfund ausgesandt hatte, um genaue Erkundigungen über Dr. Livingstone einzuziehen, falls ich noch lebe, und falls ich tot sei, meine Gebeine nach Hause zu bringen. Die Neuigkeiten, die er mir, der ich zwei Jahre ohne jede Kunde von Europa gewesen war, zu erzählen hatte, machten meinen ganzen Körper erbeben … Der Appetit stellte sich wieder ein, und statt der schmalen, geschmacklosen zwei Mahlzeiten des Tages aß ich täglich viermal, sodass ich mich nach einer Woche kräftig zu fühlen begann. Ich gehöre nicht zu den demonstrativen Naturen und bin wirklich so kalt, wie es uns Insulanern als Grundzug unseres Wesens nachgesagt wird, aber die uneigennützige Güte, welche Mr. Bennett für mich hatte und zu deren ausübendem Werkzeug Mr. Stanley sich in so edler Weise gemacht, war doch überwältigend für mich. Ich fühle eine unbegrenzte Dankbarkeit …«
Diese Zeilen bleiben aber auch die einzige gefühlsbetonte Äußerung. Auf den folgenden Seiten seines Tagebuches vermeidet Livingstone dann alle persönlichen Bemerkungen. Wenn er Stanley erwähnt, dann meistens nur mit kurzen Hinweisen auf dessen Fieberanfälle. Das besagt aber keineswegs, dass er ihn nicht schätzte und seine Leistungen nicht anerkannte. Stanley selbst war wesentlich enthusiastischer und machte aus seiner tiefen Verehrung für den Älteren nie ein Hehl. Nur einmal noch spricht er später in seinen »Erinnerungen« rückblickend von seinem Pflegevater mit gleicher Wärme. –
Die vier Monate des Zusammenseins wurden für Stanley zur wichtigen Lehrzeit. Er durfte mit Livingstone den Nordteil des Tanganika erkunden. Auch bei den Berichten über dieses Unternehmen scheiden sich die Geister. Während Stanley die Reise ausführlich schildert und die Entdeckung, dass der Rusizi einen Zufluss in den See bildet und diesen nicht in das Quellgebiet des Nils entwässert, geradezu dramatisierte, ging Livingstone auf die Entdeckung in seinen Tagebüchern nur ganz knapp und am Rande ein, weil sie ihm nicht bedeutsam genug war. Trotzdem prägten die gemeinsam verbrachten Wochen den jungen hitzköpfigen Journalisten und beeinflussten seinen weiteren Lebensweg ganz entscheidend. Am 14. März 1872 trennten sich die beiden. Livingstone blieb in Unyanyembé zurück, um auf die versprochenen Hilfsgüter zu warten, während Stanley wieder nach Osten zog. Die beiden sollten sich nie mehr wiedersehen. Sobald Livingstone seinen Nachschub erhalten hatte, zog er an der Ostseite des Tanganikasees südwärts erneut bis zum Bangweolosee und umwanderte, stets nach der Nilquelle suchend, dessen Osthälfte. Aber die Strapazen dieser Reise waren zu viel für den geschwächten Körper. Am Morgen des 1. Mai 1873 fanden ihn seine schwarzen Diener in der Hütte eines Eingeborenendorfes, in dem er Rast gemacht hatte, vor dem Bett kniend, der Kopf ruhte auf den gefalteten Händen. Der Tod hatte ihn im Gebet überrascht. –
Die treuen Diener unter der Führung von Susi und Chuma begruben sein Herz unter einem Baum und balsamierten den Leichnam auf primitive Weise ein. Dann transportierten sie ihn heimlich und unter größten Strapazen bis zur Küste; eine Tat tiefster Treue, die noch ein letztes Mal bewies, wie beliebt Livingstone bei seinen Leuten gewesen war! Die kleine Karawane erreichte den Indischen Ozean, und ein Schiff brachte den toten Forscher in die Heimat, wo er am 18. April 1874, ein Jahr nach seinem Tod und zwei Jahre nach dem Abschied von Stanley, in der Westminster-Abtei beigesetzt wurde.
Zu den Männern, die bei dem feierlichen Leichenkondukt die Schnüre des Bahrtuches hielten, gehörte auch Stanley. Er hatte in den Monaten nach seiner Rückkehr gleichermaßen heftige Anfeindungen wie begeisterte Anerkennung geerntet. Er hatte bewusst darauf verzichtet, sich im Gefolge Livingstones als Autorität in geographischen Fragen aufzuwerfen. Nun aber, nach dem Tod seines Lehrmeisters, sah er auch seine Stunde für gekommen, und er beschloss, die von Livingstone nicht mehr bewältigten Probleme anzugehen und das Rätsel der Nilquellen endgültig zu lösen.
Ähnlich wie in Nord- und Südamerika hat die Erforschung der großen Ströme und ihrer Einzugsgebiete sowie die Nutzung der Wasserwege zum Eindringen ins Innere auch bei der Entschleierung Afrikas eine bestimmende Rolle gespielt. Livingstone, dem die Sambesiforschung entscheidende Anstöße verdankt, irrte jedoch bei der Zuordnung des von ihm im März 1871 entdeckten Lualaba zum Stromsystem des Nils. Stanley, dem er von diesem Fluss berichtete, hat auf seiner 1874 angetretenen zweiten Afrikareise den Lualaba befahren und ihn durch seinen Vorstoß bis zum Atlantik als Quellfluss des Kongo identifiziert. 1879–84 war er dann noch einmal im Kongobecken – diesmal mit direktem Kolonisationsauftrag des belgischen Königs Leopold II. Die Gründung des Kongo-Staates und ihre Sanktionierung durch alle Kolonialmächte in der Berliner Kongo-Akte von 1885 ist ein direktes Ergebnis dieser Tätigkeit. In Stanley begegnet uns damit ein neuer Entdeckertyp, ein moderner Konquistador, der sich den Weg voran freipeitscht und freischießt. Die Menschenverachtung bei der Aufteilung Afrikas durch die europäischen Mächte zu dieser Zeit stand der arabischer Sklavenhändler in nichts nach.
Stanleys ursprüngliche Legitimation als Afrikakenner ist in der erfolgreich verlaufenen Suchexpedition nach dem verschollenen Menschenfreund Livingstone begründet. Immer wieder hat er sich als dessen Schüler bezeichnet, und doch gibt es kaum ein sinnfälligeres Symbol für den Wandel im Stil der Entdeckungsreisen zu Beginn des imperialistischen Zeitalters als die Begegnung zwischen Henry M. Stanley und David Livingstone.4
Seinen Bericht über dessen Auffindung hatte Stanley bereits 1872 unter dem Titel »How I found Livingstone« in London veröffentlicht. Auf ein breiteres Publikum wirkte er sensationell und beeinflusste auch die zeitgenössische Entdeckungsliteratur. Unter den bis dahin erschienenen Büchern über Entdeckungsreisen gab es gewichtige wissenschaftliche Werke wie etwa den voluminösen Bericht Heinrich Barths, es gab auch durchaus lebendige Darstellungen wie Livingstones »Missionsreisen«, aber noch nie zuvor hatte ein so krasser Außenseiter die Szene betreten – und gleichzeitig im ersten Anlauf mit seinem Buch einen solchen Erfolg erzielt. Stanley war Journalist, er sah sein Unternehmen zuerst einmal unter dem Aspekt der journalistischen Wirkung, und das spürt man deutlich aus seinem ungemein dramatischen Bericht. Aber gerade deshalb gelang es ihm auch, in aller Welt ein weitaus größeres Publikum anzusprechen, als das bisher je einem Forscher möglich gewesen war.
Sein schriftstellerischer Erfolg verschaffte ihm gleichermaßen Neider wie Nachfolger im positiven Sinne. Niemand wird die Schwächen des Werkes übersehen. Die Fachleute kritisierten seinerzeit den Mangel an geographischer Information, wir schätzen es heute wegen seines Detailreichtums als Zeitdokument ersten Ranges. Noch nie zuvor war eine Expedition in allen Einzelheiten so genau und zugleich so farbig beschrieben worden. Ebenso wie die späteren Werke, so lässt auch dieses erste Rückschlüsse auf den Menschen Stanley zu, der ein Draufgänger war, hart und diszipliniert gegen sich selbst, hart und oft geradezu brutal gegen seine Begleiter, gegen die Weißen gleichermaßen wie gegen die Farbigen. Stanley war aber auch ehrlich genug, seine Schwächen zumindest im Vergleich mit Livingstone zuzugeben. Das beweist beispielsweise eine sehr aufschlussreiche Tagebuchstelle vom 3. März 1872, die er allerdings nicht in den Reisebericht aufnahm, sondern die erst später von seiner Frau in den »Lebenserinnerungen« veröffentlicht wurde. Dort erzählt er, wie es Livingstone mit einigen ruhigen Worten gelang, einen Konflikt mit einem eingeborenen Diener zu schlichten, den er selbst infolge seines cholerischen Temperaments provoziert hatte.
Unterschiedlich war auch die Einstellung der beiden Reisenden zum Sklavenhandel. Gewiss lehnte ihn auch Stanley ab, aber er arrangierte sich, wo er es für nötig hielt, mit den arabischen Sklavenhändlern, nahm sogar Partei bei ihren internen Streitigkeiten, unterstützte sie bei ihren Kämpfen und verbündete sich auf der zweiten Reise mit einem der berüchtigtsten Händler. Livingstone dagegen war viel kompromissloser. Er prangerte das Vorgehen der Araber an, wo er nur konnte, seine Tagebücher gewinnen dort ungemein an Farbe und Dramatik, wo er sich gegen die Sklavenhändler und ihre Brutalitäten wendet.
Die vorliegende Ausgabe geht auf die erste deutsche Übersetzung des Werkes bei F. A. Brockhaus zurück. Die Rechtschreibung wurde modernisiert, beibehalten dagegen entsprechend den bisherigen Editionsprinzipien die Namensschreibung, also z.B. Tanganika statt heute Tanganyika oder Tanganjika, aber auch Udschidschi gegenüber Udjidji etwa in »Durch den dunkeln Welttheil« (und dementsprechend in der Neuausgabe »Die Entdeckung des Kongo«).
Ein besonderes Problem bildeten die Textkürzungen. Gegenüber der Originalausgabe wurde zuerst einmal auf die beiden landeskundlichen Kapitel und auf das Schlusskapitel verzichtet, das sich sowieso nur mit persönlichen Querelen auseinandersetzt. Eine stärkere Möglichkeit der Kürzung ergab sich auch bei dem Bericht über Livingstones frühere Reisen. Weitere Streichungen wurden sehr behutsam innerhalb der einzelnen Kapitel vorgenommen und beschränken sich überwiegend auf die ermüdenden Marschangaben, die Aufzählung der Ausrüstung und Charakterbeschreibungen einzelner Träger. Dementsprechend deckt sich die Kapiteleinteilung nicht mehr mit dem Original, und die ursprünglich sechzehn Kapitel des Werkes wurden in acht zusammengefasst.
Heinrich Pleticha
1Bei den folgenden Schilderungen der Lebenswege decken sich einige Abschnitte mit Teilen der Einleitungen zu Livingstone »Zum Sambesi und quer durchs südliche Afrika« und Stanley »Die Entdeckung des Kongo« (beide Edition Erdmann) vom gleichen Herausgeber. Da es nicht sinnvoll erschien, dieselben Fakten mit neuen Worten zu wiederholen, wurden sie deshalb hier übernommen, jedoch in andere Zusammenhänge eingeordnet.
2Vgl. hierzu seinen Reisebericht »Zum Sambesi und quer durchs südliche Afrika« (Edition Erdmann Tübingen 1980).
3Zur fehlerhaften Datumsberechnung vgl. im Folgenden die Bemerkungen Stanleys.
4Vgl. dazu Stanley »Die Entdeckung des Kongo« (Edition Erdmann), dort in der Einleitung auch Hinweise auf den weiteren Lebensweg.
EINLEITUNG
Am 16. Oktober 1869 war ich von den Kämpfen bei Valencia soeben in Madrid angekommen. Um 10 Uhr vormittags überreicht mir Jacopo, in Nr. – Calle de la Cruz, ein Telegramm, welches lautet: »Kommen Sie sofort nach Paris wegen wichtiger Geschäfte.«
Das Telegramm ist von James Gordon Bennett jun., dem jungen Direktor des »New York Herald«.
Schleunigst nehme ich meine Bilder von den Wänden meiner im zweiten Stock gelegenen Zimmer, packe meine Bücher und Andenken, meine hastig zusammengerafften, teils halb gewaschenen, teils noch nicht getrockneten Kleider in meine Koffer, und nach ein paar Stunden eiliger und angestrengter Arbeit ist mein Gepäck geschnürt und nach Paris signiert.
Um 3 Uhr nachmittags war ich unterwegs, und da ich in Bayonne einige Stunden Aufenthalt hatte, kam ich in Paris erst in der folgenden Nacht an. Ich ging direkt ins Grand Hotel und klopfte an Herrn Bennetts Tür.
»Herein!«, rief eine Stimme.
Bei meinem Eintritt fand ich Herrn Bennett im Bett.
»Wer sind Sie?«, fragte er.
»Mein Name ist Stanley«, antwortete ich.
»Ach ja! Nehmen Sie Platz. Ich habe ein wichtiges Geschäft für Sie.«
Nachdem er sich den Schlafrock umgeworfen, fragte mich Herr Bennett: »Wo, glauben Sie, dass Livingstone sich aufhält?«
»Ich weiß es wirklich nicht.«
»Glauben Sie, dass er am Leben ist?«
»Kann sein, kann aber auch nicht sein«, antwortete ich.
»Ich glaube, er ist am Leben und man kann ihn finden, und ich will Sie ausschicken, um ihn aufzusuchen.«
»Was?«, sagte ich, »Sie meinen wirklich, dass ich imstande bin, Dr. Livingstone aufzufinden? Sie meinen, dass ich nach Zentralafrika gehen soll?«
»Jawohl, ich meine, dass Sie hingehen und ihn aufsuchen sollen, wo Sie ihn nur immer vermuten können, dass Sie dann alle Nachrichten, die Sie von ihm erhalten können, sammeln. Und vielleicht«, fügte er in nachdenklichem Ton hinzu, »ist der alte Mann in Not. Nehmen Sie genug mit sich, um ihm beizustehen, wenn er dessen bedarf. Natürlich werden Sie nach eigenem Plan handeln und das tun, was Sie für das Beste halten, aber – finden Sie Livingstone!«
»Aber«, sagte ich in Verwunderung über den kaltblütigen Befehl, mit dem man einen Menschen nach Zentralafrika schickte, um einen Mann aufzusuchen, den ich wie die meisten für tot hielt, »haben Sie ernstlich die große Ausgabe überlegt, der Sie sich für diese kleine Reise aussetzen?«
»Was wird es kosten?«, fragte er kurz.
»Burtons und Spekes Reise nach Zentralafrika hat 3000 bis 5000 Pfd. St. gekostet, und ich denke, man kann die Reise nicht für weniger als 2500 Pfd. St. machen.«
»Gut, da will ich Ihnen sagen, was zu tun ist. Erheben Sie zunächst 1000 Pfd., und wenn Sie die verbraucht haben, trassieren Sie wieder 1000 Pfd., und wenn diese verausgabt sind, abermals 1000 Pfd., und wenn Sie damit zu Ende sind, noch 1000 Pfd. usw., aber – finden Sie Livingstone!«
Erstaunt, aber nicht irregemacht durch diesen Befehl – denn ich wusste, dass, wenn Herr Bennett einmal zu etwas entschlossen war, er nicht leicht von seinem Plan abging –, meinte ich doch, da es ein solches Riesenunternehmen war, dass er noch nicht völlig die Gründe und Gegengründe bei sich erwogen habe, und sagte: »Ich habe gehört, dass, wenn Ihr Vater stirbt, Sie den ›Herald‹ verkaufen und sich vom Geschäft zurückziehen wollen.«
»Wer Ihnen das gesagt hat, hat Sie falsch informiert, denn es gibt gar nicht Geld genug in New York, um den ›New York Herald‹ zu kaufen. Mein Vater hat ihn zu einer großen Zeitung gemacht, aber ich gedenke, ihn noch bedeutend zu vergrößern. Ich wünsche, dass er eine Zeitung in dem wahren Sinne des Wortes werde. Ich meine, dass er alles bringen soll, was die Welt interessiert, gleichviel was das kosten möge.«
Ich erwiderte ihm: »Dann habe ich nichts weiter zu sagen. – Meinen Sie, dass ich direkt nach Afrika gehen soll, um Dr. Livingstone aufzusuchen?«
»Nein; ich wünsche, dass Sie sich zuerst zur Einweihung des Suez-Kanals begeben und dann den Nil hinaufgehen. Ich höre, dass sich Baker gerade nach Oberägypten begibt; suchen Sie alles über seine Expedition zu erfahren, was Sie können, und wenn Sie den Nil hinaufgehen, beschreiben Sie möglichst genau alles, was für Touristen von Interesse ist. Schreiben Sie einen Führer, einen recht praktischen, für Unterägypten, in dem Sie uns alles berichten, was es dort Sehenswertes gibt.
Dann könnten Sie auch nach Jerusalem gehen, Kapitän Warren soll dort eben einige interessante Entdeckungen machen. Besuchen Sie darauf Konstantinopel und berichten Sie über die zwischen dem Khediven und dem Sultan herrschenden Schwierigkeiten. Dann können Sie ja wohl auch die Krim und die alten Schlachtfelder dort besuchen. Gehen Sie durch den Kaukasus ans Kaspische Meer, dort sollen die Russen eine Expedition gegen Chiwa ausrüsten. Von da können Sie durch Persien nach Indien gehen und uns einen interessanten Bericht aus Persepolis schreiben. Bagdad liegt dicht an Ihrem Wege nach Indien; wie wäre es, wenn Sie dort hingingen und uns etwas über die Euphrattal-Eisenbahn berichteten. Wenn Sie dann in Indien gewesen sind, können Sie sich nach Livingstone umschauen. Vermutlich werden Sie bis dahin gehört haben, dass er sich auf dem Rückwege nach Sansibar befindet, wenn nicht, so gehen Sie ins Innere und suchen Sie ihn dort. Wenn er am Leben ist, versuchen Sie, von ihm soviel Nachrichten wie möglich über seine Entdeckungen zu erlangen, und wenn er tot ist, bringen Sie alle möglichen Beweise für seinen Tod mit. Das ist alles. Gute Nacht und Gott sei mit Ihnen!«
»Gute Nacht«, sagte ich, »ich will alles tun, was in der Menschenmöglichkeit liegt, und Gott wird bei einer Aufgabe, wie sie mir gestellt ist, mit mir sein.«
Ich brauche hier gar nicht aufzuzählen, was ich getan habe, ehe ich nach Zentralafrika ging: Ich zog den Nil hinauf, sah den Oberingenieur der Bakerschen Expedition, Herrn Higginbotham, in Phylae und verhinderte ein Duell zwischen ihm und einem tollen jungen Franzosen, der sich mit Herrn Higginbotham auf Pistolen duellieren wollte, weil er die Zumutung übel nahm, für einen Ägypter gehalten zu werden, obgleich er einen Fes trug. Ich habe mich mit Kapitän Warren in Jerusalem unterhalten und bin dort mit einem Unteringenieur in eine der Gruben gefahren, um die Merkzeichen der tyrischen Arbeiter auf den Grundsteinen des Salomonischen Tempels zu besehen. Ich habe die Moscheen von Stambul in Gesellschaft des nordamerikanischen Ministerresidenten und Generalkonsuls besucht, ich bin über die Schlachtfelder der Krim gereist, Kinglakes berühmtes Werk in der Hand; ich habe mit der Witwe des Generals Liprandi in Odessa gespeist; ich habe in Trapezunt den arabischen Reisenden Palgrave und in Tiflis den Zivilgouverneur des Kaukasus, Baron Nicolay, besucht; in Teheran bin ich mit dem russischen Gesandten zusammen gewesen, habe überall auf meiner Reise durch Persien die größte Gastfreundschaft von den Herren der Indo-Europäischen Telegraphen-Gesellschaft erfahren und nach dem Beispiel vieler berühmter Männer meinen Namen auf die Monumente von Persepolis eingeschrieben. Im Monat August 1870 kam ich in Indien an, am 12. Oktober fuhr ich auf der Barke »Polly« von Bombay nach Mauritius. Da die »Polly« ein langsames Schiff war, dauerte die Überfahrt 37 Tage. An Bord der Barke befand sich ein gewisser William Lawrence Farquhar aus Leith in Schottland als Erster Steuermann. Er war ein ausgezeichneter Schiffer, und da ich meinte, dass er mir von Nutzen sein könnte, nahm ich ihn in Dienst unter der Bedingung, dass sein Sold von dem Tag an gehen solle, wo wir von Sansibar nach Bagamoyo abreisen würden. Da ich keine Gelegenheit hatte, direkt nach Sansibar zu fahren, so ging ich zu Schiff nach den Seychellen. Drei oder vier Tage nach meiner Ankunft in Mahé, einer Insel der Seychellen, hatte ich das Glück, auf einem amerikanischen Walfischfahrer mit William Lawrence Farquhar und Selim, einem arabischen Christenknaben aus Jerusalem, der als Dolmetscher fungieren sollte, nach Sansibar zu segeln, in welchem Hafen wir am 26. Januar 1871 ankamen.
London, Oktober 1872
Henry M. Stanley
ERSTES KAPITEL
Es war am frühen Morgen, als ich durch den Kanal segelte, der Sansibar von Afrika trennt. In dem Morgengrauen wurden die Höhen des Festlandes gleich langen Schatten sichtbar; die Insel lag uns in einer Entfernung von nur einer Meile zur Linken und trat mit dem vorrückenden Tage aus den sie umhüllenden Nebeln allmählich hervor, bis sie endlich deutlich in Sicht war und so schön aussah wie das schönste Kleinod der Schöpfung. Sie schien niedrig, aber nicht flach zu sein, hin und wieder sah ich sanfte Höhen, die sich über den anmutigen Wipfeln der Kokosbäume erhoben, welche sich längs der Insel hinzogen. Auch wurden sie in angenehmer Weise durch Talsenken unterbrochen, welche andeuteten, wo diejenigen, die Schutz vor der heißen Sonne suchten, Kühlung finden könnten. Mit Ausnahme der schmalen Sandlinie, über die das saftgrüne Wasser in beständigem Gemurmel dahinrollte, schien die Insel ganz in Grün gehüllt. Auf dem herrlichen Spiegel der Meerenge befanden sich mehrere Dhauen, die rasch mit schwellenden Segeln der Bucht von Sansibar zueilten oder dieselbe verließen. Über dem Horizont des Meeres erschienen nach Süden zu die nackten Masten einiger großer Schiffe und östlich von diesen eine dichte Masse weißer Häuser mit flachen Dächern. Dies war Sansibar, die Hauptstadt der Insel, welche sich bald als eine ziemlich große, dicht gebaute Stadt enthüllte, an der man alle charakteristischen Merkmale der arabischen Baukunst erkennen konnte.
Mit aufrichtiger Höflichkeit und Gastfreiheit empfing mich der nordamerikanische Konsul, Kapitän Francis R. Webb (der früher in der nordamerikanischen Flotte gedient hatte). Ein Tag in Sansibar brachte mir meine Unwissenheit in Bezug auf das Volk und die Dinge Afrikas im Allgemeinen zum Bewusstsein. Ich bildete mir ein, ich hätte Burton und Speke ziemlich gut durchgelesen und folglich die Bedeutung, Wichtigkeit und Größe der Aufgabe, die ich übernommen hatte, erfasst. Aber meine auf Bücherweisheit gegründeten Schätzungen waren einfach lächerlich, die phantastischen Vorstellungen von den Reizen, die Afrika bietet, waren alsbald zerstreut, die Freuden, die ich vorausgesetzt hatte, verschwanden, und alle unreifen Vorstellungen nahmen eine bestimmte Gestalt an.
Ich spazierte durch die Stadt und verschaffte mir allgemeine Eindrücke. In dem reinlichen Stadtviertel sah ich krumme, enge Gassen, weiß getünchte Häuser, mit Mörtel gepflasterte Straßen. In dem Teil, den ich das Banyanenviertel nennen will, erblickte ich auf jeder Seite sehr vertiefte Alkoven, vor denen rot beturbante Banyanen saßen, und im Hintergrund dünne Baumwollstoffe, Kalikos, amerikanische und bedruckte Baumwollwaren und andere Gegenstände; auf den Fluren lagen Elfenbeinzähne dicht gedrängt; in dunklen Ecken Haufen von ungereinigter loser Baumwolle, Vorräte von Steingut, Nägeln, billigen Eisenwaren und Werkzeugen. Im Negerquartier rochen die Straßen sehr übel nach der gelben und schwarzen Bevölkerung, welche mit ihren Wollköpfen vor den Türen ihrer elenden Hütten schwatzend, lachend, feilschend und keifend saß. Der Geruch war ein Gemisch von Häuten, Teer, Schmutz, vegetabilischem Abgang, Exkrementen usw. Ich sah Straßen, die von großen, solide aussehenden Häusern mit flachen Dächern begrenzt wurden, mit großen geschnitzten Türen und Messingklopfern, vor denen Sklaven mit übereinandergeschlagenen Beinen saßen und den Eingang zu den Häusern ihrer Herren bewachten; eine seichte Seebucht, auf der sich Dhauen, Nachen, Boote und ein paar vereinzelte Bugsierdampfer befanden, welche auf dem von der Ebbe zurückgelassenen Schlammmeer seitlich übergeneigt dalagen.
Dem neuen Ankömmling sind die Muskataraber von Sansibar im höchsten Grade interessant. Sie haben eine gewisse Geschäftigkeit an sich, die man bewundern muss. Sie sind fast alle Reisende. Die Mehrzahl von ihnen ist oft schon in gefahrvollen Lagen gewesen, wenn sie in Zentralafrika eindrangen, um das kostbare Elfenbein zu bekommen, und dies sowie ihre reichen Erfahrungen haben ihrem Gesicht einen gewissen unverkennbaren Zug von Selbstvertrauen und Selbstgenügsamkeit gegeben; sie haben etwas Ruhiges, Entschlossenes, Trotziges, Unabhängiges an sich, welches jedem unbewusst Achtung abgewinnt. Die Erzählungen einiger dieser Leute könnten meines Erachtens Bände voll spannender Abenteuer füllen.
Der Banyane ist ein geborener Handelsmann, das Ideal eines schlauen, Geld verdienenden Menschen. Das Geld fließt ihm so natürlich in die Tasche wie das Wasser von einer Höhe hinab, und nie werden Gewissensbisse ihn daran hindern, seinen Nebenmenschen zu betrügen. Er übertrifft den Juden, und sein einziger Nebenbuhler auf dem Markt ist der Perser. Der Araber ist ein Kind dagegen. Es ist Geldes wert, ihn zu sehen, wie er mit aller Energie der Seele und des Leibes dahin arbeitet, den Eingeborenen selbst um die allerkleinste Geldsumme zu übervorteilen. Hat zum Beispiel der Eingeborene einen Elfenbeinzahn, der ein paar Frasileh wiegt, die Waagschale zeigt auch das Gewicht an, und der Eingeborene versichert aufs Feierlichste, dass es mehr als zwei Frasileh betragen müsse, so wird unser Banyane auf alle mögliche Weise behaupten und schwören, dass der Eingeborene nichts davon verstehe und dass die Waagschale falsch sei. Er nimmt seine ganze Kraft zusammen, um den Zahn aufzuheben. »Er ist ja so leicht, er wiegt nicht mehr als ein Frasileh. Komm«, sagt er, »Knicker, nimm dein Geld und geh deiner Wege. Bist du verrückt?« – Wenn der Eingeborene zaudert, so pflegt er vor Wut laut aufzuschreien, er schiebt ihn weg, stößt das Elfenbein mit verächtlicher Gleichgültigkeit mit dem Fuße fort, kurz, nirgends wird solch ein Lärm um nichts gemacht. Obgleich er nun dem erstaunten Eingeborenen befiehlt, sich zu trollen, so beabsichtigt er durchaus nicht, dass ihm der Kauf entgehen soll.
Die Banyanen üben vor allen anderen Klassen den größten Einfluss auf den Handel von Zentralafrika aus. Mit Ausnahme von ein paar reichen Arabern sind fast alle anderen Kaufleute den Nachteilen des Wuchers ausgesetzt. Ein Handelsmann, der eine Reise ins Innere machen will, gleichviel ob er nach Sklaven oder Elfenbein, Kopalgummi oder Orseillewurzel auszieht, schlägt einem Banyanen vor, ihm 5000 Dollars zu 50, 60 oder 70 Prozent zu leihen. Der Banyane weiß sicher, dass er nichts verliert, ob die Spekulation des Handelsmannes sich bezahlt macht oder nicht; denn ein erfahrener Handelsmann erleidet selten Verluste, oder wenn er unschuldigerweise unglücklich gewesen ist, so verliert er seinen Kredit nicht. Mithilfe des Banyanen kommt er bald wieder auf die Beine.
Blick auf Sansibar
Auf die Banyanen folgen in Sansibar, was die Machtstellung betrifft, die mohammedanischen Hindus. Eine Zeit lang war ich wirklich im Zweifel, ob die Hindus nicht ebenso arg im Handel betrügen wie die Banyanen, und wenn ich den Letzteren die Palme gereicht habe, so ist das nur mit Widerstreben geschehen. Dieser Stamm der Inder erzeugt Massen gewissenloser Schurken, während er kaum einen ehrlichen Kaufmann aufzuweisen hat. Einer der ehrlichsten Leute von allen, ob weiß oder schwarz, ob rot oder gelb, ist ein mohammedanischer Hindu, namens Tarya Topan. Er ist unter den Europäern in Sansibar durch seine Ehrlichkeit und strenge Rechtschaffenheit im Geschäft sprichwörtlich geworden. Er ist sehr reich, besitzt mehrere Schiffe und Dhauen und nimmt eine hervorragende Stellung im Rat bei Seyyid Barghasch ein. Tarya hat viele Kinder, unter denen zwei oder drei erwachsene Söhne sich befinden, welche er ganz nach seinem Vorbild erzogen hat. Aber Tarya repräsentiert nur eine ungemein kleine Minderheit.
Die Araber, Banyanen und mohammedanischen Hindus bilden die höheren und mittleren Klassen. Diese sind im Besitz der Landgüter, der Schiffe und des Handels. Vor ihnen beugen sich die Mischlingsrassen und die Neger.
Nach diesen sind das bedeutendste Volk, welches zur gemischten Bevölkerung dieser Insel beiträgt, die Neger. Sie bestehen aus den eingeborenen Wasawahili, Somalis, Komorines, Wanyamwezi und einer Anzahl Repräsentanten der Stämme von Innerafrika.
Für einen weißen Fremdling, der im Begriff steht, ins Innere von Afrika zu gehen, ist ein Spaziergang durch die Negerquartiere der Wanyamwezi und Wasawahili höchst interessant; denn hier lernt man es erst, dass man zugeben muss, dass die Neger Menschen wie unsereins sind, obgleich von anderer Farbe; dass sie Leidenschaften und Vorurteile, Sympathien und Antipathien, Geschmacksrichtungen und Empfindungen wie alle anderen Menschen haben. Je eher man diese Tatsache einsieht und sich nach ihr richtet, um so leichter wird einem die Reise unter den verschiedenen Stämmen des Innern werden. Je schmiegsamer man von Natur ist, um so gedeihlicher werden die Reisen ausfallen.
Die Neger der Insel bilden wohl zwei Drittel der ganzen Bevölkerung; sie sind die arbeitenden Klassen, ob sie Sklaven oder Freie sind. Die Sklaven verrichten die Arbeit auf den Plantagen, Landgütern und in den Gärten der Gutsbesitzer oder dienen als Hamals oder Lastträger auf dem Lande sowie in der Stadt. Auf dem Lande sieht man sie mit sehr großen Lasten auf dem Kopf so zufrieden und heiter wie möglich, nicht etwa, weil sie freundlich behandelt werden oder leichte Arbeit haben, sondern weil sie ihrer Natur nach heiter und leichten Herzens sind, weil sie weder Vergnügungen noch Hoffnungen haben, die sie nicht nach Belieben befriedigen können, und keinem Ehrgeiz frönen, dem sie nicht Genüge tun könnten, daher auch in ihren Hoffnungen nicht getäuscht worden sind.
Die Stadt Sansibar, auf dem südwestlichen Ufer der Insel gelegen, hat eine Bevölkerung von fast 100 000 Einwohnern; die ganze Insel schätze ich auf nicht mehr als 200 000, alle Rassen eingeschlossen.
Die Europäer und Amerikaner, die in der Stadt Sansibar wohnen, sind entweder Regierungsbeamte oder unabhängige Kaufleute oder Agenten für ein paar große europäische und amerikanische Handelshäuser. Das wichtigste Konsulat ist das britische. Als ich in Sansibar meine Expedition ins Innere von Afrika ausrüstete, war Dr. John Kirk britischer Konsul und Geschäftsführer daselbst. Ich war sehr begierig, diesen Herrn kennenzulernen, weil sein Name so oft mit dem des Dr. David Livingstone, den ich aufsuchen wollte, zusammen genannt worden ist. In fast allen Zeitungen wurde er als der frühere Begleiter von Dr. Livingstone bezeichnet. Nach den Artikeln und Briefen an die indische Regierung, die ich gelesen hatte, bildete ich mir ein, dass, wenn ich überhaupt irgendwelche positive Kunde in Bezug auf den Aufenthaltsort des Dr. Livingstone erhalten könnte, mir dieselbe von Dr. Kirk zukommen würde; daher erwartete ich die Ehre, von Kapitän Webb bei ihm eingeführt zu werden, mit nicht geringer Ungeduld.
Am zweiten Morgen nach meiner Ankunft in Sansibar gingen der amerikanische Konsul und ich, in Übereinstimmung mit der Etikette des Ortes, auf die Straße hinaus, und nach einigen Augenblicken stand ich vor diesem viel besprochenen Mann. Kapitän Webb sagte zu einem Mann von dünner, hagerer Gestalt, der einfach gekleidet und etwas gebückt ging, schwarzhaarig, von schmalem Gesicht und eingefallenen Wangen war und einen Bart trug: »Dr. Kirk, erlauben Sie mir, Ihnen Herrn Stanley, vom ›New York Herald‹, vorzustellen.«
Ich glaubte zu bemerken, dass er in dem Augenblick seine Augenlider merklich erhob und dadurch den ganzen Umfang seiner Augen zeigte. Wenn ich einen solchen Blick beschreiben sollte, so würde ich ihn als ein Anstarren bezeichnen. Während der Unterhaltung, die sich über verschiedene Gegenstände verbreitete, sah ich sein Gesicht, welches ich aufmerksam beobachtete, sich nur einmal beleben und erregt werden, und zwar als er uns einige seiner Jagdgeschichten erzählte. Da der Gegenstand, der meinem Herzen am nächsten war, nicht zur Sprache kam, nahm ich mir vor, ihn über Dr. Livingstone das nächste Mal, wenn ich ihn besuchte, auszufragen.
Am Dienstagabend haben Dr. und Frau Kirk ihre Gesellschaftsabende, wie die Sansibarer wissen. Die Freuden eines solchen Abends werden von der zivilisierten Bevölkerung von Sansibar im Allgemeinen ignoriert, aber die Repräsentanten der europäischen Kolonie besuchen sie trotzdem. An eben diesem Abend waren die reichsten Einwohnerklassen ziemlich stark vertreten.
Die Erfrischungen, welche der britische Konsul nebst Frau ihren Gästen an ihren Empfangsabenden anboten, bestanden aus einer Art milden Weines und Zigarren, nicht weil sie nichts anderes zu Hause haben, etwa Tee oder ein paar Kuchen, sondern wohl nur, weil es die Sitte eines sansibarisierten Europäers ist, dergleichen, mit etwas Soda- oder Selterswasser gemischt, als eine Art Reizmittel für das bisschen Klatsch zu sich zu nehmen, das gewöhnlich unter dem Einfluss des Weines sympathische und eifrige Zuhörer findet.
Es war wohl alles sehr schön, aber trotzdem hielt ich diesen für einen der langweiligsten Abende, die ich je erlebt hatte, bis Dr. Kirk aus Mitleid für die Langeweile, an der ich litt, mich beiseiterief, um mir eine schöne Elefantenflinte zu zeigen, welche ihm, wie er sagte, vom Gouverneur von Bombay geschenkt worden sei. Ich hörte nun Loblieder auf ihre tödliche Kraft und Verderben bringende Präzision und ließ mir einige Anekdoten von dem Leben im Schilfmoor, einige Jagdabenteuer und Erlebnisse auf seinen Reisen mit Livingstone erzählen. »Ach, jawohl, Dr. Kirk«, sagte ich nachlässig, »was Livingstone betrifft – wo, glauben Sie, ist der jetzt?«
»Ja«, erwiderte er, »das ist sehr schwer zu sagen; er kann tot sein; wir wissen nichts Positives, worauf wir uns bestimmt verlassen können. Davon bin ich überzeugt, dass niemand etwas Bestimmtes von ihm seit mehr als zwei Jahren gehört hat. Dennoch glaube ich, dass er am Leben sein muss. Wir schicken ihm beständig irgendetwas zu. In Bagamoyo befindet sich eben eine kleine Expedition, die im Begriff steht aufzubrechen. Ich glaube wirklich, dass der alte Mann jetzt nach Hause kommen sollte; er wird, wie Sie wissen, alt, und wenn er stirbt, so wird die Welt nichts von seinen Entdeckungen haben. Er schreibt weder Notizen noch Tagebücher, und nur sehr selten bringt er seine Beobachtungen zu Papier, sondern macht nur ein Zeichen oder einen Punkt oder etwas Ähnliches auf eine Karte, was niemand als er selbst verstehen kann. Ja, wenn er am Leben ist, so sollte er unter allen Umständen heimkehren und einem jüngeren Mann seine Stelle lassen.«
»Wie ist er im Umgang, Doktor?«, fragte ich mit lebhaftem Interesse an dieser Unterhaltung.
»Nun, ich glaube, dass es im Ganzen sehr schwer ist, mit ihm zu verkehren. Ich habe persönlich zwar nie mit ihm Streit gehabt, aber ich habe ihn gegen andere Leute oft hitzig werden sehen, und das ist, wie ich glaube, der hauptsächliche Grund, weshalb er niemanden gern um sich hat.«
»Wie ich höre, ist er ein sehr bescheidener Mann, nicht wahr?«, fragte ich.
»Nur, er kennt den Wert seiner eigenen Entdeckungen besser als irgendein anderer. Er ist nicht gerade ein Engel«, sagte er lachend.
»Nun, gesetzt, ich begegnete ihm auf meinen Reisen; ich könnte doch möglicherweise mit ihm zusammentreffen, wenn er in der Richtung reist, die ich selbst nehme. Wie würde er sich gegen mich verhalten?«
»Um Ihnen die Wahrheit zu sagen«, sagte er, »so glaube ich nicht, dass er es sehr gern sehen würde. Ich weiß, dass, wenn Livingstone in Erfahrung brächte, dass Burton oder Grant oder Baker oder einer von diesen Leuten ihn aufsuchen wollten, er es bald so einrichten würde, dass hundert Meilen Sumpfboden sich zwischen ihnen befänden. Das glaube ich bestimmt – auf mein Wort!« –
Das war der Inhalt der Unterhaltung, die ich mit Dr. Kirk, dem früheren Genossen von Livingstone, führte, so genau, wie mein Tagebuch und mein Gedächtnis sie mir erinnerlich machen.
Brauche ich wohl zu sagen, dass diese Kunde von einem Herrn, der bekanntlich mit Dr. Livingstone genau bekannt war, eher mehr dazu beitrug, den Enthusiasmus für meine Sache zu dämpfen als ihn zu beleben? Ich fühlte mich sehr verstimmt und hätte gern mein Unternehmen aufgegeben, aber der Befehl lautete: »Gehen Sie und finden Sie Livingstone!« Außerdem hatte ich nicht angenommen, obgleich ich sehr gern darauf eingegangen war, den Doktor aufzusuchen, dass der Weg nach Zentralafrika mit Rosen bestreut sein werde. Wenn ich nun wirklich als ein unverschämter Eindringling auf dem Gebiet der Entdeckungen getadelt werden sollte, als ein Mensch, der sich in Dinge mischt, die ihn nichts angehen, als einer, dessen Abwesenheit dem Doktor viel angenehmer wäre als seine Anwesenheit – hatte ich nicht den Befehl erhalten, ihn zu suchen? Nun, ich wollte ihn aufsuchen, wenn er noch auf Erden wandelte, und wenn nicht, so wollte ich das mitbringen, was die Leute sicher zu wissen interessierte. Dr. Kirk versprach mir freundlich alle in seiner Macht stehende Unterstützung und stellte mir alle Vorteile seiner Erfahrung zur Verfügung, aber ich erinnere mich weder, dass er mir in irgendeiner Weise wirkliche Unterstützung angedeihen ließ, noch finde ich es in meinem Tagebuch verzeichnet. Natürlich wusste er nicht, dass meine Befehle dahin lauteten, Dr. Livingstone aufzusuchen, sonst würde er wohl zweifelsohne sein Versprechen eingelöst haben. Er glaubte, dass ich im Begriff stände, den Rufidschifluss bis an seine Quellen zu verfolgen. Aber welche Zeitung würde wohl einen Spezialkorrespondenten ausschicken, um die Quellen eines so unbedeutenden Flusses wie des Rufidschi zu entdecken?
Ich kannte das Innere durchaus nicht, und es war daher schwer zu wissen, was ich brauchte, um eine Expedition nach Zentralafrika zu unternehmen. Auch war die Zeit kostbar, und ich konnte nicht viel auf Erkundigung und Nachforschung verwenden. In einem solchen Fall wäre es, nach meiner Ansicht, ein großes Glück gewesen, wenn einer der drei Herren, Kapitän Burton, Speke oder Grant, uns irgendeine Belehrung über diese Punkte gegeben hätte, wenn sie ein Kapitel darüber geschrieben hätten, wie man eine Expedition nach Zentralafrika auszurüsten habe.
Einige der Fragen, die ich mir vorlegte, wenn ich mich nachts im Bett herumwälzte, lauteten: Wie viel Geld ist nötig? Wie viele Pagazis oder Lastträger? Wie viele Soldaten? Wie viel Tuch? Wie viele Perlen? Wie viel Draht? Welche Sorten Zeug sind für die verschiedenen Stämme nötig? – Ich mochte mir diese Fragen noch so häufig stellen, so kam ich dem Punkt doch nicht näher, den ich zu erreichen wünschte. Die Europäer in Sansibar wussten so wenig wie möglich hierüber. Es gab nicht einen Weißen in Sansibar, der mir sagen konnte, wie vieler Dotis per Tag eine Truppe von hundert Mann für ihren Unterhalt auf der Reise bedurfte.
Ich beschloss als das Beste, einen arabischen Kaufmann aufzutreiben, der mit Elfenbein handelt oder der vor Kurzem aus dem Innern angekommen war.
Scheikh Haschid war ein Mann von Bedeutung und Reichtum in Sansibar. Er hatte selbst eine Anzahl Karawanen ins Innere gesandt und war infolgedessen mit verschiedenen hervorragenden Händlern bekannt, die in sein Haus kamen und sich mit ihm über ihre Abenteuer und Gewinne unterhielten. Von diesem graubärtigen, ehrwürdig aussehenden Scheikh habe ich über afrikanische Tauschwerte, die Art, mit ihnen umzugehen, die Menge und Qualität der Stoffe, die ich brauchte, mehr Auskunft erhalten als aus einem dreimonatigen Studium von Büchern über Zentralafrika. Auch von anderen arabischen Kaufleuten, mit denen der alte Scheikh mich bekannt machte, erhielt ich sehr wertvolle Andeutungen und Winke, welche mich schließlich in den Stand setzten, meine Expedition auszurüsten.
Meine Berater gaben mir zu verstehen, dass hundert Menschen mit 10 Doti oder 40 Meter Tuch täglich für ihre Nahrung auskommen; es war also das Richtige, 2000 Doti amerikanische Leinwand, 1000 Doti Kaniki und 650 Doti farbige Zeugsorten zu kaufen. Dies hielt man für völlig ausreichend für den Unterhalt von hundert Mann auf zwölf Monate. Nach diesem Maßstab würden also für zwei Jahre 4000 Doti oder 16 000 Meter amerikanische Leinwand, 2000 Doti oder 8000 Meter Kaniki, 1300 Doti oder 5200 Meter verschiedene farbige Zeuge nötig sein.
Die zweite wichtige Frage war: wie viele und welche Perlen nötig wären. Perlen sollten unter einigen Stämmen des Innern die Stelle des Zeuges einnehmen. Der eine Stamm zieht weiße Perlen den schwarzen, braune den gelben, rote den grünen, grüne den weißen usw. vor. Daher musste ich genau den Aufenthalt meiner Expedition in den verschiedenen Ländern erforschen und berechnen, damit ich genug von jeder Gattung hätte und doch einen zu großen Überschuss vermiede. Burton und Speke zum Beispiel mussten einige Hundert Fundo Perlen als wertlos wegwerfen.
Nach den Perlen kam die Drahtfrage. Ich machte nach bedeutender Mühe die Entdeckung, dass die Nummern 5 und 6, die fast die Dicke von Telegraphendraht haben, als die besten für Handelszwecke gelten. Perlen vertreten in Afrika die Kupfermünzen, Zeuge das Silber, Draht gilt als Gold in den Ländern jenseits des Tanganika. 10 Frasileh oder 350 Pfund Messingdraht hielt mein arabischer Ratgeber für völlig ausreichend.
Nachdem ich meine Einkäufe an Zeug, Perlen und Draht gemacht hatte, überblickte ich mit nicht geringem Stolz die stattlichen Ballen und Pakete, welche reihenweise in dem geräumigen Vorratszimmer des Kapitäns Webb aufgehäuft lagen. Damit war aber meine Arbeit nicht zu Ende, sondern fing erst an. Noch waren Provisionen, Kochgeräte, Boote, Seile, Bindfaden, Zelte, Esel, Sättel, Packleinwand, Segeltuch, Teer, Nähnadeln, Handwerkszeug, Munition, Flinten, Reisegerät, Beile, Arzneimittel, Bettzeug, Geschenke für Häuptlinge, kurz tausenderlei einzukaufen. Die Feuerprobe, die ich beim Schachern und Feilschen mit hartherzigen Banyanen, Hindus, Arabern und Mischlingen zu bestehen hatte, war sehr angreifend. Ich kaufte zum Beispiel 22 Esel in Sansibar, wofür mir 40–50 Dollars abgefordert wurden, was ich mit einem ungeheuren Aufwand an Argumenten, die einer besseren Sache wert waren, auf 15–20 herabdrücken musste. Meine Erfahrungen mit den Eselhändlern wiederholten sich bei den Kleinkrämern, selbst der Preis eines Pakets Stecknadeln musste um 5 Prozent heruntergehandelt werden, was natürlich sehr viel Zeit und Geduld erforderte.
Nachdem ich die Esel zusammengebracht hatte, entdeckte ich, dass man in Sansibar keine Packsättel haben konnte. Nun waren aber die Esel ohne Packsättel für mich ganz nutzlos. Ich erfand also einen Sattel, den ich und mein weißer Diener Farquhar einzig und allein aus Segeltuch, Stricken und Baumwolle fabrizieren mussten. 3–4 Frasileh Baumwolle und 10 Stück Segeltuch waren für die Sättel nötig. Ich selbst machte einen Mustersattel zur Probe, darauf wurde ein Esel gesattelt und ihm eine Last von 140 Pfund aufgepackt, und obgleich das Tier, eine wilde Bestie aus Unyamwezi, sich bäumte und wütend gebärdete, so blieb doch die ganze Last festsitzen. Nach diesem Experiment ließ ich Farquhar noch 21 Sättel nach demselben Muster fabrizieren. Auch wurden wollene Polster angekauft, um die Tiere vor dem Wundwerden zu schützen, doch muss ich hier wohl erwähnen, dass die Idee zu dem Sattel, den ich fertigte, von dem Otagosattel hergenommen ist, den die englische Armee zu ihren Transporten in Abessinien benutzt hat.
John William Shaw, ein geborener Londoner, der bisher Dritter Steuermann auf dem amerikanischen Schiff »Nevada« gewesen war, wandte sich an mich, um Beschäftigung zu erlangen. Obgleich seine Entlassung von der »Nevada« etwas verdächtig war, besaß er doch alle die Eigenschaften eines Menschen, wie ich ihn brauchte, war vertraut mit der Nadel und verstand aus Segeltuch alles zu machen, war ein vorzüglicher Schiffer und willig, soweit seine Kunst reichte. Ich sah keinen Grund, seine Dienste abzuweisen, und nahm ihn daher für ein Jahresgehalt von 300 Dollars als Zweiten im Rang nach William L. Farquhar an.
Farquhar war ein ausgezeichneter Schiffer und vorzüglicher Rechner; er war kräftig, energisch und gescheit, aber leider ein starker Trinker. Während unseres Aufenthalts in Sansibar war er jeden Tag benebelt, und das wüste, lasterhafte Leben, das er hier führte, wurde ihm, wie wir sehen werden, bald nachdem wir ins Innere kamen, verderblich.
Meine nächste Aufgabe bestand darin, eine zuverlässige Eskorte von zwanzig Mann für die Reise anzuwerben und mit Waffen und anderen Dingen auszurüsten. Dschohari, der Erste Dragoman des amerikanischen Konsulats, sagte mir, er wisse, wo man einige von Spekes »Getreuen« auffinden könne. Es war mir schon vorher klar geworden, dass es am besten sein würde, wenn es mir gelänge, einige mit den Sitten der Weißen vertraute Leute in Dienst zu nehmen, welche andere veranlassen könnten, sich der Expedition anzuschließen. Besonders hatte ich dabei an den Sidy Mbarak Mombay, gewöhnlich Bombay genannt, gedacht, der trotz seines »Holzkopfes« und seiner »plumpen Hände« für den »Getreuesten der Getreuen« galt.
Mithilfe des Dragomans Dschohari nahm ich in der Zeit von ein paar Stunden Uledi, Kapitän Grants früheren Bedienten, Ulimengo, Baruti, Ambari, Mabruki (Muinyi Mabruki, der stierköpfige Mabruki, Kapitän Burtons früheren unglücklichen Diener), also fünf von Spekes »Getreuen« in meine Dienste. Als ich sie fragte, ob sie bereit wären, abermals an der Expedition eines Weißen nach Udschidschi teilzunehmen, erwiderten sie bereitwilligst, dass sie sehr gern mit einem Bruder von Speke reisen wollten. Der englische Konsul Dr. John Kirk, der zugegen war, sagte ihnen darauf, dass ich kein Bruder von Speke sei, sondern nur seine Sprache rede; aber auf diese Unterscheidung legten sie keinen Wert, und ich hörte, wie sie mit großer Freude ihre Bereitwilligkeit erklärten, überall mit mir hinzugehen und alles zu tun, was ich wünschte.
Mombay, wie sie ihn nannten, oder Bombay, unter welchem Namen wir Wasungu (Weißen) ihn kennen, war nach Pemba, einer Insel im Norden von Sansibar, gegangen. Uledi aber war der bestimmten Überzeugung, dass Mombay bei der Aussicht auf eine neue Expedition vor Freude Luftsprünge machen würde. Dschohari erhielt daher den Auftrag, ihm nach Pemba zu schreiben und ihn von dem ihm bevorstehenden Glück zu benachrichtigen.
Am vierten Morgen nach Abgang des Briefes erschien der berühmte Bombay, dem die »Getreuen« von Speke ihrem Rang gemäß folgten. Vergeblich sah ich nach dem Holzkopf und den Alligatorzähnen, von denen sein früherer Herr gesprochen hatte. Ich sah einen schlanken, kurzen Mann von etwa fünfzig Jahren, mit grauem Kopf, ungewöhnlich hoher, enger Stirn und großem Mund, der sehr unregelmäßige, weit auseinanderstehende Zähne zeigte. Eine hässliche Lücke an der oberen, vorderen Zahnreihe Bombays war durch die geballte Faust von Kapitän Speke in Uganda bewirkt, als ihm die Geduld riss und sofortige Bestrafung nötig erschien. Kapitän Speke hatte ihn offenbar durch Güte verwöhnt, was aus der Tatsache hervorgeht, dass Bombay die Frechheit hatte, ihn zu einem Boxkampf aufzufordern. Aber das fand ich erst einige Monate später heraus, als ich selbst genötigt war, ihn gründlich zu bestrafen. Bei seiner ersten Erscheinung war ich von Bombay, trotz seines rauen Gesichts, seines großen Mundes, seiner kleinen Augen und seiner platten Nase, sehr eingenommen.
»Salaam aleikum!« waren die Worte, mit denen er mich begrüßte.
»Aleikum salaam!«, antwortete ich mit allem Ernst, den ich aufbieten konnte. Dann benachrichtigte ich ihn, dass ich ihn zum Hauptmann meiner nach Udschidschi gehenden Soldaten zu haben wünsche. Seine Antwort lautete, er sei bereit, allen meinen Befehlen nachzukommen, überall hinzugehen, wo ich ihn hinschicke, kurz ein Muster von einem Diener und ein gutes Beispiel für die Soldaten abzugeben. Er hoffe, ich werde ihn mit einer Uniform und einem guten Gewehr versehen, was ich ihm beides versprach. Als ich mich nach den übrigen »Getreuen«, welche Speke nach Ägypten begleitet hatten, erkundigte, sagte man mir, dass ihrer nur sechs in Sansibar wären.
Bombay, meinem Eskortanführer, gelang es, noch achtzehn freie Männer als Askari (Soldaten) anzunehmen, Leute, von denen er wusste, dass sie nicht desertieren würden, und für die er sich verantwortlich erklärte. Es waren lauter sehr stattliche Burschen und weit intelligenter in ihrem Aussehen, als ich jemals von afrikanischen Barbaren hätte glauben mögen. Sie stammten hauptsächlich aus Uhiyau, einige aus Unyamwezi, andere aus Useguhha und Ugindo. Als Sold wurden einem jeden von ihnen 36 Dollars für das Jahr ausgesetzt oder 3 Dollars für den Monat; jeder Soldat sollte eine Feuerschlossmuskete, Pulverhorn, Kugeltasche, Messer, Beil und hinreichend viel Pulver und Kugeln für 200 Schüsse erhalten. Bombay bekam, aus Rücksicht auf seinen Rang und seine früheren treuen Dienste gegen Burton, Speke und Grant, 80 Dollars pro Jahr, wovon er die halbe Summe im Voraus erhielt, einen guten, gezogenen Vorderlader und außerdem eine Pistole, ein Messer und ein Beil. Die anderen fünf »Getreuen«, Ambari, Mabruki, Ulimengo, Baruti und Uledi, wurden zu 40 Dollars pro Jahr und mit der gehörigen Ausrüstung als Soldaten in Dienst genommen.
Da ich alle auf Ost- und Mittelafrika Bezug nehmenden Reisebeschreibungen ziemlich gründlich studiert hatte, so hatte ich einen einigermaßen deutlichen Begriff von den Schwierigkeiten, die sich mir beim Aufsuchen von Dr. Livingstone entgegenstellen würden. Diese so weit zu vermeiden, wie Menschenwitz es könnte, war das beständige Ziel meiner Gedanken.
»Soll ich mich, wenn ich von Udschidschi über die Wasser des Tanganikasees aufs andere Ufer blicke, auf der Schwelle des Erfolges durch die Unverschämtheit eines Königs Kannena oder die Launen eines Hamed bin Sulayyam aufhalten lassen?«, fragte ich mich. Um mich gegen solche Zufälligkeiten zu schützen, entschloss ich mich, meine eigenen Boote mitzunehmen. »Dann«, dachte ich, »kann ich, wenn ich höre, dass Livingstone auf dem Tanganika ist, meine Boote vom Stapel lassen und ihm folgen.«
Ich kaufte mir also vom amerikanischen Konsul ein großes Boot für 80 Dollars, das imstande war, zwanzig Leute mit hinreichenden Vorräten und Waren für eine Seefahrt zu beherbergen, und ein kleineres von einem anderen Amerikaner für 40 Dollars. Das Letztere konnte bequem sechs Mann mit den dazugehörigen Vorräten aufnehmen.
Die Boote wollte ich aber nicht ganz mitführen, sondern die Bretter herausnehmen und bloß das Gerippe transportieren. Die Arbeit, die Boote auseinanderzunehmen und von den Brettern zu befreien, fiel mir zu, und diese kleine Aufgabe beschäftigte mich ungefähr fünf Tage; auch packte ich sie für die Pagazis zusammen, sodass jede Last, sorgfältig gewogen, nicht mehr als 68 Pfund betrug. John Shaw zeichnete sich in der Bearbeitung des Segeltuchs für die Boote aus; als die Überzüge fertig waren, passten sie genau zu den Gerippen.
Ein unübersteigliches Hindernis für das rasche Fortkommen in Afrika ist der Mangel an Lastträgern, und da Eile ein Hauptzweck der unter meinem Befehl stehenden Expedition war, so war es meine Pflicht, diese Schwierigkeiten soviel wie möglich zu verringern. Lastträger konnte ich mir zwar erst bei meiner Ankunft in Bagamoyo auf dem Festland verschaffen, doch hatte ich mehr als zwanzig gute Esel in Bereitschaft und glaubte, dass ein für die Ziegenpfade Afrikas eingerichteter Karren nützlich sein könnte. Daher ließ ich einen Karren bauen, der 18 Zoll breit und 5 Fuß lang war, den ich mit zwei Vorderrädern eines leichten amerikanischen Wagens versah, hauptsächlich, um die schmalen Munitionskästen zu befördern. Ich meinte, wenn ein Esel eine Last von 4 Frasileh oder 140 Pfund nach Unyanyembé tragen könne, so müsse er imstande sein, 8 Frasileh auf einem solchen Karren fortzuziehen, eine Last, die der Tragkraft von vier starken Pagazis oder Lastträgern gleichkommen würde. Die späteren Ereignisse werden beweisen, wie meine Theorie sich in der Praxis bewährte.
Nachdem ich meine Einkäufe vollendet hatte und alles reihenweise geschichtet aufgehäuft sah, hier Kochgeräte, da Bündel von Stricken, Zelten, Sätteln, dort wieder Koffer und Kisten, die alles Mögliche enthielten, gestehe ich, dass ich über meine eigene Kühnheit verlegen wurde. Da lagen wenigstens 6 Tonnen Material! »Wie wird es nur möglich sein«, dachte ich, »diese ganze träge Masse durch die zwischen dem Meer und den großen Seen von Afrika befindliche Wildnis zu transportieren? Doch wirf nur alle deine Zweifel hinter dich, Mensch, und lass sie fahren! Jeder Tag hat genug an seinen eigenen Sorgen, ohne dass er noch die des nächsten hinzuzunehmen braucht.«
Der Reisende, der einen See in der Mitte jenes weiten afrikanischen Kontinents vor sich hat, muss natürlich in ganz anderer Weise reisen, als er es von anderen Ländern her gewöhnt ist. Er muss das mit sich nehmen, was ein Schiff braucht, wenn es auf eine lange Reise ausgeht. Er muss sich eine Kiste mit Tee, einen kleinen Vorrat wohlverwahrter Leckerbissen, Arzneien, außerdem Flinten, Pulver, Kugeln mitnehmen, um, wenn nötig, auch verschiedene Kämpfe gehörig bestehen zu können. Er muss Leute haben, die ihm diese mannigfachen Gegenstände transportieren, und da das Höchste, was ein einzelner Mann tragen kann, nur 70 Pfund ist, so braucht man, um 11 000 Pfund zu transportieren, gegen 160 Leute.
Was für eine schwere Arbeit ist es aber für einen Einzelnen, eine solche Expedition in Bewegung zu setzen! Wenn der Tag vorüber und ich durch die Glühhitze einer unbarmherzigen Sonne von Laden zu Laden geeilt war, mich mit viel Ausdauer und Geduld für das Feilschen mit dem dunklen Hindu gerüstet, allen Mut und Witz zusammengenommen hatte, um den schurkischen Goanesen einzuschüchtern und dem listigen Banyanen ein Paroli zu bieten; wenn ich den Tag über ganze Bände zusammengesprochen, Abschätzungen korrigiert, Rechnungen gemacht, die Ablieferung von gekauften Gegenständen überwacht und sie gemessen und gewogen hatte, um zu sehen, dass sie vollgewichtig seien; wenn ich endlich die Aufsicht über Farquhar und Shaw geführt hatte, welche Eselsättel, Segel, Zelte, Boote für die Expedition machten – dann fühlte ich wohl, dass Körper und Geist der Ruhe bedurften. So mühte ich mich, ohne Unterlass, einen ganzen Monat ab.
Nachdem ich Tratten auf Herrn James Gordon Bennett im Betrag von mehreren Tausend Dollars für Zeuge, Perlen, Draht, Esel und tausend andere Bedürfnisse verhandelt, die weiße und schwarze Begleitung meiner Expedition besoldet, Kapitän Webb und seine Familie mehr als genug mit dem Lärm der Vorbereitung belästigt und sein Haus mit meinen Gütern angefüllt hatte, blieb mir nichts übrig, als formell von den Europäern Abschied zu nehmen und dem Sultan und den Herren, die mir beigestanden hatten, ehe ich mich nach Bagamoyo einschiffte, zu danken.
Ein seit langer Zeit in Sansibar lebender amerikanischer Kaufmann, Herr Goodhue von Salem, schenkte mir, als ich ihm Adieu sagte, ein edles kastanienbraunes Pferd, das vom Kap der Guten Hoffnung importiert und in Sansibar mindestens 500 Dollars wert war.