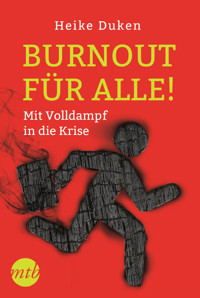14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Hommage an alle Freundinnen dieser Welt
Zwei Frauen, die unterschiedlicher nicht sei könnten, sind seit jeher beste Freundinnen. Paula ist so sehr bemüht, alles richtig zu machen, doch fühlt sich in ihrem Leben nichts richtig an, ganz besonders nicht ihre Ehe. Zett dagegen ist unabhängig, furchtlos und lebenshungrig. Dass sie tief im Inneren dunkle Erinnerungen verborgen hält, weiß niemand, nicht einmal Paula.
Die beiden verbringen unvergessliche Tage auf einer griechischen Insel, Sommertage, die nie hätten enden sollen. Doch zu Hause wartet der Herbst, Krisen kommen auf die Freundinnen zu. Um sie zu meistern, müssen sie sich dem stellen, was sie einander verschwiegen haben. Denn eins wird immer Bestand haben: Das feste Band zwischen ihnen und der Glaube, dass alles gut wird ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Obwohl Paula sich bemüht, alles richtig zu machen, fühlt sich in ihrem Leben nichts richtig an: Ihr Mann Maik, der kein gutes Haar an ihr lässt. Die Streitereien, die eskalieren. Ihre Tochter Lou, die Leidtragende.
Zett ist das komplette Gegenteil: lebenshungrig, unabhängig, kompromisslos. Niemand weiß von dem dunklen Geheimnis, das sie tief im Inneren mit sich herumträgt.
Ausgerechnet diese beiden Frauen sind seit jeher beste Freundinnen. Und mitten in der Krise nehmen sie sich die jeweils andere zum Vorbild, um sich von alten Fesseln zu befreien. Denn eins wird immer Bestand haben: Das feste Band zwischen ihnen und der Glaube, dass alles gut wird …
Die Autorin
Heike Duken, geboren 1966 in München, studierte Psychologie und arbeitet in Nürnberg als Psychotherapeutin in ihrer eigenen Praxis. Ihr erster Roman bei Limes, Wenn das Leben dir eine Schildkröte schenkt, wurde mit einem Stipendium des Deutschen Literaturfonds gefördert und von Presse und Lesern hochgelobt. Nach Denn Familie sind wir trotzdem ist Wie wir waren Heike Dukens dritter Roman, in dem sie erneut ihr großes Talent unter Beweis stellt, Figuren besonders realistisch und lebensnah zu zeichnen.
HEIKE DUKEN
WIE WIR WAREN
Roman
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Das vorliegende Werk enthält Liedzitate aus Klassikern der Musikwelt als Ausdruck der Wertschätzung für die Originale sowie als Hommage an die Musikwelt der unterschiedlichen Generationen, insbesondere der Generationen X und Y. Die hierfür verwendete zitierende Kulturtechnik ist ein prägendes Element des zeitgemäßen kulturellen Schaffens und nach § 51 a UrhG gestattet. Gleichwohl haben wir uns in allen Fällen, wo dies möglich war, um die Einholung der Zustimmung der Rechteinhaber bemüht, ohne dass hierzu jedoch eine rechtliche Verpflichtung besteht.
Copyright © 2024 by Heike Duken
Copyright © 2024 by Limes in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: René Stein
Umschlaggestaltung: Sabine Kwauka
Umschlagmotiv: © Glen Scouller.
All rights reserved 2024/Bridgeman Images; Beata Becla/Shutterstock.com
KW · Herstellung: DiMo
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-31828-4V002
www.limes-verlag.de
Für Sissi, Sonja, Uschi, Karin, Susi, Uli, Ute, Hilde, Linde und Sandra
TEIL EINS
Du liebst mich nicht du liebst mich einfach nicht du liebst mich nicht.
Sabrina Setlur
1986
Kapitel 1
Paula
Nach dem Flug und dem Chaos am Busbahnhof sitzen wir endlich mit unseren Tickets im Bus. Die großen Rucksäcke liegen im Gepäckfach, die kleinen stehen zwischen unseren Füßen. Es ist eng, jeder Platz im Bus ist besetzt. Unser Proviant: eine Flasche Cola, zwei Dosen Bier, noch kalt, zwei Tüten Chips und ein paar Weintrauben in einer Papiertüte; sie weicht gerade durch, deswegen halte ich sie in der Hand.
Zett sitzt am Fenster. Wir biegen auf die Landstraße ab, und der Busfahrer schaltet Musik ein, sie kommt aus einem scheppernden Lautsprecher direkt über uns. Wir verstehen kein Wort, aber das macht nichts, denn dass es traurig ist und um Sehnsucht geht, das verstehen wir auch so. Zett und ich sehen uns an, irgendwie feierlich. Jetzt sind wir also unterwegs. Unsere Reise beginnt. Sie lehnt sich zurück, sieht aus dem Fenster, schnauft tief durch und sagt: »Yes.« Mehr nicht, ohne mich anzusehen.
»Yes«, antworte ich. Es ist mein erster richtiger Urlaub. Ich bin neunzehn und habe bis jetzt nur den Chiemsee gesehen, und das war mit meiner Oma, als ich sechs war.
Wir haben sieben Stunden Fahrt vor uns. Erst geht es hinauf in die Berge, die Straßen sind schmal und kurvig, der Bus röchelt, der Fahrer gibt Gas, heizt über Schlaglöcher und bremst erst kurz vor den Kurven scharf ab, wir werden ordentlich durchgerüttelt. Alles schwitzt. Sogar der Wind, der durch die offenen Fenster hereinkommt, ist heiß. Die Musik bleibt die ganze Zeit laut, traurig und sehnsüchtig. Manchmal jammert ein Kind, aber nur kurz, die Mütter stecken ihnen Süßigkeiten zu, reichen kleine Tüten mit Fruchtsaft, dann wieder Kekse oder gebackene Stückchen mit Puderzucker, es ist ein ständiges Essen; später wird es herzhafter, mit Weißbrot und Plastiktüten voller Tomaten und gegrilltem Fleisch, die Gerüche vermischen sich. Irgendwann schlafen die satten Kinder alle ein, die Männer schreien noch eine Weile herum, wie kann man sich so laut unterhalten, frage ich mich, dann schlafen sie auch ein, manche schnarchen. Die Musik verstummt. Es wird ganz still im Bus, nur der Motor röchelt weiter, und metallene Teile scheppern bei jedem Schlagloch. Sogar die Frauen schlafen schließlich, ihre Kinder liegen mit roten Backen und verschwitzten Haaren auf ihnen drauf.
Zett öffnet eine der Bierdosen, sie macht das sehr cool mit einer Hand, und trinkt schnell den ersten Schluck, damit nichts herausschäumt. Sie gibt mir die andere Dose. Das Bier ist warm geworden, aber das ist uns egal. Unsere Laune wird besser und besser. Zett zieht ihren Walkman aus der Tasche und gibt mir einen der Ohrhörer, den anderen steckt sie sich ins Ohr. Wir hören Terence Trent D’Arby. Beim Refrain tippen wir mit den Zeigefingern den Takt in die Luft und bewegen nur die Lippen mit: »Sign your name across my heart, I want you to be my lady.«
»Auf Griechenland!«, sagt Zett leise und stößt mit mir an.
»Auf Griechenland.«
Der nächste Song ist von Chris Rea, Fool if you think it’s over, und wir singen lautlos mit. Dann bin ich so müde, dass mir fast die Augen zufallen. Doch meine Angst hindert mich am Einschlafen, es geht inzwischen bergab, und ich frage mich, ob die Bremsen das noch mitmachen. Ob der ganze Bus ins Schleudern gerät und von der Fahrbahn abkommt, ob wir alle in den Abgrund stürzen. Die Leitplanke ist ein Witz.
»Komm her«, sagt Zett und zieht mich zu sich, drückt meinen Kopf sachte auf ihren Oberschenkel, da soll ich liegen bleiben. Sie kennt mich eben. Sie kennt jeden meiner düsteren Gedanken. Ich ziehe die Beine an, die Füße hängen über den Sitz in den Gang hinein, ich mache mich ganz klein. Das ist bequemer, als ich gedacht hätte. Und Zett streichelt mir den Kopf. Sie hat sich den zweiten Ohrhörer genommen und hört weiter Musik, während die Männer um uns herum schnarchen. Mal rutsche ich mit den Kurven näher zu Zett hin, mal weiter weg, das Geruckel und ihr Streicheln beruhigen mich.
Da kommt sie mit ihrer Hand an die Stelle. Sie spürt es und hält inne. Streicht ganz leicht, ganz sanft darüber. Legt ihre hohle Hand darauf und lässt sie dort liegen. Es tut nicht weh, Zett ist ganz vorsichtig. Halb liegt ihre Hand auf meinem Ohr. Wir schwitzen. Ich könnte ein bisschen weinen, lasse mich aber nicht. Ich bin hier, in Griechenland, im Bus, neben Zett, sie ist da. Irgendwann raschelt sie mit einer Tüte und macht Krach mit den Chips. Sie ist ein kleiner Vielfraß, ständig knabbert sie irgendwas. Gleichzeitig summt sie einen Song mit, ich erkenne ihn nicht. Ihre hohle Hand liegt noch immer auf der Stelle. Ich bin so müde.
Ich werde wach, als die Musik aus dem Lautsprecher wieder einsetzt, und richte mich auf. Meine Haare kleben mir an der Stirn. Der ganze Bus ist wieder lebendig, alle sind wieder am Essen. Zett lehnt am Fenster und schläft. Ich habe Durst und muss pinkeln, trinke Cola und muss noch mehr pinkeln. Es gibt keine Toilette, doch etwas später halten wir an einer Raststätte an. Eine Schlange bildet sich vor der Toilette. Es ist ein Stehklo. Ich weiß nicht, wie herum ich mich hinhocken soll, zur Wand oder zur Tür. Stehklos sind ziemlich praktisch, man muss es nur heraushaben, dass es nicht zu sehr spritzt. Doch ich mache den Fehler, in das Loch zu schauen. Das hätte ich bleiben lassen sollen. Nicht in das Loch schauen bei einem Stehklo, Paula, bitte merken.
Kapitel 2
Paula
Es stürmt, als unsere Fähre den Hafen von Piräus verlässt. Piräus, ich hatte an das Lied gedacht, ein Schiff wird kommen, und das bringt mir den einen … Deswegen stellte ich mir blaues Meer und weiße Segelboote vor.
Aber der Hafen von Piräus wimmelt vor allem von Schiffskränen, Containern, Lagerhallen und Müll, der im Wasser an die Kaimauer schwappt. Als wir an der Reling stehen, ziehen außerdem dunkle Wolken auf, Regen und Windböen reißen uns fast von Bord. Wir wollten romantisch an Deck schlafen, unter dem Sternenhimmel, unsere Heimat ist das Meer und so, dieses Meer ist aber eher angriffslustig als romantisch gestimmt, es lässt das Schiff nach dem Auslaufen von links nach rechts und hoch und runter schwanken, die Gischt spritzt bis zu uns hoch, eine Welle erwischt unsere Rucksäcke. Wir müssen uns wohl oder übel einen Schlafplatz im Inneren suchen. Zweimal werden wir vertrieben, einmal, weil wir einen Notausgang blockieren, einmal wegen einer Kiste mit Schwimmwesten, die zugänglich bleiben muss. Wir finden schließlich einen Treppenabsatz und breiten die Schlafsäcke aus, sie sind feucht geworden. Auch meine Klamotten sind feucht und klamm. Es ist kalt, eine Klimaanlage läuft.
»Das fängt ja gut an«, sage ich. »Wir werden uns erkälten.«
»Nicht gleich schlechte Laune kriegen! Wir haben Bier, wir haben zwei Snickers und das hier.« Sie kramt ihren Walkman heraus. Er ist trocken geblieben und funktioniert. Wir hören Trio, Da Da Da, während die Leute an uns vorbeigehen, sie haben Kabinen und betrachten uns von oben herab, als wären wir Hunde, die im Weg liegen und vertrieben gehören.
Zett und ich sitzen an die Wand gelehnt, essen Snickers, trinken warmes Bier und hören Musik, bis die Batterien leer und die Leute in ihren Kabinen verschwunden sind, wo sie in ihren trockenen Betten schlafen.
Unsere Fähre läuft bei Sonnenschein in den Hafen von Skopelos ein. Draußen schäumen noch ein paar Gischtkronen, doch hier im Hafenbecken ist das Meer glatt und glänzend, man kann Fische sehen. Der Himmel über dem Städtchen ist strahlend blau, als hätte es den Sturm in der Nacht nie gegeben. Wir stehen unterhalb der Brücke und beobachten die Matrosen, die das Anlegemanöver vorbereiten. Sie hantieren mit Seilwinden und dicken Tauen und bekommen Anweisungen von einem Mann in weißer Uniform, der per Funk mit der Brücke verbunden ist, ein Knacken und Rauschen.
Als das Schiff nah genug und im richtigen Winkel die Hafenmole angesteuert hat, wirft einer der Matrosen ein Seil mit einem kleinen Gewicht hinüber ans Ufer. Dort steht ein Typ von der Insel bereit, um die Kugel rasch aufzulesen und dann kräftig am Seil zu ziehen, er hievt ein schweres, nasses Tau aus dem Meer. Es braucht zwei Mann, das Tau um einen Poller an der Mole zu winden, und als es geschafft ist, streckt einer den Daumen hoch in Richtung Brücke. Eine Winde setzt sich in Bewegung, sie zieht das Tau an, strafft es, sodass das Meerwasser heraustrieft. Das Schiff bewegt sich nun noch dichter an die Hafenmauer heran und drückt schließlich gegen die Autoreifen, die dort aufgereiht festgebunden sind, quetscht die Reifen sanft zusammen, und das ganze Ungetüm kommt schließlich zum Stillstand.
»Skopelos, Skopelos!«, ruft einer der Arbeiter und treibt zur Eile an. Zett macht eine Handbewegung, los, los, wir müssen runter vom Schiff, sonst fährt es noch mit uns weiter. Ich wuchte meinen Rucksack auf den Rücken, er ist schwer von der Feuchtigkeit, aber ich habe den Schwung raus.
Am Anleger kommen Leute auf uns zu. »Rooms, rooms!«, rufen sie, es klingt wie Rums, rums, sie halten aufgeschlagene Mappen mit Fotos in die Höhe. Wir schütteln die Köpfe.
»No, thank you. Camping!«
Eine junge Frau tritt vor uns hin: »Camping, yes, look!«
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Zett nimmt die Sache in die Hand. »No, thank you, wild camping, okay? Do you know, where?«
»Aah, no money?« Die Frau lacht. »Take a taxi to Panormos Beach.«
»No money«, gibt Zett lachend zurück und zuckt mit den Schultern.
Aber es geht ihr eigentlich nicht um die paar Mark für den Campingplatz, sondern ums Abenteuer. Ich war von Anfang dagegen. Wildcampen ist verboten in Griechenland, angeblich wird es in der Nebensaison geduldet, gerade hier auf Skopelos in der Panormos-Bucht.
Aber was, wenn das nicht stimmt? Wenn die Einheimischen etwas dagegen haben? Wenn die Polizei kommt und uns verjagt? Dann ist es vielleicht schon spät und dunkel, und wir haben keine Bleibe. Es arbeitet ständig in meinem Kopf, was, wenn, was dann und immer so weiter.
»Du Angsthase, du musst mal was erleben«, hat Zett schon in Deutschland bestimmt.
»Wollen wir nicht doch …?«, versuche ich es jetzt ein letztes Mal.
»Auf keinen Fall! Wo kann man das noch, wild campen, hm? Hier ist alles sicher, und ich bin bewaffnet.«
»Du bist was?«
»Bewaffnet. Komm, da drüben stehen die Taxis. Wir müssen los, damit die Schlafsäcke noch trocknen.«
In der Bucht stapfen wir über den Kies, vorbei an einer Taverne und an ein paar Zelten, ich höre deutsche Wortfetzen.
»Wo läufst du hin? Stellen wir uns zu den anderen.«
Aber Zett hält nichts davon. »Da können wir ja gleich auf dem Campingplatz schlafen. Nein, wir gehen weiter, über den Felsvorsprung, wir suchen uns eine einsame Bucht, nur für uns, verstehst du?«
Ich laufe einfach hinter ihr her. Zett hat das Kommando, ich habe Hunger und nichts zu melden. Ich kann nur mit knurrendem Magen den schweren Rucksack über den Felsvorsprung schleppen, immer weiter, es sind ihr noch zu viele Menschen am Strand. Endlich bleibt sie stehen.
»Hier«, sagt sie, setzt ihren Rucksack ab und wischt sich mit dem T-Shirt-Ärmel übers Gesicht.
Wir stehen etwas oberhalb einer winzigen Kiesbucht. Das Wasser ist so klar, dass man jeden einzelnen Stein am Grund sehen kann, die Wellen funkeln in der Sonne. Kein Mensch weit und breit. Wo wir stehen, ist die Erde platt getreten, bestimmt hat hier schon ein Zelt gestanden. Vielleicht im letzten Jahr. Um uns herum drei Kiefern, die für Schatten sorgen. Zett meint, das wäre wahnsinnig wichtig, damit wir morgens länger schlafen können, wenn wir das Zelt richtig platzieren. Sie kennt sich eben mit allem aus. Ein kleiner Felsbrocken und ein Baumstamm liegen um eine rußige Feuerstelle herum, unsere Möbel. Alles ist einfach perfekt. Wir legen die Schlafsäcke und die nassen Klamotten auf den Kies in die Sonne, damit ist die Bucht schon fast ausgefüllt, so klein ist sie, nur für uns, wie Zett gesagt hat. Dann bauen wir schweigend das Zelt auf. Klopfen Heringe in den Boden, spannen die Seile, packen unsere Vorräte aus.
Das ist der schönste Moment, wenn die Arbeit getan ist, wenn alles steht und hält und wenn Zett eine Flasche Retsina auspackt und ich das Brot und die Tomaten. Wir sitzen auf unserer privaten Terrasse mit Ausblick aufs Meer, Zett auf dem Baumstamm, ich auf dem Felsbrocken, und wir essen und trinken, und in diesen Momenten ist dieses andere, es ist weg, weit weg, so wie die Beule kaum mehr zu spüren ist, sie wird kleiner und kleiner, heilt einfach so, ist das nicht seltsam? Jetzt, als mir der Retsina in den Kopf steigt und die Tomaten so gut schmecken, ist es irgendwie gar nicht mehr wahr, was passiert ist, es ist nur ein Film, den ich gesehen habe, und langsam vergesse ich ihn. Das Meer plätschert, die Wellen rollen sanft an, ein regelmäßiges Schwappen, dazu Zetts Lachen, das lauter wird mit jedem Schluck Wein, alles ist gut jetzt. Die Zikaden setzen ein.
Nachts liege ich trotz des vielen Weins wach. Zett stiftet mich immer zum Trinken an, ich weiß nicht, warum. Sie schläft schon. Die Zikaden haben aufgehört zu zirpen, alle gleichzeitig, wie verabredet. Von der Taverne weht noch eine Weile Musik zu uns her, dann wird es ganz still. Nur das Meer gibt noch nicht auf, es gibt nie auf, rauscht und schwappt weiter. Ab und zu knackt es in den Bäumen über uns, die Äste und Pinienzapfen arbeiten in der kälter werdenden Nacht.
Zett fängt an, leise zu schnarchen, das kenne ich schon, sie hat Polypen in der Nase. Es stört mich nicht, im Gegenteil, es beruhigt mich. Das Mondlicht wirft Schatten, die sich über mir im Wind bewegen.
Ich bin gerade am Eindösen, als ich aufschrecke. Ich habe etwas gehört. Etwas anderes. Ein anderes Knacken, nicht von oben aus den Bäumen, sondern lauter und viel näher. Ich greife nach Zett, ich klopfe ihr auf den Rücken, und als sie nicht reagiert, schüttele ich sie.
»Was, Paula?«
»Hör doch mal«, flüstere ich.
Es ist still. Kein Mucks. Zett rollt sich wieder zurecht, ihr Schlafsack raschelt. Ich und meine Angst. Das denkt sie bestimmt: Paula und ihre Angst.
»Da ist nichts«, sagt sie schläfrig. »Nur Bäume.«
»Entschuldige.«
»Schlaf jetzt.«
Ich lausche weiter. Ich habe es doch gehört. Ganz nah. Vielleicht ein Tier. Ein streunender Hund. Ich könnte ihn zähmen, ihn zu unserem Wachhund machen. Ihn mitnehmen. Oder streift eine Ziege durch die Gegend? Habe ich Angst vor einer Ziege? Am Ende ist es vielleicht nur eine Maus. Die anderen Zelte sind gar nicht so weit weg. Die Kiefernzapfen knacken bloß manchmal etwas lauter. Morgen früh können wir zur Taverne gehen und bekommen vielleicht einen frischen Mocca. Alles ist gut. Alles ist doch gut. Ich muss nur einschlafen.
Doch ich liege mit offenen Augen wach, starre in die Dunkelheit, lausche, höre Zetts Atemzüge mit ihrer verstopften Nase. Wie kann sie schlafen, wir beide ganz allein hier draußen in der Dunkelheit? Wir sind naiv gewesen, unvorsichtig. Zwei Frauen allein in der Nacht. Man ist ausgeliefert, man ist schwach als Frau. Wie lange dauert es, bis es hell wird? Es ist noch vor Mitternacht, die Sonne geht erst gegen sieben auf.
Und dann höre ich wieder etwas. Ich presse meine Kiefer so fest zusammen, dass es wehtut. Es sind Schritte. Kein Tier, keine Kiefernzapfen. Jemand geht langsam um unser Zelt herum. Ich lange zu Zett, rüttle an ihr, lautlos, und lege ihr gleichzeitig eine Hand über den Mund. Sie schiebt sie harsch weg und setzt sich auf.
Dann hört sie es auch. Jemand geht um unser Zelt herum, schlägt mit dem Fuß gegen einen der Heringe, ein Stolpern, dann kurz Stille und wieder Schritte. Zett und ich fassen uns kurz an den Händen. Dann kramt sie in ihrem Rucksack herum. Ich versuche, sie zu packen, sie davon abzubringen, man hört doch, dass wir wach sind, dass wir da sind, wir müssen leise sein, unauffällig, dann passiert uns nichts. Aber das ist ja Unsinn, natürlich sind wir da, mitten in der Nacht ein Zelt in einer einsamen Bucht, wo sollen wir sonst sein?
Zett hat anscheinend gefunden, was sie gesucht hat, und wühlt sich aus ihrem Schlafsack. Ich greife nach ihr, bekomme ihr Schlaf-Shirt zu fassen und halte mich daran fest.
»Lass mich, ich geh da jetzt raus«, sagt sie laut.
»Nein!« Ich bin panisch, halte panisch das T-Shirt in der einen Hand, packe mit der anderen Hand ihren Arm, mit aller Kraft, sie versucht sich zu befreien, aber ich lasse nicht los, ich werde niemals loslassen.
»Paula!«, sagt sie noch lauter.
»Nein!« Meine Stimme klingt fremd. Ich kenne das. In Filmen schreien sie immer, sie kreischen, aber man schreit nicht wie im Film, so grell und hoch, man kreischt nicht. Es kommt von viel tiefer unten. Es ist mehr ein Grollen, ein Donnern aus den Eingeweiden. Man kontrolliert es nicht, es kommt einfach heraus, man schämt sich für das Geräusch, das man macht, man schämt sich, weil es einen verrät, es verrät die Angst, es verrät, dass man machtlos ist. Zett und ich rangeln miteinander. Sie versucht mich abzuschütteln, aber ich hänge mich mit meinem ganzen Gewicht an sie dran, sie kommt nicht weiter. Sie schafft es allerdings, den Reißverschluss vom Zelt hochzuziehen. Und als ich das höre, das Zippen, das Ratsch, da werde ich ganz starr. Ich lasse Zett los. Der Reißverschluss. Er ist doch die letzte Barriere. Zwischen drinnen und draußen, zwischen mir und den Schritten, zwischen uns und allem, und jetzt steht er offen. Ich sehe einen Ast, er bewegt sich im Wind. Dahinter der Mond. Zett klettert ins Freie und schreit aus Leibeskräften: »Ich bring dich um! I’ll kill you! I am armed, you know, an armed woman! Ich bin bewaffnet!«
Sie ist verrückt. Das werden wir zurückbekommen, ich weiß es, dafür werden wir büßen. Wie kann sie nur? Sie rennt draußen herum und schreit.
Und ich sitze im Zelt, meine Beine im Schlafsack, ich habe ein weißes, viel zu großes T-Shirt an. Draußen der Ast, er zappelt hin und her, die Schatten zappeln, schwapp, schwapp, das Meer. Kann es nicht ein Mal ruhig sein? Sie muss doch schlafen, die Frau im Zelt. Sie sitzt nur da, macht nichts, bewegt sich nicht, das Dummerchen, das Schaf, die Haare sind ganz verstrubbelt, sie sitzt da wie festgefroren. Weißt du noch, der Film, Zett, die Schneekönigin? Wir als Kinder? Weihnachten. Weißt du noch, Kai, der Junge? Ich habe ihn immer geliebt. Sein Herz war eingefroren. Er war ganz kalt. Aber dann ist er aufgetaut.
»Er ist weg«, sagt Zett und streckt den Kopf ins Zelt. »Hier ist niemand mehr.«
Ich antworte nicht, sondern schnaufe, als wäre ich um mein Leben gerannt. Mein Hals tut mir weh. Der Nacken, die Beine. Als hätte ich ein Fitnesstraining gemacht. Aber ich habe nur dagesessen, mehr nicht.
»Das war nur ein Spanner«, sagt Zett. »Der hat sich verzogen. Komm raus, wir rauchen eine auf den Schrecken.«
Ich klettere aus dem Zelt. Ich bin ganz brav. Die Nacht ist hell, der Mond fast voll.
Zett nimmt zwei Zigaretten aus der Schachtel und zündet beide an. Eine bekomme ich. Wir setzen uns auf den Baumstamm und den Felsbrocken.
»Die Luft ist rein«, sagt Zett wie zu sich selbst und bläst den Rauch aus. Etwas glänzt in ihrer Hand.
»Was hast du da?« Mein Mund ist trocken, ich räuspere mich.
»Ein Messer.« Das Mondlicht spiegelt sich darin und wirft Lichtfetzen in die Nacht.
Ich schaue auf das Messer in ihrer Hand. Es ist ganz und gar aus Metall, es glänzt, der Griff ist gelöchert, die Klinge lang. Zett klappt das Messer mit einer einzigen Handbewegung zu, es macht dabei ein schleifendes Geräusch.
»Man muss sich doch wehren«, sagt sie.
Wie kann sie so cool sein? Sie zeigt mir noch etwas, ein Reizgasspray. Ich starre auf das Messer und das Spray.
»Mir tut keiner was, Paula«, sagt sie, und jetzt merke ich, dass sie gar nicht so cool ist. Sie zittert. Ich glaube, vor Wut.
»Du hast ihn vertrieben.«
»Ja, er ist weggerannt. Er war nicht gefährlich.«
»Du, du bist gefährlich, Zett-wie-Zorro!«, sage ich und lache komisch.
»Ja, ich schon.«
Wir klettern ins Zelt zurück, und Zett macht den Reißverschluss zu. Dann knipst sie eine Taschenlampe an. Daran hatte ich gar nicht gedacht, wir haben Taschenlampen dabei. Ich leuchte zu Zett hin, damit sie ihre Waffen ablegen kann, die sie direkt neben sich an der Zeltwand platziert. Dann krabbeln wir wieder in unsere Schlafsäcke. Das Meer schwappt weiter und weiter. Alle Muskeln tun mir weh, ich strecke mich.
»Morgen ziehen wir um auf den Campingplatz«, sagt Zett im Dunkeln.
»Okay.«
Ich krieche an sie heran mitsamt meinem Schlafsack und lege mich an ihren Rücken mit dem Arm schwer auf ihrer Seite. Sie schnauft einmal tief ein und wieder aus, es rasselt in ihrer Nase.
Kapitel 3
Zett
»Wirf es ins Meer!«, bekniete mich Paula am Morgen, nachdem ich den Wichser vertrieben hatte. »Wirf das Messer ins Meer!« Ja, klar. Sie hatte mal wieder keine Ahnung. Ein psychopathischer Taucher hätte es finden können, aber so weit dachte sie nicht, obwohl sie sonst immer wahnsinnig weit dachte, viel zu weit. Das Messer machte ihr Angst.
Aber Paula, mein Schatz, das ist der Sinn von einem Messer: Angst machen. Und ehrlich gesagt, es war bedenklich, du hattest vor allem Angst: Seeigel, Dunkelheit, Meer bei Dunkelheit (»Ich geh nachts nicht ins Wasser, ich bin doch nicht verrückt.«), Bars mit Plastikstühlen (warum?), Nebengassen (?), Strand ohne Leute, Strand mit falschen Leuten, Berge (einsam!), ein Fest in einem kleinen Bergdorf (»Die Einheimischen, wir könnten sie stören!«), Rollerfahren (»Und wenn wir einen Unfall bauen?«), Tavernen, in denen du noch nie warst (»Wir waren noch nie auf dieser Insel, denk nach, Paula!«), und so weiter und so weiter. Es war eine lange Liste, die niemals endete, vielleicht erst dann, wenn wirklich mal was passierte, so wie jetzt. Aber ich glaube, du würdest nur zufrieden nicken, Paula, weil du es ja schon immer gewusst hast.
Ich war entschlossen, das Messer zu behalten und darauf aufzupassen wie auf meinen Augapfel, weil ich es nämlich notfalls mal gebrauchen konnte, das wusste man nie, und natürlich wegen Reyner. Der Junge aus meiner Klasse, ein Filipino. Die Idioten in der Schule beömmelten sich alle über seinen Namen, weil Reyner nicht wie ein Rainer aussah, darüber kamen sie nicht hinweg, sie nannten ihn »Fidschi«, obwohl jeder halbwegs normale Mensch weiß, dass die Fidschi-Inseln von den Philippinen so weit weg sind wie Italien vom Nordpol. Aber den Idioten ging es natürlich um was anderes. Sie hatten ihr Opfer. Ich schaute es mir eine Weile an. Ab und zu sagte ich, sie sollten ihn in Ruhe lassen, aber das wirkte nur kurz, weil sie es nach fünf Minuten wieder vergaßen und dann wieder ihren niederen Instinkten folgten. Beim Sport lachten sie sich tot über ihn, weil er ziemlich klein und sehr dick war. Wir Mädchen hatten Unterricht in der anderen Hallenhälfte, und die meisten waren froh, dass die Jungs es auf Reyner abgesehen hatten und nicht auf sie. Wenn er als Letzter in ihre Mannschaft gewählt wurde, donnerten die Idioten den Ball auf ihn drauf, damit er möglichst bald rausflog. Der Sportlehrer versuchte, sich das Lachen zu verkneifen, aber er lachte trotzdem. Und Reyner konnte irgendwann nicht mehr durch den Schulflur laufen, ohne dass er einen Schlag mit der Faust bekam, so ganz nebenbei.
Irgendwann reichte es mir. Es musste was passieren. Ich musste in der Sache mit Reyner was unternehmen. Deshalb sagte ich in der Klasse, morgens, bevor die Lehrerin kam, ziemlich laut, sodass alle mich hören konnten: »Hey, Reyner, kannst du mir vielleicht mal Mathe erklären? Ich meine nachmittags oder so. Würdest du das machen?«
Er sah mich ganz ruhig an und gab keine Antwort. Er wartete, klar, er wusste nicht, ob das eine Verarsche war. Er war jedenfalls darauf gefasst. Er erwartete den Schlag, den ich ihm verpassen würde, mit einer Art Schlafzimmerblick, die Augenlider halb geschlossen. Und dieser Blick, so ohne Hoffnung, machte mich einen Moment lang traurig, und weil ich jede Art von Traurigkeit hasse, wurde ich blitzschnell wahnsinnig wütend. Ich sah mich um, ob die Wut vielleicht irgendwohin konnte, ob irgendwer was Falsches sagte oder falsch schaute, aber niemand traute sich. Es war total still in der Klasse. Die Mädchen drückten ihre Köpfe tief in ihre Hefte. Die Jungs standen da und starrten mich an.
»Also nur wenn du Zeit hast«, sagte ich.
»Ich hab Zeit«, antwortete Reyner, noch immer ganz ruhig. Er hatte wahrscheinlich abgewogen, was es zu verlieren gab. Die Jungs fingen an zu lachen, aber hinter vorgehaltener Hand.
»Okay, super. Heute um drei?«
Reyner nickte. Ich nickte zurück. Die Lehrerin kam rein. Als sie vorn am Pult stand, war es immer noch auffällig still im Klassenzimmer, sie schaute sich besorgt um, konnte aber nichts Verdächtiges entdecken. Reyner steckte mir nach der Stunde einen Zettel mit seiner Adresse zu.
Er wohnte nicht in unserer Reihenhaussiedlung, sondern in der Wohnung über dem Restaurant seiner Eltern. Es war ein chinesisches Restaurant. Er zeigte mir in seinem Zimmer als Erstes eine Weltkarte und dann die Philippinen, wo er herkam. Eine Reißzwecke steckte an der Stelle. Er erzählte, sie hätten dort ein riesiges Haus gehabt und er hätte jeden Tag im Meer gebadet. Er konnte angeblich einen Fisch mit der Hand fangen.
»Warum bist du hergekommen?«
»Keine Ahnung.« Er zuckte mit den Schultern.
Das wunderte mich nicht. Kindern wurde nichts erklärt, sie mussten einfach immer alles machen, was man ihnen sagte. Das war normal.
Reyner schaute verloren auf die Reißzwecke. Er ging anscheinend davon aus, dass die Philippinen ein wesentlich schöneres Leben für ihn bereithalten würden, wenn nicht widrige Umstände (chinesisches Restaurant?) oder seine mysteriösen Eltern (Chinesen?) ihn in dieser grauenhaften Stadt in diesem grauenhaften Land festhalten würden.
»Du brauchst mir die binomischen Formeln nicht zu erklären«, sagte ich, um irgendwas zu sagen.
»Ich weiß.« Er wollte etwas sagen, entschied sich aber dagegen. Er nickte. Er schaute mich nur misstrauisch an und hätte bestimmt gerne gewusst, warum ich da war. Er war auf der Hut.
Seine Mutter brachte Salamibrote rein. Ich hatte etwas anderes erwartet. Sie war übertrieben freundlich und anscheinend froh darüber, dass ihr Sohn endlich mal Besuch hatte. Das war natürlich peinlich für Reyner. Er war auf einmal nervös, und das war er sonst nie. Zum Glück ging seine Mutter schnell wieder raus. Er saß auf seinem Schreibtischstuhl, ich auf dem Bett. Ich starrte auf den Autoteppich zwischen uns, die Straßen und Zebrastreifen, es war ein Teppich für ein Kindergartenkind. Er würde sich von diesem Teppich trennen müssen, beschloss ich, und ich war es wohl, die ihm das sagen musste.
Stattdessen sagte ich: »Mütter sind sooo …«, und verdrehte dabei die Augen.
»Ich mag meine Mom.«
Er saß dick und klein auf seinem Schreibtischstuhl, es war ein Drehstuhl.
»Schon klar.«
Eine Pause entstand. Ich schaute mir Reyners Regal an. Es standen wahnsinnig viele Bücher drin.
»Liest du viel?«
»Ja. Was soll ich sonst den ganzen Tag machen?«
»Du solltest mal diesen Autoteppich entsorgen. Also du bist zwölf oder so. Das ist ein bisschen peinlich mit den ganzen Straßen und Parkplätzen, verstehst du?«
Er schaute sich den Teppich an. Etwas passierte dabei in seinem Gesicht. Manchmal verliert etwas urplötzlich seinen Glanz oder diese Puderzuckerschicht aus irgendwelchen Kindheitserinnerungen. Es liegt nur noch so da, wie es ist, glanz- und bedeutungslos.
Reyner atmete tief ein, noch immer den Teppich im Visier. Ich hatte ihm die Augen geöffnet. Wieso mache ich das immer, Augen öffnen? Als wäre das meine Mission. Dabei ist es jedes Mal ein schrecklicher, grauenhafter Moment.
»Ich könnte dich küssen, wenn du willst«, sagte ich.
»Warum?«
Ich wusste es nicht. Ich wollte ihm irgendwie eine Freude machen. Das setzte sich später so fort, ich machte den Typen eine Freude, die mich im Inneren irgendwie rührten, und dachte dabei: Was soll’s, er freut sich.
»Lieber nicht«, sagte Reyner.
»Warum nicht?« Es kam mir komisch vor. Vielleicht war er schwul.
»Ich könnte Gefühle für dich entwickeln, und dann würden diese Gefühle enttäuscht werden.«
Das musste ich erst einmal verdauen. Mir fiel nicht sofort eine Antwort ein. Auch das war komisch.
»Keine Sorge, ich weiß, wie ich aussehe«, sagte er.
»Du könntest mal abnehmen, dann hättest du weniger Probleme.«
Er drehte sich auf seinem Stuhl nach links und nach rechts, sah mich kurz an, wenn er in der Mitte war, und gab eine gelangweilte Miene zum Besten. Es konnte jedoch unmöglich der Fall sein, dass er in diesem Moment, hier mit mir, gelangweilt war.
Als er gerade wieder nach links drehte, meinte er: »Ach so, das hat mir bis jetzt noch niemand gesagt.«
Dann drehte er zurück zur Mitte und hielt an, ein ganz zartes Grinsen im Gesicht, das ein kleines bisschen arrogant auf mich wirkte, deshalb musste auch ich lächeln. Ich würde ihm auf jeden Fall eine Freude machen, so viel stand fest.
»Man merkt, dass du viel liest«, sagte ich schließlich. »Du bist nicht so ein wahnsinniger Idiot wie die anderen.«
»Soll ich dir was zeigen?«
»Klar.«
Er ging zu einer Schublade und holte eine verzierte Schatulle heraus. Ich dachte, jetzt würde etwas Kindisches und Langweiliges kommen, darauf hatte ich keine Lust. Aber es war etwas Metallenes, eine Art Stab mit Löchern. Reyner nahm es heraus und klappte das Ding mit einer wahnsinnig schnellen, kunstfertigen Bewegung auf. Zack – es war ein Messer. In nicht mal einer Sekunde. Die Klinge glänzte. Nein, das war nicht kindisch. Reyner spielte mit dem Messer herum, klappte es zusammen und wieder auf, es ging so schnell, dass ich die Bewegungen unmöglich verfolgen konnte.
»Wow«, sagte ich. »Darf ich es mal haben?«
Er schüttelte den Kopf. »Es ist extrem scharf. Man muss es können. Mein Onkel hat es mir zur Kommunion geschenkt und mit mir geübt.«
Er bräuchte sich in der Schule nicht quälen zu lassen, dachte ich. Er müsste nur sein Messer mitnehmen und es ein paarmal ein- und wieder ausklappen. Das würde ihm Respekt verschaffen. Aber vielleicht reichte es ihm, es zu besitzen. Vielleicht ließ ihn das alles so stoisch aushalten, mit dieser Ruhe. Er hatte das Messer und konnte es jederzeit jemandem ins Herz stoßen. Und niemand wusste davon. Im Prinzip waren sie alle todgeweiht und hatten keine Ahnung.
»Es ist ein Balisong«, sagte er. »Die Klinge ist verborgen, aber mit einer einzigen Handbewegung ist das Balisong einsatzbereit. Die Fischer auf den Philippinen verwenden es. Ist es geschlossen, können sie den Fisch damit erschlagen, ist es offen, nehmen sie ihn damit aus. Man kann einen Hai damit töten.«
Er klappte es zusammen, verschloss die Griffe um die Klinge mit einem Haken und gab es mir in die Hand.
»Es gibt stumpfe Messer zum Trainieren, weil es sonst zu schweren Verletzungen kommt.«
»Zeigst du es mir? Wie dein Onkel es gemacht hat? Oder hattet ihr eines zum Trainieren?«
»Nein.«
»Du warst acht oder neun und hast mit dem scharfen Messer geübt? So einen Onkel hätte ich auch gerne, ehrlich gesagt.«
»Na gut, ich zeige es dir.«
Wir trainierten den ganzen Nachmittag. Reyner war ein guter Lehrer, ernst und vorsichtig. Er ging schrittweise vor: Erst sollte ich den Mechanismus verstehen, dann die Bewegungsabfolge.
Als ich ging, sagte ich: »Danke, Reyner.«
Er nickte. Seine Augenlider schlossen sich halb, er hatte wieder diesen Schlafzimmerblick. Ich musste los. Es war zehn vor sechs, und ich musste immer absolut pünktlich um sechs zum Abendessen zu Hause sein. Sonst kriegte ich nichts mehr. Da war mein Vater konsequent.
Es ging in der Klasse allerdings weiter mit Reyner. Manche Lehrer stachelten das Ganze noch an. »Unser Reyner!«, rief der Schindi immer hämisch in die Klasse, wenn Reyner etwas sagte, egal was. Dabei sagte er meistens das Richtige, es war nur immer ein bisschen zu viel des Guten. Er kannte sich einfach mit fast allem unwahrscheinlich gut aus, aber das nutzte ihm nichts.
Er blieb ganz ruhig (das Messer!), während ich von Tag zu Tag wütender wurde, bis ich ständig wahnsinnig wütend war, aber nicht wusste, wohin damit. Ich konnte den Schindi und die ganzen Jungs nicht verprügeln, ich war zu schwach. Also dachte ich an das Balisong. Ich bekam regelrecht Sehnsucht nach dem Messer. Ich dachte immer öfter daran, jeden Tag, jede Sekunde. Ich wiederholte im Stillen das Wort: Balisong, Balisong, Balisong. Es war fast eine Art Gebet.
Eines Tages gab es in der Pause dann die Schlägerei. Jonas hatte irgendwas zu Reyner gesagt, und es musste etwas wirklich Schlimmes gewesen sein, denn Reyner zog diesmal nicht den Kopf ein, sondern rannte mit seinem ganzen Gewicht los, keuchend, quasi eine Dampfmaschine, er rannte volle Kanne auf Jonas drauf, riss ihn um und wollte anscheinend einfach auf ihm liegen bleiben, um ihn zu zerquetschen. Aber Jonas war riesig, ein Wasserballer, ich kannte ihn aus der Schwimmhalle, er befreite sich praktisch mit links, lag nun seinerseits auf Reyner drauf und schlug ihn mit der Faust, auch ins Gesicht. Wasserballer haben unwahrscheinlich viel Kraft. Reyner schrie nicht einmal, er ließ es geschehen wie sonst auch, aber alle anderen schrien, weil es so brutal aussah, und es war immerhin ein Gymnasium, da wurde sich nicht jeden Tag geprügelt. Eine Lehrerin kam angerannt, Jonas ließ sofort von Reyner ab und behauptete: »Der Fettsack hat angefangen!«, und alle nickten und bekräftigten, dass Reyner angefangen hatte. Der sagte wie immer gar nichts. Er stand aufrecht da, mit hochrotem Kopf und abstehenden schwarzen Haaren, und verteidigte sich nicht. Ich wusste, warum. Er hatte das Messer. Er wusste, er konnte Jonas töten, und das reichte ihm. Es zu KÖNNEN.
Die Pause war fast zu Ende. Reyner bekam einen Verweis. Seine Jacke war dreckig und zerrissen. Er stand allein auf dem Schulhof, Jonas ein paar Meter entfernt, er grinste. So ein richtiges Arschgeigengrinsen. Die anderen drängelten sich um Jonas herum und schauten, ob noch was passierte.
Ich ging seelenruhig zu Reyner hin, nahm seinen Kopf in meine Hände und küsste ihn. Mit Zunge. Ich hatte das noch nie gemacht, aber es war nicht schwierig. Es gab eintausend Filme darüber. Alle konnten uns sehen. Niemand lachte. Reyners Zunge fühlte sich komisch an, es war ziemlich nass. Was hatten sie nur alle mit dem Küssen?, fragte ich mich, ich konnte in Zukunft gut darauf verzichten. Als ich von ihm abließ, ging ich à la Bilitis über den Schulhof, ich schwebte mit einem wissenden Lächeln dahin, nahm meine Umgebung gar nicht wahr und war quasi verzaubert.
Großes Kino, das musste nun mal sein.
Reyner wurde von dem Tag an ignoriert. Sie dachten, er hätte ein Geheimnis, irgendetwas, das mich, Zett, dazu brachte, ihn zu küssen. Es machte ihnen Angst. Ich war Leistungsschwimmerin und sah gut aus, das reichte, um ihre Nummer eins zu sein (Idioten, quod erat demonstrandum …), aber Reyner, der dicke Junge aus China oder sonst woher, war mein Auserwählter. Etwas stimmte nicht mit ihm. Man ließ ihn lieber in Ruhe.
Ein paar Tage später standen Reyner und ich gemeinsam am Pausenkiosk an. Wir redeten sonst nicht viel miteinander, ich hatte keine Zeit für ihn. Entweder war ich beim Schwimmen oder bei Paula, die sich beschwerte, wenn ich an den trainingsfreien Nachmittagen nicht zu ihr kam. Sie hatte sich an mir festgesaugt wie ein kleiner Tintenfisch, irgendwie süß, und sie war weit und breit die Einzige, die nie neidisch auf mich war.
Diesmal sprach Reyner mich an.
»Ich weiß, ich kann nichts für dich machen«, sagte er. »Du kapierst Mathe auch ohne mich. Aber wenn ich erwachsen bin, werde ich viel Geld haben, und dann kaufe ich dir ein Haus.«
»Meine Eltern haben ein Haus. Es ist hässlich.«
»Es wird ein schönes, großes Haus sein. Ich meine das ernst.«
»Ich weiß. Aber du solltest jetzt etwas für mich tun. Nicht in hundert Jahren. Jetzt.«
»Was? Es gibt nichts!«
»Doch, es gibt was«, antwortete ich sofort. Ich hatte schließlich lange genug darüber nachgedacht.
»Wirklich?«
»Ja.«
Ich glaube, da wusste er es schon. Er war schlau und sah mich mit diesem Schlafzimmerblick an.
»Das Balisong«, sagte ich.
Er war vorn am Verkaufstresen angekommen, der Hausmeister wollte die Bestellung haben. Man musste sich beeilen. Reyner kaufte eine Vanillemilch, ich eine Brezel. Dann standen wir uns in der Aula gegenüber.
»Das geht nicht«, sagte er. »Tut mir leid.«
»Doch, das geht.«
Ich fixierte ihn. Ich starrte ihm direkt in sein Gewissen, drinnen in seinem Kopf. Reyner dachte nach. Vielleicht ging er alle seine Bücher durch, vielleicht stand etwas drin, was ihm jetzt helfen konnte. Ich wusste, was ich von ihm verlangte, aber ich konnte unmöglich lockerlassen.
Der Pausengong ertönte, ich drehte mich um und ließ ihn stehen. Er sollte mir nachsehen und die ganze Nacht kein Auge zutun.
Es vergingen Wochen, und er saß weiter unbehelligt in der letzten Reihe. Die Idioten hatten das Interesse an ihm verloren. Ich schaute manchmal zu ihm hin, ließ meinen Blick auf ihm ruhen, er schaute zurück und biss sich dabei auf die Lippen. Am letzten Tag vor den Sommerferien überreichte er mir schließlich einen Turnbeutel. Ich sah nicht hinein, ich wusste Bescheid.
»Danke«, sagte ich.
»Ist okay«, antwortete er nur und ging zurück zu seinem Platz.
Kapitel 4
Paula
Die Tage vergehen, eine Routine hat sich eingestellt, ganz so wie ich es mag. Vor dem Zelt frühstücken, dabei den Reiseführer lesen, um eine Bucht und einen Bus dorthin herauszusuchen, die Sachen für den Strand packen, die Bikinis von der Leine nehmen, mit anderen Touris auf den Bus warten, bei einer der Kiesbuchten aussteigen, jede immer traumhaft, ein Stück laufen, die Badetücher ausbreiten. Den Tag am Strand verbringen. Lesen. Musik hören mit Zetts Walkman. Jeden Tag mindestens einmal Chris Rea, Take me back to the place that I know – on the beach. Am schönsten ist es, wenn es in der Nähe eine Taverne gibt und wir mittags eine Pause im Schatten einlegen, unterm Laubendach, bei einem griechischen Salat und einem Zaziki und einem halben Liter Wein. Wenn traurige, sehnsuchtsvolle Musik aus den Lautsprechern kommt und wir lauter reden und lachen, weil uns der Wein zu Kopf steigt. Die Kellner sind freundlich, aber zurückhaltend, fast schüchtern, keine Anmache, keine dummen Sprüche, nicht einmal ein blödes Augenzwinkern. Zett kann ihr Waffenarsenal in den Tiefen ihrer Tasche lassen. Ich habe ihr gesagt, dass ein Spray mit Reizgas in der Sonne nicht so eine gute Idee ist, und sie hat dieses eine Mal auf mich gehört und lässt es seitdem im Zelt zurück, das den ganzen Tag über im Schatten steht. Nach dem Wein kehren wir zum Strand zurück und schlafen ein, die Kiesel drücken sich in unsere Körper, hinterlassen Muster auf unserer Haut. Wenn wir schwitzend und durstig aufwachen, stürzen wir uns ins Meer, das immer warm ist und so harmlos wie die Kellner, kein Getier, keine Algen, nichts, nur Wasser, schimmernde Steine und plätschernde Wellen, ab und zu ein kleiner, neugieriger Fisch. Manchmal schwimmt Zett weit hinaus und führt ihre Künste im Delfinschwimmen vor, entlang der Bucht, ihre Arme heben sich bei jedem Zug gleichzeitig aus dem Wasser wie Flügel, tauchen dann gemeinsam wieder ein, schieben den Körper voran, der Po schaut in einer Wellenbewegung kurz und frech aus dem Wasser und verschwindet wieder, zuletzt tauchen die Füße auf, gestreckt wie bei einer Balletttänzerin.
Warum traut sie sich das? So weit draußen? Hat sie keine Angst, was unter ihr ist?
Was soll da schon sein, Paula.
Ich stehe bis zur Hüfte im Wasser und schaue Zett nach, was für eine Ausdauer sie hat und welche Kraft in den Armen und wie schön sie ist mit ihren Muskeln und den schlanken Beinen. Und ich? Ich sehe an mir herunter. Die Füße unten sehen bleich aus auf den Kieseln. Die Beine durch die Brechung des Wassers gedrungen. Dann meine Arme, Hände, ich betrachte die Haut, sie wird langsam braun, die kleinen Härchen schimmern in der Sonne, die Fingerkuppen schon etwas schrumpelig, so lange stehe ich schon da, im Meer. Es ist so warm, dass ich trotzdem nicht friere. Damals im Freibad, wir beide als Kinder, das Zittern und Zähneklappern, die blauen Lippen, doch wir wollten nicht aus dem Wasser, wir wollten einfach ewig um die Wette schwimmen, kreischen, tauchen, wir spürten den Hunger nicht, nur eine Ausgelassenheit, eine Unbeschwertheit, wie sie es nur in diesem Alter geben kann, acht oder neun, nur in einem Freibad, im Sommer, wenn der Tag langsam zu Ende gehen will.
Mein Körper ist schwach geworden. Ich habe ihm die Freundschaft gekündigt, aber er ist einfach dageblieben, er geht nicht weg, und er braucht dauernd etwas, Wasser, Essen, Wein, eine Zigarette. Verdient hat er es nicht. Er soll still sein und sich nicht irgendwie anfühlen. Er hängt hier im Meer herum, als hätte er keine Knochen, kein Skelett, kein Rückgrat, nur weiches Gewebe. Eine Stoffpuppe. Und oben ein Schädel, groß und hart. Eine Beule unter den Haaren. Mehr nicht? Ist das alles? Der hält alles aus, egal was, der Körper. Der geht schlafen und wacht auf und macht weiter, zieht die Luft ein und stößt sie wieder aus, der Magen, die Gedärme arbeiten, die Blase, das funktioniert alles weiter. Die paar blauen Flecken sieht man gar nicht, sie schimmern mittlerweile gelblich. Heile, heile Segen, morgen gibt es Regen, übermorgen Schnee, dann tut es nicht mehr weh.
Hab dich nicht so. Es gibt Schlimmeres.
Später kommt ein junger Typ zu uns her. Ich lege mich hin und stelle mich schlafend. Zett erledigt so was. Er steht vor uns in einer knappen, roten Badehose und macht uns Schatten.
»Hello, I am Marco from Italy.«
»Und?«, sagt Zett auf Deutsch.
»Maybe you want to build a company?«
Ich öffne die Augen. Marco from Italy ist hübsch, dunkle Augen, Locken, braun gebrannt, Wassertropfen auf der Haut, Sonnenbrille im Haar. Sein Englisch klingt lustig. Aber ich habe keine Lust auf company. Ich will allein sein mit meinem Buch, mit unseren Mandarinen und Weintrauben, mit dem Meer und mit Zett. Sie gibt Marco keine Antwort, sie hält sich nur die Hand über die Augen gegen die Sonne, während sie ihn mustert.
Er wird verlegen und bewegt sich hin und her. Dann setzt er sich die Sonnenbrille auf und findet anscheinend seinen Mut wieder.
»We are ten people or more. Join us if you want. This evening, Taverna Alexiou.« Seine Zähne strahlen, wenn er lächelt.
»Maybe«, sagt Zett und lächelt kein bisschen zurück.
Marco hebt eine Hand zum Gruß und geht weiter über den Kies die Bucht entlang.
»Bloß nicht«, sage ich.
»Wir gehen hin«, sagt Zett.
Widerrede zwecklos. Manchmal hasse ich sie, weil sie so herrschsüchtig ist.
Wir machen uns schick mit dem wenigen, das wir in den Rucksäcken haben. Ich mein Lieblingstop, schwarz-orange gestreift à la Wespe, ärmellos, man sieht viel Haut, unten Jeans-Minirock, man sieht viel Bein. Sandalen. Ein bisschen Gel in die kurzen Haare für den verstrubbelten Look, Kajal für die Augen, fertig. Ich stelle mich vor Zett hin, bereit für ihr Urteil. Sie sagt erst nichts und dann: »Sie werden dich wegfangen heute Abend.«
Ich winke ab. Alles, nur das nicht. Ohne mich. Nur schauen, nicht anfassen. Ich bin praktisch eine Nonne, eine Heilige oder besser ein Ding, ohne unten, es gibt nur oben bei mir, unten ist tot. Ich schnappe nach keinem Angelhaken, so lecker kann der Köder gar nicht sein.
Trotzdem denke ich an Maik und habe ein mulmiges Gefühl. Ein Schlechtes-Gewissen-Gefühl. Ein Fremdgeh-Gefühl. Ich versuche, es mit einer Handbewegung vor meinem Gesicht zu verscheuchen, verscheuche aber nur eine Fliege.
»Keine Angst, ich pass schon auf dich auf«, sagt Zett.
Alles klar, sie wird mich bewachen wie einen Sträfling, der Freigang hat. Sie trägt ein winziges bauchfreies T-Shirt und winzige Shorts und sieht aus, als hätte sie es nötig. Man darf es niemals nötig haben, Lektion eins im Buch Frauenschicksale – wie man das Schlimmste verhindert. Zett packt ihr Butterfly und ihr Reizgas in eine winzige Tasche und hängt sie sich um. Dann zwinkert sie mir zu, und wir machen uns auf den Weg zur Taverne Alexiou.
Großes Hallo von Marco, als wir dort eintreffen. Zwölf Leute sind da, eine schöne company, es werden Tische zusammengestellt, zwei Plätze am Tischende sind für uns, sodass Zett jetzt der Runde vorsteht und ich so etwas wie ihre rechte Hand bin. Wir stellen uns alle vor, ich merke mir keinen einzigen Namen, wir stoßen mit Bier an und rufen: »Yamas!« Ein Schweizer und ein deutsches Pärchen sind dabei, zwei holländische Typen, Marco mit zwei Italienerinnen, die aber anscheinend nicht zu ihm gehören, sie ignorieren ihn, und dann noch ein Amerikaner, ein Engländer und zwei Französinnen. Wir einigen uns darauf, uns auf Englisch und mit Händen und Füßen zu verständigen.
Dann wird gegessen. Der ganze Tisch steht voll mit Tellern, Platten und Schälchen. Gegrillte Oktopus-Arme, frittierte Zucchini, in Öl gegarte Auberginen, Huhn in Tomatensoße, Lammkoteletts, Pommes natürlich, überbackener Schafskäse, kleine Reisnudeln, gefüllte Tomaten, wir haben zu viel bestellt, es kostet ja kaum etwas, der Kellner bringt ein Tablett nach dem anderen. Zett und ich essen mal hiervon, mal davon, probieren uns durch, wir alle essen, als stünde eine Hungersnot bevor oder als wäre alles eine einzige letzte Henkersmahlzeit.
Am Ende, als alle Teller, Platten und Schälchen leer sind, ratzeputz aufgegessen, kommt die Wirtin aus der Küche zu uns, wischt sich ihre Hände an der Schürze ab, streicht sich die grauen Haare aus dem verschwitzten Gesicht und fragt: »Good?«