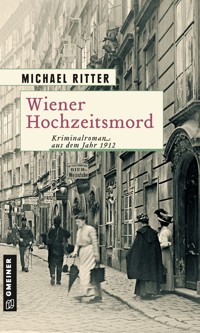Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminaloberinspektor Otto W. Fried
- Sprache: Deutsch
Der Präsident der Wiener Künstlervereinigung Secession bittet seinen Bekannten Dr. Fried um Hilfe. Der Künstler Michael Sterner wurde erstochen aufgefunden - ausgerechnet nach einem heftigen Streit mit Präsident Schmutzer. Eines der Ausstellungsstücke Sterners fehlt, eine bronzene Gämse. Der Kriminaloberinspektor Dr. Fried stellt auf eigene Faust Nachforschungen an, und sehr bald geht sein Verdacht in eine ganz andere Richtung als die offiziellen Untersuchungen. Es entwickelt sich eine Konkurrenz zwischen dem jungen Kommissar Hechter und Dr. Fried, welche die kollegiale Freundschaft der beiden auf eine harte Probe stellt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Ritter
Wiener Künstlermord
Historischer Roman
Zum Buch
Kunst, Lügen und Mord Wien im Jahr 1916. Ferdinand Schmutzer, Präsident der Wiener Künstlervereinigung Secession, ist ein alter Bekannter aus Dr. Frieds Schulzeiten. Als einer der jüngeren Künstler der Vereinigung, ein Skulpteur, nach einer heftigen Auseinandersetzung mit Schmutzer erstochen aufgefunden wird, bittet dieser Kriminaloberinspektor Dr. Fried – mitten in dessen Urlaub – um Hilfe. Doch er möge nicht als Polizist, sondern als Freund privat ermitteln. Dr. Fried kommt damit den offiziellen Ermittlungen in die Quere, und sehr bald gehen seine Recherchen und sein Verdacht in eine ganz andere Richtung als die polizeilichen Untersuchungen. Es entwickelt sich eine ungewollte Konkurrenz zwischen dem jungen Kommissar Hechter und dem Kriminaloberinspektor Dr. Fried, welche die kollegiale Freundschaft der beiden auf eine harte Probe stellt. Als der wahre Täter verhaftet wird, lässt er mit seinem Geständnis eine Bombe platzen, die das Privatleben Dr. Frieds erschüttert.
Michael Ritter wurde 1967 in Wien geboren und arbeitet als Verleger und Literaturwissenschaftler. Zahlreiche literaturwissenschaftliche Veröffentlichungen sind von ihm erschienen, darunter eine Biografie über Nikolaus Lenau. Außerdem schreibt er historische Kriminalromane und Thriller. Zuletzt erschien im Gmeiner-Verlag der historische Kriminalroman »Die Bibliothekarin und der Tote im Park« rund um die Bibliothekarin Rita Girardi. 2023 erhielt Michael Ritter das Wiener Projektstipendium für Literatur.
Mehr Informationen zum Autor unter:
www.michael-ritter.eu
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2024 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung: Julia Franze
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von: © Josef Maria Auchentaller, aus »Ver sacrum: Mitteilungen der Vereinigung Bildender Künstler Österreichs« 1901 Universitätsbibliothek Heidelberg / vs1901 / S. 4
https://doi.org/10.11588/diglit.8878#0010
ISBN 978-3-7349-3096-6
Erstes Kapitel: 9. Dezember
Nun hatten sie auch im Deutschen Reich die verantwortlichen Personen für die Beschaffung von Rohstoffen und Munition ausgetauscht. Überall dasselbe! Menschen in leitenden Positionen, die sich bedienten und sich gegenseitig den Profit zuschoben. Und wenn sie einmal aufflogen, dann wusste keiner von nichts und suchte die Verantwortung beim anderen. Darin glichen sich das Deutsche Reich und die österreichische Monarchie anscheinend wie ein Ei dem anderen.
Ähnliche Veränderungen hatte es auch im österreichischen Kriegsministerium gegeben und indirekt war Kriminaloberinspektor Dr. Fried dafür mitverantwortlich gewesen. Natürlich verkaufte man diesen Wechsel der Öffentlichkeit als routinemäßige Rochaden, weil man eben immer die besten Männer an der Spitze haben wollte. Manchmal war Dr. Fried davon überzeugt, dass Frauen die Dinge besser anpacken würden. Wahrscheinlich befänden sie sich dann sogar nicht einmal im Krieg.
Seine Tochter zum Beispiel! Sie war zu einer unverzichtbaren Person in der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung geworden, der man die Lenkung der Alltagsgeschäfte längst in die Hände gelegt hatte. Und kein Mann hätte dies besser erledigt, als sie es tat.
Dr. Fried blätterte in seiner Lieblingszeitung. Nicht einmal drei Wochen war es her, dass der alte Kaiser gestorben war. Nun gab es einen neuen, jungen. Doch Dr. Frieds Hoffnungen in diesen waren nicht allzu groß. Zu sehr hatte sich die Kriegsmaschinerie verselbstständigt, als dass er dem unerfahrenen Monarchen zutrauen würde, den Lauf der Dinge zu ändern. Auch wenn er ihm ein ehrliches Streben nach Frieden durchaus zugestand.
Ein feierliches Hochamt war am Vormittag des Vortages abgehalten worden. »Die Thronbesteigung Kaiser Karls I. Hochamt mit Tedeum in der Stephanskirche«. Dr. Fried schlug mit der flachen Hand auf die Seite in der Neuen Freien Presse, auf der dies alles geschildert wurde. Wie gewohnt hatte er die Zeitung aus der kaffeehaustypischen Halterung herausgelöst. Damit rief er inzwischen nicht mehr den geringsten Ärger bei Herrn Johann, dem Kellner, hervor, weil dieser die Zeitung nachher wieder einspannen musste. Früher hatte Herr Johann immer wieder Bemerkungen fallen gelassen, doch nachdem sein Stammgast nie darauf reagiert hatte, hatte er sich zu guter Letzt mit der faktischen Macht der Realität abgefunden.
Der Bericht war ein richtiggehendes Who’s who der feinen österreichischen Gesellschaft. Wohl mit dem Bestreben nach Vollständigkeit hatte der namentlich nicht genannte Journalist einen Namen der Gästeliste nach dem anderen aufgezählt, und so ging das über die gesamte Spalte auf die folgende Seite hinüber.
Dr. Fried ärgerte sich. Seine »Presse« war früher ein intellektuell ansprechendes, inhaltlich vielfältiges Druckerzeugnis gewesen. Sogar das Papier war, der Kriegswirtschaft geschuldet, inzwischen rauer und dünner. Jetzt war es ein Blatt wie alle anderen geworden, kriegspropagandistisch ausgerichtet und nur mehr in seltenen Fällen gewissen Ansprüchen genügend. Ab und zu im Feuilleton vielleicht. Vielleicht! Und dann die Anzeigenflut auf den letzten Seiten. War das vor dem Krieg auch so gewesen? Wenigstens legte man bei der Neuen Freien Presse noch einen gewissen Wert auf Niveau und Anständigkeit, nicht wie bei anderen Zeitungen, in denen unverhohlen und unverschämt für Gummiwaren für einschlägigen Gebrauch geworben wurde. Olla hieß eine solche Firma, die sich in der Praterstraße mit einem Geschäftslokal eingenistet hatte.
Dr. Fried konnte sich schon gar nicht mehr erinnern, wie das gewesen war, vor dem Krieg. Es klang wie eine Wendung aus altbiblischen Zeiten. Als Soldaten schmucke Männer in prächtigen Uniformen gewesen waren, Zinnsoldaten aus Fleisch und Blut, Soldaten zwar, aber irgendwie hatte das alles in jener Ziel nur wie ein Spiel gewirkt.
Es gab sie immer noch, diese farbenfreudigen Herzeige-Infanteristen, die man in Reih und Glied aufstellte, einfach nur damit sie wirkten. Ein Spalier vom Riesentor des Stephansdoms bis zum Presbyterium war aufgeboten worden, das den neuen Kaiser während des Festaktes umrahmte und hervorhob wie ein goldplattierter Bilderrahmen einen Rembrandt oder einen von diesen neuen Künstlern, die sich vor nun auch schon beinahe zwanzig Jahren in einem aufmüpfigen Akt vom Kunstestablishment abgespalten und unter dem Namen »Secession« zu einer eigenen Vereinigung geformt hatten. Seitdem brodelte es im Suppentopf der Kunstschaffenden, und es gab immer wieder neue Abspaltungen oder Distanzierungen einzelner Künstler vom Rest der schöpferischen Welt. Es konnte anscheinend in keinem Bereich des Lebens mehr ein friedvolles Nebeneinander geben.
Der Kardinal-Erzbischof von Wien, Friedrich Piffl, hatte das Hochamt zelebriert, das wohl den offiziellen Krönungsakt ersetzen sollte. Der ungarische Reichsteil, so viel wusste man, gab sich mit solchen reduzierten Gesten nicht zufrieden. In Budapest würde Karl zu Jahresende zum ungarischen König gekrönt werden.
Dr. Fried hörte auf, den Artikel zu lesen, als eine scheinbar endlose Liste mit Namen folgte. Ach, auch Kriegsminister Krobatin fand sich unter den Gästen! Eigentlich nicht weiter verwunderlich, dachte sich Dr. Fried. Er hatte den Mann seit dem Jahr 1914 nicht mehr gesehen und auch kein Bedürfnis danach. Alte Zeiten soll man hinter sich lassen, besonders wenn ihnen der Geruch von faulem Kompromiss anhing. Dr. Fried hatte das Ritterkreuz des Franz-Josephs-Ordens – ein rotes Kreuz vor dem Hintergrund des goldenen Doppeladlers mit der Reichskrone darüber an einem roten Band –, das er Krobatin zu verdanken hatte, seit der Verleihung nicht mehr aus der Schublade hervorgeholt. Falls jemand es heimlich entwendet hätte, er hätte es nicht bemerkt und würde es auch in Zukunft nicht bemerken. Es interessierte ihn einfach nicht.
Nachdem er vor zwei Jahren den Fall rund um den toten unehelichen Sohn des Kriegsministers gelöst (und zugleich auch nicht gelöst) hatte, war sein Blick auf den eigenen Berufsstand verändert. Zwar hatte er den Mörder gefasst, aber Hintermänner und Korruptionsvorfälle in seinem Ministerium hatten es Dr. Fried unmöglich gemacht, diese ebenfalls zur Verantwortung zu ziehen. Politische Interessen waren anscheinend eben doch stärker als juristische. So, wie das alles abgelaufen war, war er mit dem Ergebnis nicht wirklich zufrieden. Natürlich, er hatte keine andere Wahl gehabt, aber sein Gefühl sagte ihm, dass er trotzdem hätte widersprechen müssen. Er war keineswegs stolz auf sich.
»Was macht der Herr Schwiegersohn?«, wandte sich Herr Johann an Dr. Fried.
Es gab nur wenige Gäste an diesem Samstag in Dr. Frieds Stammcafé am Graben im Trattnerhof, was ihn zu einem der durchschnittlichen Samstage machte, wie sie seit Kriegsbeginn typisch geworden waren.
»Er dient«, antwortete Dr. Fried in Ermangelung detaillierterer Informationen über Max. »Und Ihr Herr Sohn?«
»Dient«, murmelte Herr Johann, dem es anscheinend genauso erging wie Dr. Fried und dessen Tochter Amalia.
Man erfuhr nie genug von der Front. Ab und zu eine Postkarte, vielleicht ein Brief, aber was stand da schon drin? Was durfte überhaupt nach außen getragen werden? Alles wurde hinter einer Maske der Beschönigung versteckt, wusste Dr. Fried, wie im Fasching. Vorne ein keckes Grinsen unter einer roten Nase, dahinter das ernste Gesicht, dem schon längst kein Lächeln mehr abzuringen war.
»Was führt Sie eigentlich an einem Samstag zu uns?«, wagte Herr Johann es nachzufragen. Üblicherweise kam Dr. Fried am frühen Montagvormittag her, bevor er in sein Büro ging und die neue Woche in Angriff nahm. »Das zweite Mal hintereinander!«
Dr. Fried lächelte und faltete die Zeitung. Einmal. Zweimal. Der Schmerz war für Herrn Johann fast körperlich spürbar. »Auch ein Kriminaloberinspektor hat ein Anrecht auf Urlaub«, antwortete Dr. Fried und legte die Zeitung neben sich auf die Bank.
»Urlaub?« Die Frage des Herrn Johann klang so ungläubig, als wüsste er gar nicht, was mit diesem Begriff gemeint war.
»Nicht nur das«, fuhr Dr. Fried fort. »Im Gegensatz zu früheren Jahren kümmere ich mich diesmal um gar nichts. Früher bin ich in meiner freien Zeit ab und zu ins Büro gegangen, diesmal aber …« Er hob beide Hände und winkte ab, als hätte man ihm etwas Überflüssiges angeboten. »Der gute Hechter kümmert sich jetzt um alles.«
Kommissar Julius Hechter war ein junger Mann, den Dr. Fried bisher davor hatte schützen können, zum Kriegsdienst beordert zu werden. Und das ganz ohne faule Kompromisse und zweifelhafte Beziehungen zu höhergestellten Personen, die man an unsichtbaren Rädern zu drehen bat und sich dafür in deren Schuld begab. Hechter war ein Mitarbeiter, auf den sie bei der Polizei nicht verzichten konnten, und das war nicht gelogen. Im Gegenteil: Angesichts des gewaltigen Personalschwunds, den sie in den letzten beiden Jahren auch bei der Polizei hatten erleben müssen, war es nicht allzu schwierig gewesen, den schlanken, hochgewachsenen und eleganten Kommissar vor der Einberufung zu bewahren. Und der hatte sich als derart fähig erwiesen, dass Dr. Fried ihm nun zum ersten Mal für die zwei Wochen seines Urlaubs die Leitung seiner Abteilung anvertraut hatte. Stellvertretend, verstand sich, aber doch offiziell und mit voller Verantwortung. Der Novak, Dr. Frieds rechte Hand, hatte zeitgleich mit ihm seinen Urlaub angetreten, denn die beiden alten Freunde hatten sich vorgenommen, einiges gemeinsam zu unternehmen.
»Ich hab’s nicht früher geschafft!« Ein älterer Herr in einem sehr langen Mantel, der seine ohnehin schmale Gestalt noch mehr streckte, kam auf den Tisch von Dr. Fried zugehumpelt. Ein wollener Schal quoll aus dem Kragen heraus, als wäre er achtlos hineingestopft worden. Seinen Hut hielt er bereits in der Hand und war im Begriff, ihn auf einem der freien Stühle abzulegen, als Herr Johann herbeieilte und dem neuen Gast sowohl den Hut als auch den Mantel abnahm.
»Ich habe mich bei Dr. Schwerdtner mit der Assistentin verplaudert.« Der Novak nahm neben Dr. Fried Platz und setzte sich dabei auf die zusammengefaltete Zeitung, die er übersah. Er zog die Bank einem Stuhl vor, weil er so sein Bein von sich strecken konnte, ohne das Gefühl zu haben, jeden Augenblick von der Sitzfläche zu rutschen.
»Nun noch zwei, drei Monate Winter, dann wird sich das Knie wieder besser anfühlen«, stellte der Novak im Brustton der Überzeugung fest.
»Das sagt Ihnen die Assistentin?« Dr. Fried schmunzelte.
»Nein, das sagt mir die Erfahrung der Jahrzehnte, die ich mich mit dieser Kriegserinnerung bereits herumschleppe«, sagte der Novak und winkte Herrn Johann ungeduldig herbei.
»Für mich auch einen …« Er blickte ratlos auf die leere Tasse des Kriminaloberinspektors.
»Kapuziner«, vervollständigte Herr Johann die Bestellung.
Zum Glück hatte der Kellner nicht mitbekommen, wohin sich der Novak gesetzt hatte. Ob er die nun nicht einfach nur gefaltete, sondern zerknitterte und durch die Körperwärme des Novak völlig außer Form gebrachte Zeitung wieder glatt bekommen würde und sie in den Leserahmen einspannen würde können, war keineswegs gewiss.
»Eine hübsche, junge, sehr attraktive Assistentin, nehme ich an«, bohrte Dr. Fried weiter.
»Aber, Herr Doktor!«, zeigte sich der Novak künstlich empört. »Was denken Sie denn von mir?«
»Nur das Beste, mein lieber Novak, nur das Beste. Und so eine nette Assistentin … Das wäre doch ein Ausblick, nicht wahr?«
»In meinem Alter, Herr Doktor?«
»Ach, Alter … Da kommt Ihr Kapuziner.«
Herr Johann stellte die Tasse auf dem kleinen runden Tisch mit der marmorierten Platte ab und daneben ein Glas Wasser, ganz wie es sich für die Wiener Kaffeehaustradition gehörte. »Der Chef hat sich überlegt, für das Wasser ein paar Heller extra zu verlangen«, sagte er und grinste dabei, obwohl es sich nicht um einen Scherz handelte. »Die Kosten steigen und steigen … Das ist der Krieg.«
»Verdammt sollen sie sein, alle, die dafür verantwortlich sind«, murmelte der Novak und warf zwei Würfel Zucker in seinen Kaffee.
»Und alle, die der Krieg noch blöder gemacht hat, als sie vorher schon waren«, fügte Herr Johann hinzu und spielte mit seinem Hangerl, einer reinweißen größeren Stoffserviette, die er stets formvollendet über den linken Unterarm gelegt trug und mit der er immer wieder die eine oder andere leere Tischfläche abwischte. »Aber manchmal erwischt es dann doch auch mal den Richtigen.«
»Was meinen Sie?«, fragte der Novak nach. Er blickte an Herrn Johann vorbei in das Lokal hinein. »Haben Sie vielleicht noch ein Butterkipferl?«
Herr Johann brachte ihm eines und lieferte auch gleich die Antwort auf die Frage davor mit. »Den Stürgkh natürlich!« Er deutete mit dem Kinn auf das Butterkipferl, das auf einem weißen Tellerchen lag. »Ganz frisch, ist noch warm.«
Der Novak nickte und lächelte dankbar. »Sie meinen den Mord an ihm?«
»Ja, das Attentat!«, bestätigte Herr Johann, der das Wort »Mord« nicht in den Mund nehmen wollte.
Der sozialdemokratische Publizist und Politiker Friedrich Adler hatte Ende Oktober den Ministerpräsidenten Karl Graf Stürgkh erschossen. Es war seine Art gewesen, gegen den Krieg und die wachsende Verarmung der Bevölkerung zu protestieren.
»Sie werden ihn zum Tode verurteilen. Oder vielleicht zu lebenslänglich begnadigen. Was für eine Gnade …« Herr Johann zischte zwischen den zusammengebissenen Zähnen hindurch. »Der Mann hat eine Heldentat vollbracht, wenn Sie mich fragen. Sogar die Zeitungen schreiben es.« Herr Johann war in eine leichte Erregung geraten, sein Gesicht hatte mehr Farbe angenommen als normal.
»Kommt darauf an, welche Zeitungen man liest«, murmelte Dr. Fried kaum hörbar.
Es war schon richtig, dass Blätter wie die Arbeiterzeitung die Tat Friedrich Adlers mehr und mehr zu einer Heldentat und einem Akt politischer Befreiung hochstilisierten. Andere hingegen, wie seine Neue Freie Presse, sahen das Attentat unter einem vollkommen eigenen Blickwinkel. So betrachtet hatte Herr Johann schon recht: Die Welt war derart aus den Angeln gehoben, dass die Menschen sich nicht einmal im Falle eines Mordes darauf einigen konnten, dass dies ein Unrecht war und blieb, egal, wie die Motivlage aussah.
»Wenn jeder seinen politischen Protest auf diese Weise ausdrücken würde, sähen wir ganz schön alt aus«, wagte Dr. Fried einen Widerspruch.
»Na ja, völlig unrecht hat er nicht«, überlegte der Novak. »Unser Herr Johann, meine ich …«
»Novak!«, rief Dr. Fried aus und zog die Augenbrauen weit in die Höhe. »Wir reden von Mord! Sie wissen, auf welcher Seite wir dabei zu stehen haben. Und es ist vollkommen richtig so. Mord kann nie eine Lösung sein.«
Dr. Fried musste plötzlich an seinen Schwiegersohn Max denken. Mord war keine Lösung, ganz gleich, welche Umstände einen dazu trieben. Doch auch er musste sich eingestehen, dass man unter gewissen Umständen so etwas wie ein Verständnis entwickeln konnte. Keine Entschuldigung, kein Gutheißen, doch er hatte es nie verlernt, sich in die Gemütslage anderer Menschen hineinzuversetzen.
»Aber ist ein politisches Attentat mit den Maßstäben des Strafgesetzbuches zu messen?«, ließ der Novak seinen Gedanken freien Lauf und biss in die Spitze des Butterkipferls. Brösel fielen auf den Tisch und in seinen Kaffee.
»Stehen politische Akte automatisch außerhalb des Rechts?«, antwortete Dr. Fried mit einer Gegenfrage. Und er fügte bekräftigend hinzu: »Nein, das tun sie nicht.«
»Und wer zieht die Kriegstreiber zur Verantwortung?«, hielt Herr Johann dagegen.
Es gab außer Dr. Fried und dem Novak keine weiteren Gäste mehr im Lokal, sodass er ohne ein Blatt vor dem Mund vertraulich sprechen konnte. Es hätte gerade noch gefehlt, dass er sich zu den beiden an den Tisch setzte.
»Der Krieg geht dadurch nicht zu Ende«, meinte Dr. Fried. »Glauben Sie mir, Herr Johann, an einzelnen Personen liegt es nicht.«
»Woran dann?«, ereiferte sich der Kellner, während der Novak das bereits zur Hälfte verspeiste Butterkipferl mit der zweiten Spitze in den Kaffee tunkte.
»Ich sehe das in einem größeren Zusammenhang«, fuhr Herr Johann fort. »Es war nicht bloß ein Attentat auf Stürgkh, sondern ein Attentat auf die österreichische Moral. Und die liegt völlig darnieder. Die Menschen gehören aufgerüttelt. Wie lange sollen unsere Söhne noch an der Front darben? Bis jeder einzelne in einem Sarg zurückkehrt?«
Wie sollte, wie konnte Dr. Fried dem emotionsvollen Mann reinen Gewissens widersprechen? Er wollte ja selbst nicht, dass sein Schwiegersohn Max in einer billigen Holzkiste nach Wien zurückgeschickt wurde, wo seine Familie ihn begraben musste.
»Geh’n S’, Herr Johann!«, war eine kräftige Frauenstimme aus jenem Bereich des Kaffeehauses zu hören, wo die Vitrine mit den Mehlspeisen stand. »Könnten S’ mir kurz zur Hand gehen?«
Herr Johann zupfte sein Hangerl zurecht und schlurfte ohne Anzeichen von Eile davon. Der Novak schob gerade das letzte Stück des Butterkipferls in den Mund und sah Dr. Fried an, als hätte er vom Ende des Gesprächs nichts mitbekommen.
»Es gibt Dinge, die werden sich nie ändern«, sagte er kauend vor sich hin und schluckte kräftig. »Die Lernfähigkeit der Mensch zum Beispiel. Manche Fehler machen wir immer wieder, wenngleich auch stets in neuem Gewand. Aber besser aussehen tut’s deswegen nicht.«
Dr. Fried holte aus der Innentasche seines Jacketts eine Brieftasche hervor und zählte ein paar Kronen ab. »Sie sind mein Gast, lieber Novak«, sagte er und klemmte die Scheine unter das Silbertablett, auf dem die leer getrunkene Tasse Kaffee und das nicht angerührte Glas Wasser standen.
»Wollen Sie es nicht?«, fragte Dr. Fried und zeigte auf das Glas.
Der Novak schüttelte den Kopf, und Dr. Fried trank es in einem kräftigen Zug leer.
»Wenigstens unser gutes Wiener Wasser haben sie bisher nicht rationalisiert und auf Lebensmittelmarken gesetzt«, sagte er, als er das Glas wieder absetzte.
Die beiden Männer zogen sich die Mäntel über und griffen nach ihren Hüten. Herr Johann eilte herbei, warf einen Blick auf die Geldscheine auf dem Tisch und nahm Dr. Frieds Worte »Stimmt so« wohlwollend entgegen.
»Sie kommen am Montag wieder?«, fragte Herr Johann, während er Dr. Fried in den zweiten Ärmel hineinhalf.
»Eher nicht, lieber Herr Johann!«, zeigte sich Dr. Fried erfreut. »Eine Woche Urlaub habe ich noch und es wird mich keine Kraft dieser Welt dazu bringen, in mein Büro zu gehen. Daher auch kein traditionelles Frühstück bei Ihnen. Aber danach schon wieder, keine Sorge!« Er nahm seinen Hut an der Krempe und wandte sich dem Novak zu. »Wir sehen uns morgen zum Adventsessen?«
»Wie ausgemacht, Herr Doktor.«
Langsam gingen sie auf den Ausgang zu.
»Gut«, brummte Dr. Fried zufrieden. »Gut.«
Sie hatten für dieses Jahr verabredet, dass der Novak an jedem Adventssonntag zu Dr. Fried und dessen Tochter zum Mittagessen kommen würde. Auch für den Heiligen Abend hatten sie es so geplant, und Amalia freute sich, ihren »Onkel Novi«, wie sie ihn als Kind genannt hatte, in der Adventszeit dieses Jahres häufiger zu sehen.
»Na dann …«
Die beiden Männer reichten einander die Hände und verabschiedeten sich. Als sie das Lokal verlassen hatten, fiel Herrn Johanns Blick auf die zerknitterte und zerdrückte Zeitung auf der Sitzbank. Schnaubend griff er danach und musste feststellen, dass es ihm diesmal besonders viel Mühe bereiten würde, sie auseinanderzufalten, zu glätten und in den Leserahmen einzuspannen. Die nächsten Gäste würden sich gewiss bei ihm beschweren über den Zustand des Blattes. Dabei konnte er gar nichts dafür. Immer wieder geriet man zwischen die Fronten als kleiner Mann.
Zweites Kapitel: 10. Dezember, mittags
Amalia hatte das Adventsgesteck aus Tannenzapfen mit silbrigen und goldenen Fäden durchwirkt und tiefrote Äpfel darumgelegt. Sechs Kerzen waren fest hineingesteckt, damit sie nur ja nicht umfallen und ein Feuer entfachen konnten. Als Kind hatte sie einen richtig großen Adventsleuchter bei entfernten Verwandten gesehen, vierundzwanzig auf einem großen Holzreifen angebrachte Kerzen. Das war ihrer Mutter zu aufwendig gewesen, aber sie war einverstanden gewesen, den Brauch eines Gestecks einzuführen. Amalia setzte diesen seitdem Jahr für Jahr fort und holte damit – unbeabsichtigt und unbewusst – ein wenig vom Geist ihrer Mutter zurück ins Haus.
Die ersten Jahre nach dem Tod der Mutter waren eine bedrückende Zeit gewesen. Keine Spur von Vorfreude auf den Tag, an dem der Herr geboren worden war. Amalias Vater hatte sich zwar alle Mühe gegeben, doch sie hatte gesehen und gespürt, wie er unter der Einsamkeit litt. Eine Form von Einsamkeit, gegen die sie als Tochter machtlos war. Zeitweise hatte sie sich sogar schuldig gefühlt, ihrem Vater nicht helfen zu können, doch schnell hatte sie gelernt, dass seine Gemütsverfassung nicht an ihr lag. Auch mit der Hilfe ihres Vaters, der mit ihr darüber sprach, was geschehen war. Nicht oft und schon gar nicht über seine Gefühle, niemals. Aber er ließ Amalia spüren, dass er für sie da war und alles tun wollte, um ihr die Mutter zu ersetzen, auch wenn sie nicht ersetzbar war. Zum Glück war sie kein kleines Kind mehr gewesen. Auch das hatte ihr Vater ihr einmal gesagt. »Du warst zum Glück schon eine junge Frau, jedenfalls auf dem Weg dorthin. Ohne deine Reife und deine erwachsene Art hätten wir es vielleicht nicht geschafft. Du warst mir immer eine große Stütze.«
Das waren Worte, die man ihm als Außenstehender nicht zugetraut hätte. Ein Kriminaloberinspektor, der die übelsten Verbrecher jagte. Oder jagen ließ, wie es inzwischen war, denn als Leiter seiner Abteilung kam es nur mehr sehr selten vor, dass er selbst Fälle übernahm. Er hatte seine Ermittler, die er koordinierte, denen er Vorgaben machte oder deren Arbeit er beobachtend begleitete, um da oder dort eine Korrektur vorzunehmen oder den Kollegen in seinem Tun zu bestätigen. Ärgerlich war nur, dass der Krieg ihren Personalstand derart ausgedünnt hatte.
Doch dieser Kriminalist war auch Vater, und er würde es bis zum letzten Tag seines Lebens sein. Manche Rollen im Leben spielte man nicht einfach nur, sondern sie waren ein organischer Teil von einem selbst.
»Kümmerst du dich um die Servietten, Paps?«
Die Stimme aus der Küche rüttelte Dr. Fried auf, der die Sonntagszeitung aufgefaltet auf den übereinandergeschlagenen Beinen liegen hatte und versonnen den Blick aus dem Fenster richtete. Der Lehnstuhl war gut gepolstert, als wäre er neu, und dementsprechend kämpfte er gegen die Verführung an, in ihm einzunicken. Das konnten auch die Geräusche der Geschäftigkeit aus der Küche nicht verhindern.
Dr. Fried stand auf und stöhnte dabei ausgiebig. Seit einiger Zeit plagte ihn ein Rückenleiden, das er tunlichst vor allen zu verbergen versuchte. Vor allem vor Amalia! Sie würde ihn wie ein Neugeborenes umsorgen, wenn sie davon erführe. Und auch der Novak musste nicht unbedingt Bescheid wissen. Der würde ihm sicher von seinen elektrotherapeutischen Behandlungen vorschwärmen – das brauchte Dr. Fried am allerwenigsten. Stattdessen verließ er sich auf gymnastische Übungen, die er regelmäßig in seinem Zimmer vor dem Schlafengehen heimlich durchführen wollte, aber dabei war er nachlässig, was er mit mangelnder Zeit begründete. Sobald er spürte, dass der Rücken ihm unangenehme Signale gab, nahm er die Übungen wieder auf und war bereits nach zwei, drei Tagen wieder der Alte. Vorerst jedenfalls noch.
Sein Stöhnen war eher ein Zeichen des Alters. Das machte man einfach so, wenn man bereits mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel hatte. Und es tat gut, die Welt wissen zu lassen, welche Anstrengungen man auf sich nahm, sie in Bewegung zu halten. Ein Mann, der die sechzig erreicht hatte, durfte das.
Dr. Fried ging zur Anrichte und zog die mittlere der drei Schubladen auf, in der sich penibel genau gefaltet die weißen Stoffservietten befanden. Er nahm eine heraus und bewunderte, wie sehr sie gestärkt war. Die Hausarbeit hatte Amalia neben ihrer beruflichen Tätigkeit in der Psychoanalytischen Vereinigung fest im Griff, als wäre sie eine professionelle Haushälterin.
Er holte zwei weitere heraus. Frau Walter, die Nachbarin, die einen Stock über ihnen wohnte und schon länger Witwe war als er Witwer, hatte nicht aufgehört, sich Hoffnungen zu machen, Dr. Frieds Haushalt zu regeln – und das nicht nur als Haushälterin. Amalia hätte ihm ein neues, ein zweites Glück im Leben gegönnt, aber wie könnte er das jemals seiner geliebten Ehefrau – Gott habe sie selig – antun? Für manche Menschen galt die Treue über den Tod hinaus.
»Frau Walter hat mir übrigens einen grandiosen Tipp gegeben, wie ich das Rindfleisch vor dem Kochen behandeln soll«, sprach Amalia plötzlich den Namen aus, der sich in Dr. Frieds Gedanken geschlichen hatte. Konnten solche Dinge einfach nur Zufall sein oder waren sie doch ein Fingerzeig des Schicksals? Dr. Fried hätte jedem massiv widersprochen, der von höheren Zeichen und Hinweisen faselte, dazu war er ein viel zu nüchtern denkender Mann, der genau wusste, wo oben und unten war, und daher seine Füße immer fest auf dem Boden hatte. Und doch gab es manchmal eine Irritation des Gefühlslebens.
Amalia stand in der Küche und erzählte, worin der Kniff mit dem Fleisch bestand, doch Dr. Fried hörte nicht richtig zu. Die Kunst des Kochens hatte sich ihm nie erschlossen, das galt bei ihm sogar für einen simplen Kessel Wasser. Dass Frau Walter hingegen eine ausgezeichnete Köchin war, hatte sie speziell in der ersten Zeit nach dem Tod von Dr. Frieds Frau bewiesen, als sie ihm alle paar Tage etwas frisch Gekochtes hinuntergebracht und ihn mit strenger Miene aufgefordert hatte, alles aufzuessen. Dass er sich in jener Zeit damit so sehr gequält hatte, hatte keinesfalls an der Qualität von Frau Walters Gerichten gelegen.
»Und Löffel auch!«, ordnete Amalia unter Klappern von Töpfen und anderem Küchengerät an. »Es wird eine feine Rindssuppe geben. Onkel Novak mag die ja besonders gern.«
»Ich auch«, hätte Dr. Fried beinahe leicht eifersüchtig entgegnet, aber was sollte er sich beklagen? Er kam ja sowieso andauernd in den Genuss dessen, was Amalia kochte.
Behutsam legte er das Besteck auf und rückte die Trinkgläser, die Amalia bereitgestellt hatte, sorgfältig zurecht. Die Teller fehlten noch, die kamen ganz zum Schluss, denn die waren in einem Küchenschrank verstaut. Und die Küche war verbotenes Gebiet, solange Amalia dort hantierte. Das hatte sie von ihrer Mutter übernommen.
Es läutete. Ein lang gezogener Ton, als wollte jemand seinen Finger nicht mehr vom Klingelknopf nehmen. Der Novak machte das gerne so, und wenn man die Tür öffnete, war das Erste, was einem entgegenleuchtete, ein farbenfroher Blumenstrauß, selbst im tiefsten Winter.
Genau so war es auch jetzt.
»Ich geh schon!«, rief Dr. Fried, warf einen letzten, halb zufriedenen Blick auf den Tisch und ging in den Flur. Er ließ den Novak hinter einer wildwüchsigen Flora aus breiten, tiefgrünen Blättern und großen Blütenköpfen in Gelb und Orange eintreten. Es fehlte nicht viel, dass der ihm das Zeug ins Gesicht quetschte.
»Zum Glück bin ich kein Allergiker«, sagte Dr. Fried anstelle einer Begrüßung und bekam zusammengeknittertes Papier in die Hand gedrückt.
»Sie sind aber auch nicht die Dame des Hauses«, stellte der Novak vergnügt fest und machte keine Anstalten, den Mantel abzulegen. Das war wohl schwer möglich mit dem übergroßen Blumenstrauß in beiden Händen.
»Soll ich Ihnen das abnehmen?«, fragte Dr. Fried und starrte den Blumenstrauß an, der das Gesicht des Novak fast vollständig verdeckte.
»Wäre wahrscheinlich günstig«, meinte der Novak und belud seinen Vorgesetzten und Freund neben dem Papier nun auch mit den Blumen.
Er hängte den Hut auf, streifte die Handschuhe ab und steckte sie in eine der Manteltaschen. Den Mantel ließ er elegant an sich herabgleiten und fing ihn am Kragen auf. Dabei machte er eine fast jugendliche Hüftdrehung, die Dr. Fried auffiel.
»Heute habe ich endlich wieder einen absolut schmerzfreien Tag«, merkte der Novak an.
»Nun ja«, entgegnete Dr. Fried. »Sie haben es ja eigentlich auch nicht in der Hüfte oder doch auch schon?«
»Onkel Novak!« Amalia flog in einer großen blauen Schürze, die mit weißen floralen Mustern bedruckt war, herbei.
Sie fiel dem groß gewachsenen Mann um den Hals, der umfasste ihre Taille und hob sie sanft in die Höhe. Alles ging ihm mit einer Leichtigkeit von der Hand, durch die Dr. Fried sein vorheriges Stöhnen beim Aufstehen aus dem Lehnstuhl wie ein katastrophales Zeichen des rasanten körperlichen Niedergangs vorkommen ließ. Zwischen Blütenköpfen und breiten Blättern sah er zu, wie der Novak sich mit Amalia einmal um die eigene Achse drehte und die junge Frau danach absetzte.
»Kannst du dich um eine Vase kümmern, Paps?«, rief Amalia und eilte schon wieder in die Küche.
»Ich habe nur zwei Hände«, grummelte Dr. Fried und folgte dem Novak, der ins Zimmer trat.
»Ein stilvoll gedeckter Tisch, wie üblich«, kommentierte der Novak. »Wo finde ich eine Vase?«
»Anrichte, oben links«, sagte Dr. Fried. Auf dem linken Revers seines Jacketts hatte sich von den Blumenstielen ein kleiner Wasserfleck gebildet. »Nehmen Sie die mit den asiatischen Mustern.«
Der Novak holte eine bauchige weinrot-schwarze Vase heraus. »Die ist aber leicht«, stellte er bewundernd fest.
»Und wenn Sie sie fallen lassen, zerspringt sie in Millionen Scherben. Also aufpassen, das ist ein echtes chinesisches Stück.«
Der Novak verschwand kurz im Badezimmer, um die Vase mit Wasser zu befüllen, und kehrte zurück. Dr. Fried stellte die Blumen hinein und drückte dem Novak das Papier in die Hand.
»Sie können es in der Küche entsorgen«, sagte er und grinste ihn an. »Ich habe dort keinen Zutritt, solange Amalia kocht.«
Der Novak verschwand kurz, und Dr. Fried vernahm ein heiteres Schäkern aus der Küche. Als der Novak zurückkam, trug er drei Suppenteller.
»Die Terrine kommt gleich, wir sollen bereits Platz nehmen«, erklärte er und stellte auf jeden Platz einen Teller.
Dr. Fried kramte nach Streichhölzern und zündete zwei der Kerzen auf dem Adventsgesteck an.
»Stimmungsvoll«, kommentierte der Novak. »Man kann so etwas gleich viel mehr genießen, wenn man sich nicht um den Alltag und irgendwelche laufenden Fälle kümmern muss.«
»Kein Wort davon!«, traf Amalias strenge Stimme die beiden Männer. Sie trug die Terrine, in der schon ihre Mutter zu Festtagen Suppen aufgetragen hatte, und stellte sie in die Mitte des Tisches. Der Griff des Schöpflöffels ragte unter dem Deckel hervor, rundherum dampfte es.
»Frittatensuppe«, erklärte Amalia stolz.
Die Augen des Novak wurden groß. Er kannte natürlich diese Spezialität Amalias, die eine Frittatensuppe zu kredenzen verstand, wie man sie im exklusivsten Gasthaus nicht besser bekommen konnte. Es musste an der richtigen Mischung von Gewürzen liegen, dachte er sich oft, aber Amalia verriet ihr Geheimnis nicht. Auch die schmalen Teigstreifen als Einlage hatten etwas ganz Spezielles an sich, ihr minimaler Eigengeschmack verband sich harmonisch mit der Rindssuppe.
»Greifen Sie zu, meine Herren!«, forderte Amalia auf, und Dr. Fried gab die Suppe in die Teller.
»Keine Sorge, Amalia«, beruhigte der Novak, der vor dem dampfenden Teller saß und darauf wartete, dass die Suppe ein wenig abkühlte, »ich habe wirklich nicht vor, auch nur das geringste Thema aus unserer Abteilung hier hereinzuholen. Büro ist Büro und das hier … Das hier ist Advent!«
Amalia lachte.
»Aber du kannst erzählen, was sich so bei dir in der Vereinigung tut.«
Amalias Position in der Psychoanalytischen Vereinigung hatte sich im vergangenen Jahr derart stark gefestigt, dass sie als die eigentliche Leiterin der Institution galt. Wenn auch nicht offiziell. Schließlich traute man es einer Frau nicht zu, eine solche Position zu bekleiden, schon allein im Umgang mit den männlichen Kollegen anderer Länder war nicht damit zu rechnen, dass einer Frau der entsprechende Respekt entgegengebracht würde. Also saß jemand anderer auf diesem Stuhl, allerdings weit entfernt von Wien, nämlich in Berlin, und ließ Amalia vertrauensvoll alles so handhaben, wie sie es für richtig erachtete. Der offizielle Vorsitzende der Vereinigung war sowieso nach wie vor Professor Sigmund Freud, die Untiefen der Alltagsrealität aber durchschritt er nur selten. Dafür gab es eben unter anderem Frau Dr. Amalia Becker. Oder Fräulein Dr. Fried, wie sie von einigen immer noch genannt wurde, denen ihre Hochzeit vor nun auch schon über vier Jahren gedanklich nicht präsent zu sein schien – was kein Wunder war angesichts des abwesenden Ehemannes.
»Das Spannende ist, dass unsere Idee immer weiter wächst«, erzählte Amalia, während der Novak den ersten Löffel zum Mund führte. Sie sah ihm an, dass er begeistert war. »Irgendwann wird Abraham einen Ableger in den USA gründen, wenn er wieder zurückkehrt. Falls er zurückkehrt …«
Dr. Fried, der gerade ansetzte, ebenfalls von seiner Suppe zu kosten, hielt inne. »Wieso? Hat er es sich anders überlegt und will in Österreich bleiben? Liegt es vielleicht daran, dass er schon zu viel von seinem Geld hier veranlagt hat?« Er spielte damit auf die Kriegsanleihen an, die Amalias Kollege im vergangenen Jahr gekauft hatte, weil sie ihm als gutes Investment empfohlen worden waren. Er hatte dabei eine Begeisterung an den Tag gelegt, die man mit Patriotismus erklären konnte, aber nicht musste.
»Das sicher nicht«, sagte Amalia und lächelte verschmitzt. »Was das angeht, hat er seine Meinung sogar geändert.«
»Wie? Dein Herr Kollege hat seine Begeisterung für Kriegsanleihen abgelegt? Wie kam es denn zu diesem Sinneswandel?« Dr. Fried hielt den Löffel auf halbem Weg zwischen Teller und Mund, die Suppe tropfte kontinuierlich herab.
»Es ist bereits die vierte Anleihe, die sie ausgeben«, erzählte Amalia, und Dr. Fried nahm das Löffeln seiner Suppe wieder auf. »Abraham …«
»Abraham?« Erst jetzt mischte sich der Novak in das Gespräch ein. Er wusste nicht, von wem hier die Rede war.
»Abraham Brill«, erklärte Amalia. »Er ist seit letztem Jahr bei uns in der Psychoanalytischen Vereinigung. Er ist Amerikaner und zugleich auch Österreicher, seine Familie stammt aus Wien. Er wurde sogar hier geboren, aber sie sind in die Staaten gezogen, als er noch ganz klein war. Nun will er die Methoden von Professor Freud nach Amerika bringen.« Amalia lächelte angetan.
»Und was ist nun mit der Anleihe?«, kehrte Dr. Fried zum Ausgangspunkt zurück.
»Abraham findet es etwas inflationär, dass in nicht einmal zwei Jahren bereits vier Anleihen ausgegeben wurden. Er fragt sich, ob man wirklich darauf vertrauen kann, dass das Geld zurückgezahlt wird. Denn die Auszahlung soll erst ab Dezember 1930 beginnen. Ein unglaublich langer Zeitraum, nicht wahr?«
»Und das stört ihn?«, fragte der Novak.
»Er hat die zweite Anleihe gezeichnet, letztes Jahr. Ich glaube, da beginnt die Tilgung Mitte der Zwanzigerjahre. Das fand Abraham noch in Ordnung. Er meinte, der Krieg wäre schnell vorüber, dann brauche der Staat noch für ein paar Jahre das Geld zur Reinvestition, dazu kämen die Zahlungen der Kriegsverlierer …« Amalia brach ab und löffelte schweigend ihre Suppe.
»Und das meint er jetzt nicht mehr?«, fragte der Novak weiter. »Worin liegen seine Zweifel? Dass das Geld nicht zurückkommt oder dass wir den Krieg nicht schnell gewinnen?«
Der Novak wollte hinzufügen, dass von schnell sowieso keine Rede mehr sein konnte, doch das war in dieser Runde, die den Krieg ablehnte, nicht notwendig. Und dass er von Kriegsanleihen genauso wenig hielt wie Dr. Fried, konnte man seinem leicht angewiderten Gesichtsausdruck ansehen.
»Nein«, fuhr Amalia fort. »Zu Beginn des Kriegs war er ziemlich begeistert gewesen, aber jetzt … Das ist verflogen.«
»Wie der Pulverdampf im Wind«, stellte der Novak einen gewagten Vergleich an. Dann hob er die Augenbrauen und grinste breit. »Ein sympathischer junger Mann?«