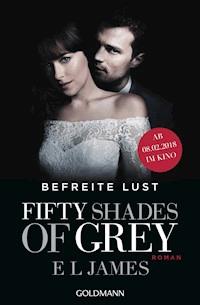Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Stephenson Verlag
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Wimmern darfst Du ... schreien nie! Das Geheimnis dieser Liebe ist ein Ritual. Nur wer dieses Ritual versteht - und das können nur sehr wenige -, wer es liebt, wer seine Liebe in seinem Schmerz erlebt, nur der ist fähig, das auszuschöpfen, was Liebe wirklich schenken kann. Es gibt keine Liebe ohne Schmerz. Alles andere bleibt Oberfläche, Abziehbild. Nur der, der sich im Schmerz der Liebe hingibt oder in der Liebe dem Schmerz, wird das erreichen, was köstlicher ist als jedes andere Geschenk, das das Leben für uns bereithält. Sie werden den Schmerz lieben, den ich Ihnen schenken werde, weil er Ihnen den Ozean und den Himmel öffnet." Dies teilt ihr der Fremde gleich zu Beginn ihrer Beziehung mit. Noch versteht die junge Frau die Tragweite dieser Worte nicht. Doch rasend schnell gerät sie in den Bann jenes Mannes, der in ihre jene Gefühlsabgründe zum Leben erweckt, die schon lange in ihr verborgen liegen. Sie ist "wie ein Instrument, das nur der eine, wirkliche Künstler zu spielen vermag" …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wimmern darfst Du …
Amun Gard
Wimmern darfst du. Ja, mein Liebes. Wimmern, das ist die Musik, die zu unserem Ritual paßt.“ Das hattest du gesagt. Immer wieder und mich dabei angesehen, mit diesem Blick, der nicht aus dieser Welt ist. Den ich unter meiner Haut spüre. Deine und meine Augen bilden dies verschlungene Band, das sich in meinem Körper verzweigt und aus meinen Fingerspitzen wieder herauskriecht. Anfangs, zu Beginn unserer Ehe, eigentlich schon beim ersten Mal, als deine Augen meine berührten, und später, noch gestern, nein, noch heute morgen, endete dieser Blick nicht in meinen Fingerspitzen. Er kriecht in eine andere Spitze meines Körpers. In die, die zwischen feinen Lippen versteckt mehr und mehr zum Zentrum unseres Seins geworden war.
„Wimmern darfst du“, frißt es sich in meinen Kopf. Unaufhörlich dieser Satz, der als einziger eine Brücke zu schlagen fähig ist zwischen dem abgrundtiefen Glück, das mich noch vor wenigen Augenblicken umfangen hat, und dieser unfaßbaren Verlorenheit, die nun um mich ist. Mir jedes Gefühl für den Augenblick unmöglich macht. Ich hatte es dir ja versprochen.
„Zwei Dinge dürfen niemals geschehen, und ich sage dir das nur ein einziges Mal. Du darfst niemals schreien und niemals einen Orgasmus haben, von dem ich nichts weiß. Wirst du diese Gesetze befolgen, zeige ich dir ein Glück, das du in deinem Leben nicht für möglich gehalten hast. Brichst du eines davon, verlasse ich dich sofort. Für immer.”
Warum, warum war aus meinem Wimmern ein Schrei geworden? Ich kenne doch unser Ritual so gut, ich liebe es. Ich bin süchtig danach!
Immer und immer wieder hämmert dieses „Wimmern darfst du ...“ und der nicht verhallende Nachklang meines verfluchten, alles zerstörenden Schreies in mir. Die unzähligen Bilder, die durch meinen Kopf schießen, geben mir ein Gefühl von Wahnsinn. Und doch ist das alles wie eine Beschwörung. Eine in, Todesängsten hastig und immer wieder zwanghaft rasend ausgestoßene, rettende Lüge, daß dieser eine Moment, diese eine Unkontrolliertheit doch nicht gewesen ist.
„Es war doch nur ein Wimmern, ein etwas lauteres. Bitte hör doch, hör mich doch an!“
Aber meine Ohren sind noch jetzt so voll von diesem Schrei, daß es mich würgt.
Wahrscheinlich war ich einige Zeit ohnmächtig gewesen. Ich spürte eine Art Erwachen und sah mich nun zum erstenmal da liegen, wo ich schon seit Stunden gelegen haben muß. Die Kälte, die meine nackten Füße, Beine, ja längst einen entblößten Po erreicht hat, sitzt wie eine eisige Klammer auf meiner schutzlosen, einsamen Schnecke. Ich liege, hänge auf dem Fußboden vor deinem Schreibtisch. Noch mit meiner linken Schulter und dem verdrehten, inzwischen völlig verzerrten Nacken und meinem Ohr, das glühend heiß an die Unterkante unseres Schreibtisches drückt. Ich bin nicht in der Lage, mich irgendwie zu rühren. Nur meine Augen versuchen, Bilder aufzunehmen.
Bilder, die mir meine Lage wie auch immer verstehbar zu machen versuchen. Über mir nehmen sie die beiden offenen Lederriemchen wahr, aus denen ich mich offensichtlich gelöst haben muß, denn du hattest sie nicht mehr geöffnet. Ohne nur eine Sekunde zu zögern, daran erinnere ich mich nun langsam, drehtest du dich um und warst weg. Nach diesem Schrei, dem ersten. Und wie ich später wußte, dem ersten, dem unzählige folgen sollten, als ich begriffen hatte, daß du mich wirklich verlassen hattest.
Heute — oder war es schon gestern, ich habe kein Gefühl dafür, wie lange ich schon hier kauere — war es wieder soweit gewesen. Endlich war der Tag, an dem unser Ritual, nach dem ich mich sehnte wie ein durstiges Tier nach Wasser, wieder angekündigt. So hattest du es immer gemacht. Am Nachmittag, genau 24 Stunden vorher, zogst du mich an dich. Strichst mir mit deinen festen Händen meine Haare von der Stirn hinter das Ohr, um es mir zuzuflüstern.
„Morgen ist es wieder soweit, Liebes.“
Während du das sagst, fährt deine rechte Hand jedesmal sanft und unnachgiebig zugleich über die untere Bindung meiner linken Pobacke. Diesem Augenblick, deinen Lippen an meinem Ohr und deiner Hand fest auf meinem Po, fieberte ich oft wochenlang entgegen. Was für ein Strahl aus lichtvoller Energie, aus Hitze und Kälte zugleich, der eine Achse bildete zwischen deinen Lippen und deiner Hand. Diese Achse, die mich unbegreiflich stark und einzigartig werden ließ. Die mich zu deinem Werkzeug machte, zum wertvollsten Werkzeug unserer Liebe. Es ist so klug, so gut von dir, daß du mir diesen Tag, diese Nacht zur Vorbereitung jedesmal gegeben hast. „Alles, alles, Liebster, war klug und gut. Niemals zuvor habe ich eine so vollkommene Liebe erleben dürfen. Du weißt es doch!“
Daß ich auch niemals nach diesem Augenblick wieder diese deine Liebe erleben werde, das weiß, wußte ich jetzt, damals, hier an diesem Schreibtisch hockend noch nicht. Noch ist das Rauschhafte, das Dämonische so gegenwärtig. Noch ist der ganze Raum von deinem, von unserem Duft durchwoben, daß ich dieses „Sofort-für-immer“ überhaupt nicht fassen will. Fassen kann.
„Nein, nein“, jammerte es in mir, „wir haben doch vom ersten Augenblick an gewußt, daß wir — und nur wir! — wie ein Gedanke, wie ein Körper, eine Sehnsucht zusammengehören. Bitte, es war doch kein wirklicher Schrei! Du hast dich verändert. Du bist strenger geworden. Immer längere Keuschheit hast du von mir verlangt. Und wenn du mich dann endlich, endlich befriedigen wolltest, dann hast du vor meiner Erlösung unsere Gerte immer schärfer über meinen Po gezogen. Früher habe ich nie geschrien. Du weißt doch, Liebster, mein gurgelnder, feiner Gesang galt doch der Vorfreude. Bitte, bitte verzeih mir. Reiß mich nicht auseinander! Wirf mich nicht weg wie ein abgerissenes, nicht mehr gebrauchtes Teil von dir!“
Und so liege ich hier wie ein lebloses Stück Fleisch.
„Du mußt deinen Kopf anders hinlegen“, hämmert es hinter meiner Stirn. Doch alles, was mir gehorchen will, sind meine Augen. Sie streifen wieder die beiden herunterhängenden Lederriemen, mit denen du mich vor unserem Ritual an den Schreibtisch bindest. Damit es mir leichter fällt, auch deine letzten Schläge demütig entgegenzunehmen und ich mich nicht, einem vegetativen Reflex erliegend, auch nur einen Moment lang ungewollt deiner Liebe entziehe. Immer wieder unser süchtiges, vollkommenes Spiel. Immer läuft es so ab. In meinem Kopf. Die Bilder stehen auf in mir. Das Gefühl, diese unsagbare Mischung aus ängstlicher Spannung und tiefem Glück, greift plötzlich nach meiner Kehle, und wieder würgt es mich, erwürgt mich.
„Liebster, ich hatte mich doch so vorbereitet, wie du es mich gelehrt hast. Wie du es wolltest“
Diese 24 Stunden, von denen ich wußte, daß du mich in dieser Zeit auf keinen Fall berühren würdest. In denen wir miteinander sprachen, sprechen. In denen alles gesagt werden kann. Ich dir meine Ängste anvertraue. Ängste, die erst durch dich ihren Namen wiederbekamen. Endlich erlöst aus ihrem Käfig des Unbewußtseins. Meine Sehnsüchte, Kindheitsgefühle, Verlorenheitsgefühle. Dann die Dankbarkeit, dich getroffen zu haben. Dann strömte sie klar und einfach von mir zu dir, die Liebe. Was hast du mir nicht alles anvertraut in diesen heiligen Stunden. Ich beschwöre dich. Ich weiß doch alles von dir: Ich bin doch die einzige, die den Blick deiner Mutter nachmachen kann. Den Blick, nach dem du so begierig bist. Wenn sie deinen Vater ansah. Den du verschlungen hast. Um den du deinen Vater beneidest und für den du ihn bewundert hast. Den du mir ausgemalt hast in unzähligen Bildern.
„In ihm liegt das Geheimnis der untrennbaren Liebe und Hingabe. Er hat diesen beiden Menschen eine Aura verliehen. Sie hatten nur eine Aura, weil sie nur eine brauchten.“
Und das, das war mir doch gelungen. Du hast selber fassungslos vor mir gestanden, als du sagtest:
„Jetzt beweg dich nicht! Um Himmels willen, bleib so!“ Und dein Gesicht zerfloß.
„Jetzt hast du ihren Blick gehabt, mich angesehen wie sie ihn.“
Das war es, was du dir von Kindheit an ersehnt hattest. Daß dich einmal deine Frau so ansieht wie sie deinen Vater. Ich, ich allein habe dir dieses Geschenk gemacht. Du hast kein Recht, mich zu verlassen. Ich habe dir zuviel von dem gegeben, was du brauchst. Du bist verloren ohne mich. Du wirst dich auflösen ohne meine Sehnsucht!“
Ich bin es, die sich auflöst. Alles um mich herum zerfällt in diese Lüge, die ab jetzt zu meiner einzigen, unbarmherzigen Wahrheit wird.
War ich eingeschlafen? War ich wieder ohnmächtig geworden? Es ist hell. Ein Lichtstrahl gleitet über meine Leblosigkeit. Ich bin inzwischen ganz auf den Boden geglitten. Die Schmerzen in meinem Nacken sind von einer Starre zu einem dumpfen Pochen geworden. Ich friere. Die Kälte, die immer tiefer in meinen nackten Körper eindringt, zwingt mich endlich doch zu einer Bewegung.
Ich muß aufstehen, eine Decke holen, mir etwas überziehen. Auch wenn du sterben willst; so hier liegen zubleiben, ist nicht länger möglich. Aber ich will nicht weg! Nicht weg von genau diesem Platz! Hier habe ich dich zuletzt gespürt. Hierher wirst du zurückkommen. Und dann wirst du sehen, daß ich mich nicht bewegt habe, daß ich genau hier, voller Reue, voller Zuversicht auf dich warte. Dann brauchst du mich einfach nur wieder mit den Riemchen festzubinden. Mir wieder so zärtlich über die Innenseite meiner Schenkel z streichen, mit der Gerte oder mit der Hand, wie du es willst, so soll es geschehen. Und ich, ich werde nie wieder auch nur den leisesten Schrei ausstoßen. Du wirst weitermachen beim neunten Schlag, wo du aufgehört hast. Gestern oder vorgestern. Bis zwanzig werde ich zählen. Zwanzig Schläge — das hatte dir dein Vater anvertraut und du später mir —, ruhig und liebevoll gesetzt, auf den nackten Po, bei gut befestigten Oberschenkeln, dafür die Riemchen, die er hatte anbringen lassen, damals, als deine Eltern noch ein junges Paar waren. Ja, siehst du, ich weiß alles über euch. Ich bin die einzige, die das weiß. Ich habe mir alles genau gemerkt., Zwanzig Schläge und dann, dann? Dann das Liebesspiel. Das Geheimnis ihres, meines Blickes.
Ich darf nicht weiterdenken. Es zerreißt mich. Ich muß aufs Klo. Muß mich bewegen. Verzeih mir! Ich bin sofort zurück.
Kriechend erreiche ich das Badezimmer. Oh, welche Wärme fließt aus meinem Körper. Ich spüre sie an meinen Schenkeln. Sie erweckt wenigstens einen Teil von mir zu einer Art Leben. Nie hätte ich für möglich gehalten, daß dieser simple Vorgang einen Menschen aus dem Reich des Sterbens zurückholen kann. Aber dennoch, ich muß wieder dorthin.
Dorthin, wo er weitermachen wird, wenn er eingesehen hat, daß er ohne mich nicht leben kann. Aber ich muß mir etwas überziehen. Er wird es verstehen. „Du hast doch alles verstanden, was mich bewegt“
Ich krieche zurück zum Schreibtisch und setze mich genau unter die Riemchen. Ich greife nach ihnen wie nach einem Halt. Ich habe es doch nicht gewagt, mir etwas anzuziehen. „Vielleicht wird es dich gerade in dieser Situation doch stören. Aber eine Decke, gegen die wirst du nichts haben.“ Und so lege ich mir eine Decke um.
„Ich kann sie ja sofort abnehmen, wenn ich deine Schritte höre.“
Ich schöpfe einen Hauch von Hoffnung. Das Pochen hinter meiner Stirn ist nicht mehr so rasend, und der Schrei in mir wird leiser, eine Spur, noch längst nicht verklungen, aber leiser. Nur dieses „Wimmern darfst du“. Nach wie vor fliegen deine Worte durch meinen Kopf. Ich muß an den Augenblick denken, als ich zum erstenmal diese fremde Formulierung hörte. Deine Augen in mich eindrangen, als würdest du mir mit diesen Worten die Zauberformel für das Glück dieser Welt offenbaren. Es war in unserer Hochzeitsnacht. Auch sie war so fremdartig. In der du mich nicht einmal berührt hast. Erst am nächsten Tag. Alles an uns machtest du ungewöhnlich. Machst du ungewöhnlich!
„Wie, wie!“ Es bricht aus mir heraus. „Das kannst du nicht von mir verlangen, du Kopf, du grausames Gehirn. Du kannst nicht von mir verlangen, daß ich all die Bilder, all die grausamsüßen Augenblicke noch einmal durch mich hindurchziehen lasse. Sie gleichsam erlebe und dennoch von nichts so weit, so erbarmungslos getrennt zu sein, wie von eben diesen Bildern. Ich flehe dich an, laß mich vergessen oder erleben! Ich will ihn spüren, riechen, die Hand spüren, wie sie mit ihrer Selbstverständlichkeit meine Klitoris zwischen Daumen und Zeigefinger nimmt. Sie fest und sanft hält, reibt, verzaubert.“
Während meine Tränen mein Gesicht wärmen, zieht die Erinnerung wie Honig in meinen Schoß.
Ich weine lange, und die Süße in meinem Geschlecht sehnt sich nach deiner Hand. Schreit nach ihr.
Ich denke daran, diese Hände, wie sie immer ihren Weg fanden, zu ihr, zu meiner Schnecke. Immer wenn wir allein waren, zusammen, fandest du sie, suchte sie dich. Nur ich, ich durfte sie nicht mehr berühren. Habe sie nicht mehr berührt seit unserer Hochzeitsnacht. Nein, o nein, nicht mehr bis auf dieses eine Mal. Dieses eine Mai, das du aber nicht gemerkt hast. Gott sei Dank nicht gemerkt. In diese dämonische Nacht schleuderst du mich, du grausames Gehirn, das keinen Gedanken zuläßt, der sich nicht um ihn dreht. Was soll ich tun? Ich muß mich dir ergeben. Vielleicht wird es ihn anlocken, ihn hierher zurückführen, wenn ich unsere Geschichte noch einmal durch jede Pore meines Körpers ziehen lasse.
Der Anfang unserer Liebe war ebenso eigenartig wie alles, was bis heute folgte. Es war im Theater. Ein sehr modernes, exzentrisches Stück wurde gespielt. Ein Mann versuchte, mit den Folgen seiner gutbürgerlichen Erziehung fertigzuwerden. Es gelang ihm aber nicht. Die Hohlheit, die Gefühlskälte der elterlichen Welt schienen ihn dazu verdammt zu haben, seine Identität nicht finden zu können. Ständig auf der Suche nach sich selbst, im Teufelskreis der Beziehungslosigkeit hin-und hergeworfen. Es schien, als würde das Leben für ihn nie über die Bedrohlichkeit herauswachsen, die ein Kleinkind empfindet, dem statt Einfühlung starre Regeln von Erziehungsmaximen begegnen. Dieses Angegriffensein durch den ganz normalen Alltag fand eine Entsprechung in seinem Körper. Er führte den inneren Kampf gegen diese Ichlosigkeit in Form von Krebs. Die Inszenierung war brutal. Für mich abstoßend. Das Bühnenbild war eine öffentliche Toilette, die teilweise Zentimeter tief unter Wasser gesetzt wurde. In einer Szene kroch der Hauptdarsteller auf dem Bauch durch diese Wasserlache. Plötzlich entkleidete er sich und schleuderte sein triefnasses Hemd in den Zuschauerraum. Ich sitze im Konzert oder Theater immer gern auf Plätzen, wo ich gut sehen kann. So saß ich also auch an dem Abend in einer der vordersten Reihen. Dies Hemd nun schlug ausgerechnet gegen mein Gesicht. Ekelhaft naß, landete es halb über meinem Kopf, zerstörte meine Frisur und rutschte triefend auf den Rock meines Seidenkostüms. Dieser Schauspieler hatte es einfach in den Zuschauerraum geworfen und mich damit in erschreckender Weise, natürlich völlig unvorbereitet, zu einem Teil der Aufführung gemacht. Jeder, der in meiner Nähe saß, starrte mich erschrocken und befremdet an.
Nach der ersten Erstarrung griff ich nach dem tropfenden Ding und hielt es so weit wie möglich weg von meinem Körper, von meinem teuren Kostüm. Ich war unfähig, etwas anderes damit zu tun, zum Beispiel das Hemd zurückzuwerfen. Die nasse Haarsträhne klebte in meinem Gesicht. Ich war sicher, daß ein großer Teil meines Make-ups völlig zerlaufen sein mußte. Ich fühlte mich erbärmlich, ausgeliefert. Ich wurde erst wieder fähig zu einer Reaktion, als mein Nachbar mir dieses widerliche Geschoß aus der Hand nahm. Er tat das, was mir in meiner Erstarrung nicht möglich war, warf es zur Bühne zurück. Es fiel irgendwo in den Graben zwischen Zuschauerraum und Podest.
Es dauerte endlos lange. Es war mir nicht in den Sinn gekommen — oder besser, ich war nicht fähig gewesen —, schon vorher aufzustehen. Benommen in meinem jämmerlichen Zustand, blieb ich brav sitzen.
Das alles hattest du genau beobachtet. Und nicht nur zufällig an diesem Abend. Nein, du warst zu jeder Aufführung dieses Stückes gekommen. Gekommen, um eben diese Szene immer wieder von deinem Seitenplatz im ersten Rang aus zu beobachten. Von diesem Platz aus, das hattest du im Laufe der Aufführungen herausgefunden, waren Gesicht, Gestik, Entsetzen, Erschrecken genau zu erkennen. Dein Theaterglas holte dir jede Reaktion des Opfers so nah heran, wie du es wolltest. Dies Stück im Stück war es, was dich hierher trieb. Was später uns auf diesen Rang zog. Du sagtest mir sofort, schon am ersten Abend, wie sehr es dich gefangen nahm, was dort geschah.
„Wissen Sie, was mich immer wieder in dieses Stück zieht? Es ist die Tatsache, daß das Opfer auf der Bühne in seiner Verzweiflung selber zum Täter wird. Es erzeugt mit diesem Wurf nahezu zufällig, aber doch zwingend ein neues Opfer. Derjenige, den seine nasse Hülle trifft, dieses Opfer im Zuschauerraum, reagiert so unverfälscht, so unecht mit seinem ganzen bedrohten Charakter. Ich bin der festen Überzeugung“, sprachst du nach einer kurzen Pause weiter, „daß man in kaum einer anderen Situation so schnell und ungeschönt Einblick in das innerste eines Menschen bekommt. Ich finde, wir werden in dieser kurzen Szene mit zwei ganz elementaren Wahrheiten des menschlichen Daseins konfrontiert. Die erste: Ein Mensch, der durch das Leben, das er führt, führen muß, zum Opfer wurde, erschafft in der Art, wie er handelt, neue Opfer.“
Ich verstand dich nicht. Vieles von dem, was du mir später immer wieder erklärt hast, verstand ich zumindest beim ersten Mal nicht. Aber alle deine Theorien übten auf mich einen sonderbaren Reiz aus. Und egal, ob ich dich verstand oder erst zu verstehen begann, als ich tiefer darüber nachdachte, ich konnte mich deinen Theorien nicht widersetzen. Nie fand ich Gegenargumente, nie suchte ich nach ihnen. Dich sprechen zu hören, dein Gesicht, die Bewegung deiner Hände, das Eindringliche, mit dem du immer wieder dein lud von der Welt auf mich übertragen hast.
„Und die zweite Wahrheit ist: So wie der Zuschauer, den es jeweils erwischt, mit diesem erschreckenden Moment umgeht, das zeigt, welche Rolle er in seinem Leben wirklich verkörpert. Welche Rolle er für sich eingenommen hat.“
Ja, das hatte ich verstanden. Du hattest meine ganze Hilflosigkeit genauestens beobachtet. Ja, du warst nur aus dem Grund gekommen, um diesen entscheidenden Moment auf dich wirken zu lassen. In ihm zu erkennen, was für dich so eine große Bedeutung hat.
Du warst kurz vor Beginn der Pause aufgestanden, hast dich vor die Tür gestellt, durch die ich voraussichtlich kommen mußte. Du beobachtetest genau, daß ich sofort zu einer Damentoilette flüchtete und wie ich später, einigermaßen wiederhergestellt, meinen Mantel holen wollte, um zu gehen. Und dann kam der Augenblick unserer ersten Berührung. Noch ehe wir irgendein Wort miteinander gesprochen hatten, spürte ich hinter mir deine Hand, wie sie meinen Mantel nahm. Dann, wie beide Hände mich fest, nur für den Hauch einer Sekunde, aber dennoch so fest hielten, daß mein ganzer Körper sich berührt fühlte. Noch lange, nachdem du mir in den Mantel geholfen hattest. Ich drehte mich um. Zum erstenmal wurde ich von deinem Blick getroffen.
„Es tat mir leid, zusehen zu müssen, wie hilflos Sie sich eben gefühlt haben.” Es tat dir leid, meine Hilflosigkeit zu sehen. Dabei war das doch erst der Anfang. Der seichte Rand des Strudels von Hilflosigkeiten, in die du mich immer wieder geführt hast. Und jetzt! Meine Hilflosigkeit jetzt, hier am Boden, vor dem Schreibtisch! Tut sie dir nicht leid? Du bist nicht bei mir! Hilfst mir nicht aus der Kälte!
„Ich hätte Sie gern erlöst. Aber ich war zu weit weg von Ihnen. Ich möchte, daß Sie ein Glas Wein mit mir trinken. Sie trinken doch Wein? Sicher, und mir erzählen, wie es Ihnen dabei ergangen ist, als der nasse Lappen Ihr Schicksal wurde. Das wird Ihnen guttun.“
Das wird Ihnen guttun. Die Art, wie du mit mir sprachst, das Nach Gespür, das deine Hände auf meinen Schultern zurückließen, dein Blick und deine ganze Erscheinung, alles zog mich sofort in deine Nähe. Ich hätte dich am liebsten sofort geküßt. Du wolltest wissen, wie es mir geht, und ich sehnte mich danach, dir mein ganzes Sein anzuvertrauen.