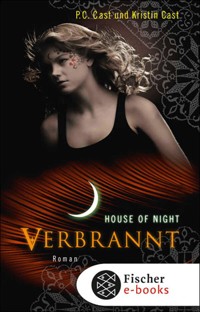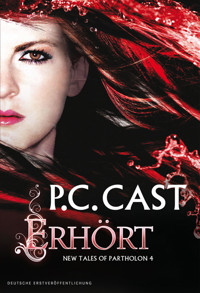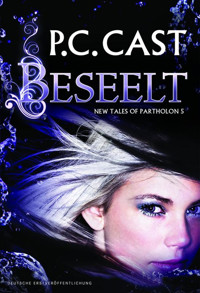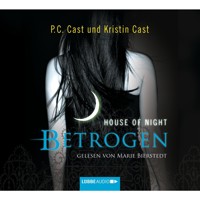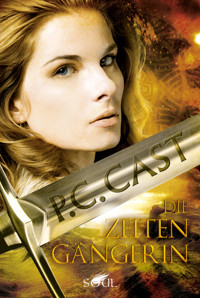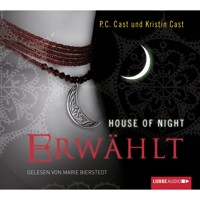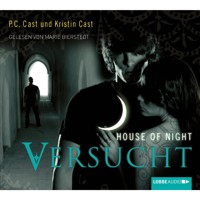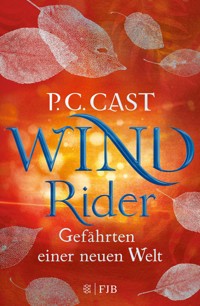
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Gefährten einer neuen Welt
- Sprache: Deutsch
In einer zerstörten Welt voller Gefahren kämpfen drei verfeindete Stämme ums Überleben. Die junge Mondfrau Mari ist auserwählt, sie zu retten, doch überall lauert Verrat. Mari, Nik und ihr neues Rudel werden gejagt. Thaddeus und der Gott des Todes geben nicht auf, bevor sie vernichtet sind. Mari und Nik haben ein Ziel: die Ebenen der Wind Riders zu erreichen. Mit ihnen gemeinsam wollen sie Thaddeus daran hindern, alles zu zerstören, was Mari und Nik lieb ist. Doch werden die geheimnisvollen Wind Riders das Rudel akzeptieren, oder müssen sie weiter fliehen, um ihr Leben zu retten?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 803
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
P.C. Cast
Wind Rider: Gefährten einer neuen Welt
Über dieses Buch
Ein Verrückter hat Mari, Nik und ihr neues Rudel aus dem einzigen Zuhause vertrieben, das sie kannten, und ist weiter auf der Jagd nach ihnen. Er wird vor nichts Halt machen und nicht rasten, bevor er sie vernichtet hat. Mari weiß, ihre einzige Chance zu überleben, besteht darin, die Ebenen der Wind Riders zu erreichen. Sie sind ein sagenumwobenes Volk, bekannt für ihr Band mit ihren hervorragenden Pferden und ihre unvergleichlichen Reitkünste.
Mari und ihr Begleiter Nik sind zu allem entschlossen, aber sie begeben sich auf eine gefährliche Reise, als sie Sicherheit und Zuflucht suchen. Der Gott des Todes kommt näher, und falls das Rudel von den Wind Riders vertrieben werden sollte, wird es nicht überleben.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
P.C. Cast ist die Autorin der zwölfbändigen »House of Night«-Serie. Sie wuchs in Illinois und Oklahoma auf und arbeitete viele Jahre als Lehrerin, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Ihre Bücher erreichten eine Gesamtauflage von über zwanzig Millionen Exemplaren und erschienen in mehr als vierzig Ländern.
Die Autorin lebt mit ihrer Familie und ihren geliebten Katzen, Hunden und Pferden in Oregon.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel
›Wind Rider. Tales of a New World‹ bei Wednesday Books, New York.
Copyright © 2018 by P.C. Cast
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2019 S. Fischer Verlag GmbH,
Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Published by Arrangement with St. Martin's Press, LLC.
All rights reserved.
Dieses Werk wurde durch die Literarische Agentur
Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover, vermittelt.
Covergestaltung und -abbildung: bürosüd, München
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490945-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
1. Kapitel
Drei Jahre zuvor – Ebenen der Windreiter – Ort der Treffen
2. Kapitel
Gegenwart – Höhenzug über der Stadt in den Bäumen
3. Kapitel
4. Kapitel
Zwei Jahre zuvor – Ebenen der Windreiter – Nahe der Frühlingsweidegründe der Magenti-Herde
5. Kapitel
Gegenwart – Umbria-Fluss
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Gegenwart – Umbria-Fluss – Rudel
10. Kapitel
Anderthalb Jahre zuvor – Herbstlager der Magenti-Herde, Ozark-Plateau
11. Kapitel
Gegenwart – Umbria-Fluss
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Sechs Monate früher – Winterlager der Magenti-Herde – Tal der Nebel
15. Kapitel
Gegenwart – Stamm des Lichts
16. Kapitel
Gegenwart – Stadt in den Bäumen
17. Kapitel
Gegenwart – Day-Damm – Das Rudel
Gegenwart – Stadt in den Bäumen
18. Kapitel
Gegenwart – Stadt in den Bäumen
Das Rudel – Verlorener See
19. Kapitel
Gegenwart – Ebenen der Windreiter – Stutenprüfung
20. Kapitel
Gegenwart – Dorf der Salish am Bonndamm
Verlorener See – Das Rudel
21. Kapitel
Felsenberge – Das Rudel
22. Kapitel
Ebenen der Windreiter – Ort der Treffen
23. Kapitel
Felsenbergpass – Das Rudel
24. Kapitel
Beginn des Wegs durch die Felsenberge – Tods Armee
25. Kapitel
Ebenen der Windreiter – Ort der Treffen – Hengstrennen
Danksagung
Dieses Buch ist meinem Dad gewidmet – du wirst immer mein Mighty Mouse und mein großer Held sein. Das hier hat besonders viel Spaß gemacht!
1
Drei Jahre zuvor – Ebenen der Windreiter – Ort der Treffen
Die Morgendämmerung spielte am Horizont und ließ den Himmel erröten, als River sich leise aus dem überfüllten Zelt schlich, das sie sich mit ihrer Mutter, drei jüngeren Schwestern, ihren beiden Tanten, fünf Cousinen, der Stute ihrer Mutter und den beiden Wallachen teilte, die vor vielen Jahren ihre Tanten als Reiterinnen erwählt hatten. Dank der Position ihrer Mutter als Reiterin der Leitstute der Magenti-Herde stand das Zelt nahe dem Mittelpunkt der Spirale aus steinernen Monolithen, die anzeigten, dass sich hier, am Ort der Treffen, mächtige Leelinien kreuzten. Doch selbst ohne die Monolithen, die sich wie uralte stumme Wachtposten ausnahmen, wäre die schlundartige Höhle in ihrer Mitte ein Beweis für die zerstörerische Kraft der Sonne gewesen, die vor vielen Jahrhunderten dafür verantwortlich gewesen war, dass die Erde aufriss und die Welt sich für immer veränderte. River spähte zum Eingang der Höhle hinüber, um vielleicht einen Blick auf die Jährlinge darin zu erhaschen. Aber alles, was sie sah, waren Schatten im Licht der Fackeln; immerhin hörte sie ihr unruhiges Schnauben und Rascheln.
River widerstand dem Drang, sich den Fohlen zu nähern. Das Gesetz der Herden verbot den Kandidaten jeglichen Kontakt zu den Jungpferden, sobald diese am Ort der Treffen angelangt waren – nicht zuletzt deshalb wurden sie in der Höhle zusammengetrieben, in deren sicheren Tiefen ganze Herden Platz finden konnten.
Heute ist der Tag der Wahl. Nur noch wenige Stunden bis zu dem Ereignis, von dem ich geträumt habe, seit ich träumen kann. Vor Aufregung und Nervosität war ihr ganz schwindelig. Schon jetzt im ersten Morgenlicht begann es in dem riesigen Lager, geschäftig zu summen. Sie wandte sich von der Höhle ab und setzte mit raschem Schritt ihren Marsch durchs Lager fort, den Kopf gesenkt, in der Hoffnung, dass niemand sie erkannte.
»Hallo, River, das Glück der Stute sei heute mit dir!«, rief eine entfernt vertraute Stimme.
Ohne innezuhalten, winkte River flüchtig einen Dank und beschleunigte ihren Schritt. Sie wollte bloß einen kurzen Moment lang allein sein, ehe der Tag begann und sich alle Augen auf sie richten würden.
Tu nicht so dramatisch. Nicht die ganze Aufmerksamkeit wird sich auf dich richten – nur die deiner eigenen Herde, schalt sie sich sarkastisch, während sie zwischen den letzten leuchtend violetten Zelten hindurchschlüpfte, die sich rund um das ihrer Mutter gruppierten und anzeigten, dass hier die Magenti-Herde lagerte. Ihre Herde. Ihr Leben. Und heute der Grund für ihre Nervosität.
Die violetten Zelte wurden durch solche in unterschiedlichen Blautönen ersetzt – hier begann die Indigo-Herde. River lächelte still vor sich hin. Anders als ihre eigene Herde, die viel darauf gab, von einem einzigen wahren tiefen Violettton repräsentiert zu werden, waren die Indigo-Reiter stolz darauf, wie viele Blauschattierungen sie hervorbrachten. Ihrer Mutter gefiel das überhaupt nicht, aber River fand die Vielfalt erfrischend und wunderschön.
An diesem frühen Morgen blieb sie allerdings nicht wie sonst stehen, um die Farbenpracht zu bewundern. Noch vor den blauen Zelten wandte sie sich nach links, fiel in Trab und joggte an den gelben und roten Zelten der Jonquil- und Cinnabar-Herde vorbei bis zu der sanften Anhöhe, auf der die Prärie durch einen Waldstreifen abgelöst wurde, der anzeigte, dass ein Bach in der Nähe war.
Erleichtert, dass am sandigen Ufer des klaren schnellfließenden Jährlingscreeks noch kein Mensch zu sehen war, eilte River die Uferböschung hinab. Mit einem der langen violetten Tuchstreifen, den sie sich von dem Haufen eigens gefärbter und bestickter Bänder geschnappt hatte, die man ihr sehr bald ins Haar flechten würde, band sie sich ihre wilde pechschwarze Lockenpracht zurück. Dann kniete sie sich in den weichen Sand, schöpfte mit beiden Händen Wasser aus dem Creek und klatschte es sich ins Gesicht. Die Kälte ließ sie scharf einatmen – so früh im Jahr war die Prärie noch nicht heiß genug, um dem kleinen Strom aus den Bergen etwas Wärme einzuhauchen. Doch River ließ sich nicht beirren, wusch sich gründlich das Gesicht, schlüpfte aus ihrem Nachthemd und watete nackt ins Wasser, vorsichtig von einem glatten Stein zum nächsten, bis sie hüfthoch in der Strömung stand. Ohne zu zögern, hockte sie sich bis zum Hals ins Wasser und schloss die Augen.
Spüle meine Nervosität und meine Zweifel fort. Hilf mir, die Magenti-Herde und meine Mutter stolz zu machen. Große Mutterstute und Vater Hengst, bitte lasst mich heute für würdig erachtet und als Reiterin erwählt werden.
Erwählt … Das Wort war alles, woran River denken konnte, während sie tief im eiskalten Wasser saß. Endlich war der große Tag angebrochen, und falls es geschah – falls sie erwählt wurde –, würde ihr Leben unwiederbringlich ein anderes werden.
Sicher, auch wenn sie nicht erwählt würde, würde es anders werden. Insgesamt würde sie drei Chancen dafür haben: Jedes Kind einer Herde, das den sechzehnten Winter überschritten hatte, wurde dreimal in drei aufeinanderfolgenden Jahren den Jährlingen präsentiert, und auch jene, die nie erwählt wurden, wurden als wertvolles Mitglied ihrer Herde betrachtet – aber sie waren keine Windreiter. Reiten konnten sie natürlich – jeder, der in eine Herde hineingeboren wurde, verfügte über diese Fähigkeit –, doch es war ein riesiger Unterschied, ob man sozusagen als Passagier auf einem Pferd saß oder ob man durch Körper, Geist und Seele mit dem Pferd verbunden war, von dem man als Gefährte und Freund fürs Leben erwählt worden war.
Während ihrer ganzen Kindheit hatte River das Band zwischen ihrer Mutter und deren herrlicher Stute Echo beobachten können, und mit aller Macht sehnte sie sich nach dieser unbeschreiblichen innigen Verbindung. Auf den heutigen Tag hatte sie die meiste Zeit ihrer sechzehn Lebensjahre hingearbeitet, und das vergangene Jahr hindurch war sie geradezu besessen davon gewesen.
»Mir egal, ob das Fohlen, das mich erwählt, als Leitstute oder Leithengst in Frage käme. Ich wäre mit jedem glücklich – ein süßer Wallach würde mir völlig reichen. Nur lasst mich bitte, bitte von einem angenommen werden, lasst eines der Fohlen mich heute erwählen.«
»Mach dir keine Sorgen. Du weißt doch, du reitest wie deine Mutter, und sie wurde schon bei ihrer ersten Präsentation von Echo erwählt.«
Langsam drehte River sich in Richtung der männlichen Stimme um, die über den Creek zu ihr trieb. Er stand am Ufer, hielt ihr Nachthemd in die Höhe und lächelte sie an. Wie lang sein Haar geworden war! Und verziert war es mit scharlachroten Bändern von genau der Farbe seiner Weste, die viel von seiner breiten, muskulösen Brust erkennen ließ. So wirkte er viel erwachsener statt nur zwei Jahre älter als sie. In River stieg eine Freude auf, die sie überraschte – ihr war nicht klar gewesen, wie sehr sie ihn vermisst hatte.
»Clayton! Ich dachte schon, du wärst nicht rechtzeitig zur Präsentation gekommen, weil ich dich die letzten Tage nicht gesehen hatte! Schön, dass du da bist – auch wenn du mich beim Beten belauscht hast.«
»Ich habe nicht gelauscht. Ich bin einfach hierhergekommen, und da warst du bereits am Beten – laut und deutlich.«
»Aaaah ja. Das nächste Mal denke ich daran, ein bisschen leiser zu beten. Was hast du hier draußen überhaupt zu suchen?« Sie grinste schelmisch. »Willst du auch ins Wasser kommen?«
Clayton schnaubte. »Nein! Ich habe tatsächlich nach dir gesucht, weil ich dich gern sehen wollte, aber ich bade lieber auf zivilisierte Weise – in einem Zuber mit warm gemachtem Wasser oder noch lieber in einer dampfend heißen Quelle.«
»Immer noch das alte Baby«, neckte sie ihn grinsend.
»Immer noch die alte freche Göre«, konterte er. »Komm lieber raus, bevor du blau anläufst und um Aufnahme in der Indigo-Herde bitten musst. Außerdem will ich dir etwas schenken, was dir Glück bringen soll – auch wenn du das garantiert nicht nötig hast.«
»Schenken?« Ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, ob ihre Nacktheit schamlos oder verführerisch wirken könnte, watete sie aus dem Wasser zu Clayton, der ihr ihr Nachthemd reichte. Sie trocknete sich am Saum ab und blickte zu ihrem alten Freund auf. »Bist groß geworden.«
»Noch größer«, berichtigte er.
»Und vielleicht auch noch eitler?«
»Nö. Ich glaube, ich bin so eitel wie schon immer.«
Sie zog sich das Nachthemd über und musterte ihn. »Irgendwie hast du auch mehr Muskeln bekommen. Die Cinnabar-Herde muss dich und Bard den Winter über auf Trab gehalten haben. Wo ist denn dein Kleiner?« River spähte an Clayton vorbei in der Annahme, der Dreijährige warte irgendwo in den lichter werdenden Schatten, die sich noch hartnäckig auf der Grasfläche unter den grünenden Pfahleichen und Weiden hielten, von denen der Jährlingscreek gesäumt war.
»Meine Mutter hat darauf bestanden, ihm die roten Bänder aus Mähne und Schweif zu nehmen und durch die richtigen zu ersetzen.«
»In Magenti-Violett natürlich.«
»Selbstverständlich.«
»Ähm, hat sie die etwa nicht bemerkt?« River griff nach einem der scharlachroten Bänder in seinem Haar und zog daran. »Oder das da?« Sie tippte auf seine blutrote Weste, von der sie aus der Nähe erkannte, dass sie kunstvoll mit steigenden Pferden aus fuchsfarbenem Mähnenhaar bestickt war.
»Doch. Sie meinte, ich solle mich anständig anziehen und die Bänder rausnehmen, aber dann scheuchte sie mich weg und begann, ein Riesenaufhebens um Bard zu machen, wie sehr sie ihn vermisst hätte und dass es höchste Zeit wäre, ihm seine Mähne mal ordentlich zu flechten.«
»Hey, willst du wissen, was wirklich ein Riesenaufhebens ist? Dann sieh mal zu, wie alle um Echo herumscharwenzeln.« Mit einem leisen Auflachen verdrehte River die Augen.
Clayton lachte nicht mit, sondern wurde ganz ernst. »Na ja, nach Echo sind schon alle ein bisschen verrückt. Schließlich ist sie die Leitstute und das klügste, stärkste und schönste Pferd der Magenti-Herde – oder nach Ansicht vieler sogar aller fünf Großen Herden.«
Rivers Schultern sackten nach vorn. »Hast recht. Tut mir leid. Ich habe kein Problem mit Echo, wirklich. Sie ist wundervoll, und ich liebe sie nicht weniger als Mutter.«
»Womit hast du dann ein Problem?«
Statt einer Antwort gab sie gleich zwei Fragen zurück. »Clayton, würdest du sagen, dass Echo sozusagen eine Erweiterung von Mutter ist? Dass Mutter genau dieselben Qualitäten hat wie Echo?«
Er antwortete, ohne zu zögern. »Ja, definitiv. Das würde jeder sagen – in unserer Herde und in den anderen auch.«
»Ich auch. Meine Angst ist, dass ich sie nicht habe.«
»Dass du was nicht hast?«
»Diese Qualitäten.« Sie sah Clayton in die Augen. »Ich will Mutter und unsere Herde nicht enttäuschen.«
»Wirst du nicht. Kannst du gar nicht. Außer du hast dich in dem halben Jahr, das ich weg war, drastisch verändert?« Er hob herausfordernd die Augenbrauen.
»Nein. Ich bin immer noch ich.«
»Dann bist du die passionierteste Reiterin, die ich mir vorstellen kann. Hey, lass dich nicht von all den Leuten und ihrem Gerede irremachen. Du weißt doch, dass die Jährlinge deine Nervosität spüren. Konzentrier dich darauf, du selbst zu sein und das Pferd anzunehmen, das heute zu dir kommt, egal was für eines – das ist alles.«
River verdrehte die Augen. »Ach – das ist alles?«
»Na ja, fast alles. Wenn du erwählt wirst, wirst du damit leben müssen, dass die Erwartungen der ganzen Herde auf dir ruhen – vor allem wenn es ein Stutfohlen ist. Und wenn du nicht erwählt wirst, wirst du damit leben müssen, dass sich alle verzweifelt fragen, woher nun die nächste Leitstute und ihre Reiterin kommen sollen …« Er grinste. »Hilft dir das?«
»Nicht das kleinste bisschen.« Dann grinste auch sie.
Clayton breitete die Arme aus. »Komm her, Angsthase. Ich habe dich so vermisst.«
River ließ sich von ihm umarmen. Es war ein zugleich vertrautes und seltsam fremdes Gefühl. Er hielt sie sehr fest, und auch sie klammerte sich an ihn. Dann löste sie sich aus der Umarmung, wie es das gute Recht jeder Frau aus den Herden war, trat zurück und blickte zu ihm auf.
»Ich hoffe, du hast mich auch vermisst«, sagte er.
»Und wie!« In seinen Augen sah sie, dass er drauf und dran war, noch mehr zu sagen. Sie hielt den Atem an und hoffte inständig, jetzt würde es nicht peinlich werden. Doch zum Glück hielt er sich zurück. Stattdessen griff er in die Tasche und zog etwas heraus. In der geschlossenen Faust bot er es ihr dar.
»Hier, für dich.«
Sie streckte die Hand aus. Clayton ließ etwas hineinfallen. Ein Kristall – ein länglicher Finger aus glitzerndem Quarz, der sich perfekt in ihre Handfläche schmiegte. Er war warm von Claytons Körper, aber bei der Berührung mit ihrer Haut wurde er noch heißer – er reagierte auf das Blut der Kristallseher der Magenti, das stark in ihr pulste. River konnte sie spüren, die schlafende Macht des Kristalls … und obwohl sie noch nicht einmal eine Windreiterin war, begann der Stein zu erwachen, stimmte sich auf sie ein und übte eine beruhigende Wirkung auf die wie Glühwürmchen herumflirrenden Gedanken aus, die sie plagten, seit sie vor zwei Tagen zum Ort der Treffen gekommen war.
Instinktiv atmete sie ruhiger, ihre Schultern lockerten sich. Zum ersten Mal seit Tagen ließ die brennende Spannung darin nach. River wollte Clayton schon für das herrliche Geschenk danken, aus dem Dank wurde allerdings ein ungläubiges Luftschnappen, als die ersten Sonnenstrahlen auf die Facetten des Kristalls trafen und enthüllten, was sich darin verbarg.
»Clayton, das ist ja ein Phantom!«
»Sieh genauer hin, was für ein Phantom es ist.«
River hob den Kristall in die Höhe, kniff die Augen zusammen – und riss sie weit auf. »Große Mutterstute, ein Amethystphantom! Das kann ich nicht annehmen, Clayton. Das ist viel zu wertvoll.«
Sanft schloss Clayton ihre Hand um den Kristall. »Nein. Für mich nicht. Für mich wäre er nur schön. Um seine Geheimnisse zu wecken, braucht es eine weibliche Windreiterin der Magenti-Herde.«
»Aber du könntest ihn gegen so viel eintauschen – ein ganzes eigenes Zelt zum Beispiel. Wirklich, Clayton, nimm ihn zurück.«
»Ich glaube, dazu ist es zu spät. Du bist jetzt viel entspannter – also, jedenfalls kam’s mir so vor, bevor du gemerkt hast, dass es ein Phantom ist. Er ist für dich erwacht, oder?«
River konnte nicht anders, als die Faust wieder zu öffnen und das glitzernde Geschenk anzustarren. Sie spürte, wie ihr Herzschlag in dem Stein echote.
»Und? Er ist erwacht, nicht wahr?«, drängte er.
»Ja.« Es war, als hielte der Stein ihren Blick fest. »Er ist wach. Definitiv.«
»Ich wusste es! Du reitest nicht nur wie deine Mutter. Du bist auch eine Kristallseherin!«
Sie riss den Blick von dem Stein los und sah sich rasch nach allen Seiten um. »Pst! Das kann man erst sicher sagen, wenn ich von einem Fohlen erwählt wurde. Du weißt, dass man es uns als totale Arroganz auslegen würde, wenn man einen von uns das sagen hörte.«
»Aber es stimmt doch – du hältst den Beweis in der Hand.«
»Alles, was ich in der Hand halte, ist ein extrem seltener mächtiger Kristall, der mein Blut erkannt und sich darauf eingestimmt hat.«
»Blut, aus dem schon so einige überaus fähige Seherinnen hervorgegangen sind«, fügte Clayton hinzu. »Welche Eigenschaften hat ein Amethystphantom noch mal? Ich wollte niemanden fragen, als ich es gefunden hatte. Dass es ein Phantom ist, habe ich immerhin erkannt, deshalb habe ich es versteckt gehalten, bis ich es dir geben konnte.«
Rivers Blick wurde wieder von dem Kristall angezogen, der warm und pulsierend in ihrer Handfläche lag. »Mit Hilfe eines Amethystphantoms können Seherinnen die Anfänge jedes Lebenszyklus sehen.«
»Wow. Aber, äh, was heißt das genau?«
»Das heißt, dass der Kristall dazu verwendet werden kann, zu sehen, zu welcher Erkenntnis jemand in jedem seiner Lebenszyklen kommen sollte. Dadurch kann die Seherin einer Person helfen zu verstehen, was sie noch vollbringen muss.« Sie sah auf in Claytons dunkle Augen. »Wenn es dir zum Beispiel nicht gutginge – also, ich meine seelisch –, wenn du so richtig deprimiert wärst, könnte eine Seherin mit Hilfe dieses Steins all deine Leben anschauen und erkennen, wonach sich deine Seele sehnt und was du in diesem Leben noch vollenden musst.«
Clayton nickte. »In der Cinnabar-Herde gab es so ein Mädchen. Das einfach nur todtraurig war, meine ich. Sie sprang mit ihrer Stute von einer Klippe – mit Absicht. Niemand konnte sie aufhalten. Niemand konnte ihr helfen. Du meinst, dieser Kristall hätte sie retten können?«
»In den Händen einer Kristallseherin? Ja, wahrscheinlich. Aber habe keine zu großen Gewissensbisse. Das konntest du unmöglich wissen.«
»Als es passierte, hatte ich den Kristall noch nicht. Aber ich bin froh, dass ich’s jetzt weiß – und dass ich den Stein gefunden und in deine Hände gegeben habe.« Er nahm eine der bewussten Hände und streichelte langsam und zärtlich mit dem Daumen Rivers Handgelenk. »Verwende ihn, um anderen zu helfen, Kristallseherin.«
»Ich bin keine Kristallseherin«, sagte sie automatisch, ungeachtet der Tatsache, wie der Kristall mit ihrem Herzschlag mitschwang.
»Noch nicht. Aber schauen wir, was heute Vormittag passiert. Na, wenigstens hat er dir geholfen, ein bisschen ruhiger zu werden.«
»Mehr als nur ein bisschen.« In einem Impuls stellte River sich auf die Zehenspitzen und küsste Clayton sacht auf die Wange. »Tausend Dank! Das ist ein unglaubliches Geschenk.«
Während sie zurücktrat, nahm er ihr Gesicht zwischen seine beiden Hände. »River, während ich weg war, habe ich jeden Tag an dich gedacht.«
»Jeden Tag, sechs Monde lang – das ist ganz schön viel. Du übertreibst doch.«
»Ich übertreibe nicht, und ich mein’s ernst. Wenn du mir eine Chance gäbst, würde ich dir zeigen, wie ernst es mir ist.«
Langsam trat River noch weiter zurück, so dass Clayton ihr Gesicht loslassen musste. »Clayton, momentan kann ich bloß an die Präsentation denken.«
»Du hast schon immer bloß an die Präsentation gedacht.«
Ihr Blick hielt seinen fest. »Das ist wahr. Solange ich denken kann, und vor allem jetzt, war und ist es für mich das Wichtigste im Leben, zur Windreiterin zu werden.«
»Aber wenn du heute erwählt worden bist …«
»Falls ich erwählt werde. So was kann niemand sicher voraussagen.«
»Na gut. Falls du heute erwählt wirst, wirst du dann in deinem Leben noch für andere Dinge Platz haben?«
»Weiß ich nicht«, gab sie aufrichtig zu. »Weiter als bis zur Präsentation habe ich noch nie gedacht.«
Clayton holte tief Luft, bevor er ihr in einem einzigen Atemzug eine wichtige Frage stellte. »Sag mir bitte ganz ehrlich: Findest du mich anziehend, oder fühlst du dich zu einem anderen hingezogen – oder zu einer anderen?« Sein Ton war frei von Bitterkeit. In der Herde galt Sexualität als etwas Veränderliches, und es war völlig normal, wenn Frauen Frauen liebten oder Männer Männer – oder wenn gar eine Frau beschloss, als Mann zu leben oder umgekehrt. Seine sexuellen Bedürfnisse auszuloten war etwas Natürliches und Alltägliches, und solange es im gegenseitigen Einverständnis geschah, war alles erlaubt.
River antwortete ihm so ehrlich sie konnte. »Ich finde dich gutaussehend. Du bist klug und witzig, und wir sind befreundet, seit wir klein waren. Aber ich fühle mich nicht sexuell zu dir hingezogen. Das habe ich dir schon unzählige Male gesagt. Ich fühle mich sexuell zu überhaupt niemandem hingezogen. Ich will einfach nur erwählt werden und anfangen, ein Leben als Windreiterin und vielleicht sogar als Kristallseherin zu führen. Das ist für mich das Allerwichtigste. Kannst du das verstehen?«
Claytons Haltung veränderte sich vollkommen. Er trat zurück und verschränkte die Arme vor der Brust. Seine Miene wurde ausdruckslos, und seine sonst so angenehme Stimme bekam eine harte Note. »Ob ich verstehen kann, dass du dich sexuell zu niemandem hingezogen fühlst? Nein. Eigentlich nicht. Du bist sechzehn, River. Ich bin achtzehn. Jeder in unserem Alter – alle, mit denen wir aufgewachsen sind, und alle in unserem Alter in den anderen Herden – ist pausenlos dabei, sich zu verlieben und zu entlieben, und alle Gedanken drehen sich fast nur darum. Also, nein, ich kapiere nicht, was mit dir los ist. Aber unabhängig davon mag ich dich nun mal – mehr als rein freundschaftlich. Ich wünschte, du würdest uns eine Chance geben.« Er seufzte und fuhr sich mit der Hand durchs Haar. »Ich würde dir für heute gern Glück wünschen, aber das wirst du nicht brauchen. Dein Jährling wird dich finden, und ich hoffe, dann wirst du Zeit für die übrigen wichtigen Dinge des Lebens haben – für die Liebe und einen Partner.«
Abrupt drehte er sich um und ging davon.
River blieb regungslos zurück, den Kristall fest in der Hand. Allmählich beruhigten sich durch seinen Einfluss ihr Herzschlag und ihr aufgewühlter Magen. Dann machte sie sich auf den Rückweg den kleinen Abhang hinauf.
Ich lasse das nicht an mich ran. Das wird mir nicht das Gefühl geben, nicht dazuzugehören. Nicht heute.
Auf der Anhöhe hielt sie an und blickte über das Lager der Herden hinweg, das sich vor ihr auf der Hochgrasprärie ausbreitete. Die Sonne war über den Horizont gestiegen. Sie war riesig und hatte die Farbe eines reifen Pfirsichs. Ihr Licht tauchte den Ort der Treffen in plötzliches Gold, in dem die Kristalleinschlüsse in den riesigen granitenen Wächtermonolithen um den Eingang der Höhle, die von den Vorfahren der Prärieleute aus dem Felsen der nahen Berge gehauen und hier aufgestellt worden waren, geradezu magisch funkelten. Die Zelte der Herden führten die Spirale der Steine in immer weiteren Kreisen fort und verwandelten die Prärie in ein Mosaik aus leuchtenden Farben.
Zuerst fand River die Magenti-Herde. Deren violette Zelte und die lange schwalbenschwanzförmige Flagge mit dem Wappen der Herde – einer Kristallrose –, die träge in der morgendlichen Brise zuckte, zogen ihren Blick an wie das Licht die Motten. River liebte ihre Herde und war stolz darauf, dass nur dem Blut der Windreiterinnen der Magenti die Fähigkeit des Kristallsehens innewohnte – die Kunst, Kristalle und die darin schlummernden Kräfte zum Leben zu erwecken.
Mit mir ist nichts los! Ich bin in der Herde akzeptiert. Mutter hat nie bemängelt, dass ich keinen Freund oder keine Freundin habe, oder mir die Ohren vollgejammert, dass ich mir jemanden suchen soll. Über das Thema haben wir noch überhaupt nie geredet. Und meine Freundinnen sprechen auch nicht darüber. Also jedenfalls inzwischen nicht mehr.
Aber hatte sie überhaupt Freundinnen? Oder hatten die Neckereien und blöden Fragen deshalb aufgehört, weil sie sich vor den anderen zurückgezogen hatte, insbesondere das letzte Jahr hindurch?
River umklammerte den Kristall, um mit Hilfe seiner beruhigenden Eigenschaften den Wirbel der Gedanken zu besänftigen, den Claytons Worte verursacht hatten. Sie atmete langsamer, tiefer. Ein stürmisches Begrüßungswiehern lenkte ihre Aufmerksamkeit von der Ansammlung violetter Zelte zu dem smaragdgrünen Areal, wo die Virides-Herde lagerte, deren Flagge von der Silhouette eines galoppierenden Hengstes geziert wurde – was nur passend war für die Herde, aus deren Zucht schon immer die schnellsten Tiere hervorgegangen waren. Das Wiehern kam von einem Hengst, der einer ganz in Grün gekleideten Frau entgegentänzelte. Diese umarmte ihren Gefährten, und er beugte leicht die Knie – nicht als Zeichen der Unterwerfung, sondern als Geste der Hingabe, damit sie es leichter hatte, auf seinen breiten Rücken zu steigen. Sobald sie saß, warf das prächtige Tier den Kopf zurück, tänzelte auf der Stelle, stieg ein bisschen und schlug temperamentvoll nach hinten aus. River glaubte, deutlich das übermütige Lachen der Reiterin zu hören, ehe sie die beiden zwischen den Zelten, den anderen erwachenden Pferden und Reitern außer Sicht verlor.
Ein nicht kastriertes Hengstfohlen als Gefährte, das wäre auch nicht schlecht, dachte sie.
Nicht schlecht. Aber nicht ihr absoluter Traum.
Ihr Blick wanderte weiter zur Jonquil-Herde und deren Behausungen aus leuchtend sonnengelbem Tuch. Das Symbol auf ihrer Flagge war aus der Ferne am leichtesten zu erkennen – ein dunkler stilisierter Bison, der andeutete, welch überragende Jäger diese Herde hervorbrachte.
Neben der Jonquil-Herde lagerte Cinnabar mit ihren blutroten Zelten und der Flagge mit dem schwarzen Speer darin. Vom äußersten Norden mit seinen gefrorenen Seen bis zu den brackigen Wassern des Meeres im tiefen Süden, vom großen Missi im Osten, dem Fluss, der die Prärie begrenzte, bis zu den Felsenbergen, die gleich westlich des Ortes der Treffen aufragten – aus allen Ecken der riesigen Prärie strömten unablässig junge Windreiter, Männer und Frauen, zu dieser Herde, um bei deren unübertroffenen Kriegern in die Lehre zu gehen.
Ist Clayton meinetwegen dorthin gegangen? Weil ich ihn zurückgewiesen habe? Der Gedanke war ihr noch nie gekommen; eilig schob sie ihn von sich. Falls das der Grund war, ist das sein Problem, nicht meines. Ich habe ihm nie etwas versprochen. Ich habe noch nie irgendjemandem irgendwas versprochen!
Sie knetete den warmen Kristall in ihrer geballten Faust, bis in dessen Wärme der Zorn taute, von dem ihr kalt und einsam zumute war.
Wieder ruhiger, ließ sie den Blick zu den wunderhübschen blauen Zelten der Indigo-Herde wandern. Dank der ganz eigenen, individuellen Farben der Zelte fand sie, von weitem sahen sie aus wie Wasser, auf dem die Sonne spielte. Ihre heutige Flagge strahlte im süßen, reinen Blau eines Sommertags, von dem sich sehr schön das kunstvoll verschlungene Muster in der Mitte abhob, das die hohe Kunst der Heilung symbolisierte, in der die Indigo-Herde sich auszeichnete.
Jede der fünf Großen Herden war ein einzigartiger Teil eines Ganzen – völlig unterschiedlich, und doch hingen sie alle voneinander ab. Sie handelten miteinander, kreuzten die Zuchtlinien ihrer Pferde, gingen untereinander Partnerschaften ein – sie gehörten zusammen und waren doch jede in sich geschlossen.
Kann das nicht auch für mich gelten? Kann ich nicht Teil der Herde sein, ohne mich an eine bestimmte Person zu binden? Das war etwas, was River verwirrt hatte, seit sie und ihre Freundinnen begonnen hatten, Brüste zu bekommen und jeden Mond zu bluten. Körperlich hatte diese Veränderung River ebenso betroffen wie die anderen Mädchen, aber anders als diese hatte sie sich geistig nicht verändert – oder zumindest nicht sehr.
Der Mittelpunkt ihres Denkens war derselbe geblieben: erwählt zu werden. Sie wollte zu einer Windreiterin werden, auf die ihre Mutter und die Herde stolz sein konnten. Die anderen Mädchen? Die verrichteten zwar ihre Aufgaben für die Gemeinschaft, aber während sie alle früher Windreiterinnen gespielt und sich vorgestellt hatten, wie sie gemeinsam über die Hochgrasprärie jagten und die Magenti-Herde unter ihrer Führung blühte und gedieh, brachten sie heute ihre Pflichten so schnell wie möglich hinter sich, damit sie sich herausputzen und mit Jungs flirten konnten, die sie noch vor gar nicht langer Zeit viel zu doof und unreif gefunden hatten, um auch nur mit ihnen befreundet zu sein.
River fand es lächerlich, sein Leben so von sinnlichen Begierden beherrschen zu lassen. Sie seufzte. Wenn sie ganz ehrlich war, musste sie sich eingestehen, dass ihre Freundinnen offenbar sie für lächerlich hielten, weil sie niemanden begehrte.
Ausprobiert hatte sie ja schon einiges. Ehe Clayton zu seiner Kriegerausbildung zur Cinnabar-Herde gereist war, hatte sie sich von ihm küssen lassen – sogar mehrmals. Die Küsse waren ganz okay gewesen. Nicht atemberaubend, aber auch nicht eklig. Einfach ganz okay. Definitiv nichts, wovon man schwärmen oder worüber man kichern musste.
Auch Gretchen hatte River geküsst, eine ihrer Kindheitsfreundinnen, die keinen Hehl daraus machte, dass sie sowohl Jungs als auch Mädchen toll fand. Es war nett gewesen, wie weich Gretchen sich anfühlte und wie hübsch sie war, doch wiederum waren die Küsse einfach bloß ganz okay gewesen.
»Ich verstehe beim besten Willen nicht, was für ein Aufhebens die alle darum machen. Mir hat noch kein Kuss so viel gegeben – solche Spannung, solche Freude und Erfüllung –, wie wenn ich bei den Pferden bin. Warum soll das so schlecht sein, warum verstehen es weder meine Freundinnen noch Clayton?«, fragte sie in die wärmer werdende Luft hinein, während sie die geballte Pracht der fünf Windreiterherden bewunderte.
Da wurde ihr schlagartig bewusst, wie sonnig der Morgen bereits war und welch geschäftiges Treiben unten auf der Prärie herrschte. Sie rannte den Abhang hinab und hetzte in die Spirale der Zelte hinein, dem Violett der Magenti-Herde entgegen.
»Halt still, ich bin fast fertig!«, mahnte Dawn, als River sich ungeduldig bewegte.
»Mutter, ich sehe wunderbar aus. Ich habe schon viel zu viele Bänder im Haar. Wir kommen zu spät!«
»Man kann nie zu viele Bänder im Haar haben«, sagte Tante Heather, die soeben ins Zelt kam. »Aber River hat recht. Die Debütanten versammeln sich. Unsere ganze Herde ist schon dort und bereit, uns zuzujubeln. Wir sollten gehen.«
»Geh schon mal mit den Mädchen voraus, Heather. River und ich kommen gleich nach. Dort wird nichts anfangen, bevor nicht alle Leitstutenreiterinnen da sind – vor allem wenn die Tochter von einer von ihnen präsentiert wird«, gab ihre Mutter unbeeindruckt von all der Nervosität ringsum zurück.
»Mutter, bitte. Lass uns gehen. Jetzt. Meine Freunde sind schon alle dort.«
»Das Letzte, worum du dir heute Gedanken machen solltest, ist, was andere gerade tun oder denken.« Ihre Mutter lächelte, um den Tadel zu lindern. »Sie werden warten. Ich wette, die Tochter der Cinnabar-Leitstutenreiterin, die heute debütiert, ist auch noch nicht dort.« Dawn trat zurück und musterte River. »So. Fast perfekt.«
»Fast?« River musste sich im Zaum halten, um nicht loszujammern oder aus dem Zelt zu stürmen.
»Ja, fast. Keine Sorge, ich weiß genau, was noch fehlt.« Sie ging zu der abgenutzten Reisetruhe hinüber, die auch als Tisch diente, zog das violette Tuch darüber zur Seite, öffnete den Deckel und fand in einer der Schubladen sofort, was sie suchte. Mit einer funkelnden Halskette in den Händen ging sie auf ihre älteste Tochter zu. »Das hier ist das gewisse Etwas.«
»Oh! Großmutters Kette! Ich dachte, sie wäre mit ihr begraben worden.«
»Nein.« Einen stummen Moment lang strich Dawn respektvoll über die Kette. »Sie hat eigens darum gebeten, dass dieser Schmuck nicht mit ihr in die Graslande des Jenseits kommen solle. Sie wollte, dass du ihn zu deiner Präsentation trägst.«
»Glaubst du nicht, Großmutter wollte, dass ich sie nur trage, wenn ich erwählt werde?« Wehmütig sah River die Kette an, die sie in den fünf Jahren seit Großmutters Tod nicht mehr zu Gesicht bekommen hatte. Sie war noch ebenso schön, wie sie sie in Erinnerung hatte. Silberne Perlen, in die winzige Umrisse von Pferden geritzt waren, wechselten sich mit den herrlichsten Amethysten ab, die River je gesehen hatte: vom leuchtenden Violett blühenden Flieders, jeder Stein so groß wie ein Walnusskern, flach und so geschliffen, dass er das Licht einfing und damit spielte.
»Nein. Deine Großmutter hat sich unmissverständlich ausgedrückt. Sie sagte: Gib sie River am Morgen ihrer Präsentation und dazu einen Kuss voller Liebe von mir. Jetzt dreh dich um und lass sie dir umlegen.«
River wischte sich die Tränen aus den Augen und gehorchte. Schwer und beruhigend legte die Kette sich ihr um den Hals. River tastete nach dem größten Stein, der vorn in der Mitte hing. Zuerst fühlte die glatte Oberfläche sich kühl an, doch schon nach wenigen Augenblicken spürte sie, wie sie sich erwärmte und mit ihrem Herzschlag zu pochen begann.
Ihre Mutter drehte sie um und musterte sie noch einmal, und nun glänzten in ihren Augen Tränen. Danach hielt sie ein Stück kostbares poliertes Glas so in die Höhe, dass Mutter und Tochter gemeinsam hineinblicken konnten.
Wieder berührte River den Stein in der Mitte. Auf ihrer dunklen Haut sah die Kette ihrer Großmutter einfach atemberaubend aus. Dawn, die es schon immer hervorragend verstanden hatte, ihr die Bänder der Herde in die schwarze Lockenmähne zu flechten, hatte an diesem Morgen besonders herrliche Arbeit geleistet: Auf dem Kopf bildeten die bebänderten Zöpfe ein festes, kunstvolles Muster, aber dann fielen ihr die Locken frei über den Rücken, dazwischen verteilt die violetten Bänder, die mit kostbarem silbernen Haar aus Mähne und Schweif von Mutters Stute bestickt waren. Selbst River, die sich kaum je Gedanken um ihr Aussehen machte, musste zugeben, dass all das über ihren jugendlich zarten Schultern faszinierend aussah. »Bin das wirklich ich?«
Dawn wischte sich eine Träne aus den Augen und legte den Arm um ihr geliebtes ältestes Kind. »Bist du. Und du bist wunderschön.« Sie küsste River auf die Stirn. »Der hier ist von deiner Großmutter.« Zart drückte sie ihr einen zweiten Kuss auf die Lippen. »Und der hier von mir. Denk daran, ich werde immer stolz auf dich sein. Alles, was ich mir von dir wünsche, ist, dass du stets gütig und ehrlich bist und dein Bestes tust.«
»Aber wenn ich nicht erw…«
»Nein!«, schnitt ihre Mutter ihr das Wort ab. »Das sage ich völlig unabhängig von den Jährlingen. Ich sage es zu meiner Tochter, auf die ich sehr, sehr stolz bin und immer sein werde. Sei heute ruhig, ganz bei der Sache und offen für alles. Sei du selbst. Das ist alles, was ich und jeder Jährling von dir verlangen können.«
»Ich bin so nervös.«
»Ich auch!« Sanft strich ihre Mutter ihr über die Wange. »Aber nicht, weil ich mir Sorgen wegen der Präsentation mache – was die angeht, habe ich keinen Zweifel. Ich bin nervös, weil mein ältestes Kind heute erwachsen wird. Da kommen Echo und ich uns sehr alt vor.«
Wie aufs Stichwort hin steckte die Leitstute den Kopf durch den Türvorhang des Zelts und schnaubte ungeduldig.
River lachte und wischte sich die letzten Tränen ab. »Ich weiß, Echo! Erzähl das Mutter. Sie hat eine Ewigkeit mit meinen Haaren gebraucht.«
Rivers Mutter trat zu ihrer Stute und kraulte deren breite Stirn. River fand das Tier heute besonders schön mit den vielen violetten Bändern in der silbernen Mähne, die ihr in anmutigen Wellen über das makellose Fell fiel – ein Fell, so strahlend weiß, dass es in der Herde oft als silbern bezeichnet wurde. Mit dem samtenen aschgrauen Maul begann Echo, an der Schulter ihrer Reiterin zu knabbern, fand den Träger von deren reich bestickter violetter Tunika und zog daran.
Dawn musste lachen. »Schon gut! Wir sind ja fertig.«
River folgte ihrer Mutter aus dem Zelt. Mit flatterndem Magen ließ sie den Blick über die leeren Zelte ringsum schweifen.
»Meine geliebte Tochter, schau nicht so nervös. In dir fließt das Blut eines weithin bekannten Geschlechts von Leitstutenreiterinnen – wie jeder weiß. Also denk daran, wer du bist und was du repräsentierst. Halte dich aufrecht.«
»Ich denke daran«, sagte River feierlich und versuchte, sich so gut wie möglich zu beruhigen.
»Echo, meine Hübsche, zeigen wir den Herden, wie die Tochter der Leitstutenreiterin der Magenti-Herde debütiert.«
Echo ging in die Knie. Dawn wandte sich ihrer Tochter zu und deutete auf die silberne Stute. »Steig auf. Nun mach schon.«
»Aber, äh, willst nicht du …« River starrte die bezaubernde Stute an. Es geschah nur selten, dass Echo von jemandem außer ihrer Mutter geritten wurde, erst recht dann, wenn auch die anderen Herden anwesend waren.
»Oh, ich bleibe neben euch. Aber heute ist dein Tag, und Echo und ich möchten dieser Tatsache gerecht werden.«
»Danke, Mutter. Danke, Echo. Ich … ich hoffe nur, ich enttäusche euch nicht.«
Echo schnaubte River an und schlug mit dem Schweif.
»Genau meine Meinung«, sagte Dawn. »Lass das Unken. Tochter, denk daran: Es reicht völlig aus, du selbst zu sein – genau wie du es gerade jetzt bist. Der Rest liegt in der Hand der Großen Mutterstute. Nun steig auf, beeil dich. Wir kommen zu spät!«
»Sag ich doch schon die ganze Zeit«, murmelte River, ging auf Echo zu, griff in die bebänderte Mähne und schwang sich mühelos auf ihren Rücken.
Echo stand auf, und ihre Mutter trat neben sie. Als Dawn sich in Bewegung setzte, tat Echo es ihr nach. Hoch aufgerichtet strahlten Leitstute und Leitstutenreiterin der Magenti-Herde unvergleichliche Kraft und Schönheit aus. Automatisch straffte River den Rücken, ließ sich in den tiefen Sitz gleiten und schloss die Schenkel um die Seiten der Stute, ihre nackte Haut auf Echos silberweißem Fell. Selbst wenn sie wie jetzt im Schritt ging, war die unleugbare Anmut des Tiers zu spüren, und River wusste, dass sie und Echo ein atemberaubendes Bild abgaben. Ihr Herz platzte fast vor Stolz, als sie in den Weg zur großen Präsentationsarena einbogen und vor dieser noch einmal haltmachten. Ihre Tante sah sie zuerst. »Da ist River auf Echo! Magenti!«
»Magenti!« – »River auf unserer Echo! Magenti!«, erhoben sich ringsum Jubelrufe. Echo bog den Hals noch anmutiger und tänzelte auf der Stelle.
»Lauf, meine Schöne – bring River an ihren Platz.« Dawn klopfte der Stute den Hals. Dann sah sie mit Stolz in den Augen zu ihrer Tochter auf. »Halt dich fest. Du weißt, Echo setzt sich gern in Szene. Sitz aufrecht und stolz, zeig allen Herden, wie sehr sie und ich dich schätzen. Echo und ich wünschen dir das Glück der Stute, Tochter.«
River wollte ihrer Mutter danken, aber Echo hatte beschlossen, dass es jetzt endgültig reichte. Mit erhobenem Schweif stob die anmutige Stute auf das flache, grasbewachsene Feld hinaus und galoppierte unter dem Jubel der gesamten Magenti-Herde und vieler Mitglieder der anderen Herden einmal um den Kreis derer, die bereits ihre Präsentation erwarteten. River war, als flöge sie. Sie nahm wahr, dass die ansteigenden steinernen Sitzreihen rings um die Arena komplett mit Menschen gefüllt waren, alle in festlicher Kleidung und herausgeputzt mit Bändern, Perlen und Juwelen in den Farben ihrer Herde. Ganz oben auf dem äußeren Rand der Arena standen Pferde mit aufmerksam gespitzten Ohren, warteten gespannt in freudiger Erwartung, deren Süße River buchstäblich im Wind zu schmecken glaubte.
Vor der Gruppe der Kandidaten in Magenti-Violett kam Echo zum Stehen. Rasch saß River ab, umarmte die silberne Stute und nahm ihren Platz zwischen den anderen jungen Leuten ihrer Herde ein.
»Na endlich!«, sagte ihre Herdenschwester Skye und rückte etwas beiseite. »Wir dachten schon, es wäre was passiert.«
»Mutter wollte unbedingt, dass ich absolut perfekt aussehe. Ist die Tochter der Leitstutenreiterin von Cinnabar schon da?«
»Ja. Du bist die Letzte.«
River nickte stumm. Die Verspätung lag einzig an ihrer Mutter, aber das Skye jetzt zu erklären hätte wenig Sinn gehabt. Stattdessen sah sich River in dem großen Kreis der Kandidaten um. Sie waren nach Herden gruppiert – violett, blau, rot, gelb und grün – und versuchten alle mit wenig Erfolg, nicht nervös zu wirken … oder verängstigt.
River sah Skye an. »Das Glück der Stute sei mit dir, Skye.«
»Äh, danke. Mit dir auch«, gab Skye zurück, sichtlich, ohne es so zu meinen.
Unverdrossen wandte River sich dem Jungen links von sich zu. Sie erkannte ihn als Claytons Cousin Rex. »Das Glück der Stute sei mit dir, Rex.«
»Oh, danke, River.« Er wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Ich will nur noch, dass das Ganze endlich rum ist. Dieses Warten ist die reinste Folter. Hast du die Zahlen mitbekommen?«
»Nein.«
»Es gibt hundertneunundzwanzig Kandidaten und nur neunundneunzig Jährlinge. Das heißt, dreißig von uns werden keine Reiter werden«, informierte er sie gequält und wischte sich wieder über die Stirn.
»Nur neunundneunzig Fohlen? Die letzte Zahl, die ich gehört hatte, war hundertfünf oder so. Was ist passiert?« Sie richtete die Frage in die Runde, aber wen sie wirklich hätte fragen mögen, war ihre Mutter. Warum hat mir niemand gesagt, dass plötzlich so viele Jährlinge fehlen?
»Es gab einen Zwischenfall in der Jonquil-Herde. Anscheinend sind ein paar Fohlen auf dem Weg hierher in ein Pfeilgrasgebüsch geraten.«
»Pfeilgras? Wie schrecklich! Haben sie überlebt?«
»Ja, dank der Großen Mutterstute, aber sie sind noch nicht wieder fit genug, um an der Präsentation teilzunehmen. In ein paar Wochen wird Jonquil ein besonderes Treffen abhalten, und alle Kandidaten, die jetzt leer ausgehen, dürfen teilnehmen. Dass du davon nichts mitbekommen hast!«
»Ich war viel allein, seit wir hier sind – du weißt schon, meditieren, mich vorbereiten. Wahrscheinlich hat einfach niemand daran gedacht, mir …«
Die Worte blieben ihr im Hals stecken, als eine uralte Stute steif in die Arena trottete. Ihre Reiterin war ebenso alt und grau wie das Tier – und ebenso wohlbekannt. Morgana war die Älteste im Rat der Stuten. Von ihrer Stute Ramoth hieß es, sie sei die älteste Stute in allen fünf Herden. Niemand kannte ihr genaues Alter oder das ihrer Reiterin, aber ihre gemeinsame Weisheit war legendär.
Stute und Reiterin trugen Bänder in allen fünf Farben, das Zeichen dafür, dass sie dem Rat der Stuten angehörten. Die Kandidaten verneigten sich respektvoll vor ihnen. Dann hob die alte Frau die Hand, und Schweigen fiel über die Menge.
»Kandidaten, tretet auseinander, so dass wenigstens eine Armeslänge Platz zwischen euch ist!«, rief Morgana mit tiefer, kräftiger Stimme. Unverzüglich breiteten River und die anderen einhundertachtundzwanzig Jugendlichen die Arme aus und traten nach außen, bis der Kreis größer und nicht mehr so gedrängt war. »Gut. Und jetzt setzt euch hin!« Alle Kandidaten ließen sich mit gekreuzten Beinen nieder. Die alte Frau hob die Arme zum Himmel und sprach den Segen. »Große Mutterstute und Vater Hengst, leitet die Jährlinge zu den Reitern, die für sie bestimmt sind – seid mit ihnen in Weisheit, Liebe und Freude! So sei es!«
»So sei es!«, wiederholte jede Stimme der versammelten Herden.
»Und nun mag es beginnen. Kandidaten, ich wünsche euch das Glück der Stute. Lasst die Jährlinge los!«
River holte tief Luft. Automatisch glitt ihre Hand zu dem größten Amethyst vorn an der Kette ihrer Großmutter. Ich bin ruhig. Ich bin gefasst. Ich bin bereit. Meine Gedanken sind klar, und ich bin offen für alles, was auch immer jetzt passieren wird.
Der Boden vibrierte vom vertrauten Donnern von Hufen, das sich zum Staccato von Rivers Herzschlag gesellte. Alle Augen richteten sich auf den Eingang der Arena – und dann stürmte die Herde der Jährlinge in vollem Galopp auf das Feld. Die Kandidaten saßen ganz still, während die jungen Pferde zwischen ihnen hindurchtrabten und sich nach und nach in der Kreismitte sammelten.
Bei ihrem Anblick konnte River kaum ihre Erregung im Zaum halten. Wie herrlich sie waren! Hier standen die besten Jungtiere, die jede Herde zu bieten hatte. Geboren waren sie im vorigen Frühling, vor einem Jahr, und waren von Anfang an bestens umsorgt worden. Man hatte sie das ganze Jahr bei ihren Müttern gelassen und erst vor zwei Tagen von diesen getrennt. Den Fohlen war bewusst, was geschah und dass es Zeit für sie war, ihre Mütter zu verlassen und erwachsen zu werden, doch waren auch sie sichtlich nervös.
River verstand sie nur zu gut. Sie waren einsam – sie vermissten ihre Mütter und die Aufmerksamkeit, mit der ihre Herde sie ein Jahr lang überhäuft hatte. Andererseits wussten die jungen Pferde, dass sie, wenn sie den Kreis verließen, für immer ein Band mit einem Menschen eingegangen sein würden – und weder Mensch noch Pferd würden dann je wieder einsam sein.
Auch die Ratsälteste und ihre uralte Stute ritten in den Kreis, bewegten sich zwischen den Fohlen, sprachen ihnen zu, beruhigten sie, bereiteten sie auf die Präsentation vor.
Mit dem Blick suchte River unter den Tieren nach den Jährlingen der Magenti-Herde. Magenti war eine der größten Herden; sie besaß fünf Zweige, jeder davon mehrere hundert Menschen und etwa halb so viele Pferde stark. Insgesamt hatten sie dreißig Jährlinge zu dem Treffen beigetragen. Fünfzehn davon stammten aus Rivers Zweig, Magenti-Mitte, der am größten war und momentan auch die Leitstute und deren Reiterin stellte.
Sie wusste genau, welchen Jährling sie suchte, obwohl sie nie zugegeben hätte, dass sie einen Favoriten hatte – wenigstens niemand anderem gegenüber.
Da! Endlich fand sie ihn – jenes herrliche Palomino-Hengstfohlen, das über das letzte Jahr immer wieder in Gesprächen erwähnt worden war. Seine Färbung war das Erste, was üblicherweise an ihm auffiel. Er war so leuchtend sandfarben, dass er buchstäblich golden schimmerte, und Mähne und Schweif waren fast makellos weiß. Er stand ein wenig abseits der anderen und scharrte rastlos mit den Hufen. Noch hatte er keinen Namen – erst sein Reiter würde diesen nach der Wahl erfahren –, daher nannte River ihn bei sich Ghost, weil er so schnell war und sich fast lautlos zu bewegen verstand. Schon auf den ersten Blick sah man, dass er das größte der Hengstfohlen war, doch wirkte er weder unproportioniert noch hager. Anders als bei den meisten Jährlingen waren seine Bewegungen selbstsicher. Während sie im vergangenen Jahr geholfen hatte, sich um die Pferde zu kümmern, und täglich mit den Fohlen umgegangen war, hatte River nicht einmal bemerkt, dass er auch nur aus dem Tritt gekommen wäre.
Als spürte er ihre Aufmerksamkeit, wandte der junge Hengst ihr den Kopf zu und erwiderte ihren Blick. Seine dunklen Augen waren wach und klug und noch mehr – etwas lag darin, was ihr beinahe vorkam wie Trauer. Ehe sie weiter darüber nachdenken konnte, erhob die alte Ratsfrau wieder die Stimme.
»Denkt daran, Kandidaten, verlasst den Kreis nicht, bis ihr selbst erwählt wurdet oder der letzte Jährling gewählt hat.« Dann drehte sie Ramoth den Fohlen zu. Die alte Stute bog den Hals, warf den Kopf zurück und stieß einen Ruf aus, der von allen Pferden im Zuschauerrund aufgenommen wurde. Die Wahl begann.
Rivers Welt schrumpfte auf den Boden direkt vor ihr. Durch tiefe Atemzüge gelang es ihr, ruhiger zu werden. Sie ließ den Amethyst um ihren Hals los, und ihre Hand wanderte zu der Tasche, in der stumm das fingerförmige Phantom lag. Ihr Herzschlag verlangsamte sich. Ihre Nervosität fiel von ihr ab, versickerte im Boden und zerstreute sich.
Links von ihr ertönte ein Freudenschrei. River sah auf. Vor einem Mädchen, das die blutroten Bänder der Cinnabar-Herde trug, war eine kleine Fuchsstute zum Halten gekommen und streckte das Maul nach ihm aus. Ohne zu zögern, erhob das Mädchen sich auf die Knie, nahm das zarte Köpfchen der Stute in die Hände und blies ihr sanft ins samtene Maul. Das Band zwischen den beiden war besiegelt. Die Cinnabar-Herde brach in Jubel aus, als die frischgebackene Reiterin aufstand und die Arme um ihre Gefährtin schlang. Seite an Seite verließen Tier und Reiterin den Kreis, um sich ihrer Herde zuzugesellen. Im nächsten Moment brachen auch die Indigo- und Virides-Herde in Jubel aus, als weitere Jährlinge ihre Reiter fanden.
River kam es vor wie eine Ewigkeit, aber später sagte ihre Mutter ihr, dass die gesamte Präsentation nur wenige Minuten gedauert hatte. Die Herde der Fohlen war auf wenige Dutzend Tiere geschrumpft, die mit aufgestellten Ohren im Zentrum des Kreises standen und die noch sitzenden Kandidaten musterten. Langsam bewegten sie sich dabei im Kreis, um das ganze Rund absuchen zu können. Ab und zu schnaubte ein Jährling, warf den Kopf zurück und trabte auf einen Kandidaten zu, und wieder erhob sich Jubel aus der gespannten Menge.
Plötzlich wieherte der Palomino, den River Ghost nannte, schrill auf, stieg und scherte aus dem Kreis der Jährlinge aus. In vollem Galopp umkreiste er die wartenden Kandidaten, wobei er Gras und Erdklumpen aufwirbelte. Skye rechts von River duckte sich mit einem Schrei zur Seite und wischte sich spuckend einen hufgroßen Klumpen Dreck vom Gesicht. River wollte sich zu ihr beugen und ihr helfen, da trabte eine Apfelschimmelstute aus der Magenti-Herde, die sichtlich verstört wirkte, auf Skye zu und bot dieser ihr Maul dar. Hastig wischte Skye sich den letzten Rest Erde vom Gesicht, beugte sich eifrig nach vorn, blies der Stute sanft in die weichen Nüstern und warf ihr die Arme um den Hals. »Alles gut! Keine Sorge, Scout! Jetzt kann mir nichts mehr etwas anhaben, jetzt bin ich deine Reiterin!«, hörte River sie ihrer soeben gebundenen Stute zuflüstern.
Ein Luftschnappen der Zuschauer lenkte ihre Aufmerksamkeit wieder auf das Palomino-Fohlen. Der kleine Hengst wirkte immer verzweifelter. Er hatte nun dem Kreis ganz den Rücken zugewandt und donnerte von einer Seite der riesigen Arena zur anderen, ohne Rücksicht auf die anderen Jährlinge, die vor ihm auseinanderwichen. Die Ratsälteste und ihre Stute bemühten sich, an ihn heranzukommen und seiner steigenden Erregung entgegenzuwirken – ohne Erfolg. In seinen Augen war das Weiße zu sehen, und immer wieder wieherte er laut und panisch, als suche er nach jemandem und finde ihn nicht. Und dann tat er etwas wahrhaft Absonderliches. Er verlangsamte und schritt noch einmal den Kreis ab. Nicht in panischem Galopp. Sondern ganz langsam, wobei er jeden Kandidaten ganz genau musterte. Als er River erreichte, sah sie auf und schaute ihm in die dunklen klugen Augen.
Was sie dort erblickte, brach ihr fast das Herz.
Der Jährling weinte. Über sein goldenes Gesicht rollten Tränen.
»Oh, Ghost! Was ist los? Was quält dich so?«, platzte sie heraus.
Der Hengst wurde noch langsamer, und einen Moment setzte ihr Herzschlag aus, und sie dachte, er würde ihr sein Maul darbieten. Doch er warf den Kopf zurück, schnaubte und schritt weiter den Kreis ab. Als er einmal ganz herum war, erstarrte er wieder. Nun stand er River genau gegenüber. Zwischen den wenigen Fohlen, die noch übrig waren, konnte sie ihn genau sehen. Er stieg und schlug mit den Vorderhufen, als kämpfe er gegen einen unsichtbaren Feind an. Und dann galoppierte er los, geradewegs auf River zu!
Vor Entsetzen verharrte sie reglos. Aus der Menge glaubte sie ihre Mutter ihren Namen schreien zu hören, aber sie konnte sich nicht bewegen. Der Jährling würde sie zu Tode trampeln.
Im letzten Moment sprang er ab, flog mühelos über Rivers Kopf hinweg, jagte auf den Ausgang zu und verschwand aus der Arena.
In betäubtem Schweigen starrten alle – Fohlen, Kandidaten und Zuschauer – dem Hengstfohlen hinterher. Noch nie hatte River gehört, dass ein Jährling sich keinen Reiter ausgesucht hätte, und sie wusste genau, dass noch nie ein Fohlen während der Präsentation geflohen war.
Schon hörte sie, wie das Gerede begann.
»Der ist verrückt.«
»Mit dem stimmt was nicht.«
»Sieht ja gut aus, aber er hat einen Schaden, kein Zweifel.«
Fohlen, die irgendein Gebrechen hatten – sei es geistig oder, was weitaus öfter vorkam, körperlich –, waren die einzigen, die sich keine Reiter suchten. Solche versehrten Tiere erreichten meist nicht die volle lange Lebensspanne gesunder Pferde. Gewöhnlich erkannten sie und ihre Mütter diesen Mangel selbst. Sie wurden nicht bei den Treffen vorgestellt, sondern blieben bei ihrer ursprünglichen Herde, wo man sich gemeinschaftlich um sie kümmerte, sie umsorgte und umhegte, bis der frühe Tod sie ereilte. Aber Ghost war ein gesundes, intelligentes Tier.
Das war total absurd. Als suchte er nach seinem Reiter und könnte ihn nicht finden.
Noch während sie auf ihrer Unterlippe herumkaute und sich fragte, was es mit der Traurigkeit in Ghosts Augen auf sich gehabt hatte, fiel ein Schatten über sie.
Sie sah auf.
Vor ihr stand ein wunderhübsches Stutfohlen mit hellgrauem Fell – fast schon weiß – und schwarzgrau gesträhnter Mähne. Auch ihre Beine wurden nach unten hin dunkler, von Weißgrau zu Schwarz. Für eine Jährlingsstute war sie groß. River kannte sie nicht, aber ihre breite Stirn, ihre gut bemuskelte Brust und ihre geraden, perfekt geformten Beine verrieten unzweifelhaft, dass in ihr dasselbe Blut fließen musste wie in Echo.
Und River konnte sie spüren. Die Stute war aufgeregt und nervös – ängstlich und froh zugleich.
»Alles gut, meine Süße – alles ist gut«, redete River ihr automatisch zu.
Und dann geschah das Wunderbarste, was River je erlebt hatte. Der Jährling – diese absolut perfekte, herrliche, intelligente Stute – bot ihr das Maul dar.
River erhob sich auf die Knie, streckte die Arme aus und legte dem Fohlen die Hände an die Wangen, und dann blies sie zärtlich in deren samtene Nüstern.
Mit dem nächsten Atemzug, den Pferd und Reiterin gemeinsam taten, verbanden sich unwiderruflich ihre Seelen, ihr Leben, ihr Schicksal. Eine Woge wilden, glücklichen Kribbelns durchströmte River, und in ihrem Geist ertönte wie ein magischer Fanfarenstoß ein Wort – ein Name.
»Anjo! Meine Anjo!« River stand auf, schlang die Arme um den Hals ihrer Gefährtin und vergrub das Gesicht in deren warmer duftender Mähne, umtost von den Jubelrufen der Magenti-Herde.
2
Gegenwart – Höhenzug über der Stadt in den Bäumen
»Die Schnitter sind bereit, mein Gebieter. Sie warten nur noch auf den Sonnenuntergang und deinen Befehl.« Tief verneigte sich Stahlfaust vor seinem Anführer – und Gott.
Der Gott des Todes würdigte ihn kaum eines Blickes. »Hervorragend. Sag ihnen, sie sollen sich weiter verborgen halten und auf mein Signal warten. Ich werde vorausgehen und kundschaften.« Daraufhin schritt Tod davon, ohne sich zu vergewissern, ob der Schnitter Stahlfaust, sein Stellvertreter, dem er den Titel »Klinge« verliehen hatte, seinen Befehl weitergeben würde. Das war unnötig. Stahlfaust wusste genau, dass es ihn das Leben kosten würde, Tods Befehlen nicht Folge zu leisten.
Tod erklomm den Grat, von dem aus man einen guten Blick auf die zentrale Partie des Gebiets hatte, das der Stamm des Lichts bewohnte. Im Gegensatz zu den Männern, die sich ein Stück hinter ihm hielten, duckte er sich nicht. Verbarg sich nicht. Offen trat er an den Rand des Grats und blickte auf die verbrannten, geschwärzten Reste dessen hinab, was einst eine Stadt gewesen war.
»Alles vernichtet«, murmelte er vor sich hin. »Welch törichte Verschwendung.« Angewidert schüttelte er den Kopf, wobei sein massives Geweih bizarre, missgestaltete Schatten über die nächsten Bäume warf. »Nun, sei’s drum. Ich werde die Stadt in den Bäumen wiederaufbauen, herrlich und prächtig, wie es sich für die Heimstatt eines Gottes gehört.« Tod hob den gewaltigen Dreizahn an, den er aus der Hand der leblosen Statue gerissen hatte, die sein Volk verehrt hatte. »Nie wieder wird das Volk totes Metall anbeten«, schwor er sich leise. »Nun weiß es, wie es ist, einem wahren Gott zu folgen. Nun weiß es, was wahre Macht ist. Und bald wird es wissen, wie sich ein wahrer Sieg anfühlt.«
Tod blickte sich um. Er wünschte, die Sonne würde sich beeilen und endlich hinter den Horizont sinken. Schon nahm der Himmel eine dunklere Färbung an, nicht mehr das strahlende Blau des Eichelhähers, sondern ein mattes Taubenblau.
»Täubchen …«, knurrte Tod, während er sich nach links wandte, immer ein wachsames Auge auf die dunkle Ruinenstadt gerichtet. »Ich muss etwas wegen Täubchen unternehmen. Sie scheint nicht ganz zu begreifen, welche Rolle sie in unserer Zukunft spielen wird.« Vor seinem inneren Auge sah er sie vor sich – ihr ebenmäßiges, augenloses Gesicht, ihre perfekte Haut. Ja, ihr Leib war in der Tat ein ideales Gefäß für seine geliebte Göttin – und als Göttin des Lebens würde diese ihrem Gefäß sicherlich Augen verleihen. »Doch ihr Verhalten ist untragbar.« Tod machte eine schnelle Bewegung mit den Schultern, wie um Stechmücken zu verscheuchen. »Ich war zu nachsichtig mit ihr. Sie braucht dringend eine Lektion in Gehorsam.«
Mit diesem Beschluss wanderte der Gott des Todes gemächlich den Grat entlang, wobei er unten nach Lebenszeichen des Stammes spähte. Aber alles, was er sah, waren die Ruinen der einst so mächtigen Stadt. Der Wind trieb nicht die Laute geschäftigen, frohen Treibens an seine Ohren. Alles, was zu ihm aufstieg, war der Gestank nach Rauch und Aas.
»Wo sind eure Späher?«, fragte Tod die verkohlten Bäume drunten. »Wo sind die großen Krieger, die einst so mächtig und schrecklich waren, dass mein Volk sich nicht aus seiner verseuchten Stadt heraustraute?«
Wie als Antwort blitzte es im Wald grell auf, ein strahlendes Leuchten, das ihn sofort an Sonnenlicht erinnerte.
»Noch ein Feuer? Bringen die Anderen es etwa fertig, nun auch den übrigen Wald in Brand zu setzen?« Ein hohles Grauen breitete sich in dem Gott aus. Er hatte darauf gebaut, dass noch genug von der Stadt in den Bäumen übrig sein würde, um sein Volk von Hafenstadt in den Wald umzusiedeln, sobald seine Schnitter und er die kümmerlichen Reste der Anderen besiegt hätten. Tod beschleunigte seinen Schritt. »Nein. Ich muss verhindern, dass der Rest der Stadt verbrennt.«
Nicht lange, und er sah durch die geschwärzten Stämme grünes, lebendes Laub durchschimmern. »Da bist du ja, Stamm des Lichts. Ich sehe, es ist durchaus noch etwas von eurer Stadt im Himmel unversehrt geblieben.« Der Gott spähte hinab.
Zuerst begriff er nicht so recht, was sich seinen Augen bot. Die Anderen hatten sich um einen riesigen Baum jenseits der Brandgrenze versammelt. Und inmitten eines Kreises von etwa fünfzig Menschen, die wütend durcheinanderriefen, stand sie. Alle übrigen Anderen schienen unschlüssig oder verwundet; sie lagen auf Strohlagern oder einfach auf dem Boden, ihre Hunde neben sich. Tod beachtete sie nicht. Seine ganze Aufmerksamkeit richtete sich sofort auf das Mädchen.
Sie stand inmitten eines Kreises aus Flammen – doch schien das Feuer ihr nicht das Geringste anhaben zu können.
Ihr zur Seite standen ein junger Mann, der einige blutende Wunden hatte, und zwei große Hunde. Auch von ihnen schien keiner Schaden durch das Feuer zu nehmen, über das sie irgendwie gebot.
Die Krieger der Anderen versuchten, sich ihr zu nähern – ohne Erfolg. Da beschossen sie das Mädchen mit Pfeilen, aber die Sphäre aus Flammen hielt auch diese ab. Kaum nahe genug, verglühten sie zu Asche.
»Was ist sie?«, flüsterte Tod.
Da setzte das Mädchen sich in Bewegung. Der Flammenschild bewegte sich mit ihr. An der Grenze der verbrannten Zone angelangt, beschleunigten sie und ihre Begleiter den Schritt. Die zornigen Anderen folgten ihnen, waren allerdings wegen der Hitze der Flammen gezwungen, Abstand zu halten.
Hoch über ihnen, von niemandem bemerkt, folgte Tod dem ahnungslosen Mob, immer faszinierter von dem Mädchen, das über das Feuer gebot.
Als er an Stahlfaust vorbeikam, der im Gebüsch wartete, pfiff er scharf. Seine Klinge kam herbeigeeilt – und bekam große Augen, als ihr Blick dem des Gottes folgte.
»Was für eine Zauberei ist das?«, hauchte Stahlfaust gedämpft.