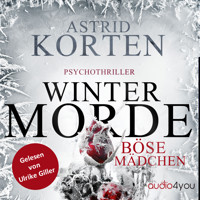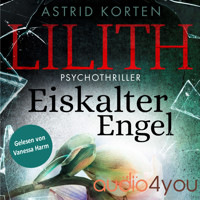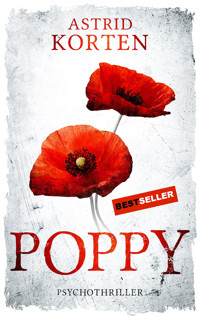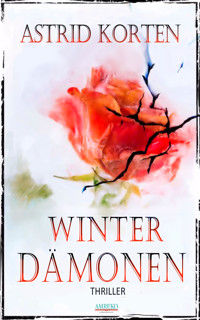
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein außergewöhnlicher Profiler Ein tödliches Spiel Auf der Suche nach seiner Ehefrau erhält der freiberufliche Profiler Ibsen Bach in Edinburgh einen Anruf aus dem Kreml. In Moskau engagiert ihn General Sorokin, die Mörder seiner Tochter Leonela zu finden. Überzeugt, dass die junge Bloggerin in Gefahr ist, aber noch lebt, akzeptiert Ibsen den Auftrag, da Leonela ihm einst das Leben gerettet hat. Mit Pola Kamorow, seiner verstörenden Partnerin, leitet er die Ermittlungen ein. Beide erkennen jedoch bald, dass die Gründe für Leonelas Verschwinden weitaus komplizierter und gefährlicher sind, als sie zunächst vermutet haben und auch mit der jüngsten Welle unerklärlicher Morde und Selbstmorde in Verbindung gebracht werden kann, die Moskau und Großbritannien erschüttern. Gejagt von den Visionen eines kleinen, gesichtslosen Jungen und einem Inferno, aus dem die Winterdämonen und die Dornen des Bösen brechen, gerät Ibsen ins Zentrum eines Verbrechens, das ihn bis zu den Toren des Wahnsinns führt...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
WINTERDÄMONEN
Die Dornen des Bösen
Ein außergewöhnlicher Profiler
Ein tödliches Spiel
Auf der Suche nach seiner Ehefrau erhält der freiberufliche Profiler Ibsen Bach in Edinburgh einen Anruf aus dem Kreml. In Moskau engagiert ihn General Sorokin, die Mörder seiner Tochter Leonela zu finden. Überzeugt, dass die junge Bloggerin in Gefahr ist, aber noch lebt, akzeptiert Ibsen den Auftrag, da Leonela ihm einst das Leben gerettet hat. Mit Pola Kamorow, seiner verstörenden Partnerin, leitet er die Ermittlungen ein.
Beide erkennen jedoch bald, dass die Gründe für Leonelas Verschwinden weitaus komplizierter und gefährlicher sind, als sie zunächst vermutet haben und auch mit der jüngsten Welle unerklärlicher Morde und Selbstmorde in Verbindung gebracht werden kann, die Moskau und Großbritannien erschüttern.
Gejagt von den Visionen eines kleinen, gesichtslosen Jungen und einem Inferno, aus dem die Winterdämonen und die Dornen des Bösen brechen, gerät Ibsen ins Zentrum eines Verbrechens, das ihn bis zu den Toren des Wahnsinns führt...
Maastricht, Vrijthof, 16. Mai 2019, 15.00 Uhr
Bart van Damme hört das CD-Radio auf dem Küchentisch kaum. Es spielt keine Rolle, ob es dieser Rocksong ist, zu dem er heute Abend mit Loes tanzen wird.
Loes … Die Liebe seines Lebens.
Doch im Moment denkt er nicht an die hübsche, schelmische Rothaarige, an die kleinen Grübchen, die mit jedem Lächeln auf ihren Wangen entstehen, oder an ihre Eigenart, eine lockige Haarsträhne um ihren Finger zu wickeln.
Seine Hände sind in das heiße Wasser des Spülbeckens getaucht. Seit einigen Minuten spült er eine Keramikschale. Er schaut dabei durch das Küchenfenster, das den Blick über den Eingang und den vorderen Bereich seines Hauses freigibt.
Seine Augen fixieren starr den Eingang, sein Verstand ist leer. So bemerkt er die siamesische Katze kaum, die die alte Ulme in der Mitte des vertrockneten Rasens emporklettert. Er ignoriert auch den alten Kees, seinen siebzigjährigen Nachbarn, der so ausgedörrt und braun ist wie ein Stück Trockenfleisch. Dieser pensionierte Mann, der mit der Regelmäßigkeit eines Metronoms sein Haus in Richtung Servatius-Basilika verlässt, nackt unter seinem braunen Overall, einer blauen Kappe über sein zerzaustes Haar und tief in das Gesicht gezogen, stets mit einer Zigarette in einem Mundwinkel.
Barts Mund steht offen, sein Gehirn ist im Leerlauf. Sein Verstand ist überwältigt von den diffusen, disharmonischen Klängen der Rockband in seinen Ohren.
Er blinzelt, schließt den Mund und lässt die Keramikschale ins Wasser fallen. Ein kleiner Funke hat sich soeben in der toten grauen Substanz seines Kopfs entzündet. Die Rockmusik wird leiser, dann still, ersetzt durch die nun vertraute, kleine Stimme.
Bart stimmt mit dem überein, was sie ihm sagt.
Er nimmt seine Hände aus dem Spülbecken und wischt sich an seiner Jeans das schäumende Wasser von den Händen. Mit kurzen Schritten geht er durch das Wohnzimmer und streicht über die Rückenlehne des Stuhls, auf dem seine Mutter eingenickt ist. Zu dieser Tageszeit schaut sie stets die AVRO-Nachrichten, mit halbgeschlossenen Augen und einer fast leeren Flasche Rotwein neben sich.
In seinem Zimmer öffnet Bart den Schrank, schiebt die Kleiderbügel mit seinen Lederjacken, Hemden und Jeans beiseite, um mit einem Handgriff nach seinem Gewehr zu greifen. Er legt nacheinander zwölf Patronen ein und entsichert die Waffe.
Als er das Wohnzimmer wieder betritt, springt seine Mutter erstaunlich schnell auf, stützt sich im hellblauen Morgenmantel und den Füßen in flauschigen Pantoffeln, mit einer Hand an der Armlehne des Stuhls ab. Sie starrt ihn an, ihr Blick ist entrückt.
„Bart? Mein Junge, was ist los?“, fragt sie mit belegter Stimme.
Er antwortet nicht, er legt an und schießt eine Schrotladung in den riesigen Bauch seiner Mutter. Die fast einhundertfünfzig Kilo schwere Frau stolpert zwei Schritte zurück und bricht zusammen. Sekunden später klebt ihre Hirnmasse am Fernseher. Ein rotes Linienzebra verläuft über das Gesicht der TV-Moderatorin, die mit breitem Lächeln und schneeweißen Zähnen das Wetter ansagt.
Bart ist glücklich, verlässt seine Wohnung und geht in Richtung St.-Servatius-Kirche. Dort löst er ein Besucherticket und betritt die romanische, dreischiffige Kreuzbasilika. Vor der alten Glocke Grameer bleibt er stehen und nimmt sein Gewehr aus der Sporttasche. Die Stimme in seinem Kopf ist fast zufrieden. Es gibt da nur noch eine winzige Sache zu erledigen, um sie zu gänzlich zufriedenzustellen. Er betritt die Schatzkammer, unter deren Besitztümern sich auch der Servatius-Schrein aus dem zwölften Jahrhundert befindet. Dort entdeckt er seinen Nachbarn Kees, der das goldene Kunstwerk hinter der Verglasung ehrfürchtig ansieht. Bart tippt ihm auf die Schulter und schießt Sekunden später eine Schrotladung in den Bauch des alten Mannes.
Bart lächelt, lädt das Gewehr letztes Mal und legt den Lauf unter sein Kinn.
„Und wenn du dabei noch ein letztes Mal in die glasigen Augen deines Nachbarn schaust“, wispert die Stimme.
Bart nickt und drückt ab.
London-Chinatown, Wardour Street, 16. Mai 2019, 19.30 Uhr
Die Teekanne pfeift schon seit mehr als einer Minute auf dem Elektrokocher.
Ko Lien Shen hört das Pfeifen sehr gut, aber er bewegt sich nicht in seinem alten Sessel vor dem ausgeschalteten Fernseher. Mit den Unterarmen auf den Armlehnen ruhend, wartet er regungslos. Er hat vor einer halben Stunde den Herd aufgedreht, seitdem strömt das Gas in die Wohnung.
In seinem Kopf wächst das schwarze Loch und absorbiert das bisschen Licht, das noch übrig ist: das strahlende Lächeln seines zwanzigjährigen Sohnes, der bei einem bewaffneten Raubüberfall erschossen wurde und dessen Zimmer noch immer mit Postern und Trophäen von diversen Fußballclubs dekoriert ist. Die Freundlichkeit und Sanftmut seiner Frau, deren Sammlung an Porzellanpuppen er während ihrer Krebserkrankung über viele Jahre weiter ergänzt hatte, bis sie dem Brustkrebs erlag und die Sammlung in ihr Grab mitnahm. Bald wird von diesen Momenten des Glücks nichts mehr übrig sein. Es wird Zeit, sich zu verabschieden.
Ko kommt aus seinem Sessel hoch, schließt den obersten Knopf seines karierten Hemdes und geht in die Küche.
Martha, die Nachbarin von nebenan, klopft an seine Haustür. „Herr Phan, geht es Ihnen gut? Da ist ein seltsamer Geruch im Flur. Ich rufe die Feuerwehr an.“
Ko Lien Shen muss die Nase nicht hochziehen, um zu wissen, dass Gas aus der Leitung die Wohnung sättigt. Seine Augen sind gereizt, er hustet und bewegt sich wie ein Roboter auf die Schublade zu, wo er die Streichholzschachteln aufbewahrt.
Das Klopfen an der Tür wird lauter.
„Herr Shen! Aufmachen! Machen Sie bitte auf!“
Ko Lien Sen erkennt die Stimme von Gregory, dem Hausmeister.
Sie wollen sicher eingreifen, denkt er, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr.
Er starrt auf die Köpfe der Streichhölzer.
Die Wohnungstür gibt nach einem kräftigen Tritt nach. Aber weder Martha noch Gregory haben Zeit, die Küche zu erreichen.
Beide werden von der Druckwelle weggeschleudert, als Ko die Streichhölzer anzündet.
Moskau, Solntsevo-Distrikt, 16. Mai 2019
Ich wache auf, als die Scheinwerfer eines Fahrzeuges durch die Bäume an meinem Fenster vorbeihuschen. Das Licht ist schwach, kraftlos und grau an den Rändern. Dann umschließt mich wieder die Nacht, und in einem Augenblick der Orientierungslosigkeit weiß ich nicht, wo ich bin. Ich drehe mich auf die Seite, die Matratze quietscht unter mir, lausche der Klimaanlage, die auf Hochtouren läuft, meinem panischen Atmen und weiß, dass ich eine weitere unruhige Nacht vor mir habe. Ich ziehe meine Beine an, krümme mich wie ein Embryo und schiele auf die Akte und das Foto auf dem Nachttisch. Im Licht der Straßenlaterne sehen die Kinder auf dem Foto seltsam glücklich und ahnungslos aus. Erwartungsvoll, als wäre das Leben, das vor ihnen liegt, eine Selbstverständlichkeit. Aber ich weiß es besser.
Ich schließe die Augen und versuche, wieder einzuschlafen, und bemühe mich, die Geräusche von draußen auszublenden. Sie klingen schrill und disharmonisch – Nachttiere, deren Rufe sich in das Brummen vorbeifahrender Fahrzeugen mischen. Ich fange den geisterhaften Ruf einer Eule.
In der Dunkelheit meines Schlafzimmers starre ich mit trockenen Augen in das Schweigen des Raumes und versuche, mich zu erinnern. Ein Erinnerungsfetzen ist wie eine heftige, fast greifbare Spannung, die in der Luft hängt, schmerzhaft wie die stechenden Dornen des Bösen.
Ich knipse das Licht an. Als ich das Foto aus der Ermittlungsakte in die Hand nehme, wird mir schwindlig. Etwas stimmt nicht. Woher kommt der plötzliche Geruch von verbrannter Asche?
Ich halte das Foto an meine Nase. Nichts. Nur der Geruch von altem Papier. Mein Herz pocht wild, mein Atem beschleunigt sich, mein Blut pulsiert in den Adern und meine Gedanken überschlagen sich.
Ich stehe mit einem tiefen Seufzer auf. Gehe zum Schlafzimmerfenster. Öffne die Vorhänge. Der Himmel ist dunkler als ein Grab in der Hölle, kein einziger Stern durchbohrt das Schwarz. Alle Lichter in der gegenüberliegenden Häuserfront sind ausgeschaltet. Auf der Straße ist nichts zu sehen, außer einem streunenden Hund, der unter dem Licht einer Laterne vorbeiläuft.
Da! Das Haus gegenüber. Das linke Fenster im zweiten Stock, mit Eisengittern geschützt, dahinter ist ein schwaches Licht, das ein- und ausgeschaltet wird. Irgendetwas geht in diesem Haus vor.
Und dann sehe ich es. Ein Kind, ein kleiner Junge, steht am Fenster. Alles harmlos. Nur ein kleiner Junge, der auch nicht schlafen kann.
Nein. Ein Trugbild.
Ich schließe die Augen, reiße sie wieder auf. Das Haus auf der anderen Straßenseite ist jetzt dunkel.
In der vergangenen Woche habe ich jede Nacht von einem gesichtslosen Kind geträumt und von gewaltigen, hochlodernden Flammen, aus denen Schreie der Angst aufsteigen.
TEIL 1
Der Magier
Auf der Tarotkarte Der Magier schwebt das Zeichen der Unendlichkeit im Kartenmotiv über dem Kopf der Figur und verdeutlicht einer Kartenlegerin, dass der Magier eine Verbindung zum Übernatürlichen besitzt.
Sobald die Karte aufgedeckt wird, ist man für die Kartenlegerin ein offenes Buch. Sie ahnt, kombiniert, prophezeit. Besitzt sie die Gabe, Dinge wahrzunehmen, die andere nicht sehen und in der Lage, sie mit anderen Begebenheiten in Verbindung zu bringen, erkennt sie die Chance für ihr Gegenüber, den nächsten Schritt … Oder sie täuscht sich.
Als Einzelkarte repräsentiert Der Magier Männlichkeit, Selbstbewusstsein, Perfektion und Stärke. Zudem strebt er ständig danach, seine Kräfte weiterzuentwickeln. Natürlich nutzt er aber sein Geschick und sein Talent dafür, um die Wirklichkeit nach seinen Wünschen und Zielen zu gestalten.
Deswegen wird Der Magier oft auch als Karte der Schöpferkraft bezeichnet.
Kapitel 1
Zermatt, Schweiz, 12. Juni 2019
Gefangenschaft
Langsam geht Andras Ribbenthal durch den langen Korridor auf das Zimmer zu und legt dabei die sündhaft teure Rolex um sein Handgelenk. Er hält einen Moment vor der massiven Holztür inne, die einen Spalt offensteht, zieht rasch den Knoten seiner Krawatte gerade und linst in den großen Wohnraum.
Die zierliche Frau sitzt wie erwartet gefesselt auf dem Stuhl, vor dem riesigen Erkerfenster mit Blick auf die Bergkette der Walliser Alpen und die Dufourspitze, dem höchsten Gipfel der Schweiz. Im harten Licht des Frühsommers schimmert das ewige Eis auf dem Granit.
Sie wirkt verloren inmitten des gigantischen Wohnzimmers des Chalets, das in schwindelerregender Höhe auf dem Bergplateau liegt.
Andras stößt einen zufriedenen Seufzer aus. Am Ende dieser Geschichte wird sie sterben. Es ist unvermeidlich. Er wird ihr jedoch nicht das gleiche Schicksal zuteilwerden lassen wie ihren Vorgängerinnen. Sein Plan ist in ihrem Fall ein anderer, ein besserer. Er schließt die Tür hinter sich und geht mit festen Schritten auf die junge Frau zu. Seine Absätze knarzen auf dem gewachsten Parkettboden.
Leonela Sorokin würdigt ihm keines Blickes, als er sich hinter den Stuhl stellt und zum Erkerfenster nickt. Sie starrt weiter auf die in der Ferne vom ewigen Schnee weiß leuchtenden Gipfel. Er weiß, dass in ihre Kehle kein Speichel mehr rinnt, ihre Mundhöhle trocken ist und durch den Knebel wie erstarrt.
Andras spürt die Wut, die von dem erschöpften, zierlichen Körper ausgeht, und bemerkt die geröteten Augenlider, die Tränen des Zorns und der Angst, die über ihre Wangen rinnen.
Wenn sie könnte, würde sie mich töten, denkt er. Wie all die anderen vor ihr.
Ein falsches Lächeln huscht über seine Lippen. „Gefällt Ihnen die Aussicht, Leonela? Ich darf Sie doch Leonela nennen?“
Leonela murmelt eine Antwort durch den Fremdkörper in ihrem Mund und spannt ihre Muskeln an, als hätte seine Stimme Gift versprüht.
„Keine Sorge, diese ganze Angelegenheit ist zeitlich begrenzt. Sie werden bald von Ihren Fesseln befreit. Doch vorher habe ich das Bedürfnis, ein wenig mit Ihnen zu plaudern. Denn in ein paar Stunden werden wir ein überaus interessantes Gespräch führen.“ Er stellt sich neben den Stuhl. „Sie wissen, wer ich bin?“
Leonela blickt zur Seite und wirft ihm einen finsteren Blick zu.
„Ich sehe es Ihrem Gesichtsausdruck an, dass Sie es bereits wissen. So ersparen wir uns endlose, langweilige Erklärungen. Sie werden bald mehr über mich erfahren. Das war es doch, was Sie mit Ihrer Aktion erreichen wollten. Wer weiß, vielleicht werden Sie eines Tages verstehen, dass ich weder grausam noch verrückt bin.“
Andras Ribbenthal hält inne und fährt sanft mit seinem Zeigefinger über den Knebel. „Wir sind stets die Narren von irgendjemandem, Leonela. Normalität ist doch vor allem eine Frage der Sichtweise. Nichts ist richtig oder falsch. Wenn wir beide den gleichen Hintergrund gehabt hätten, dieselbe Kindheit oder identische Möglichkeiten, dann würden Sie meine gegenwärtige Haltung verstehen, ebenso wie ich Ihre. Nehmen wir einen Dschihadisten, für ihn liegt das Böse im westlichen Lambda, und insbesondere in dem, was der Westen repräsentiert. Letzterer hält sich nicht für schädlich, der Westen erkennt nicht unbedingt, dass seine Lebensweise nahezu gänzlich auf der Ausbeutung von Minderheiten und den Armen dieser Welt beruht. In Wahrheit ist es ihm egal, solange nichts seinen Alltag als blinder und rastloser Verbraucher stört. Ich sage Ihnen das, weil es wichtig ist, dass Sie das verstehen. Ihr Wohlbefinden steht auf dem Spiel.“
Ein Hauch von Furcht schimmert in Leonelas Augen, sie vertreibt sie, indem sie trotzig die Augenbrauen hebt, die Stirn runzelt und ihn fragend ansieht.
Ribbenthal zeigt auf die Kamera, die über dem Kamin neben dem Erkerfenster angebracht ist. „In Kürze können Sie sich als mein Gast frei in diesem Zimmer bewegen. Wir werden Sie aber dabei beobachten, und ich rate Ihnen, sich zu benehmen. Andernfalls wäre ich gezwungen, Sie zu eliminieren … ohne Garantie auf ein schnelles Ende.“
Sie wirft ihm einen Blick voller Abscheu zu. „Hören Sie mir jetzt gut zu, Leonela. Wenn ich dieses Zimmer betrete, dann setzen Sie sich an den Tisch.“ Er zeigt auf das Möbelstück. „Ich werde Ihnen jedes Mal einen Teil meiner Geschichte erzählen. Danach stelle ich Ihnen ein paar Fragen. Die Unversehrtheit Ihres schönen Körpers wird von Ihren Antworten abhängen. Demzufolge rate ich Ihnen, mir äußerst aufmerksam zuzuhören.“
Ribbenthal nimmt sein iPhone aus der Innentasche seiner Jacke und zeigt auf das Display. „Ich habe speziell für diesen Anlass eine Anwendung programmiert. Nur zu, drücken Sie den grünen Punkt!“
Leonela bewegt sich nervös auf dem Stuhl hin und her und schüttelt den Kopf. Ribbenthal nimmt ihren Zeigefinger und legt die Fingerspitze auf das Display. Ein Feuerwerk farbiger Partikel explodiert, und das Wort korrekt erscheint.
„Das passiert, wenn Sie wahrheitsgemäß antworten. Dann wird niemand Sie berühren. Keine Qualen, keine Verstümmelungen.“ Er nimmt das iPhone wieder an sich und klopft auf das Display. Dieses Mal zeigt der Screen einen roten Punkt. Er hält ihr das Handy erneut hin und ermutigt sie mit einem Kopfnicken, ihn zu berühren. Sein autoritärer Blick duldet keinen Widerspruch, sie drückt mit dem Zeigefinger auf den roten Punkt.
Ein virtuelles Rad erscheint in einem Partikelregen und dreht sich im Uhrzeigersinn. Mehrere Symbole erscheinen nach und nach auf dem Display. Besorgniserregende Bilder: Finger, Hand, Auge, Ohr …
Leonela winselt, als das Rädchen mit seinem Pfeil bei der Abbildung eines Daumens anhält.
Stille. Nur einen Moment.
Ribbenthal nimmt das iPhone wieder an sich. Nach einem tiefen Atemzug umfasst er die Hand der Frau und betrachtet sie voller Bewunderung. „Wussten Sie, dass der Daumen das wichtigste Glied der Hand ist? Ohne ihn können Sie nichts greifen, die Hand verliert die Fähigkeit einer Zange und ist vielleicht so nützlich wie ein Fuß. Wenn Sie mir jemals die falsche Antwort geben, wünsche ich Ihnen, dass Sie nicht auf dieses Symbol treffen. Der kleine Finger wäre eine bessere Wahl. Wie auch immer, ich vermute, dass bei einer Frau Ihrer Klasse das Ohr auch höchstens mit einem Wattestäbchen oder mit der Zunge eines Liebhabers in Berührung kommt. Sehe ich das richtig?“
Panik blitzt in den Augen der jungen Frau auf. Sie atmet mit weit aufgerissenen Lidern durch die Nase. Sie blinzelt, spürt eine Träne über ihre Wange laufen, spürt, wie sie das Salz alter Tränen auflöst.
„Wissen Sie, Leonela, das Wichtigste ist die Vorfreude auf das Spiel. Überlegen Sie, dieser aufregende Moment, in dem Sie ihren Urlaub planen und die Palmen, den heißen Sand und die Wellen, die Ihre Füße umspielen, vor Augen haben. Angst funktioniert gleichermaßen. Ich habe das ausprobiert, beim Spiel mit einer Bohrmaschine oder dem Vergnügen, meinen Gast mit einer Zange so in Panik zu versetzen, dass er fast in Ohnmacht fiel, obwohl mein Spielzeug ihn nicht einmal berührt hatte. Die Worte sprudelten oft, ich musste nicht nachhelfen, was mir sehr entgegenkam, denn ich bin kein Sadist.“
Ganz dicht steht er nun wieder hinter ihr, so nah, dass sie seine Körperwärme spüren muss. Andras sieht, dass sie nach Luft schnappt, im selben Augenblick, als sie seinen Atem in ihrem Nacken spürt. „Ich erzähle Ihnen das auch nur, damit Sie es begreifen“, haucht er ihr ins Ohr.
Sie kauert auf dem Stuhl zusammen, so als wolle sie sich klein machen, sich verstecken. „Alles andere ist sinnlos, Leonela. Aber ich bin mir sicher, dass Sie begreifen werden, denn wenn ich mit Ihnen rede, wird sich dieses kleine Rad stets in einer Windung Ihres Gehirns drehen. Sie können gar nicht anders, als sich vorzustellen, dass der virtuelle Pfeil auf einem Auge stehenbleibt!“
Andras Ribbenthal lockert seinen Krawattenknoten, während er Richtung Tür geht. Auf halbem Weg hält er inne und dämpft das Echo seiner Schritte. „Ein grausames Spiel, ich weiß, aber Ihnen bleibt keine Wahl. Und versuchen Sie den Kiefer zu schonen, die Schmerzen werden sonst unerträglich, ihr Hals schwillt an, und Sie könnten ersticken. Wir sehen uns in ein paar Stunden, seien Sie dann bereit, Leonela! Empörung lenkt nur ab!“
Kapitel 2
Schottland, Edinburgh, 4. Juli 2019
Vorzeichen
Emily Duncan deckt zwei der vier vor ihr liegenden Tarotkarten auf. Ein Lächeln breitet sich auf ihrem Gesicht aus und enthüllt die makellosen, weißen Zähne der attraktiven rothaarigen Wahrsagerin. Entzückt hebt sie den Zeigefinger, das schwere Perlenarmband klirrt an ihrem Handgelenk.
„Das ist eine interessante Kombination, die ich hier vor mir habe: Der Magier und das Glücksrad.“ Sie schmunzelt. „Übrigens nennen meine Kunden mich Emily, Herr Bach.“
Ich nicke und vertreibe mit dem Handrücken den Rauch, der aus einem auf dem Tisch stehenden Räuchergefäß entweicht. Nun habe ich eine bessere Sicht auf die Karten.
„Und was bedeutet das genau, Emily?“, erkundige ich mich und schmunzle innerlich. „Wie steht es mit meinem Leben? Halte ich es aus?“
Die grünen Augen der Wahrsagerin sehen mich vielsagend an. „Eine Veränderung, Herr Bach. Sie werden bald Gelegenheit haben, einen neuen Weg in Ihrem Leben einzuschlagen. Die Möglichkeit, sich auf ein Abenteuer einzulassen, um die Monotonie des Alltags zu durchbrechen – wenn Sie es wollen.“ Sie lacht. Ein heiseres Lachen, vermutlich ein Stigma von Alkohol und Zigarettenmissbrauch.
Hm … Ein Abenteuer? Um die Eintönigkeit des Alltags zu durchbrechen? Wenn sie wüsste. So eine Eulenspiegelei. Das ist der Augenblick, in dem ich aufstehen sollte, um wieder tief in die kalte, hellsichtige Finsternis einzutauchen und den harten Kern der Wahrheit aufzuspüren. Die Wahrheit … Ich bin auf der Suche nach ihr, und meiner Vergangenheit, an die ich mich nur bruchstückhaft erinnere. Noch immer weiß ich nicht, wo ich meine frühe Kindheit verbracht habe und wer ich in Wahrheit bin. Aber ob ich sie hier finden werde? Dennoch ... Ich mag diese vierzigjährige Schottin, ihr Lächeln ist warmherzig und weckt Sympathie, aber wie die anderen hat wohl auch Emily nicht das, wonach ich suche. Wie dieser Hellseher – angeblich einer der Besten seines Fachs –, den ich vor Monaten aufgesucht hatte und der mir einen Geldregen prophezeite, auf den ich heute noch warte. Oder dieses leuchtende Medium in seinem maßgeschneiderten Anzug und mit strahlendem Gesicht, der mir versicherte, dass Schutzengel über ihn wachten. Eine Erkenntnis, die dem Mann gekommen war, nachdem er die Rolltreppe im Londoner Harrods heruntergefallen war und drei Wochen in einem Krankenhausbett verbrachte. Nein, die Erforschung der paranormalen Welt – heute mithilfe von Tarotkarten – ergibt nichts Aufschlussreiches. Emily Duncan wird mir außer einer Tasse Tee und ihrer Gesellschaft nichts bieten können. Aber schließlich ist das auch nicht der Hauptgrund für meinen Besuch.
Ich räuspere mich. „Haben Sie jemals … gewisse Dinge gespürt, Emily, ich meine, etwas, das Sie nicht Ihren Tarotkarten entnommen haben? Ich rede von gewissen Vorahnungen, von gewissen Strömungen oder Empfindungen.“
Die Wahrsagerin schüttelt langsam den Kopf und hebt ihren Zeigefinger. „Nein, nein, nein!“, antwortet sie für meine Begriffe ein wenig zu schnell, zu hektisch. „Ich bin nur ein einfacher Vektor, Herr Bach. Ich enthülle hier nur …“, sie tippt mit dem Finger auf die Karte des Magiers, „…die Botschaften, die mir die Tarotkarten vermitteln. Und wenn ich manchmal gewisse Vibrationen bei den Menschen spüre, denen ich begegne, dann mehr aufgrund meines Mitgefühls als aufgrund meiner Gaben.“
Ich nicke und führe die Tasse Tee an meine Lippen. Der Duft von Jasmin dringt in meine Nase. Auch Emily Duncan kann mir trotz ihrer Familiengeschichte, auf die ich zufällig gestoßen bin und weswegen ich sie auch aufgesucht habe, nicht helfen. Oder täusche ich mich? Seit meiner letzten Frage haben sich hektische rote Flecken an ihrem Hals gebildet.
Ich frage mich, ob ich meinen Dämonen jemals entkommen werde. Ob ich mich jemals von meiner Vergangenheit befreien kann. Oder bin ich dazu verdammt, einen für mich bestimmten Weg zu gehen? Keiner der Scharlatane, die ich bislang getroffen habe, konnte mir darauf eine Antwort gegeben. Es wird höchste Zeit zu zahlen und den wahren Grund meines Besuchs zu nennen. Ich greife in die Innentasche meiner Jacke, um meine Brieftasche herauszunehmen, aber Emily hält mich mit einer Handbewegung davon ab.
„Was genau wollen Sie denn wissen, Herr Bach? Ich brauche keine weiteren Karten zu ziehen, um zu erraten, dass Sie sich nicht besonders für eine Zukunft interessieren, die die Karten Ihnen prophezeien. Sie sind kein typischer Kunde. Sie sind auf der Suche nach etwas …“, sie hält inne, „Bedeutenderem.“
Kluges Mädchen.
„Sind wir das nicht alle, Emily?“ Ich schenke ihr ein rätselhaftes Lächeln.
Emily klatscht vergnügt in die Hände und lässt die Perlen am Handgelenk klappern. „Oh, Sie würden es nicht glauben! Die meisten Menschen, die auf Ihrem Platz sitzen, wollen von mir nur erfahren, ob sie die wahre Liebe finden oder zu Reichtum kommen werden. Aber die Selbstanalyse oder die Sinnsuche stehen nie auf meinem Speiseplan. Das ist auch gut so, denn ich könnte ihnen ein so exotisches Gericht niemals servieren.“
„Zumindest geben Sie es offen zu, Emily. Ihre Mitstreiter besitzen diese Ehrlichkeit eher selten. Dennoch nehme ich Ihnen das nicht ab.“ Ich schmunzle und stelle das Teeglas ab.
Die Augen der Wahrsagerin sprühen Funken, und die feinen Linien um ihre Augenlider vertiefen sich. „Sie zweifeln an mir? Ich werde Sie vielleicht überraschen, Herr Bach. Was ich vor meinen Augen auf dem Tisch habe, lügt nicht. Sind Sie nicht darauf gespannt zu erfahren, was sich hinter den letzten beiden Karten verbirgt?“
„Vielleicht später. Ich muss Ihnen etwas gestehen, Emily. Ich bin nicht zufällig hier, und Sie haben recht: Ich bin nicht so sehr an meiner Zukunft interessiert. Eigentlich ist es Ihre, die mein Interesse geweckt hat.“
Emilys Miene verfinstert sich. Misstrauen flackert in ihren Augen auf.
„Es mag Ihnen seltsam erscheinen, aber ich bitte Sie, mir ein paar Minuten Ihrer Zeit zu schenken und mir aufmerksam zuhören.“
Sie lächelt matt und lehnt sich in ihrem Stuhl zurück.
„Ich habe in den vergangenen Monaten mehrere Medien aufgesucht, und so stieß ich auf ihren Namen“, fahre ich fort, während ich mein Notizbuch und einen Stift aus meiner Jackentasche nehme. „Es gab eine Zeit, da habe ich die Seiten dieses Notizbuchs mit Worten geschwärzt, in der Hoffnung, mich an eine Realität zu klammern, die mir abhandenkommen könnte. Vor sechs Jahren hatte ich einen schweren Unfall und leide seitdem an Amnesie, meine Erinnerungen an das, was davor war, sind verloren. Aber vor einem Jahr holte mich mein verstorbener Kollege aus meinem lethargischen Alltag, und heute arbeite ich als Profiler für die OMON, eine Spezialeinheit der russischen Polizei, die dem Innenministerium untersteht. Seitdem schließt sich hin und wieder eine Gedächtnislücke. Aber alles bleibt dennoch sehr problematisch.“
Nach wie vor liegt Misstrauen in ihrem Blick. „Wieso?“
Für Emily ist das hier nicht mehr als ein Job, für den ich sie bezahle. Sie hat keine Ahnung, worum es wirklich geht, aber ihre Anwesenheit hat etwas Vertrauenswürdiges, sodass ich offen sein werde. „Ich habe einen Hirntumor und verliere mich aufgrund dessen mitunter. Mein Notizbuch hilft mir, die verlorenen Stunden zu rekonstruieren. Die Operation möchte ich noch ein wenig hinauszögern. Sie könnte mir meine Fähigkeiten nehmen. Meine Vergangenheit habe ich bereits verloren, Emily, also meine Erinnerung daran. Sie ist nur bruchstückhaft vorhanden. Heute unterstreiche ich in meinem Notizbuch Namen, die mir während meiner Arbeit als Profiler begegnen, um die Gegenwart nicht auch noch zu verlieren. Aber wenn ich privat recherchiere wie heute, sind es Namen, von denen ich glaube, dass sie für mich – was meine Vergangenheit betrifft – von Bedeutung sein könnten. Einer ihrer Kollegen nannte vor einigen Wochen Ihren Namen, und ich wusste sofort, dass es da etwas gab, dem ich nachgehen musste. Ich hatte die Hoffnung, durch ein Treffen mit Ihnen mehr über meinen Weg in die Vergangenheit zu erfahren.“
„Ich sagte Ihnen bereits, dass ich nur die Tarotkarten interpretieren kann, Herr Bach“, erwidert Emily und schüttelt entschieden ihren Kopf.
„Sie besitzen eine gewisse Gabe, Emily, und die haben Sie von Ihrer Großmutter geerbt.“ Jetzt habe ich ihre volle Aufmerksamkeit.
„Was wissen Sie über meine Großmutter?“
„Ihre Großmutter war Helen Duncan, eine bekannte Wahrsagerin und Geisterbeschwörerin. Sie wurde im Januar 1944 verhaftet und in der Folge zu neun Monaten Haft verurteilt. Möglich wurde dies durch den Witchcraft-Act, ein aus dem Jahr 1735 stammendes Anti-Hexereigesetz. Dieses Gesetz stellte allerdings nicht die Hexerei als solche, sondern die Ausnutzung des Glaubens an Hexen zu betrügerischen Zwecken unter Strafe. Der Prozess erregte landesweit Aufsehen, weil Ihre Großmutter angeblich Militärgeheimnisse während des Zweiten Weltkriegs verraten hatte. Erst vier Monate nach Ende des Krieges wurde sie wieder aus dem Gefängnis entlassen.“
„Das Ganze war ein abgekartetes Spiel von Großmutters Konkurrentin, Geraldine Cummins“, wirft Emily sichtlich aufgewühlt ein. „Diese durchgeknallte irische Suffragette war doch kein ernstzunehmendes Medium. Das Pathos des Alltags war ihr Steckenpferd und ihre ... Schreiberei. Cummings war im Zweiten Weltkrieg als britische Spionin tätig, um staatsfeindliche Aktivitäten der irischen Republikaner zu beobachten. Obwohl sie als Staatsheldin gefeiert wurde, war sie neidisch auf den Erfolg meiner Großmutter als Medium. Geraldine Cummings war diejenige, die Geheimverrat beging, der mittels einer von ihr eingefädelten Intrige meiner Großmutter angelastet wurde. Meine Großmutter wurde seitdem vom Geheimdienst ausgespäht, weil sie plötzlich aufgrund bestimmter Wahrsagungen als Sicherheitsproblem galt. Meine Familie kämpft bis heute um Großmutters Rehabilitierung. Wir sind davon überzeugt, dass die britischen Sicherheitsdienste auch bei der Prozessführung eine Rolle gespielt haben. Unlängst freigegebene Dokumente scheinen dies zu bestätigen. Aber die wichtigsten Unterlagen liegen bis heute unter Verschluss.“
Ich versuche, entspannt zu wirken, sie nicht anzustarren oder zu taxieren. Ein paar helle Strähnen durchziehen ihre roten Haare – aber das Bemerkenswerte an Emily sind ihre grünen, hellwachen Augen. „Ich bin zu Ihnen gekommen, weil ich glaube, dass Sie nicht nur die Tarotkarten deuten können, sondern die Fähigkeit besitzen, mehr zu sehen. Weil ich hoffe, durch Sie etwas zu erfahren, dass die Anzahl der Fragezeichen, die über meinem Kopf schweben, reduziert.“
Emily zuckt auf dem Stuhl zusammen und wird feuerrot. „Und was soll das Ihrer Meinung nach sein, Herr Bach?“, fragt sie und sieht mich mit einer Mischung aus Ungeduld und offensichtlicher Neugier an.
„Sie wissen es bereits“, antworte ich vorsichtig.
Plötzlich rollt eine Träne über ihre Wange. „Ich habe meine Gabe viele Jahre unterdrückt, aber als Sie durch die Tür kamen, wusste ich sofort, dass ich mich ihr heute stellen muss. Sie haben recht, ich habe Sie vorhin angelogen, denn ich kann durchaus gewisse Dinge sehen, sie spüren und Rückschlüsse daraus ziehen. Sie sind also, wie ich bereits vermutet habe, nicht nur wegen Ihrer Zukunft hier, Herr Bach, sondern insbesondere wegen gewisser Vorkommnisse in Ihrer Vergangenheit.“
„Können Sie mir etwas darüber sagen, Frau Duncan?“
„Ja“, antwortet sie ruhig und trocknet ihre Tränen mit einem Taschentuch.
Meine Augen weiten sich, mein Körper fühlt sich plötzlich taub an. Ich sitze in der Falle, die ich selbst hervorgerufen habe. Einen Moment schweifen meine Gedanken ab.
„Ibsen?“
Ein Flüstern, irgendwo in der Dunkelheit.
Diese Stimme, so vertraut.
Es riecht nach Kälte und Leere. Nach Tod.
Meine Frau lehnt sich an mein Ohr. „Alles wird gut, Ibsen.“
Ein Flüstern aus dem Jenseits.
Ich reibe mir die Augen und verdränge die Erinnerung an meine Frau. Mein Freund Tinnitus meldet sich, ich ignoriere ihn und verfluche mich im selben Moment. Was tue ich nur hier?
Emily schenkt mir eine zweite Tasse Tee ein, und dann sich selbst. „Meine Mutter hat mir vor vielen Jahren eine Geschichte erzählt, Herr Bach, und mir gesagt, dass mich eines Tages jemand aufsuchen würde, für den sie bestimmt sei. Die Geschichte handelt von zwei kleinen Mädchen aus dem schottischen Leath, ein kleiner Ort nahe Edinburgh: Bonnie und Fiona, zwei unzertrennliche Freundinnen.“ Emily legt ihre Ellbogen auf den Tisch und faltet ihre Hände. „Am Ortsende gab es direkt am Fluss Water of Leath einen kleinen Pub: Lands End, ein beliebter Treffpunkt der Hafenarbeiter. Die Mädchen radelten fast täglich dorthin und stellten ihre Fahrräder an der Rückseite des Lokals ab. Sie folgten dem schmalen Pfad zum Ufer des Flusses und durchquerten das hochgewachsene Schilf, bis zu einem schmalen, steinigen Strand, an dem sie einen Unterstand aus Zweigen gebaut hatten. Dort saßen sie oft stundenlang und sprachen über Abenteuer, über ihre Träume, und nichts, nicht einmal die lästigen Mücken konnten ihre Zweisamkeit zerstören. Fiona träumte davon, Ärztin zu werden. Bonnie hatte ein bescheideneres Ziel: Sie wollte Köchin werden und den besten Caramelpudding der Welt zubereiten.“
Die Wahrsagerin hält einem Moment inne. Ihre Augen sind leicht gerötet, als kündigten sich die Tränen der Trauer an. „Es ist die Geschichte einer Freundschaft, bis zu einem Tag im Juni“, fährt sie fort. „An diesem Tag regnete es ununterbrochen wie in der Woche davor. Das feuchte Wetter war für diese Jahreszeit ungewöhnlich, und es hatte sich den beiden Mädchen zu lange in den Weg gestellt. Fiona, die Temperamentvollere der beiden, wollte trotz des heftigen Regens unbedingt den Tag mit ihrer Freundin am Fluss verbringen. Zu dieser Zeit wusste Bonnie nicht, dass Fiona das Elternhaus nach einem heftigen Streit mit dem Vater verlassen hatte und auch nicht noch einmal dahin zurückzukehren gedachte. Bonnie selbst zögerte zunächst, ihre Mutter arbeitete als Krankenschwester in der Klinik und musste ihren Dienst antreten. Ihr Vater, der seit einem Autounfall querschnittgelähmt war, brauchte ihre Hilfe bei der täglichen Pflege. Aber Fiona bestand auf einem Treffen mit Bonnie, weil Bonnie am nächsten Tag für einen zweiwöchigen Urlaub zu ihrer Großmutter nach Crail aufbrechen sollte. Sie verabredeten ein Treffen am Ufer.“
Unsere Blicke treffen sich, erneut werden ihre Augen feucht.
„Bonnie verspätete sich. Sie trat trotz des seitwärts fallenden Regenvorhangs und des starken Windes fest in die Pedale, wollte die Zeit aufholen“, fährt Emily fort. „Nichts konnte sie aufhalten, schon gar nicht die wütenden Elemente. Als sie am Lands End ankam, stellte sie ihr Fahrrad neben Fionas hinter dem Pub ab und lief durch den Regen. Ihre nasse Kleidung klebte ihr bereits am Körper, ihre Schuhe versanken im Schlamm, aber umkehren wollte Bonnie nicht, denn Fiona wartete am Ufer. Sie lief durch das feuchte Schilf, das vom Wind gepeitscht wurde, und erlebte am Ende eine tiefe Enttäuschung. Der tobende Fluss hatte den Strand verschlungen und den Unterschlupf zerstört. Äste, die von den Bäumen gerissen wurden, trieben auf der Wasseroberfläche und wurden von der Strömung mitgerissen.“ Emily stockte. „Und ... von Fiona fehlte jede Spur. Bonnie rief ihren Namen und lief auf den Felsenvorsprung zu, der von tosendem Wasser umspült wurde. Das Wasser reichte ihr bis zu den Waden, und sie kämpfte mit dem Gleichgewicht, da die Strömung sehr stark war. Sie geriet in Panik und kehrte um, weil sie ahnte, dass etwas Schreckliches geschehen war. Der Fluss musste Fiona verschluckt haben. Eine andere Erklärung gab es nicht. In derselben Nacht träumte Bonnie von Fionas ausgestreckter Hand, die versuchte, ein unsichtbares Seil zu greifen, um den Wassermassen zu entkommen. Aber am nächsten Tag wurde nicht Fionas Leiche gefunden, sondern nur ihre Kleidung. Die Menschen rätselten, was das wohl bedeuten könnte. Manche sprachen von Selbstmord. Was auch immer geschehen war, in Bonnie war seit jenem Tag etwas gestorben. Die Schuldgefühle haben sie niemals verlassen, wie Fionas Geisterecho, das in jedem ihrer Schritte widerhallt. Bonnie wird ihr Leben lang nach der Antwort suchen, was einen Gott antreiben kann, ein kleines, fröhliches Mädchen voller Freude verschwinden zu lassen. Bonnie wird nicht heiraten, sie wird auch keine Köchin werden und es nicht schaffen, die Leere in ihrem Herzen zu füllen. Sie wird weder die Antwort auf ihre Frage noch die Kraft finden, sich selbst zu vergeben.“
In meinem Unterbewusstsein regt sich etwas, wobei ich mein Unbehagen nicht verhehlen kann. Meine Lunge schreit nach Sauerstoff.
Emily sieht mich aus dunklen Augen an. Eine Sekunde lang, zwei, ewig lang. „Ich weiß nicht genau, warum mir meine Mutter diese Geschichte erzählt hat, Herr Bach. Sie kannte weder Fiona noch Bonnie persönlich. Aber kurz vor ihrem Tod hat sie mir etwas für Sie gegeben.“ Emily steht auf, geht zum Wandschrank und öffnet eine Schublade.
Mein Puls beschleunigt sich. Ich erhebe mich ebenfalls und nähere mich der Wahrsagerin, als sie sich umdreht. Emily drückt mir einen Zettel in die Hand. Ich falte ihn auseinander, lese den Namen und stöhne. Ein messerstichartiger Schmerz schießt durch mein Trommelfell ins Mittelohr. Gefolgt von einem Tinnitus und pulsierendem Schmerz, der mich zwingt, mich hinzusetzen. Ich klammere mich an die Tischkante, falle nicht hin. Mein Blick ist verschwommen. Der Name tanzt mir vor den Augen.
Lara. Wenn ich an Fiona denke, denke ich an Lara. Wer ist Lara?
Der Schmerz lässt nach, der Tinnitus wird leiser. Ich setze mich wieder.
Emily nimmt ebenfalls Platz. „Wer sind Sie, Ibsen Bach? Was sind Sie?“
„Ich funktioniere, Emily. Ich tue, was zu tun ist. Das bin ich. Ich funktioniere, aber ich lebe nicht wirklich, seit dem Unfall.“
„Und jetzt sind Sie auf der Suche nach jemandem, der Ihnen schweres Leid zugefügt hat.“
Ich balle eine Faust. „Das ist richtig.“
„Wollen Sie mir nicht sagen, welche Bedeutung die Geschichte meiner Mutter für Sie hat? Und was hat diese Notiz zu bedeuten?“ Sie zeigt auf den Zettel in meiner Hand.
Ich hebe erstaunt die Augenbrauen. „Sie wissen es nicht?“
„Nein. Ich wusste nur, dass ich Ihnen die Geschichte erzählen musste“, erwidert Emily.
„Ich verstehe. Diese Geschichte ... Sie ist tatsächlich für mich bestimmt, Emily. Das beweisen die Notiz und der Name auf dem Zettel Ihrer Mutter. Fiona war der zweite Vorname meiner Ehefrau Lara. Ich habe vor sechs Jahren nicht nur mein Gedächtnis verloren, sondern auch meine Frau.“ Ich atme tief ein und aus. „Wissen Sie zufällig, wer Bonnie ist?“
„Ich habe ein wenig recherchiert, Herr Bach. Bonnie war die Tochter eines befreundeten Ehepaares meiner Eltern. Sie lebt noch immer in Leath. Ich habe Ihnen die Adresse aufgeschrieben.“ Und wieder drückt Emily mir einen Zettel in die Hand. „Ich denke, Sie sollten Bonnie aufsuchen. Ich spüre, dass es wichtig sein könnte.“
Mein Smartphone vibriert. Ich blicke auf das Display. Eine russische Rufnummer. „Entschuldigung, ich muss dieses Gespräch entgegennehmen.“ Ich drücke die grüne Hörertaste, höre zu, während ich Emily beobachte. Sie sieht aus dem Fenster. Der Himmel ist tiefgrau verhangen und kündet einen Aprilsturm an.
Ich unterbreche den Anrufer nicht. „Ich fahre so schnell wie möglich zum Flughafen und werde Sie auf dem Laufenden halten“, sage ich, beende das Gespräch und starre auf mein Handy. Dann ziehe ich einige Scheine aus meiner Brieftasche, lege sie auf den Tisch. „Ich hätte gern weiter mit Ihnen geplaudert, Emily, aber es handelt sich um einen Notfall. Behalten Sie bitte den Rest. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, es scheint, dass Ihre Vorhersage zutrifft, Emily.“
Sie sieht mich irritiert an.
„Ihre Interpretation der Tarotkarten: der Magier und das Glücksrad, Emily“, helfe ich ihr auf die Sprünge.
Sie räuspert sich und ringt sich ein fast jungenhaftes Lächeln ab. „Reicht Ihre Zeit noch für die beiden letzten Karten, Herr Bach?“
Ich zögere, bin gefangen in einer irrationalen Angst und versuche, Gelassenheit zu bewahren. „Entschuldigung, natürlich möchte ich das wissen, Emily.“
Die Wahrsagerin dreht die dritte Karte um. Sie zeigt einen Mann, an seinen Füßen erhängt. Ich spüre, wie die Röte in mein Gesicht schießt.
„Der Gehängte“, flüstert Emily. „Das namenlose Arkanum, Herr Bach.“
„Ist es so schlimm?“, frage ich mit einer Spur Ironie.
„Das namenlose Arkanum ist der Ausdruck für eine Veränderung, der Gehängte ist mit dem Tod verbunden. Der Tod will seine Früchte ernten. Seine Botschaft lautet stets, die Endgültigkeit anerkennen und Veränderung zulassen. Das muss aber nicht unbedingt negativ belastet sein, es geht nur um den Kontext. Die Kombination der beiden könnte bedeuten, dass Sie sich auf einen Weg wagen werden, dessen Ziel mit einer radikalen Veränderung einhergeht.“
Sie lässt sich Zeit, die letzte Karte umzudrehen, als fürchte sie sich davor. Auf der Karte thront der Fürst der Finsternis auf einem Sockel. Zu seinen Füßen ein an Ketten gefesseltes Paar, das mit Teufelsschwanz und kleinen Hörnern ebenfalls teuflische Züge darstellt.
„Der Teufel steht für Befreiung aus dem geistigen Gefängnis, für Verführung, Doppelzüngigkeit und für emotionale Abhängigkeit. Der Teufel ist stets eine Warnung, Herr Bach.“
„Sie meinten vor dem Anruf, ich sollte Bonnie aufsuchen, weil es wichtig sein könnte. Warum glauben sie das?“
„Der Teufel steht auch für die Unfreiheit durch Illusion. Ihre Frau ...“ Sie stockt und zeigt auf die letzte Tarotkarte. „Lara ... Sie kann nicht tot sein. Ich glaube, dass Ihre Frau lebt und … dass Sie sie finden sollten, denn wenn Sie es nicht tun, wird Lara Sie finden. Sie ist ein dunkler Schatten.“
„Warum sollte Lara mich suchen, Emily?“
„Das weiß ich nicht. Ich spüre nur den Widerhall schlimmer Geschehnisse. Es sind nicht die Toten, vor denen Sie sich fürchten müssen, Herr Bach, sondern die Lebenden. Im tiefsten Teil der Dunkelheit lauern stets die Ungeheuer.“
Vor einem Jahr hat Leonela Sorokin mir gesagt, dass Lara noch lebt. Ich habe es verdrängt, geglaubt, ignoriert und wieder verdrängt. Doch die Tatsache, das es wahr sein könnte, hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Und dann ist sie plötzlich wieder da: die Angst. Mein Bauch verflüssigt sich fast vor Angst. Ich spüre das Böse. Es ist ganz nah und krallt sich wie einst die Dornen der verwilderten Rosen am Institut Rosenrot um meinen Körper.
Ich reiche Emily die Hand und verabschiede mich. In meinem Wagen hallen ihre letzten Worte nach.
Alles wird noch übler werden …
Kapitel 3
Moskau, Anwesen Bogdanowitsch Sorokin, 5. Juli 2019
Zerbrechlichkeit
Ich sitze ungeduldig auf dem Ledersofa vor dem aus Marmor gemeißelten Kamin, mit einem großen Glas Cognac in meinen Händen, und vor Sorge angespannt.
Während ich warte, denke ich an den Blick, den ich beim Anflug auf den Flughafen auf das Herz Russlands, das kosmopolitische Moskau, von der Moskwa durchflossen, werfen konnte. Ich sah das Bolschoi-Theater, dessen Aufführungen ich so oft mit meiner Frau Lara besucht habe; den Moskauer Kreml mit seinen prachtvollen Gebäuden und Türmen und goldenen, in den Himmel hochragenden Kuppeln; die Basilius-Kathedrale mit den bunt gemusterten Zwiebeltürmen. Ein Blickfang, selbst von oben aus der Vogelperspektive. Andreas Neumann, mein Exkollege und Freund, der während unserer letzten Ermittlung ermordet wurde, empfand Moskau als überheblich und hektisch. Ich erlebe die Stadt als majestätisch, extravagant und dynamisch. Im Kreml spricht so mancher Mitarbeiter mit geschwellter Brust auch vom „dritten Rom“. Ich liebe diese Stadt, aber nicht wegen ihrer Prachtbauten und ihrem gewaltigen Wandel, sondern wegen der vielen Konstanten. Ich kenne ihren Geist und ihre Menschen. Hier hat die Kommunalka, die enge und russische Form des Zusammenlebens überlebt. Ich hatte bereits viele Jahre zuvor in Moskau gelebt, und mit dem Tod meiner Frau Lara wäre auch ich hier fast gestorben. Vielleicht habe ich mich deshalb entschieden, das Angebot der OMON anzunehmen und als freiberuflicher Profiler für sie zu arbeiten. Oberst Kamorow hatte mir während unserer gemeinsamen Ermittlungen das Angebot unterbreitet, bevor auch er dem Berliner Dämon zum Opfer fiel.
Der Cognac hilft nicht. Mir ist unwohl in diesem riesigen, kalten und unpersönlichen Raum. Ich spüre, dass hier mit Absicht die Spuren der Vergangenheit aus diesem seelenlosen Volumen ausgelöscht wurden. Seine Erinnerungen nehme ich dennoch wahr, wie auch die Lebensfreude, die einst diesen Ort erfüllt hat. Weder die nicht vorhandene Dekoration, die weißen Wände noch das Fehlen von Familienfotos auf dem Kaminsims können die Echos der Vergangenheit zum Schweigen bringen. Das Lachen der Kinder, die einst auf der alten Eingangstreppe spielten, wird heute durch das Geräusch eines Fahrstuhls aus Glas und Edelstahl ersetzt. Die zarten Klaviertöne des großen Steinway-Flügels durch die Stille einer stummen sphinxartigen Skulptur. Der ehemals knisternde Kamin hat vermutlich seit Jahren nicht mehr das Holz eines dicken Astes gesehen.
Ein Sonnenstrahl, der durch die dicht belaubten Bäume hinter der Holzterrasse auf mein Gesicht fällt, blendet mich, obwohl sie bereits langsam der spätnachmittäglichen Dämmerung Platz macht. Ich blinzle, sinke tiefer in das geschmeidige Leder und werfe einen Blick nach rechts auf den schwarzgekleideten Wachhund, der mich bis hierhin begleitet hat. Als guter Wachmann steht er vor der zweiflügeligen Holztür, breibeinig und gerade wie eine Eisenstange, seine leeren Augen starren ins Nichts.
Warten ist alles, was ich tun kann. Seit einem dringenden Anruf aus dem Moskauer Innenministerium habe ich keine weitere Erklärung erhalten. Der Fahrer der schwarzen Luxuslimousine, der mich vom Flughafen Moskau zu der abgelegenen Residenz inmitten eines Kiefernwäldchens fuhr, sagte kein Wort, ebenso das Muskelpaket mit markantem Kinn, das mich dort entgegennahm und mich mit großen Schritten durch den langen leeren Korridor zum Wohnzimmer eskortierte. Trotz seines Schweigens und ohne auch nur auf meine besonderen Fähigkeiten zurückzugreifen, spüre ich, dass es sich um eine ernste Angelegenheit handeln muss.
Der Wachhund rückt seinen Blazer zurecht, dessen Knöpfe bei jeder Bewegung abzuspringen drohen, sieht mich kurz an und nickt. Sein Gesicht bleibt dabei ausdruckslos.
Ich vermute, dass sein Boss auf dem Weg ist. Rasch führe ich das Cognacglas an meine Lippen, nehme noch einen Schluck und unterdrücke eine Grimasse, als die feurige Lava des Alkohols über meinen Gaumen fließt. Nur noch wenige Sekunden, bis ich erfahre, ob sich mein Eindruck bestätigt und meine Vermutungen zutreffen. Ich irre mich in der Regel selten.
Die Türen knarren beim Öffnen. Schnelle, entschlossene Schritte eilen über Fliesen, die in dem leeren Wohnzimmer nachhallen.
Er hat es eilig. Er steht unter Druck. Er hat ein Problem!
Ich greife nach meinen Gehstock, auf dem ich mich abstütze, um von der bequemen Couch aufzustehen, und strecke dem Mann vor mir die Hand entgegen.
Mein Gastgeber, in Jeans und ein weißes Hemd gekleidet, erweckt den Eindruck eines gebrochenen Riesen. Dabei hat er alle Merkmale eines kraftvollen und selbstbewussten Mannes: kantiger Kiefer, autoritärer Blick, hochmütige Statur, militärischer Haarschnitt. Doch seine Stärke ist nicht mehr als eine Fassade. Seine harten Gesichtszüge und sein spartanischer Look können den Schmerz nicht verbergen, der ihn ausmacht. Hinter seinen stahlblauem Augen, von Trauer gerötet, sehe ich nur noch die Überreste eines eisernen Willens, eine Zitadelle der Gewissheiten, in Trümmer zerfallen.
Bogdanowitsch Sorokin mustert mich einige Sekunden lang von Kopf bis Fuß und greift energisch meine ausgestreckte Hand. „Danke, dass Sie so kurzfristig gekommen sind, Herr Bach.“
„Das ist selbstverständlich, General Sorokin.“
„In diesem Haus bitte ohne General. Nun, ich schätze, Sie wissen, warum Sie hier sind.“ Sorokin legt seine Stirn in tiefe Falten.
Es ist eine Fangfrage, vermute ich. Er will mich testen.
„Sicher“, antworte ich gelassen. „Sie möchten, dass ich Ihre Tochter finde. Leonela wird vermisst, nicht wahr?“
Ein flüchtiger Schimmer von Überraschung huscht über sein Gesicht, aber als hätte er einen Moment der Schwäche offenbart, verhärten sich seine Gesichtszüge sofort wieder. „Können wir unsere Karten auf den Tisch legen, Herr Bach?“
„Mir ist keine andere Art zu spielen bekannt, Herr Sorokin.“
Der General ignorierte meine Bemerkung. „Ich bin ein pragmatischer Mensch, glaube nur sehr wenig … Nein, eigentlich glaube ich überhaupt an gar nichts, und noch weniger an das Übernatürliche. Ich glaube nicht an Geister, Außerirdische oder gar an Gott.“ Er hält inne und holt tief Luft. „Ich habe Sie aus Verzweiflung und gegen meine Überzeugung zu mir gebeten, und auch nur, weil ich weiß, dass Leonela Sie sehr schätzt. Meine Prinzessin hatte mir von Ihren sogenannten Fähigkeiten erzählt, von Ihrer … Gabe.“ Er zeigt mit der Hand einladend auf die Couch. „Bitte, stehen wir nicht nur herum, setzten wir uns doch. Ich muss Ihnen etwas zeigen, aber zuerst könnte ich auch einen Drink vertragen.“
Sorokin steht sich selbst im Weg. Dieser Mann möchte glauben und sich an jeden Strohhalm Hoffnung klammern, aber dazu er ist nicht fähig. Und weil er so erschüttert ist, muss die Situation ernster sein, als ich annehme.
Meine Prinzessin hatte …
Er spricht bereits in der Vergangenheit über seine Tochter. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut.
Bogdanowitsch Sorokin macht ein paar Schritte in Richtung der Bar neben dem Kamin und packt eine Cognacflasche am Hals, eine Flasche aus feingeschliffenem Kristall.
„Einer meiner besten Cognacsorten, ein Louis XIII. von Rémy Martin, aber heute könnte ich Katzenpisse trinken, ohne den Unterschied zu schmecken“, sagt er mit zittriger Stimme. Dann gießt er sich ein Glas ein, füllt es zur Hälfte und leert das Glas mit einem einzigen Zug.
Der General stellt die Flasche ab, schüttelt langsam den Kopf und lächelt bitter. Dann nimmt er sein Smartphone aus der Hosentasche und setzt sich neben mich.
„Während meiner Karriere beim militärischen Geheimdienst hatte ich stets das Sagen und die Kontrolle. Dennoch hätte ich viele Möglichkeiten gehabt, Fehler zu machen. Ich weiß nicht, ob Sie sich dessen bewusst sind, aber auch seit 1992 die Russische Föderation die völkerrechtlichen Rechte und Pflichten der UdSSR ausübt, hat Russland nie aufgehört, Kriege zu führen, und in den letzten fünfundzwanzig Jahren russische Soldaten in der ganzen Welt eingesetzt, um die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten zu bekämpfen oder zu unterstützen und die eigenen Interessen zu wahren. Russland ist ein schlechter Verlierer. Die Medien machen es den Leuten nicht noch schwerer. Der Informationsaustausch ist begrenzt, und das ist gut so. Auf diese Weise können unsere Mitbürger essen, trinken, sich mit ihrer Hockeymannschaft entspannen, im Winter wandern oder mit dem Schneemobil fahren, ohne zu wissen, dass es eine andere Realität gibt. Eine Realität, die wir vor ihnen verbergen, um die Maschinerie nicht zu stoppen. Kluge Köpfe wissen, dass die Zukunft unseres Landes anderswo auf dem Spiel steht, Herr Bach. Im Ausland, wo es ebenfalls wertvolle Ressourcen oder strategische Positionen gibt. Ob Sechstagekrieg, Prager Frühling, chinesisch-sowjetischer Grenzkrieg, die Bürgerkriege in Äthiopien, Angola, der Ogadenkrieg gegen Somalia, Kriege in Afghanistan, Georgien, Transnistrien, Tadschikistan, die Tschetschenienkriege, der Dagestankrieg, Priština, um nur einige zu nennen, unsere Armee war an allen Kämpfen beteiligt, wie ich an allen beteiligt war, bevor ich das Düngemittelunternehmen meines Vaters übernahm. Ich traf Entscheidungen, ich gab Befehle, ich setzte Leben aufs Spiel … zum Wohle unseres Landes. Das geopolitische Schachbrett erschien mir nie unklar, ich verstand seine Regeln und Probleme und war ein guter Spieler. Auf der anderen Seite, auf der Familienebene, ist es eine andere Geschichte. Sie wissen, dass ich meinen Sohn Valentin verloren habe. Meine Frau verließ mich am Ende und verfiel dem Wahn … Und nun Leonela. Sie hat immer gesagt, dass ich sie eines Tages besser verstehen würde. Ich hätte sie gern als Top-Juristin an meiner Seite in unserem Düngemittelunternehmen gesehen. Warum sonst ein Jurastudium finanzieren an der O. E. Kutafin Universität Moskau, einer der führenden Universitäten Russlands im Bereich der Rechtswissenschaften? Wohl kaum für ein investigatives Bloggerdasein wie das meiner Tochter: Eine Hobby-Influencerin, auf der Suche nach verborgenen Wahrheiten, dachte ich. Aber ich habe mich getäuscht. Seit Leonela mit Ihnen im vergangenen Jahr an dem Fall um diesen Berliner Dämon gearbeitet hat, weiß ich, dass meine Prinzessin eine sehr gute Journalistin ist.“
Der General bleibt eine Weile still, den Kopf nach unten gebeugt. Auch ich schweige.
„Und nun das hier. Ich habe das nicht kommen sehen. Ich war blind und taub, trotz meiner noch immer vorhandenen guten Beziehungen zum Kreml. Ich lag die ganze Zeit falsch, verstand nichts von dem wahren Leben, ich meine nicht das hinter dem Vorhang des Kremls, wo ich auf Kosten meiner Lieben aufblühte. Und ich fürchte, ich zahle jetzt den Preis dafür. Glauben Sie, dass wir für unser Handeln stets einen Preis bezahlen müssen, Herr Bach?“
Ich atme tief ein und aus und sehe die tiefe Furchen, die sich in das Gesicht des Mannes gegraben haben. Er sieht mich flehend an. Sein Jochbein zuckt, ein Zeichen seiner enormen Nervosität.
„Sie fragen mich tatsächlich, ob ich an Karma glaube, Herr Sorokin, ist es das, was Sie mir sagen wollen?“
Der General antwortet nicht, tippt auf den Bildschirm des Smartphones und übergibt es mir. Dann steht er auf und bewegt sich langsam auf die Terrasse zu. Unmittelbar vor dem Fenster bleibt er stehen und legt seine Hände hinter den Rücken.
Meine Brille habe ich mal wieder verlegt, vermutlich liegt sie in meinem Büro auf dem Schreibtisch oder im Auto. Es geht aber auch ohne. Meine Augen sind auf den Bildschirm gerichtet, der einige Sekunden schwarz bleibt, bis sich ein Video öffnet. Die Aufnahme wurde mit einer fest installierten Kamera gemacht, die ein Mädchen zeigt, das an einen Stuhl gefesselt ist, der vor einem Tisch steht. Der Blickwinkel verhindert eine Sicht auf das nach unten gebeugte Gesicht, nur der Hinterkopf ist zu sehen, mit langem kastanienrotem Haar, dessen Strähnen sich wie die Filamente einer gestrandeten Qualle auf dem Tisch ausbreiten. Leonela sieht aus, als würde sie schlafen. Das Video bleibt fast eine Minute lang stehen, eine Ewigkeit lang. Ich schlucke schwer. Meine Kehle ist plötzlich eng und trocken.
Ein Mann erscheint auf dem Bildschirm, gekleidet in einen perfekt sitzenden grauen Anzug. Er steht vor der Kamera. Leider ist es unmöglich, sein Gesicht zu sehen, das sich hinter einer inzwischen berühmten weißen Maske mit Schnurrbart verbirgt: dem des Web-Guerilla Anonymus.
„Oh, nein, nein, nein …“, flüstere ich, ergriffen von einem unguten Gefühl. Die Härchen meiner Unterarme stellen sich auf. Mein Körper erwartet bereits das Geschehen.
Der Mann zeigt mit dem Zeigefinger auf das Mädchen, steht hinter ihr, packt dann ihr Haar und zieht langsam ihren Kopf hoch. Er geht äußerst langsam vor, als wolle er, dass der Betrachter des Videos begreift und nicht das Geringste versäumt.
Als das Mädchen auch von vorn zu sehen ist, bemerke ich eine Reihe von beängstigenden Details: zuerst der Verband auf ihrem rechten Auge, dann ein anderer auf ihrem linken Ohr, dann das Oberteil ihres T-Shirts, gefärbt mit braunen Flecken, und schließlich die Worte auf ihrer Brust: Kein Fleisch. Keine Molkerei. Kein Witz.
„Leo … Oh, mein Gott“, flüstere ich, zu Tode erschrocken. Meine verschwitzten Finger gleiten über das Smartphone. Oh Gott, was hat der Typ mit ihr gemacht?
Das Mädchen wirkt benommen, als stünde sie unter Drogen, eine Marionette mit schlaffen, schweren Gliedmaßen, fast leblos. Die Maske nimmt beide Arme des Mädchens, die am Körper runterhängen, und legt die Hände sichtbar auf den Tisch.
Ich zucke zusammen. Mir fällt auf, dass dem Mädchen einige Finger fehlen. Beide kleine Finger wurden abgetrennt, ebenso der Ringfinger der linken Hand. Kalter Schweiß perlt auf meiner Stirn. Ich möchte das Smartphone wegwerfen, gegen die Wand schmettern.
Die Maske betrachtet, auch jetzt mit großer Langsamkeit und extremer Sorgfalt, die verschiedenen Wunden, die dem Mädchen zugefügt wurden, dann verschwindet er kurz aus dem Bild und erscheint mit einer Bohrmaschine und einem Skalpell wieder. Er widmet sich weiteren Zielen: das linke Auge, das rechte Ohr, die restlichen Finger. Er arbeitet sehr präzise, ein Meister seines Fachs. Ich rieche das Blut, höre die Stille, sehe das Dunkel dieses Monsters. All das spricht zu mir.
Schließlich lässt der Mann Leonela los, die in ihre Ausgangsposition zurückfällt, und zieht eine Waffe aus dem Holster. Er hält sie vor die Kameralinse, legt dann den Lauf an Leonelas Schläfe, starrt in die Linse und wartet einige Sekunden …
Mein Herz pocht und droht in der Brust zu zerbersten.
… und schießt.
Leonela kippt zur Seite. Blut spritzt an die Wand. Sie erstarrt, ihr Kopf fällt rückwärts, ihre Arme baumeln.
„Nein!“ Ein Aufschrei, ich kann nicht anders.
Der Mann mit der Maske grüßt in die Kamera und verschwindet aus dem Bild, während das Video noch eine Minute läuft, die Linse unerbittlich auf den zerschundenen Körper gerichtet. Dann nur noch ein Rauschen.
Das Smartphone fällt mir aus den Händen, als wäre es glühendes Metall, und liegt Sekunden später unter dem Glastisch.
Und plötzlich, als die Enge in meiner Brust zunimmt und ich kaum noch atmen kann, fährt der seit Wochen stumpfe Schmerz in meinem Bein wie ein Computer hoch, meine rechte Hand beginnt zu zittern. Ich atme ein, aber mein Zwerchfell blockiert. Ich schließe die Augen und konzentriere mich auf meine Umgebung, zwinge mich, aus dem Nebel hervorzutreten, der parasitäre Gedanken in meinen Geist webt. Ohne es zu wollen, sehe ich Bilder längst vergangener Tage vor mir: Leonela, die einst nach mir suchte und auf das Fenster meiner Wohnung schoss, um mich vor meinem Mörder zu warnen, Leonela, die mich mit Pola in letzter Sekunde im Institut Rosenrot aufgespürt hatte, um mich auch dort zu retten, Leonela, die mir in Moskau anvertraute, dass sie weiter den ungeklärten Verbrechen nachgehen und für Gerechtigkeit kämpfen wolle. In diesem Moment ist die Erinnerung für mich wertvoller als alles Gold der Welt.
Doch Leonela hat in ein Wespennest gestochen und deshalb schon ihren Freund verloren, aber nichts davon ist mit dieser Situation zu vergleichen. Auf dem Video wird die Tochter des Generals auf bestialische Weise getötet. Dies hier ist so eindeutig, so gegenständlich.
„Ich habe das Video vom Geheimdienst analysieren lassen“, fährt Sorokin mit belegter Stimme fort. Die Experten sind sich einig. Es ist keine Montage. Meine Tochter wurde gefoltert und erschossen. Meine Mädchen …“
Ausatmen. Den Gedankennebel vertreiben. Ich öffne die Augen. Es hat funktioniert, aber ich höre sein Gemurmel kaum noch. Worte prallen in meinem Kopf aufeinander, Fragen explodieren zu einem Feuerwerk.
Ist sie tot? Ist sie das wirklich in diesem Video? Das kann nicht sein. Verschwunden. In Gefahr. Aber nicht tot, nicht so …
Ich weigere mich, diese Realität anzunehmen. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich hatte eine andere Empfindung, als ich hierherkam.
Der General dreht sich um, seine Gesichtszüge sind jetzt wutverzerrt. Seine stahlblauen Augen könnten selbst mich durchbohren.
„Sie haben sich geirrt, Herr Bach! Ich möchte nicht, dass Sie die verstümmelte Leiche meiner Tochter finden. Ich möchte, dass Sie die Leute aufspüren, die das getan haben. Ich will diese Bastarde dafür bezahlen lassen. Es ist mir egal, ob Sie übersinnliche Fähigkeiten haben oder ein talentierter Profiler der OMON sind. Ich vertraue auf den Glauben meiner Tochter an Sie und Ihre jüngsten Erfolge. Ich verlange Gerechtigkeit!“
Mein Verstand reagiert immer noch nicht, gefangen in einer Gedankenblase umkreist ihn ein Tumult von Fragen: Wie kam der General zu dieser Nachricht? Warum sollte ihm jemand dieses Video schicken? Gab es eine Lösegeldforderung? Nein! Wozu? Leonela ist tot!
Das Innere meines Schädels beginnt zum ersten Mal seit fast einem Jahr, wieder zu brodeln, und ich spüre, wie der Druck in meinem Kopf ansteigt: das Kribbeln in den Fingern, die Kontraktion der Brustmuskulatur, das Zittern ... der Tinnitus. Mein Schädel droht zu bersten.
„Natürlich werden Sie Hilfe bekommen“, sagt die entfernte Stimme von Bogdanowitsch Sorokin. Ich höre die Verzweiflung, aber meine Gedanken driften weiter ab, die Geräusche aus dem Mund des Generals scheinen aus einem schalldichten Raum zu kommen, als hätte ich mein Ohr an dessen Wand gelegt. Ich neige den Kopf zum Klavier, inspiriert von einer Melodie, das von ihm zu kommen scheint.
„Ich habe Ressourcen, Herr Bach …“
Daran besteht kein Zweifel.
Die Klaviertasten ruhen in der verdächtigen Stille. Dann höre ich die Musik, die sie erzeugen. Ein Stück, das ich kenne, obwohl es selten auf einem Klavier gespielt wird.
„ … Sie werden nicht allein sein. Ein paar Männer, die mir gegenüber äußerst loyal sind …“
Richard Wagner. Friedrich von Flotow. Johann Sebastian Bach, Mozart.
„ …Hören Sie mir überhaupt zu, Herr Bach?“
Und dann sehe ich es. Neben dem Steinweg, er dreht mir den Rücken zu. Der kleine Junge mit den braunen Haaren. Ich habe schon einmal von ihm geträumt und die Vision schon zu Hause vor meinem inneren Auge gehabt, aber ohne das Gesicht des Kindes zu sehen. Diesmal ist es greifbarer, er …
„Wann haben Sie meine Tochter eigentlich das letzte Mal gesehen, Herr Bach?“
„Vor einigen Monaten, hier in Moskau“, antworte ich. „Sie wollte mit mir über ihre Zukunftspläne sprechen.“
„Bitte, erzählen Sie mir davon, Herr Bach.“
Ich sehe aus dem Fenster. Das Licht blendet. Ich beschirme meine Augen mit der rechten Hand, um sie gegen die Sonnenstrahlen zu schützen, die durch die Äste der gekrümmten Bäume fallen.
Meine Gedanken wandern in die Vergangenheit, zum Moskauer Druckhof und den Tieren über dem Eingang. Löwe und Einhorn an der Fassade symbolisieren die Macht und das Gute. Leo sitzt neben mir und stellt eine Tüte Pommes zwischen uns auf die Bank.
„Leo hat mir damals von einem mysteriösen Kontakt berichtet, der sie auf die Spur meines damaligen Falles gebracht hat. Sie wollte die Wahrheit über einen Journalisten herausfinden, der in den Siebzigern spurlos verschwand. Die Enkelin dieses Journalisten arbeitete damals als Angestellte für das Innenministerium in Berlin und hegte einen Verdacht, nachdem sie zufällig ein paar Gesprächsfetzen über das Projekt Rosenrot mitbekommen hatte. Sie wusste, dass ihr Großvater deswegen in Moskau recherchiert hatte …“
„Das weiß ich alles. Leonela hat es mir erzählt. Mich interessiert vielmehr, was sie für Pläne hatte.“ Sorokin klang ungeduldig. „Meine Tochter hat nach der Aufklärung dieses Falles ihr Jurastudium unterbrochen, wussten Sie das?“
„Leo spielte damals mit dem Gedanken. Sie war eine mutige, investigative Bloggerin.“ Ich rutsche unruhig auf dem Sofa hin und her. „Sie wollte weiterrecherchieren, denn trotz der Verhaftungen in Moskau und Deutschland hatten wir beide die Geschehnisse um die Akte Rosenrot nur gestreift. Es hat nicht gereicht, um alle Köpfe rollen zu lassen. Und …“
„Kann es sein, dass Leonela sich viele Feinde gemacht hat, Herr Bach?“
„Das kann ich nicht beurteilen, Herr Sorokin. Ich habe ihr damals geraten, bei ihren Recherchen den Bogen nicht zu überspannen.“
„Leonela befolgt keine Ratschläge, Herr Bach, und schon gar nicht solche! No way, war ihr Lieblingsspruch.“
Wie recht der General doch hat.
Plötzlich höre ich seine Worte nicht mehr. Seine Stimme ist nur ein Hintergrundgeräusch. Meine Aufmerksamkeit richtet sich auf den kleinen Jungen, der mit dem Gesicht zur Wand an der Tür neben dem Wachmann steht. Er trägt ein weißes T-Shirt und eine Latzhose. Ich schätze ihn auf vier oder fünf Jahre. Ich nehme eine Kindheit wahr, die man für ihn erschaffen hat, in der Liebe verwurzelt, auf festen Säulen erblühend. Eine Mutter, ein Vater, die ihr Leben geben würden, um das zu beschützen, was am wertvollsten ist: seine Unschuld. Ich klammere mich an diese Bilder von Glück, ich will sie so lange wie möglich halten, wie ein Licht in meinem Innern. Dann schieben sich graue Wolken vor meine Vision, die Bilder verblassen, meine Gedanken verdunkeln sich. Ich sehe das Kind nun mit traurigen Augen in einem Keller, ich spüre seine Angst, als sich eine Doppeltür öffnet. Ich sehe den Schmerz und höre die Schreie. Ich spüre die Gier der hungrigen Schatten, die in der vergeblichen Hoffnung, die unendlichen Tiefen ihrer Abgründe zu füllen, seine Seele plündern und ihm das Kostbarste nehmen.
„Herr Bach?“
„Entschuldigung. Ich verliere mich manchmal. Mein Gehirn spielt mir einen Streich. Verantwortlich ist ein Hirntumor, der auf seine Entfernung wartet. Aber ich kann mich nicht zu einer Operation durchringen.“
Noch nicht,füge ich gedanklich hinzu. Meine Gabe, Dinge wahrzunehmen, die andere nicht sehen, sie mit anderen Begebenheiten in Verbindung zu bringen oder sie mit einem Fall zu kombinieren, hat sich seit dem Tumor nicht verändert. Ich befürchte aber, dass die Operation etwas auslösen könnte, das mir diese Fähigkeiten nehmen würde.
Sorokin nickt nur. „Darf ich Sie etwas Persönliches fragen?“
„Sicher.“
„Man hat Ihnen doch die Leitung der Moskauer OMON angeboten. Warum haben Sie das Angebot abgelehnt?“