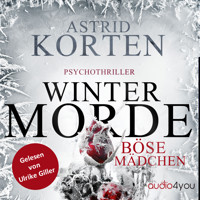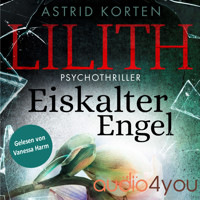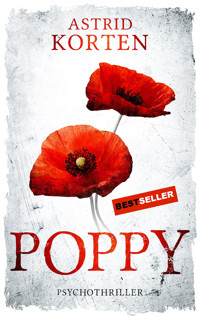4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Leute sagen, ich bin seltsam. Ich bin nicht seltsam, ich bin nur anders. Im Zentrum des Romans steht Flora, die in völliger Isolation in der Einöde der bayrischen Voralpen aufwächst. Nach dem Tod ihrer Mutter wird das verwahrloste, vierzehnjährige Mädchen in die Zivilisation gebracht und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Jahre später ist Flora eine erfolgreiche, mehrfach ausgezeichnete Kräuterexpertin und lebt zurückgezogen in Mühlbach. Ihr Leben ändert sich schlagartig, als Ella sie besucht, die sich als ihre Zwillingsschwester entpuppt. Ella konfrontiert sie mit verblassten Fotos aus der Vergangenheit, die Flora in Panik versetzen und ihre alten Ängste wieder wachrufen. Wenig später verschwindet Ella spurlos. Verzweifelt macht sich Flora auf die Suche und weckt dabei die Dämonen einer bizarren Vergangenheit… „FLORA – Die Dornen der Lüge ist ein packender Psychothriller mit einer außergewöhnlichen Protagonistin und ein Roman über das vermeintlich Teuflische in uns.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Über das Buch
Prolog
Teil 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Teil 2
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Teil 3
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Teil 4
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Teil 5
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Teil 6
Kapitel 62
Epilog
Personen
Impressum
Über das Buch
Die Leute sagen, ich bin seltsam.
Ich bin nicht seltsam, ich bin nur anders.
Im Zentrum des Romans steht Flora, die in völliger Isolation in der Einöde der Voralpen aufwächst. Nach dem Tod ihrer Mutter wird das verwahrloste, vierzehnjährige Mädchen in die Zivilisation gebracht und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.
Jahre später ist Flora eine erfolgreiche, mehrfach ausgezeichnete Kräuterexpertin und lebt zurückgezogen in Mühlbach. Ihr Leben ändert sich schlagartig, als Ella sie besucht, die sich als ihre Zwillingsschwester entpuppt. Ella konfrontiert sie mit verblassten Fotos aus der Vergangenheit, die Flora in Panik versetzen und ihre alten Ängste wieder wachrufen.
Wenig später verschwindet Ella spurlos. Verzweifelt macht sich Flora auf die Suche und weckt dabei die Dämonen einer bizarren Vergangenheit…
FLORA – Die Dornen der Lüge ist ein packender Spannungsroman mit einer außergewöhnlichen Protagonistin und ein Roman über das vermeintlich Teuflische in uns.
Prolog
Du trugst ein braunes Kleid und einen Kranz aus Wildrosen und Alpenglöckchen, als wir dich fanden, und warst gerade vierzehn Jahre alt geworden. An diesem Tag brannte die Sonne erbarmungslos, die Luft war stickig. Die Voralpen schienen vor Hitze zu zittern.
Hinter dir stand eine Art Tonne aus Stahl, aus der Rauch aufstieg. Aus Fichtenharz und Lavendel hattest du Weihrauch gemacht. Der Duft milderte den Gestank des Todes, der sich wie ein Schleier über das Tal legte.
Dein Anblick hat mich tief berührt. Deine Arme und Beine waren blutig von den Dornen der Wildrosen, mit denen du den toten Körper neben dir geschmückt hattest. Du saßest mit geschlossenen Augen einfach nur da und sangst eine Art Mantra. Deine klare Stimme hallte durch das Tal und schien perfekt mit dem monotonen Zirpen der Grillen zu harmonieren. Ah-oh. Ah-oh… Ah-oh. Ah-oh… Dir war entgangen, dass bereits Polizisten den schmalen Pfad zum Hof hinaufgeklettert waren.
Deine Mutter lag auf einem Reisighaufen. Blauer Enzian und wilde Rosen waren in das blonde Haar geflochten. Die Blumen gaben ihr etwas Andächtiges. Es hatte etwas Intimes, etwas Zerbrechliches, wie deine geschwollenen Finger die Hände deiner Mutter streichelten, als könntest du die Tote wieder zum Leben erwecken.
Doch dieses Gefühl verflüchtigte sich augenblicklich, als ich mich neben dich hockte und den Verwesungsgeruch der Ermordeten wahrnahm, der stärker war als der Duft der schwelenden Kräuter. Ich zuckte zusammen, hielt mir die Hand vor Mund und Nase und stand auf.
Ich befahl den Kollegen, die Spurensicherung zu verständigen und den Leichnam ins Tal zu bringen.
„Deine Mutter ist tot“, flüsterte ich und legte meine Hand sanft auf deine schmale Schulter.
Erst da hobst du den Kopf. Aus deinem rechten Auge lief Eiter. Heftig schütteltest du den Kopf und begannst wieder zu singen. Ah-oh. Ah-oh… Ah-oh. Ah-oh …
Wir beschlossen, dich zu betäuben und den Berg hinunterzutragen. Freiwillig wärst du ohnehin nie mit uns in die Zivilisation zurückgekehrt.
Erst ein Jahr später gaben die Behörden dir einen Namen, nachdem sie festgestellt hatten, dass du nirgendwo registriert warst. Sie nannten dich Flora Graf. Das Blumenmädchen.
Teil 1
Die Frau an der Tür
Ella
Ich hatte immer das Gefühl, das Flora existiert.
An einem anderen Ort auf dieser Welt.
Wenn ich als Kind allein oben in meinem Zimmer mit meinen Barbiepuppen spielte, war es, als säße ein Mädchen neben mir.
In meiner Vorstellung sprach ich mit ihr.
Ich habe nie allein gespielt.
Ich war auch nie allein.
Dieses Mädchen war immer bei mir.
Daher war ich nicht wirklich überrascht, als ich erfuhr, dass Flora existiert.
Es war die Lüge, die mich schockierte.
Und was die beiden uns angetan haben.
Ja, hauptsächlich das Letzte.
Kapitel 1
Rosenheim, Eröffnung Kräuterladen Floresse
Samstag, 6. Juli 2019
Hinter der Ladentür durchschneidet leises Gemurmel die Stille.
„Flora, wie weit bist du? Die ersten Gäste warten schon.“
Martha watschelt in die Küche und stellt sich neben mich, als drohe ein Unheil.
„Ich bin fast fertig“, antworte ich, hebe den Deckel vom Topf mit der brodelnden Schokolade und schnuppere. Zufrieden fische ich die Gewürzzweige aus der cremigen Soße und lecke mir die Finger. Zur Eröffnung habe ich ein dreitausend Jahre altes Kriegsgetränk der Maya zubereitet. Endlich mal eine Abwechslung zum traditionellen Champagner. Später werden die Leute gut gelaunt und euphorisch, vielleicht auch ein wenig streitlustig, wieder durch die Tür ins Freie strömen.
„Kann ich irgendwas tun?“, fragt Martha. Ihre rehbraunen Augen funkeln in dem runden Gesicht. Am liebsten würde sie das Kriegsgetränk kosten. Ihre High Heels klappern auf dem Fliesenboden. Martha trägt oft hohe Absätze. Sie wirkt dann nicht so klein und pummelig. In solchen Schuhen könnte ich nicht laufen.
„Du könntest die Tassen füllen, Martha“, antworte ich, während ich den Topf vom Herd nehme und ihn auf den Tisch neben die kleinen Becher stelle.
„Mach’ ich.“ Eine Locke hat sich aus ihrem Knoten gelöst. Es schmeichelt ihr. Martha sieht schick aus in ihrem blauen Kostüm, das so schön mit ihrem weißgrauen Haar kontrastiert.
„Ziehst du dich auch hübsch an?“, fragt sie und streichelt mir über die Wange. „Schließlich kommen die Gäste deinetwegen, Flora.“
Sie klingt unwiderstehlich. Ich kenne diesen Tonfall und weiß, dass ich gleich wieder ‚gesellschaftsfähig‘ sein muss. Ich soll mich auf das konzentrieren, was die Leute sagen, nicht sofort auf ihren Geruch oder den Klang ihrer Stimme, denn das würde mich ablenken. Das kommt nicht gut an. Dann mache ich einen seltsamen Eindruck, behauptet Martha. Ich weiß, aber meine Aufmerksamkeit ist ohnehin immer auf den Geruch gerichtet.
So nahm ich auch vor zehn Jahren wahr, dass sich der Geruch von Marthas Exkrementen verändert hatte. Ich wusste sofort, dass etwas nicht stimmte, und sagte es ihr. Noch am selben Tag ging Martha schockiert zum Arzt. Ich sollte recht behalten, denn an ihrem zähen Stuhl haftete Schleim mit Krebszellen. Sie kam gerade noch rechtzeitig. Der befallene Darmabschnitt wurde entfernt und ein halbes Jahr später roch ihr Stuhl wieder normal. Jetzt bittet sie mich einmal im Monat, gleich nach dem Stuhlgang nachzusehen, ob er noch ‚sauber‘ ist. Denn das ist die beste Zeit zum Riechen: wenn der Stuhlgang noch warm und dampfend ist. Manche Leute rümpfen die Nase, wenn ich ihnen das empfehle, aber ich bin in der Natur aufgewachsen, wo Gerüche für das Überleben entscheidend sind.
„Okay. Ich ziehe mich jetzt um“, antworte ich, streife meine Schürze ab und gehe in das muffige Badezimmer rechts neben der Küche. Martha hat mir ein fliederfarbenes Kostüm mit passenden Ballerinas hingelegt.
Im Nu ziehe ich mich um, bürste meine blonden Locken und stecke sie mit einer Haarnadel zu einem Dutt zusammen. Martha wünscht sich das. Ich sei dann auffälliger und sehe weniger wild aus. Vor allem Letzteres.
Ich schleiche mich in den Laden, stelle mich unbemerkt neben die Vitrine mit den ätherischen Ölen und werfe einen Blick auf unsere neueste Kräuterkollektion. Braun- und Grüntöne dominieren. Die Farben der Berge und der malerischen Gassen. Der Standort am Max-Josefs-Platz ist perfekt.
„Dieses Haus entstand nach dem großen Brand von 1641“, erklärte mir Martha, als wir uns das Haus ansahen. „Teilweise stammen sie aus dem 14. Jahrhundert, aber aus den ehemals schmalen Holzhäusern entstanden prächtige Patrizierhäuser.“
Ich sah mir die hochgezogenen, horizontal gegliederten Fassaden, Arkaden und Erker an und recherchierte, welche Heilmittel nach dem Brand und dem Untergang der Stadt ihren Siegeszug antraten. Deshalb habe ich zur Eröffnung diese Epoche als mein neues Kräuterthema gewählt. Aus der Verschmelzung der Völker entstehen stets neue Ideen.
An der Innenseite meines Handgelenks rieche ich noch die Essenz des Wermutkrauts, mit dem ich heute Morgen experimentiert habe. Artemisia absinthium, ein starkes Zeug. Die Römer behandelten damit Magen-Darm-Infektionen. Es wirkt gut, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Mama hat es immer genommen, wenn sie Magenschmerzen hatte.
Ich lutsche an meinem Handgelenk, fahre mit der Zunge an meinen Zähnen entlang und schmecke immer noch den Absinth. Ich will zurück in mein Labor und drehe mich um. Greife nach der Türklinke.
„Flora! Du bleibst hier!“ Martha packt mich am Arm. „Wir fangen jetzt an.“
Sie zieht mich mit sich. Wir schlängeln uns an ein paar Gästen vorbei. Ich halte die Nase hoch und atme ein. So viele Gerüche, ich kann sie nicht einordnen.
Wo ist die Tür?Schau dich immer nach einem Fluchtweg um, hat mir Mama beigebracht, als ich klein war. Okay, die Glastür ist rechts, drei Meter entfernt.
Ich folge Martha und steige die Stufen zu einem Podium hinauf. Dann stehen wir neben einem korpulenten Mann, der uns kurz zunickt und das Mikrofon ergreift.
„Es ist mir eine Ehre, als Bürgermeister von Rosenheim die Eröffnung vornehmen zu dürfen“, sagt er.
Martha nimmt meine Hand und drückt sie kurz. Ich richte meinen Rücken auf. Der dicke Bürgermeister redet und lächelt. Er gestikuliert in meine Richtung. Er riecht aus dem Mund – eindeutig eine beginnende Parodontitis. Seine Zähne faulen. Ob er das schon weiß? Das sollte ich ihm gleich sagen, wenn er fertig ist.
„Wir Rosenheimer sind stolz, dass die berühmte Kräuterexpertin, Dr. Flora Graf, sich in unserer Stadt niedergelassen hat“, fährt er fort und wendet sich dann Martha zu. Er stellt sie als meine geschäftstüchtige Mutter vor, die mein großes Talent erkannte und alles verkaufte, was sie besaß, um mich bei der Gründung meiner Firma Floresse zu unterstützen. Martha Mandel sei der Wind unter meinen Flügeln, sagt er und nickt dem Publikum zu, das begeistert applaudiert. Eine komische Redewendung.
Martha streicht mir mit dem kleinen Finger über die Handfläche. Ich rücke noch näher an sie heran und gebe ihr einen Kuss auf ihren grauen Dutt. Der Bürgermeister fragt, ob Martha kurz etwas sagen möchte. Darin ist sie wirklich gut. Von uns allen ist Martha die Rednerin. Sie übernimmt das Mikrofon und beginnt zu sprechen.
„Meine Damen und Herren, meine Tochter und ich fühlen uns sehr geehrt, dass wir endlich eine Floresse-Filiale in dem lebendigen Rosenheim eröffnen können. Gegenüber Ihrer schönen St. Nikolaus-Kirche …“
Ich denke an die Zähne des Oberbürgermeisters. Der Mann muss tagsüber Kalmuswurzeln kauen und den Saft schlucken. Das hilft. Und oft mit starkem Goldrutentee gurgeln. Gerade als ich überlege, ob ich auch cremige Kamille dazugeben würde, verändert sich etwas in den Gesichtern der Anwesenden. Habe ich etwas Unbedachtes getan? Ich weiß es nicht. Gepupst habe ich nicht, da bin ich mir sicher. Ich bin mit dem unwohlen Gefühl aufgewachsen, seltsamer zu sein als andere. Die Spuren meiner sonderbaren Kindheit haften mir noch an, behaupten manche Menschen. In pudrigen Mikrodosierungen scheinen sie für meine Umwelt akzeptabel. Heute habe ich das Gefühl verdrängt, habe jeden noch so leisen Zweifel an meiner Seltsamkeit erstickt. Ich bin nicht seltsam, ich bin anders.
Vielleicht hat aber auch Martha etwas Lustiges gesagt? Nein, Martha spricht nicht mehr. Ich drehe mich zu ihr um. Wie eine steife Marionette steht sie da, den Mund offen, die Arme unbeweglich an den Körper gepresst.
Ich folge ihrem Blick und sehe die Frau am Eingang. Sie ist groß und schlank und hat blonde Locken. Aber … das kann doch nicht sein? Ich scharre mit den Zehen in meinen Ballerinas.
Seht her. Ich stehe hier auf der Bühne, nicht an der Tür.
Ich umklammere Marthas Arm.
Meine Kopie kommt auf uns zu.
Kapitel 2
Rosenheim, Kräuterladen Floresse
Samstag, 6. Juli 2019
Meine Kopie sitzt mir gegenüber am Küchentisch. Mehr als dreißig leere Tassen stehen zwischen uns. Der Schokoladenduft des Maya-Getränks hängt noch im Raum. Martha hantiert an der Spüle. Seit der Eröffnung riecht sie säuerlich, es ist ihr Stressgeruch. Ich stehe auf und überprüfe zum zweiten Mal den Fenstergriff. Das Fenster ist offen. So kann ich sofort fliehen, wenn es sein muss.
Ich setze mich wieder hin und schaue auf das Blatt Papier vor mir. Sie hat ihren Namen darauf geschrieben: Ella Kaplan-Wagner. Ihre Mutter stammt aus Bad Urach in der Schwäbischen Alb. Als Kind war sie dort oft bei den Verwandten zu Gast. Jetzt lebt sie mit ihrem Ehemann auf dem Weingut Bad Urach.
Obwohl Ella mich nervös macht, fasziniert sie mich auch, wenn sie spricht. Wie sie sich artikuliert, wie sie ihre Lippen um die Worte formt. Wie sie ihre Hände bewegt. Wie sie mit ihrem Ehering spielt und sich gelegentlich umschaut, wie ein ängstliches Vögelchen, schnell und wachsam, als könnte sich jeden Moment ein hungriges Männlein auf sie stürzen. Bewege ich mich auch so? Möglich, sie ist mir in fast allem ähnlich. Nur riecht sie anders. Ein Cocktail aus Parfüm, Deodorant und Weichspüler. Der Geruch der Zivilisation.
Ella hat uns schon in einem langen Wortschwall viel erzählt. Auch darin ist sie anders als ich. Sie spricht leicht und flüssig. Sie hat uns erzählt, dass ihre 81-jährige Mutter seit letztem Monat nach einem Schlaganfall in einem Pflegeheim in Dettingen ist. Auf dem Weingut konnte sie nicht richtig versorgt werden. Ihr Vater ist vor sechs Monaten an Speiseröhrenkrebs gestorben, kurz nach seinem dreiundachtzigsten Geburtstag. Sie war am Boden zerstört. Papa war ihr liebster Mensch auf Erden.
‚Aber zum Glück lebt meine Mutter noch‘, sagte sie, ‚obwohl nur noch ihre Hülle im Stuhl sitzt.‘
Ella besucht sie jeden Tag und hofft, etwas von der starken Frau wiederzusehen, die das Fundament ihrer Existenz war. Wie auch immer.
Als sie das Zimmer ihrer Mutter auflöste, fand sie – versteckt in einem dicken Buch mit Grimms Märchen – einen Zeitungsausschnitt über mich in der Süddeutschen Zeitung. Auf dem Foto, das dem Artikel beilag, fiel ihr sofort unsere Ähnlichkeit auf. Wir sehen uns sehr ähnlich, sind beide sehr groß und schlank, haben goldblonde, krause Locken und eine schneeweiße Haut. Und wir haben die gleichen grünen Augen, eine Farbe, die man selten sieht. Sie hat mich gegoogelt und noch mehr Gemeinsamkeiten entdeckt. Ihr seid gleichaltrig und habt die gleiche Stimme, hatte ihr Mann gesagt, der ein YouTube-Video von mir gesehen hatte. Da dämmerte Emma etwas, das sie schon lange vermutet, aber nie auszusprechen gewagt hatte: dass ihre Mutter und ihr Vater nicht ihre leiblichen Eltern waren.
„Ich rief unseren Hausarzt an und erkundigte mich nach der Blutgruppe meiner Eltern“, sagt Ella. „Er erklärte mir, dass ein Vater und eine Mutter mit der Blutgruppe AB kein Kind mit der Blutgruppe 0 haben können. Aber eigenartigerweise gibt es keine Adoptionspapiere. In meiner Geburtsurkunde sind Cornelius und Roswitha Wagner als meine leiblichen Eltern eingetragen. Laut Urkunde kam ich am 17. Juni 1974 in der Arztpraxis meines Großvaters, Dr. Josef Söder, in Bad Urach zur Welt. Meine Mutter hat mir später erzählt, dass sie fremden Ärzten nicht vertraute und unter der fachkundigen Aufsicht ihres eigenen Vaters entbinden wollte.“ Sie lächelt. „Jedenfalls meldete mich mein Vater noch am selben Tag in Bad Urach an, wo meine Eltern eine Weinhandlung besitzen.“ Sie reicht mir den Mutterpass.
Alles ist darin perfekt dokumentiert. Angefangen mit der ärztlichen Unterschrift ihres Großvaters auf Ellas Geburtsurkunde: Dr. Josef Söder, dann Ellas Gewicht und Größe.
„Aber keinem Dokument konnte ich entnehmen, dass ich adoptiert wurde. Fakt ist, dass sie mich belogen haben. Ich wurde manipuliert. Als ich dein Foto sah, wusste ich, dass ich die Antwort bei dir finden würde. Deshalb bin ich hier, Flora. Ich suche meine leiblichen Eltern.“
Meine Kopie kramt in ihrer Ledertasche und holt einen dicken Ordner heraus. „Ich möchte dir etwas zeigen“, sagt sie und öffnet den Ordner. Dann klingelt ihr Handy.
„Mein Mann, der wahrscheinlich wissen will, ob es mir gut geht.“ Sie holt das Ding aus ihrer Tasche. „Hey, Leo, ich bin im Gespräch. Kann ich dich später zurückrufen?“
„Was ist das für eine Sprache?“, frage ich und beuge mich zu ihr.
„Schwäbischer Dialekt. Verstehst du das?“
„Ja. Das ist ein Dialekt, den meine Mutter gesprochen hat. Und es ist die Sprache, in der ich manchmal denke und träume.“
Die Augen meiner Kopie leuchteten auf. „In der du denkst und träumst? Aber dann hast du diesen Dialekt von deiner Mutter gelernt.“
„Wahrscheinlich.“ Ich halte mich mit beiden Händen an der Tischkante fest.
„Wie hieß deine Mutter?“, fragt sie.
„Das wissen wir nicht“, antwortet Martha blitzschnell. „Sie wurde ermordet, als Flora vierzehn war.“
Eine Sekunde Schweigen, ein Moment, kurz bevor es kippt, eine Sekunde höchster Fragilität. So kommt es mir vor.
Ella dreht sich mit einem Ruck um und sieht Martha an. „Ermordet?“, flüstert sie entsetzt.
„In den Voralpen, auf einem fast unauffindbaren Bauernhof“, knurrt Martha, als sie eine Tasse Tee vor Ella abstellt. Die Art, wie sie das tut, hat etwas Bösartiges. Sie will nicht über meine Kindheit sprechen. Anweisung vom Psychiater. Behauptet sie zumindest, wenn ich mal nachhake.
Ella ist plötzlich still und fährt mit den Fingern an ihrer Tasse entlang. Der Duft von frischer Minze steigt auf. Meine Gedanken schwingen davon. Das frische Aroma ist ein schöner Gegenpol zu den schweren Dämpfen des Kakaos. Zumindest, wenn man die richtige Minze verwendet. Es gibt so viele Sorten. Wasserminze. Bergminze. Kranzminze. Und sie alle schmecken anders …
„Und warum wurde sie getötet?“, fragt Ella. Sie klingt plötzlich herrisch, wie eine würdige Gegnerin von Martha. „Von wem? Und wann?“ Sie sieht Martha an. Ella ist klug, sie versteht, dass Martha mein Sprachrohr ist.
„Sie wurde im Juni 1988 ermordet“, antwortet Martha, „Sie wurde erstochen und der Täter nie gefasst. Wir wissen nicht, wer es getan hat und warum.“
„Sie wissen ihren Namen nicht? Wie seltsam! Jeder Mensch hat doch einen Namen.“
„Ich nannte sie nur Mama“, erwidere ich.
Ellas Kopf schwirrt wieder in meine Richtung. Wie ein kleiner Vogel. Schwupp!
„Mama…?“
„Flora lebte dort oben allein mit ihrer Mutter“, sagt Martha. „Sie wurde neben ihrer Leiche gefunden und in die Zivilisation gebracht. Meine kleine Flora konnte weder lesen noch schreiben. Nach einem Jahr in der Psychiatrie kam sie zu mir. Ich habe sie 1990 adoptiert. Seit 22 Jahren bin ich ihre Mutter. Nicht wahr, mein Schatz?“ Sie lächelt.
Ich nicke.
„Aha.“ Ella hat offenbar bislang nicht genug Fragen gestellt. Immer wieder wandert ihr Blick zu meiner verstümmelten linken Hand. „Was ist mit deiner Hand?“, fragt sie schließlich. „Hattest du einen Unfall?“
Martha seufzt und beugt sich zu mir herunter. „Darüber reden wir nicht“, sagt sie entschieden.
Ich betrachte die rote, geriffelte Narbe, wo früher mein kleiner Finger war, und versuche, meine Hand zu bewegen. Es fällt mir schwer.
„Ich weiß nicht“, flüstere ich. „Jemand hat mir den kleinen Finger abgehackt. Das war an dem Tag, an dem Mama getötet wurde.“
Martha knurrt.
„Er wurde dir abgehackt?“ Ella führt ihre Hand an den Mund. „Aber warum?“
„Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nicht mehr an den Tag, an dem ich zu den Menschen kam.“
Plötzlich scheint die Sonne wieder. Das Licht fällt auf Ellas Hände, die sie um ihren Becher gelegt hat: Ihre Finger sind schlank und zierlich. Ihre zehn langen, blutrot lackierten Fingernägel glänzen im hellen Licht.
Ich blicke noch einmal auf das Blatt Papier vor mir: Ella Kaplan-Wagner.
Ella…
„Was machen Sie beruflich?“, fragt Martha. Ihr Schweißgeruch wird stärker.
„Ich bin Agraringenieurin und habe vor zehn Jahren den Hof meiner Eltern in Bad Urach übernommen. Leo und ich haben daraus ein Weingut gemacht.“
„Du bist also Bäuerin“, antwortet Martha. In ihrer Stimme schwingt Missbilligung mit. Bauern haben bei Martha keinen guten Stand. Sie streiken ihr zu oft.
„So ähnlich“, antwortet Ella. „Wir bauen seit 2009 Wein an. Deshalb habe ich Önologie studiert. Ich habe einen guten Geruchs- und Geschmackssinn. Unsere Weine werden wegen meiner Nase ausgezeichnet.“
Ich grinse. „Ich kann auch gut schmecken und riechen.“
„Du bist wie ein Hund“, sagt sie. „Du schnüffelst an den Leuten. Das solltest du nicht.“
Ella und ich lachen laut auf. Martha nicht.
„Bist du in einer Beziehung, Flora?“, fragt sie.
Martha stöhnt.
„Nein, mein Gabor ist tot.“ Ich scharre mit meinen Ballerinas auf dem Boden. „Er ist am 9. Dezember 2010 an Herzversagen gestorben. Er war achtundfünfzig.“
„Achtundfünfzig?“
Sie schaut zur Seite und rechnet. Das tat Martha auch, als ich ihr von meiner Liebe zu Gabor erzählte. Martha klagte über den großen Altersunterschied. Er würde immer vor mir sterben, sagte sie. Ich würde eine junge Witwe sein. Sie behielt recht.
„Hast du Kinder, Ella?“, frage ich.
Martha zuckt zusammen.
„Nein, ich habe keine eigenen Kinder“, antwortet Ella und lächelt. „Leo hat zwei halbwüchsige Jungs.
Sie leben bei ihrer Mutter. Als ich ihn kennenlernte, war ich schon achtunddreißig. Er war geschieden. Die Jungs kommen jedes zweite Wochenende zu uns. Dann kümmere ich mich um seine Söhne.“ Sie setzt sich leicht auf. „Und du?“
„Darüber reden wir nicht!“, stöhnt Martha.
„Ich habe einen Sohn“, antworte ich und balle die Fäuste. „Er ist tot. Mein kleiner Benjamin ist im Schlaf gestorben. Er war noch ein Baby. Erst ein Jahr alt. Er hat neben mir im Bett geschlafen. Als ich mich am Morgen zu ihm umdrehte, lag er kalt und steif neben mir. Er roch schon nach Tod.“
Ich beuge mich vor und drücke meine Fingerknöchel so tief wie möglich in meinen Bauch, dorthin, wo Benjamin in mir heranwuchs. „Seitdem ist die Leere in meinem Bauch“, sage ich.
Für eine Sekunde herrscht Stille.
Dann blinzelt Ella. „Oh … dein Bauch ist leer …“, flüstert sie und starrt mich an.
„Ja.“ Ich drücke noch fester zu.
Martha steht auf und kommt zu mir herüber. „Sch… mein Käfer, komm“, sagt sie leise und streicht mir über die Haare. „Sch…“ Sie nimmt mich in den Arm und drückt kleine Küsse auf meine Locken.
Ich seufze. Der Geruch ihrer Angst ist jetzt sehr stark. Sie will nicht, dass ich von Benjamin erzähle. Reden weckt Erinnerungen, und mit den Erinnerungen kommt die Trauer und das, was Martha das verrückte Verhalten nennt, wie mein Abtauchen. Und allein durch die hohen bayerischen Voralpen zu wandern. Um zu vergessen. Das Schaukeln beruhigt mich. Wie immer. Martha ist gut im Schaukeln. Ich entspanne meine Fäuste und richte den Rücken auf.
Martha lässt mich los und tippt auf den Plastikdeckel. „Was ist noch in der Mappe?“
Ellas Mund steht leicht offen. Ihr Blick wandert von mir zu Martha. „Habt ihr ein Foto von Floras Mutter?“
„Nein“, antwortet Martha. „In dem Haus hat man kein Foto von ihr gefunden. Flora wollte, dass ich die Polizei um ein Foto ihrer Leiche bitte, weil sie sich nach einem Jahr im Heim nicht mehr genau erinnern konnte, wie ihre Mutter ausgesehen hat. Aber ich wollte kein Foto von einer ermordeten Frau im Haus haben!“
Ich stecke meinen Daumen in den Mund und beginne, an der Haut neben meinem Fingernagel zu knabbern.
Ella und Martha schauen sich an. Sie tauschen Botschaften aus. Wie Rehe. Ella öffnet leise die Mappe, nimmt zwei Fotos heraus und schiebt sie über den Tisch.
„Guck mal“, sagt sie, „das habe ich im Nachttisch meiner Mutter gefunden. Das Schwarz-Weiß-Foto ist eine Kopie des Passes eines Mädchens namens Ambra Mahler. Der Pass wurde am 18. Juli 1972 von der Stadt Bad Urach ausgestellt. Das Mädchen auf dem Foto war damals 13 Jahre alt. Das Farbfoto zeigt dasselbe Mädchen ein Jahr später. Es wurde am 2. September 1973 aufgenommen und ist ein Schulfoto. Schau. Das ist das Logo des Gymnasiums.“
Ella zeigt auf ein Quadrat in der rechten unteren Ecke, aber ich sehe nur das Mädchen. Mein Atem stockt und ein unangenehmes Gefühl macht sich am Zwerchfell breit. Ich kann kaum atmen.
„Nein!“, rufe ich und schieße hoch. Mein Stuhl kippt um. Ich gehe ein paar Schritte zurück, stoße gegen den Geschirrschrank und versuche zu atmen, aber es geht nicht.
Mir wird schwindelig, die Küche dreht sich. Ich will nach dem Stuhl greifen, verfehle ihn und breche zusammen. Lande auf dem Boden. Der sich so kalt anfühlt.
„Nein!“
Ich zittere, krümme mich wie ein Fötus. Eine Grausamkeit fällt mich an wie ein wildes Tier und gräbt ihre Zähne in meinen Nacken. Ich schnappe nach Luft.
Erneut höre ich Ellas Stimme. Dieses Mal seltsam dumpf. Die Welt dreht sich rasend schnell, rückwärts in die Vergangenheit, obwohl sie stehen bleiben sollte.
Ich lege meine Hände schützend über den Kopf. „Nein, Mama! Nein! Schmerz!“
Dann wird die Welt schwarz.
Kapitel 3
Bayrische Voralpen, Mühlbach
Samstagabend, 6. Juli 2019
Ella steigt aus meinem Auto, geht ein paar Schritte auf mein Haus zu und schaut sich um. Ich folge ihr. Das Reden gelingt mir nicht. Auf ihre Fragen antworte ich nur mit Ja und Nein. Ich begreife bis jetzt nicht, dass ich eine Zwillingsschwester habe, denn das ist sie. Ich spüre es und sie auch, aber Ella wollte Gewissheit durch einen DNA-Test. Wir waren gerade bei meinem Hausarzt, um Speichel abzugeben. Ich bin nicht neugierig auf das Ergebnis. Ich kenne die Antwort. Sie ist meine Schwester. Alles an ihr ist wie ich. Das Einzige, was uns unterscheidet, ist unser Geruch. Ihr Schweiß riecht anders. Ella isst Fleisch.
Ich war froh, dass Martha bei mir war, als Ella ihre Fragen stellte. Sie wollte alles über meine Kindheit mit Mama und mein Leben danach wissen. Martha kann wunderbar Fakten aufzählen.
„Es ist es ziemlich einsam hier, Flora“, sagt sie. „Hast du keine Angst, überfallen zu werden?“
„Nein, außerdem habe ich eine Katze.“
Martha mag diesen trostlosen Ort nicht, aber gerade wegen der Abgeschiedenheit habe ich die Steinruine mit dem angrenzenden Stall gekauft. An einem Sackgassenpfad, achthundert Meter hoch, auf einem Plateau, ohne Menschen.
„Öde und einsam“, nörgelte Martha, als wir mit dem Makler die Ruine besichtigten. „Im W… Winter friert man hier oben! Und wenn Einbrecher kommen? W … was machst du dann? Als Frau allein?“, fragte sie entsetzt.
Zum ersten Mal war mir Marthas Stottern egal, denn alles, was ich roch, war diese verführerische Mischung aus Feigenbäumen, Korkeichen und wilden Zitronen, als wir durch das verdorrte Gras gingen und die bröckelnden Mauern betrachteten. Die Ruine und der Stall nebenan erinnerten mich sehr an den Bauernhof, auf dem ich aufgewachsen war. Von hier aus hatte ich denselben Blick auf die Alpen, konnte den Stand der Sonne verfolgen und den Wind spüren. Ich ließ einen Bauunternehmer kommen, sorgte für Wasser und Strom und baute mir mein Refugium. Endlich allein.
Mein Haus ist klein, aber es hat alles, was ich benötige. Martha hat es eingerichtet. Sie hat den Holzofen ausgesucht, den Tisch und die Stühle, den Sessel, das Bücherregal, das Bett, die Kommode und den Schrank. Einen Fernseher wollte ich nicht, weil er ohnehin immer läuft, wenn ich bei ihr bin. Aber ich habe eine Stereoanlage. Ich liebe klassische Musik. Da kann ich eintauchen und alles um mich herum vergessen. Sie ist ein Überbleibsel aus meiner Zeit in der Psychiatrie, wo mein Psychiater festgestellt hat, dass mich die Harfenklänge von Bach beruhigen. Musik ist das Schönste, was ich in der Welt der Menschen entdeckt habe, sie ist tief in mir verankert. Weniger begeistert bin ich vom Internet, obwohl ich einen Laptop besitze. Man kann auch in die Online-Welt eintauchen, sicher, aber auf eine andere Art und Weise. Musik beruhigt mich, Bildschirme machen mich nervös.
An der Haustür gebe ich den Code ein. Martha hat das hochmoderne Sicherheitssystem installieren lassen. Es gibt Kameras an der Straße und am Eingang. Sie selbst hat einen Monitor, den sie von ihrem Haus in Ebbs aus bedienen kann. Wenn jemand meinen 200 Meter entfernten Wildschutzzaun durchbricht, wird sie alarmiert und kann sehen, wer sich meinem Haus nähert. Martha hat Angst vor Einbrechern. Martha hat vor vielem Angst.
„Hast du etwas unter dem Korken?“, fragt Ella.
„Was meinst du?“
„Eine Flasche Wein zum Beispiel?“, antwortet sie. „Ich bin bereit für einen Schluck.“
„Ich habe selbst gemachten Feigenlikör. Ist das okay?“
Ella lacht. „Klar, Hauptsache etwas mit Alkohol.“
„Okay. Setz dich bitte nach draußen.“ Ich deute auf die Rückseite des Hauses. „Da können wir den Sonnenuntergang genießen. Er wird heute wunderschön sein.“
Ella geht zur Westseite des Hauses und wendet sich der Sonne zu. „Er ist schon schön“, sagt sie.
Weil du bei mir bist, antworte ich in Gedanken.
Kurz darauf sitzen wir auf der Bank hinter dem Haus. Die Abendsonne streichelt unsere Gesichter. Die Luft ist knochentrocken. Wir schnuppern den wilden Thymian und den blühenden Fenchel. Ich ziehe meine Ballerinas aus und versuche, die langen Gräser mit den Zehen zu pflücken. Es kitzelt so schön. Ich bewege mich ein wenig, um sie besser greifen zu können. Ella folgt meinem Beispiel, zieht ihre Turnschuhe aus und spielt wie ich mit dem Gras. Ich stelle vergnügt fest, dass ich Grashalme besser greifen kann als meine Schwester.
Ella…
Ihre Anwesenheit stört mich nicht. Bemerkenswert. Für gewöhnlich dulde ich hier keine Menschen um mich herum. Selbst Martha nervt mich, wenn sie länger bei mir bleibt. Dann schicke ich sie weg. Martha versteht das.
„Wo ist denn dein Leibwächter, Flora?“, fragt Ella.
„Sie streunt überall herum, kommt aber abends immer nach Hause.“
„Und wie fühlst du dich jetzt?“ Ihre Zehen krallen sich in einen Halm.
„Schon etwas besser.“ Meine anfängliche Nervosität legt sich.
„Wirklich? Du hast so erschöpft und angespannt gewirkt. Und Martha, sie war kurz vor dem Zerspringen.“
Zerspringen… Bei dem Wort denke ich an mein Springmesser, das ich in der Küchenschublade aufbewahre und mit dessen Sicherung ich oft ganz mechanisch spiele, um meine Nerven zu beruhigen.
„Ja, mir geht es gut.“ Die Kräutertabletten, die ich bei Martha eingeworfen habe, haben mich ein wenig beruhigt. Aber den Schock habe ich bislang nicht überwunden.
„Wie bist du eigentlich bei Martha gelandet?“, fragt Ella nach einem Moment des Schweigens.
„Sie hat sich beworben“, antworte ich und habe das kleine Sprechzimmer in der psychiatrischen Klinik wieder vor Augen. Martha saß an einem weißen Tisch, als wir einander vorgestellt wurden. Sie roch nach Vanille. Aber auch nach etwas Saurem, nach Angst. An unserem Treffen war es das einzige Mal in unserem gemeinsamen Leben, dass Martha nicht zuerst sprach. Ihre Hand war feucht. Ich fragte sie, warum.
Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. „Ich bin nervös“, antwortete sie.
„Warum denn?“
„Ich möchte, dass du mich magst.“
„Ich mag dich“, erwiderte ich.
„Ach ja?“ Überraschung lag in ihrer Stimme.
„Ja. Du siehst aus wie Bruno.“
„Bruno? Wer ist das?“
„Bruno war mein Freund.“ Ich erzählte Martha von dem braunen, dicken Hund, der in meiner frühen Kindheit bei meiner Mutter und mir gelebt hatte. Ich liebte meinen schwanzwedelnden Freund. Er war für mich eine Wärmequelle. Wir kuschelten ständig miteinander und waren unzertrennlich, bis er eines Tages verschwand. Es geschah, als Mama mich mal wieder in den Keller einsperrte, um Proviant im Tal zu besorgen…
Ich spüre Mamas Hand auf meiner, ihren festen Griff. Sie wird mich in den Keller werfen und einsperren. Und mir wird schwindlig.
Ich falle in die Tiefe, höre Schreie und begreife, dass es meine eigenen sind.
Unten krieche ich auf eine Decke, darunter ist Beton, Erde und Sand. Bald werde ich in Panik geraten, das weiß ich, bald werde ich die Zeit vergessen…
Ich zittere und weine, hebe die Hand und sehe nichts. Ich bin am Ende der Welt angekommen und starre in den Abgrund. Es ist so dunkel, dass ich keine Konturen, keine Entfernungen, keine Schatten erkennen kann. Ich halte mir die Hand vor das Gesicht, aber ich kann weder meine Finger noch das verkrustete Blut in meinen Handflächen vom Aufprall sehen. Ich könnte genauso gut blind sein.
Ich fasse mir an den Bauch, er tut weh. Weiter oben, auf der Brust, taste ich einen Bluterguss.
Ich frage mich, ob ich tot bin und begreife, dass der Tod, wenn er kommt, mir diese Frage nicht mehr stellen kann.
Die Dunkelheit ist kein Segen, sondern ein Fluch. Der körperliche und seelische Schmerz überfällt mich in so heftigen Schüben, dass ich würge, spucke und Schaum vor dem Mund habe.
Und ich weiß genug, um Angst zu haben…
Als Mama mich wieder aus dem Keller holte, war Bruno verschwunden. Ich suchte ihn überall und irrte stundenlang in Panik durch die Berge, aber ich konnte Bruno nirgends finden und war wochenlang krank vor Kummer.
Als ich Marthas glückliches Gesicht sah, wusste ich sofort, dass sie mein neuer Freund war. Ich sagte es ihr, worauf Martha zu weinen begann…
„Martha hat sich um einen Job beworben? Wie soll ich mir das vorstellen?“
„Ganz einfach. Sie war vierundvierzig Jahre alt und verwitwet. Martha hatte sich immer Kinder gewünscht, aber es hatte nicht geklappt. Ihr Mann erkrankte kurz nach ihrer Hochzeit an Leukämie. Die Chemotherapie machte ihn unfruchtbar. Sie kam zu dem Schluss, dass sie inzwischen zu alt war, um schwanger zu werden, zumal kein neuer Mann in Sicht war. Sie beschloss, ein Kind zu adoptieren, aber auch das erwies sich als schwierig. Alleinstehende bekamen damals seltener ein Kind als Paare. Also bot sie sich als Pflegemutter für verhaltensauffällige Kinder an. So kam sie zu mir. Ich war ein Fall für die Psychiatrie. Niemand wollte mich damals haben.“
Ella lächelt. „Wirklich? Du, ein Fall für die Psychiatrie? Und Jahre später eine Frau, die in Pharmazie promovierte. Das nenne ich eine steile Karriere.“
Ich zucke mit den Schultern.
„Ich finde, du und Martha seid ein tolles Paar. Sie hat dich also adoptiert. Hm…“
„Martha wollte es so, damit man uns nicht mehr trennen kann. 1990 kamen die Papiere und ab da war es amtlich. Pflegeelternschaft ist eben etwas anderes als eine Adoption.“
„Aber du hast einen anderen Nachnamen als Martha“, sagt Ella.
„Der Staat hat mir den Namen Flora gegeben, weil ich mit Blumen geschmückt war, als sie mich fanden. Ich war das Blumenmädchen, sagte Martha. Und mein Nachname Graf leitet sich von der Gegend ab, in der ich gefunden wurde. Martha mochte meinen Namen, also hat sie es dabei belassen.“
„Martha hat recht.“
Ich nicke. „Martha ist mein Ein und Alles. Sie war und ist die beste Mutter, die ich mir wünschen kann.“
„Und unsere leibliche Mutter? Wie war sie denn so? Oder ist es dir unangenehm, wenn ich Fragen über sie stelle?“
Ich rücke ein Stück von Ella ab, etwas explodiert in mir. „Ja. Wenn ich über Mama spreche, denke ich oft an den schwarzen Moment. Das ist nicht gut für mich.“
Ella verdreht die Augen. „Was soll ich mir darunter vorstellen?“
„Den Moment, in dem Mama ermordet wurde. Mein Psychiater sagt, dass ich etwas Schreckliches gesehen oder erlebt habe und deshalb traumatisiert bin. Tatsächlich kann ich mich nicht an den Moment erinnern, als Mama starb. Das ist ein schwarzer Fleck in meinem Gedächtnis. Mein damaliger Psychiater hat diese Worte geprägt: der schwarze Moment. Und wenn ich an Mama denke, entsteht Chaos in meinem Kopf. Mit Ängsten und Schwindelgefühlen, wie vorhin.“
„Wie furchtbar.“ Ella nimmt meine Hand und streichelt sie.
„Die letzten Jahre ging es mir gut. Solche Anfälle wie heute hatte ich seit fünf Jahren nicht mehr.“
Die Sonne geht unter und färbt die Hügel vor uns in ein flammendes Orange. Wir halten den Atem an, lauschen regungslos den Geräuschen um uns herum: dem Dialog der Natur.
„Dein schwarzer Moment. Du musst nicht darüber sprechen, Flora. Wirklich nicht. Wir werden überhaupt nicht über diesen schlimmen Tag reden, okay? Aber erzähl mir von deiner Kindheit. Von deinem Leben in den Bergen. Das fasziniert mich.“
Ich nicke. Wie war mein Leben auf unserem Hof? Ich wende mich Ella zu und betrachte ihr Profil. Unsere Münder ähneln denen von Mama. Wir haben dieselben vollen Lippen. Ella streicht mir kurz über den Arm. Auch unsere Finger haben wir von Mama geerbt. Sie sind schlank und zierlich. Nicht gerade geeignet für schwere körperliche Arbeit. Und doch taten meine Hände es. Mama war meistens mit ihren Kräutern beschäftigt. Ich erinnere mich noch an ihren steifen Gang. Wie sie halb gebeugt den Weg zur Wiese entlangging, den Blick auf den Boden gerichtet. Wie sie sich bückte, um die schwefelgelben Anemonen zu pflücken, genau unter dem letzten Blatt. Wie sie mit gleichmäßigen Bewegungen Öl aus Lavendelblüten presste. Wie sie sich über ihren Kräuterkorb beugte und den Duft des frisch gepflückten Frauenmantels schnupperte. Dann hob ich den Kopf und schaute nach links.
Der Mann kam immer von links, aus dem Tunnel, über den Weg, der in die andere Richtung in die Welt der Teufel führte. Mama hat diesen Weg oft beobachtet. Sie hörte ihn immer, bevor sie ihn sah. Wegen der kleinen Glocke. Der Draht, der den Alarm auslöste, hing im Tunnel. Mama kontrollierte die Glocke regelmäßig, denn sie wollte immer auf die Ankunft des Bösen vorbereitet sein. Ihr ganzer Körper verkrampfte sich, wenn die Glocke läutete. Dann ließ sie alles fallen, was sie in den Händen hielt, und lief im Eiltempo zu unserem Hof, um einen Joint zu rauchen. Sie wollte high sein, wenn er sie berührte.
Wenn ich daran denke, ist es wie ein kümmerlicher Rest Sehnsucht nach etwas Wahrem, verbunden mit der heimlichen Hoffnung auf etwas Schöneres und Größeres als mein Leben mit Mama. Aber es ist nur ein Wunschtraum-Fetzen.
Ich hielt die Hoffnung nicht künstlich am Leben, ich habe sie begraben.
Kapitel 4
Bayrische Voralpen, Mühlbach
Samstagabend, 6. Juli 2019
Verdammt! Mit den Erinnerungen an Mama drängt sich auch der ‚böse Mann‘, wie ich ihn früher nannte, in mein Hirn. Ella sollte mir diese Fragen nicht stellen. Dann lässt sich mein Gedächtnis nicht kontrollieren. Die Erinnerungen tauchen auf, wenn ich sie nicht sehen will, und verstecken sich, wenn ich sie suche. Und vor allem will ich nicht an diesen grauenvollen Mann denken.
Die Katze ist wieder da und kratzt unermüdlich am Holz. Manchmal, in dunklen Nächten, überträgt sich das Geräusch auf die Dielen meines Schlafzimmers und ich denke an den bösen Mann, an das Monster. Von ihm bekomme ich einen schlechten Geschmack im Mund.
Ich stehe auf und gehe in meinen Kräutergarten. Schnell pflücke ich ein paar Pfefferminzblätter und stopfe sie mir in den Mund. Ich kaue und kaue, bis mir der Saft über das Kinn läuft. Zum Glück breitet sich der Geschmack der Minze schnell aus. Riechen will ich die Minze nicht!
Hinter mir sind Schritte zu hören. Ich drehe mich um.
„Flora, was ist los mit dir?“ Ella fasst mich an den Schultern. Sie sieht besorgt aus.
Die Kieselsteine im Kräutergarten stechen in meinen Füßen. Ich löse mich von ihr und stelle mich ins Gras. Ella folgt mir.
„Woran denkst du?“ Sie streichelt meinen Arm.
Ich bleibe stumm. Sie fragt noch einmal. Vielleicht verschwindet mein Zorn, wenn ich es ihr sage. Oft ist mein Gedächtnis zufrieden, wenn ich mich nicht verweigere. Dann fühle ich mich eine Weile schlecht, aber danach kann ich weitermachen.
„An das Monster“, antworte ich.
„Monster? Wer ist das?“
Ich darf es ihr nicht sagen. Das ist zu gefährlich. Aber Ella ist meine Schwester. Und ich möchte ihr von ihm erzählen. Ich will es ihr so gerne sagen. Es hilft. Es hat auch geholfen, als ich es Martha erzählt habe. Die Tränen kommen, ich spüre die Feuchtigkeit auf meinen Wangen. Mein Körper reagiert. Ich habe so lange nicht an ihn gedacht.
„Er kam durch den Tunnel“, schluchze ich und wende mich ihr zu. „Aus der Welt der Teufel. Am Anfang jeder neuen Jahreszeit. Er blieb ein paar Tage. Er hat Mama gefickt. Ständig. Er war schrecklich. Er hat sie krank gemacht.“
„Ein böser Mann aus der Teufelswelt?“ Ella sieht mich verständnislos an. Etwas hat sich in ihrem Blick verändert. Glaubt sie mir etwa nicht?
„Ja. Mama hat mir beigebracht, dass es zwei Welten gab: Eine gute, in der wir beide lebten, und die böse Welt, in der die Teufel hausten. Die Welt der Teufel begann am Tunnel. Dahinter war die böse Welt. Nur durch diesen Tunnel konnte man zu uns gelangen. Ich durfte nie in die Nähe des Tunnels kommen. Dann hätten mich die Teufel erwischt. Ich musste mich auch verstecken, wenn ich einen Hubschrauber sah. Die Hubschrauber waren die Spürhunde des Teufels. Der böse Mann kam aus dem Tunnel. Er war ein Teufel.“
„Das ist absurd“, sagt Ella und schlägt sich die Hand vor den Mund.
„Damals nicht. Ich habe es geglaubt.“
Ich spucke die Reste der Minzblätter aus. Es wird besser. Reden hilft. Das habe ich in meiner ersten Woche mit Martha gelernt. Damals geriet ich in Panik, als ich den Zigarettengeruch ihres Nachbarn roch. Da habe ich ihr von dem Monster erzählt.
„Geht es dir wieder besser?“, fragt Ella.
„Ja.“
„Mit jedem Besuch des Monsters entfernte sich Mama mehr und mehr. Am Anfang nahm sie nur Cannabis, wenn er bei uns war. Der Geruch war sehr stark. In unserem letzten gemeinsamen Jahr war sie immer öfter bekifft. Ich hatte keine Kontrolle mehr über sie. Das hat mir Angst gemacht. Allein konnte ich nicht überleben.“
„Mama hat sich prostituiert? Und Drogen genommen, um damit klarzukommen?“, flüstert Ella.
Ich drehe mich zu ihr um. Ihr Mund ist leicht geöffnet.
„Ja. Der Mann hat sie angeekelt. Wenn er nicht hinsah, spülte sie sich fast zwanghaft den Mund mit Rosenwasser aus. Wenn er wieder durch den Tunnel verschwand, ging sie zum Fluss, selbst bei Regen und Frost, und tauchte in das eiskalte Wasser. Sie schrie. Dann befahl sie mir, ihre Bettwäsche an unserem Waschplatz zu kochen. Danach musste ich alles reinigen, was sie berührt hatte. Dann hielt sie eine Duftzeremonie ab und ging mit einem Räuchergefäß mit Labdanumharz durch jeden Winkel des Hauses, um seinen Geist zu vertreiben.“
„Das ist einfach schrecklich.“ Ella rieb sich die Arme, als ob sie fröstelte.
„Ja.“
„Hat er Mama getötet?“
Ihre Frage überraschte mich.
„Nein. Natürlich nicht. Da war er schon tot.“
„Wie ist er denn gestorben?“
„Ich habe ihm die Kehle durchgeschnitten. Das war in meinem letzten Herbst mit Mama.“
„Was hast du getan?“ Ella zuckt zusammen und hält sich eine Hand vor den Mund.
„Es war ganz einfach“, fahre ich fort. „Er hat sich aus dem Gebüsch an mich herangeschlichen und stank nach Verwesung. Seine Augen bohrten sich in meinen Rücken. Aber ich habe gewonnen. Weil er in den Wind gelaufen ist. Das war dumm. Ich roch ihn, bevor ich ihn sah. Mit einem Ruck drehte ich mich um, stürzte mich auf ihn und schnitt ihm mit einem Ruck die Kehle durch.“
Ellas Gesicht gleicht einer Maske. Sie ist leichenblass.
„Du hast ihm die Kehle durchgeschnitten?“ Langsam schüttelt sie den Kopf und lehnt sich leicht zurück.
„Ich habe vor ihm schon unzählige Kehlen durchgeschnitten. Hühnern, Kaninchen, Rehen und einem Wildschwein. Ich war ein Virtuose mit dem Messer. Das bin ich immer noch. Und seine Kehle war dünn. Es ging leicht.“
„Aber Flora! Er war ein Mensch!“
„Stimmt, aber das wusste ich damals noch nicht. Für mich war er ein Teufel!“
Als ich ihn tötete, zerfiel für Sekunden meine Welt zu Staub, verloren Bäume Blätter und Nadeln, verwelkten Wiesen, trockneten Bäche und Flüsse aus, verdunkelte sich die Sonne, und ein Sturm zog auf. Ich schnitt ihm die Kehle durch, aber ich häutete mich mit dem Messer und sah, was unter der obersten Schicht lag. Alles, was im Dunkel meines jungen Körpers innen gewesen war, wurde nach außen gestülpt und kam in dieser Sekunde des Tötens ans Licht. Es stank. Brannte wie Feuer. Dann, Minuten später, legte sich mein innerer Sturm. Aber das kann ich Ella nicht erzählen. Sie würde es nicht verstehen.
Damals dachte ich, dass meine Untat mich mein Leben lang verfolgen würde, wie die Dämonen in meinen Träumen. Aber die Dämonen verschwanden kurz darauf, als hätte eine Art Blutzoll sie befriedigt.
Ich starre auf die Berggipfel und wieder kommen die Bilder. Weil ich sie nicht sehen will, gehe ich auf den alten Apfelbaum zu, bleibe stehen und lehne mich an die knorrige Rinde. Hinter mir knacken Äste. Ich konzentriere mich auf das Geräusch. Ella kommt auf mich zu wie ein junges Reh. Unsere Mutter ging anders. Ihre Schritte waren kontrolliert, wie die von Wildschweinen: langsam, aber konzentriert.
„Sag mal, Flora, was hast du eigentlich mit dem Monster-Mann gemacht? Mit seiner Leiche meine ich.“
„Mama und ich haben ihn verbrannt“, antworte ich.
Seine Verbrennung ist mir immer im Gedächtnis geblieben und die heftige Reaktion meiner Mutter, als sie ihn mit durchgeschnittener Kehle dort liegen sah. Ich schließe die Augen und sehe, wie Mama unsicher um ihn herumging und ihm dann gegen den Kopf trat. Wahrscheinlich um sich zu vergewissern, ob er wirklich tot war. Sein Kopf drehte sich leicht. Seine Zunge ragte heraus. Auf ihr waren bräunlich-gelbe Flecken. Ich hockte mich neben ihn, bückte mich, nahm einen dünnen Zweig und stopfte ihn ihm in den Mund, um tiefer in seinen Rachen zu sehen. Ich war neugierig, woher sein stinkender Atem kam. Mama war nicht interessiert. Sie schrie, jetzt kämen noch mehr Teufel. Sie kreiste um seinen Körper, weinte und lachte. Ich verstand kein Wort. Dann rannte sie nach Hause und kam kurz darauf mit einem Joint zurück. Erst nachdem sie ihn mit zitternden Fingern geraucht hatte, wurde sie ruhiger und pragmatischer. Stotternd befahl sie mir, den Bösewicht an den Beinen zu packen. Sie selbst packte ihn unter den Armen. Zu zweit schleppten wir ihn den Weg hinunter und legten ihn neben unsere Feuerstelle. Mutter prüfte den Wind. Er wehte nicht in die Richtung unseres Hofes, das war gut. Mama bat mich, trockene Zweige zu sammeln. Das dickere Holz holte sie selbst. Aus all den Stämmen und Zweigen machten wir einen langen Scheiterhaufen. Mama mischte auch trockenes Gras dazu. Sie schmierte seinen Kopf mit Butter ein. Damit sein Schädel schneller zerspringt, sagte sie, und als sein Kopf in der Sonne glänzte, hob sie seinen Körper keuchend hoch und legte ihn auf den riesigen Holzstoß. Dann nahm Mama einen Stock, den sie mit Stofffetzen umwickelte und machte daraus eine Fackel. Sie tauchte ihn in Petroleum, nahm ein Stück glühende Kohle und zündete die Fackel an. Sie ging um den Leichnam herum und zündete das Gras zwischen den Zweigen an. Innerhalb weniger Minuten stiegen Rauch und Feuer zum Himmel.
Die Verbrennung des Leichnams dauerte viele Stunden. Gegen Ende nahm Mama eine Axt, zerschlug mit beispiellosem Fanatismus seine Knochen und entfachte das Feuer erneut. Vom Monster blieb nur noch Asche übrig. Die fegte Mama schließlich zusammen. Sie füllte die Asche in einen Eimer und ging damit zu unserem Toilettenhäuschen. Dort schüttete sie die Asche demonstrativ in unser Plumpsklo. „Scheiße zu Scheiße“, sagte sie, high vom Kiffen.
Ella sieht mich nachdenklich an. „Komm, Flora, lass uns schlafen gehen“, flüstert sie. „Ich bin müde. Es war ein langer Tag.“
Sie nimmt mich fest an der Hand. Als wir uns der Haustür nähern, erzählt sie mir, dass sie später in der Familiengruft der Familie Wagner begraben werden möchte, obwohl kein Wagner-Blut in ihren Adern fließt.
„Die Wagners haben ein schönes Mergelhäuschen auf unserem Dorffriedhof“, sagt sie. „Da möchte ich später auch liegen. Schön und gemütlich. Kommst du auch dorthin, wenn deine Zeit gekommen ist?“
„Ich werde mit der kleinen Urne von Benjamin zum Hocheck-Gipfel gehen, wenn mein Ende naht. Ich will auf dem Felsen sterben, mit der Asche meines Kindes neben mir, ohne Kleider, mit dem Wind auf meiner Haut, und dann sollen mich die Aasgeier fressen. Dort oben werden meine Knochen mit der Zeit verwesen.“
Ella schüttelt den Kopf. „Das wird nicht passieren. Das ist nicht bequem. Wir werden zusammen in der Wagnergruft liegen, Flora. Und Benjamin bekommt darin eine eigene Nische. Dann kann er auf uns herabschauen.“
Ich bleibe stumm, stürze in ein Vakuum.
Kapitel 5
Mühlbach, in der Nacht von Samstag auf Sonntag
Ich schleiche zurück in mein Zimmer und schlüpfe vorsichtig ins Bett. Das Fenster steht weit offen und lässt dem nächtlichen Fallwind freien Lauf. Die Temperatur sinkt schon leicht. Gott sei Dank. Die Geräusche der Nacht klingen gedämpft, nur der Waldkauz ist laut. Die Morgendämmerung ist nicht mehr fern.
Ellas Atmung ist kaum zu hören. Ich verschiebe mein Kissen ein wenig und ziehe das Laken bis zum Hals hoch. Als ob die dünne Baumwolle mich vor dieser seltsamen Angst schützen könnte, die wie eine Welle über mein Leben schwappt und die nach Jahren der Abwesenheit letzte Nacht zurückgekehrt ist. Es begann in meinem letzten Jahr bei Mama, als sie immer öfter Haschisch rauchte. Wenn sie high war, konnte ich mich nicht auf sie verlassen und musste selbst die Zügel in die Hand nehmen. Langsam dämmerte es mir, dass die Zeit nahte, in der ich auf mich allein gestellt sein würde. Etwas in mir wusste schon damals, dass ich allein dort oben nicht überleben würde. Der Wind wehte damals rau, aus einer anderen Richtung, denn in meinen Augen war Mama kein Mensch mehr, sondern eher ein Tier.
Die Angst verschwand mit der Ankunft von Martha, aber sie flammte wieder auf, als Martha an Krebs erkrankte. Ich spürte, dass sie krank war, ich spürte den Krebs. Nach der Operation verflog meine Angst sofort wieder. Die Kontrolluntersuchungen machten mir nichts aus. Ich wusste nur: Der Krebs war fort und Martha ging es wieder gut.
Die Angst kam zurück, als ich neben Gabor im Bett lag. Ich spürte, dass er nicht mehr lebte, noch bevor ich die Augen öffnete und seinen toten Körper sah. Ich fühlte, dass mein Baby, mein kleiner Benjamin, sterben würde, denn die Angst kam und blieb auch nach seiner Geburt, bis ich am 10. August 2012 mitten in der Nacht aufwachte und mein kleiner Junge gestorben war.
Bereits mit zwölf Jahren habe ich begriffen, dass schlimme Erlebnisse Schichten von mir abtragen und es mir erschweren, Mitgefühl zu empfinden. Mit Gabor und Benjamin wusste ich, dass sich diese Schichten manchmal wiederaufbauen ließen, weil ich geliebt wurde. Weil ich liebte.
Nach dem Tod meiner Männer ist die Angst einer Leere gewichen, die mich nie wieder verlassen hat. Aber heute Nacht hat diese Angst wieder von meiner Seele und meinem Körper Besitz ergriffen. Ich habe Angst um Ella, aber Ella liegt hier neben mir. Sie ist gesund. Sie hat keinen Herzfehler. Sie hat nichts. Ich habe gerade noch an ihr geschnuppert. Und trotzdem habe ich ein ungutes Gefühl. Ich höre wieder ihren Atem und seufze.
Gerade eben, als ich draußen bei der großen Zeder stand und in die Sterne schaute, dachte ich an die Jahre mit Mama zurück. In meiner Kindheit fühlte ich auch eine Leere, aber sie war klein im Vergleich zur Leere, die ich jetzt fühle. Damals wurde sie auch kleiner, wenn ich meine Hände zu den weißen glitzernden Lichtern am schwarzen Nachthimmel hob, die an mir zu zerren schienen. Ich stellte mir vor, wie sie mich hochhoben und in eine Welt ohne Leere trugen…
„Wo warst du gerade in Gedanken?“ Ellas Stimme.
Ich zucke zusammen. „Du bist wach?“
„Ja, schon eine ganze Weile. Ich habe mir Sorgen gemacht.“
„Warum?“
Ella greift unter der Bettdecke nach meiner Hand. „Ich habe Angst, dich wieder zu verlieren, Flora.“
„Ich auch.“ Ich versuche, meine Angst zu lindern, lege meinen rechten Fuß auf ihre linke Wade.
„Warst du deshalb vorhin draußen?“, fragt Ella.
„Ja, die Angst lässt nach, wenn ich mich bewege.“
Wieder ruft der Waldkauz.
„Sollen wir uns ein wenig unterhalten, Flora? Ich kann ohnehin nicht schlafen.“
„Willst du wieder Fragen stellen?“ Ella hat mir den ganzen Abend über Fragen über mein Leben gestellt.
Sie lacht. „Ich kann nicht anders, aber ich muss immer an deine Zeit mit unserer Mutter zu denken. Du warst mit ihr zusammen. Ich nicht. Ich habe in Bad Urach gelebt und würde so gerne wissen, wie sie war. Ihr Charakter, meine ich.“
„Ich will nicht über sie reden, Ella.“ Etwas geschieht mit mir, das alles verändert und zurechtrückt, seit meine Schwester in mein Leben getreten ist. Meine mühsam aufgebaute Welt zersplittert und wird zu einem neuen, guten Ganzen zusammengefügt. Aber das Bild, das entsteht, ist ein Spiegel. Ich schaue hinein und sehe nichts. Wenn man erkennt, wer man wirklich ist, kann man es nicht in einem Spiegel sehen. Vielleicht um nicht am unvermittelt entdeckten Selbst zu zerbrechen?
Sie beugt sich leicht vor. „Und über dein Leben in den Bergen? Willst du überhaupt darüber reden? Wie waren deine Tage? War es schwer, dort zu überleben? Ist diese Frage in Ordnung?“
Ich balle die Hand zur Faust und strecke die Finger wieder aus. Ella drängt. Martha sagt, dass ich das auch mache, also antworte ich besser, denn sie wird nach anderen Wegen suchen, um Informationen aus mir herauszupressen.
„Ich habe nicht über meine Arbeit nachgedacht und darüber, ob sie schwer war oder nicht“, sage ich.
„Und abends? In deiner Freizeit? Was hast du da gemacht?“
Ella setzt sich aufrecht hin. Auch ich drücke mir das Kissen in den Rücken.
„Freizeit?“
Ich erinnere mich. Mama hat nie von Freizeit gesprochen. Sie hat mich die ganze Hausarbeit machen lassen, bis ich nicht mehr konnte. Ich scharre mit dem linken Fuß auf der Matratze. Den Unterschied zwischen ‚arbeiten‘ und ‚nicht arbeiten‘ lernte ich erst kennen, als ich in die Psychiatrie kam und die Krankenschwester nach Hause ging, weil sie ‚frei‘ hatte, und eine andere Schwester kam, die kein ‚frei‘ hatte.
„Ich kannte das Wort Freizeit nicht“, antworte ich und schnuppere Ellas Achselduft. Sie hat das Deodorant durch den Duft von Maiglöckchen ersetzt. „Ich tat, was Mama mir sagte, und folgte dabei dem Rhythmus der Jahreszeiten. Ich bin bei Sonnenaufgang aufgestanden und bei Sonnenuntergang ins Bett gegangen. Im Winter schlief ich länger, weil es kaum Kerzen gab und im Sommer nur kurz, weil es dann mehr zu tun gab. Bei der Arbeit habe ich auch Pausen gemacht. Wenn ich etwa Rückenschmerzen vom Unkraut jäten im Gemüsegarten hatte, habe ich eine Pause gemacht und etwas getrunken. Und abends musste ich in mein Zimmer gehen. Dort standen ein Tisch, ein Stuhl und ein Bett. An diesem Tisch habe ich immer gegessen.“
„Du hast allein in deinem Zimmer gegessen?“
„Ja. Mama hat auch allein gegessen. In ihrem Zimmer.“
Stille tritt ein. Das Summen einer Mücke ertönt. Sie kann uns nichts anhaben. Wir sind mit Zitronengras eingerieben. Ich taste meine Haut, sie fühlt sich glatt an. Früher hatte ich im Sommer immer Mückenstiche. Da gab es noch kein Zitronengras. Der Juckreiz hat mich wahnsinnig gemacht. Meine Haut war oft entzündet vom Kratzen.
„Und was hast du nach dem Essen gemacht?“, bohrt Ella weiter.
„Säckchen genäht.“
„Säckchen genäht?“
Ich nicke. „Mama hat sie mit ihren Kräutern gefüllt. Die hat sie bei den Leuten gegen Proviant eingetauscht.“
„Warst du nicht einsam?“
„Was meinst du?“
„Martha hat mir erzählt, dass du bis zu deinem vierzehnten Lebensjahr kaum Leute gesehen hast. Abgesehen von dem Monster.“
Habe ich die Menschen in meiner Kindheit vermisst?
„Nein. Ich habe keine Erinnerungen an ein Gefühl, etwas vermisst zu haben.“
Ich setze mich ein wenig mehr aufrechter hin und schaue nach draußen. Der Mond scheint auf dem markanten Hocheck-Gipfel. Er ist wieder kahl, denn der Schnee ist in der Sommerhitze geschmolzen. Auch von meinem Zimmer in Marthas Haus aus konnte ich den Berg sehen. Erst als ich bei ihr einzog, schien etwas mit meiner Erinnerung zu geschehen. Erst da wurde mir bewusst, dass ich in der fernen Vergangenheit mit anderen Menschen zusammengelebt hatte. Die Jahre mit meiner Mutter schienen sie ausgelöscht zu haben. Ich hatte sie vergessen. Plötzlich waren die Bilder aus meiner frühesten Kindheit wieder da, und sie kamen mit Gerüchen. Bei Martha roch ich zum ersten Mal wieder Bohnerwachs. Ich schaute auf den Marmorboden, hörte die Nonnen singen und sah sie in ihren langen schwarzen Gewändern vorbeigehen. Und als ich in Marthas Garten frisch gepflückte Erdbeeren aß, spürte ich wieder die Hand eines alten Mannes mit schwarzen Haaren in meiner. Wir liefen gemeinsam durch die Büsche und pflückten Beeren. Ich vermute, dass er einst mit meiner Mutter auf unserem Hof gelebt hat, als ich noch jung war.
„Gab es da oben auch glückliche Momente?“
Ich lehne mich zurück und schließe die Augen. Gab es glückliche Momente auf unserem Bauernhof? Was ist Glück? Für Ella muss es etwas anderes sein als für mich. Sie schöpft ihr Glück aus Freundschaften und materiellen Dingen. Ich hingegen empfinde Glück in der Abwesenheit von Menschen und den Dingen um mich herum. So war es auch in meiner Kindheit. Ich hatte meine friedlichen Momente, wenn ich allein war, weit weg von Mama, und eins war mit der Natur. Nach diesem Gefühl der Zugehörigkeit, der Sorglosigkeit, der kleinen, heiteren Welt sehne ich mich heute noch. Ich mag keine Orte, an denen sich Menschen zusammenrotten. Ich fühlte mich wunderbar zufrieden, wenn ich mit vollem Bauch auf dem Moos im Kiefernwald lag und die Wolken zwischen den Ästen vorbeizogen. Wenn ich Beeren pflückte oder Eichhörnchen und Vögel beobachtete. Wenn sich die Baumwipfel im Wind wogen und wie sie rauschten. Und dass ich lachte, wenn ich mit meinem schwanzwedelnden Bruno kuschelte. Aber meine glücklichen Momente wurden immer von Panik überschattet, wenn Mama mich in den Keller sperrte. Ich rücke ein wenig von Ella ab. Daran will ich jetzt nicht denken. Sie sperrte mich ein, wenn sie zu den Menschen ging, um ihre Kräuter gegen Vorräte einzutauschen. Wir würden verhungern, wenn sie nicht gegangen wäre. Und doch war das Einsperren unnötig, denn in den vergangenen Jahren war ich in der Lage, ein paar Tage allein auf dem Hof zu leben.
„Ja, es gab glückliche Momente da oben“, antworte ich.
„War Mama liebevoll?“, fragt Ella.
Mir wird wieder übel. Ich will keine weiteren Fragen mehr hören.
„Sie gab mir zu essen.“
„Sie gab dir zu essen? Und sonst nichts? Kuscheln? Hat sie das gemacht?“
Ellas Wade fühlt sich warm an. Ich habe auch schon ihren Arm berührt, ihr krauses Haar, ihren Rücken, ihre Wange. Und ihre nackte Schulter. Mamas Haut habe ich bis zu ihrem Tod nur selten gespürt. Sie war mir nur nahe, wenn sie mich mit einem Ruck hochhob und in den Keller trug, um mich einzusperren.
„Nein, Mama hat mich nie umarmt oder mit mir gekuschelt“, antworte ich. „Aber der Wind schon. Der Wind hat mich immer gestreichelt, wenn ich zu meinem Felsen gegangen bin.“
Ella bewegt sich. Der Duft der Maiglöckchen riecht säuerlich.
„Der Wind hat dich gestreichelt…“, flüstert sie. Ihr Griff um meine Hand wird fester.
„Ja.“
Eine Viertelstunde von unserem Hof entfernt erhebt sich ein vorspringender Felsen. Das weiche Moos auf dem grauen Stein fühlte sich gut an unter meinen nackten Füßen. Der Wind hatte dort freie Bahn. Jeden Tag ging ich hinauf. In den warmen Monaten zog ich mich aus, stellte mich fest auf die Beine, breitete die Arme aus, schloss die Augen, warf den Kopf in den Nacken und atmete tief ein. Mal streichelte mich der Wind langsam, mal heftig, mal drückte er gegen mich, manchmal mit heftigen Stößen. Meine Haut kribbelte. Die Berührung war intensiv. Ich war glücklich auf meinem Felsen, mit dem Wind, der mal warm, mal kalt war. Ich konnte genau riechen, wo er gewesen war. Wenn er von der Seite kam, wo die Sonne unterging, roch er salzig. Wenn er von der Seite kam, wo die Sonne aufging, roch er sandig. Jede Richtung hatte ihren eigenen Geruch.
„Ja, Ella, ich liebe den Wind. Ich muss ihn jeden Tag spüren, deshalb lebe ich hier. Und ich hatte unsere Kaninchen und Ziegen und eine Zeit lang meinen kleinen Hund Bruno. Die haben auch gekuschelt. Auf ihre Art.“
Ella räuspert sich. „Wie traurig“, flüstert sie. „So allein.“
„Nein“, ich streichle ihren Daumen. „Ich war nie allein. Die Berge und der Wind waren immer bei mir. Sie haben mich gerettet, als Benjamin starb. Sie haben mich gelehrt, dass das Weinen immer aufhört, wie der Regen.“
Ella schweigt. Die Atmosphäre ist plötzlich voller Trauer geladen, so kommt es mir vor.
„Und worüber habt ihr gesprochen?“, fragt sie nach langem Schweigen. „Hat sie nie etwas über mich gesagt? Dass es noch ein Kind gibt?“
„Nein. Mama hat nie mit mir gesprochen. Sie hat nur Befehle erteilt. Dabei hat sie mich nicht einmal angesehen. Sie drehte sich zur Seite und sagte mir, was ich tun sollte, oder brachte mir bei, wie man Tiere tötet und häutet. Wie man Kräuter sammelt und abfüllt. Wie sie wirken. Und was ich essen durfte und was nicht. An manchen Tagen sprachen wir kein Wort miteinander. Wir lebten in Stille. Mama stotterte. Vielleicht war sie deshalb so still. Ich weiß noch, dass ich es sehr komisch fand, als ich in Prien plötzlich über meine Gefühle reden musste.“ Ich ziehe das Laken noch etwas höher.
„Prien?“