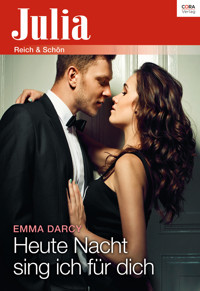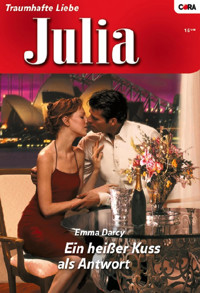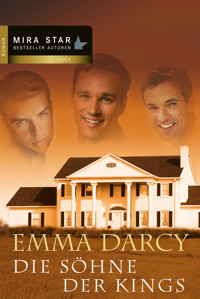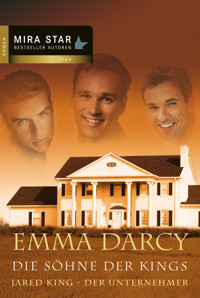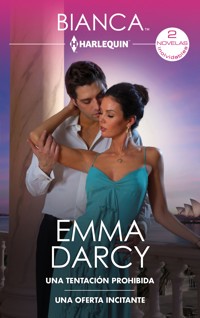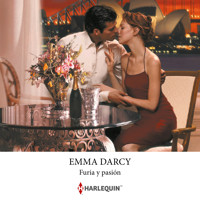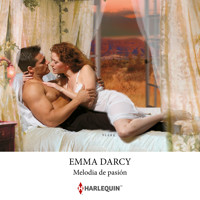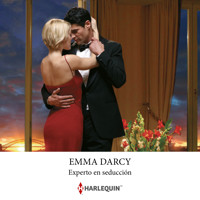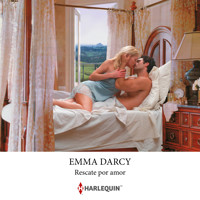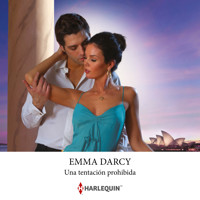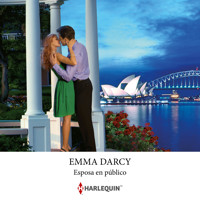1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CORA Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Digital Edition
- Sprache: Deutsch
Noch wagt Lydia ihrem Glück nicht so recht zu trauen: Der umschwärmte Peter Kelso, der Freundinnen wie seine Hemden wechselt, hat plötzlich nur noch Augen für sie. Jedes Problem löst er für sie - bei jedem Kummer ist er sofort an ihrer Seite. Liebt er sie wirklich oder sucht er nur ihre Freundschaft?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
IMPRESSUM
Wir sind füreinander bestimmt erscheint in der HarperCollins Germany GmbH
© by Emma Darcy Originaltitel: „The Unpredictable Man“ erschienen bei: Mills & Boon Ltd., London Published by arrangement with HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V./S.àr.l.
© Deutsche Erstausgabe in der Reihe JULIABand 779 - 1988 by CORA Verlag GmbH & Co. KG, Hamburg
Umschlagsmotive: GettyImages_Remains
Veröffentlicht im ePub Format in 02/2018 – die elektronische Ausgabe stimmt mit der Printversion überein.
E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 9783733755607
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten. CORA-Romane dürfen nicht verliehen oder zum gewerbsmäßigen Umtausch verwendet werden. Sämtliche Personen dieser Ausgabe sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
Weitere Roman-Reihen im CORA Verlag:BACCARA, BIANCA, JULIA, ROMANA, HISTORICAL, MYSTERY, TIFFANY
Alles über Roman-Neuheiten, Spar-Aktionen, Lesetipps und Gutscheine erhalten Sie in unserem CORA-Shop www.cora.de
Werden Sie Fan vom CORA Verlag auf Facebook.
1. KAPITEL
Lydia fühlte sich noch einsamer als sonst. Ihr Vater saß neben ihr, das Lenken des Daimlers erforderte seine ganze Aufmerksamkeit. Von hinten drang die Stimme ihrer Mutter wie eine eintönige Melodie an ihr Ohr. Sie versuchte Deborah zu trösten, die nicht aufhörte zu betonen, wie empört sie sei. Mit Lydia sprach niemand. Seit der Anwalt Tante Henriettas erstaunliches Testament verlesen hatte, erntete sie nur noch eisige Blicke. Sie sehen mich an wie ein lästiges Insekt, das man gern verscheuchen würde, dachte Lydia.
„Henrietta kann nicht bei Verstand gewesen sein!“
Alicia Mansfields Anklage richtete sich scheinbar gegen ihren Mann, aber gemeint war Lydia, daran bestand kein Zweifel. Wer Lydia ihrer schönen Schwester vorzog, musste verrückt sein, eine andere Erklärung gab es nicht. Tränen stiegen Lydia in die Augen. War es so ungerecht, dass jemand einmal etwas Gutes für sie tat? Ein einziges Mal? Sie hatte sich seit Jahren daran gewöhnt, von ihren Eltern zurückgesetzt zu werden, aber dieser neue Beweis ihrer Lieblosigkeit schmerzte doch. Tante Henrietta würde ihr fehlen, der einzige Mensch in der Familie, der jemals gerecht zu ihr gewesen war. Mehr als gerecht, wie ihr Testament bewies.
Lydia sah ängstlich auf ihren Vater. Kränkte ihn der Vorwurf, seine Schwester sei geistig umnachtet gewesen, oder irritierte ihn Deborahs leises Schluchzen? Sein grimmiger Gesichtsausdruck ließ beide Deutungen zu.
„Es hat keinen Sinn, derartige Vermutungen anzustellen, Alicia“, sagte er scharf. „Das Testament ist einwandfrei gültig. Kein Gericht würde die absurde Behauptung ernst nehmen, die Direktorin der angesehensten Mädchenschule von Sydney sei verrückt gewesen. Außerdem würde ich niemals zulassen, dass der Name Mansfield aus so zweifelhaftem Anlass in die Presse kommt. Es gibt deshalb in dieser Angelegenheit nur eine einzige Lösung. Wir müssen diesen bedauerlichen Irrtum unter uns regeln.“
Lydia zuckte zusammen. Sie würden ihr die Erbschaft streitig machen, irgendwie. Noch schwiegen sie, aber Lydia spürte die Feindseligkeit, die von ihnen ausging. Ein Schauer überlief ihren Rücken, so deutlich empfand sie Deborahs hasserfüllte Blicke. Ihr Schluchzen hatte Erfolg gehabt wie immer. Sie verfügte über die bemerkenswerte Gabe, es je nach Bedarf an- oder abzustellen.
Tiefe Traurigkeit überfiel Lydia. Egal, was sie tat, egal, wie verzweifelt sie sich um die Gunst ihrer Eltern bemühte, Deborah kam immer an erster Stelle. Der volle Glanz der Sonne fiel auf sie, während Lydia im Schatten lebte, ohne Zustimmung und Anerkennung. Es war fast ein Wunder, dass Tante Henrietta sie ihrer schönen, bewunderten Schwester vorgezogen hatte, das hässliche Entlein dem stolzen Schwan.
Würde sie, Lydia, dieses unerwartete Glück genießen können? Schwerlich. Sie war und blieb eine Versagerin, geboren dazu, alles falsch zu machen und von anderen missachtet zu werden. Tante Henrietta hatte es gut gemeint, aber es würde Lydia nur neue Schwierigkeiten einbringen, dass sie ihr die elegante Wohnung in Kirribilli vermacht hatte.
Der Wert der Wohnung war bedeutend, doch darüber regte sich niemand auf. Die Mansfields waren wohlhabend genug, um sich von Geld nicht beeindrucken zu lassen. Nein, das Unerhörte lag darin, dass Lydia und nicht Deborah die Erbin war. Jeder hatte etwas bekommen, aber der Hauptteil war an Lydia gefallen. Nicht an Deborah, wie es sich gehört hätte. Wäre sie die Hauptbegünstigte gewesen, hätte niemand ein Wort darüber verloren. Es wäre nur natürlich gewesen, dachte Lydia und fühlte, wie die alte Bitterkeit in ihr aufstieg.
Sie passte nicht in die Mansfield-Familie. Sie war einfach nicht dafür geschaffen, in der Gesellschaft zu glänzen und herumzuflattern wie ein Schmetterling. Sie sah nicht so aus, und sie konnte sich nicht so benehmen. Deborah dagegen konnte es, aber Lydia würde nie wie ihre Schwester werden. Sie hatte es lange genug versucht, immer mit dem gleichen negativen Ergebnis. Es war an der Zeit, mit diesen sinnlosen Versuchen aufzuhören und von zu Hause fort zu gehen. Irgendwohin, wo sie das tun konnte, was sie wollte. Wo ihr Leben einen Sinn bekommen würde. Warum sollte sie nicht auch einmal Erfolg haben? Sie musste.
Der Gedanke beschäftigte Lydia und nahm immer klarere Gestalt an. Tante Henrietta hatte sie mit einer Wohnung versorgt. Lydia brauchte nur noch einen Job zu finden, um Geld zu verdienen. In der Freizeit würde sie an ihren Entwürfen arbeiten. War das Testament erst einmal bestätigt, konnte sie ihren Bargeldanteil benutzen, um einen eigenen Laden aufzumachen und ihre Arbeiten zu verkaufen. Vielleicht würde sie sogar neue Aufträge bekommen.
Während der ganzen Heimfahrt dachte Lydia an nichts anderes. Der Kopf schwirrte ihr von Zukunftsplänen, und sie vergaß vorübergehend sogar die Feindseligkeit ihrer Familie. Sobald der Wagen hielt, sprang sie heraus und lief nach oben in ihr Zimmer.
Ein Anruf beim Anwalt ergab, dass Lydia in Tante Henriettas Wohnung ziehen konnte, wann sie wollte – sie brauchte sich nur den Schlüssel abzuholen. Blieb noch das Problem, einen Job zu finden, aber das musste ebenfalls zu lösen sein. Ihr Zeugnis von der Kunsthochschule konnte nicht völlig wertlos sein.
Sie fühlte Dankbarkeit für Tante Henrietta, ohne deren Hilfe sie die Hochschule nie besucht hätte. Gerald Mansfield hatte klipp und klar erklärt, Kunst zu studieren sei unseriös und nicht gesellschaftsfähig. Er werde nicht dulden, dass seine Tochter sich lächerlich mache. Lydias sehnlicher Wunsch war erst in Erfüllung gegangen, als Tante Henrietta zum Kampf gegen ihren Bruder angetreten war. Ihr Sieg war schwer errungen, aber endgültig. Trotzdem hätte Lydia vielleicht einen Rückzieher gemacht, wenn Tante Henrietta sie nicht streng angesehen und ermahnt hätte, das in sie gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen. Dass ihre Fürsorge sogar noch über den Tod hinausreichte, machte Lydia glücklich und bestärkte sie in ihrem Entschluss.
Auch wenn das Zeugnis ihr nicht zu einem Job verhalf, würde sie es schaffen. Sie hatte eine gute Schulausbildung und wusste ihre Fähigkeiten ins rechte Licht zu rücken. Jede Arbeit würde ihr willkommen sein. Es handelte sich nur um eine Übergangszeit, allein das Ziel war wichtig.
Lydia spürte, wie der alte Ehrgeiz in ihr erwachte, den die Familie systematisch unterdrückt hatte. Sie öffnete den Kleiderschrank und holte die vier großen Plastikbeutel heraus, in denen sie ihre Arbeiten aufbewahrte. Die ganze Zukunft lag darin, alles, was sie sich wünschte und was immer nur als „Lydias kleines Hobby“ abgetan worden war. Diese Arbeiten würden der Grundstock ihres Ladens sein.
Sie wollte gerade den Beutel öffnen, der ihr Lieblingsstück enthielt, als Deborah hereinkam. Ein scheinheiliges Lächeln umspielte ihre makellos geschminkten Lippen.
„Na, Lydia? Zufrieden mit dir?“
Das bösartige Funkeln in Deborahs Augen warnte Lydia, nicht zu antworten. Sie packte die Plastikbeutel wieder in den Schrank und verschloss die Tür. Vor Deborah war nichts sicher. Sie machte sich wie ihre Eltern über Lydias Entwürfe lustig, hatte sie aber ungeniert um ein selbst entworfenes Tüllkleid gebracht. „Borgen“ nannte sie das, und da die Eltern ihrer Lieblingstochter alles nachsahen, konnte Lydia nichts machen. Damit ist jetzt Schluss, schwor sie sich. Du wirst mir nichts mehr wegnehmen, liebe Schwester!
„Verrätst du mir dein Geheimnis?“, stichelte Deborah weiter. Sie hatte sich aufs Bett gelegt, ihre Haltung war vollendet weiblich und graziös. „Wie hast du Tante Henrietta dazu gebracht, dir den Löwenanteil zu überlassen? Ich dachte immer, du seist zu stolz, um zu betteln oder anderen etwas vorzujammern.“
Lydia war auf der Hut. „Ich weiß nicht, warum sie es getan hat“, sagte sie abweisend. „Ich war genauso überrascht wie ihr.“
„Diese engstirnige Jungfer … bestimmt war sie übergeschnappt.“ Deborah bemühte sich nie um geschliffene Umgangsformen, wenn sie mit Lydia allein war. „Ein Glück, dass sie tot ist. Sie hat dich immer vorgezogen. Aber glaub ja nicht, dass dir das etwas nützt. Daddy ist auf meiner Seite.“
Lydia spürte die alte Wunde. Sie wäre am liebsten auf Deborah losgegangen, aber das hätte nur unangenehme Folgen gehabt. Stattdessen bemühte sie sich, der Schwester ihre Verachtung zu zeigen.
„Bist du so wütend auf die Tante, weil sie die Einzige war, die du nicht um deinen kleinen Finger wickeln konntest? Ist das der Maßstab, nach dem du Menschen beurteilst?“
Deborahs Lächeln wurde noch süßer. „So streitlustig kenne ich dich ja gar nicht, Lydia. Ich rate dir, Daddy gegenüber vorsichtiger zu sein. Tante Henrietta ist tot und kann dir nicht mehr beistehen. Und was ist am Ende so ein Testament? Nichts als ein Stück Papier.“ Ein triumphierender Ausdruck trat in ihre Augen. „Übrigens erwartet Daddy dich in der Bibliothek … zu einem kleinen Schwätzchen. Er hat mich beauftragt, dich hinunterzuschicken. Ich hatte es einen Moment lang vergessen.“
Lydias Mut schwand. Eine Unterhaltung mit ihrem Vater konnte nur eins bedeuten – sie würde einmal mehr das ganze Ausmaß seines Zorns zu spüren bekommen. Niedergeschlagen sah sie Deborah hinausgehen, es war mehr ein Schweben als ein Gehen. Noch fester als vorher klammerte sich Lydia an ihren Vorsatz, während sie langsam hinunterging. Sie musste sich ihrem Vater stellen, aber es war das letzte Mal.
Lydia hasste die Bibliothek, zu viele Wunden waren ihr dort zugefügt worden, zu viele Kränkungen und Niederlagen hatten dort stattgefunden. Die Angst beschleunigte ihren Herzschlag, aber sie zwang sich zur Ruhe und beschloss, diesen letzten Kampf mit Stolz und Würde auszufechten.
Gerald Mansfield lehnte mit gekreuzten Armen am Schreibtisch, als sie eintrat. Er schien ärgerlich zu sein, wie immer, wenn er sie erwartete. „Das nächste Mal bitte ich mir Pünktlichkeit aus, Lydia“, begann er unfreundlich.
Lydia wusste aus Erfahrung, dass es gänzlich sinnlos gewesen wäre, Deborah die Schuld an der Verspätung zu geben. Auf einen ungeduldigen Wink hin setzte sie sich in einen der großen Ledersessel in denn ihr zierlicher Körper fast verschwand. Das gab ihr wie immer das Gefühl der Unterlegenheit. Sie nahm allen Mut zusammen und blickte ihren Vater offen an.
Er war ein kräftiger Mann und sah mit seinen neunundvierzig Jahren noch immer gut aus. Und er war noch immer blind, was Deborah betraf.
„Ich habe über diese unglückliche Geschichte nachgedacht, Lydia“, fuhr er nach einem umständlichen Räuspern fort. „Du weißt natürlich auch, dass das Testament, so wie es lautet, eine grobe Ungerechtigkeit gegenüber Deborah ist. Ich begreife nicht, was sich Henrietta dabei gedacht hat. In jedem Fall wird ihre Wohnung verkauft, damit der Erlös zwischen dir und deiner Schwester geteilt werden kann … wie es gleich hätte geschehen sollen.“
Lydia wurde blass. Der Traum vom selbstständigen Leben, vom eigenen Laden, von Ruhm und Erfolg geriet ins Wanken.
„Das … das kannst du nicht tun“, protestierte sie.
„Natürlich kann ich das, ich brauche nur dein schriftliches Einverständnis. Und ich darf wohl erwarten, dass du mir keine Schwierigkeiten machst.“
Er wollte sie einschüchtern, aber Lydia ließ sich nicht beirren. „Entschuldige, Dad, Tante Henrietta wollte, dass ich die Wohnung bekomme und …“
„Lydia?“, fuhr er aufgebracht dazwischen. „Nicht nur, dass du Henrietta hinter unserem Rücken beeinflusst hast …“
Genau wie Deborah! Er glaubte, was sie ihm einredete, ohne je die leisesten Zweifel zu haben. Lydia sprang auf. „Denkst du das wirklich?“, rief sie, am ganzen Körper bebend. „Dass ich mich heimlich an Tante Henrietta herangemacht habe?“
„Was soll ich denn sonst denken? Henrietta hätte Deborah sonst nie so übergangen.“
Lydia kämpfte gegen die aufsteigenden Tränen an. Sie musste ruhig bleiben, wenn sie sich behaupten wollte. „Ich gebe die Wohnung nicht für Deborah auf“, sagte sie mit Nachdruck. „Ich will dort wohnen, mir einen Job suchen und für mich selbst sorgen. Ich werde einen Laden aufmachen …“
„Einen Laden?“
„Ja, einen Laden. Das ist mein Wunsch, Dad, aber du hast nie auf meine Wünsche gehört. Ich muss endlich …“
„Meine Tochter als gewöhnliche Verkäuferin? Das werde ich niemals zulassen!“
Er wollte sie nicht verstehen, wie er es nie gewollt hatte. Verzweiflung übermannte sie. „Dann brauchst du mich ab heute nicht mehr zu kennen … glaubst du, das macht mir noch etwas aus? Ich existiere ja schon seit Jahren nicht mehr für dich!“
Das Gesicht des Vaters rötete sich vor Zorn. „Du weißt nicht, was du sagst, Lydia. Du hast die gleiche Liebe und die gleichen Rechte gehabt wie deine Schwester.“
„Die gleichen, Dad? Wirklich die gleichen?“
„Deine Eifersucht auf Deborah ist unberechtigt und stellt dir kein gutes Zeugnis aus, Lydia.“ Seine Stimme wurde lauter und drohender. „Nenne mir ein Beispiel … einen einzigen Fall, bei dem du schlechter weggekommen bist als sie.“
Es fiel Lydia schwer weiterzusprechen, die Ungerechtigkeit ihres Vaters tat zu weh. Doch Schweigen half ihr auch nicht weiter. Jetzt war vielleicht die letzte Gelegenheit, ihm doch noch die Augen zu öffnen.
„Ich könnte dir tausend Beispiele nennen, Dad, aber wenn du nur eins hören willst … bitte.“ Sie ging zum Schreibtisch und nahm das goldgerahmte Foto, das dort stand, in die Hand. „Hier … du und Deborah am Tag ihrer Schulentlassung, der stolze Vater und die schöne Tochter. Wo ist das Foto von dir und mir?“ Tränen schossen Lydia in die Augen, während sie auf das Bild hinuntersah. „Du fuhrst mit Deborah in die Stadt und kauftest ihr das hübscheste Kleid, das du finden konntest. Du warst so stolz auf sie, dass du einen Fotografen ins Haus bestelltest, um diese Aufnahme machen zu lassen. Du und deine geliebte Tochter.“ Lydia hielt die Tränen nicht länger zurück. „Hast du dasselbe auch für mich getan?“
„Du hast mich nicht darum gebeten. Ein Wort und …“
„Deborah brauchte dich nicht zu bitten. Ich hoffte, du würdest von dir aus zu mir kommen … mir auch etwas von der Liebe geben, mit der du Deborah immer überhäuft hast. Ich habe zu lange gewartet, Dad. Es ist mir egal, ob du mich nach dem heutigen Tag kennst oder nicht, aber Deborah hat mehr als genug bekommen. Was Tante Henrietta mir vermacht hat, behalte ich. Morgen ziehe ich in ihre Wohnung.“ Lydia stellte das Foto wieder auf den Schreibtisch und ging zur Tür. „Kein Wort von dir kann mich in diesem Entschluss noch umstimmen.“
„Lydia … komm gefälligst zurück!“
Sie überhörte den Befehl und floh in ihr Zimmer. Sie war zu erregt, um sich die Entschuldigungen ihres Vaters anzuhören, und sie wusste, er würde sich entschuldigen.
Sie begann zu packen. Alles, was ihr persönlich gehörte, wurde in Koffern und Kartons verstaut, bis Schränke und Kommoden leer waren. Niemand kam herauf, um mit ihr zu sprechen. Doch die Auseinandersetzung würde noch kommen. Deborah würde sich mit ihrem Los nicht abfinden, und ihr Vater würde alles tun, um sie glücklich zu machen. Und noch etwas wusste Lydia – ihre Mutter würde nie und nimmer verstehen, warum sie von zu Hause fortging. Sie hatte die Ansichten ihrer jüngeren Tochter nie verstanden, sich allerdings auch keine besondere Mühe gegeben, es zu tun.
Lydia hatte innerlich von allem Abschied genommen, als sie zum Dinner nach unten kam, aber sie war auch zu stolz, dem Kampf auszuweichen.
Deborah sprudelte über vor guter Laune. „Daddy hat die himmelschreiende Ungerechtigkeit von Tante Henriettas Testament gutgemacht“, berichtete sie triumphierend. „Er eröffnet mir morgen ein Konto mit der Summe, die deinem Erbe entspricht.“ Ihre Augen glänzten. „Ich kann mit dem Geld machen, was ich will.“
„Es war ausgleichende Gerechtigkeit“, ergänzte Gerald Mansfield.
Lydia sah aufmerksam zu ihrer Mutter hinüber. Ihr schönes Gesicht, das Deborah von ihr geerbt hatte, verriet deutlich, dass sie ärgerlich war.
Lydias Entschlossenheit wuchs. „Ich weiß nicht mehr, was gerecht ist und was nicht“, sagte sie und sah ihren Vater durchdringend an. „Ich weiß nur, dass in dieser Familie kein Platz für mich ist.“
„Du enttäuschst mich, Lydia. Ich hatte angenommen, du würdest deinen Trotz überwinden und wieder zur Vernunft kommen. Niemand kann dich zwingen, etwas zu teilen, was gesetzlich dir gehört. Du solltest aber wenigstens genügend Verstand besitzen, dir mit Hilfe von Henriettas Wohnung ein regelmäßiges Einkommen zu sichern. Es ist lächerlich, von zu Hause fortzulaufen oder auch nur davon zu sprechen.“
„Trotzdem gehe ich, Dad. Ich habe mit dem Anwalt gesprochen … es steht nichts im Wege, dass ich in mein neues Heim einziehe. Ich verlasse euch morgen Früh.“
„Das ist unmöglich!“, ereiferte sich Mrs. Mansfield. „Was sollen die Leute denken? Gerald, du darfst sie einfach nicht gehen lassen?“
„Wenn du unseren Wunsch missachtest, verweigere ich dir in Zukunft jede Unterstützung“, drohte ihr Vater.
Lydia sah ihn traurig an. „Hast du nie gemerkt, dass ich etwas anderes als Geld von dir wollte, Dad?“
Gerald Mansfield runzelte die Stirn, zum ersten Mal nachdenklich und nicht vorwurfsvoll. Er schien plötzlich zu ahnen, wie sehr Lydia in all den Jahren durch seine Schuld gelitten hatte. Er wollte etwas sagen, tat es dann aber doch nicht.
Lydias Mutter hingegen empfand offensichtlich nichts. „Glaube ja nicht, dass ich mich damit abfinde!“, erklärte sie scharf. „Ich erlaube nicht, dass du etwas tust, was deinen Ruf ruiniert. Das wäre in höchstem Maße undankbar … um nicht zu sagen überspannt.“
„Ach, Mummy!“ Deborah versuchte, Mrs. Mansfield zu beruhigen. „Lydia ist über einundzwanzig. Lass sie ihr Schicksal eine Weile selbst in die Hand nehmen.“
Lydia wusste, dass Deborah sie nicht aus Sympathie unterstützte. Die einzige Tochter des Hauses zu sein, musste sie ganz einfach reizen. Ihre Mutter dagegen interessierte nur, was die anderen machten. Das war schon immer ihre einzige Sorge gewesen, das Maß, mit dem sie alles gemessen hatte.
„Sie wird Tür an Tür mit diesem … Mann leben“, fuhr Mrs. Mansfield beinahe angewidert fort. „Ein anständiges Mädchen hat da nichts zu suchen. Bei Henrietta war das etwas anders … eine ältliche Schuldirektorin ist über jeden Zweifel erhaben. Aber Lydia? Sie wird unweigerlich ins Gerede kommen.“
Deborah brach in helles Lachen aus. „Beunruhige dich nur deshalb nicht, Mummy“, spottete sie. „Peter Kelso wird Lydia nicht einmal bemerken.“
„Darum geht es nicht, Deborah. Die Leute …“
„Ach Mummy … Lydia ist nun wirklich kein Objekt für die Presse. Denk an die Frauen, mit denen Peter Kelso zusammen war. Sie hatten entweder große Namen oder waren vielbeneidete Schönheiten.“
So ist es recht, liebe Schwester, dachte Lydia. Sag es nur recht deutlich, dass das hässliche Entlein der Mansfields reizlos für einen berüchtigten Frauenhelden ist.
„Allein unser Name wird die Presse aufhorchen lassen.“ Mrs. Mansfield widersprach ihrer Lieblingstochter zum zweiten Mal. „Diesem Mr. … ich bringe es nicht fertig, seinen Namen auszusprechen, wird es ein Vergnügen sein, auch den Namen Mansfield in den Schmutz zu ziehen. Hast du vergessen, wie es den Thursons ergangen ist? Sie sind in der Gesellschaft von Sydney ein für alle Mal erledigt.“
Deborah machte ein scheinheiliges Gesicht. „Ein Makler darf sich eben keine Unterschlagung leisten, Mummy.“
„Niemand wird mich je davon überzeugen, dass Howard Thurson nicht für seine Kunden investiert hat. Wenn dieser … dieser Spieler nicht gewesen wäre …“ Mrs. Mansfield sah ihren Mann streng an. „Ich werde nie gutheißen, dass du sein Börsenblatt beziehst, Gerald. Schließlich haben wir mit den Thursons einmal verkehrt.“
„Ich lese das Blatt, weil die Tipps immer stimmen“, antwortete Gerald Mansfield ruhig. „Ein Mann, der Millionen gemacht hat durch …“
„Glücksspiel!“
„Wir spielen alle, Alicia, wenn wir investieren.“
Lydia horchte bei dem letzten Wort auf. Genau das tue ich, dachte sie. Ich investiere etwas, um in der Zukunft die Früchte zu ernten.
Ihre Mutter ließ sich nicht so schnell beruhigen. „Trotzdem kannst du nicht zulassen, dass deine Tochter direkt neben ihm wohnt. Sein Ruf ist schlecht, das weißt du so gut wie ich. Peter Kelso ist ein … Verführer ohne jedes Ehrgefühl. Ich werde nicht zulassen, dass meine Tochter in seine Nähe kommt. Niemals!“
Gerald Mansfield sah seine Tochter an. Er versuchte Lydia zu verstehen, vielleicht zum ersten Mal.
„Deine Mutter hat nicht ganz Unrecht, Lydia“, sagte er weicher, als es sonst seine Art war.
Lydia sehnte sich noch immer danach, Verständnis bei ihrem Vater zu finden. Würde sie es erreichen, wenn sie die Worte sorgfältig wählte? Vielleicht, doch Deborah hätte nicht dabei sein dürfen.
Lydia sah sie von der Seite an. Der wache Ausdruck in den grünen Augen und der ironische Zug um Deborahs Mund verrieten ihr, dass ihre Schwester jeden Versuch in dieser Richtung verhindern würde. Es war zu spät. Viel zu spät.
„Du solltest deiner Erziehung mehr trauen, Dad“, sagte Lydia daher nur. „Wir Mansfields sind unseren Nachbarn gegenüber immer zurückhaltend gewesen.“
Tatsächlich hatte sie wenig Lust, sich mit einem so zweifelhaften Mann einzulassen, auch wenn er in Zukunft ihr Nachbar war. Früher oder später würde sie ihm über den Weg laufen, aber dabei wollte sie es belassen. Tante Henrietta hatte den Umgang mit ihm für unpassend gehalten, das wusste Lydia. Trotzdem beschäftigte er ihre Neugier, doch sie hatte den berüchtigten Peter Kelso noch nie gesehen.
Mrs. Mansfield beruhigte der Hinweis auf Lydias tadellose Erziehung keineswegs. Es ärgerte sie, dass ihr Mann sie nicht mehr unterstützte, und auch Deborahs berechnende Worte trösteten sie diesmal nicht.
Als Lydia am nächsten Morgen Koffer und Kartons in ihrem Kombiwagen verstaute, überhäufte sie ihre Tochter mit Vorwürfen und Klagen, bekam aber keine Antwort. Was Lydia sagen wollte, hatte sie gesagt.
Dann war es so weit. Deborah erschien und gab sich zum Abschied versöhnlich. Lydia küsste ihre Mutter mechanisch auf die Wange. „Auf Wiedersehen, Mummy.“
Ihr Vater hatte schweigend geholfen, das Gepäck zu verladen. Er hatte den Redeschwall seiner Frau nicht gebremst, sie aber auch nicht in ihren Vorwürfen unterstützt. Als sich Lydia von ihm verabschiedete, las sie zum ersten Mal echte Sorge in seinen Augen. „Leb wohl, Dad. Ich danke dir für alles, was du für mich getan hast.“
Er ergriff ihre Hand und drückte sie in einer plötzlichen Gefühlsaufwallung. „Du kommst doch zu mir, wenn du Hilfe brauchst, Lydia?“, fragte er mit rauer Stimme.
Würde sie es tun? Nein. Die Zeit dafür war lange vorbei. Zu oft hatte er ihr nicht zugehört, zu oft sich blind gegenüber ihren Sorgen und Nöten gestellt und ihr keine Liebe gegeben. Sie dachte an die vielen verpassten Gelegenheiten und war plötzlich berührt. „Ich werde daran denken, Dad.“
Nach einem letzten Blick auf das Haus, in dem sie so lange gelebt hatte, stieg sie in ihr Auto. Es war ein großes, prächtiges Haus, das häufig Treffpunkt von Sydneys Gesellschaft war. Für Lydia hatte es jedoch immer nur ein Gefängnis dargestellt.
Sie schlug die Autotür zu, ließ den Motor an und fuhr die baumgesäumte Auffahrt hinunter, ohne sich ein einziges Mal umzusehen. Die Vergangenheit lag hinter ihr, eine Folge von Fehlschlägen, an die sie nicht mehr denken durfte. Sie bereute ihre Entscheidung nicht. Die Zukunft winkte. Ein neues Buch lag vor ihr aufgeschlagen, in das sie selbst ihre Geschichte schreiben würde.