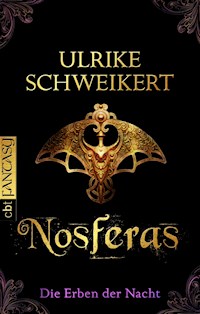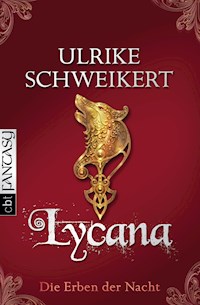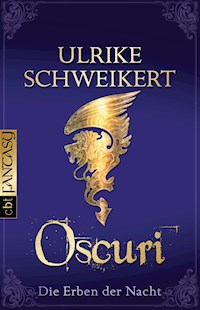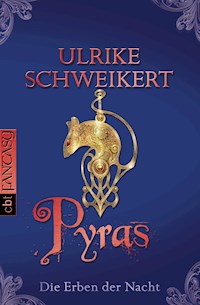9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als sie bei der Testamentseröffnung ihres Vaters erfährt, dass sie ein Haus auf Cape Cod geerbt hat, fällt Jane aus allen Wolken. Was hat es mit diesem Haus auf sich und mit dem Stapel Briefe – auf Deutsch verfasst – aus dem Nachlass ihrer Mutter? Seit ihrem traumatischen Einsatz als Sanitäterin im Irakkrieg wird Jane von Albträumen geplagt. Selbst die Musik, die ihr einst alles bedeutete, hat sie aufgegeben. Die Tochter eines schwarzen US Marines und einer weißen Krankenschwester mit deutschen Wurzeln fühlte sich immer zerrissen, nirgends zugehörig. Während sie das Haus auf Cape Cod ausräumt, das ihren aus Deutschland ausgewanderten Großeltern gehörte, erschließt sie sich Stück für Stück die Geschichte ihrer Herkunft. Vor allem die Briefe berühren sie zutiefst. Sie schrieb ihr Großvater 1915 aus Bagdad an seine spätere Frau. Ein besonders dunkles Kapitel der Geschichte entblättert sich, aber auch die Geschichte einer großen Liebe …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 649
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Ulrike Schweikert
Woher wir kamen
Roman
Über dieses Buch
Über Meere und Zeiten hinweg
Als sie bei der Testamentseröffnung ihres Vaters erfährt, dass sie ein Haus auf Cape Cod geerbt hat, fällt Jane aus allen Wolken. Was hat es mit diesem Haus auf sich und mit dem Stapel Briefe aus dem Nachlass ihrer Mutter? Seit ihrem traumatischen Einsatz als Sanitäterin im Irakkrieg wird Jane von Albträumen geplagt. Selbst die Musik, die ihr einst alles bedeutete, hat sie aufgegeben. Als Tochter eines Schwarzen US-Marines und einer weißen Krankenschwester mit deutschen Wurzeln fühlt sie sich nirgends zugehörig. Sie beschließt, nach Cape Cod zu fahren. Dort, im Haus ihrer aus Deutschland ausgewanderten Großeltern, erschließt sich ihr Stück für Stück die Geschichte ihrer Herkunft. Jane ist tief berührt von den Briefen ihres Großvaters, die er 1915 aus Konstantinopel und Bagdad an seine spätere Frau schrieb. Sie enthüllen ein besonders dunkles Kapitel des Krieges, aber auch die Geschichte einer großen Liebe …
Vita
Ulrike Schweikert arbeitete nach einer Banklehre als Wertpapierhändlerin, studierte Geologie und Journalismus. Seit ihrem Romandebüt «Die Tochter des Salzsieders» ist sie eine der bekanntesten deutschen Autorinnen historischer Romane. Mit ihrer Erfolgsreihe «Die Charité» begeisterte sie ein großes Publikum und schaffte es in die Top 10 der Bestsellerliste.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Copyright © 2024 by Ulrike Schweikert
Redaktion Heike Brillmann-Ede
Covergestaltung zero-media.net, München
Coverabbildung FinePic®, München
ISBN 978-3-644-01422-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für meinen geliebten Mann Peter
Prolog
Ich kann die Schwere spüren, die von meinen Gliedern Besitz ergreift. Müdigkeit und Erschöpfung drücken auf meine wild kreisenden Gedanken und halten sie für einen Moment an. Der Schlaf lauert in einer Ecke, bereit, die Herrschaft zu übernehmen, doch noch wehrt sich etwas in mir. Es ist die Furcht davor, die Kontrolle zu verlieren, aufzugeben, in die Schwärze zu fallen, in deren Schatten die Monster mit gebleckten Zähnen lauern.
Nein, es sind keine Krokodile unter dem Bett, keine Vampire vor der Tür und auch sonst keine fantasievollen Monster aus den Büchern meiner Kindheit oder den Horrorfilmen, die ich später mit meinem Bruder heimlich geschaut habe und die mir damals den Schlaf geraubt haben. Diese neuen Feinde gibt es wirklich. Ich habe ihnen in die Augen geblickt, ich habe ihren heißen Atem gespürt, ich war mitten unter ihnen, mitten zwischen Tod und Verderben und namenlosem Grauen, das mich jetzt heimsucht, sobald ich mich dem Schlaf überlasse und meinem Geist die Chance gebe, unkontrolliert seine Träume zu spinnen.
Mein Vater erhebt sich vor mir in meinem Traum: groß, stark, unumstößlich, wie ich ihn all die Jahre erlebt habe. «Du darfst dich vor der Angst nicht wegducken, sonst besiegt sie dich. Stelle dich ihr entgegen, sei stark und sieh ihr in die Augen, dann kann sie dir nichts anhaben!»
So spricht er, dabei weiß ich selbst in meinem Traum, dass auch er nicht mehr lebt – so wie mein Bruder Tyler und Mom.
Ich will mich aufrichten, mich den Schatten stellen, und sehe mich nach meinem Vater um, doch der ist verschwunden. Stattdessen umgibt mich ein Labyrinth aus finsteren Kammern und Gängen. Meine Füße sind schwer wie Blei, aber ich weiß, ich muss weiter. Ich muss hier raus, sonst bin ich verloren. Es ist heiß und staubig. Ich habe das Gefühl zu verdursten, und jeder Atemzug kostet Kraft. Kraft, die ich kaum mehr habe, und dennoch taste ich mich Schritt für Schritt weiter. Ich höre Schüsse und Schreie, ich rieche Blut. Eine Biegung und noch eine. Auf dem Boden liegen reglose Körper mit weit aufgerissenen, starren Augen. Ich will nicht hinsehen, zu sehr fürchte ich mich davor, jemanden zu erkennen. Da höre ich den keuchenden Atem hinter mir und versuche mit aller Macht, meine Schritte zu beschleunigen, doch der Boden saugt meine Füße fest, sodass es sich anfühlt, als würde ich durch zähen Schlamm waten. Der fremde Atem kommt näher, eine Hand greift in mein Haar und zieht mir den Kopf nach hinten. Und dann drückt die Klinge kalt gegen meine Kehle.
Mit einem gurgelnden Schrei fahre ich in die Höhe. Meine Hände klammern sich um meine Kehle, aber meine Beine sind gefesselt. Ich schreie noch lauter, bis mir klar wird, dass sich nur der Schlafsack um meine Beine gewickelt hat. Mit fahrigen Händen ziehe ich den Reißverschluss auf und komme schwankend auf die Füße. Ich taumle, bis ich gegen die Wand stoße, und sinke in mich zusammen. Von eiskaltem Schweiß bedeckt, kauere ich auf dem Boden, meine angezogenen Knie umklammert, und wiege mich wimmernd hin und her.
Es ist niemand da, der mich hören könnte. Niemand, dessen Nachtschlaf ich stören würde. Niemand, der kommt, mich in den Arm nimmt und mich tröstet. Sie sind alle tot. Mom, Tyler und jetzt auch Dad, meine ganze Familie. Nein, das ist kein Traum. Ich bin allein.
Kapitel 1
Jane
Cape Cod, 2007
Sobald ich den Stau von New York hinter mir gelassen habe, cruise ich in dem offenen Mustang gemütlich über die Landstraßen. Die Sonne blitzt immer wieder hinter den Wolken hervor. Ich suche mir einen Sender mit Soulmusik und schwelge in den melancholischen Melodien. Sie stimmen mich traurig, und dennoch habe ich mich seit Monaten nicht mehr so wohl und lebendig gefühlt.
Dabei sind nach Dads Tod die Albträume erst einmal schlimmer geworden. Keine Ahnung, warum. Es ist ja nicht gerade so, dass er mich mit meinen Ängsten und Zweifeln aufgefangen hätte. Seine Stahlhärte, die niemals Risse zeigte, führte mir eher meine eigene Schwäche noch deutlicher vor Augen. Und dennoch, jetzt, wo er nicht mehr da ist, fühle ich mich wie im freien Fall. Trotzdem funktionierte ich auch auf seltsame, emotionslose Weise und tat, was in einem Todesfall getan werden muss.
Wenige Tage nach der Beerdigung saß ich bei seinem Anwalt und ließ mir sein Testament erläutern. Ich erbte seine New Yorker Wohnung, die er sich erst vor ein paar Jahren gekauft hatte, und einen Teil seiner Aktien und Goldmünzen, so weit keine Überraschung. Auch dass er einen Teil seines Vermögens einer Stiftung für versehrte Veteranen hinterließ, passte zu ihm.
Die einzige Überraschung kam danach. Es gab da ein Haus auf Cape Cod, das ebenfalls zu meinem Erbe gehört. Perplex starrte ich den Notar an.
«Sind Sie sicher? Von diesem Haus habe ich noch nie gehört, und ich kann mich auch nicht erinnern, dass mein Vater jemals dort hingefahren ist.»
Der Notar las den Rest der Unterlagen durch und bestätigte seine Ankündigung. «Das Haus liegt am Strand und wurde in den Sechzigerjahren von Ihrem Großvater gebaut. Er verbrachte dort mit Ihrer Großmutter seinen Lebensabend. Nach deren Tod fiel das Haus an Ihre Mutter, dann an Ihren Vater – und jetzt gehört es Ihnen. Ich kann Ihnen nicht sagen, in was für einem Zustand das Haus ist, allerdings ist so ein Grundstück auf Cape Cod direkt am Strand heute ein Vermögen wert. Vielleicht sollte man das alte Haus abreißen und das Grundstück verkaufen, aber das ist natürlich Ihre Entscheidung.»
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Schließlich erkundigte ich mich, ob das Haus seit dem Tod meiner Großeltern leer stand. Dort draußen in Cape Cod direkt an der Küste? Dann wäre es sicher nur noch eine Ruine.
Der Notar schüttelte den Kopf. «Nein, es wurde mehrfach vermietet. Im Moment scheint es allerdings unbewohnt. Die letzten Mieter sind vor drei Monaten ausgezogen, und ich habe keinen neuen Vertrag vorliegen. Außerdem gibt es noch diesen Brief von Ihrem Vater und diese Schachtel, die von Ihrer Mutter stammt; er hat sie für Sie aufbewahrt.» Er schob mir die Schachtel zu und legte den verschlossenen Brief darauf.
Das musste ich alles erst einmal verdauen. Zu Hause breitete ich die Testamentsblätter auf meinem Küchentisch aus und starrte lange auf die beschriebenen Seiten. Wobei «zu Hause» nicht die richtige Bezeichnung für meine Bude in der Bronx war. Den Brief meines Vaters drehte ich unschlüssig in den Händen, war aber noch nicht bereit, ihn zu öffnen.
Und die Schachtel meiner Mutter? Warum hatte er sie mir nicht gleich nach ihrem Tod gegeben? Warum musste ich sie Jahrzehnte später auf diese Weise bekommen? Meine Hand ruhte auf dem Deckel, doch auch diesen Schritt wagte ich nicht.
Ich nahm mir die Testamentsseite über das Haus auf Cape Cod vor. Seltsam, dass Dad nie darüber gesprochen hatte. Gut, es handelte sich um seine Schwiegereltern. Trotzdem. Dieses Haus am Strand weckte meine Neugier. Ich hatte nichts zu tun, warum nicht Richtung Boston fahren und das Haus ansehen? In einem Briefumschlag, den der Notar mir mitgegeben hatte, fand ich einen Schlüssel mit einem Adressanhänger. Die Schachtel meiner Mutter und den Brief meines Vaters packte ich ungeöffnet zu ein paar anderen Dingen in eine Reisetasche. Nachdem ich wochenlang ohne Plan und Ziel in den Tag hineingelebt hatte, elektrisierte mich der Gedanke.
Und nun steuere ich also meinen schon in die Jahre gekommenen Wagen über kurvige Straßen von einem Dorf zum nächsten. Die Hauptstraßen meide ich. Diese Neuenglandorte sind älter und natürlicher gewachsen als die meisten Kleinstädte in den USA, die ich kenne. Statt Blocks mit hässlichen Funktionsbauten und immer gleichen Einkaufszentren, Baumärkten und Fast-Food-Läden findet man hier im hügeligen Gelände entzückende Giebelhäuser, mit Liebe in verschiedenen Farben gestrichen, gepflegte Gärten und sogar sorgfältig bemalte Hydranten, die wie kleine Feuerwehrmännchen aussehen. Jedes Dorf hat sich seine eigene Farbkombination ausgesucht. Mal sind sie rot mit gelben «Hütchen» und «Armen», dann blau mit Silber, Schwarz und Rot. Ich fange an, mit mir selbst zu wetten, wie sie im nächsten Ort wohl eingefärbt sein würden. So erkennt man die Grenze zwischen den Ortskreisen stets am Wechsel der Hydrantenfarben, die in nahezu allen Fällen offensichtlich regelmäßig erneuert werden. Ich stelle mir vor, wie sich eine «Taskforce» einmal im Jahr im Gemeindezentrum trifft und dann mit Farbeimern und Pinseln ausgestattet durch den Ort zieht, um die Hydranten wieder auf Vordermann zu bringen. Was für ein Unterschied zu der verwahrlosten Gegend voller Müll und Graffiti, in der ich zurzeit hause.
Und dann überquere ich den Cape Cod Canal und fahre auf die nach Norden krallenförmig um die Cape Cod Bay geschwungene Halbinsel raus. Weißer Sand in Dünen aufgehäuft, dann wieder schilfbestandene Lagunen, in denen sich Wasservögel tummeln. Über mir kreisen kreischende Möwen. Statt nach Autoabgasen riecht die Luft salzig nach Meer. Ich spüre den kühlen Wind, wie er an meinen Haaren zerrt und mir die schwarz glänzenden Strähnen immer wieder ins Gesicht weht, doch ich habe es aufgegeben, sie mir ständig zurück hinter die Ohren zu schieben.
Und dann bin ich da und parke den Mustang in der kiesbedeckten Einfahrt. Neugierig umrunde ich das Haus.
Es steht etwas entfernt von seinen Nachbarn. Vermutlich darf dieser Abschnitt seit längerer Zeit nicht mehr bebaut werden, denn die Terrasse, die auf das Meer ausgerichtet ist, schiebt sich in den mit Strandgräsern dicht bewachsenen Dünengürtel. Ein schmaler Holzsteg führt zwischen den sich im Wind wiegenden Gräsern hindurch auf die Linie zu, wo sich das helle Blau des Himmels mit dem dunkleren des Meeres trifft.
Das Haus selbst scheint von außen gesehen in keinem so schlechten Zustand zu sein, wie ich befürchtet habe. Die Schindeln an den Wänden gehören zwar gestrichen, doch die Holzveranda macht einen stabilen Eindruck, und wenn man das Weiß um die Sprossenfenster, an den Schnitzereien unter dem spitzen Giebel und dem Verandageländer erneuert, wird es ein echtes Schmuckstück.
Jedenfalls sieht es deutlich besser aus als das Nachbarhaus auf der linken Seite, das mehr als nur einen neuen Anstrich nötig hätte. Gerade öffnet sich die Tür, und eine grauhaarige Frau mit einem Henkelkorb unterm Arm tritt heraus. Sie scheint um die siebzig zu sein, hält sich aber erstaunlich gerade, als sie mit forschem Schritt auf mich zutritt und mir die Hand entgegenstreckt.
«Ah, endlich eine neue Nachbarin? Ich bin Eve Rosenberg.»
«Jane, Jane Williams.» Ich schüttle ihr die Hand. «Ich weiß noch nicht …», sage ich unsicher.
«Oh? Sie sind keine neue Mieterin? Wird das Haus etwa verkauft?»
«Ich habe es geerbt, von meiner Mutter. Ihren Eltern hat es vor vielen Jahren gehört.»
Eve nickt mit wissendem Gesichtsausdruck. «Und jetzt müssen Sie erst einmal überlegen, was Sie mit dem Haus anfangen.»
«Ja, so ähnlich», gebe ich zu.
«Es ist schön hier, wissen Sie? Nicht nur im Sommer. Ich liebe auch die raue Jahreszeit», sagt die Nachbarin.
Ich lächle stumm und sehe von ihrem Haus zu meinem. Eve lächelt ebenso, und ein Kranz von Fältchen umrahmt ihre grauen Augen. «Kommen Sie erst einmal in Ruhe an und genießen Sie unseren wundervollen Strand und das Meer.»
Sie nickt mir noch einmal zu und geht dann zu ihrem Wagen, der ebenso in die Jahre gekommen wirkt wie ihr Häuschen.
Als ihr Pick-up um die nächste Kurve verschwunden ist, schließe ich die Holztür mit den blind gewordenen Glaseinsätzen auf und trete in das Vestibül. Langsam wandere ich von Zimmer zu Zimmer. Sie sind nicht sehr groß, der Dielenboden knarrt unter meinen Schritten. Oben gibt es drei kleine Schlafzimmer und ein Bad, das wohl noch aus den Sechzigerjahren stammt. Doch bis auf ein paar angerostete Rohre wirkt alles gepflegt.
Die erstaunlich große Küche besteht aus einer seltsamen Mischung aus uralten und modernen Geräten. Nachdenklich gehe ich noch einmal durch das ganze Haus und überlege mir, was ich richten lassen müsste, um es modernen Ansprüchen anzupassen. Was würde das kosten, und wie viel wäre das Haus dann wert? In dieser Lage? Viel, sehr viel!
Ich bin zu erschöpft, um heute noch nach New York zurückzufahren. Also werfe ich eine Decke und meinen Schlafsack auf die Veranda und strecke mich auf dem Boden aus. Ich lausche dem ungewohnten Rhythmus der Wellen. Er stimmt mich schläfrig, dennoch kreisen meine Gedanken und lassen mich nicht einschlafen. Ich fühle mich jedoch friedlicher als in meinem Schlafzimmer in der Bronx, wo die vorbeifahrende U-Bahn mein Bettgestell regelmäßig durchschüttelt.
Irgendwann in der Nacht stehe ich auf, setze mich an den Küchentisch, schütte den Rest meines Kaffees aus der mitgebrachten Thermoskanne in eine Tasse und beginne, eine Liste dessen aufzusetzen, was ich unbedingt renovieren müsste und was ich zusätzlich schön fände. So vergeht die Nacht, und als das Schwarz verblasst, mache ich mich den Holzsteg entlang auf den Weg zum Strand, um dort die glutrot aus dem Meer steigende Sonne zu begrüßen, ehe ich in mein Haus zurückkehre.
Am meisten fasziniert mich in dem großzügigen Wohn-Bücher-Kamin-Musikzimmer der Flügel. Ein wunderschönes, großes, schwarz glänzendes Instrument, das den Raum einnimmt. Viel mehr gibt es nicht, außer den Bücherregalen rechts und links des Kamins mit ein paar eingestaubten alten Büchern, der verschlissenen Couch, einem Sessel und dem niederen Tischchen. Die Morgensonne sendet ihre Strahlen durch die schlierigen Scheiben und lässt den tanzenden Staub magisch glitzern. Draußen erhebt sich der Schrei der Möwen über dem Rauschen der Wellen.
Ich gehe in die Küche, feuchte ein Tuch an und beginne, sorgfältig den schwarzen Lack des Klaviers zu reinigen, bis er staubfrei schimmert.
Hat mein Großvater diesen Flügel gekauft? Für Großmama? Ich überlege, was meine Mutter mir früher über ihre Eltern erzählt hat. Sie haben in Berlin gelebt, und meine Großmutter Emilia ist so etwas wie ein Revuestar gewesen, hat auf der Bühne getanzt und gesungen, ja, daran erinnere ich mich, denn Mom hat mehr als ein Mal gesagt, das hätte ich von ihr, wenn ich daheim mit einem Song die Filmdiva mimte. Ich bin ja nicht gerade die geborene Tänzerin, aber singen kann ich, und ich habe eine schöne Stimme, wie Mom, mit der ich früher so gerne zusammen gesungen habe.
Meine Großmutter der Revuestar? Wann das wohl gewesen war? In den wilden Zwanzigern? Noch vor Hitlers Machtergreifung? Und wann waren meine Großeltern in die USA ausgewandert?
Ich überlege, was ich über meinen Großvater Benno weiß. Ich glaube mich zu erinnern, dass er ein Findelkind war, aufgewachsen in einem Waisenhaus, und dass er später im Ersten Weltkrieg als Soldat diente.
Ein Soldat wie Dad und Tyler. Ja, so waren die Männer dieser Familie. Sie dienten ihrem Vaterland! Doch darüber will ich im Moment nicht nachdenken. Zu viele gefährliche Gedanken! Lieber streiche ich über den Lack des Flügels und sinniere über meine Großmutter, die Sängerin und Tänzerin.
Zaghaft hebe ich den Deckel und lasse meine Finger über die elfenbeinfarbenen Tasten streichen. Der erste Ton klingt erstaunlich rein. Ich schlage ein paar Akkorde an. Der Klang erfüllt das Zimmer und bricht dann ab, als ich die Tasten loslasse. Ein wenig verstimmt ist der Flügel schon, doch nicht so sehr, dass er einen Missklang erzeugen würde. Er ist nicht verstimmter als manch Klavier in den Jazzkneipen, in denen ich mit Pete gesungen habe. Früher, als wir noch ein Paar waren. Als wir noch zusammengehörten.
Nein, an Pete und unsere zerbrochene Liebe will ich momentan auch nicht denken!
Ich ziehe mir den Hocker heran, drücke das Pedal und spiele eine Folge von Akkorden. Als ich die Finger von den Tasten nehme, klingt der letzte nach, bis er sich in der staubigen Luft auflöst. Ich spiele ein paar Läufe, erst langsam, um meine Finger wieder daran zu gewöhnen, um Erinnerungen in ihnen wachzurufen, die irgendwo gespeichert sein müssen.
Ja, da sind sie, und mein Spiel wird flüssiger. Ich schließe die Augen. Die Erinnerungen übernehmen und spielen Passagen aus Stücken, die ich so gern gesungen habe. Ich versuche gar nicht, bewusst zu spielen. Ich lasse meinen Fingern freien Lauf. Meine Gedanken verweben sich mit den Erinnerungen, die die Melodien hervorlocken. Plötzlich spüre ich die Tropfen, die über meine Wangen rinnen. Erschrocken halte ich inne. Noch eine Träne quillt hervor und noch eine. Ich habe seit Tylers Tod nicht mehr geweint, doch jetzt lässt es sich nicht mehr aufhalten. Ich sitze auf dem Klavierhocker und weine still vor mich hin.
In einem familiär wirkenden Diner im nächsten Ort frühstücke ich erstaunlich viel und lasse mir meine Thermoskanne mit frischem Kaffee füllen. Zurück im Haus, zieht es mich wieder zum Flügel. Ich habe die Musik immer geliebt. Früher sang ich alles, was ich gehört hatte, und tanzte dazu. Mom hat auch gern gesungen. Sie hatte eine schöne Stimme, und sie lächelte immer so verträumt, wenn wir zusammen bei der Küchenarbeit einen unserer Songs anstimmten. Wenn meine Träume es einmal gut mit mir meinen, sehe ich sie vor mir und höre ihre schöne Altstimme.
Für Dad war Musik eher ein überflüssiges Geräusch, hatte ich zumindest den Eindruck, und fürs Tanzen hatte er noch weniger übrig. Oder zumindest von meiner Art freier Bewegung, in die ich alles einfließen ließ, was mir gerade in den Sinn kam. Dabei sang ich, wirbelte herum und warf die Arme in die Luft. Es war ein Gefühl der Losgelöstheit und ein Verzücken, das zu empfinden ich schon lange nicht mehr in der Lage bin. Ich selbst fand meinen Tanz berauschend schön. Einmal hörte ich Dad zu Mom sagen: «Kann sie sich nicht wie ein normaler Mensch bewegen? Muss sie immer so albern herumhüpfen?»
Danach vermied ich es, zu tanzen und zu singen, wenn er in der Nähe war. Gegen Moms Gesang hatte er übrigens nie etwas einzuwenden. Wenn er ihr zuhörte, sah ich manches Mal ein sentimental wirkendes Lächeln auf seinen Lippen, das ich ansonsten nie bemerkte. Na ja, vielleicht sang sie einfach besser als ich.
Nach ihrem Tod habe ich lange nicht mehr gesungen und getanzt. Dafür nahm ich Klavierstunden bei einer Lehrerin, die ich sehr mochte – bis Dad als Angehöriger des Marinecorps ein weiteres Mal versetzt wurde. Da wir kein eigenes Klavier besaßen, schlummerte auch diese Fertigkeit danach lange still vor sich hin.
Vielleicht war es auch das, was mich, als ich neu in die Klasse kam, an Pete so faszinierte – neben seiner Sportlichkeit, seinem guten Aussehen und seinem sprühenden Charme. Auch er liebte Musik und hatte ein gutes Gefühl für Rhythmus. Schon damals spielte er Saxofon, aber auch E-Gitarre und Klavier. Ich habe sonst keinen Menschen kennengelernt, dem die Musik so zuflog, und dennoch war klar, dass dies nicht sein Karriereweg würde. Ein Hobby, ein schöner Zeitvertreib, da unterschied sich die Meinung seines Vaters, ebenfalls Offizier bei den Marines, wenig von der meines Dads.
Und seine Mutter? Ich weiß es nicht. Ein paarmal, als ich bei ihm zum Üben war, hat sie uns aufgefordert, nicht so einen Krach zu machen.
Jedenfalls hatte er ein Klavier und war ein geduldiger Lehrer, sodass meine tief verschütteten Klaviererfahrungen wieder hervorgekitzelt wurden. Und wenn er spielte, sang ich. Vielleicht war ich besser geworden, hatte sich meine Stimme mit den Jahren weiterentwickelt, jedenfalls liebte er es, und ich liebte den sanften Blick, den er dann bekam. Schließlich schlitterten wir in eine stürmische Affäre, bis, ja, bis sein Vater starb und Pete mit seiner Mutter den Stützpunkt für immer verließ.
Ich war todunglücklich, wie das so ist bei der ersten großen Liebe, die in die Brüche geht. Ich hatte ernsthaft überlegt, abzuhauen und zu Pete nach New York zu trampen, habe es dann aber doch nicht getan. Vielleicht war ich zu feige? Oder zu vernünftig? Ich weiß nicht, was davon eher zutrifft, irgendwann heilte mein gebrochenes Herz, und ich begann, andere junge Männer wahrzunehmen …
Nein, an Pete will ich nicht denken. Ich setze mich an das Tischchen und nehme den Brief meines Vaters in die Hand. Unschlüssig drehe ich ihn um, schaue dann wieder die Vorderseite an, auf der in seiner akkuraten Druckschrift nur das eine Wort steht: Jane.
Wann hat er ihn geschrieben? Zu der Zeit, als er das Testament verfasst hat? Vielleicht nach Tylers Tod? Nach dem Verlust seines einzigen Sohnes, seines Erben, seiner großen Hoffnung und Liebe? Oder erst jetzt, als er im Krankenhaus lag nach seinem Herzinfarkt und nicht wusste, wie viel Zeit ihm noch blieb? Hat er geahnt, dass es nur noch Tage sein würden? Hat er den Tod kommen sehen?
Nein, ich schaffe es nicht, ihn zu öffnen, und stecke ihn zurück in meine Reisetasche. Dafür stelle ich die Kiste meiner Mutter vor mich hin. Der Karton ist mit altmodischem Geschenkpapier beklebt. Wildblumen, von denen ich nur wenige erkenne. Wachsen die überhaupt bei uns, oder stammt das Papier aus Deutschland? Richtig, ich entdecke unter einigen Blumen die deutschen Namen: «Schlüsselblume, Veilchen, Vergissmeinnicht, Wiesenstorchenschnabel, Schafgarbe.» Mit Mühe entziffere ich die Schrift und versuche, die Namen laut auszusprechen. Der Klang ist ungewohnt, doch er bewegt etwas tief in mir. Deutschland, damals als Kind, Dad war in Böblingen stationiert, dort, wo Mom zu Tode kam. Aus dieser Zeit muss der Karton stammen. Mit zitternden Händen hebe ich den Deckel ab, hole Briefe, ein Notizbuch, zusammengefaltete Plakate, Postkarten, aber auch ein Stofftier, eine kleine Puppe, eine bestickte Windel und andere Dinge heraus und breite sie vor mir aus.
Ich klappe das Notizbuch auf. Die Handschrift meiner Mutter verschwimmt vor meinen Augen. Ich blinzle, bis sie wieder klar wird, endlich kann ich ihre Worte entziffern.
Meine geliebte Jane,
wir sind in Deutschland! Dein Dad wurde an die Panzerkaserne nach Böblingen versetzt. Wir waren schon an so vielen Orten stationiert, aber der Gedanke, in Deutschland zu sein, elektrisiert mich. Es ist das Land meiner Väter! Ich stamme von hier, selbst wenn ich in den USA geboren wurde. Dein Dad ist durch und durch Amerikaner, aber in mir erwacht zunehmend der Wunsch, mehr über die Herkunft meiner Eltern zu erfahren und über den langen, schweren Weg, den sie zurücklegen mussten, um endlich in den USA ihr Glück zu finden und ihren Lebensabend an der Ostküste genießen zu können.
Sie hatten es nicht leicht! Ich habe die Briefe und Tagebücher gelesen, die sie in ihrem Haus auf Cape Cod zurückgelassen haben.
Du bist leider noch zu jung, um all dies zu verstehen, und Du solltest Dich mit diesen Dingen jetzt auch noch nicht beschäftigen, doch später, wenn Du älter bist, würde ich Dir gerne daraus vorlesen. Ich weiß, ich müsste erst mein Deutsch verbessern, doch ich erinnere mich, als ich klein war, dass vor allem meine Mama häufig Deutsch mit mir gesprochen hat.
Nach ihrem Tod konnte ich es nicht über mich bringen, ihr geliebtes Haus zu verkaufen, also haben wir es vermietet, denn ich will, dass es irgendwann einmal Dir gehört. Ich habe mit Dad darüber gesprochen, und er ist einverstanden. Ich glaube einfach, dass Du Dich für die Herkunft meiner Familie interessieren und – wie ich zuvor – staunend in die Geschichte eintauchen wirst. Verzeih, vielleicht bin ich Deinem Bruder gegenüber ungerecht, aber ich kann ihn mir nicht inmitten staubiger Tagebücher und Papiere vorstellen. Er wird Dir diesen Teil des Erbes nicht neiden, da bin ich mir sicher. Ihn interessieren andere Dinge, aber Du wirst Freude an den alten Theaterplakaten und Postkarten haben, und ich träume davon, dass Du die Melodien auf dem Flügel spielst, die meine Mutter einst auf der Bühne gesungen hat.
Ich muss mir schon wieder Tränen aus den Augen wischen. Wie schön wäre das gewesen, Mom! Warum nur musstest du so früh sterben? Wie ungerecht! Wie absolut unnötig!
Ich sehe mir die alten Postkarten an. Sie zeigen das Berlin der Zwanzigerjahre sowie Stars auf der Bühne in prächtigen Kostümen. Ist einer dieser Stars meine Großmutter? Ich weiß es nicht. Dann nehme ich die Puppe, die eindeutig selbst gemacht ist, in die Hand und das Stofftier, einen kleinen Hund, der so abgewetzt ist, dass er fast auseinanderfällt. Vorsichtig setze ich ihn wieder auf das Tischchen, ehe ich weiterlese.
Emilia und Benno! Sie waren einander die große Liebe, so habe ich sie in Erinnerung. Eine Liebe, die allen Widerständen trotzte. Sie haben Stürme und Trennungen überstanden, sie haben Tod und Verzweiflung erlebt, doch nichts konnte sie unterkriegen. Und dann auch noch der Große Krieg und später der Aufstieg der Nationalsozialisten, vor denen sie irgendwann flohen, nur mit einem Koffer und ein paar Habseligkeiten, um ganz neu anzufangen.
Und was sie alles geschaffen haben! Ich freue mich auf den Tag, an dem ich mit Dir das Haus in Cape Cod aufsuche und Dir von ihnen erzähle. Du wirst Dich an Emilias Flügel setzen, und ich werde Deinem Spiel lauschen, so wie Benno früher seiner geliebten Emmy.
Mein Blick wandert zum Flügel hinüber, und ich kann sie vor meinem inneren Auge sehen. Großmama Emilia spielt, und Großvater Benno lauscht verzückt dort drüben im Sessel und träumt von alten Zeiten, als sie als gefeierter Star auf der Bühne gestanden hat, als Tausende ihrer Stimme gelauscht haben, um ihr dann tosend Beifall zu spenden. Waren die Gentlemen aus ihren Plüschsitzen aufgesprungen und haben ihr Rosen auf die Bühne geworfen? Blutrote Rosen zu ihren Füßen, während sie sich vor ihrem Publikum verneigt?
Das wenige, das ich aus dem Haus nach Deutschland mitgenommen habe, bewahre ich für Dich auf, bis Du alt genug bist und wir unsere Erkundigungen gemeinsam fortsetzen können.
Der Verlust fühlt sich an wie ein Messerstich in meinem Herzen. Schon lange habe ich ihn nicht mehr so tief empfunden. Ach, Mom, nein, wir werden uns nicht gemeinsam auf die Suche machen. Es ist zu spät. Jahre zu spät!
Während mein Finger zart über die Puppe und den Hund streicht, überlege ich, was wir alles verloren haben und wo die Sachen geblieben sind, von denen sie schreibt. Warum nur hat sie die Tagebücher und Briefe nicht mitgenommen zu den Stützpunkten, an denen Dad stationiert war?
Obwohl ich weiß, dass in den Jahren verschiedene Mieter hier gelebt haben, drehe ich noch einmal eine Runde durch das Haus und schaue in jeden Schrank, ziehe jede Schublade hervor. Nichts. Alle weiteren Spuren meiner Großeltern sind längst getilgt, und doch, wenn ich mich umsehe oder die Augen schließe, glaube ich, dieses Gefühl der Liebe und die Atmosphäre des Glücks, hier zusammen alt werden zu dürfen, erahnen zu können. Was für ein wundervolles Fleckchen Erde haben sich meine Großeltern ausgesucht!
Ich denke, es ist dieser Augenblick, in dem ich beschließe, das Haus unter keinen Umständen zu verkaufen. Auch wenn ich sonst keine Ahnung habe, wie es mit mir und meinem Leben weitergeht, diesen Entschluss treffe ich, und ich spüre, wie ich bei diesem Gedanken lächle, als ich meine Jacke anziehe und mich über den Holzsteg zum Strand aufmache.
Am Strand treffe ich meine Nachbarin, die mir schon von Weitem zuwinkt. «Oh hallo, wie schön, Sie zu treffen. Darf ich Sie ein Stück begleiten?»
«Ja, gerne», sage ich. Obgleich ich dachte, alleine sein zu wollen, fühlt es sich erstaunlich gut an, mit dieser Fremden entlang der schäumenden Säume der auslaufenden Wellen durch den nassen Sand zu stapfen.
«Leben Sie schon lange hier?», frage ich nach einer Weile, obgleich mir unser Schweigen nicht unangenehm erscheint.
«Das Haus hat schon mein Vater gekauft, und früher kamen wir nur im Sommer hierher, wie so viele aus Boston und New York, doch seit mein Mann tot ist, lebe ich das ganze Jahr hier draußen und bin somit eine Exotin zwischen all den Sommerfrischlern, die man in der kalten Jahreszeit nie zu Gesicht bekommt. Aber ja, mir macht das nichts aus.»
«Das tut mir leid, ich meine, dass Ihr Mann gestorben ist.»
Ein seltsames Glitzern tritt in ihre Augen. «Ach ja, mein Oliver. Er war Feuerwehrmann in New York. Ein echter Held. Mein Held, schon als ich noch zur Schule ging. Wir haben geheiratet und zusammen ein erfülltes Leben geführt.» Sie lächelt, dass es mich fast zu Tränen rührt. «Und dann kam dieser Tag, den kein Amerikaner jemals vergessen wird.»
«Nine-eleven?», hauche ich geschockt.
Sie nickt. «Ein paar Wochen bevor er seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten hätte, haben diese Terroristen ihre Flugzeuge in das World Trade Center gesteuert. Aber so ist das Leben. Das Schicksal lässt sich unser Glück meist sehr teuer bezahlen.»
«Und wie geht es Ihnen inzwischen?», frage ich vorsichtig und bin erstaunt, wie warm ihr Blick ist.
«Ich habe mich mit dem Schicksal versöhnt und freue mich an den guten Erinnerungen, die ich mit meinem Oliver habe. Ich lebe in dem Haus, das uns so viele schöne Stunden geschenkt hat, und ich erfreue mich an der rauen Kraft des Meeres, die jeden Tag anders ist, dem Wind, der Sonne und den Möwen.»
Ich bleibe stehen und sehe sie an. Plötzlich spüre ich, wie mir eine Träne über die Wange rinnt. «Es ist so schrecklich», schluchze ich.
Eve hebt ihre Hand und wischte mir geradezu zärtlich die Träne aus dem Gesicht.
«Jane, Sie müssen nicht um mich weinen, oder geht es um etwas anderes? Ich habe Sie gar nicht gefragt. Sie sagten, Sie haben das Haus geerbt. Gerade erst? Sind Sie in Trauer, oje, ich bedaure Ihren Verlust!»
«Ach, ich weiß nicht, ja, mein Vater ist eben erst gestorben, aber das ist es nicht allein. Meine Mutter und mein Bruder sind schon lange tot, und ich fühle mich so – übrig geblieben. Ich weiß nicht, was ich tun soll, jetzt und mit meinem Leben. Ich war bei der Navy und dann bei den Marines. Ich wusste, was ich tun muss und wohin ich gehöre, und jetzt, jetzt bin ich einfach nichts mehr und gehöre nirgendwohin. Ach, entschuldigen Sie, Eve … Ich überfalle Sie einfach so mit meinen Problemen.»
Sie ergreift meine Hände und hält sie fest. «Entschuldigen Sie sich nicht, meine Liebe. Sie sehen momentan nur die Wände des schwarzen Lochs, das Sie gefangen hält, aber ich verspreche Ihnen, bald schon werden Sie die Sonne wieder erkennen. Holen Sie tief Luft. Riechen Sie die salzige Luft. Hören Sie das Rauschen des Windes im Schilf. Sie sind am Leben, und alles andere wird sich finden.»
Als die Sonne am Nachmittag schon tief steht und es langsam kalt wird, verabschieden wir uns voneinander und kehren in unsere Häuser zurück. Ich beschließe gerade, mir im Ort etwas zu essen zu besorgen, als mein Blick an der Decke im Flur an etwas hängen bleibt, das sich genauer zu betrachten lohnt: ein eiserner Ring – ja, und der gehört zu einer Luke! In der Ecke hinter dem Schrank lehnt ein eiserner Stab mit einem Haken daran. Ich kann die Luke aufziehen, eine schmale Holzleiter kommt zum Vorschein, und ich klettere hinauf in den Giebel. Hier oben kann ich in der Mitte aufrecht stehen, von da neigen sich die Dachflächen zu beiden Seiten steil hinab. Wie erwartet finde ich hier Staub, Sand und feuchte Stellen, aber auch fünf Kisten. Welcher der Bewohner hat sie hier stehen gelassen?
Die Pappkartons sind an der Seite durchweicht und etwas schimmlig, daher ziehe ich eine stabiler wirkende längliche Kiste zu mir heran. Es ist ein Überseekoffer, wie sie die Auswanderer früher mit nach Amerika gebracht haben. Sind das noch Habseligkeiten meiner Großeltern? Ich spüre, wie sich mein Herzschlag beschleunigt. Neugierig klappe ich den Deckel auf. Ich nehme altmodische Kleider in die Hand, seidige Schals, einen ausladenden Hut. Ein Schal fällt mir besonders auf. Ein langes Stück dünner, seidiger Stoff, über und über mit Federn und Pailletten besetzt – offensichtlich von nicht sehr geübten Händen. Auch ein Paar Damenschuhe finde ich, eine Puppe aus Stoffresten, selbst genäht, Murmeln und einige Bücher in altdeutschem Druck. Ich blättere vorsichtig die ein wenig feuchten Seiten um und bedaure, dass ich sie nicht lesen kann.
In dem Überseekoffer befindet sich außerdem eine mit seidigem, etwas öligem Papier beklebte Schachtel, die mit einem Samtband verschlossen und im Innern noch immer trocken ist. Ich hebe den Karton heraus und ziehe die Schleife auf. Bündel von Papieren, einige beschriebene Hefte und kleine lederne Notizbücher. Sind das die Bücher und Briefe, von denen Mom geschrieben hat? Ich kann es kaum fassen. Und das nach so langer Zeit!
Ich nehme den Karton mit hinunter in die Küche. Inzwischen sind Regenwolken aufgezogen, und der Wind peitscht das Wasser in böigen Schwüngen gegen die Scheibe. Mein Hunger hat sich plötzlich verflüchtigt. Essen kann ich auch noch später. Jetzt treibt mich die Neugier. Ich lege mir meinen Schlafsack über die Beine, fülle meinen Becher mit heißem Kaffee und blättere vorsichtig in den alten Briefen und Tagebüchern. Großvater Benno nennt Großmama Emmy, «mein weißer Schwan» und «mein Entzücken» – was immer das auch bedeutet. Sie nennt ihn «meine große Liebe», «mein Herz», aber auch «Schurke» und «Liebloser». Einige wie Briefe aufgesetzte Blätter mit ihrer Schrift liegen in den Tagebüchern und wurden wohl nie an ihn geschickt. Bei seinen Briefen sind häufig noch verschmutzte und zerknitterte Umschläge dabei. Neugierig blättere ich durch die Seiten und wünsche, ich könnte mehr als die Anrede und die Unterschrift entziffern. Unschlüssig lasse ich meinen Blick über die ausgebreiteten Schriftstücke schweifen. Jetzt kehrt auch der Hunger zurück. Vielleicht sollte ich doch etwas essen. Ich packe den Karton ins Auto und mache mich auf den Weg in den nächsten Ort. Dort esse ich einen Salat und fahre dann weiter zu einem Internetcafé. Neugierig tippe ich verschiedene Begriffe in die Suchmaschine ein, doch das bringt mich nicht viel weiter. Dass sich zwischen den beiden Dramen abgespielt haben, hat Mom bereits angedeutet, aber ich will genau wissen, warum Emilia Benno plötzlich als «Schurke» bezeichnet und als «Lieblosen», doch nur mit einem Übersetzungsprogramm komme ich nicht weiter. Ich gebe auf, schließlich liegt noch eine lange Fahrt vor mir.
Kapitel 2
Jane
New York, 2007
Zurück in der Bronx, nehme ich mir die Briefe und Tagebücher noch einmal vor, aber ich kann nicht einmal erahnen, was sich in jenen Jahren abgespielt hat. Ich betrachte die vergilbten Fotos. Es sind ein paar von diesen altmodischen, gestellt wirkenden Bildern, die man aus historischen Büchern kennt, wie sie zu jener Zeit in Fotostudios angefertigt wurden. Aber auch ein paar überraschende. Ist das meine Großmutter? Ich blinzle und starre auf die halb nackte, sehr verführerische Frau mit ihrer sehr hellen Haut, die außer einer Art Paillettenbikini, hohen Sandaletten und vielen Federn auf dem Kopf nichts anhat. Kein Zweifel, unten am Rand hat sie das Bild signiert – Emmy. Wow! Und dann noch ein Bild, auf dem eine ganze Reihe gleich aufreizend gekleideter Damen mit langen, nackten Beinen auf einer Bühne stehen. Ich versuche, das Gesicht meiner Großmutter zu erkennen, bin mir aber nicht ganz sicher.
Dann nehme ich mir ein Foto meines Großvaters vor. Er trägt Uniform und steht vor einem Militärwagen. An sich nicht ungewöhnlich. Ich weiß ja, dass er Soldat im Ersten Weltkrieg war, doch der Hintergrund des Bildes erstaunt mich: Sind das etwa Dromedare? Und auch die kastenartigen Lehmhäuser wecken in mir Erinnerungen. Keine guten! Meine Hand beginnt zu zittern. Ich muss es wissen. Ich will erfahren, was mein Großvater fast einhundert Jahre zuvor an Orten gemacht hat, die denen ähneln, die mich in meinen Albträumen heimsuchen.
Nach einer durchwachsenen Nacht sitze ich mit Kopfschmerzen am Tisch, eine Kaffeetasse in der Hand, während draußen die U-Bahn vorbeirauscht. Ich habe Magenschmerzen und kippe den Rest Kaffee in den Ausguss. Da in meinem Kühlschrank nur gähnende Leere herrscht, verschiebe ich das Thema Essen auf später. Noch immer liegen meine Dachbodenfunde und die Kiste meiner Mutter auf dem Tisch. Nachdenklich kaue ich auf meiner Unterlippe. Wer könnte mir da helfen?
Meine Freundin Lizzy studiert an der Columbia. Ich packe die Sachen zusammen und besuche sie in ihrem schicken Appartement. Lizzy freut sich, mich zu sehen, umarmt mich und fängt sofort an zu überlegen, wie sie mir helfen kann.
«Wenn du jemanden suchst, der deutsche Texte und vor allem altdeutsches Zeug übersetzen kann, dann frag mal bei Liam Carter nach. Er hat die Professur für Deutsch und Geschichte an der Columbia. Vermutlich hat er nicht die Zeit, all das zu übersetzen, aber er hat sicher Mitarbeiter, die sich gerne ein Zubrot verdienen wollen. Wobei, ehrlich gesagt, wenn ich mir die Menge anschaue, dann wird dich das ein Vermögen kosten. Ist es dir das wert, nur um zu erfahren, was sich zwei Leute, die du nie kennengelernt hast, vor fast einhundert Jahren geschrieben haben?»
So richtig erklären kann ich es Lizzy nicht, aber sie lässt die Sache auf sich beruhen, und ich rufe noch am Nachmittag bei Professor Carters Sekretärin an, um mir einen Termin geben zu lassen. Zwei Tage später lerne ich Liam Carter kennen und lege ihm einige Kostproben meines Dachbodenfundes vor.
«Es geht um meine Großeltern.» Ich ziehe einen der Briefe hervor und reiche ihm das vergilbte Blatt. «Können Sie diese alte deutsche Schreibschrift lesen?»
Professor Carter rückt seine Brille zurecht. Ich sehe, wie seine graublauen Augen die Zeilen entlanggleiten, dann nickt er. «Ja, eine schöne Schrift.» Es ist ein Brief von Emilia. Bennos Schrift würde ich jetzt nicht als schön bezeichnen, aber ja, fangen wir mit ihr an. Er beginnt an einer willkürlich gewählten Stelle leise mit ein paar Sätzen auf Deutsch und übersetzt sie dann.
Gestern hatten wir Premiere mit dem neuen Eisballett, und ich durfte drei der Einzelnummern laufen, in einem wundervollen Kostüm. Das kannst Du Dir nicht vorstellen. Glänzender Tüll bis über die Knöchel, der im Fahrtwind flatterte und bei jeder Drehung im Licht der Scheinwerfer funkelte. Den Pas de deux lief ich mit Ernesto, und wir bekamen viel Applaus. Es ist schon noch mal was ganz anderes, so exponiert dem Blick jedes Zuschauers ausgesetzt zu sein und nicht in der Menge der Läufer zu verschwimmen, die lediglich das Kulissenbild abgeben. Großvater ist wahnsinnig stolz auf mich und nennt mich den aufgehenden Stern. Was meine Mutter davon hält, schreibe ich Dir lieber nicht. Du kennst sie ja.
Ich lausche Emmys Worten und versuche, mir meine Großmutter als Star in so einer Show auf dem Eis vorzustellen. Das Revuefoto aus den Zwanzigern steigt in meinem Geist auf. Dann reiche ich Carter einen von Großvater Bennos Briefen.
«Oh», murmelt er, doch auch diese krakelige Schrift scheint für ihn kein Hindernis zu sein.
Der Zug rattert und schwankt, ich versuche dennoch, Dir zu schreiben. Gestern noch waren wir mitten in «den Schluchten des Balkans». Erinnerst Du Dich, wie wir gemeinsam die Abenteuer des Kara Ben Nemsi verfolgten, mitgefiebert haben bei jedem Abenteuer? Und jetzt sehe ich diese schroffe und so atemberaubende Landschaft mit meinen eigenen Augen. Ab und zu sieht man zerlumpte Berittene auf kleinen, zotteligen Pferden, alle sind bewaffnet. Banditen? Vermutlich, doch die Reisenden im Orientexpress sind vor ihnen sicher. In zwei Wagen haben wir mehrere Dutzend Soldaten dabei.
Mein Rittmeister reist mit den anderen Mitgliedern des diplomatischen Korps in einem Wagen, der wie ein feudales Hotelzimmer aussieht. Die anderen Offiziersburschen und ich sind nicht ganz so bequem untergebracht auf unseren blanken Holzbänken. Zudem ist die Hälfte des Wagens mit dem Gepäck unserer Offiziere zugestapelt. Wir müssen aufpassen, dass nichts in fremde Hände gerät, denn wer weiß, was für Gesindel sich an den Bahnstationen Zugang verschaffen könnte.
«1915?», fragt der Professor, als er einen Blick auf die obere rechte Ecke des Briefes wirft. «Das sind sehr interessante historische Zeugnisse.»
«Ich würde die Aufzeichnungen gerne übersetzen lassen. Natürlich bezahle ich dafür», füge ich rasch hinzu.
Carter inspiziert den Stapel an Briefen und die vielen Tagebücher. «Das ist eine ganze Menge», sagt er. «Für so etwas habe ich leider keine Zeit, aber ich habe eine Doktorandin, Cornelia Thomson, die sich gerade mit historischen deutschen Dokumenten beschäftigt. Für sie wäre es vielleicht eine interessante Arbeit und ein angenehmerer Nebenjob, als im Diner zu bedienen.»
«Fragen Sie sie bitte? Ich möchte keine Zeit verlieren.»
Er verspricht, sich bei mir zu melden, und nur zwei Wochen später finde ich die ersten Dokumente in meinem Briefkasten. Neugierig lege ich eine der CDs ein und lehne mich in meinem Sessel zurück. Die angenehm dunkle Stimme der Doktorandin hüllt mich ein und nimmt mich mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Ich steige mit dem ersten, im Ton noch sehr kindlichen Tagebuch von Emilia ein. Es beginnt im Jahr 1911 in Berlin.
Emilia
Berlin, 1911
Seit heute Nachmittag ist nicht nur die Friedrichstadt, sondern die Reichshauptstadt um eine Sehenswürdigkeit reicher geworden.
So stand es in der Zeitung, aus der der Großvater vorlas. Dann erhob er sich. «Kommt, zieht eure Mäntel an und lasst uns gehen.» Er wirkte ungewöhnlich zappelig. Emilia sprang sofort von ihrem Platz am runden Tisch im kleinen sogenannten Salon auf, denn sie liebte ihren Großvater, und ein Nachmittag mit ihm schien deutlich mehr Spaß und Abwechslung zu versprechen, als mit der Mutter alleine daheim zu sitzen. Vor allem, da sie wieder einmal düsterer Stimmung war und nur wenig, dafür in diesem harten Ton sprach, der vermutlich ihren Schmerzen geschuldet war.
«Mutti, bitte, können wir gehen und uns Großvaters neue Arbeitsstelle ansehen?»
Caroline erhob sich ebenfalls und griff nach ihren beiden Stöcken, die sie zum Gehen benötigte, wenn es mal wieder eine der schlimmeren Phasen gab, die sich, nach Emilias Empfinden, zu häufen schienen.
«Du kannst erst einmal das Geschirr vom Tisch abräumen», sagte die Mutter.
Emmy seufzte, gehorchte aber, denn mit zwei Krücken konnte es die Mutter beim besten Willen nicht selber machen.
«Aber jetzt gehen wir!», beharrte sie, als sie alles sauber neben der Spüle in der Küche aufgestapelt hatte.
«Ich habe keine Zeit», winkte die Mutter ab. «Außerdem ist mir das zu weit, und dann die vielen Treppen.»
Letzteres war wohl der wahre Grund. Ihr war alles zu anstrengend und zu schmerzhaft. Emilia bedauerte ihre Mutter von Herzen, dennoch grollte sie ihr ein wenig, dass sie mit ihr nicht den gleichen Spaß haben konnte wie andere Kinder mit ihren Müttern. Oder an manchen Wochenenden gar bei Ausflügen mit den Vätern. Einen Vater hatte Emilia nicht – zumindest weigerte sich Caroline, mit ihrer Tochter über dieses Thema zu sprechen. Es gab nur sie beide: die ungestüme Emmy, die am liebsten tanzte und sang, und die Mutter mit den Krücken und dem hinkenden Gang, der all das ein Gräuel war. Vielleicht, weil sie selbst nicht tanzen konnte?
Aber hätte sie nicht zumindest mit ihrer Tochter singen können? Emmy wusste nicht einmal, ob sie eine schöne Stimme hatte, denn sie sprach nur in diesem rauen, abgehackten Ton, so als würde selbst das Sprechen ihr Mühe bereiten.
Zum Glück gab es noch den Großvater, der ein fröhlicher und geselliger Mensch war und mit dem zusammen Emmy jede Stunde genoss.
«Mutti! Der Großvater will uns doch alles zeigen», bettelte Emilia und sah mit flehendem Blick zu der hageren Miene ihrer Mutter auf, deren Körper wie stets in einem schwarzen Kleid steckte. Ihr Haar hatte sie zu einem strengen Knoten aufgesteckt, keine Strähne wagte es, sich an ihrer Schläfe oder im Nacken zu kringeln.
Emilia dagegen trug ihre bis auf den Rücken wallenden goldblonden Locken am liebsten ungebändigt. Sie öffnete die Haarbänder und Zöpfe meist, sobald sie den Blicken ihrer Mutter entkommen konnte.
«Vater, nimm Emmy mit und zeige ihr den Admiralspalast. Sie kann mir dann heute Abend berichten.»
Das war natürlich nicht dasselbe. Emilia sah, dass der Großvater enttäuscht war, doch er schüttelte die schlechten Gefühle sogleich ab und lächelte seine Enkelin warm an.
«Aber gerne doch, mein wunderschöner Liebling.» Er streckte die Hand aus, und Emmy schob ihre Finger in die seinen. Ihre Mutter zog eine saure Miene. Oder waren es nur die Schmerzen?
«Gut, dann geht jetzt. Ich muss mich um den Abwasch kümmern.»
Vielleicht war das ihre Art anzudeuten, dass Emilia ihr auch diese Arbeit abnehmen sollte, doch diese war viel zu aufgeregt und neugierig auf den großen neuen Bau mit den vielen angekündigten Attraktionen, um darauf einzugehen. Rasch zog sie den Großvater zur Wohnungstür, bevor es sich die Mutter noch anders überlegte.
Vor einem Jahr hatten unzählige Arbeiter damit begonnen, das Terminus Hotel an der Friedrichstraße und das alte Admiralsgartenbad daneben niederzureißen, um einen neuen prächtigen Komplex zu errichten: den Admiralspalast.
So war im direkten Umfeld des bereits vor dreißig Jahren eingeweihten großen Stadtbahnhofs an der Friedrichstraße mit dem Monopol-Hotel, dem Central-Hotel mit seinem berühmten Wintergarten, der Komischen Oper und dem Savoy-Hotel ein richtiges Vergnügungsviertel entstanden – für die Berliner, aber auch für die zunehmende Zahl an Fremden, die kamen, um sich in der kaiserlichen Hauptstadt zu amüsieren.
Hand in Hand schritten die beiden am Savoy-Hotel vorbei auf die neue, prächtige Fassade zu. Im linken Gebäudeteil hatte ein elegantes Café auf zwei Ebenen eröffnet, daneben führte ein Torweg in den großen, nahezu quadratischen Hof, an dessen Ende es links in eine Bar ging, zu der Emilia keinen Zutritt hatte, doch geradeaus führten die Zugänge an den Kassenschaltern vorbei direkt in das deutlich breitere Quergebäude, in dem sich die neue Eisbahn befand, ihrem ersten Ziel, dem Emmy bereits entgegenfieberte. Und dann stand sie an der Bande der ovalen Bahn und riss staunend die Augen auf. Was für eine Pracht! Das Ganze war wie ein Theater gebaut, mit Logen und zwei rundumlaufenden Rängen mit verzierten Stützen und Bögen, nur dass die Bühne die Eisfläche war, die den Parkettraum dieses Theaters vollständig einnahm. Im Licht der Kronleuchter schimmerte und glitzerte die weiße Fläche, in die die Kufen der Schlittschuhe anmutige Kurven und Kringel zogen. Ein paar gute Läuferinnen waren auf dem Eis, auch wenige Männer hatten sich darauf gewagt. Ansonsten einige Mütter oder Kinderfrauen, die ihre Schützlinge begleiteten oder sie alleine losschickten und von der Bande aus das Geschehen beobachteten. Da ergab sich die Gelegenheit, mit Kolleginnen ein Schwätzchen zu halten und sich gar eine Limonade oder einen Kaffee zu genehmigen.
Rund um die Bahn standen mit weißen Tischtüchern gedeckte Tische, und auch in den logenartigen Rängen konnte man sich kulinarisch verwöhnen lassen, während man der Musik lauschte und den Läufern zusah, denn natürlich gab es ein Orchester, das bekannte Weisen spielte.
«Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft», sang Emmy den Marsch von Paul Lincke aus voller Kehle mit. Der Großvater lachte und summte, eine Oktave tiefer, die eingängige Melodie.
«Oh Großpapa, wenn ich das nur auch einmal versuchen dürfte», drängte Emmy.
«Aber natürlich wirst du das ausprobieren. Doch ich schlage vor, ich zeige dir erst noch das neue Bad, das über der Eisarena liegt, und meine Wohnung. Sie ist klein und nichts Besonderes. Nicht so schön wie eure, aber mir wird es reichen. Für einen Hausmeister, der Tag und Nacht im ganzen Palast nach dem Rechten sehen muss, genau das Richtige. Und wenn du willst, können wir uns auch noch die Kegelbahn im Keller ansehen.»
«Aber danach darf ich aufs Eis!», erinnerte ihn Emmy.
«Ja, versprochen!»
Strahlend folgte sie ihrem Großvater zu den Rängen hinauf, von denen aus man einen tollen Blick hinunter hatte, und dann zum Bad, das sich nun, dank einer entdeckten Solequelle, «Heilbad» nennen durfte.
Die Wohnung des Großvaters war wirklich klein mit einer Wohnküche inklusive Tisch und Stühlen, einer Schlafkammer und einem weiteren Zimmer, das bisher leer stand. Außerhalb der Wohnung, ein Stück den Flur runter, gab es eine Toilette mit einem Waschbecken. Mehr brauchte man nicht. Schließlich hatte der Großvater ein luxuriöses Bad hier direkt im Haus, wenn es ihm einmal nach einer Wanne mit heißem Wasser gelüsten sollte.
Nachdem es Emilia drunten in der Kellerkegelbahn nach mehreren Versuchen geschafft hatte, die schwere Kugel auf der Bahn so in Schwung zu bekommen, dass sie zumindest einige der Kegel umwarf, kehrten sie zur Eisbahn zurück, wo der Großvater für Emilia Schlittschuhe auslieh. An seiner Hand stakste sie zu dem Törlein in der Bande und wagte sich aufs glatte Eis. Zuerst noch mit einer Hand an der Bande, während der Großvater einen Schritt zurücktrat und ihr zusah. Vorsichtig schob Emmy die ungewohnt wackeligen Kufen unter ihren Sohlen nach vorne, was aber eher ein halbes Gehen, denn ein Gleiten war. Missmutig presste sie die Lippen aufeinander, wagte aber immerhin, den festen Halt loszulassen. Ganz vorsichtig schob sie sich, ein Fuß nach dem anderen, am Rand entlang. Emmy war zutiefst enttäuscht. Das fühlte sich weder schwungvoll und elegant an, noch sah es vermutlich danach aus. Sie warf einen Blick zu ihrem Großvater zurück, der mit einem anderen älteren Mann hinter der Bande stand und sich unterhielt.
Da sauste ein Mädchen, das vermutlich ein paar Jahre älter war als Emilia, in elegantem Schwung an ihr vorbei, legte sich ein wenig in die Kurve, breitete die Arme aus und wirbelte dann ein paarmal um ihre eigene Achse, dass die Röcke nur so flogen. Dann stoppte sie abrupt, hoch aufgerichtet, und verbeugte sich mit einem Knicks in Richtung der anderen Seite, von wo aus ein junger Mann ihr zusah und nun begeistert in die Hände klatschte.
So! Genau so wollte sie es auch machen! Emmy kehrte zur Bande zurück, stieß sich dann kräftig ab, breitete die Arme aus, um in eine Biegung zu schwingen, und verlor das Gleichgewicht. Statt elegant ausgestreckt, ruderte sie mit den Armen und knallte dann hart mit dem Hintern aufs Eis. Aua!
Der Po und ihr Stolz taten gleichermaßen weh. Sie sah zu den beiden Männern hinüber, die in ihrer Unterhaltung innehielten und zu ihr herübersahen. Der Großvater machte keine Anstalten, sie aus ihrer misslichen Lage zu befreien. In seiner Miene glaubte sie eher Interesse als Mitleid lesen zu können.
Sie brauchte auch kein Mitleid! Mühsam und sicher wenig elegant rappelte sie sich auf, bis sie wieder schwankend auf den Kufen stand, dann schob sie diese, deutlich vorsichtiger, eine nach der anderen zur Bande zurück.
«Nun?», erkundigte sich der Großvater.
«Es ist doch ein wenig schwieriger, als ich dachte», gab Emmy kleinlaut zu.
Der Fremde lachte. «Dein erstes Mal?»
Sie nickte. Er winkte ab. «Das geht jedem so. Du brauchst jemanden, der dir den rechten Schwung zeigt und dich am besten bei den ersten Runden an die Hand nimmt.»
Er ließ den Blick über die Eisfläche schweifen und rief dann laut: «Nina, komm doch bitte einmal herüber.»
Die elegante Läuferin winkte, kam angesaust und stoppte dann, ohne auch nur zu schwanken.
«Herr Lincke? Was kann ich für Sie tun?», erkundigte sie sich höflich.
«Dieses Mädchen, Emilia, ist die Enkelin des Hüters der Schlüssel hier im Admiralspalast.» Er deutete auf den Großvater. «Und sie würde gerne in das Geheimnis des Schlittschuhlaufs eingewiesen werden.»
Das Mädchen Nina, das vielleicht siebzehn Jahre zählen mochte, warf Emilia einen abschätzenden Blick zu, doch nicht unfreundlich, sagte sie sich zumindest. Dann lächelte Nina und sah mit ihrem schmalen Gesicht, den grünen Augen und dem rötlich braunen, locker aufgesteckten Haar recht hübsch aus.
«Na, dann wollen wir es mal versuchen.» Sie reichte Emmy die Hand. «Schiebe die Füße abwechselnd, ein wenig schräg nach außen gestellt, mit Schwung nach vorne. Beuge dich ein wenig vor, dann fällt es dir leichter, das Gleichgewicht zu wahren. Halte dich an meiner Hand fest und bleibe im gleichen Rhythmus wie ich. Den anderen Arm streckst du zur Seite, das gibt dir mehr Halt. Also, wir fangen mit dem linken Fuß an. Ich zähle mit, klar?»
Emmy nickte und betete im Stillen, sie möge nicht über die Füße des Mädchens stolpern, doch Nina wollte ihr wirklich helfen und schob den ersten Schritt sehr behutsam nach links. Laut zählte sie mit: «Links, rechts, links, rechts, links, rechts …»
Mit jedem Schritt wurde ihr Schub ein wenig kräftiger, und Emmy spürte, wie die Kufen ins Gleiten kamen. Jetzt fühlte es sich nicht mehr so wackelig an. Sie glitten auf die Bahn hinaus, und dann – erst recht langsam, dann ein wenig forscher – wagten sie eine Runde nach der anderen durch das Oval. Oh, war das wunderbar! Am liebsten hätte sie Ninas Hand losgelassen und ihre eigenen Schwünge gedreht, doch sie war so vernünftig einzusehen, dass das vermutlich in einem weiteren Sturz geendet hätte. Herr Lincke klatschte fröhlich in die Hände, als sie nach ein paar Runden etwas außer Atem wieder bei den beiden Zuschauern anhielten.
«Das sieht doch schon großartig aus», lobte er.
Emmy bedankte sich bei Nina und entließ sie zu ihrem Bewunderer. Gleichzeitig verabschiedete sich der fremde Herr vom Großvater und reichte dann auch Emmy die Hand.
«Emilia, ich hoffe dich nun häufig auf dem Eis zu sehen, denn lass dir gesagt sein, um es mit solch einer Eleganz und Sportlichkeit zu betreiben wie Nina, musst du viel üben und leider auch Stürze und blaue Flecken wegstecken. Das ist nichts für Weichlinge.» Er zwinkerte ihr zu.
Herausfordernd hob Emilia das Kinn, während sie seinen festen Händedruck erwiderte. «Ich bin kein Weichling, und ich fürchte mich auch nicht vor blauen Flecken.»
Herr Lincke lächelte ermunternd. «Das habe ich mir schon gedacht. Du scheinst mir eine junge Dame mit Biss zu sein. Ich denke, wir werden uns schon bald hier wiedersehen, denn ich finde den Admiralspalast und die Eisbahn so gelungen, dass ich ganz sicher häufiger da sein werde. Die Atmosphäre inspiriert mich!» Vor sich hinsummend, ging er davon.
Benno
Berlin, 1912
Er war müde und hungrig, und er fror. Seine zerschlissenen Kleider waren vom letzten Regen noch feucht, seine Füße in den fast durchgelaufenen Schuhen quietschten vor Nässe. Nein, so hatte er sich die Freiheit nicht vorgestellt. Es musste in dieser verdammt riesigen Stadt doch einen Platz für ihn geben, an dem er sich ausruhen und trocknen konnte!
Doch so einfach war das nicht. Nicht nur, dass ihn die Verkäufer an den Marktständen davonjagten, sobald sie ihn sahen. In einen Laden brauchte er erst gar nicht zu gehen. Es war eben deutlich zu sehen, dass er kein Geld besaß, und sein Hunger stand ihm vermutlich ins Gesicht geschrieben. Heute Morgen hatte er gar aus einem Mülleimer angefaulte Früchte geklaubt. So tief war er gesunken.
Und warum?
Weil er nicht mehr bereit gewesen war zu gehorchen. Weil er die Schläge nicht mehr ertragen wollte. Weil er keines der Kinder war, denen man befahl und die ohne Widerspruch gehorchten.
Die Verachtung im Blick der Erwachsenen, deren Aufgabe es war, ihn zu einem anständigen Bürger zu erziehen, schmerzte mehr, als er zugeben wollte. «Zigeuner» nannten sie ihn, und vielleicht stimmte das sogar. Keiner wusste, wer seine Eltern waren und warum er ausgesetzt worden war. Aber offensichtlich passte sein Aussehen zu den Vorurteilen der Patres und der Diakone, und so war er eben der «Zigeuner», aus dem nichts Rechtes werden würde, denn er war starrköpfig und ungehorsam und stahl Essen aus der Küche, wenn er zu hungrig war. Dass er dieses mit den anderen stets teilte – hungrig waren hier alle –, das sagte er nicht, sonst hätten diese in den Augen der Patres ja ebenfalls eine Bestrafung verdient. Nein, da war er bockig und nahm die Schläge oder den erneuten Essensentzug alleine auf sich.
Man prophezeite ihm häufig, dass sein Weg, wenn er das Heim verließe, unweigerlich direkt ins Gefängnis führen werde. Also sei jedes Jahr, das sie ihn noch hierbehielten, ein Gottesgeschenk. Was sich für ihn allerdings nicht so anfühlte.
Stunden, in denen Benno weniger litt, waren die Unterrichtsstunden bei Fräulein Wagner, der einzigen Frau unter den Aufsichtspersonen im kaiserlich-kirchlichen Kinderheim. Sie war auch die Einzige, die ihn nie geschlagen hatte. In ihrem Unterricht war er besonders aufmerksam und sog alles Wissen, das sie ihm bot, in sich auf. Er lernte auch lesen, schreiben und rechnen bei den Patres, aber mit vielen Rohrstockschlägen für Fehler, freche Antworten oder aufsässiges Verhalten.
Nicht, dass er das einzige Kind war, das die Rute zu spüren bekam. Züchtigungen gehörten zu den bewährten Erziehungsmethoden, hatte ihm Pater Clemens erklärt. Sie seien notwendig, um anständige Menschen aus dieser Brut von Waisen und Ausreißern zu formen, selbst wenn es in Ausnahmefällen nicht gelang, alle Dämonen auszutreiben, was wahrscheinlich auf ihn gemünzt gewesen war.
Benno war vermutlich bereits fünfzehn, als er den Entschluss fasste, keine Minute länger zu bleiben. Und da er sowohl über Mut als auch über Entschlussfreudigkeit verfügte, packte er noch in derselben Nacht seine wenigen Habseligkeiten zusammen, brach die Geldkassette der Köchin auf und machte sich mit ein paar Kleidungsstücken und einem leider recht kleinen Geldbetrag auf, endlich den Fortgang seines Lebens selbst zu bestimmen.
Eine Weile trieb er sich noch in den Dörfern der Umgebung herum, fand Unterschlupf in den Scheunen der Bauern, doch das Risiko, entdeckt und zurückgebracht zu werden, war groß. Ein Knecht, mit dem er sich ab und zu unterhielt, zeigte ihm eine Stelle, wo die Güterzüge nach Berlin an einer Weiche häufig anhalten mussten. So war es beschlossene Sache. Er würde nach Berlin fahren und dort endlich richtig zu leben beginnen!
Und nun war er hier, seit einigen Wochen, und inzwischen sehr hart auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Nein, Berlin empfing einen wie ihn nicht mit offenen Armen. Nein, es gab keine Arbeit und noch weniger Geld im Überfluss, jedenfalls nicht ohne Papiere. Und auch mit einer trockenen Unterkunft war das nicht so einfach. Jeden Tag der erneute Kampf, satt zu werden. Sein weniges Geld hatte er längst aufgebraucht.
Manche Regennacht verbrachte er in einem der Obdachlosenasyle im Norden der Stadt oder beim Schlesischen Bahnhof, wo sich Männer aller Altersklassen drängten. Dort bekam er auch mal einen Teller warme Suppe. Angenehm waren die Nächte allerdings nicht, gedrängt auf dem Boden oder auf einer der Holzbänke. Zwischen stinkenden, schnarchenden, häufig verlausten Männern waren die Nächte kein Paradies. Sich in der Schlange einzureihen, um sich ein richtiges Bett zuweisen zu lassen, wagte er nicht, denn dafür benötigte man ebenfalls Papiere, wofür man sich erst einmal registrieren lassen musste. Seit Benno mitbekommen hatte, wie einer der Herbergswirte einen Minderjährigen der Polizei übergeben hatte, dass sie ihn in ein Heim bringen sollten, mied er die Asyle wann immer möglich.
An diesem verregneten Frühlingsabend trottete er die Friedrichstraße entlang und warf sehnsüchtige Blicke durch die hell erleuchteten Fenster der Hotels und Vergnügungsstätten, in die Menschen jeder Herkunft, aber in sauberen Kleidern und mit Geld in der Tasche strömten. In ein Hotel oder ein Theater konnte er sich nicht schmuggeln, dazu war seine abgerissene Erscheinung zu offensichtlich. In einer Kneipe ließ er eine draußen aufgehängte saubere Jacke und eine Schirmmütze mitgehen, die ihn vor dem Nieselregen schützten und ihm ein etwas anständigeres Aussehen verliehen. Derart getarnt, wagte er sich auf den Eingang zum Admiralspalast vor. Es waren hier so viele Menschen unterwegs, die kamen und gingen, dass er, ohne aufzufallen, mit ihnen den Torweg zum Hof passieren konnte.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: