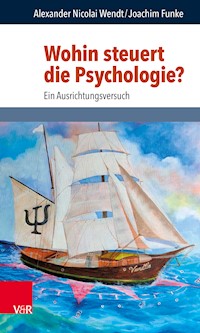
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Philosophie und Psychologie im Dialog.
- Sprache: Deutsch
Das Vertrauen auf den wissenschaftlichen Fortschritt ist heutzutage groß. Aber was heißt Fortschritt? Schreiten wir zu einer besseren oder nur von einer ehemaligen Zeit fort? Der Unterschied ist eine Angelegenheit der Ausrichtung. Das Buch widmet sich deswegen der Frage, wie es gelingen kann, dem wissenschaftlichen Streben in der Psychologie eine Ordnung zu geben. Dabei werden zwei Perspektiven eingenommen: Zunächst blickt die Philosophie auf die Möglichkeit einer theoretischen Psychologie in Hinsicht auf anthropologische und wissenschaftstheoretische Voraussetzungen, dann die Experimentalpsychologie auf die Möglichkeit guter Theoriebildung. Der dritte Teil des Buches ist der Versuch einer Synthese, in dem der philosophisch-psychologische Perspektivenpluralismus als Programm vorgeschlagen wird, die Richtungen, in die der Fortschritt der Disziplin erfolgt, kritisch zu begleiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Philosophie und Psychologie im Dialog
Herausgegeben von
Christoph Hubig und Gerd Jüttemann
Band 21: Alexander Nicolai Wendt / Joachim Funke Wohin steuert die Psychologie?
Alexander Nicolai Wendt / Joachim Funke
Wohin steuert die Psychologie?
Ein Ausrichtungsversuch
Mit 9 Abbildungen
Vandenhoeck & Ruprecht
Jürgen Bredenkamp und Hans Werbik gewidmet
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind
im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2022 Vandenhoeck & Ruprecht, Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen, ein Imprint der Brill-Gruppe
(Koninklijke Brill NV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich)
Koninklijke Brill NV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Hotei, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau, Verlag Antike und V&R unipress.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: Mariangel Beatriz Mendoza de Wendt
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISBN 978-3-647-99401-7
Inhalt
Vorwort
Alexander Nicolai Wendt
Philosophischer Teil: Der Platz der Seele in der Welt des Menschen
Joachim Funke
Psychologischer Teil: Theoretische Psychologie in Zeiten von »Big Data«
Alexander Nicolai Wendt und Joachim Funke
Diskussionsteil: Ein Plädoyer für Veränderung
Literatur
Christoph Hubig
Nachwort zum Abschluss der Reihe »Philosophie und Psychologie im Dialog«
Vorwort
Dieses Buch ist im Frühjahr 2021 unter den einschränkenden Bedingungen einer Pandemie geschrieben worden. Es handelte sich um Bedingungen, die sich wesentlich von denjenigen unterschieden, unter denen der Inhalt dieses Buches entstanden ist. Das Denken, das hier in Worte gefasst wird, entstammt der Universität als Ort der Begegnung und »Milieu der Kreativität«. Unsere Begegnungen begannen als diejenigen zwischen Professor und Erstsemester, setzten sich über eine Promotion fort und haben nun die Gestalt einer Beziehung zwischen Emeritus und Postdoc angenommen, ohne ihre Kontinuität zu verlieren.
Es lässt sich ohne Übertreibung sagen, dass die Gedanken, die an dieser Stelle verschriftlicht werden, über ein Jahrzehnt der universitären Gemeinschaft von Dozent und Student gereift sind. Zugleich handelt es sich um eine Gemeinschaft, die vom lebendigen regionalen Miteinander gekennzeichnet ist. Das Psychologische Institut der Universität Heidelberg hat die Atmosphäre beheimatet, in der sich unser Dialog entfalten konnte.
Zu dieser Atmosphäre gehört die geschichtliche Aura des Ortes, die im Staub auf den ältesten Bänden in den Regalen der Institutsbibliothek, den Wilhelm Wundt und William James gewidmeten Gedenktafeln, aber auch in der klandestinen Enklave des Innenhofes, den die Gebäude des Instituts umfassen, vergegenwärtigt ist. Die Genese dieses Buches ist eine ambulatorische – ein gemeinsames Schreiten durch die Heidelberger Hauptstraße oder zum Experimentallabor, das entfernt an die Athener Säulengänge erinnert. Aber auch die zahllosen Diskussionen beim Essen in der »Pasta Bar« haben unsere Ideen geschärft – das Essen selbst blieb weit weniger gut in Erinnerung als die dort diskutierten Provokationen, die das Mittagessen oft zu einem kleinen Symposion werden ließen, das an den Stehtischen »beim Tchibo« fortgesetzt wurde.
Manche Gedanken brauchen eine Heimat, um zu reifen, oder die Ruhe, die Geborgenheit, um entstehen zu können. Es ist eine geteilte – die Phänomenologie würde sagen: zwischenleibliche – Regionalität, die unserer Schrift vorausgeht. Nicht das rastlose Vagabundieren, sondern die Gelassenheit und das Sich-Einlassen sind die zugrundeliegende Arbeitsweise.
Die Voraussetzung für die Identifikation mit der eigenen Disziplin, die eine wissenschaftstheoretische Reflexion inspiriert, ist die Hingabe an die Sache, die dem organisationspsychologischen Konzept der »Work-Life-Balance« scheinbar diametral entgegensteht. Wir beide sind von der Lage der Psychologie betroffen (»affiziert«), auch wenn der Feierabend oder das Wochenende schon begonnen hat. Weil es uns nicht gleichgültig ist, wohin die Psychologie steuert, denken wir oft (auch zu ungewöhnlichen Zeitpunkten) darüber nach, was die ermöglichenden Bedingungen für eine epistemische (Neu-)Ausrichtung in der Wissenschaft sind. Wissenschaft ist also nicht nur Beruf, sondern Berufung. Der Geist von Max Weber ist natürlich in Heidelberg lebendig.
Allerdings profitiert die Hingabe an den Gegenstand auch von einem entstressten Geist, der nicht unter Zeitdruck steht oder gar dem Terror des »publish or perish« ausgesetzt ist. Arbeit an der Sache ist Teil einer selbstbestimmten Lebensführung und wird daher nicht als Belastung, sondern als Bereicherung angesehen.
Dieses Buch ist auch ein intergenerationales. Wir möchten damit allerdings nicht nur auf unsere Generationen verweisen, sondern uns auch mit Dank an unsere Quellen wenden. Die Beziehung zwischen Doktorand und Doktorvater oder -mutter kann eine Quelle von Besonnenheit sein, und so spannt sich eine Kette in die Geistesgeschichte, deren Glieder jeweils das nächste in die Vergangenheit und Zukunft zusammenhalten.
Ein Glied, das uns vorangeht, ist Jürgen Bredenkamp, dem wir dieses Buch in Dankbarkeit und Verehrung widmen möchten. Sein Name ist ebenfalls mit dem Heidelberger Institut verbunden und steht in enger Verbindung zu Carl Friedrich Graumann, der in den 1960er Jahren begonnen hat, die Heidelberger psychologische Forschung aufzubauen.
Die Habilitationsschrift von Jürgen Bredenkamp (1972: Der Signifikanztest in der psychologischen Forschung) markiert eine methodologische Reflexion über eine der wichtigsten Elemente empirischen Forschens in der Psychologie: den Signifikanztest. Dessen naive Verwendung hat in den vergangenen Jahrzehnten zu einem Missbrauch geführt, der den Erkenntnisgewinn einer ganzen Reihe von spektakulären Publikationen höchst fragil erscheinen lässt und die Notwendigkeit eines tieferen erkenntniskritischen Nachdenkens über die beste Vorgehensweise deutlich macht. Dieses bereits bei Jürgen Bredenkamp sichtbare Bemühen um eine gute Ausrichtung psychologischen Erkenntnisstrebens wird in diesem Buch rund 50 Jahre später wieder von uns aufgegriffen.
Ein anderes uns vorausgehendes Glied ist Hans Werbik, dem wir dieses Buch ebenfalls in Dankbarkeit und Verehrung widmen möchten. Zwar steht Heidelberg nicht im Mittelpunkt von Werbiks Wissenschaftsbiografie, Werbik aber im Mittelpunkt der jüngeren Psychologiegeschichte. Als Denker der psychologischen Handlungstheorie steht der Erlanger Professor für einen konstruktiven und zur Kontroverse bereiten Umgang mit Theorie in der Psychologie. Mit der Gründung der Gesellschaft für Kulturpsychologie im Jahre 1986 hat Werbik einen wichtigen institutionellen Beitrag zum konzeptuellen Pluralismus der Disziplin geleistet. Seine unablässige Bemühung um Interdisziplinarität, den kritischen Blick auf die eigene Disziplin und kreative Erneuerung der Psychologie ist uns Vorbild und Maßstab. Die Gründung der »Arbeitsgruppe Philosophie & Psychologie« im Jahr 2018 ist nur ein weiteres Beispiel für Werbiks gestaltende Kraft im Grundlagendiskurs unseres Faches.
Zusammenhänge dieser Art ermöglichen es erst, den jeweils eigenen Beitrag zu verorten, und wir ermutigen alle Psychologinnen und Psychologen, die Wissenschaftsgeschichte ihrer Forschungsstätte ernst zu nehmen. Erst mit dem Blick auf den geschichtlichen Zusammenhang können wir uns der Nachhaltigkeit unserer Forschung versichern, sie kontextualisieren, sie »verorten«.
Unser Dank gilt an erster Stelle unseren Frauen, die unsere Leidenschaft für das Denken tragen und ertragen. Sodann möchten wir uns herzlich bei Gerd Jüttemann und Christoph Hubig als den Herausgebern dieser Reihe für ihre wohlwollende und fördernde Betreuung bedanken. Wir empfinden es als Ehre, in dieser wertvollen Schriftenreihe für den Dialog zwischen Philosophie und Psychologie den letzten Beitrag liefern zu dürfen. Ferner bedanken wir uns bei den persönlichen Dialogpartnern, die uns in den letzten Jahren begleitet haben, insbesondere Daniel Holt, Alexandre Métraux, Mark Galliker und Hannes Wendler. Einen letzten Dank sprechen wir im Andenken an Carl Friedrich Graumann (1923– 2007) aus, der als Vater des Heidelberger Instituts einer der Riesen ist, auf deren Schultern wir heute stehen dürfen.
Alexander Nicolai Wendt und Joachim Funke
Alexander Nicolai Wendt
Philosophischer Teil:Der Platz der Seele in der Welt des Menschen
Ein Studium ist auch immer eine Initiation. Wer im ersten Semester den Hörsaal betritt, überschreitet im symbolischen Sinne die Schwelle von der alltäglichen Exoterik des sensus communis zur Esoterik der wissenschaftlichen Einstellung, also der Geheimlehre der akademischen Rationalität, deren Geheimnis ein offenes ist: Sie ist zwar stets nachvollziehbar, oder soll es sein, doch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterscheiden sich als »Experten« von der breiten Öffentlichkeit gerade dadurch, dass sie sie auch tatsächlich nachvollziehen. Kaum anders stehen sie vor der jungen Studentenschaft als diejenigen, die kraft ihres Wissens Eingeweihte sind. Wer den Schritt über die Schwelle des Hörsaals nimmt, vertraut sich den Dozentinnen und Dozenten jedoch nicht nur als Experten an, sondern auch als Meistern und Prälaten einer über Jahrhunderte tradierten Geisteshaltung der Wissenschaftlichkeit, die zwar nach einem Höchstmaß an rationaler Rechtfertigung strebt, doch sich im Erleben der Studentinnen und Studenten niemals ganz ohne mystischen Charakter etabliert.
Der Grund dafür liegt in der Sache der Bildung selbst, denn im Laufe des Studiums werden junge Erwachsene nicht nur an Sachwissen reicher, sondern vervollkommnen auch ihre geistige Identität. Das heißt aber, dass sie das Wachstum, das ihnen bevorsteht, eingangs noch nicht absehen, sondern allenfalls erahnen können. Hierin ist sowohl das denkwürdige Wesen des Studiums als Initiation in den Habitus der Wissenschaftlichkeit als auch die Universität als Institution des Vertrauens begründet – Vertrauen, das, wie Otto Friedrich Bollnow eingesehen hat, neben Liebe und Geduld auf der Gegenseite auch zu den »Tugenden des Erziehers« gehört (Bollnow, 1978).
Das Studium ist daher nicht nur im Sinne der Strebsamkeit Eifer (lat. studium), sondern auch im Sinne der Geltung von Vorbildern oder Idealen, denen die Studentenschaft nacheifert. Ferner ist die Einschreibung eine Kommunion für die universitas magistrorum et scolarium und die Matrikel umschreibt ein Noviziat ohne Glaubensgelübde. Es verlangt das gesunde Vertrauen in die Würdigkeit und Gültigkeit der gewählten Disziplin und damit auch in ihre Repräsentantinnen und Repräsentanten – selbst wenn ihnen die Anerkennung in Form der Kritik entgegengebracht wird.
Dieser Zusammenhang findet auch eine Entsprechung in dem Bild, das wir für dieses Buch gewählt haben: dem Ausrichtungsversuch. Ausgerichtet werden kann eine Gruppe oder etwas Einzelnes, doch auch die Gruppe wird durch die einheitliche Richtung gewissermaßen zum Ganzen. Deswegen lässt sich von der Ausrichtung der Disziplin der Psychologie mit dem Bilde des Schiffes sprechen. So manche Kapitänin und mancher Kapitän ist auf diesem Schiff schon gefahren, und Jahr für Jahr heuern Erstsemester auf ihm an. Sie werden zur Besatzung und die Überfahrt prägt sie wie die raue See, sodass sie als Landratten das erste Mal an Deck und als Seebären wieder von Bord gehen. Denjenigen, die als Schiffsjunge oder Leichtmatrose auf ein Schiff kommen, bleibt nichts anderes übrig, als sich den Herausforderungen und Abenteuern, die vor ihnen liegen, zu stellen. Der pathetische Ausruf »oh captain, my captain«, der für den von Tom Schulman geschriebenen Filmklassiker »Dead Poets Society« steht, ist ein Ausdruck des Vertrauens, das der charismatischen Autorität eines Lehrers oder einer Dozentin gleich derjenigen eines auf See fahrenden Kapitäns geschenkt wird.
Auch am Anfang meiner Studienzeit steht diese Erfahrung. Nicht wissend, worum es sich bei der Psychologie als Disziplin wirklich handele, und ohne die Autorität und Kenntnis für einen eigenen Ansatz öffnete ich mich – nicht ohne Skepsis oder eigene Meinung – eifrig und bereitwillig für den Einfluss der Lehre. Zum Psychologen bin ich dabei jedoch nicht vermittels spezifischer Wissensbestände allein geworden, sondern durch dasjenige, was Alfred Schütz im Anschluss an Edmund Husserl »Habitualisierung« genannt hat (Schütz, 2003). Nicht der Inhalt bestandener Klausuren selbst, die teilweise den Biologie- und teilweise den Führerscheintests der Schulzeit ähnelten, hat das disziplinäre Selbstverständnis gewährt, sondern die »Sedimentierung« der Wissensbestände, die den Habitus des Psychologen entstehen ließen.
Wichtiger als die Kenntnis der Neuroanatomie war der regelmäßige und jahrelange Umgang einerseits mit denjenigen, die den in der Regel festen Entschluss gefasst hatten, ihre bürgerliche Identität mit der Disziplin der Psychologie zu verschmelzen, also Kommilitoninnen und Kommilitonen, und andererseits Personen, die das Selbstvertrauen und die Gewohnheit besaßen, sich selbst als Psychologinnen und Psychologen zu präsentieren, den Dozentinnen und Dozenten. Das bedeutet auch, dass Abschlüsse und Diplome die Übernahme der gesellschaftlichen Rolle nur legitimieren oder für sie eine Routine bahnen. Die Initiation als Psychologin oder Psychologe besteht nicht im Ritual der Verleihungszeremonie, sondern in der Gewöhnung an die akademischen Riten des Forschens, Überprüfens oder Erhebens, ohne dass für diese Riten die Kodifizierung möglich wäre. Die Äquatortaufe für Studentinnen und Studenten ist kein einheitlicher Erwerb von symbolischem Kapital, sondern der Vollzug einer disziplinären Praxis, der sich beispielsweise in der Übernahme eines Jargons abzeichnet.
In anderen Worten: Der Übergang in die Sphäre der akademischen Wissenschaftlichkeit ist keine reine Kenntnisvermittlung für Personen, die für das, was auf sie zukommt, gänzlich bereit wären. Vielmehr ist das Studium eine Überforderung und gerade dadurch Bildung, denn das Mehr an Geistigkeit, das die hochschulische Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden schafft, bietet der Freiheit der Persönlichkeitsentwicklung Raum. Das bedeutet aber, dass Studentinnen wie Studenten die Bedingungen und Zusammenhänge ihrer akademischen Sozialisation erst begreifen können, sobald ihre Bildung erfolgt ist. Am Anfang steht der Vertrauensvorschuss, dass die geistigen Gepflogenheiten der gewählten Disziplin recht und gerecht seien.
Was aber rechtfertigt die institutionelle Autorität des Lehrkörpers, dass sich also auf ihn Hoffnung und Vertrauen des akademischen Nachwuchses vereinen? Was, so ließe sich anders fragen, ist die Eigenheit des Rufes auf einen Lehrstuhl oder der Lehrauftrag, dass sie die Lehrenden mit dem Recht ausstatten, die Studentenschaft nach ihrer Anschauung der jeweiligen Disziplin zu prägen? Die Antwort kann nicht allein in einem Bildungsmonopol staatlicher Macht liegen, denn sonst stünde die Universität nicht in Tradition der Athener Akademie, sondern der Sophisten. Ebenso wenig darf es heißen, dass die einzige Alternative Verwahrlosung sei, da einer Gesellschaft schlichtweg nur eine Riege an Akademikern zur Verfügung stünde, denn es müsste sogleich gefragt werden, was die Akademiker als Akademiker auszeichnete – Tradition allein macht noch keine Lehrer. Die Crux liegt folglich im Anspruch auf Disziplinarität, der artikuliert, warum die einen und nicht andere Psychologie – oder jedes andere Fach – lehren.
Allein, eine formale Herleitung des Anspruchs auf Disziplinarität bleibt im Zuge des Studiums gemeinhin aus – davon ist die Psychologie keine Ausnahme. Eine Taxonomie der Subdisziplinen, des Unterschieds zwischen Grundlagen- und Anwendungswissenschaft oder die Abgrenzung einer quantitativen von einer qualitativen, einer natur- von einer geisteswissenschaftlichen sowie einer hypothesengenerierenden von einer hypothesenüberprüfenden Verfahrensweise – nämlich eine wissenschaftstheoretische Propädeutik – wird zwar oftmals methodologisch zur Verfügung gestellt, doch die Deduktion der Notwendigkeit der zeitgenössischen Art und Weise, Psychologie zu betreiben, also der »herrschenden Lehre«, erfolgt zumeist nicht. Kurzum: Das Psychologiestudium wird nicht durch eine lückenlose Ableitung des Erkenntnisanspruchs aus der Geistesgeschichte und der reinen Vernunft eingeleitet. Es ist eine Initiation, in der man sich dank der Sedimentierung von Wissensbeständen an den Eindruck gewöhnt, dazuzugehören, denn die Rechtfertigung für die Lehre ist in der Regel nur implizit.
Anders wäre es auch kaum möglich, wie sich an den Gesprächen, die an die Grenzbereiche der disziplinären episteme (im Sinne von Foucault, 2003) gelangen, deutlich wird, denn verbindliche Antworten sind nicht trivial, sondern problematisch: Was ist der Gegenstand der Psychologie? Ist die Versuchsperson Subjekt oder Objekt? Welchen Geltungsanspruch haben Konstrukte? Woher wissen wir von dem Fremdpsychischen? Was misst die Psychologie? Diese Fragen sind nicht unangenehm, sondern befremdlich, weil sie zu den Präsuppositionen der psychologischen Forschung, also zu den unhinterfragten Voraussetzungen, gehören, die im Allgemeinen ausgeklammert bleiben müssen, damit sich die experimentelle Forschung als operationsfähig erhält – es bliebe ansonsten nämlich nur der Rückzug in den Lehnstuhl der Reflexion. Diese Präsuppositionen verschwinden zumeist im weltanschaulichen Hintergrund, der sich jenseits der Wissenschaftspropädeutik nicht wie der ruhige Wellengang logisch-methodologischer Klarheiten, sondern als Untiefe des Geistes bis hinein in den Gezeitenstrom der Philosophie erstreckt.
Im Allgemeinen bleiben die Fragen nach dem Anspruch auf Disziplinarität, der die Experimentalpsychologie legitimiert, ausgeklammert, doch nicht im Speziellen – nämlich nicht in der theoretischen Psychologie. Dieser spezielle Bereich wird bisweilen als ein Fremdkörper, ein freies Radikal oder ein Atavismus aufgefasst. Es ist nicht einmal gewiss, ob dieser Forschungsbereich, der beispielsweise die Sollbruchstellen des Kognitivismus oder eine Blaupause für Paradigmenwechsel sucht, der Psychologie im eigentlichen Sinne zugehörig ist. Weil Wissenschaftstheorie und -geschichte in ihm so wichtig sind, wirkt er gar wie ein falscher Freund, der besser in der Philosophie aufgehoben wäre. In unserem Bild gesprochen: Die theoretische Psychologie scheint manchem Matrosen ein Seeungeheuer zu sein, das das gesamte Schiff der Psychologie eher zu verschlingen droht, als es zu beschützen. Allein, wer die Geschichte des Kapitäns Ahab kennt, weiß, dass der Grund für diese Furcht vor dem Fremden in der Verletzbarkeit der eigenen Konstitution liegen kann.
Nichtsdestoweniger ist dieser spezielle Forschungsbereich, also die theoretische Psychologie, die sich dem szientistischen Selbstverständnis der Disziplin widersetzt, ihr notwendiger Bestandteil. Sie auszutreiben zu versuchen, ist kein erforderlicher Exorzismus, sondern die Preisgabe der Faszination, die von der Psychologie selbst ausgeht, denn ihrem Wesen nach reiht sie, die Psychologie, sich nicht ohne Zwang in die Reihe von Physik, Chemie und Biologie ein. Dieser Zwang, der beispielsweise darin bestünde, »subjektive Erfahrungsdaten durch die allein relevanten ›objektiven‹ zu ersetzen« (Herzog, 1992, S. 466) ist mit dem »Prokrustesbett der Theorie« ein Bild gegeben worden. Die Experimentalpsychologie, die sich der theoretischen Psychologie entledigte, wäre wie der Riese Prokrustes, der den Wanderern, die für sein Gästebett zu groß waren, die überstehenden Gliedmaßen abschnitt. In dieser reduktionistischen Form würde sie die Kontinuität zu Biologie und Physik gewinnen, doch die Lebendigkeit ihres Gegenstandes aufgeben. Sie würde sich sogleich ihrer Eigenheit als Psychologie berauben.
Solange die Psychologie dem Reduktionismus noch widersteht, gestattet sie der theoretischen Psychologie die Problematisierung von innen. Theoretische Psychologie stellt nämlich die Fragen, deren Beantwortung den Anspruch auf Disziplinarität zugleich riskieren – was bedrohlich wirken mag, weil die »herrschende Lehre« ihre Selbstverständlichkeit verliert – und legitimieren kann. Anders gesagt ist es die theoretische Psychologie, deren wissenschaftstheoretische und -geschichtliche Durchleuchtung der Forschung den Unterschied zwischen Ideologie und lebendiger Wissenschaftlichkeit ausmacht. Wo psychologische Arbeit (und das gilt für die Theoriebildung ebenso wie für die Laborforschung und die Anwendung) ihre Voraussetzungen für selbstverständlich hält, statt sie zu thematisieren, macht sie sich von einem konzeptuellen status quo abhängig, der bisweilen zwar unbedenklich sein mag, dessen Bedenklichkeit aber niemals kategorisch ausgeschlossen werden kann. Das bedeutet, dass diejenigen, die die theoretische Psychologie außer Acht lassen, sich der Arglosigkeit schuldig machen: eine Schuld, die dann zum Verhängnis würde, wenn die durchgeführte Forschung doch einmal bedenklich ist, für diese Bedenklichkeit aber keine Gedanken aufgewendet worden sind. Das idealtypische gesamtwissenschaftliche Beispiel ist die Kernforschung, aber auch in der Wehrpsychologie oder der Psychologie des Folterns sind vergleichbare Fälle gegeben (Mausfeld, 2009).
Arglos vermeintliche Wissenschaft zu betreiben, ist eine Schuld, die zu keiner direkten Strafe führt – und das muss durch die Freiheit der Forschung garantiert werden. Indes, die indirekte Strafe widerfährt dem Geist der Jugend, dessen Vertrauen gebrochen wird. Er gibt sich eifernd einer Lehre hin, die ihren Anspruch nicht legitimiert und anstelle von Wahrhaftigkeit Leichtgläubigkeit zum Prinzip ihrer Wissbegier macht. Deswegen besteht die Verantwortung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darin, mit größter Strenge das Ideal der Wissenschaftlichkeit zu schützen. Schützen heißt jedoch nicht, Formalismen wie den Falsifikationismus zu pflegen, als würde die Erkenntnis den ewig selben Syllogismen und Rechenregeln folgen. Die theoretische Psychologie erfüllt nicht allein die Funktion der gewissenhaften Kartografin, die die Methoden der Disziplin wie ihre Karten verwaltet. Vielmehr handelt es sich um eine Abenteuerin, die die terra incognita für möglich hält und selbst erkundet. Die Voraussetzung des Aufbruchs zu neuen Ufern ist es jedoch stets, die alte Ordnung infrage zu stellen und beständig zu prüfen. Kritik ist daher der Ausgang der theoretischen Psychologie.
Psychologie und Philosophie sollen an dieser Stelle in den Dialog treten und die richtig verstandene theoretische Psychologie ist dafür der angemessene Rahmen. Mit theoretischer Psychologie ist nach meinem Verständnis keine einheitswissenschaftliche Integration gemeint, die gleich der theoretischen Physik, die Gravitation und Kinetik vereint, nach der Welt- bzw. Seelenformel für die Psyche sucht. Gemeint ist schon eher eine »Systematik der Kontroversen« (Fahrenberg, 2015), die die ungeprüften und teilweise widersprüchlichen Voraussetzungen der Forschung zum Vorschein bringt, um dem wissenschaftlichen Gespräch Raum zu verschaffen, wo ansonsten einhellige empirische Befunde aneinandergereiht werden.
Joachim Funkes Perspektive des Psychologen, der die Philosophie zum Anlass der Reflexion nimmt, will ich dadurch komplementieren, als Philosoph die Struktur der psychologischen Wissenschaftlichkeit zu befragen. Dieser Perspektivwechsel soll wie der Blick aus dem Ausguck dem Versuch der Ausrichtung dienen, der von der Betrachtungsebene der theoretischen Psychologie abhängig ist – die ihrerseits wie ein Krähennest am Mast der Psychologie hängt. Ausrichtung bedeutet dabei nicht etwa eine einfache Kursänderung, als ginge es um Werbung für ein alternatives Paradigma. Unser Versuch der Ausrichtung unterscheidet sich von der Kurslosigkeit, indem er die Bedingung der Möglichkeit einer Route in Erinnerung ruft. Damit ist nicht behauptet, dass ein Schiff ohne Kurs nicht an neue Ufer driften könne, doch es bliebe dem Zufall überlassen – und das bedeutete auch, dass so manches neue für ein altes und alte für neue Ufer gehalten würden.
Das Schiff der Psychologie auszurichten zu versuchen, heißt allererst, auf den vakanten Platz des Steuermanns aufmerksam zu machen, also auf den Platz der gewissenhaften Psychologinnen und Psychologen, die ihre Forschung in Abhängigkeit ihrer epistemischen Verantwortung gestalten. Es handelt sich bei ihnen auch um das notwendige Korrektiv für die Kapitäne unserer Zeit, die sich weniger mit den Voraussetzungen der Navigation als der Fortführung des allgemeinen Betriebes – sei es an Bord oder im Versuchslabor – kümmern. Der Ausrichtungsversuch bedeutet, die Möglichkeit einer Kurskorrektur in Erinnerung zu rufen, auch wenn ein Streit über den richtigen Kurs unter der Besatzung droht. Gerade dann, wenn eine Flaute bevorsteht, kann die Möglichkeit der Meuterei auf einem Schiff ohne Kurs die einzige Rettung sein.
Im Folgenden möchte ich zwei philosophisch-psychologische Ansatzpunkte entwickeln, die die Bedingung der Möglichkeit für die Ausrichtung zu finden helfen sollen: erstens das Verhältnis zwischen Psychologie und Geschichte. Dabei soll zur Sprache kommen, welche Bedeutung die Historizität des Psychischen für die Experimentalforschung hat. Zweitens eine Revision der psychologischen Wissenschaftstheorie. Im Mittelpunkt steht für sie das denkwürdige Verhältnis der Psychologie zur Idee der Geltung, die aller empirischen Betrachtung vorausgeht. In diesem Zusammenhang möchte ich den kontroversen Namen der Psychologie als Seelenlehre problematisieren. Dass die Psychologie weder ganz »ohne« noch schlichtweg »mit« Seele betrieben werden kann, lässt einen methodologischen Zustand der Schwebe entstehen. Auch wenn für dieses Patt keine Lösung gefunden werden kann, ist die Psychologie doch die einzige Verantwortliche für die Frage nach der Seele und selbstbewusste Forschung nur im Anschluss an die lange Tradition der Auseinandersetzung mit dem Seelenrätsel möglich.
Zur Historizität des Psychischen
Das Ausgangsproblem der Beziehung zwischen Psychologie und Geschichte ist methodologischer Natur. Es betrifft die eigentliche Forschungsart der Psychologie und verlangt, um analysiert zu werden, die Besinnung auf ihren Erkenntnisanspruch: Untersucht die Psychologie ihr empirisches Material als unabhängiges Ereignis oder als Fall einer zu bestimmenden Regelmäßigkeit (ggf. sogar eines Gesetzes)? Es mag zwar der Anschein sein, dass die Psychologie, weil sie als empirische deklariert wird, daran interessiert sei, aufzuklären, unter welchen Bedingungen es möglich gewesen ist, dass ein Mensch auf die eine oder andere Weise gehandelt, gedacht oder sich verhalten hat. Tatsächlich ist es jedoch strittig, ob die Psychologie in diesem Sinne historisch forschend verfährt. Alternativ ließe sich nämlich sagen, dass psychologische Experimente empirische Situationen erzeugen, um die Anschauung eines zuvor postulierten Zusammenhangs zu ermöglichen. Somit wäre die empirische Handlung der einzelnen Versuchsperson nicht als Ereignis für sich von Bedeutung, sondern als Fall unter einer Regel. Diese Forschungsart lässt sich als systematische von der erstgenannten historischen abgrenzen.
Die Unterscheidung zwischen historischer und systematischer Methode der Forschung ist althergebracht und findet sich beispielsweise bei Leopold von Ranke aus einer Zeit, in der Wissenschaft noch weitgehend mit Philosophie koinzidierte. In einem kurzen Aufsatz über »Philosophie und Geschichte« von 1830 schrieb von Ranke: »Menschliche Dinge kennenzulernen, gibt es eben zwei Wege: den der Erkenntnis des einzelnen und den der Abstraktion; der eine ist der Weg der Philosophie, der andere der der Geschichte« (von Ranke, 1942, S. 134). Von Ranke begreift den Unterschied beider Forschungsarten in dezidierter Abgrenzung vom kritischen Idealismus Fichtes als eine Zuwendung zu den lebendigen Tatsachen im Einzelnen auf Seite der Geschichtswissenschaft, der die Auseinandersetzung mit Begriffen und dem abstrakten Allgemeinen entgegensteht. Angesichts dieser Unterscheidung muss die Vermutung naheliegen, dass sich die Psychologie der historischen Methode bediene, insofern sie als empirische und induktive Wissenschaft auf keine Weise weniger als auf die spekulative arbeitet.
Tatsächlich ist die methodologische Unterscheidung von historischer und systematischer Methode jedoch in den folgenden beiden Jahrhunderten weiterentwickelt worden. Ein Beispiel ist Max Webers Idee der Wissenschaft, die Eduard Spranger mit dem uns hier beschäftigenden Dualismus der »systematischen und historischen Methode« bestimmt. Am Beispiel der Rechtswissenschaft heißt es: »Als systematische Disziplin entwickelt sie also ein System von Unwirklichkeiten, von Geltungen, das seine ganz eigentümliche Logik hat; als historische Disziplin verfolgt sie eben diese früher oder heute irgendwo tatsächlich geltenden Sollensregeln« (Spranger, 1980, S. 143). Dieser Trennung, die noch mit von Rankes Auffassung parallel läuft, attestiert Spranger jedoch sogleich die konzeptuelle Unbestimmtheit (nun mit Blick auf die Soziologie): »In allen Versuchen prinzipieller soziologischer Begriffsbildung stecken immer konkret-historisch bedingte Elemente, in allen historischen Erörterungen oder Gegenwartsbeschreibungen stört der Mangel einer sicheren und angemessenen Begriffsbildung« (S. 146). Die Scheidung zwischen systematischer und historischer Methode lässt sich nicht weltanschaulich durchhalten. Es kann sich allenfalls um Akzente der wissenschaftlichen Praxis handeln.





























