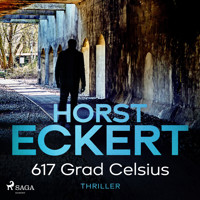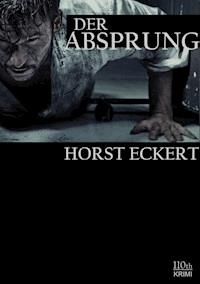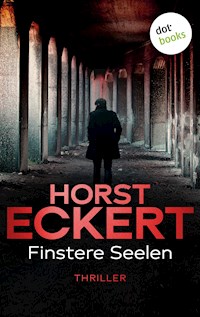9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Vincent Veih ermittelt
- Sprache: Deutsch
Es ist niemals vorbei. Eisenach, 2011: Zwei Männer liegen tot in ihrem Wohnmobil. Sie waren Teil eines rechtsextremistischen Terror-Trios, das Deutschland Jahre lang unerkannt in Angst und Schrecken versetzt hat. Aber was passierte wirklich? Ein Mann hat den «Nationalistischen Untergrund» für den Verfassungsschutz beobachtet. Er kennt die Wahrheit. Doch er muss schweigen. Jahre später ermittelt der Düsseldorfer Hauptkommissar Vincent Veih im Mordfall der Promiwirtin Melli Franck. Die Spur führt ins Drogenmilieu. Aber als weitere Morde geschehen, stößt Vincent auf eine Fährte, die in die Vergangenheit weist: zur «Aktion Wolfsspinne», die eng mit dem NSU verknüpft ist …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Horst Eckert
Wolfsspinne
Thriller
Über dieses Buch
Es ist niemals vorbei.
Eisenach, 2011: Zwei Männer liegen tot in ihrem Wohnmobil. Sie waren Teil eines rechtsextremistischen Terror-Trios, das Deutschland Jahre lang unerkannt in Angst und Schrecken versetzt hat.
Aber was passierte wirklich? Ein Mann hat den «Nationalistischen Untergrund» für den Verfassungsschutz beobachtet. Er kennt die Wahrheit. Doch er muss schweigen.
Jahre später ermittelt der Düsseldorfer Hauptkommissar Vincent Veih im Mordfall der Promiwirtin Melli Franck. Die Spur führt ins Drogenmilieu. Aber als weitere Morde geschehen, stößt Vincent auf eine Fährte, die in die Vergangenheit weist: zur «Aktion Wolfsspinne», die eng mit dem NSU verknüpft ist …
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, September 2017
Copyright © 2016 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg
Umschlagabbildung Benjamin Guimond/EyeEm/Getty Images
ISBN 978-3-644-22271-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Prolog
Sie kommen fast jede Nacht in mein Zimmer.
Junge Männer, sie ähneln sich wie Zwillinge. Ihr Haar ist so kurz, dass die Kopfhaut durch die Stoppeln schimmert. In meinem Traum tragen sie ein Licht. Es lässt mein Herz rasen und mich aus verschwitzten Laken aufschrecken.
Ich war fünf und spielte mit Schweinchen und Schornsteinfegern, die von Silvester übrig geblieben waren. In meinem Versteck zwischen den Orangenbäumen baute ich ihnen eine Wiese aus Moos und einen Wald aus abgeschnittenen Stielen, die mein Papa unter den Tisch fallen ließ.
Er band Sträuße, meiner Familie gehörte das Geschäft.
In Wirklichkeit trugen die Männer kein Licht, sondern Pistolen.
Manchmal reden sie in meinem Traum mit Papa. Er fleht sie an, nicht zu schießen. Er schenkt ihnen Blumen. Kein Traum bleibt über fünfzehn Jahre derselbe. Aber am Ende liegt mein Vater jedes Mal in seinem Blut am Boden.
Ich weiß nicht, wie oft es geknallt hat. Ich weiß nicht, warum sie mich übersehen haben. Vielleicht war ihnen das kleine Mädchen keine Kugel wert.
«Nadire, geh zu Mama», flüsterte Papa. Dann fielen ihm die Augen zu, und er regte sich nicht mehr.
Drei Tage später war er tot.
Während Mama verhört wurde, durchsuchten Polizisten unsere Wohnung. Sie behaupteten, dass Papa Spielschulden gehabt hätte, eine Geliebte, heimlichen Umgang mit Zuhältern und Menschenhändlern. Weil keiner den Verdacht bestätigen konnte, sprachen sie von einer Mauer des Schweigens, wie sie typisch für die Türkenmafia sei. Dann verloren sie das Interesse an Papas Tod.
Mama musste das Geschäft verkaufen, denn die Kunden blieben weg. Sie ging putzen und wurde krank.
Die Männer schossen mit der gleichen Pistole in Nürnberg, München, Hamburg, Rostock, Dortmund und Kassel. Die Polizei besuchte uns noch einmal. Sie sprach von «Dönermorden», nannte ihre Sonderkommission «Bosporus». Später hörte ich, dass Zeugenaussagen nur ernst genommen wurden, wenn von verdächtig wirkenden Südländern die Rede war.
Nach elf Jahren, an einem Novembertag 2011, wurde die Pistole gefunden. Und die beiden Männer, die seitdem für das Böse stehen. Aber noch immer fehlt mir die Antwort auf die Frage: Warum mein Vater, der Blumenhändler?
In letzter Zeit träume ich wieder öfter von den Zwillingen. Und jeden Tag schneide ich neue Artikel aus der Zeitung, in denen es um den Hass geht.
Überfälle, Anschläge, Morde.
Sie hören niemals auf.
Teil EinsDer Überfall
Die Hölle ist leer. Und alle Teufel sind hier.
William Shakespeare, Der Sturm
2011 – Eisenach
1
Auf einmal drangen Schreie aus dem Kundenraum ins Büro. Stefan sprang auf, um nachzusehen. Julia folgte dem Filialleiter nach vorn – nicht zu reagieren, hätte sie falsch gefunden, aber rasch bereute sie ihren Mut.
Die Bankräuber trugen Jogginghosen, Kapuzenjacken und Masken. Wie das Geistergesicht aus einem der Scream-Filme sah der eine aus, er fuchtelte nervös mit einem Revolver und brüllte Antje an, die an diesem Vormittag hinter dem Schalter saß: «Geld her, mach sofort den Tresor auf!»
Der Ruhigere trug eine Gorillamaske. Er zog einen älteren Herrn vom Geldautomaten weg und befahl ihm, sich hinzulegen. Eine zweite Kundin kauerte bereits vor dem Aufsteller mit den Prospekten. Der Gorilla bemerkte Stefan und Julia. Er rief dem Nervösen zu: «Schnapp sie dir!»
Julia rannte zurück ins Büro und schloss sich im Glaskasten ein. Ihr fiel ein, dass erst vor zwei Monaten eine Sparkasse in Arnstadt überfallen worden war. Die Täter waren noch nicht gefasst worden.
Ein Hämmern gegen die schussfeste Scheibe ließ sie zusammenzucken. Sie sah Geistergesicht, der die silbrige Waffe gegen Stefans Schläfe drückte. Durch die Löcher in der Maske starrten sie zwei hellblaue Augen an.
Auf Stefans Stirn standen Schweißperlen.
Antje flehte: «Julia, mach jetzt auf, wir geben denen alles!»
Sie gehorchte.
Der Gangster stieß Stefan und Antje zu ihr in den kleinen Raum, der als Notkasse diente. Ein paar tausend Euro in losen Scheinen lagen in der Schublade. Julia griff hinein, doch das Geld entglitt ihren zittrigen Fingern. Sie ging auf die Knie und krabbelte auf allen vieren über den Boden, um die Banknoten einzusammeln und in eine rote Sparkassentüte zu stopfen. Ihr fiel auf, dass der Scream-Typ die Enden seiner grauen Jogginghose in die Wollstrümpfe gesteckt hatte. Es sah unmöglich aus.
Schließlich packte der Typ Julia am Arm und zog sie hoch. Sein Griff schmerzte. Sie blickte in die Mündung des Revolvers.
«Wo ist der Tresor? Ihr müsst doch einen Tresor haben!»
«Den kriegen wir nicht auf», erwiderte Stefan. Julia staunte über seine Ruhe.
«Lügner!»
«AKT, automatischer Kassentresor.»
«Was heißt das?»
«Er hat eine Zeitschaltuhr. Jetzt geht da nichts.»
Geistergesicht schlug ihm die Waffe gegen den Kopf. Stefan taumelte und hielt sich an einem Stuhl fest. Blut tropfte zu Boden. Julia wünschte sich ganz weit weg.
Antje sagte: «Los, geben wir’s ihnen.»
Im Keller sprang das Licht von selbst an. Julia öffnete den Tresorraum. Die Geldbündel lagen im Regal. Sie hoffte, dass Stefan unterdessen den Alarmknopf drücken würde. Die Polizeiinspektion befand sich an der Ernst-Thälmann-Straße, gerade mal drei Autominuten entfernt.
«Macht bloß keinen Scheiß mit Farbbomben oder so!»
«Haben wir gar nicht.»
Die neuen Hunderter trugen registrierte Nummern. Julia packte sie in die Tüte zu dem Geld aus der Notkasse. Insgesamt rund siebzigtausend Euro, schätzte sie.
«Münzen?», fragte Antje.
«Könnt ihr behalten.» Der Mann riss den Beutel an sich und stürmte die Treppe hoch.
Julia drückte zur Sicherheit den zweiten Alarmknopf, der neben der Stahltür angebracht war. Spätestens jetzt wusste die Polizei Bescheid.
Antje schloss sich im Tresorraum ein. Julia schlich zurück nach oben. Sie zog es vor, den Überblick zu behalten.
Stefan saß auf seinem Stuhl und drückte sich ein Taschentuch aufs Haar. Die Räuber brachen auf. Am Geldautomaten hielt der Gorilla inne, griff ins Ausgabefach, entnahm die Scheine des Rentners, der noch immer auf dem Boden lag, und warf sie ihm zu.
Die jungen Männer stiegen auf Mountainbikes. Beim Wegfahren rissen sie sich die Masken vom Kopf. Julia sah kurzgeschnittenes Haar. An der nächsten Kreuzung bogen die Räuber ab und waren verschwunden.
Polizeisirenen wurden lauter. Drei Streifenwagen hielten auf dem Nordplatz. Die Flüchtigen haben keine Chance, dachte Julia.
Dann fiel ihr wieder ein, dass die Fahndung nach den Tätern von Arnstadt bislang erfolglos geblieben war. Man spekulierte über ein weiteres Fluchtfahrzeug, das groß genug war, um die Räder darin zu verstauen.
Julia spürte, wie ihr Herz raste. Sie ließ sich zu Boden sinken und vergrub das Gesicht in den Händen.
2015 – Düsseldorf
2
Fast wäre Melli Franck gegen den dunklen Wagen geprallt, der vor dem Restaurant halb auf dem Bürgersteig stand. Durch die Regenschlieren am Fenster war die Silhouette des Fahrers kaum zu erkennen. Idiot, dachte sie, hier ist kein Parkplatz. Doch weil das Greens Ruhetag hatte, verscheuchte sie ihn nicht.
Sie erreichte das Vordach und schüttelte den Schirm aus. Sie war in Eile, denn sie war in einer Stunde mit ihrer Freundin Marie zur großen Demonstration für Toleranz und gegen Rassismus verabredet, der Gegendemo zu einem geplanten Naziaufmarsch mitten in der Stadt.
Der Gedanke an Marie machte sie kribbelig. Teenagergefühle mit Mitte vierzig – ausgerechnet gegenüber einer Frau. Was ist nur los mit mir?
Melli kramte in ihrer Tasche nach dem Schlüsselbund. Das Greens – mein Reich, dachte sie beim Öffnen der Tür und tastete nach dem Lichtschalter.
Unordnung im Gastraum. Das Pult für den DJ, die Stehtische, alles stand noch kreuz und quer herum. Offenbar war es gestern zu spät geworden, um aufzuräumen. Zwei Mäntel hingen an der Garderobe – von ihren Besitzern vergessen.
Melli füllte einen Sektkühler mit Wasser und benutzte ihn als Vase für die Tulpensträuße, die sie vom Wochenmarkt mitgebracht hatte. Morgen früh würde sie die Tische damit schmücken.
Ihr Handy klingelte. Der Name auf dem Display ließ sie stutzen. Hannig.
Was wollte der Mistkerl? Melli drückte ihn weg. Fast kippte sie den Kühler um. Ich darf nicht zulassen, dass der Typ mich so aufregt. Er wird nie wieder einen Fuß in mein Restaurant setzen.
Morgen würde sie die ersten Bewerbungsgespräche führen, um ihren bisherigen Küchenchef zu ersetzen. Am meisten versprach sie sich von einem jungen Spanier, der in renommierten Häusern gelernt hatte und darauf brannte, sich zu beweisen. Die Speisekarte würde sich ändern, das war unumgänglich. Wird mein Stammpublikum das akzeptieren? Ich muss behutsam vorgehen, überlegte Melli.
Sie griff nach einem Glas, schenkte sich einen Schluck vom feinen Grauburgunder ein und setzte sich damit an einen Tisch am Fenster. Zuerst sortierte sie die Post nach Dringlichkeit. Dann öffnete sie den cremefarbenen Umschlag, der von ihrem Lieblingswinzer aus Baden stammte. Eine Zahlungserinnerung – habe ich tatsächlich verpennt, die letzte Rechnung zu begleichen?
Melli las die Summe, die der Weinlieferant anmahnte, und glaubte für einen Moment in einen Abgrund zu blicken. Das auch noch, dachte sie.
Der Mann im dunklen Mondeo fühlte sich wie unter einer Tarnkappe. Ein trister Herbsttag, schon dunkel, der Regenschauer wurde kräftiger, aber er saß im Trockenen. Die wenigen Passanten eilten unter Kapuzen oder Schirmen an seinem Auto vorbei und nahmen ihn nicht wahr.
Er fragte sich, wo sein Kumpel blieb. Noch zehn Minuten, beschloss er. Dann erledige ich den Job allein.
Durch die Seitenscheibe behielt er das Greens im Blick. Im Fenster konnte er die Wirtin ausmachen. Erst neulich hatte er gelesen, dass es zwischen ihr und ihrem Freund kriselte, diesem Fernsehfritzen von Tacheles-TV. Ab und zu sah man Aufnahmen des prominenten Paars in der Zeitung.
Melli Franck – immer noch attraktiv.
Er streifte seine Handschuhe über.
Sie überflog ein zweites Mal die Mahnung des Winzers. Daraufhin lief sie in das Kabuff, das sie, wenn sie zu Scherzen aufgelegt war, ihr «Büro» nannte. Dort setzte sie ihre Lesebrille auf und knöpfte sich die Buchhaltung vor.
Nach Berücksichtigung aller Belege, die noch nicht verrechnet waren, kam sie auf einen Fehlbetrag von knapp zweitausend Euro – den Gegenwert von vierzig Flaschen zum Ausschankpreis. Im Zeitalter von Kassenbons und Kreditkartenzahlung war eine solche Abweichung kaum möglich. Melli konnte sich das nicht erklären. Steckte ebenfalls Hannig dahinter?
Sie dachte nach. Vierzig Flaschen in drei Monaten. Etliche Gläschen hast du selbst abgezweigt. Dir und dem Personal am Ende eines langen Tags einen Drink spendiert, um den Adrenalinpegel herunterzufahren. Dich ruhiggestellt, wenn du mal eine Pille vom Muntermacher zu viel genommen hast.
Das hat ab jetzt ein Ende, beschloss Melli. Künftig würde sie sich selbst und den Angestellten mehr Disziplin abfordern. Die Einkäufe eigenhändig erledigen und am Abend die Letzte sein, die das Restaurant verlässt. Den Ruhetag streichen, falls es sich rechnet.
Keiner ahnte, dass der Laden seit Monaten nichts mehr abwarf. Die Gäste bestellten wie eh und je ihre Wagyu-Steaks und Hummerschwänze, aber die erhöhte Miete fraß alles auf.
Wieder klingelte ihr Handy. Diesmal war es Karsten.
Ihr Freund – war er das noch?
«Ich hab die ganze letzte Nacht versucht, dich zu erreichen», sagte Karsten. «Wo warst du?»
Melli fragte sich, was sie antworten solle. Dass ich das Handy ausgeschaltet und die Nacht bei Marie verbracht habe?
Wie oft habe ich dich wegen des Greens um Hilfe gebeten? Stets hast du dich verweigert, alter Geizhals. Aber ich soll dir zur Verfügung stehen, sobald dir der Sinn danach steht.
«Sehen wir uns heute?», fragte er.
«Ich hab dir doch erzählt, dass ich mit Marie auf die Demo gehe.»
«Mit Marie?»
«Für Toleranz und gegen Rassismus.»
«Dein plötzliches Interesse für Politik. Da steckt doch etwas anderes dahinter. Warum gibst du nicht zu, dass du dich mit einem Kerl triffst?»
«Karsten, bitte. Du machst dich lächerlich. Du solltest dich mal hören.»
«Dann sag mir, dass ich mich irre!»
«Lass uns ein andermal reden. Du bist ja völlig übergeschnappt.»
«Melli, ich will jetzt wissen …»
Sie drückte ihn weg.
An Karstens Stelle war schließlich ihr Exmann eingesprungen, um das Greens vorläufig vor dem Bankrott zu retten. Erst vor wenigen Tagen hatten sie sich geeinigt, buchstäblich in letzter Minute. Aber die Finanzspritze würde nicht lange reichen. Sie hatte Thorsten unmissverständlich klargemacht, dass sie einen Nachschlag erwartete. Für eine fällige Renovierung und für das Gehalt, das ein guter Küchenchef verlangte. Und für ein paar Fehler der Vergangenheit, die sie auszubügeln hatte.
Melli kämpfte gegen den Drang, eine Tablette einzuwerfen. Zu einem Neuanfang gehörte auch, auf das Teufelszeug zu verzichten.
Der Mann im Mondeo kontrollierte die Uhrzeit. Er versuchte, seinen Kumpel auf dem Handy zu erreichen, doch der ging nicht ran. Hatte er den Job vergessen, oder wollte er sich drücken? Kein Verlass auf den Kerl.
Er beobachtete, wie die Wirtin an ihren Fensterplatz zurückkehrte. Einmal hatte er selbst in dem Lokal gespeist. Melli Franck hatte ihm und seinen Kollegen persönlich die Karten gebracht und ihnen nach dem Mahl einen Grappa auf Kosten des Hauses angeboten. Und zwar nicht das Billigzeug aus dem Supermarkt.
Würde sich die Frau an ihn erinnern? Wohl kaum, vermutete er. Eine wie die merkt sich nur die prominenten Gäste. Und davon hat sie jede Menge, wie es heißt.
Er rief sich ihre Erscheinung ins Gedächtnis, ihre Aufmachung an jenem Abend. Reizvoll dekolletiert, in engsitzenden Hosen, die ihre Beine zur Geltung brachten. Ihren Arsch. Die Lücke zwischen den Schenkeln.
Müsste mal flachgelegt werden.
Er leckte sich die Lippen und nahm den Hammer aus dem Handschuhfach.
Das Handy gab einen Signalton von sich, eine SMS war eingetroffen.
Marie hatte geschrieben.
Bin schon da, freu mich auf dich.
Melli dachte an die Wärme, die sie bei ihrer Freundin empfand – es war mehr als eine gemeinsame Wellenlänge, es ging näher und tiefer. Sie kannte Marie durch ihren Ex, dessen rechte Hand für die Finanzgeschäfte Marie war. Gelernte Bankerin, studierte Betriebswirtschaftlerin, aber aus einfachen Verhältnissen. Ihr Gehalt schien sie als unsittlich hoch zu empfinden, weshalb sie sich zum Ausgleich in sozialen Projekten engagierte.
Melli musste an Karsten denken, der jegliches Engagement für Flüchtlinge verspottete – und neulich sogar einen Pegida-Häuptling in seiner Talkshow hofiert hatte. Der Kerl hatte eine Deutschlandfahne auf seinem Sessel ausgebreitet, vom «Volk» geschwafelt, das betrogen werde, und seine Kritiker als «undeutsch» bezeichnet. Ein Tiefpunkt in Karstens Karriere, zweifellos.
Sie tippte die Antwort an Marie: Wo treffen wir uns?
U-Bahnhof Bismarckstraße, Südausgang.
Gib mir noch eine halbe Stunde.
Lass dir Zeit, Süße.
Ein Blick auf ihre Uhr, dann schlitzte sie den letzten Briefumschlag auf. Er enthielt eine Einladungskarte des Karnevalvereins, dem sie angehörte. Melli erstarrte, als sie las, dass das Vorstandsessen am Ende der Session im Pfefferkorn stattfinden würde.
Niemand hatte sie vorab informiert. Eine Entscheidung hinter ihrem Rücken, eiskalt und beschämend. Die letzten Jahre war stets das Greens das Restaurant der Wahl gewesen. Und jetzt ausgerechnet das Pfefferkorn, wo sie manchmal am Vormittag ihren Kaffee trank und mit dem Wirt übers Wetter plauderte. Ein schmieriger Mistkerl!
Die Konkurrenz war hart in diesen Zeiten. Man intrigierte und streute Gerüchte. Nächstes Jahr speist der Vorstand wieder bei mir, sagte sich Melli. Sie würde hartnäckig bleiben, denn so war es ihre Art.
In ihrer Jugend hatte sie eine Laufbahn als Konzertpianistin angestrebt. Sie übte unermüdlich, gewann Nachwuchspreise und studierte am Konservatorium. Ein paar Jahre nach ihrer Hochzeit geschah dann der Unfall, der zwei Finger ihrer linken Hand verkrüppelte.
Zuerst hatte sie der Mut verlassen, doch ihr Mann tat alles, um sie aufzufangen. Damals hatten sie sich noch geliebt. Thorsten bezahlte Spezialisten, Operationen, Physiotherapie. Die Finger blieben steif, ihre Depressionen wurden manifest. Thorsten bezahlte den Seelenklempner. Dann machte er sie zur Managerin seiner Gastronomiebetriebe – die neue Aufgabe rettete ihr das Leben.
Melli entdeckte ihren Kampfgeist wieder und ihr Talent als Gastgeberin.
Nach der Scheidung überließ Thorsten ihr das Restaurant. Laut Ehevertrag wäre er nicht dazu verpflichtet gewesen. Und er wird mir weiterhin helfen. Ich weiß das.
Das Greens war eine Institution. Hier tafelten nicht nur Geschäftsleute auf Dienstreise, die um die Ecke in den Hotels an der Kö übernachteten. Hier trafen sich Leute, die angesagt waren oder es werden wollten. Leute, die sich gerne zeigten und die Klatschspalten der Yellow Press füllten.
Doch auf Dauer war es teuer, die High Society zu halten. Nach der letzten Mieterhöhung hatte ihr Steuerberater sie eindringlich gewarnt: Weiteres Durchwursteln könne als Insolvenzbetrug ausgelegt werden. Schließlich schlugen auch die Banken Alarm.
Zuerst hatte Thorsten nicht anders reagiert als Karsten. Sie musste alle Register ziehen. Schließlich ließ sich ihr Ex auf einen Deal ein, der fair war, wie sie fand: Sie überschrieb ihm das Lokal zur Hälfte, dafür gab er ihr Luft zum Atmen.
Melli hob das Glas auf ihren Exmann. Ein kalter, zynischer Arsch – warum vergucke ich mich immer in die gleichen Typen? Aber damit ist jetzt Schluss.
Sie dachte an Marie und beschloss aufzubrechen.
Es klopfte an der Eingangstür. Vor Schreck ließ sie fast das Weinglas fallen.
War das Hannig?
Marie Corinth trat zur Seite, um den Menschen Platz zu machen, die aus der U-Bahn ins Freie strömten. Der Regen prasselte auf ihren Schirm. Weiter vorn quäkte eine Stimme über die Lautsprecher. Die Kundgebung würde in zehn Minuten beginnen.
Es ist wichtig, Flagge zu zeigen, dachte Marie. Die Welle der Fremdenfeindlichkeit zu stoppen. Sie freute sich, dass Melli über ihren Newsletter die Stammkunden des Greens zum Mitmachen aufgerufen hatte. Damit wurden Kreise erreicht, die sich sonst vielleicht nicht angesprochen fühlten.
Melli hatte es als prominente Unterstützerin der Demo sogar mit Foto in die Zeitung geschafft. Falls das auch als Werbung für das Restaurant dienen konnte – umso besser.
Es wäre nicht schlimm, wenn Melli die erste Rede verpasste. Tausende waren gekommen, schon jetzt ein Erfolg.
Marie fragte sich, wie lang es her war, dass sie zuletzt an einer solchen Veranstaltung teilgenommen hatte.
Sie dachte an ihre Zeit als militante Tierschützerin. Sie war neunzehn gewesen. Mit ihrem damaligen Freund hatte sie einen Anschlag auf ein Versuchslabor ausgeheckt, um die Hunde zu befreien, die dort zu Tode gequält wurden. Süße Beagles in engen Käfigen, die an Schläuchen hingen und mit Chemie vollgepumpt wurden. Aufgebohrte Schädel, Sonden im Gehirn. Sie hatte Fotos gesehen. Schrecklich.
Sechzehn Jahre ist das her – wie naiv ich damals war!
Sie blickte auf die Uhr, dann verstaute sie die Hand wieder in der wärmenden Tasche ihres neuen Mantels. Prada, eigentlich Wahnsinn. Sie hatte das schöne Teil, das sie wochenlang im Schaufenster bewundert hatte, im Winterschlussverkauf ergattert. Für die Hälfte des ursprünglichen Preises – trotzdem noch so viel, dass man dafür eine ganze Flüchtlingsfamilie hätte neu einkleiden können.
Melli lachte nur über ihre Skrupel. Sie war so anders. Sie hatte Stil. Melli betrat einen Raum und stand sofort im Mittelpunkt.
Zum ersten Mal seit langem gab es einen Menschen, den Marie lieben konnte. Sie hatte vieles ausprobiert, Männer wie Frauen, doch mit Melli war es anders. Sie hatten die halbe Nacht geredet und waren Arm in Arm eingeschlafen.
Marie hielt Ausschau nach ihrer Freundin.
Das Klopfen hörte nicht auf.
Melli tippte die Nummer von Viktor in ihr Handy. Viktor Krömer, Mädchen für alles und ihr einziger Vertrauter unter den Angestellten.
«Was gibt’s, Melli?»
«Ich bin im Restaurant. Da pocht einer an die Tür. Wenn das Hannig ist …»
«Soll ich die Polizei rufen?»
«Ja, aber warte, Viktor. Ich schau zuerst nach. Bitte bleib dran!»
«Sei bloß vorsichtig, Melli …»
Sie drehte den Schlüssel, zog die Tür auf und trat einen Schritt zurück.
Ein Unbekannter stand unter dem Vordach, nasses Haar, ein Regentropfen hing an der Nasenspitze.
«Was wollen Sie?», fuhr sie den Mann an, heftiger als beabsichtigt.
«Entschuldigung, ich hab heute Nacht meinen Mantel …»
«Schon gut.» Sie wandte sich um, nahm das gesteppte, schwarze Ding vom Haken und drückte es dem Typen in den Arm.
Er deutete zur Garderobe. «Nein, sorry, der andere.»
Melli reichte ihm das zweite Teil, es war aus hellem Popeline mit bunt bedrucktem, seidigem Futter. Dabei nahm sie das Handy wieder ans Ohr.
«Entwarnung, Viktor.»
3
Es schüttete so stark, dass für einen Moment der grüne Neonschriftzug auf dem Vordach das Einzige war, was sich aus der Dunkelheit abhob.
Dann hörte der Regen mit einem Mal auf.
Es ärgerte ihn, dass sein Kumpel noch immer nicht aufgekreuzt war. Er drehte den Autoschlüssel, um die Heizung laufen zu lassen. Mit dem Motor sprang auch das Radio an. Der lokale Sender warnte vor Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt. Gleich mehrere Demonstrationen, rechte Deppen, linke Chaoten und jede Menge besorgte Bürger. Sogar der Oberbürgermeister hatte zur Teilnahme aufgerufen – und dafür vom Verwaltungsgericht wegen Verletzung seiner Neutralitätspflicht eins auf den Deckel gekriegt.
Er spürte, wie die Pillen wirkten, die er eingeworfen hatte. Wieder stellte er sich Melli Franck vor. Ihre Beine, ihr Dekolleté – wie würde die Schlampe reagieren, wenn er sie in die Titten kniff? Er malte sich aus, wie sie schrie.
Und wie ihre Seele entschwinden würde.
Während er es ihr besorgte.
Autoscheinwerfer im Rückspiegel, ein Wagen hielt unmittelbar hinter ihm. Die Lichter gingen aus. Sekunden später piepste das Handy. Sein Kumpel hatte eine SMS geschrieben.
Ich bleib draußen und pass auf, okay?
Weichei, dachte er. So einfach kommst du nicht davon. Dieser Job wird richtig schmutzig.
«Sorry, Viktor», sagte Melli ins Handy, nachdem sie den Gast verabschiedet hatte. «Dass ich dich am freien Tag …»
«Kein Problem.»
«Wir müssen morgen übrigens etwas früher anfangen. Umräumen fürs Mittagessen. Zweiertische, weiß eingedeckt. Um halb zehn?»
«In Ordnung.»
«Viktor …»
«Ja?»
«Warst du ebenfalls Kunde bei Hannig?»
«Aber Melli!»
Sie biss sich auf die Lippen. Dummes Misstrauen. Zu oft hatte man sie hereingelegt.
«Ehrlich», beteuerte Viktor. «Ich hatte keine Ahnung, bis er mich ansprach und mir ein paar Steaks aus dem Gefrierschrank verticken wollte. Und dann hab ich dich sofort … das weißt du doch!»
«Vergiss, was ich gesagt habe. Es tut mir leid.»
«Traust du mir nicht mehr?»
«Doch, doch, es ist nur …»
«Was denn, Melli?»
Sie murmelte eine weitere Entschuldigung und beendete das Gespräch. Sie schenkte sich vom Grauburgunder nach, lief ins Büro und suchte in der untersten Schublade des Schreibtisches nach der bunt emaillierten Blechdose. Mit einem kräftigen Schluck spülte sie eine Pille durch die Kehle. Clean bleiben kann ich auch morgen.
Alles wird gut – Maries Worte.
Melli öffnete den Tresor, um auf dem Weg zur Demo schnell noch die Bareinnahmen des Wochenendes zur Bank zu bringen.
Wieder klopfte es.
Der andere Mantel, dachte Melli.
Immer mehr Menschen stauten sich auf der Bismarckstraße. Selbstgebastelte Schilder mit Sprüchen gegen Rassismus und für ein buntes Miteinander. Fahnen in Rot, Orange und den Farben des Regenbogens. Eine fast euphorische Atmosphäre.
Wir sind Gleichgesinnte. Wir stehen für das Gute.
Willkommenskultur statt Dunkeldeutschland, dachte Marie.
Sie schlang ihren Schal fester um den Hals und stellte den Kragen hoch. Ihre Freundin war jetzt über der Zeit. Ich muss mich daran gewöhnen, dass Melli es mit der Pünktlichkeit nicht immer so genau nimmt, sagte sich Marie.
Auf der Bühne sprach bereits die zweite Rednerin, Wortfetzen wehten herüber. Marie gab ihren Posten auf und drängte nach vorn, um etwas zu verstehen.
Die Frau auf der Bühne vor dem Gewerkschaftshaus vermeldete, dass sich im Moment knapp einhundert Nazis vor dem Hauptbahnhof zusammenrotteten. Sie warteten offenbar noch auf Verstärkung aus Dortmund.
Marie spähte eine Seitenstraße entlang. Das andere Ende war von Polizeifahrzeugen verstellt. Ein Dutzend Beamte rannte in Richtung Bahnhof vorbei. Die blauen Uniformen erinnerten Marie an die Nacht vor sechzehn Jahren.
Sie und ihr Freund Helmut hatten die Kameras übersehen. Beim Zerschneiden des Zauns war der Wachdienst des Tierversuchslabors auf sie aufmerksam geworden. Das Loch war noch nicht fertig, als die Hetzjagd begann.
Helmut schaffte es zu fliehen, sie jedoch strauchelte im unwegsamen Gelände. Die Wachleute nahmen sie fest und beschlagnahmten ihren Rucksack voller Werkzeug und Benzinflaschen. Die Männer lachten sie aus und schubsten sie herum.
Deren Vorgesetzter brachte sie in ein fensterloses Büro voller Monitore, verriegelte die Tür und stellte sie vor die Wahl. Ficken oder Polizei.
Sie protestierte und wehrte sich, doch er schlug sie, bis ihr Kopf dröhnte, warf sie über den Tisch und band sie fest in einem Tempo, als hätte er Übung darin. Nachdem der Mistkerl seinen Spaß gehabt hatte, drohte sie ihm mit der Polizei. Er lachte nur – jeder seiner Mitarbeiter würde zu seinen Gunsten aussagen.
Beim Gedanken an das Schwein ballte Marie die Fäuste. Sie hatte bis heute mit niemandem über die damalige Nacht gesprochen. Nicht einmal mit Melli.
Marie versuchte sich zu orientieren und wählte Mellis Handynummer, um mit ihr einen neuen Treffpunkt zu vereinbaren.
Es meldete sich nur die Mailbox.
Melli nahm den übriggebliebenen Mantel vom Haken, das schwarze Daunending, und öffnete die Tür. Noch ein Unbekannter – sie streckte ihm das Kleidungsstück hin. Nimm es und verpiss dich, ich habe keine Zeit.
Ein harter Stoß.
Melli krachte gegen das DJ-Pult.
Der Schreck und der Schmerz in den Rippen ließen sie nach Luft ringen. Ein zweiter Kerl betrat das Restaurant und drückte die Tür hinter sich ins Schloss. Melli hielt den dicken, gesteppten Mantel vor ihren Körper, als böte er Schutz.
Sie reckte ihr Kinn. «Verdammt, was wollt ihr?»
Die beiden Männer gingen auf sie zu. Der eine grinste und entblößte dabei schlechte Zähne. Melli wich hinter die Theke zurück.
Keinen Widerstand leisten, dachte sie. Bloß nicht das Leben wegen einer überschaubaren Geldsumme aufs Spiel setzen. Oder wegen ihres Pillenvorrats in der Blechdose – falls die Mistkerle es darauf abgesehen hatten.
«Der Tresor ist im Büro», sagte Melli. «Aber macht euch keine falschen Hoffnungen. Viel gibt es nicht zu holen.»
Die Männer nahmen sie in die Zange. Beim Blick in die Gesichter wurde Melli klar, dass es ihnen um etwas anderes ging.
Ein Schlag traf ihren Kopf und ließ sie in die Knie gehen.
Überall Blut. Mein Blut.
4
Über dem Eingang hing ein Banner:
Brigitte Veih, Grenzfall, NRW-Kunstforum 1.12.2015 bis 13.3.2016.
Vincent fragte sich, ob er sich das wirklich antun sollte. Seine Freundin Nina hatte ihm zugeredet. Deine Mutter würde sich freuen. Und du wirst dich danach ebenfalls besser fühlen.
Ihr Dickschädel seid euch ähnlicher als du denkst, hatte Nina gesagt.
Der Regenschauer trieb Vincent die Treppe hoch bis unter den Dachvorsprung. Er drückte einen Flügel der Glastür auf, atmete tief ein und durchquerte das Foyer. Vor dem Durchgang zum Ausstellungsraum stand eine junge Frau mit einem Tablett voller Getränke. Vincent schnappte sich ein Glas Wasser, damit er etwas hatte, um sich festzuhalten, und trat ein.
Die Vernissage am Vorabend der eigentlichen Ausstellungseröffnung: Weiter hinten lauschten etwa vierzig Leute einer Frau im schwarzen Kostüm. Vincent erkannte die Kuratorin des Kunstforums. Er schnappte die Worte «Heimat» und «Abgrenzung» auf.
Applaus, der offizielle Teil war anscheinend beendet. Die Leute umringten Stehtische, griffen zu Sekt und Salzgebäck. Vielstimmiges Gemurmel.
Der Liedermacher René Hagenberg, ein enger Freund seiner Mutter, winkte Vincent einen Gruß zu. Weitere Gäste kamen ihm bekannt vor. Brigitte stand inmitten einer Menschentraube. Sie war wie immer schlicht gekleidet, Jeans und dunkles Männerhemd, das kurze Haar wirkte ungekämmt. Vincent wollte keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen und verzichtete darauf, zu ihr vorzudringen.
Erinnerungen strömten auf ihn ein. Wie seine Mutter ihn zu ihren Freunden in Niederbayern weggab, als er sieben Jahre alt war. Wie kalt sie sich ihm gegenüber verhalten hatte – warum eigentlich?
Als er danach bei den Großeltern aufwuchs, war es tabu, über Brigitte zu sprechen. Nur die Fernsehnachrichten hielten ihn auf dem Laufenden: Fahndung, Festnahme, Hungerstreik und Zwangsernährung – Vincent hatte nie gewusst, ob er seine Mutter verachten oder ihr die Daumen drücken sollte.
Nachdem er den Beruf seines Großvaters ergriffen hatte, wurde es nicht besser. Unter den Kollegen sprach sich herum, dass er der Sohn einer in Köln-Ossendorf einsitzenden RAF-Terroristin war. Kaum ein Tag ohne Anspielungen und abfällige Bemerkungen – und natürlich gab er seiner Mutter die Schuld daran.
Als Brigitte nach zwanzig Jahren Haft entlassen wurde, musste Vincent feststellen, dass sie sich kaum verändert hatte. Keine Herzlichkeit, keine Reue. Dass ihr Sohn Polizist geworden war, empfand sie als Affront. Erst in der letzten Zeit hatte sich ihr Verhältnis ein wenig gebessert.
Prost, Mama, auf deine neuen Bilder! Vincent leerte sein Glas und stellte es ab. Auf dem Weg nach draußen blieb er noch einmal vor der Stirnwand stehen. Drei Fotos hingen dort, drei Gesichter, deren Blick ihn fixierten: ein trauriges Kind, ein Alter mit zerfurchtem Gesicht, eine hagere Dunkelhäutige mit Kopftuch.
Diese Augen.
Die Aufnahmen drückten Stolz und Würde aus. Vielleicht sogar eine Form von Weisheit. Vincent fragte sich, wie seine Mutter die Leute dazu brachte, so zu gucken. Sie hatte für diese Ausstellung Bewohner von Flüchtlingsunterkünften porträtiert. Stets vor einer weißen Fläche, wie es ihrem Stil entsprach.
Jemand tippte ihn an. Er fuhr herum.
Brigitte stand vor ihm. «Läufst du schon wieder weg?»
«Danke für die Einladung.»
«Gestern habe ich noch eine Ausstellung eröffnet. Im Hauptbahnhof von Leipzig.»
«Gratuliere.»
«Wo ist Ninotschka?»
«Ich treffe sie gleich auf der Demo.»
Brigitte verzog die Mundwinkel. «Glaubst du, die Faschisten lassen sich von eurer Kundgebung beeindrucken?»
Vincent verzichtete darauf, sich auf eine politische Diskussion mit seiner Mutter einzulassen. Er wandte sich zum Gehen, doch sie hielt ihn fest.
«Hast du noch die Briefe meines Vaters?»
«Wieso?»
«Ich will ein Buch über ihn schreiben.»
«Ach.»
«Ich weiß, du würdest lieber eine Decke über seine Vergangenheit breiten. Könnte ja ein schlechtes Licht auf das Land werfen. Auf dich und deinen Beruf.»
«Quatsch, ich frag mich nur, ob die Welt auf ein solches Buch wartet.»
«Das hast du über meine Autobiographie auch gesagt.»
Und mich geirrt, dachte Vincent. Frei und ohne Furcht – damit war seine Mutter zum Liebling der Talkshows avanciert. Als sei es schick, Terroristin gewesen zu sein. Dabei enthielt der Erinnerungsband kein Wort der Distanzierung oder Entschuldigung. Echte Aufarbeitung sieht anders aus.
Sie fragte: «Weißt du, dass Gerhard Veih noch in den Achtzigern rechte Propaganda in die DDR geschmuggelt hat?»
«Wer sagt das?»
«Verwandte in Thüringen. Der Scheißkerl war bis zum Schluss ein Hetzer und Nazi-Nostalgiker.»
«Was hast du im Osten gemacht?»
«Familie. Recherche. Ich will mich meiner ganzen Geschichte stellen.»
Vincent fiel ein, dass er als Kind ein paarmal mit seinen Großeltern in Jena gewesen war. Wie seltsam ihm die DDR vorgekommen war, grau in grau und von einem fremden Geruch bestimmt – nach dem Ruß der Trabis und der Kohle, mit der die Häuser geheizt wurden. Es gab Türen ohne Klingel, an denen man klopfen musste. Es gab Häuser, die das Klo im Keller hatten.
Die gleichaltrigen Jungs gafften ihn an wie ein Tier im Zoo. Später erfuhr er, dass sie den Wessi schon an seiner Kleidung erkannten. Und dass sie alles dafür getan hätten, solche Jeans zu besitzen, wie er sie trug.
Beim letzten Mal war es Winter, Ende 1988 – also war er da schon achtzehn gewesen. In Vincents Erinnerung war sogar der Schnee in der DDR grau gewesen.
«Die Leser sollen erfahren, wozu ein ganz normaler Mann fähig ist», sagte Brigitte. «Wenn er glaubt, im Namen Deutschlands zu handeln.»
«Fähig war», korrigierte Vincent. «Du sprichst vom Krieg.»
«Ein ganz normaler deutscher Polizist. Und ich spreche vom Holocaust.»
«Schreib, was du willst. Ich wünsch dir viel Erfolg.»
«Ich tu’s für mich. Meine Eltern sind der Grund, warum ich wurde, wie ich bin. Das Buch ist eine Reise zu meinen Wurzeln.»
Vincent wollte das nicht vertiefen. Er blickte auf seine Uhr.
«Ich muss los», stellte er fest.
«Wie findest du eigentlich meine Fotos?»
«Soll ich ehrlich sein?»
Brigitte verschränkte die Arme.
«Du wirst immer besser.»
5
Die Menschenmenge war unüberschaubar. Weil auf der Bismarckstraße kein Durchkommen mehr war, wichen die Leute auf die Parallelstraße aus. Das Knattern am Himmel übertönte die Rede aus den Lautsprechern. Zwei Polizeihubschrauber kreisten über den Demonstranten.
«Sie überwachen und zählen uns», sagte Nina. «Was wetten wir? Für eure Pressemeldung teilen sie das Ergebnis durch zwei.»
Man merkt, dass du bei Brigitte wohnst, dachte Vincent. Praktisch die gleiche Einstellung.
«Deine erste Demo, stimmt’s?», fragte Nina weiter.
«In meiner Zeit bei der Bereitschaftspolizei habe ich etliche erlebt», antwortete Vincent. «Wir wurden bis nach Berlin geschickt. Damals war dort an jedem ersten Mai die Hölle los.»
«Das gilt nicht.»
«Warum?»
«Da standest du auf der anderen Seite.»
Er lachte. «Heute mach ich’s hoffentlich wieder gut.»
Nina gab ihm einen Kuss auf die Wange. «Ich find’s schön, dass du mitgekommen bist.»
Vincent legte den Arm um ihre Taille. Gegen den Pegida-Unsinn waren sie sich einig. Wer sich im Namen des Abendlands gegen eine Islamisierung empörte, die in Deutschland nicht stattfand, lehnte in Wirklichkeit die muslimischen Mitbewohner ab. So etwas nennt man Rassismus, fand Vincent, und Rassismus machte ihn fassungslos.
«Warum ist Brigitte nicht hier?», fragte Nina.
«Sie hat doch ihre Vernissage. Außerdem sind wir für ihren Geschmack zu bürgerlich.»
Sie erreichten die Kreuzung. Vincent wollte abbiegen, um zur Kundgebung zu gelangen, die bereits in vollem Gang war, aber Nina zog ihn weiter.
«Wo willst du hin?», fragte er.
«Rate mal.»
«Nicht dein Ernst, oder?»
«Man muss den Faschos zeigen, dass sie nicht willkommen sind. Aber wenn du kneifst, bin ich dir nicht böse.»
«Das Demonstrationsrecht gilt auch für diese Leute», warf Vincent ein. «Das nennt man Rechtsstaat.»
«Darüber lachen die Nazis doch nur.»
Nina setzte ihren Weg fort. Widerstrebend folgte Vincent in Richtung Hauptbahnhof. Wenn er sie nicht aufhalten konnte, dann wollte er sie wenigstens beschützen. Er wusste, dass ein paar Steinewerfer jede Versammlung im Nu in eine Straßenschlacht verwandeln konnten.
Er dachte an Berlin im Jahr 1989, an die Nacht zum ersten Mai. Er hatte gerade bei der Bereitschaftspolizei angefangen. Sie waren zur Verstärkung aus Nordrhein-Westfalen herangekarrt worden. Ein Hagel von Pflastersteinen empfing sie. Zweitausend Randalierer, mehr als dreihundert verletzte Beamte.
Vincent blickte sich um. Zahlreiche Demonstranten nahmen den gleichen Weg wie Nina und er. Bunte Pullover, Jacken und Tücher. Transparente und Lieder – die Leute wirkten friedlich. Zwei Frauen begrüßten Nina, Kolleginnen aus dem evangelischen Krankenhaus, wo sie als Kinderpsychologin arbeitete. Vincent kannte die beiden vom Sehen.
An der Graf-Adolf-Straße ging es nicht weiter. Bereitschaftspolizei stand in dichter Reihe mit Schild und Helm, die Visiere geschlossen, die Hand am umgeschnallten Schlagstock. Dahinter Absperrgitter.
Die Demonstranten riefen: Deutsche Polizisten schützen die Faschisten!
«So ein Blödsinn», entfuhr es Vincent.
«Du siehst das anders?», fragte Nina.
«Die Kollegen stehen nicht zum Spaß hier. Es geht um Recht und Gesetz, das weißt du.»
«Wenn du’s sagst.»
Weitere Menschen strömten herbei. Nina hakte sich bei Vincent ein. Andere Zeiten, wir sind nicht in Berlin, versuchte er sich zu beruhigen. Du befindest dich unter netten Leuten, nicht im schwarzen Block.
Neue, aggressive Sprechchöre schreckten Vincent aus seinen Gedanken. Aus Richtung des Hauptbahnhofs marschierten die Neonazis heran. Vincent reckte sich und lugte über die uniformierten Kollegen hinweg. Männer in Bomberjacken schwenkten schwarz-rot-goldene Fahnen, vereinzelt auch schwarz-weiß-rote: Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!
Es klang wie eine Drohung.
Die Menschen rund um Vincent gerieten in Unruhe. Ein junger Mann mit einer Aldi-Plastiktüte kam nach vorn – was hatte er vor? Ein Pressefotograf klappte eine Trittleiter auf, erklomm sie und knipste über die Polizisten hinweg den Rechten entgegen.
Die Kerle in Bomberjacken reckten die Fäuste. Lügenpresse auf die Fresse!
In den Häusern gingen Fenster auf. Anwohner wollten wissen, was los war, und traten auf ihre Balkone. Vincent registrierte Bärte und Kopftücher – sie befanden sich im Türkenviertel.
Die Nazis schossen Handyfotos von Gegendemonstranten. Wir kriegen euch alle!
Um Vincent herum wurde es laut. Nazis raus! Nazis raus!
Die Rechten waren jetzt auf gleicher Höhe. Der Junge griff in seine Tüte und schleuderte Konfetti auf die Bomberjacken. Andere versuchten, auf die Straße zu drängen. Schlagstockeinsatz, Keilerei. Die Menge wogte hin und her. Mit Schrecken erkannte Vincent, dass er Nina aus den Augen verloren hatte. Er stellte sich auf Zehenspitzen und suchte nach ihr.
In diesem Moment schlug ihm ein Nazi über die uniformierten Kollegen hinweg mit einer Fahnenstange auf den Kopf.
Vincent spürte, wie ihm Blut in die Stirn lief. Die Stange fuhr erneut herab, er bekam sie zu fassen, entriss sie dem Schläger und stieß sie wütend nach ihm.
Der Beamte, der zwischen ihnen stand, packte Vincents Arm und verdrehte ihn. Ein Schmerz fuhr durch seine Schulter, etwas im Oberarm drohte zu reißen.
«Hey, ich bin ein Kollege!»
«Und ich bin Heidi Klum.»
Vincent wehrte sich und schaffte es, den Kerl abzuschütteln. Sofort nahmen ihn zwei andere in den Schwitzkasten.
«Wir sind Kollegen!», beteuerte Vincent noch einmal.
Sein Kopf wurde nach unten gedrückt. Jemand schlang den Arm um seinen Hals, ihm blieb die Luft weg, ihm brach der Schweiß aus. Er spürte Schläge auf den Rücken und Stöße in die Rippen, fast geriet er ins Straucheln. Im Augenwinkel nahm er ein Blitzlicht wahr.
Die Uniformierten schleiften ihn zu den Fahrzeugen, seine Proteste ignorierend. Nina konnte er nirgendwo entdecken. Stattdessen nahm er wahr, dass viele Demonstranten den Tumult nutzten, um über die Gitter zu klettern und die Straße zu besetzen. Trillerpfeifen und ohrenbetäubendes Geschrei.
Der Gefangenentransporter war ein silberfarbener Mercedes Sprinter ohne Fenster in der hinteren Hälfte. Die Kollegen stießen Vincent in eine winzige Zelle. Lüftungsschlitze, spärliches Kunstlicht. Ein Uniformierter drückte ihn zu Boden, presste sein Gesicht auf das kalte, schmutzige Blech und zerrte ihm die Arme auf den Rücken, um ein Paar Handschellen um die Gelenke zu schließen.
Meine Mutter sollte mich jetzt sehen, dachte Vincent grimmig. Von wegen, ich sei nach meinem Großvater geraten.
Gedämpft waren Funksprüche zu vernehmen, aus der Ferne sich nähernde Sirenen. Die Sprechchöre und Hassparolen wurden leiser – sie entfernten sich oder wurden abgedrängt.
Schritte und Stimmen vor dem Transporter. Vincent legte ein Ohr an die Schlitze und belauschte eine Unterhaltung: Weitere Gegendemonstranten waren festgehalten worden. Vincent vernahm Schmähungen.
Linkes Pack, Drecksbande, Chaotengesocks.
Wieder musste er an Nina denken. Hoffentlich geht es ihr gut.
«Lasst die Leute laufen», befahl ein Mann. «Wir haben den Rädelsführer, das genügt.»
Die Tür wurde aufgerissen. «Ausweis dabei?»
Vincent wurde klar, wer als Rädelsführer gemeint war.
«Innentasche links», erwiderte er.
Eine Hand glitt in seinen alten Anorak. Der Mann fand den Personalausweis. Seine Dienstmarke sowie das Kärtchen mit Lichtbild und Landeswappen, die ihn als Polizeibeamten auswiesen, hatte Vincent zu Hause in der Lederjacke gelassen.
Draußen gab jemand seine Daten per Funk zur Überprüfung durch.
Dann tat sich eine ganze Weile nichts.
Ein Uniformierter kam herein, schloss Vincent die Handschellen auf und gab ihm den Ausweis zurück. Der Mann war Hauptkommissar, drei silberne Sterne an den blauen Schultern. Mitte vierzig wie er, Schatten um die Augen, zerfurchte Stirn.
«Warum hast du nicht gesagt, dass du ein Kollege bist?»
«Hab ich doch.»
«Mein Gott …»
«Dazu fehlen noch ein paar Beförderungsstufen.»
«Find ich jetzt nicht lustig.»
«Ihr habt mich gewürgt und geschlagen. Fand ich auch nicht lustig.»
«Spiel dich mal nicht so auf! Was hast du hier zu suchen, verdammt noch mal?»
«Rate mal.»
Fragender Blick. «Undercover-Einsatz im linken Milieu?»
«Nein, ich nehme mein Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit wahr.»
«Ja, super. Deine Verletzung hast du dir selbst zuzuschreiben, verstanden? Immerhin hast du die Keilerei mit den Rechten provoziert. Wir haben uns nur angemessen verhalten.»
«Ach, wirklich?»
«Versuch gar nicht erst, uns etwas anzukreiden. Würde nicht gut für dich ausgehen. Gegen dich gibt’s ’ne Menge Zeugen. Und jeder von ihnen ist ein tadelloser Beamter, verstehst du?»
«Ist klar.»
«Du hörst von uns.»
Damit war Vincent frei. Die Wunde am Kopf pochte. Sein Hals schmerzte.
Zwei Blocks weiter stieß er auf seine Freundin. Ihr war nichts passiert, zum Glück. Sie fielen sich um den Hals. Vincent fühlte große Erleichterung.
Nina half ihm, sich zu säubern. Seine Haare waren verklebt, vermutlich ein Riss in der Kopfhaut. Nicht der Rede wert, befand Vincent.
«Mein Held», sagte sie.
«Unsinn.»
«Weil sich die Bullen auf dich konzentriert haben, konnten unsere Leute die Nazis zurückdrängen.»
«Für die Idioten von der Bereitschaftspolizei bin ich der Rädelsführer.»
«Idioten? Ich dachte, es ginge um Recht und Gesetz!»
Rundherum brachen die Menschen auf, auch die Kundgebung auf der Bismarckstraße war offenbar beendet. Ein Großteil steuerte die Altstadt an.
«Ich könnte ein kühles Bier vertragen», sagte Vincent. «Was hältst du davon?»
Bevor Nina antworten konnte, spielte sein Handy London Calling.
Vincent meldete sich.
«Wir haben hier eine Tote», sagte Dominik Roth, der in dieser Woche Mordbereitschaft hatte. «Sieht echt übel aus. Kennst du das Greens?»
«Bin schon unterwegs.» Vincent warf seiner Freundin einen Blick des Bedauerns zu und verstaute das Handy. «Sorry.»
«Mörderjagd?», fragte Nina.
«Hab nun mal nichts anderes gelernt.»
«Pass auf dich auf, Vinnie.»
«Du kennst mich doch.»
«Eben.»
6
Vor dem hell erleuchteten Restaurant war der Teufel los. Stau, Gehupe, Blaulichtgeflacker – zahlreiche blau-silberne Streifenwagen blockierten die Fahrspur, darunter auch zwei zivil lackierte VW-Passat sowie ein Bulli der Kriminaltechnik.
Der Taxifahrer fluchte. «Nirgendwo ein Durchkommen! Scheißdemonstranten in der ganzen Stadt! Müssen die wegen ein paar Rechten so ein Theater machen?»
Vincent bezahlte und legte die letzten Meter zu Fuß zurück. Vor dem Eingang fing ihn ein Uniformierter ab.
«Vincent Veih, ich leite …»
«Sorry, Kollege, die Spurensicherung lässt im Moment keinen rein.»
Vincent lugte durch die Tür, entdeckte Dominik in weißer Schutzkleidung und winkte ihn zu sich. Der junge Kollege zog die Latexhandschuhe aus, streifte die Kapuze zurück und fuhr sich durchs Haar.
«Junior, wie sieht’s aus?», fragte Vincent. Die Kehle schmerzte noch vom Würgegriff der Kollegen. Sein Atem bildete weiße Wölkchen. Es war kälter geworden.
«Der Notruf ging um 18:42 Uhr in der Leitstelle ein. Keine Angaben zur Person des Anrufers, auf Nachfrage keinerlei Reaktion mehr. Ein Team der Wache Innenstadt war zuerst da.» Dominik wies nach drinnen. «Eine Tote, das Schädeldach zertrümmert. Neben ihr das Handy – offenbar hat sie selbst die Eins-Eins-Null gewählt. Dass sie das noch geschafft hat, mit diesen Kopfverletzungen!»
«Einbruchspuren?»
Junior schüttelte den Kopf. «Die Tür war nicht abgeschlossen, Schlüssel steckt von innen. Bei der Toten könnte es sich um die Wirtin handeln, eine gewisse Melli Franck.»
«Hast du Fotos gemacht?»
Dominik tippte auf seinem Handy und reichte es ihm. Vincent betrachtete das Display.
Er nickte. Sie war es.
Erst neulich hatte er mit Nina im Greens gespeist, um zu feiern, dass sie ihrer Beziehung eine zweite Chance gaben. Eigentlich lag der Nobelschuppen jenseits ihrer Preisklasse. Allein die Karte mit Mineralwasser aus aller Welt musste man gesehen haben. Aber an jenem Abend hatte Geld keine Rolle gespielt.
Vincent strich über das Display, weitere Aufnahmen. Eine Blutlache auf dem Boden. Spritzer an der Wand und auf der Theke. Die Tote vor dem Fenster, wo sie endgültig zusammengebrochen oder hingeschafft worden war. Vincent fiel auf, dass sie nicht vollständig bekleidet war. Die Hose hing an den Füßen, die Bluse war aufgerissen. Neben ihr lag ein schwarzer Mantel.
Weitere Fotos von einem anderen Ort: ein Weihnachtsbaum, Familie, ein Selfie mit einer jungen Frau. Vincent hielt Dominik das Handy hin.
«Neue Freundin?»
Der Kollege nahm es ihm ab. «Oh, ich glaub, das Bild muss ich löschen!»
«Junior, Junior.»
«Ein Raubmord scheint jedenfalls nicht vorzuliegen», fuhr Dominik fort. «Es gibt eine Art Büro mit Wandtresor. Steht offen, knapp eintausend Euro in bar.»
«Vielleicht fehlt etwas anderes. Bitte keine voreiligen Schlüsse.»
Dominik zog den Reißverschluss des Overalls auf, unter dem er Straßenkleidung trug, und wühlte einen Zettel aus der Hosentasche. «Die letzten Kontakte ihres Mobiltelefons. Fünfzehn Anrufe am heutigen Tag. Zuletzt eine SMS und ein längeres Telefonat kurz vor achtzehn Uhr.»
«Das alles knöpfen wir uns noch heute vor. Richte dich auf einen langen Abend ein.»
«Chef?»
«Junior?»
«Wie wär’s, wenn ich dieses Mal die Mordkommission leite?»
«Anna macht das. Ist sie schon da?»
«Sie und der Neue befragen die Penner, die drüben am Telekom-Gebäude kampieren.»
Zeugen sind hier vermutlich rar, dachte Vincent. In unmittelbarer Umgebung gab es nichts als Bürogebäude. Um die Ecke befand sich die Königsallee mit ihren Banken und Ladengeschäften, Anwaltskanzleien, Werbeagenturen. Wohnungen gab es dort auch, aber ohne Sicht auf den Restauranteingang.
«Früher hatte unsere Dienststelle drei MK-Leiter», sagte Dominik.
«Noch früher gab’s ’nen Kaiser.»
«Verstehe. Der dritte Posten ist für unseren Neuen reserviert. Hab ich recht?»
«Hamid? Wie kommst du darauf?»
Dominik zuckte mit den Schultern. «Migrantenförderung im öffentlichen Dienst. Es heißt, Hamid sei der Liebling der Obermuftis. Wenn das so weitergeht, übernehmen die verdammten Muselmänner noch den ganzen Laden hier.»
«Du erzählst gequirlten Unsinn, Junior.»
7
Stille im Präsidium, die Flure dunkel, Leben herrschte nur noch im Erdgeschoss, wo die Wache Bilk untergebracht war, und im entgegengesetzten Trakt der Kriminalwache. An diesem Abend auch im zweiten Stock des Ostflügels. Hier residierte das Kriminalkommissariat 11, die Dienststelle für Tötungsdelikte, die Vincent leitete.
Er hörte Dominik in seinem Büro telefonieren. Zwei Zimmer weiter saß Felix May und bereitete sich auf die Aktenführung vor. Sie hatten ihre Türen offen gelassen, um sich notfalls per Zuruf verständigen zu können. Fabri und seine Leute von der Kriminaltechnik suchten weiterhin den Tatort nach Spuren ab. Die Leiche, das Restaurant, die nähere Umgebung sowie Melli Francks Privatwohnung im Stadtteil Flingern – intensive Arbeit für etliche Tage.
Schritte auf dem Gang, ein Klopfen an der Tür. «Vincent?»
Anna trat ein. Sie trug die Haare neuerdings streichholzkurz und knallblond gefärbt, Vincent hatte sich noch nicht daran gewöhnt. Hamid Belhanda folgte ihr. Der Neue war ein drahtiger Bursche mit kurzem krausem Haar, der bis vor ein paar Wochen noch im Staatsschutz-Kommissariat gearbeitet hatte. Hamid drängte sich nie vor und redete nicht viel – Vincent hatte noch keine Gelegenheit gehabt, ihn richtig kennenzulernen.
«Die Kölner Kollegen haben Karsten Kuhn benachrichtigt, den Freund des Opfers», sagte Anna. «Wir fahren dann mal los.»
«Trefft ihr ihn im Sender oder privat?»
«Bei ihm zu Hause. Willst du …» Sie zögerte.
«Bitte?»
«Willst du mitkommen?»
«Nein, nein. Du leitest die Ermittlungen. Ich muss nicht überall dabei sein.»
Anna lächelte, als glaube sie ihm kein Wort.
«Aber fühlt ihm ohne falsche Scheu auf den Zahn», fügte Vincent hinzu. «Versprecht ihr mir das?»
Hamid tippte sich auf den Kopf. «Was hast du da?»
Vincent griff in sein Haar und spürte geronnenes Blut. Die Kopfhaut spannte an der Stelle. Der Hieb des Naziburschen hatte ihm inzwischen eine Beule eingebracht.
«War zur falschen Zeit am falschen Ort», antwortete Vincent.
Melli Francks Lebensgefährte interessierte ihn. Nachdem Anna und Hamid sein Büro verlassen hatten, zog Vincent seine Tastatur heran und googelte Karsten Kuhn. Der derzeit populärste Moderator des WDR, wie es in den Zeitungen hieß.
Tacheles-TV.
Das Foto auf der Webseite zeigte einen Endvierziger mit zurückweichendem dunkelblondem Haar, freundlichem Lächeln und kalten Augen. Kuhn gab jeden Donnerstagabend den Anwalt des Volkes – oder was er darunter verstand.
Vincent hielt den Mann für einen Zyniker und fand es erstaunlich, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen eine angebliche Informationssendung produzierte, die sich mit Krawall und Populismus beim Publikum anbiederte.
Ein paar Klicks weiter landete Vincent auf den Online-Seiten eines Klatschmagazins. Offenbar waren Kuhn und Franck für lautstarke Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit berüchtigt. Mal wurde über Trennung spekuliert, mal Versöhnung vermeldet.
Die beiden besaßen getrennte Wohnungen, die Adresse des Fernsehmoderators befand sich in der Domstadt rund fünfzig Kilometer rheinaufwärts. Vincent musste an seine Beziehung zu Nina denken. Auch sie lebten seit zwei Jahren nicht mehr zusammen. Nachdem sie sich verkracht hatten, war Nina in Brigittes Häuschen auf der anderen Rheinseite eingezogen. Ausgerechnet bei seiner Mutter – Vincent staunte immer noch, wie gut sich die beiden Frauen verstanden.
Eigentlich wäre es praktischer, wenn Nina wieder bei mir wohnen würde, dachte er.
Vincent hörte, wie Dominik sein Telefonat beendete. Dann rief der junge Kollege über den Flur: «Wir haben den Kerl!»
Sie trafen sich zur Dreierrunde am Besprechungstisch in Vincents Zimmer: Dominik, Felix und er.
Junior breitete seine Notizen aus. «Ein gewisser Jens Hannig. Bis vor kurzem Chefkoch im Greens. Laut Viktor Krömer, dem Angestellten, mit dem ich gerade gesprochen habe, hat Hannig seine Chefin mehrfach beklaut und Vorräte aus der Kühlkammer auf eigene Rechnung verkauft. Daraufhin hat Melli Franck ihn rausgeschmissen, und er hat sehr emotional auf die Kündigung reagiert.»
«Inwiefern?»
«Drohungen. Das soll so weit gegangen sein, dass Franck Angst vor Hannig hatte.»
«Ist das alles?»
«Am frühen Abend hat die Wirtin Krömer angerufen, weil jemand an der Tür geklopft hatte. Wäre es Hannig gewesen, hätte er umgehend unsere Kollegen verständigen sollen.»
«Behauptet Krömer.»
«Ja.»
«Er soll morgen zur Aussage ins Präsidium kommen.»
«Schon vereinbart.»
«Und weiter?»
«Hannig war’s aber nicht, sondern nur ein Gast, der seinen Mantel vergessen hatte. Also falscher Alarm. Die Wirtin hat dann noch eine Weile mit Krömer geplaudert und sich schließlich beruhigt, sagt er.»
«Hat Hannig eine Akte bei uns?»
«Ja. Franck hat ihn wegen des Diebstahls angezeigt.»
Vincent sah Felix an. Der zuckte mit den Schultern.
«Dringender Tatverdacht», insistierte Dominik.
«Hast du Hannigs Adresse?»
«Klar.»
«Okay, Junior, schnapp dir jemanden von der Kriminalwache. Fahrt hin und fühlt dem Koch mal auf den Zahn.»
Dominik und Felix standen auf.
«Gute Arbeit», fügte Vincent hinzu.
Dominik wandte sich um und verneigte sich spöttisch, als überrasche ihn das Lob.
Als Nächstes widmete sich Vincent den weiteren Verbindungsdaten aus dem Handy der toten Wirtin. Ganz oben auf der Liste standen zwei verpasste Anrufe kurz vor neunzehn Uhr – zu diesem Zeitpunkt war Melli Franck bereits niedergeschlagen worden, denn der Notruf war etwas früher eingegangen. Beide Male derselbe Name: Marie Corinth.
Kommt mir bekannt vor, dachte Vincent.
Er ging zu Felix hinüber. «Zeig mir noch mal die Abschrift der letzten SMS-Nachrichten.»
Der Kollege schlug eine Akte auf und schob sie über den Tisch.
Marie Corinth: Bin schon da, freu mich auf dich …
Die beiden Frauen hatten sich zur Demo verabredet. Wie er und Nina.
«Gibt es dazu die genaue Uhrzeit?», fragte Vincent.
«Die nennt uns morgen der Netzbetreiber.»
Vincent kehrte in sein Büro zurück und wählte Marie Corinths Nummer.
«Ja, was gibt’s so spät?» Eine Stimme, die verschlafen klang, warm und weich. Vincent stellte sich eine üppige Frau vor, Mitte dreißig, dunkelrot geschminkte Lippen. Er wusste, dass er damit wahrscheinlich falsch lag, abgesehen vielleicht vom Alter.
«Frau Corinth?»
«Und wer sind Sie?»
«Vincent Veih, Kripo Düsseldorf.»
«Ist etwas mit Melli?»
«Wie kommen Sie darauf?»
«Sagen Sie mir, was los ist!»
«Können wir uns darauf einigen, dass ich die Fragen stelle und Sie antworten?»
Für ein paar Sekunden war es in der Leitung still.
«Wie kann ich mir sicher sein, dass Sie wirklich von der Polizei sind?»
Nicht dumm, dachte Vincent. Er revidierte sein Bild: ungeschminkt, randlose Brille, das Haar straff zurückgekämmt. Er sagte: «Hören Sie, wir legen jetzt auf, dann wählen Sie die Nummer des Präsidiums. Haben Sie etwas zum Schreiben?»
«Mhm.»
«Acht, sieben und zweimal die Null. Um diese Uhrzeit meldet sich jemand von der Wache unten im Haus. Dann lassen Sie sich mit mir verbinden. Mein Name ist …»
«Veih, ich hab’s verstanden.»
Aufgelegt.
Gleich darauf klingelte sein Apparat. So schnell konnte die Frau nicht gewesen sein.
Es war Nina. «Schon die Nachrichten vernommen?»
«Nein.»
«Wir waren fünftausend, nach offizieller Zählung, die anderen nur zweihundert. Die Guten überwiegen also bei weitem.»
«Hoffentlich bleibt das so.»
«Versprich mir, dass du morgen zum Arzt gehst mit deinem Kopf!»
«Ohne wäre es schwierig.»
Sie lachte. Ein leises Tuten, Anklopfgeräusche.
«Sorry, Nina, Arbeit.»
Er drückte sie weg.
«Veih.»
«Corinth.» Die warme Stimme von vorhin, aber ohne Schläfrigkeit. «Stellen Sie Ihre Fragen.»
«Wie ist Ihre Beziehung zu Melli Franck?»
«Wir sind gut befreundet. Sie war mal mit meinem Chef verheiratet. Thorsten Franck, Fondsmanagement und Immobilienentwicklung.»
«Sie haben sich heute SMS-Nachrichten geschrieben. Wann war das?»
«Am frühen Abend, ziemlich genau um sechs Uhr.»
«Wie kommen Sie darauf, Frau Franck sei etwas zugestoßen?»
«Weil sie nicht zur Demo kam. Als ich sie deshalb anrief, ging sie nicht ran. Sonst hat sie ihr Handy stets bei sich. Nicht erreichbar zu sein, ist Melli ein Gräuel.»
«Danke, Frau Corinth, das wär’s fürs Erste. In den nächsten Tagen werden wir uns noch einmal melden und einen Termin im Präsidium vereinbaren.»
«Beantworten Sie jetzt meine Frage?»
Vincent holte tief Luft. «Sie haben richtig vermutet. Wir gehen davon aus, dass Ihre Freundin einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist.»
«Nein! War es dieser Koch? In welchem Krankenhaus liegt Melli?»
«Kein Krankenhaus.»
«Ist sie …»
«Frau Franck ist tot, es tut mir leid.»
8
Ein Klopfen schreckte Vincent aus der Arbeit. Dominik schob seinen Kopf durch den Türspalt.
«Hannig sitzt in Gewahrsam», sagte er. «Gib Bescheid, wenn du …»
«Wieso Gewahrsam?», unterbrach ihn Vincent.
«Wir haben ihn festgenommen. Das wolltest du doch.»
«Ich sagte, fühlt ihm mal auf den Zahn. Damit meinte ich keine Zwangsmaßnahme!»
«Ich dachte, du willst ihn vielleicht selbst vernehmen. Immerhin hast du mal ein paar Semester Psychologie …»
«Lass den Scheiß.»
«Warum bist du so sauer?»
«Sag mir, Junior, welchen Grund siehst du für eine Festnahme?»
«Dringender Tatverdacht, Flucht- und …»
«Schwachsinn! Jetzt müssen wir Hannig bis morgen um Mitternacht dem Haftrichter zuführen. Damit stehen wir unnötig unter Druck. Sollten wir nämlich bis dahin keine Beweise gegen den Mann haben, lässt ihn der Richter frei. Und dann ist Hannig gewarnt, kann fliehen, Beweismittel vernichten, sich mit Leuten absprechen, die ihm ein Alibi geben – all das, was du verhindern wolltest. Du hast Mist gebaut, kapierst du das?»
Dominik zuckte mit den Schultern und wirkte beleidigt.
«Hättest du wenigstens noch zwei Stunden mit der Festnahme gewartet», sagte Vincent.
«Wieso?»
«Dann wäre es Dienstag, und es würde genügen, Hannig dem Richter erst am Mittwoch um Mitternacht vorzuführen.»
«Sorry.»
«Um Leiter einer Mordkommission zu werden, musst du noch eine Menge lernen.»
Dominik blickte zu Boden. «Und jetzt?», fragte er störrisch.
«Bring den Kerl her.»
Kaum war Dominik gegangen, klopfte es wieder. Hamid Belhanda, der Neue.
«Wie war’s bei Kuhn?», fragte Vincent.
«Der Mann sagt, er war zur Tatzeit in der Redaktion. Er gab uns etliche Namen von Mitarbeitern, die das angeblich bestätigen können.»
«Hat er einen Verdacht, wer es gewesen sein könnte?»
«Da gibt es einen Koch, den seine Freundin entlassen hat.»
«Jens Hannig, ich weiß. Dominik bringt ihn gerade her.»
«Chef?»
«Ja?»
«Dürfte ich dabei sein, wenn du ihn vernimmst? Vielleicht kann ich was lernen. Anna meint, du hättest Psychologie studiert.»
Vincent winkte ab. «Nur vier Semester, dann bin ich zur Praxis zurückgekehrt.»
«Worauf soll ich achten?»
«Körpersprache.»
«Aha.»
«Notier dir die Fragen oder Aussagen, bei denen sich der Verdächtige unwohl fühlt. Es geht dabei nicht bloß um die Mimik. Achte vor allem auf die Füße. Die hat man weniger unter Kontrolle als das Gesicht.»
Vincents Büro füllte sich. Er hatte seine private Pinnwand abgehängt, denn er wollte nicht, dass Hannig sich ablenken ließ oder etwas über ihn erfuhr. Zudem hatte Vincent die Stühle frei im Raum gruppiert. Kein Tisch sollte dem Verdächtigen die Möglichkeit geben, seine Hände ruhig zu stellen, oder den freien Blick auf den Kerl verwehren.
Sie nahmen Platz. Dominik, Hamid, Vincent und der Koch. Jens Hannig war Ende dreißig, groß und massig, kleine Augen hinter geröteten Wangen. Er hielt den Mund leicht geöffnet, die fleischige Unterlippe hing herab. Der Mann strahlte etwas Brutales aus. Vincent fiel es schwer, sich vorzustellen, dass dieser Mann das raffinierte Essen fabriziert hatte, das er mit Nina im Greens genossen hatte.
Der Koch hob seine Hände, die mit der Acht gefesselt waren. «Muss das sein?»
«Nicht wenn Sie sich benehmen.» Vincent zeigte ein Lächeln und nickte Dominik zu, der widerwillig die Handschellen aufschloss.
«Ich hab Melli nicht umgebracht», sagte Hannig.
«Nur ein paarmal damit gedroht», erwiderte Dominik.
«Vielleicht fangen wir ganz von vorn an», sagte Vincent, um die Situation zu entspannen. «Wie sind Sie seinerzeit zu Ihrer Anstellung im Greens gekommen?»
«Ich sag gar nichts.» Der Koch rieb sich theatralisch die Handgelenke, dann verschränkte er die feisten Arme vor der Brust und warf Dominik einen feindseligen Blick zu.
Vincent ärgerte sich über Dominik. Offenbar hatte der junge Kollege bereits zu viel mit Hannig geredet und ihn in eine Verweigerungshaltung gedrängt.
«Wir wollen doch alle miteinander verstehen, was passiert ist», sagte Vincent.
«Ich hab mit dem Mord nichts zu tun.»
Die Luft im Büro war verbraucht, Hannig roch nach Schweiß. Das Fenster mochte Vincent trotzdem nicht öffnen. Draußen lag die Temperatur beim Gefrierpunkt, und die Heizung im Präsidium lief nachts nur auf Sparflamme.
«Hat mein Kollege Sie schon über Ihre Rechte belehrt?»
«Ja, und ich sag nichts weiter.»
«Komm schon, Hannig», drängte Dominik. «Wir kriegen ohnehin alles raus.»
Vincent warf dem Kollegen einen tadelnden Blick zu. Halt lieber deinen Mund, Junior.
Dominik ignorierte ihn. «Wer soll es denn sonst gewesen sein? Jeder zeigt mit dem Finger auf dich.»
Der Koch wandte sich an Vincent. «Muss ich mir gefallen lassen, dass der Kerl mich duzt?»
«Fakt ist», fuhr Dominik fort, «dass Sie Melli Franck bedroht haben.»
«Sie hat mich bedroht!» Speichel sprühte von der Unterlippe des Dicken. «Das Miststück wollte mich vernichten. Sie wusste, dass ich vorhab, mich selbständig zu machen, und hat mich nur angezeigt, damit ich keine Lizenz bekomme. Melli wollte verhindern, dass ich ihr Konkurrenz mache. Da war ihr kein Mittel zu absurd!»
«Und dann?»
«Ich will meinen Anwalt sprechen.»
«Um diese Uhrzeit?»
«Ich hab das Recht darauf!» Hannig wurde laut, er lief rot an und zupfte mehrfach an seiner Nase. Vincent fragte sich, ob der Mann unter Drogen stand. Er händigte ihm sein Mobiltelefon aus und hoffte, dass er sich dadurch beruhigen würde.
Der Koch tippte mit seinen dicken Fingern darauf herum und hielt es ans Ohr. Nach ein paar Sekunden verdüsterte sich sein Blick. Nur der Anrufbeantworter, vermutete Vincent. Vor morgen früh wirst du nichts ausrichten.
Der Strafverteidiger-Notdienst wäre auch nachts zu erreichen. Bin ich verpflichtet, dem Kerl die Nummer zu geben? Nein, entschied Vincent.
Er bemühte sich um einen freundlichen Ton. «Herr Hannig, lassen Sie uns die Sache nüchtern betrachten. Zwischen Mord, Totschlag und fahrlässiger Körperverletzung mit Todesfolge bestehen beträchtliche Unterschiede, gerade auch im Strafmaß. Sie wissen, dass es der Richter positiv wertet, wenn ein Beschuldigter frühzeitig und von sich aus gesteht, bevor Sachbeweise auftauchen, die ihm keine andere Wahl mehr lassen.»
«Fuck!»
«Bitte?»
Hannig zupfte und rieb an seiner Nase. Seine Knie wippten. Adrenalin pur, vermutete Vincent.
«Wenn Sie jetzt nicht mit uns reden, müssen wir Sie über Nacht dabehalten.»
«Ich will den Haftrichter sehen!»
«Das hat Zeit bis morgen Abend.»
Hannig blähte die Backen auf und stieß die Luft aus. Er kratzte sich den Nacken und blickte um sich.
«Darf ich Ihnen einen persönlichen Rat geben?», fragte Vincent. «Sie werden heute Nacht kein Auge zutun, bevor wir uns nicht ausführlich unterhalten haben. Es wird Sie beruhigen, wenn wir offen über alles reden.»
Der Koch sah auf, zusammengekniffene Augen, Abscheu im Blick. «Stecken Sie sich Ihren Rat in den …»
«Werd hier nicht frech, Hannig!», unterbrach ihn Dominik.
Vincent hob die Hand, eine Geste zur Beruhigung. «In Ordnung, Herr Hannig. Wir sprechen uns dann, sobald Sie morgen Ihren Anwalt erreicht haben.» Sie standen auf. «Gute Nacht.»
«Sie mich auch.» Der Mann spuckte auf den Boden.
Dominik baute sich bedrohlich vor ihm auf, Vincent trat dazwischen. Hamid Belhanda schloss die Handschellen um das eine Gelenk des Kochs. Bevor er das andere fassen konnte, hieb Hannig ihm den Ellbogen ins Gesicht und rannte auf den Flur hinaus.
Hamid war zu Boden gegangen.
Vincent kümmerte sich um ihn. Sein Puls war gut zu spüren. Dominik gab den Kollegen der Wache im Erdgeschoss telefonisch Bescheid, damit sie den Flüchtenden am Ausgang abfingen.
Hamid setzte sich auf, sichtlich benebelt. Blut rann aus seiner Nase. «Habt ihr ihn?»
Vincent rannte aus dem Büro. Im Treppenhaus hielt er inne. Keine Schritte zu hören. Er beugte sich über die Brüstung und spähte hinunter. Das Foyer war menschenleer.