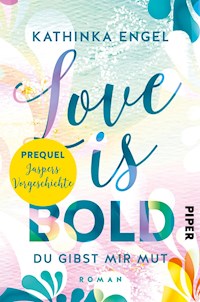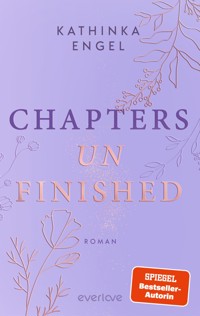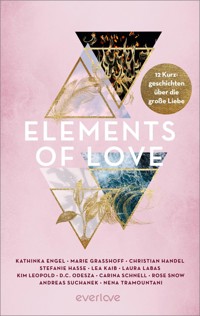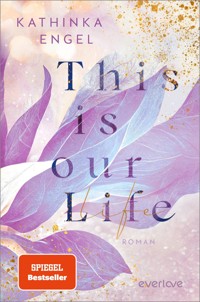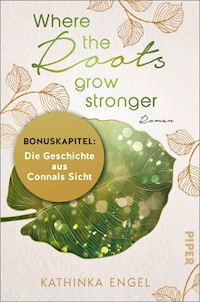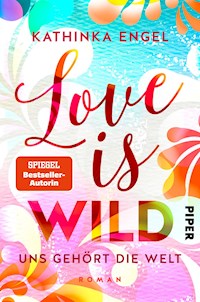9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Love Story mit ganz besonderem Twist ... Willkommen in der Welt von »Badger Books«! | Dieses E-Book enthält das exklusive Page Overlay als Grafik Lektor Bash kämpft im Indie-Verlag Badger Books zwischen Manuskriptstapeln und Verlagsdruck für seine Herzensprojekte. Als er die verschlossene Agentin Camille kennenlernt, steht Bash plötzlich vor einem unerwarteten Gefühlschaos, denn trotz der professionellen Distanz zieht Camille ihn magisch an. Während sie gemeinsam an einem aufregenden Buchprojekt arbeiten, entwickeln sich zarte Gefühle zwischen den beiden. Doch eine unerwartete Enthüllung stellt Bash vor eine schwierige Entscheidung. Können die beiden den Mut aufbringen, ihre Differenzen zu überwinden und die Liebe zuzulassen? Band 1 der Badger-Books-Reihe von SPIEGEL-Bestsellerautorin Kathinka Engel – die drei Geschichten aus dem Universum des Indie-Verlags versprechen jede Menge Funkensprühen! Hotness-Skala: 3 von 5 heißen Chilis
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Text bei Büchern mit inhaltsrelevanten Abbildungen und Alternativtexten:
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.everlove-verlag.de
Wenn dir dieser Roman gefallen hat, schreib uns unter Nennung des Titels »Words unspoken« an [email protected], und wir empfehlen dir gerne vergleichbare Bücher.
© everlove, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2024
Redaktion: Michelle Gyo
Illustration: Carina Vellichor
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44 b UrhG vor.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Illustration
Widmung
1
Jethro
2
Bash
3
Bash
4
Camille
5
Bash
6
Camille
7
Bash
8
Bash
9
Jethro
10
Bash
11
Camille
12
Bash
13
Camille
14
Camille
15
Bash
16
Bash
17
Jethro
18
Bash
19
Camille
20
Bash
21
Jethro
22
Camille
23
Jethro
24
Bash
25
Jethro
26
Bash
27
Jethro
28
Camille
29
Bash
30
Bash
31
Camille
32
Camille
33
Bash
34
Bash
35
Camille
36
Bash
37
Jethro
38
Bash
39
Jethro
40
Bash
41
Camille
42
Bash
43
Bash
44
Camille
45
Camille
46
Camille
47
Bash
48
Jethro
49
Bash
50
Camille
51
Bash
52
Bash
53
Camille
54
Bash
55
Camille
56
Camille
Fünf Monate später.
57
Bash
Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für die Mädchen, die wir waren.
Für die Frauen, die wir werden.
1
Jethro
In der Dunkelheit werde ich unsichtbar. Ich verschmelze mit der Schwärze der Nacht, verschmelze mit der Welt. Niemand sieht mich. Niemand hört mich. Ich bewege mich lautlos, bewege mich schnell. Selbst wenn sich jemand nach mir umdrehen sollte, bin ich im nächsten Augenblick verschwunden. Denn ich bin ein Phantom. Ich bin unsichtbar.
Meine letzte Aktion liegt zwei Monate zurück, und es juckt mich in den Fingern. Ich spüre es schon seit einiger Zeit. Ich merke es immer daran, dass ich unruhiger werde. Und gleichzeitig stiller. Und dann entschlossener.
Wenn ich länger nicht unterwegs war, vermisse ich nicht so sehr das Unsichtbarsein. Nicht so sehr den Nervenkitzel. Ich vermisse das Gehörtwerden. Das Etwas-zum-Ausdruck-Bringen. Das Jemand-Sein. Kompromisslos Ich-Sein. Denn ich habe etwas zu sagen. Ich will gehört werden. Will, dass meine Botschaft gesehen wird.
Ich husche zwischen geparkten Autos über die Straße. Die Laterne oben an der Kreuzung flackert. Es ist beinahe gespenstisch still. Kein Motorenlärm ist zu hören, kein Hundegebell. Nur mein leiser Atem, während ich mich im Schatten der Häuserwand fortbewege.
Mein Ziel ist ein altes Warehouse an der Waterfront, der ideale Ort für mein neuestes Gedicht, um den ich schon eine Weile herumschleiche. Lange genug habe ich gezögert. Aber jetzt, im Dunkel der Nacht, bin ich mir sicher.
Ich bin so bei mir, dass ich das Auto, das auf einmal neben mir hält, zu spät bemerke. Für den Bruchteil einer Sekunde denke ich, es ist vorbei. Denke ich, es ist die Polizei. Wie automatisch ducke ich mich, schnell atmend und dennoch mucksmäuschenstill. Aus meiner Hosentasche ziehe ich meine Sturmmaske und setze sie mir mit hektischen, aber geübten Bewegungen auf, ziehe sie zurecht. In meiner Deckung hinter – wie ich jetzt feststelle – einer Mülltonne blicke ich mich hektisch nach meinen Fluchtmöglichkeiten um. Nur nicht in eine Sackgasse rennen.
Bei einem meiner ersten Graffitis wäre ich beinahe geschnappt worden, weil ich auf einmal vor einem abgeschlossenen Maschendrahttor stand. Diesen Fehler macht man kein zweites Mal. Seither kenne ich die Routen, die ich zurücklege, auswendig – auf dem Hinweg eine andere als auf dem Rückweg, nur um sicherzugehen – und weiß in jedem Fall, wohin ich mich wenden muss. Ich bin schnell. Wenn sie auf der Suche nach mir sind, kann ich aus der Deckung das Überraschungsmoment für mich nutzen, die Straße hinunterrennen und mich dann nach links orientieren. Sobald ich zwischen den Hafengebäuden bin, gibt es jede Menge sichere Verstecke.
Als ich Autotüren höre, bereite ich mich auf meine Flucht nach vorne vor. Ich atme tief ein und aus, dann noch mal ein, halte die Luft an, um zu hören, was passiert. Zwei Männer unterhalten sich. Lachen. Das klingt nicht, als wären sie auf der Suche. Ihre Stimmen entfernen sich. Ich atme langsam aus. Noch mal gut gegangen.
Trotzdem warte ich einen Augenblick, meinen Rucksack fest an die Brust gedrückt. Ich kann nicht vorsichtig genug sein. Denn meine Identität muss geheim bleiben, um jeden Preis. Schon wegen der sehr realen juristischen Konsequenzen, die mein Schattendasein mit sich bringt. Während die einen meine Kunst bejubeln und zu Hunderttausenden auf Social Media teilen, werfen mir die anderen Vandalismus vor. Aber auch die hören mich. Lesen mich. Und darum geht es.
Ich biege in eine kleine Seitenstraße ein. Der Asphalt ist rissig, brüchig. Hier und da sieht man im fahlen Licht der Straßenlaternen, dass er ausgebessert wurde. Ich husche über eine Straße, über eine weitere. Kein Blick zurück. Wer sich umsieht, wird langsamer und macht sich verdächtiger. Wer eine Strumpfmaske trägt, auch, weswegen ich sie mir normalerweise erst kurz vor der Aktion überziehe. Aber die Holyoke Wharf liegt nun verlassen vor mir. Die Luft ist schwanger vom Geruch nach frühem Herbst und Meer, und in einiger Entfernung sehe ich ein Tier. Es könnte ein Fuchs sein. Oder ein Hund. Auf der Suche nach Fischabfällen. Ansonsten bin ich mutterseelenallein. Das einzige Geräusch neben den Autos, die zu dieser nachtschlafenden Zeit unregelmäßig in der Ferne zu hören sind, ist das Knarzen der sich wiegenden Fischerboote am Rand des Kais.
Und dann stehe ich vor dem Gebäude. Die halb blinden Fenster im Erdgeschoss liegen in völliger Dunkelheit. Neben einer unscheinbaren Eingangstür hängen halb abgerissene Plakate von Konzerten oder Festivals, deren Datum weit in der Vergangenheit liegt, doch ich sehe sie mir nicht näher an. Ihre losen Ecken flattern bei jedem Windhauch.
Stattdessen trete ich einen Schritt zurück, blicke an die Wand. Dann hole ich die Stencils aus dem Rucksack. Einen nach dem anderen befestige ich an der Wand. Ich muss schnell sein, aber gleichzeitig nicht leichtsinnig. Immer wieder halte ich inne, lausche. Dann arbeite ich weiter, bis die festen Papierschablonen ein Ganzes ergeben.
Ich ziehe meine Spraydose aus dem Rucksack. Sprühe eine dünne Schicht Farbe gleichmäßig über die ausgestanzten Buchstaben. Es würde schneller gehen, wenn ich dauersprühen würde, statt das Cap immer nur kurz zu drücken, aber die Gefahr, dass Farbe hinter die Schablone läuft, ist zu groß. So sprühe ich erst eine Schicht, dann eine zweite, schließlich eine dritte.
Es dauert alles in allem nur ein paar Minuten, dennoch kommt es mir vor wie eine Ewigkeit. Endlich entferne ich die Schablonenteile behutsam und werfe noch einen Blick auf mein fertiges Werk. Weiße Buchstaben auf roten Ziegelsteinen.
Ich zücke mein Handy, mache ein schnelles Foto. Dann drehe ich mich um und renne. Lautlos in die Dunkelheit. In die Unsichtbarkeit.
2
Bash
Der Pitch des Projekts klang vielversprechend, aber je länger ich lese, desto prätentiöser finde ich die Sprache. Irgendwie gewollt. Unauthentisch. Als hätte der Autor versucht, so poetisch und intellektuell wie irgend möglich zu klingen, dabei aber vergessen, wer er selbst ist. Niemand will ein Buch lesen, das aufgesetzt wirkt.
Das ist bereits das vierte Manuskript, in das ich heute reinlese. Es ist Sonntagabend – oder eher Montagnacht, wie mir der Blick auf meine Handyuhr verrät. Ein Uhr fünfundzwanzig. Dabei hatte ich Louise versprochen, mir einen Tag freizunehmen. Dafür ist es nun zu spät, aber so ist das eben, wenn man zusammen mit seinen zwei besten Freunden einen kleinen Indie-Verlag gründet. Man arbeitet. Immer.
Doch weil Louise recht hat und mein Kopf vor verschwurbelten Bandwurmsätzen und schiefen Metaphern ohnehin kurz davor ist, abzuschalten, lege ich die Leseprobe zur Seite und will gerade meine Nachttischlampe ausmachen, als mein Handy vibriert.
Nicht viele Leute rufen mich mitten in der Nacht an. Eigentlich nur zwei Personen. Entweder es ist meine kleine Schwester Evie, die sich Gott weiß wo in Europa herumtreibt, sich mit Gott weiß was für Jobs über Wasser hält und mich betrunken von ihrem Heimweg aus Gott weiß welchem Club anruft, um mir zu sagen, wie lieb sie mich hat und dass ich mich mal entspannen soll. Oder es ist wie in diesem Fall meine Highschool-Ex-Freundin Laura.
»Hi Laura«, sage ich und unterdrücke ein Gähnen.
»Bash?« An der Art und Weise, wie sie meinen Namen sagt, merke ich bereits, dass sie geweint hat. Shit.
»Hey, was ist los?« Ich schalte den Lautsprecher ein und lege das Handy neben mein Kopfkissen, sodass ich schon mal die Augen schließen kann, während wir telefonieren.
»Habe ich dich geweckt?«
»Nein, alles gut. Ich habe noch gearbeitet. Wo bist du?«
»Im Auto.«
»Warum?«
»Ich musste raus.« Ihre Stimme bricht.
»Habt ihr euch wieder gestritten?«
Einen Moment lang sagt sie nichts. Ich sehe sie vor mir, wie sie in ihrem kleinen Peugeot durch die nächtlichen Straßen unseres Heimatorts fährt, sich auf die Unterlippe beißt, gegen neuerliche Tränen ankämpft. Dann sagt sie: »Ja.«
»Willst du drüber reden?« Louise würde mich schimpfen. Nicht nur, weil ich längst schlafen sollte, wenn ich morgen pünktlich und fit im Büro sein will, sondern auch, weil sie findet, ich solle den Kontakt zu Laura abbrechen. Oder wenigstens auf ein Minimum reduzieren. Sie haben sich zwar nie kennengelernt, aber Louise sagt, ich müsse mich mehr um mich kümmern als um eine Person, die mich mit siebzehn betrogen hat. Ich habe Laura allerdings längst verziehen. Wir waren jung. Kinder. Man macht Fehler. Nur, dass sie immer noch mit diesem Fehler zusammen ist – inzwischen zusammenwohnt –, macht die Sache ein bisschen schwieriger. Aber ich versuche eben, ein guter Freund zu sein. Versuche, das Richtige zu tun.
»Ich verstehe einfach nicht, wie man jemanden lieben und gleichzeitig so ein Arsch sein kann.«
»Was ist denn passiert?«
»Jayden hat Sachen gesagt, Bash. Richtig üble Sachen. Und ich weiß, dass er es nicht so meint, dass er einfach auch echt viel um die Ohren hat und kein Ventil und …«
»Du musst ihn nicht verteidigen. Niemand hat das Recht, ein Arsch zu dir zu sein, Laure.« Der vertraute Spitzname kommt mir wie automatisch über die Lippen. Louise würde schimpfen. Vielleicht zu Recht. Louise hat meistens recht.
»Ich weiß, ich meine ja nur … Er ist manchmal nicht er selbst.«
Oder er ist immer er selbst.
»Mit dir habe ich mich nie so beschissen gefühlt, Bash. Du hättest nie gesagt, dass du dich zwingen musst, mit mir zu schlafen, weil ich es nicht bringe. Du hättest mich nie …« Sie stockt. »Du hättest mich nie betrogen.«
Du mich schon. »Er hat dich betrogen?«
»Ich weiß es nicht. Er hat es gesagt, aber vielleicht wollte er mir auch nur wehtun.«
»Warum wollte er dir wehtun?«
»Weil ich mit meiner Mom shoppen war und mir ein Kleid gekauft habe, von dem ich dachte, es würde ihm gefallen. Aber ich habe vergessen, das Preisschild abzumachen, und er hat gesehen, wie viel ich ausgegeben habe. Und ich weiß ja selbst, dass wir nicht einfach so fünfzig Dollar übrig haben. Aber Mom hat die Hälfte bezahlt, und ich habe mich endlich mal wieder ein bisschen wie ich gefühlt.«
»Hast du ihm das gesagt?«
»Ja. Aber da hatte er schon entschieden, dass wir uns streiten würden.«
»Laura«, sage ich behutsam und achte darauf, ihren richtigen Namen zu benutzen, »du weißt, dass du das nicht machen musst, oder? Bei ihm bleiben?«
»Ich weiß«, flüstert sie erstickt. »Aber ich liebe ihn. Und es ist nicht immer so.«
»Aber es ist oft so.«
»Sag das nicht, Bash, bitte. Mach es mir nicht schwerer, als es ist.«
»Ich versuche, es dir weniger schwer zu machen.«
»Aber das tust du nicht. Du tust so, als sei es leicht. Zehn Jahre wirft man nicht einfach weg.«
Nee, man packt noch mal zehn Scheißjahre obendrauf. »Ich weiß, es ist hart, Laura. Und ich weiß, du liebst ihn. Aber das ist das vierte Mal diesen Monat, dass du mich weinend anrufst. Und das zweite Mal diese Woche. Und ich mache mir ehrlich gesagt Sorgen um dich.«
»Ach was.« Sie schnieft. »Manchmal muss es einfach raus, weißt du? Aber es geht mir schon viel besser.« Ich höre, dass sie sich an einem Lächeln versucht. »Wenn ich mit dir rede, geht’s mir immer besser. Danke.«
»Ist doch selbstverständlich«, sage ich. »Ich bin da, wenn du mich brauchst.« Ich bin immer da. Weil man das so macht unter Freunden. Weil es das Richtige ist.
»Danke.«
»Kannst du heute Nacht woanders schlafen? Bei deiner Mom?«
»Ich werde einfach im Auto schlafen.«
»Laura!« Auf einmal bin ich wieder hellwach. »Du kannst doch nicht im Auto schlafen!«
»Es ist sogar ganz bequem.«
»Verriegelst du wenigstens die Türen?« Die Kleinstadt in Illinois, aus der wir kommen, ist zwar nicht unbedingt gefährlich, aber man weiß ja nie.
»Natürlich.«
»Ich finde das ziemlich kacke, Laure.«
»So ist vielleicht das Leben. Ziemlich kacke.«
»Aber so muss es nicht sein.«
»Für manche schon.« Sie lacht.
Genau das Lachen, in das ich mich mit fünfzehn verliebt habe. Genau das Lachen, das mir zwei Jahre später das Herz gebrochen hat, als es nicht mehr mir galt, sondern Jayden. Unter der Tribüne des Highschool-Footballfelds. Was für ein Klischee. Es ist leise und ein bisschen verschämt. Es klingt, wie Zuckerguss schmeckt. Zu süß. Und ich hasse Jayden dafür, dass er ihr das Leben so schwer macht.
»Gute Nacht, Bash. Danke, dass ich dir mein Herz ausschütten durfte.«
»Gute Nacht. Und jederzeit.«
Wir legen auf, und ich spüre mein Herz überdeutlich in meiner Brust. Es rast. Vor Wut. Vor Wut auf Jayden. Und vor Wut auf Laura, weil sie damals etwas Gutes weggeworfen hat für etwas, das ihr Leben elend macht. Aber das ist eine Entscheidung, die sie getroffen hat. Sie hat mit mir nichts zu tun. Nur insofern, als dass ich eben nicht der Bad Boy bin, von dem man hofft, er würde sich für die Liebe ändern.
Ich lösche nun endgültig das Licht, rolle mich auf die Seite, schließe die Augen. Drehe mich um. Schüttle mein Kissen, weil irgendwas nicht stimmt. Strample die Decke von den Beinen, denn mir ist auf einmal viel zu heiß. Scheiße, warum konnte der Anruf nicht von Evie sein? Ihre etwas zu laute Stimme, weil sie gerade aus einem lauten Berliner Technoclub kommt, die mir kichernd irgendwas aus ihrem Leben erzählt. Aber ich habe seit zwei Monaten nichts mehr von ihr gehört. Wo sie wohl ist?
Kurzerhand entsperre ich mein Handy. Das helle Licht des Displays blendet mich im ersten Moment. Ich suche unsere Unterhaltung, die viel zu weit nach unten gerutscht ist. Die letzten vier Nachrichten stammen allesamt von mir.
Lange nichts gehört. Wie geht’s dir? Ich denke an dich!
Alles gut bei dir? Louise hat heute Muffins mitgebracht, da musste ich an dich denken. Deine sind besser.
Hey Sis, ich bin mit Coulter im Great Beers (great name, oder?) und hab schon das ein oder andere great beer getrunken (das ist eine Lüge, sie haben hier nur Cors Light und Bud) und denke an dich. Lass mal was von dir hören.
Hi Evie. Hab mit Mom telefoniert. Sie macht sich langsam Sorgen. Ich hab ihr gesagt, dass sicher alles gut ist, aber es wäre gut, du würdest mal ein Lebenszeichen von dir geben.
Sie hat alle Nachrichten bekommen und gelesen, aber nicht reagiert. Es ist nicht das erste Mal, dass das passiert, aber das bedeutet nicht, dass es leichter wird.
Gute Nacht, Evie, schreibe ich jetzt und schicke die Nachricht ab. Sie wird zugestellt, im nächsten Moment sehe ich, dass Evie online ist. Ich warte ab, ob sie etwas antwortet. Starre auf das kleine Bild von ihr. Das Wort online daneben. Ich stelle mir vor, wie sie sieht, dass auch ich online bin. Wir beide zur selben Zeit, wie wir diese digitale Version von uns anschauen. Aber sie antwortet nicht. Und dann ist sie wieder weg.
Ich seufze. Wenn wir wenigstens wüssten, dass es ihr gut geht. Andererseits, Evie geht es immer gut. »Keine Nachricht ist eine gute Nachricht«, sagt unser Dad in solchen Momenten immer, und das stimmt vermutlich. Denn wenn etwas wäre, würde man uns informieren. Denke ich. Und sie ist ab und zu online, also kann es so schlimm nicht sein. Oder?
Die Gedanken verselbstständigen sich. Ich weiß, dass ich nicht werde schlafen können, wenn ich in diese Spirale aus Sorge und – ja – Wut gerate. Also mache ich das, was ich immer tue, wenn ich unruhig bin. Ich gebe den Namen Jethro in die Suchleiste meines Handys ein und scrolle mich durch die neuesten Artikel und Forenbeiträge. Es gibt einige Theorien, wer sich hinter dem berühmten Street Poet verbirgt, der seit ein paar Jahren vor allem in Portland (Maine, nicht Oregon) und Umgebung, selten auch mal an anderen Orten in den USA seine Gedichte auf Hauswände und Straßen sprayt. Er sei der Sprössling einer Politikerfamilie, der vor Jahren für einen Eklat sorgte, als er dabei erwischt wurde, wie er stümperhaft Wände beschmierte. Er sei ein bedeutender Name aus der Sprayerszene, genauer gesagt BIGboy77, der auch aus Maine stammt und ebenfalls mit Schablonen arbeitet. Einer schrieb neulich, es handle sich bei Jethro um einen Literaturprofessor der University of Southern Maine, der eine Vorlesungsreihe zum Thema Lyrik im 21. Jahrhundert gehalten und mehrere Stunden lang vermeintlich tiefe Einsichten in Jethros Werke gewährt hat.
Ich klicke auf den neuesten Beitrag im Forum. Er stammt von WhoIsJethro123 und ist mit »Bestsellerautor Jethro???« überschrieben. Obwohl ich eigentlich schlafen sollte, klicke ich auf den Beitrag, denn ich liege Louise und Coulter schon seit Ewigkeiten damit in den Ohren, dass man ein Buch mit Jethro machen sollte. Und mit »man« meine ich »wir«. Leider lief bislang jede Kontaktaufnahme meinerseits ins Leere, da es abgesehen von einem Instagram-Account keine Möglichkeit gibt, ihn anzuschreiben.
Doch als ich beginne zu lesen, merke ich schnell, dass es nur eine weitere abstruse Theorie ist. WhoIsJethro123 ist der Meinung, es handle sich bei Jethro um das Alter Ego des neuen amerikanischen Wunderkindes der Literatur, Cy Bellamy, der mit seinem Debütroman The Gentle Art of Losing your Mind vor anderthalb Jahren die nationalen und internationalen Bestsellerlisten stürmte. Was natürlich nichts damit zu tun hat, dass sein Vater die Autorenlegende Holm Bellamy ist. Und, na gut, das Buch ist auch so ungefähr das Beste, was in den letzten Jahren geschrieben wurde. Zufällig ist er außerdem Louise’ bester Freund seit Kindertagen, weswegen ich die Bitterkeit sein lassen sollte. Sie steht mir ohnehin nicht.
Jethros Graffiti »Dieser Tag wie eine Ewigkeit« sei eine Anspielung auf Allen Ginsbergs Gedicht Howl, das außerdem die Grundlage für den ikonischen letzten Satz »Ich bin bei dir Rockland« aus Bellamys Debüt lieferte. Außerdem seien die Kapitelanfänge ein Anagramm des Namens Jethro, wenn man die Kapitel 3–10, 13, 15–18 und 20–25 ausklammert. Hier hört die Beweisführung allerdings auf, sodass ich kopfschüttelnd den Thread »Neues von J« öffne. Er ist nach oben gerutscht, weil der letzte Beitrag nur ein paar Minuten alt ist. Mein Herzschlag beschleunigt sich, als ich lese, was JeThRoOoOo geschrieben hat: Es gibt ein neues Gedicht.
Sofort schließe ich die Seite und öffne Instagram. Und tatsächlich – nach Monaten der Stille sehe ich als Erstes einen neuen Post von Jethro. Wie jedes Mal handelt es sich um einen beinahe laienhaft aufgenommenen nächtlichen Schnappschuss. Ich kann nicht identifizieren, wo er aufgenommen wurde, aber ich lese gebannt die Worte, die Jethro auf die Ziegelsteine gesprayt hat.
Wer, wenn nicht du
Wann, wenn nicht jetzt
Wo, wenn nicht hier
Was, wenn nicht
dein eigener verfluchter Traum
Ich weiß nicht, warum, aber immer, wenn ich ein Gedicht von Jethro lese, resoniert etwas in mir. Seine Worte sind vielleicht nicht die poetischsten. Die Botschaften nicht unbedingt die tiefsten. Aber er trifft einen Nerv. Hat damals mit seinem Gedicht über Identität genau meinen Nerv getroffen, was wohl der Grund ist, warum ich – in Louise’ und Coulters Worten – »besessen« von ihm bin.
Und ja, vielleicht bin ich das, denke ich, als ich auf sein Profil klicke und dann auf den Nachrichten-Button. Die Konversation mit Jethro ist ebenso einseitig wie die mit Evie seit ein paar Monaten. Laura reagiert wenigstens auf das, was ich ihr sage, wenn auch nur passiv. Drei Vorstöße habe ich bereits gewagt und mir eigentlich geschworen, dass ich es nun auf sich beruhen lasse. Er sieht meine Nachrichten nicht einmal. Und dennoch – vielleicht weil es inzwischen nach zwei Uhr nachts ist oder weil Lauras Anruf und ihr Nicht-Handeln und Evies Schweigen dazu geführt haben, dass ich meine masochistische Ader aktiviert habe – tippe ich eine weitere Nachricht an Jethro.
Hi Jethro, schreibe ich und weiß jetzt schon, dass Coulter und Louise sich morgen über mich lustig machen werden.
Ich noch mal, Bash, der Lektor aus dem Indie-Verlag Badger Books, der großes Interesse daran hätte, ein Buch mit dir zu machen. Deine Anonymität würden wir selbstverständlich wahren. Es würde mich freuen, von dir zu hören. Viele Grüße, Bash Hanlon.
Ich schicke die Nachricht ab, starre ein paar Minuten darauf, in der bescheuerten Hoffnung, Jethro könnte sie lesen. Denn wenn jemand mitten in der Nacht wach ist, dann ein Typ, der auf den Schutz der Dunkelheit angewiesen ist, oder? Aber nichts dergleichen geschieht. Stattdessen wird mein Display irgendwann dunkel, und ich mache mir nicht mehr die Mühe, draufzutippen, sondern schließe endlich die Augen.
3
Bash
»Mr Hanlon, ich kündige!«
Ich bin gerade zur Tür unseres Büros hereingekommen, habe noch nicht einmal einen Kaffee getrunken, was ein Problem ist, wenn man viel zu wenig geschlafen hat. Aber da Mrs Pavlidis ungefähr einmal pro Woche droht, zu kündigen, bin ich nicht sonderlich alarmiert.
»Bash«, korrigiere ich, doch sie weigert sich seit anderthalb Jahren, uns beim Vornamen zu nennen. »Lassen Sie mich erst mal ankommen. Und erzählen Sie mir in Ruhe, was passiert ist.« Dann vermittle ich zwischen ihr und Coulter, wie ich es immer tue. Er verspricht grummelnd, sich in Zukunft zusammenzureißen, sie verkündet, dass es das letzte Mal ist, dass sie sich von mir und meinem Charme hat überreden lassen.
Ich durchschreite den großen Hauptraum, der eher einer Halle gleicht, und begrüße nickend der Reihe nach unsere Angestellten. Anna, eine kleine Brünette mit Nasenpiercing und Mütze, die für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, Katie und Vikram, unsere Trainees, Kwan, den überkommunikativen Vertriebsmanager, und Zara, unsere Freelance-Grafikdesignerin, die dreimal pro Woche da ist.
Das Büro von Badger Books befindet sich im dritten Stock eines alten Warehouses. Die Wände sind aus unverputzten Ziegelsteinen, der Boden aus Rohbeton. Durch die riesigen Fenster fallen Sonnenstrahlen auf unsere Sitzecke aus Sofas und Sesseln am einen Ende des Raums. Daneben befindet sich eine kleine Küchenzeile, von wo die Kaffeemaschine einen betörenden Duft verströmt. Die Schreibtische, an denen das Team sitzt, sind zu Arbeitsinseln zusammengeschoben, und dahinter befindet sich die Tür zu dem Büro, das ich mir mit Louise teile. Gegenüber der Eingangstür, neben unserem Konferenzraum, führt außerdem eine kleine Treppe ins Dachgeschoss, wo Coulter, der dritte im Bunde und Mrs Pavlidis’ erklärte Nemesis, ein eigenes Büro hat. Daneben liegt die Tür zu seiner Wohnung, einer industrial chic Junggesellenbude.
Praktischerweise gehört Coulter das Gebäude. Vor ein paar Jahren hatte er einen Verkehrsunfall und bekam eine wahnwitzige Summe Schmerzensgeld ausgezahlt, mit der er uns den Traum eigener Räumlichkeiten für Badger Books ermöglicht hat, wofür wir ihm ewig dankbar sein werden, auch wenn er davon nichts hören will.
Mrs Pavlidis folgt mir auf dem Fuß, schimpfend, gestikulierend. »Das war das letzte Mal, Mr Hanlon. Das letzte Mal!«
»Ich weiß«, versuche ich, sie zu beruhigen, betrete mein Büro und stelle die lederne Umhängetasche, die unter anderem die Manuskripte von letzter Nacht beinhaltet, auf den Schreibtisch. Der Platz gegenüber ist noch leer, weil Louise morgens erst Philomena in die Vorschule bringt.
»Die Unverschämtheiten von Mr Barnett werde ich mir nicht länger gefallen lassen!«
»Sie sollen sich überhaupt keine Unverschämtheiten gefallen lassen, das ist doch klar«, sage ich und bedeute ihr, die Tür zu schließen, damit die anderen nicht jedes Wort mitbekommen. Denn Coulter ist ohnehin nicht der Beliebteste von uns dreien. »Setzen Sie sich, dann bereden wir das ganz in Ruhe.« Ich deute auf einen Stuhl.
Doch Mrs Pavlidis bleibt stehen. »Nein, Mr Hanlon, es gibt nichts mehr zu bereden.« Eine graue Strähne hat sich aus ihrem strengen Dutt gelöst und steht fast im rechten Winkel von ihrem Kopf ab.
Im nächsten Moment klopft es an der Tür, und Coulter steckt seinen Kopf herein. »Ich schätze mal, es geht um mich?«, fragt er, in der Hand einen Rubik’s Cube, dessen bunte Quadrate er hin und her dreht, um Ordnung zu schaffen.
Er ist immer der Erste im Büro – zum einen, weil er hier wohnt, und zum anderen, weil er Coulter ist und morgens um sieben bereits zehn Meilen gejoggt ist, ein gesundes Frühstück zu sich genommen hat und bereit ist, in einen sehr effizienten Tag zu starten. Er tritt ein und verschränkt die Arme.
»Sie brauchen gar nicht so selbstgefällig dreinschauen. Sie haben es geschafft, Mr Barnett. Sie haben mich vertrieben.«
»Das war mitnichten meine Absicht«, sagt Coulter. »Ich habe lediglich darum gebeten, dass Sie …«
»Sie haben mir nicht zu erklären, wie ich meinen Job mache! Seit über dreißig Jahren arbeite ich als Assistentin. Noch nie hat sich jemand beschwert.«
»Dann war allen anderen wohl egal, dass Sie schlampig arbeiten?« Er blickt von seinem Rubik’s Cube auf.
»Coulter«, ermahne ich ihn.
»Dass ich … Was erlauben Sie sich, Sie aufgeblasener Flegel!«
»Wir sind ein Verlag, Mrs Pavlidis. Wir arbeiten mit Sprache. Da darf ich wohl erwarten, dass Sie die E-Mails, die Sie verschicken, noch mal auf Richtigkeit überprüfen.«
»Es war eine E-Mail an ihn!« Mrs Pavlidis blickt mich an und zeigt mit dem Finger auf Coulter. »Die ging nicht mal nach draußen. Ich habe mich einfach vertippt!«
»Ich habe es gern akkurat«, sagt Coulter und zuckt mit den Schultern. »Und wo wir schon dabei sind, habe ich es auch gern privat. Und ich weiß zufällig, dass Sie Freitagabend in meinem Büro waren.«
»Um Ihre Pflanze zu wässern!«
»Ich habe Sie nicht darum gebeten, oder?«
»Coulter«, sage ich beschwichtigend, »das ist doch albern.«
»Albern? Es gibt hier klare Regeln. Beispielsweise, dass meine Tasse nicht in die Spülmaschine darf, nicht wahr, Mrs Pavlidis? Oder eben, dass niemand mein Büro betritt, wenn ich es nicht ausdrücklich erlaube.«
»Mrs Pavlidis hat es nur gut gemeint.«
»Und?«
»Du könntest dich bedanken und beim nächsten Mal nicht so viel Wirbel darum machen«, schlage ich vor, denn ich weiß zwar, dass Coulter eigen ist, und versuche, es – ebenso wie alle anderen – zu respektieren, aber manchmal wäre es gut, er wäre in diesen Dingen ein bisschen entspannter.
»Die Tür ist übrigens auch immer noch nicht repariert«, sagt Coulter jetzt. »Wenn ich mich richtig erinnere, hattest du, Bash, Mrs Pavlidis darum gebeten, das zur absoluten Priorität zu machen.« Er grinst selbstgefällig.
Die Tür ist seit einer Woche kaputt. Selbst wenn sie nicht abgeschlossen ist, kommt man nur mit Schlüssel rein und raus, was ein Problem für Zara ist, weil sie keinen eigenen Schlüssel hat. Deswegen hat Coulter natürlich recht.
»Ich wollte es heute machen«, sagt Mrs Pavlidis. »Aber leider …« Sie reicht mir ein gefaltetes Blatt Papier, das sie anscheinend schon die ganze Zeit in der Hand gehalten hat. »Es tut mir leid, Mr Hanlon. Das geht nicht gegen Sie oder Miss Calahan. Aber mit diesem Rüpel« – wieder zeigt sie auf Coulter – »halte ich es keinen Tag länger aus.«
Ich nehme das Papier entgegen und falte es auf. Hat sie diesmal die Bedingungen, unter denen sie bereit ist, weiter für uns zu arbeiten, schriftlich festgehalten? Vielleicht wäre das eine gute Gedankenstütze für Coulter. Doch dann lese ich das erste Wort. Kündigung, steht da.
»Nein«, entfährt mir. »Mrs Pavlidis, das meinen Sie nicht ernst.«
»O doch!«
»Aber … wir brauchen Sie!«
»Pff«, macht Coulter, und ich bedeute ihm mit einer barschen Geste, zu schweigen.
»Es tut mir leid, Mr Hanlon, aber meine Entscheidung steht fest.«
»Das bisschen Admin-Kram kriege ich gerade noch selbst hin«, sagt Coulter. »Mit korrekter Orthografie.«
»Coulter, sei still. Du hilfst kein bisschen!«
»Es spielt keine Rolle, Mr Hanlon. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass Sie sich für mich einsetzen. Aber ich bin heute nur hier, um mich persönlich von Ihnen zu verabschieden.«
»Aber Mrs Pavlidis …«
»Es hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Sie sind ein prächtiger junger Mann und ein hervorragender Chef. Warum Sie allerdings mit diesem ungehobelten Kerl befreundet sind, werde ich nie verstehen.«
Coulter lacht, und in diesem Moment verstehe ich selbst nicht, warum er seit dem Studium mein bester Freund ist, Warehouse hin oder her.
»Bitte richten Sie Miss Calahan meine besten Wünsche aus. Und geben Sie der Kleinen einen Kuss von mir.« Mit diesen Worten streckt sie mir die Hand hin. »Auf Wiedersehen, Mr Hanlon. Danke für alles.«
»Aber …« Doch ich weiß, dass ihre Entscheidung diesmal endgültig ist. »Auf Wiedersehen«, sage ich mechanisch. Und ohne Coulter auch nur eines letzten Blickes zu würdigen, dreht sie sich um und verlässt das Büro.
»Endlich.« Coulter seufzt, lässt sich auf dem Stuhl nieder, den ich Mrs Pavlidis angeboten hatte, und schlägt lässig die Beine übereinander.
Ich sehe ihn entgeistert an. »Super. Jetzt müssen wir uns nach einer neuen Assistenz umschauen. Bist du zufrieden?«
»Schon, ja.« Er grinst. Dann dreht er noch zweimal an seinem Würfel herum, sodass nun jede Fläche eine Farbe hat, und legt ihn auf meinen Schreibtisch.
»Dann kannst du dich gleich mal an die Stellenausschreibung machen.«
»Ich habe noch ein paar Verträge auf dem Schreibtisch. Die gehen vor.«
»Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du so ätzend zu Mrs Pavlidis warst.« Es fällt mir schwer, geduldig zu bleiben, wenn Coulter sich benimmt wie ein absoluter Arsch. Aber es sind Situationen wie diese, in denen mir zugutekommt, dass ich ein Leben lang Übung darin habe, nicht auszuflippen.
»Sie hat meine Grenzen nicht respektiert, Bash. Wie oft habe ich ihr gesagt, mein Büro ist tabu?«
Ich nicke. Denn natürlich, es stimmt. Coulter hat von Anfang an Grenzen gezogen. »Aber die Sache mit der E-Mail …«
»Sie hat nicht sauber gearbeitet. Und ich kann ja wohl von den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, erwarten, dass sie sich an meinen Standards orientieren. Das tue ich bei Anna und Kwan ebenso.« Er hat vermutlich sogar recht. Mrs Pavlidis war weit entfernt davon, eine perfekte Teamassistenz zu sein. Aber sie war immerhin da. Und wir waren eingespielt. »Und bei dir und Louise, wenn wir schon dabei sind. Nur gibt’s da komischerweise keine Probleme.«
»Wo gibt’s keine Probleme?« Die Tür ist erneut aufgegangen. Ich sehe auf und erblicke Louise mit ihren rotblonden Haaren, der schwarz umrandeten Brille und dem weiten Mantel und … ihrer Tochter Philomena. »Sorry, Phil hat leicht erhöhte Temperatur, deswegen durfte ich sie nicht in der Vorschule lassen.« Sie rollt mit den Augen. »Zeig mir ein Kind, das keine leicht erhöhte Temperatur hat.«
»Aber ich bin topfit!«, sagt Philomena strahlend.
»Keine Sorge, ich telefoniere gleich rum, wer sie abholen kann. Vermutlich deine Grandma. Was meinst du, Phil?«
»Klar«, sagt sie, klettert mit ihrem bunten Rucksack auf Louise’ Schreibtischstuhl und fängt an, sich im Kreis zu drehen.
Leiser, damit Philomena es nicht hören kann, flüstert Louise: »Ich erreiche natürlich den nichtsnutzigen Erzeuger nicht. Aber Mom hat sicher Zeit.«
»Und wenn nicht, bleibst du einfach hier, oder?«, fragt Coulter.
Es ist wirklich erstaunlich, wie er zu Mrs Pavlidis so ein Stinkstiefel sein kann, aber im nächsten Moment kein Problem damit hat, dass Louise Philomena mitbringt, obwohl heute Montag ist und in einer Viertelstunde unser wöchentliches Teammeeting beginnt.
Coulter steht auf und hält den kreiselnden Stuhl an. »Hast du schon gefrühstückt, Philibuster?«
»Philomena«, korrigiert sie ihn und lacht. »Darf ich Badger füttern?«
»Die Nüsse sind im Küchenschrank«, sagt Louise, die normalerweise das Streifenhörnchen mit der ungewöhnlichen Färbung füttert. Dieser Besonderheit verdankt der Verlag seinen Namen.
»Hast du keine Angst, dass du dir Krankheiten einfängst?«, fragt Coulter. Er hält nichts davon, emotionale Beziehungen zu wilden Nagetieren aufzubauen. Oder zu Assistentinnen. Oder zu Sexualpartnerinnen.
»Bin doch schon krank«, erwidert Philomena triumphierend. Dann springt sie vom Stuhl und nimmt Coulters ausgestreckte Hand. Philomena muss das einzige Wesen auf der ganzen Welt sein, das Coulter mit klebrigen Fingern oder Kinderkrankheiten nahe kommen darf.
Louise zückt ihr Handy, um ihre Mom anzurufen, und ich folge Coulter und Philomena zur Küche, um mir endlich meinen ersten Kaffee zu genehmigen.
»Erst mal zum Organisatorischen.« Coulter hat gerade unser Meeting eröffnet. Philomena wurde von ihrer Grandma abgeholt, und wir haben uns alle bei unserer Sitzecke eingefunden. »Die meisten haben es schon mitbekommen, weil sie nicht gerade leise war, aber Mrs Pavlidis hat gekündigt und wird nicht mehr kommen.«
»Wie bitte?«, fragt Louise. »Wann ist das passiert?«
»Vorhin. Kurz bevor du eingetrudelt bist. Coulter und sie …«, setze ich an.
»Coulter? Ist das dein Ernst?« Sie funkelt ihn wütend an.
»Louise, sie hat immer wieder Grenzen überschritten.«
»Und wie sollen wir das auffangen? Ich bin schon am Anschlag, Coulter. Mit Phil und …«
»Niemand hat gesagt, dass du das auffangen sollst«, sagt Coulter. »Bash und ich haben die Sache im Griff, oder Bash?«
Das war ja klar. »Äh ja«, sage ich, obwohl ich nicht weiß, wie ich noch mehr arbeiten soll. Coulter hat, soweit ich weiß, ungefähr drei Wochenenden frei gehabt, seit wir Badger Books gegründet haben. Und Badger Books ist gerade zwei Jahre alt geworden. »Ich kümmere mich nach dem Meeting gleich um die Ausschreibung. Vikram, kannst du einen Text aufsetzen?«
»Klar«, sagt Vikram und schreibt es sich in sein Notizbuch.
Louise schüttelt dennoch den Kopf. Ich kann es verstehen. Coulter ist – obwohl verschlossen und eigenbrötlerisch – Teil von Badger Books. Und damit ist er Teil unserer Familie. So wie Philomena zwar Louise’ Tochter ist, aber Coulter und ich so was wie ihre Ersatzväter sind. Coulter, ich und Cy natürlich. Aber in Momenten wie diesen macht Coulter es uns wirklich nicht leicht.
»Und vielleicht schaust du mal, ob du jemanden findest, der die Tür repariert«, sage ich. »Also wenn du es zeitlich schaffst.«
Vikram nickt und macht sich eine weitere Notiz.
»Katie und ich sind Ende des Monats auf dem National Book Festival in D. C., wo zwei unserer Autoren an Diskussionspanels teilnehmen.« Coulter wechselt unsanft das Thema. »Außerdem liest Emerson Philby auf einer kleinen Bühne vorab aus seinem neuen Buch, und wir hoffen, dass die Druckerei es hinkriegt, ein paar Bücher für den Büchertisch vor dem offiziellen Verkaufsstart dorthin zu schicken.«
»Ich mache da heute noch mal Druck«, sagt Kwan. »Steht auf meiner Liste, aber vorhin ist niemand ans Telefon gegangen.«
»Ich habe tolle Neuigkeiten«, sagt Louise, die sich nach der Nachricht von Mrs Pavlidis’ Kündigung offenbar wieder gefangen hat. »Ariana Guidry ist für den Bookend Award vom Texas Book Festival nominiert. ›Für ihren herausragenden Beitrag zur texanischen Literatur.‹«
»Richtig stark!«, sagt Anna, und wir anderen klatschen.
»Hat noch jemand was Allgemeines?«, fragt Coulter. Alle schütteln ihre Köpfe. »Dann zu den Prüfmanuskripten. Was Interessantes dabei?«
»Ich habe bis um zwei Uhr nachts Quatsch gelesen«, sage ich. »Nichts dabei. Aber dafür … ja, ihr dürft mich auslachen … habe ich noch mal versucht, zu Jethro Kontakt aufzunehmen.«
Coulter stöhnt. Louise prustet leise.
»Bash, wir lieben dich. Ehrlich, Mann. Aber deine Fixierung auf diesen Typen macht mir Angst.«
»Das ist keine Fixierung. Ich wittere eine große Chance!«
»Ja, seit anderthalb Jahren. Aber der Typ will anonym bleiben. Warum sollte er ein Buch machen? Noch dazu mit uns, wo er doch wahrscheinlich Angebote von allen möglichen Großverlagen bekommt?«, fragt Louise.
»Erstens, weil wir ihm die Anonymität geben können, die er will. Und zweitens, weil nicht jeder ein Cy Bellamy ist.« Ich sollte das mit der Bitterkeit wirklich lassen, denn ich würde mein Debüt auch bei Random House bringen und nicht bei einem kleinen Verlag wie Badger Books, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte. Da fällt mir wieder ein, was ich gestern gelesen habe. »Apropos, in einem Forum geht das Gerücht, dass Jethro Cy Bellamy ist.«
»Es gibt für Leute wie dich Foren?«, fragt Coulter gespielt entsetzt. »Merkste selber, Bash, oder?«
»Was?« Louise prustet wieder und nimmt dankenswerterweise keine Notiz von Coulter. »Ja, sicher. Weil Cy aus L. A. nach Portland rüberjettet, um nachts ein Gedicht an eine Hauswand zu sprayen.«
»Ist er immer noch in Kalifornien?«, fragt Katie, die einen kleinen Crush auf Cy hat. Und auf Emerson Philby. Und auf Sid Barriero, wenn wir schon dabei sind. Und auf Jonathan Safran Foer.
»Ja, und er hasst es«, sagt Louise. »Hollywood ist nicht seine Welt.«
»Aber so eine Verfilmung ist doch ein absoluter Traum für einen jungen Autor«, sagt Katie und kann gerade so ein schmachtendes Seufzen unterdrücken.
»Also bist du zum hundertsten Mal super smooth in Jethros DMs geslidet?«, fragt Coulter, um zum eigentlichen Thema zurückzukehren, und sein Tonfall macht überdeutlich, was er von dieser Ausdrucksweise und Social Media im Allgemeinen hält.
»Ja«, gebe ich zu.
»Und was ist jetzt die Neuigkeit, außer, dass du deine Besessenheit noch mal auf eine neue Stufe der Traurigkeit gehoben hast?«
»Glaub mir, ich bin die Erste, die in Jubelstürme ausbricht, wenn Jethro ein Buch mit uns machen will«, sagt Louise. »Der große Street Poet unter Vertrag bei Badger Books. Wenn das im Newsletter von Publishers Weekly stünde … O Mann, ich würde ausrasten. Aber Bash, irgendwann musst du einsehen, dass du einem Phantom hinterherjagst.«
»›Jagst‹.« Coulter malt Anführungszeichen in die Luft. »In DMs sliden hat mit Jagen so viel zu tun wie Professionalität mit Mrs Pavlidis.«
Ich seufze. Vielleicht haben sie recht. Vielleicht bin ich wirklich zu fixiert auf diesen Street Poet. Vielleicht verschwende ich wirklich meine Zeit. Aber Gedichte, die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt begeistern, begeistern mich eben auch. Seine Messages, die Tatsache, dass er Lyrik auf die Straße bringt – indem er sie mithilfe von Schablonen auf Straßen und an Häuser sprayt … Vielleicht ist es auch zu groß, um es nicht immer wieder zu versuchen.
»Ich habe eine Kurzgeschichtensammlung von einem Schauspieler hier aus Maine«, meldet sich Katie zu Wort. »James Percival. Kennt den jemand?«
»Den Namen habe ich mal gehört«, sagt Louise. »Der hat einen Detective in einer Krimiserie Anfang der Zweitausender gespielt, oder?«
Katie blättert in ihren Unterlagen. »Maine Suspect, ja. Er kommt aus einem kleinen Fischerort. Deswegen geht es in seinem Buch viel um Natur und die Freiheit, die das Meer und die Luft und die Wälder einem geben. Vom Stil so ein bisschen Hemingway. Also was die Einsamkeit anbelangt, die über allem liegt.«
»Klingt ja spannend«, sagt Louise in ironischem Tonfall. Auf Hemingway reagiert sie allergisch.
»So ein richtiger Pageturner ist es nicht, aber das will es gar nicht sein. Eher eine zarte Liebeserklärung an Heimat und so. Und ich finde, es ist wirklich gut geschrieben.«
»Über wen kam das?«, fragt Coulter.
»Über eine Agentur, warte …« Wieder blättert sie. »Camille Ives von Encore Artists.«
»Nie gehört.«
»Es ist keine Literaturagentur, sondern eine Künstleragentur. Deswegen vertreten sie auch Schauspieler wie diesen Percival oder Singer/Songwriter, Street Artists …«
»Kennt man jemanden?«, frage ich. »Ist das für uns vielleicht ein spannender Kontakt?« Mit einem Blick zu Louise füge ich hinzu: »Auch abseits des Möchtegern-Hemingway?«
Vikram tippt etwas in sein Tablet ein. Dann liest er: »Als Künstleragentur vertreten wir Schauspielerinnen und Schauspieler, Musikerinnen und Musiker sowie Street Artists und viele mehr. Zu unseren bekanntesten Klientinnen und Klienten zählen James Percival, Liza Mendez, Anthony Cubbard, BIGboy77 oder The Vault.«
»Mit diesem Percival haben sie es ja echt«, sagt Coulter.
»Vielleicht will jemand von euch mal reinlesen?«, fragt Katie. »Ich glaube wirklich, es könnte was für uns sein.«
»Louise ist raus«, sagt Coulter und grinst beim Anblick von Louise, die heftig den Kopf schüttelt.
»Willst du das dann übernehmen, Coulter? Abwechslung von den Verträgen?«, frage ich.
»Ehrlich gesagt, nein. Ich glaube nicht an diesen Percival und schon gar nicht an Kurzgeschichten – sorry, Katie.«
»Alles gut.«
»Ich finde nicht, dass wir es uns leisten können, einen potenziell interessanten Kontakt einfach so abzusagen.« Auch wenn das Buch vielleicht nichts für uns ist.
»Na, dann ist doch alles klar. Bash kümmert sich um Camilla Ives.«
»Camille«, korrigiert Katie. »Soll ich dir Exposé und Leseprobe schicken, Bash?«
Eigentlich habe ich keine Zeit. Mein Blick trifft auf Louise’ Blick. Sie sieht mich streng an, weil sie weiß, dass ich zu viel zu tun habe. Aber dann zuckt sie resigniert mit den Schultern, als würde sie sagen: Du machst ja ohnehin, was du willst.
»Ich kann gern reinlesen«, sage ich und schiebe in Gedanken Aufgaben herum, um Platz zu schaffen für Camille Ives.
Kurz darauf lösen wir das Meeting auf. Zurück an meinem Schreibtisch öffne ich meine Mails. Katie hat mir bereits das Kurzgeschichtenprojekt weitergeleitet. Die Agentin eines Autors, den ich gern zu Badger Books geholt hätte, sagt, dass sie leider ein anderes Angebot angenommen haben. Ich seufze, und als Übersprunghandlung greife ich zu meinem Handy, gehe auf Instagram und öffne die Nachricht an Jethro. Doch er hat sie natürlich nicht gesehen.
4
Camille
»Und wie geht es ihr?«, frage ich. Es ist früh morgens, ich mache mich gerade für die Arbeit fertig. Aber weil mich meine Chefin Nina gestern Abend auf das Konzert einer Folksängerin geschickt hat, die wir unter Vertrag nehmen wollen, habe ich es nicht geschafft, meine Mom anzurufen, wie ich es eigentlich jeden Mittwochabend tue.
Ich würde gern ihren Namen sagen, den Namen meiner Schwester. Aber die zwei Silben fühlen sich auch nach all den Jahren schwer an. Nicht schwierig, sondern buchstäblich schwer. Als könnten meine Lippen, meine Zunge, mein Kiefer nicht die Kraft aufbringen, Ma und ra aneinanderzureihen. Ma-ra. Mara.
Mom räuspert sich, was durch meine billigen Kopfhörer leicht scheppernd klingt. Ich weiß, dass sie sich nichts sehnlicher wünscht, als dass wir wieder eine Familie sind. Mara und ich und sie. Es war hart genug für sie, Dad zu verlieren. Dass sie sich seit sieben Jahren zwischen Mara und mir entscheiden muss, ist ziemlich unerträglich für sie. Aber die Dinge sind, wie sie sind. Auch wenn es wehtut. Ob es ihr auch wehtut? Ma-ra? Mara?
»Gut, gut.« Das sagt Mom immer. Immer geht es ihr gut, gut.
Obwohl ich nicht erwarte, etwas über sie zu erfahren, sticht es dennoch jedes Mal ein bisschen, wenn Mom bei dem Thema abblockt. Seufzend nehme ich ein Kostüm von der Kleiderstange und lege es auf mein Bett. Ich fahre mit der Hand einmal über den leicht rauen Stoff, dann schlüpfe ich in ein einfaches weißes T-Shirt, steige in den knielangen Rock. Schließlich ziehe ich mir das Jackett über. Es ist meine Agentinnenrüstung. Wenn ich professionell aussehe, kann ich Camille Ives, Künstleragentin, sein. In ihre Rolle schlüpfen. Eine Rolle, die ich selbst sein sollte.
Ich atme tief ein, denn nun muss ich doch in den Spiegel sehen, um sicherzugehen, dass ich dieser Rolle auch gerecht werde. Ich schließe die Augen, positioniere mich, straffe die Schultern. Dann …
Ich schlucke. Ich sehe mich. Ich sehe auch sie. Aber so ein Kostüm hat Mara nie getragen. Mara hatte farbenfrohe, modische Klamotten, die allesamt umwerfend an ihr aussahen. Deswegen ist das hier einfacher.
Ich fasse meine dunkelbraunen langen Haare zusammen, drehe sie ein und halte sie, als würde ich sie hochstecken. Doch ich entscheide mich dagegen und lasse sie wieder über meine Schultern fallen. Ich wiege den Kopf, versuche mich an einem Lächeln, dann an einem ernsten Blick.
Nachdem ich mich von allen Seiten betrachtet habe, bin ich einigermaßen zufrieden. Ich sehe aus wie Camille Ives, Künstleragentin. Und die bin ich wohl.
»Und bei dir, Liebes?«, fragt Mom. »Was gibt’s bei dir Neues zu erzählen?«
»Bei mir ist alles wie immer. Du kennst mich doch.« Ich sage das, als wäre es das Natürlichste der Welt. Aber wenn man sich selbst nicht kennt, kann man eigentlich nicht erwarten, dass andere es tun. »Ich arbeite viel, aber es läuft wirklich gut. Ich versuche gerade, für einen Schauspieler einen Buchdeal klarzumachen, und nehme eine neue Sängerin unter Vertrag.«
»Ich bin so stolz auf dich«, sagt Mom, und ich glaube es ihr, auch wenn es sich anfühlt, als wäre sie auf eine Hülle stolz.
»Danke, Mom, das bedeutet mir viel.« Es sind einfach nur leere Worthülsen. Als hätten wir seit dem Abend vor sieben Jahren keine Sprache mehr. Manchmal ist es besser, aber heute – vielleicht, weil ich von unserer Routine abgewichen bin – ist es schwierig, ein Gespräch zu führen.
Mein Blick fällt auf die gegenüberliegende Wand meines Einzimmerapartments. Dort, wo neben dem Futon, der auf dem Boden liegt, Postkarten an der Wand hängen. Die einzige Dekoration in meinem spartanisch eingerichteten Zimmer, als wäre jede Annehmlichkeit, jeder Schmuck zu viel. Eine der Karten zeigt das Foto eines Jethro-Gedichts.
Der grelle Lärm
meines Schweigens
erstickt die Worte,
die zu sagen
ich nicht imstande bin.
Für ein paar Wochen prangte es mitten auf der Kreuzung Union Street/Fore Street, sodass von morgens bis abends Autos darüberfuhren, bis die Schrift wieder weg war. Ich fand das clever, denn viel effektiver kann man Missachtung nicht illustrieren.
Das Gedicht lebt trotzdem weiter. In den sozialen Medien, an meiner Wand. Und es fühlt sich passend an, dazu einzuschlafen und dazu aufzuwachen und in Momenten wie diesen an den Sinngehalt erinnert zu werden. Es ist mit ein Grund, warum ich das Gespräch jedes Mal auf sie bringe. Auf Ma-ra. Auf Mara. Meine Zwillingsschwester. Mit der ich alles geteilt habe. Hoffnungen, Träume, Tagebücher, Klamotten, Identitäten. Wenn sie nicht genug gelernt hatte beispielsweise oder wenn … Der Gedanke bricht ab. Selbstschutz nennt man das wohl. Oder Selbstverleugnung.
»Es ist einfach ein schönes Gefühl, zu wissen, dass man sich um euch keine Sorgen mehr machen muss, weißt du?«, sagt Mom jetzt. »Finanziell, meine ich.«