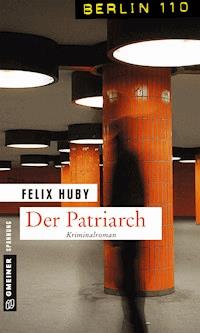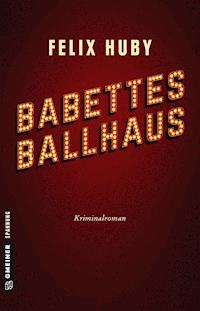Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Peter Heiland
- Sprache: Deutsch
Eine solche Anschlagserie hat es in Berlin noch nicht gegeben. Der Täter muss ein Karatekämpfer sein - mit einem gezielten Handkantenschlag schickt er seine Opfer nachts in den Berliner Parkanlagen in eine lange Ohnmacht. Er bringt sie nicht um und raubt sie auch nicht aus. Als ein weiterer Überfall tödlich endet, ist erneut kein Motiv zu erkennen. Erst als Kommissar Peter Heiland gewisse Zusammenhänge zwischen den Opfern herstellen kann, kommt ein wenig Licht in die düsteren Ereignisse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Felix Huby
Wut
Kriminalroman
Impressum
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Babettes Ballhaus (2018), Bienzle und der Terrorist (2017),
Bienzle und der Tod im Tauerntunnel (2017),
Heiland (2017), Der Patriarch (2016),
»Nichts ist so fein gesponnen – Kriminalgeschichten aus erlesener Feder«, (hrsg. mit Horst Bosetzky 2011), Kurzgeschichte »Mord auf der Mettnau« in »Gefährliche Nachbarn« (2009)
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2019
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Africa Studio / stock.adobe.com
Druck: GGP Media GmbH, Pößneck
Printed in Germany
ISBN 978-3-8392-6122-4
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
1 VON PERSON BEKANNT
»Dass es so anstrengend werden würde, hätte ich nicht gedacht.« Hanna Heiland wischte sich mit ihrem Handtuch den Schweiß von der Stirn. Sie saß auf der schmalen Lattenbank in der Damengarderobe des Fitness- und Karateklubs K2 und lehnte sich erschöpft gegen den Spind zurück, in dem ihre Kleider hingen.
Die Frau, zu der sie das sagte, antwortete nicht. Sie war schon unter der Dusche gewesen. Jetzt ließ sie das große Badetuch fallen, das sie um ihren sehnigen Körper geschlagen hatte, und zog sich rasch an.
»Sie machen das schon länger, nicht wahr?«, fragte Hanna.
»Wir duzen uns hier«, kam die knappe Antwort.
»Okay. Wusste ich nicht. Ich heiße Hanna.«
»Louisa!« Die andere fuhr sich mit einer Bürste durch ihre nassen Haare. Sie sah dabei nicht in den Spiegel, wie das vermutlich jede andere Frau getan hätte. Ohne sich noch einmal umzudrehen, warf sie ihren Rucksack über die Schulter und verließ wortlos den Raum.
Während des Trainings hatte Hanna Heiland Louisa immer wieder beobachtet. Sie wirkte perfekt auf sie. Kräftig und geschmeidig zugleich und total auf die Übungen konzentriert. Als Einzige redete sie nicht, lachte nie, wenn die anderen lachten, gab auch keine Schreie von sich, wenn sie zuschlug.
Hanna gab sich einen Ruck, stand auf und öffnete den Spind. Sie holte ein zweites Handtuch heraus und verschwand in dem gekachelten Duschraum. Dort traf sie auf drei andere Klubmitglieder. »Ich bin Hanna«, sagte sie, »ich hab gehört, wir duzen uns hier.«
»Ja klar«, rief eine der anderen Frauen, »ich bin Kathrin.«
»Loreen« und »Stefanie«, stellten sich die anderen beiden vor.
»Und, wie hat’s dir gefallen?«, fragte Kathrin.
»Ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig.«
»Aber total in«, rief Stefanie. »Wird Zeit, dass wir Frauen lernen, uns zu wehren.«
»Es gibt auch noch andere Gründe«, sagte Loreen, »ich war oft unheimlich schlecht drauf: aggressiv, immer sofort auf 180. Viele Leute denken ja, Karate mache aggressiv, aber das Gegenteil ist der Fall. Es beruhigt einen eher. Mich wenigstens.«
»Na, ich weiß nicht«, rief Stefanie, und ihre beiden Kameradinnen lachten.
»Doch! Wenn ich’s doch sage! Dieser Wechsel aus Anspannung und Entspannung, diese Kombination aus Dynamik und Disziplin …«
Wieder lachten die anderen. »Niemand kann besser über Karate reden als Loreen«, rief Stefanie.
Kathrin demonstrierte ein paar der Übungen, was besonders apart wirkte, weil sie es nackt unter der Dusche tat. »Also ich mach vor allem wegen der Schönheit der Bewegungen hier mit.«
»Ich finde, Karate schärft den Blick für gefährliche Situationen«, meldete sich Stefanie wieder. »Es ist so wichtig, sich nicht unterkriegen zu lassen.«
»Genau deshalb bin ich da!«, gab Hanna zurück.
Das war allerdings nicht die ganze Wahrheit. Hanna war auf Geheiß ihres Chefs in den Klub eingetreten. Seit einem halben Jahr arbeitete sie in der Abteilung »Rauschgift« des Berliner Landeskriminalamts. In der 4. Mordkommission hatte sie nach ihrer Heirat mit Peter Heiland, der die Abteilung leitete, nicht bleiben können.
Eigentlich hatte sich Hanna auf den Wechsel gefreut. Aber sie hatte nicht damit gerechnet, in eine Abteilung zu geraten, in der es so unpersönlich zuging. Der Chef, Axel Rottmann, legte Wert darauf, zwischen sich und den Mitarbeitern, aber auch unter den Kollegen untereinander, eine größtmögliche Distanz zu halten. Er hasste nichts mehr als kumpelhafte Vertrautheit, und wo sie dann doch einmal entstand, empfand er sie sofort als gegen sich gerichtet. Peter, der Rottmann von den Abteilungsleitersitzungen kannte, hatte Hanna einmal erklärt: »Der Mann muss voller Angst sein. Überall wittert er Konkurrenz und Gegnerschaft. Aber seine Abteilung arbeitet effizient, das muss man ihm lassen.«
Der Fitness- und Karateklub K2 stand schon seit Längerem unter dem Verdacht, dass in seinen Anlagen heimlich Doping- und Anabolikamittel vertrieben würden. Aber die bisherigen Ermittlungsergebnisse waren ergebnislos verlaufen. Als Rottmann eines Tages fragte, wer es sich zutraue, in den Klub einzutreten, um undercover zu ermitteln, hatte sich Hanna ohne langes Zögern gemeldet.
Kathrin, Laureen und Stefanie zogen gemeinsam los. Ihr Angebot, sie solle doch mitkommen, lehnte Hanna ab, versprach aber, das nächste Mal unbedingt dabei zu sein. Bewusst hatte sie so lange getrödelt, dass sie erst halb fertig war, als die drei anderen gingen.
Die Umkleideräume lagen nun leer da. Von der Halle, wo jetzt die Männer trainierten, drangen gelegentlich Schreie herüber. Vorsichtig stieß Hanna die Tür zur Herrenumkleide auf. Hier roch es viel intensiver nach Schweiß als drüben bei den Frauen. Seltsamerweise waren auch alle Fenster geschlossen. Auf den Bänken lagen verstreut die Kleider der Sportler. Sie machten sich offenbar nicht die Mühe, die Schränke zu benutzen.
Am Ende der Spindreihe stand ein Papierkorb aus Metall, dessen Inhalt überquoll. Hanna zog ihre Latexhandschuhe an und begann, ihn zu durchsuchen. Immer wieder hob sie den Kopf und horchte. Es dauerte nicht lange, da hatte sie die erste Spritzenampulle in der Hand. Zwei weitere fand sie am Boden des Korbs. Sie stopfte die Getränkedosen, Papiertücher und offenbar abgelegten Socken zurück und verließ auf Zehenspitzen den Umkleideraum.
Als sie vor dem Klub auf die Straße trat, blieb sie stehen und wendete sich noch einmal dem zweistöckigen grauen Gebäude zu, einem lang gezogenen Betonkasten. Im Erdgeschoss befanden sich die Fitnessräume mit allen möglichen Geräten für Kraft- und Ausdauertraining. Gleich hinter der Eingangstür lagen der Empfang und eine kleine Bar. Im oberen Stockwerk nahm die große Trainingshalle für die Karatesportler fast den ganzen Raum ein. Dort befanden sich außerdem die Dusch- und Umkleideräume.
Über der Stadt lag schon seit Tagen eine graue Wolkendecke. Ständig schien es, als kündige sich Regen an, aber seit Mitte März war kein Tropfen gefallen, und heute schrieb man den 10. Juni. In den Wäldern rund um Berlin herrschte höchste Waldbrandgefahr. Viele Pflanzen drohten zu verdorren. Die Wiesen verfärbten sich nach und nach von Grün in Gelb. Oft war es schwül, aber auf das erlösende Gewitter warteten die Menschen vergeblich.
Um 9 Uhr wollte Peter sie abholen. Das Areal am Salzufer lag leer und verlassen da. Graue, gesichtslose Gebäude, die meisten sechs bis acht Stockwerke hoch, reihten sich aneinander – Blöcke aus Beton, Stahl und Glas. Die schmalen Gassen dazwischen wirkten wie Schluchten, in die die Abenddämmerung kroch.
Hanna war noch keine zehn Schritte gegangen, da erfasste sie das grelle Licht aufgeblendeter Autoscheinwerfer. Eine große Limousine schoss auf sie zu und sehr knapp an ihr vorbei: Weißer BMW, registrierte sie und merkte sich die Nummer: B-QR 7210 – ein beruflicher Reflex. Der Fahrer musste einen Schlüssel zum Eingangstor des Geländes haben, war also vermutlich hier beschäftigt. Er stoppte vor dem Karateklub. Ein Mann in einem weißen Anzug sprang aus dem Auto und rannte eilig in das Gebäude hinein. Hanna wendete sich ab und ging mit schnellen Schritten weiter durch die dunkle Gasse.
Peter Heiland wartete schon seit einer Viertelstunde auf seine Frau. Er hatte seit Kindertagen die Angewohnheit, überpünktlich zu sein. »Des klugen Menschen Pünktlichkeit ist fünf Minuten vor der Zeit«, lautete einer der vielen Sprüche, die ihm sein Großvater Heinrich eingetrichtert hatte. Manchmal entdeckte Peter sich dabei, dass er sie gegenüber seinem Sohn Heinrich genauso verwendete wie einst dessen gleichnamiger Opa bei ihm. »Schmieren und Salben hilft allenthalben« zum Beispiel oder »man kann net alle Berg eben machen«. Einen anderen Spruch bezog der alte Heinrich Heiland meist auf sich selbst: »Aus einem krummen Holz machst du kein Lineal!«
Peters Großvater hatte seinen Enkel alleine aufgezogen, nachdem dessen Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen waren und seine Frau viel zu früh gestorben war. Bis heute verband die beiden ein inniges Verhältnis.
Hanna ließ sich auf den Beifahrersitz fallen. »Da hab ich mich ja vielleicht auf was eingelassen.«
Peter beugte sich zu ihr hinüber und küsste sie. »Guten Abend, erst mal! Charlotte übernachtet heute bei uns, wir haben also frei. Wo wollen wir hingehen?«
Charlotte Heinz betreute als Tagesmutter den kleinen Heinrich und war eine gute Freundin.
»Mir ist nach indischem Essen«, gab Hanna zurück. »Wie wär’s mit dem ›Masala‹ in der Friedbergstraße?«
»Wunderbar! Es ist auch nicht zu weit.« Peter wendete den Wagen und steuerte ihn am Landwehrkanal entlang bis zur Dovenbrücke. Hanna zog ihr Telefon aus der Tasche und wählte eine Nummer.
Peter sah zu ihr hinüber. »Arbeit oder privat?«
»Dienstlich«, antwortete Hanna und sprach dann ins Telefon: »Ich bin’s, Hanna Heiland. Kannst du mir bitte den Besitzer eines KFZ durchgeben? Kennzeichen B-QR 7210. Ja, verstehe. Ruf mich bitte zurück.«
Hanna schüttelte nur den Kopf. »Der Michel müsste mich doch an der Stimme erkennen. Warum muss er zur Sicherheit zurückrufen?«
»Vorschrift!«, sagte Peter knapp. »Den BMW habe ich auch gesehen. Er ist aufs Gelände gefahren, kurz bevor du gekommen bist. Ist was passiert?«
»Warte!« Hannas Handy klingelte. »Ja, Michel?«, sagte sie ins Telefon. »Augenblick, ich bin gleich so weit …«, sie zog ein Notizblöckchen und einen Stift aus der Tasche, »so, jetzt kann’s losgehen.« Hanna wiederholte, was sie mitschrieb. »Doktor Kai Leibrand, Wundtstraße 168. Rechtsanwalt.«
Peter hatte aufmerksam zugehört. »Von Person bekannt«, sagte er.
Hanna legte auf und sah ihn fragend an. »Er hat schon in einigen Prozessen gegen die russische Mafia die Angeklagten vertreten. Neuerdings vertritt er diesen libanesischen Familienclan, der in Berlin 77 Wohneinheiten besitzt. Vermutlich alles Objekte, die per Geldwäsche finanziert wurden. Der Mann ist mit allen Wassern gewaschen. Und weißt du, was mein Opa immer gesagt hat? ›Wer mit allen Wassern gewaschen ist, kann nicht ganz sauber sein.‹«
Ein paar Gäste saßen auf der Terrasse vor dem indischen Restaurant. Hanna und Peter beschlossen, im Lokal zu Essen, und fanden einen Tisch nahe der Theke. Der Kellner empfahl ihnen als Vorspeise Paneer Paapri Chat und als Hauptgericht Ente Curry, und wie immer folgten sie seinem Vorschlag.
Die beiden hatten ein Abkommen: Beim Essen und beim abendlichen Wein zu Hause durfte nicht über dienstliche Angelegenheiten geredet werden.
Hanna erzählte von ihrem ersten Karatetraining. »Zuerst hatten wir eine Demonstration. Ein japanischer Karatemeister zelebrierte … – ja, man muss wirklich so sagen, er zelebrierte die wichtigsten Bewegungen. Es geht nämlich nicht um Kampf, habe ich gleich gelernt, sondern nur um die Bewegungen und Schläge, die im Kampf eingesetzt werden könnten.«
»Und wie merkt man dann, wer gewonnen hat?«, wollte Peter wissen.
»Bei Wettbewerben gib es vier Seitenrichter und einen Mattenrichter. Die vergeben Punkte. Eigentlich ist das wie beim Eiskunstlauf oder beim Wasserkunstspringen.«
»Und was für Bewegungen sind das?«
»Mach ich dir demnächst mal vor. Sie sind unheimlich schnell. Man kann sie kaum mit den Augen verfolgen. Der Japaner trug nicht den weißen Anzug wie wir alle, sondern ein Gewand mit einer weiten, rockartigen Hose, das ihn sehr elegant umflossen hat. Bei einem seitlichen Fußstoß zum Beispiel stand sein Fuß schon lange wieder auf der Erde, ehe das Kleidungsstück zurückgeflossen war. Faszinierend! Einfach faszinierend!«
»Na, nu krieg dich mal wieder ein. Möchtest du noch einen Nachtisch?«
Der Kellner empfahl »unsere köstliche Eisschokolade, genau das Richtige bei diesen Temperaturen.«
Als sie auch diese verspeist hatten, konnte Hanna endlich auf das Dienstliche kommen: »Ich hab drei Ampullen gefunden. Die muss ich gleich morgen früh ins Labor bringen.«
Bevor Peter antworten konnte, meldete sich sein Telefon. »Ich hätte es ausschalten sollen«, stöhnte er, als er auf dem Display erkannte, dass es ein Rundruf war. »Jemand in der Nähe vom Lietzensee?«, stand da. Das waren sie unbestreitbar. Er gab ihre Position durch und nahm die genaue Beschreibung des Tatortes auf. Ein Anrufer bei der Polizei hatte einen leblosen Mann entdeckt.
Peter zahlte rasch. Sie fuhren die paar Hundert Meter zum Lietzensee. Er parkte das Auto auf dem breiten Gehsteig und rannte voraus den Asphaltweg hinab in den Park am Wasser.
Ein Mann winkte wild mit seinem Spazierstock und rief: »Hierher!« Er stand neben einem großen Busch und zeigte mit seinem Stock auf den Boden. Mit der anderen Hand hielt er seinen Hund an der Leine, der Peter gefährlich knurrend anspringen wollte.
»Haben Sie sich bei der Polizei gemeldet?«, fragte Heiland.
»Nein. Ich hab gar kein Handy mit. Haben Sie eins? Wir müssen sofort anrufen.«
»Dann muss es wer anders gewesen sein«, sagte Peter Heiland und zeigte seinen Polizeiausweis. »Heiland, Landeskriminalamt.«
»Ich bin grade erst gekommen«, sagte der Mann mit dem Hund, als ob er sich entschuldigen müsste.
Peter ging auf die Knie. Er fasste nach der Schulter des Mannes, der mit dem Gesicht nach unten halb unter dem Gebüsch lag. Vorsichtig drehte der Kommissar den Verletzten auf den Rücken. Sein weißer Anzug war voller trockener Blätter und kleiner Reisigzweige. Aus seiner Nase floss Blut. Jetzt gab er ein leises Stöhnen von sich.
Hanna war inzwischen auch herangekommen und – ganz anders als Peter – von dem Hund freundlich empfangen worden, den sie nun hinter den Ohren kraulte. Peter sah zu ihr auf, nickte zu dem am Boden liegenden Mann hin und sagte: »Von Person bekannt. Doktor Kai Leibrand, Rechtsanwalt.«
Ein Polizeiwagen näherte sich mit Blaulicht und Martinshorn. Und aus einem direkt folgenden Dienstwagen der Kriminalpolizei stiegen Peters Kollegen Jenny Kreuters und Carl Finkbeiner, die Nachtdienst hatten.
Peter hatte inzwischen vorsichtig die Taschen des Opfers durchsucht. Er fand kein Portemonnaie und kein Handy, aber die Brieftasche steckte in der Innenseite des weißen Jacketts. Sie enthielt Ausweis, Führerschein, Fahrzeugpapiere und eine ganze Reihe Kreditkarten.
»Die Spurensicherung muss gleich da sein«, sagte Carl Finkbeiner.
Peter erhob sich. »Okay, ich hab dienstfrei. Dann bis morgen. Der Mann hier ist Doktor Kai Leibrand, der Rechtsanwalt.«
»Echt jetzt?«, fragte Jenny Kreuters. »Ich hab ihn nicht wiedererkannt.«
»Ist ja auch verdammt dunkel hier. Außerdem ist sein Gesicht ziemlich verunstaltet.« Peter nahm Hanna an der Hand und die beiden gingen rasch davon.
Jenny Kreuters sah ihnen nach und sagte leise: »Beneidenswert!«
»Was hast du gesagt?«, fragte ihr Kollege.
»Nichts! Nichts von Bedeutung.«
Die Beamten der Spurensicherung kamen und stellten Scheinwerfer auf. Gleißendes Licht erhellte den Tatort.
Carl Finkbeiner wendete sich dem Hundebesitzer zu, der seine Rolle offensichtlich genoss. Die ganze Zeit war er an derselben Stelle stehen geblieben und hatte alles mit wachsamen Augen verfolgt.
»Haben Sie denn irgendetwas Ungewöhnliches bemerkt?«
»Nein. Aber weit wird man nicht suchen müssen. Da drüben«, er zeigte mit seinem Stock zu einer Baumgruppe auf der gegenüberliegenden Seite des Lietzensees hinüber, »… das sind ganz gefährliche Typen. Die lungern da jeden Abend bis weit nach Mitternacht herum. Marokkaner, Iraker und was weiß ich. Auch ein paar Deutsche drunter. Gesocks halt. Zu faul zum Arbeiten. Liegen uns auf der Tasche und lassen sich ihren Suff vom Staat bezahlen.«
»Danke!«, sagte Carl Finkbeiner. Er schenkte es sich, auf die Tiraden des Spaziergängers einzugehen. Als Jenny Luft holte, um dem Mann zu antworten, sagte Carl schnell. »Ja, dann schauen wir uns die mal an. Solange die Kollegen der Spurensicherung arbeiten, stören wir hier nur. Sie übrigens auch«, wendete er sich noch einmal an den Mann mit dem Hund und sagte dann zu einem Kollegen von der Schutzpolizei: »Nehmen Sie bitte die Personalien des Herrn auf. Danach kann er nach Hause gehen.«
Jenny Kreuters und Carl Finkbeiner umrundeten den See und trafen am Ufer auf der anderen Seite auf eine Gruppe Jugendlicher. Jenny zählte sie rasch durch und kam genau auf ein Dutzend, fünf waren Mädchen. Die jungen Leute bemerkten die Beamten nicht gleich. Sie hoben ihre Bierflaschen und riefen wie aus einem Mund: »Auf Nobby, den edlen Spender.«
Nachdem sie getrunken hatten, rief ein Mädchen: »Los, wir ziehen in die ›Xeniabar‹. Nobby hält uns frei.« Und dann direkt zu einem der jungen Männer: »Du hast doch noch genug von der Kohle?«
»Sicher! Klar!«, rief der.
»Fragt sich bloß, woher«, sagte Finkbeiner in seinem gemütlichen schwäbelnden Ton und trat mitten zwischen die Jugendlichen.
»Hey, was soll denn das, Alter?«, schrie einer und ging drohend auf Finkbeiner zu. Carl blieb ganz ruhig. Er zog seinen Polizeiausweis heraus und hob ihn hoch. »Hauptkommissar Finkbeiner, Landeskriminalamt, 4. Mordkommission. Und die junge Frau dort drüben, die zur Sicherheit schon mal ihre Dienstpistole gezogen hat, ist meine Kollegin Kreuters.« Er lächelte. »Ich habe übrigens die gleiche Waffe. Und jetzt zur Sache, Nobby.« Er ging auf den Mann zu, den die anderen gerade noch hatten hochleben lassen, zog nun ebenfalls seine Pistole, und während er sie in der rechten Hand hielt, durchsuchte er ihn blitzschnell mit der linken, zog ein Portemonnaie aus der Backentasche seiner Jeans und ein Handy aus der linken Hosentasche.
Die anderen Jugendlichen verhielten sich erstaunlich ruhig. Wie gelähmt standen sie da und sahen zu. Finkbeiner klappte den Geldbeutel auf und zog eine Visitenkarte heraus. »Doktor Kai Leibrand«, las er laut. »So heißen Sie nicht, oder, Nobby?«
Der Junge schüttelte den Kopf.
»Sondern wie?«
»Norbert Kleindienst«, antwortete der brav.
»Herr Leibrand wurde brutal niedergeschlagen. Er wird es vermutlich nicht überleben. Dann ist es Mord«, sagte Carl Finkbeiner, schob seine Waffe zurück ins Holster und versenkte das Portemonnaie und das Handy in einem Plastikbeutel.
»He«, rief Nobby, »das Handy ist meins.«
Finkbeiner schaltete das Telefon aus und nach ein paar Sekunden wieder ein. »Die PIN?«
Der Junge ratterte die Zahl herunter und der Kommissar tippte sie ein.
Das Display leuchtete auf.
Finkbeiner gab Nobby sein Telefon zurück.
Der nahm es entgegen und sagte trotzig: »Ich hab den nicht niedergeschlagen.«
Carl Finkbeiner lachte nur auf.
»Ehrlich. Der lag da schon. Ich hab versucht, ihm zu helfen, aber es sah aus, als wär er schon hin. Und da hab ich den Geldbeutel genommen. Und ich hab dann gleich von meinem Handy die Bull… – ich meine die Polizei angerufen. Danach bin ich abgehauen und hab hier meine Kumpels getroffen.«
»Das stimmt«, rief ein Mädchen, »der Nobby kann doch nicht mal ’ner Fliege … – wie heißt das?«
»Nicht mal einer Fliege was zuleide tun«, half Jenny Kreuters aus, nahm ihr Telefon, wählte und sagte: »Jenny Kreuters hier. Habt ihr die Nummer des Handys, von dem aus der Überfall gemeldet wurde?«
Alle starrten zu ihr herüber.
»Danke«, sagte Jenny, wählte erneut eine Nummer auf ihrem Mobiltelefon, und zwei Sekunden später meldete sich das Gerät, das Finkbeiner in den Plastikbeutel gesteckt hatte.
»Ganz schön raffiniert«, sagte der, »erst einen Mann zusammenschlagen, ausrauben und dann gleich die Polizei anrufen.« Er musterte Norbert Kleindienst. Der war nicht sehr groß, 1,70 vielleicht, und ziemlich dünn. Dass er die Kraft hatte, einen hoch gewachsenen, kräftig gebauten Mann wie Leibrand niederzuschlagen, bezweifelte der Kommissar im Stillen.
»Ich sag doch, der lag da schon«, meldete sich nun Nobby wieder. »Das müssen Sie mir glauben.«
Auf dem Rundweg näherten sich mehrere uniformierte Polizisten.
»Ich muss Ihnen das nicht glauben, ich muss es beweisen«, sagte Carl Finkbeiner in ruhigem Ton. »So ist das bei uns. Tut mir leid. Wir müssen Sie vorläufig festnehmen.«
Die Umstehenden protestierten nur halbherzig.
Einer der Schutzpolizisten trat zu Nobby: »Kommen Sie bitte?«
Norbert Kleindienst ging gehorsam mit.
»Wir sind nicht so, wie Sie denken«, sagte ein dunkelhäutiger Mann, der etwas älter als die anderen zu sein schien. »Wir saufen nicht, Drogen gibt’s bei uns auch keine. Und manche haben sogar einen Job.« Ein leichter Sarkasmus lag in seinem Ton.
»Mag sein«, sagte Finkbeiner. »Trotzdem muss ich meine Kollegen bitten, die Personalien von Ihnen allen aufzunehmen.«
Kai Leibrand wurde ins Martin-Luther-Krankenhaus an der Caspar-Theyß-Straße gebracht. Es war Dienstagabend, kurz vor Mitternacht. Am frühen Mittwochmorgen kam er zu Bewusstsein. Der diensthabende Arzt unterrichtete den Polizeibeamten, der im Korridor vor dem Krankenzimmer Wache hielt, und der fragte, ob der Patient denn schon vernehmungsfähig sei. »Ich denke ja«, antwortete der Mediziner. Daraufhin gab es der Polizist an die zuständige 4. Mordkommission durch.
Gegen 10 Uhr stieg Peter Heiland in der Caspar-Theyß-Straße aus seinem Dienstwagen. Er warf einen Blick zum Himmel. Noch immer lastete die graue Wolkendecke über der Stadt, und die Hitze war unerträglich. Heiland betrat das Martin-Luther-Krankenhaus, wies sich am Empfang aus, und ein Pfleger brachte ihn in den zweiten Stock.
Leibrand sah dem Kommissar entgegen. »Kennen wir uns?«, fragte er mit leiser, rauer Stimme, nachdem Peter ihn mit einem freundlichen »Grüß Gott, Herr Doktor Leibrand« begrüßt hatte.
»Ja, wir sind uns schon zwei Mal begegnet. Hauptkommissar Heiland. Aber Sie müssen sich nicht erinnern. Ich hab damals keine wichtige Rolle gespielt.« Peter zog einen Stuhl neben das Bett, setzte sich und sah den Patienten an. Ein Verband lief um seinen Kopf. »Ich freue mich, dass es Ihnen offenbar schon wieder ganz gut geht.«
»Ich hab eine Bärennatur, sagen die Ärzte.« Leibrand richtete sich ein bisschen in den Kissen auf. »Hätte freilich schlimmer ausgehen können. Nur meine Nase ist gebrochen, und ich kriege noch schwer Luft. Dazu kommt eine Gehirnerschütterung.«
»Erinnern Sie sich denn, wie es passiert ist?«
»Es ging alles so schnell. Der Angriff kam von hinten. Ich wurde geschlagen. Hier hin, wenn ich mich recht erinnere.« Er zeigte auf die rechte Seite seines Halses. »Ich stürzte nach vorne und fiel aufs Gesicht. Zum Glück war da weiche Erde. Nicht auszudenken, wenn da ein Stein gewesen wäre. Der Angreifer muss meinen Kopf noch mehrfach auf den Boden geschlagen haben.«
»Wir haben Ihr Portemonnaie bei einem Jugendlichen gefunden.«
»Und mein Handy, nehme ich an.«
»Nein, er hatte nur sein eigenes Handy bei sich.«
»Auf jeden Fall fehlt meins.«
Peter Heiland machte sich eine Notiz. »Der junge Mann behauptet, er habe Sie bewusstlos gefunden und sich nur das Geld unter den Nagel gerissen. Er war es dann auch, der die Polizei angerufen hat.«
»Ein Jugendlicher?«
»Ja, offenbar gehört er zu einer Gruppe, die sich regelmäßig am Lietzensee trifft.«
»Ach die! Ich gehe fast jeden Abend diesen Weg. Er ist der kürzeste zwischen meinem Büro in der Neuen Kantstraße und meiner Wohnung in der Wundtstraße. Ich kenne die jungen Leute, die da abhängen. Die sind harmlos. Kann mir nicht vorstellen, dass einer von denen mich niedergeschlagen haben soll.«
»Wen können Sie sich denn vorstellen?«
»Ehrlich gesagt: niemanden.«
»Sie haben keine Feinde?«
Leibrand versuchte zu lachen, verzerrte dann aber sein Gesicht vor Schmerzen und fasste sich kurz an den Hals. »Mehr als genug. Aber … – na gut, einer von denen könnte einen Schläger angeheuert haben. Sich selber macht sich da keiner die Finger schmutzig.«
»Können Sie mir Namen nennen?«
»Nein! Das sind ja nur ganz vage Vermutungen. Und ich beschuldige natürlich niemanden auf Verdacht.«
»Sie waren gestern Abend gegen neunzehn Uhr noch im Karateklub K2.«
»Wie bitte?«
Peter Heiland grinste. »Ich hab Sie selbst gesehen.«
»Wie – Sie haben mich selbst gesehen?«
»Ich war ganz zufällig da.«
»Wo denn? Im Karateklub?«
»Beantworten Sie doch bitte erst einmal meine Frage: Was haben Sie dort gemacht? Trainieren Sie im K2?«
»Das sollte ich vielleicht, nach dem, was gestern passiert ist. Aber was haben Sie denn in dem Klub gesucht?«
»Beunruhigt Sie das? Ich meine, dass ich dort war?«
»Nein, warum soll mich das beunruhigen? Wie kommen Sie überhaupt darauf?«
»Sie wirken so auf mich.«
»Quatsch!«
Peter lächelte. »Wenn es Sie beruhigt: Ich habe nur jemanden abgeholt, der dort trainiert. Also: Warum waren Sie da?«
»Es war rein geschäftlich. Die Geschäftsführerin des Klubs ist meine Mandantin.«
»In welcher Angelegenheit?«
»Sie verstehen sicher, dass ich Ihnen dazu nichts sagen kann.«
»Was haben Sie danach gemacht?«
»Ich bin in mein Büro gefahren, habe ein paar Mails beantwortet und ging dann zu Fuß nach Hause wie fast jeden Abend. Und jetzt muss ich Sie bitten zu gehen. Ganz so robust, wie ich wirke, bin ich dann doch noch nicht.«
Peter erhob sich und stellte den Stuhl an seinen alten Platz zurück. »Ich wünsche Ihnen gute Besserung, Herr Doktor Leibrand.«
»Danke!« Der Anwalt schloss die Augen und rutschte tiefer unter die Zudecke.
Als Peter Heiland auf die Caspar-Theyß-Straße hinaustrat, hatte sich der Himmel verdunkelt. Erste schwere Regentropfen fielen und schlugen kleine Krater in den Staub des Trottoirs. Ein leises Donnergrollen war zu hören. Weit im Westen war ein Wetterleuchten zu sehen. »Endlich Regen! Die Natur kann’s brauchen«, sagte Peter laut und fing sich den irritierten Blick einer verschleierten Frau ein, die mit schnellen Schritten auf den Eingang des Krankenhauses zuging. Er hatte sich gerade hinters Steuer seines Dienstwagens gesetzt, da öffnete der Himmel seine Schleusen. Gewaltige Regensalven gingen nieder. Die Scheibenwischer wurden mit den Wassermassen nicht fertig. Peter Heiland beschloss, einfach sitzen zu bleiben, bis der Regen nachlassen würde.
Als er Leibrands Krankenzimmer verlassen hatte, war er noch ins Ärztezimmer gegangen und hatte dort den Mediziner getroffen, der den Rechtsanwalt behandelte. »Wir haben außer dem Bruch des Nasenbeins, einigen Schürfwunden im Gesicht und der Gehirnerschütterung keinerlei Verletzungen gefunden«, hatte der gesagt. »Auch keine Blutergüsse, die in der Regel entstehen, wenn jemand mit einem Gegenstand niedergeschlagen wird.«
»Verstehen Sie etwas von Karate?«, hatte Peter gefragt.
»Nicht sehr viel. Ich habe zwar den schwarzen Gürtel als Judoka, aber Karate habe ich nie betrieben. Warum fragen Sie?«
»Herr Doktor Leibrand hat mit Karate zu tun.«
»Sicher gibt es Karateschläge, die einen Menschen sogar töten können. Aber im Wesentlichen geht es darum, Beweglichkeit und Schnelligkeit zu trainieren und die körperliche Kondition zu stärken. Leute, die so lange üben, bis sie Ziegel oder Bretter mit einem einzigen Handkantenschlag zerteilen können, gibt es nur noch selten.«
Peter hatte anerkennend genickt. »Sie kennen sich ganz gut aus.«
»Dass Herr Doktor Leibrand mit einem Karateschlag zu Fall gebracht wurde, halte ich für sehr gut möglich«, sagte der Mediziner nachdenklich. »Ein Schlag gegen die Halsschlagader …«, er deutete die Stelle an seinem eigenen Hals an, »… kann zur Bewusstlosigkeit führen, die aber meist nach ein paar Stunden vorbei ist. So könnte es bei unserem Patienten gewesen sein.«
»Was passiert da genau?«, wollte Peter Heiland wissen.
»An dieser Stelle an der Halsschlagader …«, der Mediziner zeigte auf den gleichen Punkt wie zuvor, »… befinden sich Rezeptoren für die Blutdruckregulation. Wenn man durch einen Schlag diese Rezeptoren durcheinanderbringt, sinken Herzfrequenz und Herzkraft stark ab. Es kann zur Bewusstlosigkeit kommen, schlimmstenfalls zu einem Herzstillstand. Das ist nicht ungefährlich. Bei Doktor Leibrand ist es zum Glück zu keinem Herzstillstand gekommen.«
Nach einer knappen Viertelstunde ließ der Regen schlagartig nach. Im Westen riss der dunkle Himmel auf, zwischen den Dächern der Stadt und den Wolken war ein weißer Streifen zu sehen. Peter Heiland ließ den Motor an und fuhr los.
Zum Mittagessen traf er sich mit seiner Frau Hanna in der Kantine. Es gab Hackbraten mit lauwarmem Kartoffelsalat. Sie teilten sich eine Literflasche Mineralwasser. Hier im Haus des LKA galt ihre Abmachung nicht, während des Essens nicht über ihre Fälle zu reden.
»Also es war doch ganz offensichtlich kein Raubüberfall«, sagte Hanna, »immerhin hat der Täter Leibrand die Brieftasche gelassen.«
Plötzlich fiel Peter wieder ein, was der Anwalt über sein Mobiltelefon gesagt hatte. »Leibrand vermisst sein Handy. Aber bei diesem Nobby haben wir es nicht gefunden. Mal angenommen, der Junge lügt nicht, dann müsste es tatsächlich einen anderen Täter geben, der dem Anwalt das Handy weggenommen hat.«
»Aber warum?«
»Was weiß ich?«
»Jedenfalls: Der Junge ist absolut nicht der Typ, der einen so kräftigen Menschen mit der bloßen Hand niederschlagen kann.«
Peter ging zum Kaffeeautomaten und kam mit zwei Tassen Cappuccino zurück. »Ich werde mir den Karateklub mal ansehen.«
»Aber bitte nicht, wenn ich dort bin«, sagte Hanna.
»Besser noch, Norbert Meier übernimmt das. Und am besten meldet der sich gleich fürs Training an. Könnte ihm nicht schaden. Ich hab das Gefühl, der wird jeden Tag dicker.«
»Jetzt übertreibst du aber«, protestierte Hanna. Sie hatte nach anfänglichen Schwierigkeiten den Kollegen Meier ins Herz geschlossen, mochte seine direkte, raubeinige Art und war längst dahintergekommen, dass hinter Norberts rauer Schale ein feinfühliger Mensch steckte. Aber als sie das einmal laut zu ihm gesagt hatte, kam von ihm heftiger Protest. Sie hatte lachen müssen und gesagt: »Das kannst du nicht brauchen, dass man dir auf die Schliche kommt, wa?« Danach hatte er ein paar Tage nicht mit ihr geredet. Eines Morgens aber stand ein kleiner Blumenstrauß auf ihrem Schreibtisch mit einem Zettel dran: »Recht haste ja, Norbert.« Danach hatten sie ein gutes, fast schon freundschaftliches Verhältnis; und Norbert Meier hatte es mehr als alle anderen in der Abteilung bedauert, als Hanna zum Rauschgift versetzt worden war.