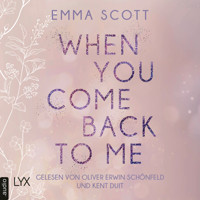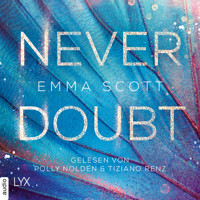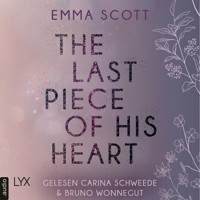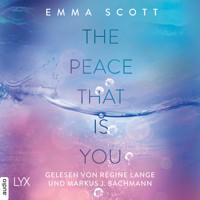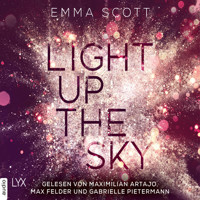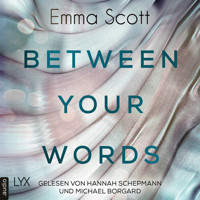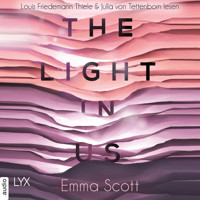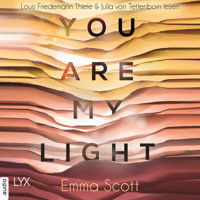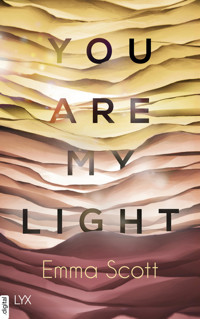
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Light-in-us-Reihe
- Sprache: Deutsch
Der perfekte Abschluss für Charlottes und Noahs Geschichte
Durch Charlotte hat Noah Lake die Kraft gefunden, ins Leben zurückzukehren und seine Blindheit endlich zu akzeptieren. Doch er will sich Charlottes‘ Liebe wahrlich würdig erweisen und macht sich auf eine Reise, die zur größten Herausforderung seines Lebens wird. Denn zu lernen, sich in der Welt zurechtzufinden, ist eine Sache - die Dämonen, die ihn so lange fesselten, endgültig konfrontieren, eine ganz andere ...
"Wenn du 'The Light in Us' geliebt hast, ist dieses Buch ein Must-Read. Dies ist die beste Novella, die ich bisher gelesen habe!" MY BOYFRIEND LIVES IN BOOKS BLOG
Die Novella zu "The Light in Us"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
Prolog
New York City
Das Buch der Offenbarungen
Startvorbereitung
Auf Wiedersehen!
Wien
Der dunkelste Weg
Rom
Barcelona
Amsterdam
Heilige Marit
Metamorphose
Salzburg
Intermezzo
Paris
Der richtige Ring
Wenn es regnet …
Peru
Rückkehr nach New York
Epilog
Danksagung
Die Autorin
Die Romane von Emma Scott bei LYX
Impressum
EMMA SCOTT
You Are My Light
DIE NOVELLAZU »THE LIGHTIN US«
Ins Deutsche übertragen von Stephanie Pannen
Zu diesem Buch
Durch Charlotte hat Noah Lake die Kraft gefunden, ins Leben zurückzukehren und seine Blindheit zu akzeptieren. Doch er weiß, dass er erst zu sich selbst finden muss, zu seinem neuen Selbst, damit ihre Liebe wirklich eine Zukunft haben kann. Daher macht sich Noah auf eine Reise, die zur größten Herausforderung seines Lebens wird. Denn zu lernen, sich in der Welt zurechtzufinden, ist eine Sache – die Dämonen, die ihn so lange fesselten, endgültig zu konfrontieren, eine ganz andere …
Diese Geschichte ist den wohlwollenden, herzlichen und unglaublichen Leserinnen und Lesern von »The Light in Us« gewidmet.
Bei Euren zahlreichen Schilderungen, wie viel Euch Noahs und Charlottes Liebesgeschichte bedeutet hat, wurde mir ganz warm ums Herz. Für eine Autorin gibt es nichts Befriedigenderes als das Wissen, dass meine Worte jemanden berührt haben oder dass meine Figuren jemanden noch lange nach Ende der Geschichte bewegt haben. Diese Novella ist mein Dankeschön an Euch für dieses großartige Geschenk.
Vielen Dank!
Prolog
Charlotte, Lenox Hill Hospital, Februar
Meine Schritte hallen über den breiten Linoleumflur, um sich dem Klang der Maschinen und Stimmen anzuschließen, die um diese späte Stunde zwar gedämpft sind, mir jedoch immer noch laut vorkommen. Krankenhäuser sind keine erholsamen Orte, und in der Luft hängt der schwere Geruch von Desinfektionsmitteln und Tränen. Ich hasse es. Ich hasse es, dass er wieder hier ist. Es ist nicht fair. Er hat das doch alles schon eine Million Mal durchgemacht.
Eigentlich sollte ich gar nicht mehr hier sein. Die Besuchszeiten sind längst vorbei, aber das Pflegepersonal ist nachsichtig mit mir. Oder sie wollen nicht, dass ich eine Szene mache. Wahrscheinlich eher Letzteres.
Auf dem Schild an der Tür steht 8C. Sein Zimmer. Ich atme tief ein, damit meine Stimme nicht zittert. Sonst wird Noah sofort wissen, wie verängstigt ich bin. Er hat auch Angst. Er versucht, es nicht zu zeigen, es zu verdrängen und zu ignorieren, aber ich weiß, dass er Angst hat. Ich kenne ihn.
Es ist spät, aber Noah ist wach. Seine Augen sind offen, und er starrt ins Leere. Er wirkt schwach und blass unter der Decke. Aus seinen Armen kommen viel zu viele Schläuche, und zu viele Maschinen überwachen seine Lungenfunktion, seine Körpertemperatur und seinen Herzschlag.
Sein Herz gehört mir, denke ich kämpferisch. Seines und meines schlagen im Einklang.
Als ich eintrete, dreht Noah seinen Kopf, und ein Lächeln tritt auf seine Lippen. Er weiß immer sofort, wenn ich es bin.
»Hi, Baby«, sagt er erschöpft. »Wie spät ist es?«
»Fast elf.« Ich gehe zu ihm und stelle meine schwere Tasche ab. »Lucien hat alle nach Hause gebracht, aber sie kommen morgen früh wieder. Ava auch.«
»Ava kommt mit dem Flugzeug her?«, fragt er und verzieht sein Gesicht. »Gott, was für ein Mist!«
Ich küsse meine Finger und berühre mit ihnen die Falte zwischen seinen dunklen Augenbrauen. »Sie sind deine Familie. Nichts könnte sie fernhalten, und genauso sollte es sein.«
Er sagt nichts, aber ich weiß, dass er sich Vorwürfe macht. Als ob die unablässigen Migräneanfälle seine Schuld wären. Oder dass er gestern Nachmittag zusammengeklappt ist wie eine Marionette, der man die Fäden durchgeschnitten hat.
Er greift nach meiner Hand. »Was ist mit dir? Geh nach Hause, Baby. Schlaf ein bisschen.«
»Von wegen«, sage ich leichthin und ziehe meine Schuhe aus.
»Ist die Besuchszeit nicht vorbei?«
»Die gilt nicht für mich.«
Er zwingt sich zu einem Lächeln. »Kaum auszumalen, was hier los wäre, wenn sie versuchen würden, dich hinauszuwerfen.«
»Das kannst du vergessen. Rutsch mal, du machst dich ja furchtbar breit.«
Ich lege mich neben ihn und ein Bein über seine Beine, die unter der Decke stecken. Wir schauen uns an, unsere Finger sind miteinander verschränkt, und unsere Körper berühren sich so weit, wie es das schmale Bett erlaubt.
»Charlotte, du zitterst ja.«
»Es ist kalt hier drin. In Krankenhäusern ist es immer kalt. Ist dir das schon mal aufgefallen?«
Er schüttelt leicht seinen Kopf auf dem Kissen. »Tut mir leid, Baby. Ich wollte dir keine Angst machen. Darum habe ich nie was gesagt. Oder vielleicht wollte ich mir selbst auch keine Angst machen. Ich dachte, wenn ich zugebe, wie schlimm es ist, mache ich es damit wahr.« Er lacht düster. »Und damit hatte ich recht. Denn jetzt fühlt es sich ziemlich wahr an.«
Er schließt seine Augen, als ob er wieder eine Migräneattacke hätte. Er hatte so viele in den letzten Monaten, mehr, als ich zählen kann. Mehr, als er mir gegenüber zugegeben hat. Genug, um die Ärzte zu alarmieren, die heute einen Haufen Tests angeordnet haben: CT-Scans, MRTs und sogar ein Röntgenbild, »nur um sicherzugehen«, dazu eine Million Bluttests, bis ich schon dachte, sie hätten Noah komplett ausgesaugt.
Die Angst, dass diese Tests zu einem schlimmen Ergebnis kommen würden, hat uns alle, die wir Noah lieben, fest im Griff. Etwas, was eine Operation erfordern würde, vielleicht eine weitere Kraniotomie. Allein schon das Wort lässt mich erschaudern.
Oder vielleicht ist es auch etwas Schlimmeres. Es gibt schließlich schlimmere Worte. Aneurysma. Hirnläsion. Tumor. Und über alldem das furchtbare Schreckgespenst eines Wortes, das ich mir nicht mal zu denken erlaube. Dieser heimtückische, gierige Dieb, der dieser Welt so viel stiehlt und niemals zufrieden ist.
»Ich kann verstehen, dass du Angst hast, Noah«, sage ich. »Das kann jeder.«
»Ja, und trotzdem. Ich hätte früher etwas sagen sollen, aber ich wollte nicht wieder hierher. Ich dachte, ich sei fertig damit.«
»Ich weiß.« Ich presse meine Finger auf meine Lippen. »Aber dieses Mal ist es anders. Bald wird es dir besser gehen.«
Er nickt, und wir wissen beide, dass meine Worte nicht mehr als ein frommer Wunsch sind.
»Ich habe gute Neuigkeiten bezüglich deines Buchs«, sage ich betont optimistisch. »Yuri hat ein gedrucktes Manuskript geschickt. Damit du es in Händen halten und das Gewicht deines eigenen Buchs spüren kannst.«
Noah runzelt die Stirn. »Es ist doch noch nicht mal fertig.«
»Ich denke, das ist seine Art, dich zu ermutigen.« Ich drücke liebevoll seinen Arm. »Es ist echt aufregend. Len Gordon will es unbedingt! Natürlich wäre ich noch begeisterter, wenn du es mich mal hättest lesen lassen …«
»Es ist noch nicht fertig«, wiederholt Noah, und ich sehe ihn an. Er wirkt weder begeistert noch erfreut, sondern wütend. Oder verstört. Oder beides zugleich, und die Emotionen kämpfen darum, welche von ihnen die Oberhand gewinnt. »Ich wollte es fertigstellen, bevor du es liest. Bevor überhaupt jemand es liest. Es hat noch kein Ende.« Seine braunen Augen suchen nach mir, seine Hände umfassen meine noch fester. »Ich kann das Ende nicht sehen, Charlotte. Wie wird es aussehen?«
»Glücklich«, sage ich. Verkünde ich. »Es wird ein glückliches Ende, Noah.«
Er schließt seine Augen und beendet damit ihre erfolglose Suche. »Ich bin so müde, Baby. Ich will jetzt schlafen.«
Ich nicke und küsse seine Lippen. »Natürlich«, sage ich, obwohl ich will, dass er weiter mit mir redet, bis er sich besser fühlt. Aber mit einem dumpfen Schmerz wird mir klar, dass ich nichts zu sagen habe. Nichts, was ihm helfen würde.
Er fällt in einen, wie ich hoffe, erholsamen Schlaf ohne Schmerzen. Ich bleibe neben ihm liegen und beobachte ihn. Unsere Hände sind immer noch miteinander verschränkt. Ich bemühe mich, nicht an das »Was, wenn …« zu denken, an die unzähligen Möglichkeiten, was ich da morgen aus dem Mund der Ärzte erfahren könnte.
Aber mein Wunsch, Noah zu helfen, ist stark und macht mich ruhelos. Noah schläft, und er braucht die Erholung, doch ich muss ihn auch hören. Seine Gedanken kennen, in dieser dunklen Stunde so viel von ihm so nah wie möglich spüren.
Mein Blick fällt auf meine Tasche, in der sich das Manuskript seines Buches befindet. Er wollte nicht, dass ich es lese, bevor es fertig ist, aber ich muss einfach. Ich muss wissen, wie wir hier gelandet sind und warum er mir seinen Schmerz vorenthalten hat. Ich muss wissen, was in Europa mit ihm passiert ist. Er hat mit seiner Erblindung seinen Frieden geschlossen, aber bis dahin war es eine lange, mühsame Reise, die ihren Tribut gefordert hat. Ich will – nein, ich muss – wissen, was er für mich aufgegeben und erlitten hat. Für uns.
Vorsichtig löse ich mich von ihm und stehe auf. Ich ziehe das Manuskript aus meiner Tasche und sinke in einen Sessel am Fenster. Das Buch ist dünn, hat nicht mehr als hundert Seiten, alles auf dickem Papier gedruckt und von Metallklammern zusammengehalten. Ich schlage die erste Seite auf, in Schriftart und Format immer noch die Rohfassung und unredigiert.
Eine endlose Fülle von Möglichkeiten
Eine Biografie
Von Noah Lake
Widmung:
Für Lucien, den Gott meiner dunklen Welt, der sagte: »Es werde Licht«, und es wurde Licht …
Und für Charlotte, das Licht in meiner Dunkelheit.
Du bist der Grund, warum ich lebe und nicht nur existiere.
Du bist die aufgehende Sonne an jedem neuen Tag.
Meine endlose Fülle von Möglichkeiten.
Bei diesen Worten blinzele ich die Tränen fort, ehe ich mich dem ersten Kapitel zuwende.
Ich lese von Noahs ersten großen Leidenschaften: von Adrenalin, Geschwindigkeit, Angst. Ich lese von seinen Heldentaten für Planet X, von seiner tief verwurzelten Reiselust, diesem Drang, niemals an einem Ort zu bleiben, sondern die Welt in all ihrer Pracht zu erleben. Ich lese von den Ereignissen vor seinem Unfall und dann von dem Unfall selbst, dem erschütternden Versinken in Schmerz und Dunkelheit. Entsetzt stelle ich fest, dass seine Genesung so viel schlimmer war, als ich es mir vorgestellt hatte.
In seinen eigenen Worten war es so viel eindringlicher als die furchtbaren Fotos von seinen Verletzungen, die ich auf Google gesehen hatte. Und noch mehr schreckliche Begriffe standen dort. Worte wie Kraniotomie und Zerebrospinalflüssigkeit, Shunts und Schrauben, Transplantate, die septisch wurden … Und es war von Schmerz die Rede. So viel Schmerz. Mein Geliebter hatte so viel Schmerz ertragen müssen, wie ich es mir kaum vorstellen kann.
Mit tränenerfüllten Augen lese ich Noahs Beschreibung des Tags, an dem ihm gesagt wurde, er sei für immer erblindet. Die herzzerreißende Aufzählung von Dingen, Orten und Personen, die er niemals sehen würde, einschließlich der Gesichter seiner eigenen Kinder.
Ich lese von seiner Reha und der unglaublichen Fürsorge seines Therapeuten, eines weisen Mannes namens Harlan Williams – eines Mannes, den ich am liebsten sofort aufsuchen und umarmen würde für die Art und Weise, wie er meinen Noah durch seine schlimmste Trauer geführt hat.
Ich lese von Noahs einsamem, hoffnungslosem Rückzug in das Haus hier in New York und die schnelle Abfolge von Assistenten, die er genauso vertrieben hatte wie seine Familie.
Und dann lese ich über mich selbst, über den Tag, an dem wir uns zum ersten Mal begegnet sind, und hier schreibt Noah plötzlich von Hoffnung und dem Beginn von etwas Gutem und Neuem. Von uns. Von unserer chaotischen, wunderschönen, turbulenten Liebe, die mit einem Bewerbungsgespräch begann, das er gar nicht führen wollte, mit einer jungen Frau, die nur ein klein wenig Sicherheit und Frieden brauchte, um ihr gebrochenes Herz ausruhen zu lassen.
Ich lese weiter, bis ich an die Stelle komme, nach der ich von Anfang an gesucht habe: die Stelle, an der Noah und ich getrennt wurden, damit er tun konnte, was er als seine Aufgabe sah, um uns – und sich selbst – wieder zusammenzusetzen.
Das ist der Teil der Geschichte, den ich nicht kenne, und das ist es, was ich lesen muss: was mit ihm in Europa und danach geschehen war, warum er sich selbst an den Abgrund gebracht hatte und warum er immer noch fand, dass es nicht genug gewesen war.
Ich fürchte mich vor dem, was ich lesen werde, denn dies ist meine Reise in das dunkle Unbekannte.
Mit angehaltenem Atem blättere ich um und tauche ein.
New York City
Ich habe sie verlassen.
Allein die Worte zu schreiben fühlt sich selbst Wochen später an wie ein Schlag in den Magen. Ich habe Charlotte verlassen, und es war das Schlimmste und Beste, was ich jemals getan habe.
Der Planet X-Ball war eine Katastrophe, genau das, wovor sie mich zu warnen versucht hat. Die Demütigung, allein durch den Ballsaal zu gehen wie ein Schiffbrüchiger ohne Rettungsring und ohne eine Küste weit und breit, war noch zu ertragen. Aber Deacon McCormick hat meine Charlotte in einem Aufzug abgefangen und versucht, sich ihr aufzudrängen. Und das war unentschuldbar.
Ich habe auf der Polizeiwache kein Wort gesagt, während Charlotte zu Protokoll gegeben hat, was passiert war, aber innerlich habe ich geschrien. Deacon hat sie am Kinn gefasst und versucht, ihr seine Zunge in den Hals zu stecken, bis sie das Pfefferspray eingesetzt hat, das sie von meiner Schwester bekommen hatte.
Meine Fingerknöchel taten weh von dem Schlag, den ich Deacon verpasst hatte, nachdem er und Charlotte aus dem verpesteten Aufzug getorkelt waren, also konzentrierte ich mich während Charlottes Aussage darauf, nicht vor Wut auszurasten. Immer wieder streckte ich meine Finger und kostete den Schmerz aus. Aber diese Knochen hätten gebrochen sein müssen. Meine Hand schmerzte nicht genug. Ich hatte ihn nicht hart genug geschlagen. Ich hörte die Angst und Scham in Charlottes Stimme, während sie wiedergab, was passiert war, und ich wollte Deacon umbringen. Ich war kein gewalttätiger Mensch, aber hätte er in diesem Moment vor mir gestanden, hätte ich ihn so lange mit aller Kraft geschlagen, bis man mich verhaftet hätte.
Der Vorfall bewies, wie weit ich davon entfernt war, Charlotte das Leben garantieren zu können, das sie verdiente. Meine Dummheit und mein Stolz hatten sie in die denkbar schlimmste Situation gebracht. Meine Wut und Verbitterung waren immer noch da und lauerten unter der Oberfläche. Mein unnachgiebiges Verlangen, genauso weiterzumachen wie zuvor, mein Leben genau da wieder aufzunehmen, wo es mit dem Unfall geendet hatte, war so stark wie eh und je … ein Gift, das zwischen mich und Charlotte sickerte und unsere Beziehung zerstörte. Ich musste gehen.
Ich hatte keinen Plan. Wir kehrten zusammen in das von uns bewohnte Stadthaus meiner Familie zurück, und ich verschwand sofort in meinem Zimmer, um zu packen, warf wahllos Kleidung in meinen Koffer. Ich musste schnell verschwinden, bevor ich es mir anders überlegen konnte.
Charlotte brachte mir meine Sonnenbrille und meinen Langstock – ausgerechnet von Valentina –, und sofort war ich wieder von Schuldgefühlen zerfressen. Dank Deacons Lügen hatte Val mich geküsst, und das hatte Charlotte wahrscheinlich auch gesehen.
»Was tust du da?«, fragte Charlotte mit gebrochener, tränenerfüllter Stimme.
Uns retten, wollte ich sagen, aber das klang zu heroisch, und dabei war ich doch alles andere als ein Held. Ich versuchte, vor der Scham über mein Versagen davonzulaufen. Momente des Versagens hatte es an diesem Abend viele gegeben, aber vor allem hatte ich darin versagt, Charlotte zu beschützen. Mir wurde klar, dass Deacon mich viel schlimmer getroffen hatte als ich ihn. Er hatte mich dort getroffen, wo es am meisten wehtat, und Charlotte hatte fast den schlimmsten Preis gezahlt.
Es war Zeit zu gehen. Sie weinte, und ich hielt sie, spürte, wie sie sich an mir festklammerte, hörte ihre Tränen und ihren Schmerz. Ich bat sie, auf mich zu warten. Ich wusste nicht mal, was ich da sagte, worum ich da bat. Worauf sollte sie warten? Darauf, dass ich meinen Scheiß geregelt bekam, nehme ich an, auch wenn ich absolut keine Ahnung hatte, wie ich das hinbekommen sollte. Aber ich war monatelang ein selbstsüchtiger Arsch gewesen, und das war das Erste, was ich tat, das sich ein wenig so anfühlte, als würde ich geben, statt zu nehmen. Es brach mir das Herz, aber es gab nichts mehr, was ich sonst tun konnte.
»Ich liebe dich, Charlotte«, sagte ich zu ihr. Zum ersten Mal. Ich sagte es ihr zum Abschied. Ich ging, weil ich sie liebte. »Ich liebe dich mehr als mich selbst, und das ist der Grund, weshalb ich heute durch diese Tür gehen kann.«
Ich küsste sie, um sie ein letztes Mal zu schmecken und zu spüren, aber auch, um sie zum Schweigen zu bringen. Wenn sie mich gebeten hätte zu bleiben, hätte ich nachgegeben. Der Schmerz in meinem Herzen fühlte sich an wie ein Bleigewicht. Auf die Knie zu sinken und sie um Vergebung anzuflehen wäre so viel leichter gewesen. Und falsch.
Also küsste ich sie schnell, verließ sie und schloss die Tür hinter mir.
Ich trat in den frühen Morgenstunden auf den Gehweg. Es war immer noch ruhig, und die Luft war feucht und schwer. Vielleicht würde es regnen. Ich kramte meinen Langstock aus meinem Koffer und tastete mich vorwärts, bis ich die Rundung des Bordsteins spürte. Ich ging um die Ecke, außer Sicht, sollte es Charlotte in den Sinn kommen, mir zu folgen, und zog mein Handy aus meiner Hosentasche. Ich hatte ihr gesagt, ich hätte mir ein Taxi gerufen, aber das war eine Lüge gewesen. Ich hatte keinen Plan und keine Ahnung, was ich als Nächstes tun sollte. Ich sagte meinem Handy, es solle Lucien anrufen.
Ich trug immer noch einen Smoking, verdammt, auch wenn ich die Krawatte schon lange abgelegt hatte. Während ich darauf wartete, dass der Anruf durchging, öffnete ich die obersten drei Knöpfe meines Hemds, weil ich das Gefühl hatte zu ersticken. Ein schläfriger Lucien ging dran.
»Hallo? Noah?«
Es lag so viel Sorge in seiner Stimme. Und ich hatte ihn so schlecht behandelt. Diesen Mann, der mir wie ein zweiter Vater gewesen war. Der es mit mir ausgehalten und immer wieder Assistenten eingestellt hatte, während ich sie nur systematisch gefeuert oder rausgeekelt hatte. Alle bis auf eine. Er hatte mir Charlotte gebracht, und hatte ich jetzt auch das ruiniert? Alles, woran ich mich geklammert hatte, hatte sich als unerreichbar entpuppt, und nun stand ich verloren und hilflos auf der Straße.
»Lucien«, krächzte ich. Meine Stimme hörte sich so gebrochen an, wie ich mich fühlte, und ich sagte etwas, was ich seit dem Unfall zu niemandem mehr gesagt hatte: »Ich brauche dich.«
Ich war seit zehn Jahren nicht mehr in Luciens Hochhausapartment gewesen. Ich erinnerte mich dunkel an geschmackvolle Kunst – hauptsächlich Glasskulpturen und Waterford-Kristall – und an den Geruch seiner Dunhill-Zigaretten. Als er mich hereinführte, waren der Rauchgeruch und der Duft seines teuren Eau de Cologne wie ein Schuss Nostalgie direkt in den Arm. Er ließ mich in einem Ledersessel Platz nehmen – wenn es derselbe war, an den ich mich erinnerte, war es ein dunkelgrüner – und zündete sich eine Zigarette an.
»Also«, sagte Lucien und atmete den Rauch aus. »Was ist los?«
»Ich habe Charlotte verlassen.«
»Ist mir aufgefallen. Warum?«
»Um uns zu retten.«
Auf dem Arm spürte ich die Wärme des Sonnenlichts, das durch die Fenster drang, und nahm die Geräusche der Stadt wahr, die langsam zum Leben erwachte, während ich innerlich starb. Ich erzählte ihm alles, was auf dem Planet X-Ball geschehen war. Die Worte sprudelten nur so aus meinem Mund – ein Strom der Schande, den ich hinauslassen musste, bevor mein Stolz ihn wieder zum Versiegen bringen würde.
Ich erzählte Lucien, wie Charlotte unablässig daran gearbeitet hatte, mir ein besseres Leben zu zeigen, und wie ich es ihr gedankt hatte, indem ich sie mit diesem Mistkerl Deacon allein gelassen hatte.
»Aber jetzt ist sie in Sicherheit«, sagte Lucien mit eiskalter Stimme.
»Ja«, antwortete ich. »Sicher vor mir. Sie hat nächste Woche ein Probespiel für ein Tourneeorchester, und ich weiß, dass sie es schaffen wird. Sie ist einfach zu gut, um es nicht zu schaffen.«
»Ich hatte den Eindruck, dass Charlotte die Musik in letzter Zeit fremd geworden ist. Seit dem Tod ihres Bruders?«
»Sie nähert sich ihr wieder an. Diese Tournee … ist perfekt für sie. Ihre Zeit ist gekommen. Ich weiß es, und ich denke, sie weiß es auch. Und … sie wollte, dass ich sie begleite«, sagte ich und verspürte dabei einen Stich in meinem Herzen. »Aber ich kann sie nicht als ihr Anhängsel begleiten. Ich würde sie nur herunterziehen. Sie hat die letzten paar Monate nur für mich gelebt. Jetzt muss sie für sich selbst leben.«
»Und du denkst nicht, dass sie diese Entscheidung selbst treffen kann?«
»Natürlich kann sie das«, erwiderte ich gereizt. »Und wenn ich nicht so vollkommen am Arsch wäre, würde ich tun, was immer sie will. Aber ich bin am Arsch – der Ball gestern war Beweis genug. Also kann ich sie nicht begleiten und das auch noch versauen. Sie würde sich immer nur um mich kümmern, statt sich auf ihre Musik zu konzentrieren. Und Tournee hin oder her, ich muss lernen, wie ich allein leben kann. Wenn mir das nicht gelingt … nutze ich ihr nichts. Nicht so, wie ich jetzt bin.«
Lucien schwieg.
Ich rutschte nervös hin und her. Es war eh schon schwer, es zuzugeben, wenn man völligen Mist gebaut hatte. Doch es war noch eine Million Mal schlimmer, wenn man das Gesicht der Person, der gegenüber man es zugab, nicht sehen konnte. Ich fühlte mich wie ein Gefangener mit Augenbinde, der darauf wartete, dass das Beil fällt. Oder auch nicht.
Schließlich knarrte Luciens Sessel. Ich stellte mir vor, wie er sich zurücklehnte, nachdachte und der Rauch sich vor seinem weißhaarigen Haupt erhob. »Dann bleibt die Frage, was du jetzt tun willst. Du hast Charlotte gesagt, dass sie warten soll. Worauf soll sie warten?«
»Ich weiß es nicht. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich verdammt noch mal tue.« Ich rieb mir übers Gesicht. »Falls du eine Idee hast, immer her damit.«
»Noah«, sagte Lucien, »selbst wenn ich eine Antwort hätte, müsstest du selbst darauf kommen. Aber ich möchte dich daran erinnern, dass du von einer außergewöhnlichen jungen Frau geliebt wirst. Bitte denk daran, bevor du dich in Selbsthass vergräbst.«
Plötzlich fiel mir ein, was Charlotte auf der Polizeiwache zu Protokoll gegeben hatte.
»Deacon hat mich in eine Ecke des Aufzugs gedrängt. Er … hat mich am Kinn gepackt. Fest. Um meinen Mund zu öffnen …«
Ich erschauderte. »Zu spät.«
»Quoi?«
»Nichts.«
Ich rieb mir den Hinterkopf, wo sich allmählich ein dumpfer Schmerz ausbreitete. Offenbar war diese monumental beschissene Nacht noch nicht fertig mit mir. Das Monster erwachte.
»Migräne?« Luciens Stimme klang schärfer, war voller Besorgnis.
Ich nickte und suchte in der Tasche meines Jacketts nach meinem Medikament. Charlotte hatte natürlich daran gedacht, es mir in die Tasche zu stecken, bevor wir zum Ball aufgebrochen waren.
»Ich bin aber auch verkatert.«
Die Luft wurde zum Schneiden dick, so beträchtlich war Luciens Überraschung. »Du hast getrunken?«
»Oh, ja klar. Ich habe gestern Abend nichts als schlechte Entscheidungen getroffen.«
Ich hörte den Sessel knarren, Schritte auf dem Boden, dann einen laufenden Wasserhahn. Lucien kehrte zurück und drückte mir ein Glas Wasser in die Hand. Ich steckte mir eine Azapram in den Mund und spülte sie herunter. Dann lag seine Hand auf meiner Schulter. »Komm!«
Er führte mich in sein Gästezimmer, das sauber, aber unbenutzt roch. Ich setzte mich aufs Bett und bemerkte sofort, wie erschöpft ich war. Die Kopfschmerzen waren langsam, kriechend. Ich nahm an, dass die Wirkung des Medikaments und der Schlaf einsetzen würden, bevor sie explodierten, aber eigentlich war es mir egal. Geschieht mir recht.
»Gegenüber vom Bett auf der linken Seite ist ein Badezimmer«, sagte Lucien. »Sobald du dich ausgeruht hast, werden wir uns unterhalten und dabei vielleicht eine Lösung für dein Problem finden.«
»Lucien«, sagte ich, bevor er die Tür schloss, »vielen Dank!«
»Natürlich, mein Junge. Schlaf gut!«
Er sagte es wie ein Freund und nicht wie ein Mann, dem mein Vater einen Haufen Kohle zahlte, damit er sich um mich kümmerte, und das war die verdammt noch mal beste Sache, die mir in den letzten zwölf Stunden passiert war.
Ich ließ mich aufs Bett sinken. Der Schmerz in meinem Schädel ließ nach, und ich fiel ins Nichts.
Das Buch der Offenbarungen
Es gibt nur wenige Dinge, die einen deutlicher an einen katastrophalen Abend erinnern, als allein in einem kalten Bett aufzuwachen. Ich tastete nach dem Aufwachen nach Charlotte. Dort, wo ich ihre Wärme, ihre Haut und ihr weiches Haar vermutete, war nur eine leere Stelle. Ich wollte ihre Lippen auf meinen, wollte spüren, wie sie lächelte, und hören, wie sie mir einen guten Morgen wünschte. Ich hatte das Bett im Stadthaus erst seit etwas über einer Woche mit ihr geteilt, aber es hatte sich bereits angefühlt, als wäre es immer schon so gewesen.
Aber sie war nicht bei mir. Ich war nicht im Stadthaus. Ich brauchte einen Moment, um die Gerüche und Geräusche des Raums einzuordnen, bis mir einfiel, dass ich mich im Gästezimmer von Luciens Park-Avenue-Wohnung befand. Sie lag im dreiundzwanzigsten Stockwerk und hatte eine spektakuläre Aussicht auf den Central Park. Ich war das letzte Mal mit etwa dreizehn hier gewesen, und natürlich hatte ich die Aussicht nicht zu schätzen gewusst. Damals hatte ich nur höher gewollt.
Damals hatte ich mich für unverwundbar gehalten.
Ich setzte mich langsam auf. Ich hatte keine Migräne, aber mein Mund fühlte sich an, als hätte ich die ganze Nacht Dreck gefressen, und mein Magen war nicht allzu glücklich darüber. Ich tastete mich an der Wand entlang, bis ich die Badezimmertür gefunden hatte, dann suchte ich nach der verdammten Toilette. Ich verfluchte mich selbst dafür, dass ich Lucien nicht öfter besucht hatte, als ich den verdammten Schnitt seiner Wohnung noch hätte sehen können.
Und sein Gesicht. Luciens Erscheinung – sein genaues Aussehen – schwand aus meiner Erinnerung wie eine langsam verblassende Zeichnung. Genau wie meine Eltern. Und Ava. Ich hatte Charlotte vor meinem geistigen Auge, aber nur, weil ich ihr Gesicht so oft berührt hatte. Würde ich dieses Bild nun, da sie fort war, ebenfalls verlieren?
Der Gedanke verursachte mir stärkere Übelkeit als mein Kater.
Ich pinkelte, was ungefähr zehn Stunden dauerte, dann tastete ich mich bis in die Küche vor. Glücklicherweise hatte Lucien mich gehört und führte mich zum Frühstückstisch, wo er mir einen starken schwarzen Kaffee einschenkte.
»Hungrig?«, fragte er. »Es ist weit nach Mittag.«
Ich schüttelte den Kopf. »Halte ich dich von der Arbeit ab?«
»Überhaupt nicht.«