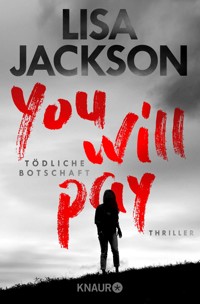
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Mobbing, Drohung, Rache, Mord: Im Thriller "You will pay – Tödliche Botschaft" von der amerikanischen Bestseller-Autorin Lisa Jackson drängen grausame Geheimnisse eines verhängnisvollen Sommers nach zwanzig Jahren ans Licht – und die damals Beteiligten müssen bitter bezahlen … Camp Horseshoe, Oregon: Vor zwanzig Jahren arbeitete eine Gruppe von Jugendlichen als Betreuer in einem Ferienlager. Nachts, wenn ihre Schützlinge im Bett lagen, schlichen sie sich aus ihren Hütten, hatten Sex, feierten wilde Partys mit Alkohol und Drogen, spannen Intrigen – bis etwas gründlich schief ging und zwei von ihnen spurlos verschwanden. Die polizeilichen Ermittlungen dazu liefen ins Leere, die Akte wurde geschlossen. Heute, zwei Jahrzehnte später, tauchen Knochen auf dem Grundstück des Feriencamps auf. Detective Lucas Dalton, einer der damaligen Betreuer, möchte den Fall erneut aufrollen. Zunächst will keiner der ehemaligen Betreuer aussagen. Doch dann erhalten sie einer nach dem anderen ein grausiges Foto mit der unheilvollen Botschaft "You will pay" – "Strafe muss sein". Und bald darauf geschieht ein Mord … Ein neuer nervenaufreibender Thriller um geheime Affären, Intrigen und tödliche Rache von der Bestseller-Autorin (u.a. "Raubtiere", "Zwillingsbrut", "Desire")!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 652
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Lisa Jackson
You will pay – Tödliche Botschaft
Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Auf dem Gelände eines ehemaligen Jugendcamps in Oregon werden menschliche Überreste entdeckt. Detective Lucas Dalton, der vor zwanzig Jahren als Betreuer in dem unglückseligen Ferienlager arbeitete, schwant Böses: Handelt es sich um die Knochen der zwei Mädchen, die während jenes Sommers spurlos verschwanden? Lucas rollt den nie geklärten Fall neu auf, doch zunächst will keiner der damals Beteiligten aussagen. Bis einer nach dem anderen die Drohung »Strafe muss sein« erhält – und der erste Mord passiert …
Inhaltsübersicht
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Kapitel sechzehn
Kapitel siebzehn
Kapitel achtzehn
Kapitel neunzehn
Kapitel zwanzig
Kapitel einundzwanzig
Kapitel zweiundzwanzig
Kapitel dreiundzwanzig
Kapitel vierundzwanzig
Kapitel fünfundzwanzig
Kapitel sechsundzwanzig
Kapitel siebenundzwanzig
Kapitel achtundzwanzig
Kapitel neunundzwanzig
Kapitel dreißig
Kapitel einunddreißig
Kapitel zweiunddreißig
Kapitel dreiunddreißig
Kapitel vierunddreißig
Kapitel fünfunddreißig
Kapitel sechsunddreißig
Kapitel siebenunddreißig
Kapitel achtunddreißig
Kapitel neununddreißig
Kapitel vierzig
Kapitel einundvierzig
Kapitel zweiundvierzig
Kapitel dreiundvierzig
Epilog
Lisa Jackson bei Knaur
Kapitel eins
Cape Horseshoe
Damals
Elle
Das war also das Ende.
Ihr Leben war vorbei. Mit neunzehn.
Elles Kinn zitterte. Sie ermahnte sich, tapfer zu sein, dennoch verließ sie der Mut.
»Gott steh mir bei«, flüsterte sie, auch wenn sie bezweifelte, dass Gott ihre Worte hören konnte, so laut heulte der Wind. Sechs Meter unter ihr toste die Brandung. Sie stand am Abgrund, die nackten Zehen um die Felskante gekrümmt. Das Herz schlug ihr bis zum Hals, ihr blondes Haar peitschte in den starken Böen um ihr Gesicht. Ein Sturm braute sich zusammen, weiße Schaumkronen tanzten auf dem schwarzen Wasser, und der Himmel drohte seine Schleusen zu öffnen.
Doch sie bemerkte es kaum, war allein darauf bedacht, all ihren Mut zusammenzunehmen.
Spring! Jetzt! Es ist der einzige Ausweg, das weißt du genau.
Mit Tränen in den Augen berührte sie ihren flachen Bauch unter dem dünnen Baumwollstoff ihres Nachthemds.
Es ist das Beste für dich. Das Beste für Lucas. Das Beste für das Baby.
Oder doch nicht? Ein neues Leben. Ungeboren. Hinter ihren Augen breiteten sich Kopfschmerzen aus, Zweifel wurden laut. War es wirklich das Beste, wenn sie ihrem Leben ein Ende setzte?
Auf jeden Fall! Eine andere Möglichkeit gibt es nicht.
Tränen liefen ihr über die Wangen. Sie wusste, dass das, was sie vorhatte, kompletter Wahnsinn war, trotzdem blieb ihr keine Wahl. Sie konnte nirgendwohin, hatte niemanden, dem sie vertraute. Eine Sekunde lang schloss sie die Augen, holte tief Luft und schmeckte das Salz auf ihren Lippen. All ihre Träume, die Zukunft betreffend, waren auf einen Schlag geplatzt. Hier, in diesem elenden kleinen Sommercamp an der Küste Oregons. Ein sicherer Hafen, ein Garten Eden, der sich unversehens in einen finsteren Hades verwandelt hatte.
Voller Vorfreude war sie zu Beginn des Sommers hierhergekommen, um mit jüngeren Kindern zu arbeiten, das Wort Gottes zu verbreiten, etwas Gutes zu tun, bevor sie im Herbst von der Highschool aufs College wechselte. Doch stattdessen … Ach du lieber Gott! Stattdessen war sie auf Hass gestoßen und auf Schmerz, hatte Liebe erfahren und Zurückweisung, Heimtücke und Verrat.
Und sie hatte gesündigt.
Ach, Lucas. Bei dem Gedanken an ihn musste sie schlucken. Groß und blond, mit breiten, muskulösen Schultern und einem markanten Kinn sah er ausgesprochen gut aus, und er hatte Humor.
Sie blinzelte gegen die Tränen an, die sich mit den ersten Regentropfen vermischten, fühlte sich kreuzunglücklich und allein. Einsam.
Würde sie es über sich bringen? Würde sie es schaffen, sich in die Tiefe zu stürzen? Ins eisige Wasser des tosenden Pazifiks?
Gab es wirklich keinen anderen Ausweg, als sich das Leben zu nehmen? Sie stemmte sich gegen den stürmischen Wind, taumelte. Riss die Augen weit auf und fing sich wieder. Vor sich sah sie nichts als Schwärze. Keinen Horizont.
Tu es! Spring! Es gibt für dich keinen Grund, am Leben festzuhalten. Keinen!
Aber das stimmte nicht, es gab doch –
Plötzlich hörte sie über das Heulen des Windes und das ohrenbetäubende Klatschen der Wellen gegen den Fels hinweg ein Geräusch. Ein helles Scheppern, als schlüge Metall gegen Stein. Ihre Nackenhaare stellten sich auf.
Was war das? War sie etwa nicht allein?
Niemand, der auch nur halbwegs bei Verstand war, würde sich bei diesem Sturm mitten in der Nacht hier herumtreiben.
Sie warf einen flüchtigen Blick über die Schulter auf die felsige Ebene, auf der vereinzelte, windzerzauste Krüppelkiefern wuchsen. Dahinter ragte der Wald mit seinem uralten Baumbestand düster und unheilverkündend in den dunklen Nachthimmel auf. Selbstverständlich war sie allein. Wer außer ihr wäre verrückt genug, sich um diese Uhrzeit und bei diesem Wetter auf einen rutschigen Felsvorsprung zu wagen?
Ganz bestimmt niemand.
Da war nichts. Du bildest dir etwas ein.
Es fing jetzt stärker an zu regnen, dicke Tropfen platschten auf die Abbruchkante, prasselten auf ihre nackten Füße, durchweichten ihr dünnes Nachthemd. Entschlossen verdrängte sie ihre Furcht. Sie war allein, und sie würde springen. Musste springen.
Sie atmete tief durch.
Dachte an ihre Familie, ihre Freundinnen – Erinnerungssplitter tanzten vor ihren Augen, doch sie genügten nicht, ihr so viel Hoffnung zu geben, dass sie von ihrem verzweifelten Vorhaben abließ.
Sie war verloren.
Bleib ganz ruhig. Gleich hast du es hinter dir. Endlich werdet ihr Frieden finden … du und das Baby. Heftige Schuldgefühle rissen an ihr, und sie legte tröstend die Hand auf ihren flachen Leib. »Alles wird gut«, flüsterte sie ihrem ungeborenen Kind zu. Die Worte wurden verschluckt vom heulenden Wind. »Alles wird gut.«
Lügnerin! Gar nichts wird gut! Das, was du da tust, Elle, ist Mord! Sie hörte die mahnenden Worte ihrer Mutter, ihre schrille, vorwurfsvolle Stimme: »Wenn du das tust, Elle, wirst du auf ewig in der Hölle schmoren. Ist es das, was du willst?«
Aber ihre Mutter war nicht hier. Sie war allein. Die Stimme, die sie hörte, war die Stimme der Angst, die versuchte, sie vom letzten, entscheidenden Schritt abzuhalten.
Abermals das metallische Scheppern. Sie erstarrte. Drehte sich um. Hätte beinahe das Gleichgewicht verloren.
Was um alles auf der Welt ist das? Metall, daran besteht kein Zweifel, etwas Metallisches, das gegen Stein schlägt, aber was?
Sie schluckte mühsam.
Spitzte die Ohren, doch jetzt hörte sie das Geräusch nicht mehr. Besorgt drehte sie sich um, starrte mit zusammengekniffenen Augen Richtung Wald. Eine Böe drückte ihr das nasse Nachthemd gegen die Beine. Zum Glück ließ der Regen schon wieder nach. Ein kurzer, heftiger Schauer, wie er typisch war für diese Gegend. Für einen kleinen Moment riss die Wolkendecke auf, der Mond kam hervor.
Plötzlich sah sie es – ein schnelles Aufblitzen, eine Bewegung hinter einer der windgepeitschten Kiefern.
Ihr Herz stand einen Augenblick lang still, die Welt um sie herum ebenfalls – der Regen, der Wind, der Ozean –, alles verblasste, während sie sich auf diesen kleinen Ausschnitt ihres Gesichtsfelds konzentrierte.
Das bildest du dir nur ein! Jetzt flipp nicht aus, atme tief durch und – um Himmels willen!
Eine finstere Gestalt löste sich aus der Dunkelheit und kam langsam auf sie zu.
Das Herz schlug ihr bis zum Hals.
Ach du lieber Gott, was war das denn? Hielt die Gestalt etwa ein Messer in der Hand? Ein großes Messer mit langer, scharfer Klinge?
»Nein«, stieß sie entsetzt hervor, als sie ihren Peiniger erkannte. »Nein, nein, nein!«
Ungläubig schüttelte sie den Kopf, den Blick auf die blitzende Klinge geheftet, streckte erschrocken die Hand aus, um den Streich abzuwehren. Die andere Hand hielt sie schützend vor ihren Bauch. Unwillkürlich machte sie einen Schritt zurück, rutschte mit der Ferse von dem nassen Felsvorsprung ab.
Nein!
Sie wankte, stürzte auf ein Knie und ruderte wild mit den Armen, um Halt zu finden, sich irgendwo festzuklammern. Eine kräftige Böe drückte sie nach hinten.
Im selben Augenblick zuckte ein Blitz über den Himmel und tauchte das Gesicht ihres Peinigers in ein grelles, verzerrendes Licht. Sie sah sein bösartiges Grinsen, die Zufriedenheit in seinen tief in ihren Höhlen liegenden Augen.
Er kam zu ihr auf den Felsvorsprung.
Panisch tasteten ihre Finger auf der Suche nach Halt über den felsigen Boden. Ihr Fuß fand einen vorstehenden Stein.
Auf einmal wollte sie nicht mehr sterben.
Wollte weiterleben, zusammen mit ihrem Baby.
Mit aller Kraft krallte sie sich an einem Stein fest, Auge in Auge mit dem personifizierten Bösen. Bitte, lieber Gott, flehte sie, bitte hilf uns!
Donner hallte über das schwarze Wasser. Ihr Angreifer machte einen Satz nach vorn, ein finsterer Dämon, der sich unerbittlich auf sie stürzte.
Elle warf sich zur Seite, um ihm auszuweichen, doch es war zu spät. Mit einem lauten Aufschrei rutschte sie von der Abbruchkante. Eine behandschuhte Hand packte sie, stählerne Finger schlossen sich um ihr Handgelenk.
Was hatte das zu bedeuten? War er gar nicht ihr Peiniger? War er ihr Retter?
Ein winziger Hoffnungsschimmer stahl sich in ihr Herz, doch dann spürte sie, wie sich seine Finger lösten.
Mit dem Rücken voran, den Blick in den dunklen Nachthimmel gerichtet, fiel Elle den salzigen Fluten entgegen. Bevor sie ins eisige Wasser eintauchte, sah sie für den Bruchteil einer Sekunde, wie er sich über die Kante beugte, um zuzuschauen, wie sie und ihr Baby dem Tod entgegenstürzten.
Kapitel zwei
Camp Horseshoe
Damals
Monica
Sie hatte einen Fehler gemacht.
Einen großen, nein, eher einen kolossalen Fehler.
Einen Fehler, den sie nicht würde wiedergutmachen können.
Verdammt noch mal, dachte Monica, die vollständig angezogen auf ihrer Pritsche in dem Blockhaus lag, wo sie, kaum neunzehn Jahre alt, für acht Elfjährige verantwortlich war. Sie hatte einen halbprivaten Bereich für sich – genauer gesagt eine kleine Nische mit einem offenen Fenster zu dem großen Raum, in dem die Mädchen auf Pritschen aus Holz und Leinen, die noch aus den fünfziger Jahren stammten, in ihren Schlafsäcken schliefen. Alles an diesem vermaledeiten Camp war mehr als retro, was sie dem tyrannischen Prediger zu verdanken hatten, der dieses Dreckloch von Sommercamp besaß und leitete. Jeremiah Dalton erinnerte mehr an einen Diktator als an einen Mann Gottes, zumal sein herrisches Gehabe herzlich wenig mit christlichem Handeln zu tun hatte. Dalton, ein großer, imposanter Mann mit scharfem Blick und markanten Gesichtszügen, besaß einen Doktortitel in Theologie, auf den er so stolz war, dass er von allen mit »Doktor« oder »Reverend« angeredet werden wollte. Sogar von seiner Frau und seinen Kindern. Wie krank war das denn?
Aber jetzt wollte sie nicht an ihn denken.
Sie hatte weitaus größere Probleme als einen an Selbstüberschätzung leidenden Prediger, dachte sie bitter, den Blick auf die frei liegenden Dachbalken über ihr geheftet. Durch die offenen Fenster der Blockhütte hörte sie den einsamen Schrei einer Eule. Er übertönte das immerwährende Rauschen der Brandung, die keine Viertelmeile entfernt gegen die Klippen schlug.
Monica warf einen Blick auf ihre Uhr. Fast Mitternacht.
Die anderen Betreuerinnen würden sich in der Bucht versammeln und dort auf sie warten. Sie alle waren – genau wie sie selbst – Betreuerinnen im Camp Horseshoe und echte Zicken, jede einzelne. Sie hasste sie alle, und sie fragte sich, warum sie sich einer von ihnen anvertraut hatte. Was hatte sie sich bloß dabei gedacht? Ja, Bernadette Alsace konnte ein Geheimnis für sich behalten, zumindest hoffte Monica das, dennoch hätte sie das sportliche Mädchen mit dem messerscharfen Verstand und der noch schärferen Zunge niemals einweihen dürfen. Zumal es da noch Bernadettes jüngere Schwester Annette gab. Wie um alles auf der Welt war diese mickrige Schwätzerin an einen so verantwortungsvollen Job gekommen? Kaum älter als die Kids, die sie zu beaufsichtigen hatte, drückte sich Annette bei den Schlafhütten und dem Empfangsgebäude herum, die Ohren gespitzt, um nur ja nicht den neuesten Klatsch und Tratsch zu verpassen. Um ehrlich zu sein, machte Annette mit ihren großen Augen und dem ach so unschuldigen Lächeln ihr Angst.
Was für ein Freak!
Ein weiterer Blick auf die Uhr. Mist, sie musste sich dringend auf die Socken machen.
Monica spürte, wie sich ihre Stimmung veränderte, von schlecht zu grottenschlecht abrutschte, aber sie konnte es nicht ändern.
Sie war schwanger gewesen, hatte Tyler die Nachricht überbracht, dass er Vater werden würde – ob es ihm gefiel oder nicht. Hatte insgeheim gehofft, er würde seine Haltung ändern, wenn er davon erfuhr, würde sie lieben und heiraten. Sie schluckte. Das war vor zwei Wochen gewesen. Inzwischen war alles anders. Sie hatte angefangen zu bluten und Krämpfe bekommen … und jetzt war nichts anderes mehr in ihr als tiefe Trauer.
Sie hatte nicht vorgehabt, schwanger zu werden, bei Gott nicht, aber es war nun mal passiert. Und obwohl sie sich nicht hatte vorstellen können, ein Baby zu bekommen, geschweige denn großzuziehen – dafür war sie doch noch viel zu jung! –, war sie enttäuscht gewesen über die Fehlgeburt, die ihre romantischen Träume von einem Leben mit Tyler auf einen Schlag zerstört hatte. Er sah so gut aus mit seinem dichten braunen Haar, dem kantigen Kinn und den Augen, die die Farbe von Stahl hatten …
Strotzend vor Leben, sportlich, bereit für jedwede Herausforderung, war er alles, was sie sich je gewünscht hatte, und dann bekam sie auch noch ein Baby von ihm …
Kein Baby. Tränen traten in ihre Augen, aber sie drängte sie zurück und redete sich ein, dass es besser so war. Jetzt konnten sie beide aufs College gehen und … und Tyler konnte Jo-Beth heiraten, das Mädchen, mit dem er so gut wie verlobt war. Halt, stopp – das verfluchte Miststück, mit dem er so gut wie verlobt war.
Monica krümmte sich innerlich bei dieser Vorstellung.
Lautlos stand sie auf und spähte durch das Fenster in den großen Raum der Blockhütte, der nur von einem kleinen Nachtlicht beleuchtet wurde. Alle Pritschen waren belegt, die Mädchen schliefen tief und fest nach einem anstrengenden Tag mit Reitstunden, Schwimmen, Bibelkursen und Küchen- oder Latrinendienst, gefolgt von dem allabendlichen Lieder- und Gebetstreffen.
Um zehn wurden die Lichter gelöscht, und nach einer halben Stunde heimlicher Tuscheleien war auch das letzte Mädchen eingeschlafen. Sogar die überängstliche Bonnie Branson, die kleiner war als die anderen und lange, blonde Löckchen hatte. Sie schlief nur ein, wenn sie sich an ihren heißgeliebten einäugigen Teddy klammern konnte. Stofftiere waren laut Dr. Dalton eigentlich verboten, aber Monica hatte der Kleinen erlaubt, ihren rosafarbenen Knuddelbär zu behalten. Wenn er die vor Heimweh weinende Elfjährige beruhigte und dafür sorgte, dass sie wenigstens etwas Schlaf abbekam, war das doch eine gute Sache. Die übrigen Mädchen waren da leider anderer Meinung, vor allem Kinley Marsh, die sie eifrig auf den Regelverstoß hinwies und wiederholt drohte, sie beim Reverend zu verpetzen. Monica hatte ihre Schützlinge gewarnt: Wenn einer von ihnen ein Wort verriet, würde sie nicht mehr Abend für Abend die Blockhütte nach Schlangen absuchen. Alle hatten panische Angst vor Waldklapperschlangen, auch wenn diese hier, in der Nähe des Ozeans, kaum zu finden waren. Zum Glück wusste das keins der Mädchen, nicht einmal die lesewütige, aufgeweckte Kinley. Die anderen ordneten sich Kinley unter, und Monica belohnte sie mit Schokolade dafür, dass sie den Mund hielten. Die Schokolade hatte sie aus der Küche geklaut, noch ein Geheimnis, das die Mädchen eisern für sich behielten.
Herrgott, war das alles ein Mist! Zum Teufel mit Reverend Dalton und seinen despotischen Regeln!
Geräuschlos schlüpfte Monica in ihre Schuhe, band sie zu, dann warf sie einen letzten Blick auf ihre schlafenden Schützlinge, nahm ihre Kapuzenjacke von einem Kleiderhaken an der Wand und die Taschenlampe für die nächtlichen Toilettengänge von einem kleinen Regal und schlüpfte durch die große Holztür hinaus in die kühle Nachtluft.
Sie atmete die salzige Luft des Ozeans ein, die sich mit dem Rauch des erlöschenden Lagerfeuers in der Mitte der kreisförmig angeordneten Blockhütten vermischte. Vereinzelte Kohlen glühten rot auf und warfen unheimliche Schatten auf die Wände. Für einen kurzen Moment meinte Monica, jemanden auf einer der Bänke rund ums Feuer sitzen zu sehen, eine dunkle, vornübergebeugte Gestalt, die den Kopf drehte, um in ihre Richtung zu blicken.
Erschrocken schnappte sie nach Luft und machte einen Schritt zurück, doch dann stellte sie fest, dass sie lediglich eine Schaufel gesehen hatte, die an der Sitzfläche lehnte.
Herrgott Sakrament!, schoss ihr durch den Kopf, der Lieblingsfluch ihrer Mutter. Wie hatte sie eine Schaufel mit einem Menschen verwechseln können? Ja, sie hatte wahrhaftig eine überbordende Fantasie. Niemand wusste, dass sie hier draußen war. Niemand ahnte, was sie vorhatte. Es war lediglich ihr eigenes Schuldgefühl, das sie so ausflippen ließ.
Leise zischend stieß sie die angehaltene Luft aus und sah sich nach allen Seiten um. Acht Hütten, einschließlich der, die ihrer Verantwortung unterlag. Alle wurden von weiblichen Betreuerinnen überwacht, und alle waren dunkel. Die Hütten der Jungs lagen ein Stück entfernt am Waldrand. Ohne die Maglite einzuschalten, schlüpfte Monica zwischen zwei Hütten hindurch zu einem Pfad, der von den zentralen Gebäuden fort und in den Wald hineinführte. Dieser Weg wurde nicht so häufig benutzt und war länger, aber so konnte sie sich wenigstens halbwegs sicher sein, nicht den anderen Betreuerinnen zu begegnen.
Sie würde sich jetzt mit Tyler treffen, nur noch dieses eine Mal, um ihm zu sagen, dass –
Plötzlich hörte sie Stimmen. Flüstern.
Mist! Sie durfte auf keinen Fall gesehen werden. Von niemandem!
Die Stimmen kamen näher. Monica bemerkte den schwachen Lichtstrahl einer Taschenlampe.
Eilig versteckte sie sich im Unterholz und drückte sich mit dem Rücken gegen einen dicken Baumstamm. Knack! Unter ihrem Turnschuh zerbrach ein Zweig. Verdammt! Bitte, lieber Gott, mach, dass sie mich nicht sehen!
»Was war das?«, wisperte eine Stimme, die Monica als die von Reva Mercado erkannte.
O nein! Nicht ausgerechnet Reva, ein toughes, cleveres Mädchen, das ziemlich aufbrausend sein konnte, wie Monica mehr als einmal am eigenen Leib erfahren hatte. Sie traute Reva nicht, und mögen tat sie sie schon gar nicht. Der Lichtstrahl der Taschenlampe setzte sich wieder in Bewegung, schweifte über die umliegenden Büsche und Sträucher.
Am liebsten wäre Monica mit dem Baumstamm verschmolzen. Sie durften sie nicht entdecken! Ihre Gedanken überschlugen sich. Was sollte sie sagen, wenn sie sie hier im Unterholz fanden? Dass sie pinkeln musste? Oder dass sie sie kommen gehört, ihre Taschenlampe bemerkt und sich versteckt hatte, weil sie dachte, Reverend Dalton oder einer seiner Söhne sei auf Patrouillengang?
»Was ist?« Die Stimme gehörte Jo-Beth Chancellor.
Na super. Einfach großartig. Jo-Beth war ein echtes Miststück, eine gertenschlanke Rothaarige, die im Herbst auf irgendein Elitecollege gehen wollte. Sie kam aus reichem Haus und stank förmlich nach Geld. Der einzige Grund, warum sie hier, in Camp Horseshoe, als Betreuerin arbeitete, war der, dass sie in Tyler Quade verliebt war. Tyler wiederum nahm aus purer Abenteuerlust am Camp teil. Er hatte seinen überfürsorglichen Eltern entkommen und den Geschmack der Freiheit kosten wollen, bevor er in Colorado aufs College ging. Allerdings hatte er nicht mit Reverend Dalton und seinen eisernen Regeln gerechnet.
Monica schluckte, als sie an Jo-Beth dachte und daran, was sie hinter deren Rücken getan hatte.
»Hast du das nicht gehört?«, fragte Reva.
»Nein. Was?«
»Keine Ahnung. Ein Knacken. Als sei jemand auf einen Zweig getreten.« Revas Stimme klang nervös. »Kann es sein, dass außer uns noch jemand hier draußen ist?«
O Gott, nein, bitte nicht!
»Klar. Wir sind doch alle unterwegs«, erinnerte Jo-Beth die andere. »Weil wir uns gleich in der Höhle treffen.«
»Ich weiß, aber –«
»Wegen Elle. Sie ist der Grund für unser Treffen.« Ihr Ton klang beinahe drohend, als sei sich Reva der Bedeutung dieser nächtlichen Zusammenkunft nicht bewusst. Was seltsam war, fand Monica, denn Reva war eine üble Intrigantin, die sich darauf verstand, immer wieder ihren eigenen Hintern zu retten.
Ganz anders als die verträumte Elle Brady, die Betreuerin, die für Hütte Nummer fünf verantwortlich und urplötzlich wie vom Erdboden verschluckt war. Niemand wusste, wo sie sein konnte, ob ihr womöglich etwas zugestoßen war, zumindest behaupteten das alle, allerdings hatten auch alle Grund genug zu lügen. Wenn sie nicht bald gefunden wurde …
»Erinnere mich nicht daran! Elle ist eine Spinnerin.« Die dunkeläugige Reva mit dem verschlagenen Grinsen war dafür bekannt, dass sie mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg hielt. »Ich wäre nicht erstaunt, wenn sie sich aufgrund irgendwelcher verquerer romantischen Fantasien von der Selbstmordklippe gestürzt hätte.«
»O Gott, warum sollte sie das tun?«
»Weil Lucas sie verlassen hat. Für Bernadette, diese blöde Schlampe.« Reva schien ziemlich überzeugt von ihrer Theorie, und wenn Monica ehrlich war, musste sie zugeben, dass tatsächlich etwas dran sein konnte. Die Polizei würde bestimmt darauf anbeißen. Lucas war der älteste Sohn von Reverend Dalton und das Faktotum des Sommercamps. »Elle ist labil, das weiß doch jeder. Sie hätte niemals als Betreuerin arbeiten dürfen.«
Das stimmte. Bernadette, eine der beiden Alsace-Schwestern, die ebenfalls zu den Betreuern im Camp Horseshoe zählten, war auf alle Fälle um einiges vernünftiger als Elle.
Jo-Beth schwieg für einen kurzen Moment. Monica konnte beinahe hören, wie sich die Rädchen in ihrem Gehirn drehten. »Das klingt gut«, sagte sie schließlich gedehnt.
»Gut? Wovon redest du?«
»Davon, dass sie sich von der Klippe ins Meer gestürzt hat. Damit könnten wir’s probieren.«
»Wie meinst du das?«, fragte Reva misstrauisch.
»Ach, komm schon. Du weißt genau, was ich meine. Wir brauchen eine Story, richtig? Um die Polizei zu überzeugen, dass wir nichts damit zu tun haben.«
»Das ist mir klar, aber –«
»Jede von uns braucht ein Alibi, auch du, Reva«, zischte Jo-Beth. »Die Cops werden uns morgen befragen, eine nach der anderen.«
»Mist.«
»Siehst du? Wir sollten uns also besser überlegen, was wir ihnen sagen. Aber das besprechen wir gleich in der Höhle. Sie kommen doch alle, oder?«
»Ja. Jayla hat fest zugesagt.«
Jayla Williams war eine Afroamerikanerin aus Portland. Angeblich hatte sie dort einen festen Freund, war so gut wie verlobt, trotzdem schien sie sich für andere Männer zu interessieren. Monica hatte bemerkt, wie sie die männlichen Betreuer musterte und auch einige der anderen Camp-Angestellten.
»Die Kleptomanin?«
»Ja«, bestätigte Reva.
Wenn die Gerüchte stimmten, hatte Jayla ziemlich klebrige Finger.
»Was ist mit Sosi? Sie wird doch nicht etwa kneifen?«
»Sie hat geschworen zu kommen«, versicherte Reva.
Sosi Gavin, die elfenhafte, streng religiöse Turnerin, hatte all ihre Hoffnungen auf ein Stipendium gesetzt.
»Und die Schwestern?«
Reva schnaubte. »Bernadette und Annette wollen beide kommen, aber Nell bleibt im Camp. Sie weiß nichts von unseren Plänen.
»Sie ist mir egal. Es geht mir um die anderen.«
Reva runzelte die Stirn. »Ich mache mir Sorgen wegen der Schwestern. Bernadette ist … Ach, ich weiß auch nicht. Genauso scheinheilig, wie ihre Schwester sonderbar ist – ständig belauscht sie unsere Gespräche, obwohl sie behauptet, das nicht zu tun. Total unheimlich, und Bernadette kaufe ich ihr Gutmenschgetue auch nicht ab.«
»Trotzdem müssen wir sicher sein, dass alle mit an Bord sind.«
»Sogar Monica?«, fragte Reva mit höhnischer Stimme.
»Na ja …«
Monicas Herzschlag beschleunigte sich.
»Wir sind alle keine Unschuldslämmer.«
»Aber wenn wir der Polizei helfen können, Elle zu finden –«
»Glaub mir, die Polizei mit ihren Officers, Detectives, Computern und dem ganzen Schnickschnack braucht unsere Hilfe nicht.« Jo-Beth’ Stimme klang vernichtend.
»Aber wenn wir Beweismaterial unterschlagen –«
»Welches Beweismaterial? Das tun wir doch gar nicht! Ich sage lediglich, dass wir uns eine Geschichte zurechtlegen müssen. Wir erzählen allen, wie traurig Elle war, wie missmutig, und dass sie vielleicht gar nicht mehr leben wollte. Das ist die Wahrheit, oder etwa nicht?«
Reva schwieg. Im Wald war nichts zu hören außer dem leisen Seufzen des Windes und dem fernen Tosen der Wellen. Und natürlich dem schnellen Pochen von Monicas Herz.
»Oder etwa nicht?«, wiederholte Jo-Beth. Herrgott, sie war ein so herrisches Miststück!
»Ich denke schon«, antwortete Reva zögernd.
»Du denkst nicht, du weißt das.«
Monica stellte sich vor, wie Jo-Beth der kleineren Reva ihren langen, schlanken Zeigefinger gegen die Brust stieß.
»Richtig?«
»Na schön, wenn du meinst.« Reva ließ sich nicht so leicht unterkriegen, auch nicht von Jo-Beth. Sie war in Ost-L.-A. aufgewachsen und erst vor zwei Jahren nach Oregon gezogen, in eine Kleinstadt namens Woodburn. Reva war hübsch, clever und gerissen, es brauchte einiges, um sie zum Einknicken zu bringen, sie gab nicht schnell klein bei.
»Gut.« Jo-Beth klang zufrieden. »Wo ist das Messer?«
Das Messer? Wovon redete sie?
»Ich hab’s vergessen.«
»Du hast was?«
»Es tut mir leid. Ich hab’s nicht weit von hier versteckt. Warte kurz, dann hole ich es.«
»Verdammte Scheiße!«, explodierte Jo-Beth.
»Ich hab doch gesagt, ich hole es. Beherrsch dich!«
»Aber wir haben nicht mehr viel Zeit!«
Reva wollte ein Messer holen? Warum? Monica hielt den Atem an und wünschte, sich davonstehlen zu können. Aber noch war Jo-Beth in der Nähe, und das Risiko, ihr über den Weg zu laufen, durfte sie nicht eingehen. Der Wind frischte auf, ließ die Blätter in den Baumkronen rascheln. Monica harrte reglos hinter dem Baumstamm aus. Die Minuten verstrichen. Ob Tyler noch auf sie wartete oder ob er aufgegeben hatte und schon gegangen war?
»Komm schon, beeil dich«, hörte sie Jo-Beth murmeln, und ausnahmsweise stimmte Monica ihr zu. Wie sie diese blöde Kuh hasste!
Sie warf einen Blick auf die Uhr. Reva war seit über zehn Minuten fort. Sollte sie versuchen, sich an Jo-Beth vorbeizuschleichen, die immer noch den Weg blockierte? Doch was, wenn sie auf einen Zweig trat oder über eine Wurzel stolperte?
Nein, es war besser, sie würde warten.
Jo-Beth schäumte. Am liebsten hätte sie vor Wut geschrien, aber sie beherrschte sich und wartete an der Gabelung zwischen Höhle und alter Kapelle auf Reva. Herrgott, wo steckte sie nur? Wenn sie nicht bald auftauchte, wäre alles umsonst gewesen. Wie hatte sie bloß das verdammte Messer vergessen können?
Das Messer war das Schwierigste bei diesem Plan. Reva wusste es, trotzdem hatte sie es vergessen. Wie blöd war das denn?
»Komm schon, beeil dich«, murmelte sie nervös. Die Nerven gespannt wie Flitzbögen, wartete sie in der Dunkelheit, spitzte die Ohren und sehnte sich nach einer Zigarette. Sie hatte so viel zu tun und so wenig Zeit.
Und dann war da noch der entflohene Häftling. Ein Mörder. Das zumindest hatte Doktor Dalton oder Reverend Dalton – oder wie auch immer der tyrannische Leiter des Sommerlagers genannt werden wollte – behauptet. Er hatte die Kinder und Jugendlichen nicht direkt gewarnt, wollte sie vielmehr beschwichtigen, doch zumindest bei Jo-Beth hatten seine Worte Öl ins Feuer gegossen. Jetzt war sie noch nervöser als zuvor, nahezu paranoid. Was allerdings auch daran liegen konnte, dass ihr Freund sie betrog.
»Lächerlich«, murmelte sie mit zusammengebissenen Zähnen.
Sie wusste nicht, auf wen sie wütender sein sollte, auf Tyler oder auf Monica, aber sie entschied sich für Monica, die in ihren Augen eine hinterhältige, berechnende Schlampe war. Doch wer hätte gedacht, dass sie es tatsächlich wagen würde, die Grenze zu überschreiten, mit Tyler zu flirten, herumzuknutschen und sich dann auch noch von ihm vögeln zu lassen? Wirklich, die ganze Misere war Monicas Schuld. Jungs waren so dumm und geil und dachten oft nur mit ihrem Schwanz … Ja, Monica hatte verdient, was sie bekommen würde.
Ob sie wirklich schwanger war?
Tyler, dieser Schwachkopf, war vor zwei Tagen angekrochen gekommen, kurz bevor die verrückte Elle verschwand. Er hatte Jo-Beth nach der abendlichen Flaggenzeremonie bei der Hand genommen und hinter eine hohe Hecke gezogen. Nach einem prächtigen Sonnenuntergang blinkten am lila leuchtenden Abendhimmel bereits die ersten Sterne. Jo-Beth war glücklich gewesen, hatte sie doch angenommen, er wolle sich tatsächlich bei ihr entschuldigen, ihr gestehen, dass er einen großen Fehler gemacht habe, dass er sie liebe, und zwar nur sie, und dass Monica ein Flittchen sei, das ihm den Kopf verdreht habe, aber es sei jetzt vorbei.
Doch das hatte er nicht getan.
Er war nervös gewesen, hatte geschwitzt und sich immer wieder mit den Händen durchs Haar gestrichen.
»Was ist?«, fragte sie.
Er blinzelte, dann riss er sich zusammen und antwortete mit heiserer Stimme: »Sie ist schwanger.«
»Wie bitte?«, wisperte sie und spürte, wie ihr Inneres zu Eis gefror. »Wer?« Doch noch bevor er antworten konnte, wusste sie es. Sein panischer Blick genügte, um sie zu überzeugen, dass er zutiefst geschockt war. Angst hatte vor den Konsequenzen, die diese Schwangerschaft nach sich ziehen würde. Es gelang ihr, die Worte »Großer Gott, Tyler, was hast du getan?« hervorzustoßen.
Schniefend wischte er sich mit dem Handrücken die Nase ab und schaute für einen kurzen Moment zur Seite. Die Muskeln in seinem Gesicht arbeiteten angestrengt, als er stammelnd hervorstieß: »Ich … Herrgott … ach, Mist … du weißt, was ich getan habe. Ja, das war dumm von mir und … Ach, zum Teufel, ich bin am Arsch. Total am Arsch.« Er kauerte sich zusammen und presste die Hände an die Schläfen, als fürchte er, sein Kopf könne jeden Augenblick explodieren. »Am Arsch …« Mit einiger Mühe schaute er zu ihr auf, dann hob er den Blick zum immer dunkler werdenden Himmel. In seinen Augen glänzten Tränen. »Was um alles auf der Welt soll ich nur tun?«
Woher sollte sie das wissen? Aber war es nicht schon immer so gewesen? Er baute Mist, und sie musste es wieder geradebiegen? Seit der zehnten Klasse waren sie ein Paar, und immer war sie diejenige gewesen, die dafür sorgte, dass alles glattlief. Ihretwegen. Seinetwegen. Für sie beide. Schließlich war er ein guter Fang: groß, sportlich, attraktiv, und aus reichem Hause kam er auch noch.
»Es ist dein Baby«, zischte sie. »Damit musst du allein klarkommen.«
»Jo, bitte hilf mir!«
Ihre Nackenmuskeln spannten sich an. »Dein Baby. Dein Problem. Lös es!«
»Das kann ich nicht! Nicht ohne dich.«
Sie drehte sich um, wollte davonlaufen, sich verstecken und sich die Augen ausheulen, aber er sprang auf, packte ihr Handgelenk und zog sie an sich. »Du musst mir helfen, Jo. Es gibt nur dich und mich. Uns beide. Für immer. Das weißt du.« Der Mond warf ein silbriges Licht auf sein Gesicht. Wie ernst er aussah! »Ich weiß, dass ich Mist gebaut habe, und es tut mir leid. Schrecklich leid. Aber ich liebe nur dich, mein Schatz.« Er strich ihr die Haare aus dem Gesicht, so zärtlich, dass ihr das Herz gebrochen wäre, läge es nicht ohnehin schon wegen seines Betrugs in tausend Scherben.
»Und wie konnte sie schwanger von dir werden, wenn es nur ›uns beide‹ gibt, hm?«
»Jo –«
Klatsch! Sie verpasste ihm eine Ohrfeige, so fest, dass ihre Handfläche brannte und er die freie Hand unweigerlich zur Faust ballte. »Es ist aus, Ty. Aus und vorbei. Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Ein Baby … Du wirst Vater, du bekommst ein Kind von ihr!« Sie starrte ihn mit weit aufgerissenen Augen an und spürte, wie ihr die Tränen kamen. Wütend kniff sie die Lider zusammen. »Diesmal bist du auf dich allein gestellt. Viel Glück, Daddy! Du wirst es brauchen.« Sie versuchte, sich loszureißen, aber er lockerte seinen Griff nicht.
»Ich liebe dich«, flüsterte er heiser, gequält.
»Und warum hast du dann mit ihr geschlafen?«
»Ich weiß es nicht. Bitte, Jo …« Er ließ ihr Handgelenk los und schlang seine Arme um sie. »Glaub mir, ich liebe dich. Nur dich allein!«
»Du Scheißkerl!« Zornig trommelte sie mit den Fäusten auf seine Brust, ließ ihren Gefühlen freien Lauf. »Du gottverdammtes Arschloch! Was ist bloß los mit dir? Warum musstest du sie unbedingt vögeln? Ich hasse dich!« Am liebsten hätte sie ihn umgebracht, doch schließlich ließ sie erschöpft von ihm ab und sackte gegen ihn. »Bist du sicher, dass das Baby von dir ist?«
Einen Herzschlag Schweigen, dann sagte er zögernd: »Ich … ich weiß es nicht.«
»Du weißt es nicht.«
»Sie behauptet, es sei von mir, aber … Wie kann ich mir da sicher sein?« Plötzlich wirkte er aufgeregt, als sei ihm selbst nie die Idee gekommen, dass ein anderer dieses Flittchen geschwängert haben könnte. »Sie ist auch viel mit David und Ryan zusammen, und sie hat mir mal erzählt, dass sie Ryan heiß findet.«
Die Tremaine-Brüder. Schwester Naomis Jungs, die Stiefsöhne von Dr. Dalton.
»Aber du bist dir sicher, dass sie wirklich schwanger ist?«
Neuerliches Schweigen, bevor er gedehnt antwortete: »Nein …« Sein Atem strich über ihren Scheitel, der Druck seiner Arme wurde fester. »Aber warum sollte sie so etwas behaupten?«
War er wirklich so dämlich? »Das kommt doch ständig vor, Ty. Ein Mädchen behauptet, es sei schwanger, heiratet den Jungen, und dann – upps! – kein Baby.«
»Wie? Du meinst, dann passiert eine Fehlgeburt?«
»Nein, du Dummkopf! Ich meine, dass das Mädchen nur so tut, als sei es schwanger!«, zischte sie so laut, dass sie ein kleines Tier – einen Vogel, ein Eichhörnchen oder ein Kaninchen – im Unterholz aufscheuchte.
»Gut möglich, dass sie gelogen hat.« Er legte nachdenklich die Stirn in Falten. »Das würde ich ihr zutrauen.« In seiner Stimme schwang neue Hoffnung mit.
Ich auch, dachte Jo-Beth, obwohl das im Grunde gar nicht der Punkt war. Das eigentliche Problem bestand darin, dass Tyler sie betrogen hatte.
Unfassbar, dass er ihr untreu gewesen war, ihr, Jo-Beth Chancellor. Sie wusste, dass sie schön war, man hatte sie sogar gefragt, ob sie modeln wolle. Dazu musste man eine perfekte Figur haben und mehr als gut aussehen. Aber sie konnte nicht nur mit ihrem Äußeren punkten – sie war noch dazu ausgesprochen intelligent, würde nach Yale gehen … Herrgott noch mal, sie war ein Genie! Ein umwerfendes, reiches, megasexy Genie! Und was war Monica O’Neal? Weißer Abschaum. Zugegeben – sie sah auf eine billige Art und Weise hübsch aus mit ihren vollen Lippen und den großen Brüsten, auf die die Jungs so standen, aber sie war ein Nichts. Eine Null.
Und jetzt war sie schwanger. Erneut wallte Zorn in Jo-Beth auf, erneut zwang sie sich, sich zu beherrschen. »Reiß dich zusammen«, sagte sie schnippisch, während sie von Tyler zurücktrat, um wieder klar denken zu können, auf der Suche nach einer Lösung seines Problems. Wieso hatte die dumme Kuh nicht wenigstens die Pille genommen? Eins stand fest: Sie mussten Monica eine Lektion erteilen, ihr einen Denkzettel verpassen, den sie nicht so schnell vergessen würde.
»Hör mal, Ty, mir kommt gerade eine Idee. Ich glaub, wir kriegen das hin.«
»Du hilfst mir?«
»Tue ich das nicht immer?«
Tief in ihrem Herzen wusste sie, dass sie verrückt war, wenn es um ihn ging, aber im Augenblick machte ihr das nichts aus; sie wollte ihn einfach nur zurückhaben. Und sich an Monica rächen. Jo-Beth war noch nie einer Auseinandersetzung aus dem Weg gegangen, und sie würde auch jetzt nicht damit anfangen. Stattdessen schmiedete sie bereits einen Plan. Am liebsten hätte sie das Miststück einfach umgebracht, eigenhändig erwürgt, aber das ging nicht. Jo-Beth hatte vor, Jura zu studieren und Anwältin zu werden, da würde sich ein Mord in ihrem Lebenslauf nicht gerade gut machen. Nein, sie musste sich etwas Besseres überlegen.
»Ich wusste, dass du mich verstehst«, sagte Tyler eine Spur zu schleimig.
»Nein, du irrst dich – ich verstehe dich keineswegs«, brauste sie auf und kratzte ihm empört mit den Fingernägeln durchs Gesicht.
»Au! Was soll das? Verdammt, tut das weh!«
»Was das soll?« Fast hätte sie gelacht. »Glaubst du wirklich, du kommst so leicht davon? Ich werde nie verstehen, warum du was mit ihr angefangen hast, obwohl du mich hattest.«
»Ich –«
»Spar dir deine Ausreden! Ich will, dass so etwas nie wieder vorkommt, hast du mich verstanden? Sorg dafür, dass du deinen Schwanz in der Hose behältst, sonst ist es aus zwischen uns, und zwar für immer! Und wer soll dir dann bei deinen Problemen helfen, hm?«
Einen Augenblick lang flackerte Widerstand in seinen Augen auf. Obwohl er nicht gerade der Hellste war, ließ er sich nicht gern vorschreiben, was er zu tun hatte. Trotzdem nahm er sich zusammen und stieß aufgeregt hervor: »Mein Gott, ich liebe dich, Jo!«
Zufrieden hatte Jo-Beth ihm über die zerschrammte Wange gestrichen, hatte das Blut unter ihren Fingern gespürt und all ihren Zorn auf Monica O’Neal konzentriert, die wahre Verräterin.
Die Isebel.
Die Verführerin.
Die Schlampe, die bestraft gehörte.
Und genau deshalb stand Jo-Beth jetzt hier, versteckte sich an der Weggabelung zwischen Höhle und alter Kapelle hinter einer Douglasie und wartete auf Reva, um endlich ihren Plan in die Tat umzusetzen.
Und zu welchem Zweck?
Aus purer Rache?
Weil du in Wirklichkeit nicht an Tyler Quades unsterbliche Liebe und ewige Treue glaubst und deshalb meinst, du müsstest Monica einschüchtern?
Hm.
Einmal ein Betrüger, immer ein Betrüger.
Die lästige Stimme in ihrem Kopf bestätigte nur das, was sie längst wusste, sosehr sie ihm auch glauben wollte. Die schlichte Wahrheit war, dass sie Tyler nicht vertrauen konnte. Er liebte das Risiko, liebte Extremsportarten und war ein echter Teufelskerl, der stets bis an seine Grenzen ging, auch beim Sex. Sie wusste das, und sie fürchtete, dass er sich durch sämtliche bereitwilligen Kommilitoninnen vögeln würde, wenn er im kommenden Herbst nach Colorado ans College ging. Allein der Gedanke daran brachte Jo-Beth’ Blut zum Kochen. Dummerweise war sie davon ausgegangen, dass er es in einem christlichen Camp nicht wagen würde, derart über die Stränge zu schlagen, aber leider hatte sie falsch gedacht. Sie hatte nur seinetwegen eingewilligt, diesen dämlichen Betreuerjob zu übernehmen, und das hatte sie nun davon.
Was glaubte er eigentlich, wer er war?
Jetzt brauchte sie wirklich dringend eine Zigarette, aber sie hatte ihre Schachtel ganz unten in ihrem Rucksack versteckt und in der Hütte gelassen.
Schritte näherten sich. Ein Lichtstrahl hüpfte durch die Dunkelheit. Jo-Beth drückte sich mit dem Rücken gegen den dicken Stamm der Douglasie, nur für den Fall, dass es nicht Reva war, die da den Pfad entlangkam. Die Schritte wurden langsamer, Jo-Beth hörte atemloses Keuchen.
»Jo-Beth?«, flüsterte Reva.
Endlich! »Ich bin hier.« Sie trat hinter dem Baum hervor und ging zu Reva, die auf dem Pfad stand und versuchte, wieder zu Atem zu kommen, vornübergebeugt, die Hände auf die Knie gestützt, als sei sie einen Marathon gelaufen und nicht nur eine knappe halbe Meile.
Reva richtete sich auf. »Wir haben nicht viel Zeit. Sosi hat das hier gesehen.« Sie hielt das Messer in die Höhe.
Jo-Beth hätte sie küssen können. Sie brauchten das Messer, und Reva war der einzige Mensch, der es Cookie vor der Nase wegstehlen konnte. Sie hatte es tatsächlich geschafft. Das war die gute Nachricht. Die schlechte war, dass Sosi, dieser Jammerlappen, Wind davon bekommen hatte und sich womöglich zusammenreimte, was sie vorhatten. »Herrgott, Reva. Warum hast du zugelassen, dass sie das Messer sieht?«
»Das wollte ich nicht. Ich bin buchstäblich über sie gestolpert, als sie dabei war, mit Nell rumzumachen.«
»Mit Nell? Du meinst –«
»Ich weiß nicht, was das sollte, und es ist mir auch egal, aber sie haben heftig geknutscht und sich befummelt. Nell ist sofort abgehauen, ich glaube nicht, dass sie das Messer bemerkt hat. Sosi dagegen war total außer sich, weil ich die zwei erwischt hatte, und hat allen möglichen Unsinn geredet, um sich zu rechtfertigen. Dabei hat sie das Messer gesehen. Das konnte ich nicht verhindern.«
»Natürlich hättest du das verhindern können. So doof bist du nun auch wieder nicht!«
»He! Sprich nicht so mit mir. Falls du es vergessen hast: Ich halte für dich den Kopf hin. Und das nur, weil dein Freund seine Hose nicht zulassen kann. Also mach mich nicht an. Ich habe getan, was du wolltest, und wenn wir uns nicht beeilen, geht das Ganze eh nach hinten los.« Sie machte einen herausfordernden Schritt auf Jo-Beth zu. Das war das Problem mit Reva: Sie brauste viel zu schnell auf. Gelassenheit war für sie ein Fremdwort. Jetzt schwenkte sie tatsächlich das Messer vor Jo-Beth’ Nase.
»Würdest du bitte einen Gang runterschalten?«, blaffte Jo-Beth unbeeindruckt zurück. »Ich habe lediglich gesagt, es wäre besser gewesen, wenn –«
»Hier, Jo-Beth« – Reva drückte der anderen das Messer in die Hand –, »es ist dein Plan, also sieh zu, dass du ihn in die Tat umsetzt. Ich hab damit nichts zu tun.«
»Na schön. Dann geh zu den anderen und sag ihnen, dass ich später komme, weil es mir nicht gutgeht. Dass ich noch auf dem Klo bin. Oder nein, ich habe meine Periode. Krämpfe. Aber ich komme nach, in zehn, höchstens fünfzehn Minuten.«
»Und was, wenn nicht?«
»Dann wartet ihr eben noch auf mich.«
»Wie lange?«
Gute Frage. Hoffentlich geht nichts schief! »Höchstens eine halbe Stunde.«
»Und dann?«
»Dann hältst du dich einfach an den Plan. Erzähl ihnen, was sie wegen Elle sagen sollen.«
»Sie werden sich fragen, warum Monica nicht kommt.«
»Ach Mist, lass dir halt etwas einfallen!« Sie musste jetzt wirklich los. Konnte denn niemand in diesem gottverdammten Camp etwas ohne ihre Anleitung tun?
»Bald kommt die Flut.«
»Ich weiß!«
»Ich will doch bloß wissen, was ich tun soll. Hast du einen Plan B für den Fall, dass du nicht auftauchst?«
»Ich habe dir gesagt, dass du dir keine Sorgen machen musst, okay? Ich komme, versprochen. Und sollte ich tatsächlich nach einer halben Stunde noch nicht aufgetaucht sein, dann ist irgendetwas gründlich schiefgegangen.« Sie mochte sich gar nicht vorstellen, was.
Revas Augen glitzerten. »Dann sieh zu, dass das nicht passiert. Du musst mir das Messer noch heute Nacht wiedergeben, damit ich es zurücklegen kann.«
»Ich weiß. Keine Sorge.« Jo-Beth warf einen Blick auf die Uhr. Mist! Sie würde zu spät kommen!
»Bringen wir’s hinter uns«, sagte Reva, drehte sich um und verschwand in der Dunkelheit.
Kapitel drei
Camp Horseshoe
Damals
Monica
Hau einfach ab. Trotz der kühlen Nachtluft schwitzend, wartete Monica, dass die beiden Mädchen endlich den Pfad freigaben. Nervös zählte sie die Sekunden, die stetig vertickten.
Endlich schien Jo-Beth ihre Stoßgebete zu erhören, denn sie setzte sich in Bewegung. Die Schritte wurden leiser, verhallten, der Strahl der Taschenlampe verschwand.
Monica stieß die Luft aus, die sie unweigerlich angehalten hatte. Was wollten die beiden »durchziehen«? Und wofür brauchten sie die anderen? Egal. Das sollte sie heute Nacht nicht interessieren. Sie würde sich gleich mit Tyler treffen, aber der würde nicht ewig auf sie warten. Lautlos schlich sie zurück zum Pfad. An der Gabelung schlug sie den Weg zur alten Kapelle ein, wagte es endlich, die Maglite einzuschalten, und rannte los, so schnell sie konnte.
Während sie durch den Wald lief, schweiften ihre Gedanken zu den anderen Betreuerinnen, die im gleichen Alter waren wie sie. Doch ihre Freundinnen waren sie nicht. Ganz bestimmt nicht. Monica betrachtete sie eher als Leidensgenossinnen, eingepfercht in dieses Camp unter der Knute von Reverend Jeremiah Dalton. Wenn man die verschwundene Elle mitzählte, gab es insgesamt neun Betreuerinnen, eine biestiger als die andere.
Jo-Beth wollte, dass sie sich aus den Hütten schlichen und sich in der Höhle am Meer trafen, um zu besprechen, was wohl mit Elle passiert sein mochte, der neunten »Schwester«, wie Reverend Dalton sie beharrlich nannte. Schwester Jo-Beth, Schwester Reva, Schwester Elle, Schwester Sosi, Schwester Bernadette, Schwester Annette, Schwester Nell, Schwester Jayla und Schwester Monica. Sogar seine eigene Frau nannte er »Schwester Naomi«, als seien sie allesamt ältliche Nonnen. Bizarr. Erniedrigend. Demütigend. Monica hasste es.
Nur noch ein paar Tage – weniger als eine Woche, dann bist du endlich hier raus.
Eine bittersüße Vorstellung.
Wegen Tyler.
Ihr Herz schmerzte bei dem Gedanken an ihn. Wie würde Jo-Beth reagieren, sollte sie je von ihrer Affäre erfahren? Nun, das wollte sie sich lieber nicht vorstellen. Außerdem spielte es mittlerweile eh keine Rolle mehr. Monica liebte Tyler von ganzem Herzen, sie hatte sich nicht nur mit ihm eingelassen, um der versnobten reichen Zicke eins auszuwischen.
Oder doch?
Nein! Ganz bestimmt nicht.
Trotzdem hätte sie es besser gefunden, Jo-Beth wäre verschwunden und nicht die seltsame, in sich gekehrte Elle. Jo-Beth war ein arrogantes Miststück. Führte sich auf, als gehörte ihr die Welt, nur weil sie mit einem silbernen Löffel im Mund geboren worden war, genau wie Tyler. Es war einfach nicht fair.
Was um alles auf der Welt hatten die beiden Mädchen mit dem Messer vor? In der Höhle, bei dem Betreuerinnentreffen? Es jagte Monica Angst ein. Jo-Beth war nicht so gefestigt, wie sie immer vorgab. Was sagte man noch gleich über die ganz Schlauen, die Superhirne? Genie und Wahnsinn liegen dicht beieinander. Nun, das traf zu. In Monicas Augen war Jo-Beth eine waschechte Psychopathin.
Denk jetzt nicht an sie. Gleich bist du da!
Plötzlich meinte sie, jemanden hinter sich zu hören. Schritte. Angestrengtes Atmen. Sofort knipste Monica die Taschenlampe aus und warf ängstlich einen Blick über die Schulter. Niemand zu sehen. Bestimmt spielten ihr wieder einmal ihre überspannten Nerven einen Streich. Hier oben auf dem Hügel teilte sich der Weg erneut. Ein Pfad führte zum Meer hinunter und auf Umwegen zu der Höhle, in der sich die anderen trafen, der andere, grasüberwuchert und lange nicht mehr benutzt, zur alten Kapelle. Brombeerranken und Dornengestrüpp zerkratzten Monicas nackte Beine, trockene Kiefernzapfen zerbarsten unter den Sohlen ihrer Laufschuhe. Um sicherzugehen, dass sie nicht vom Weg abgekommen war, leuchtete sie den unebenen Boden ab, dann warf sie einen Blick auf ihre Armbanduhr.
Verflixt, sie würde viel zu spät zu dem Treffen in der Höhle kommen! Hoffentlich wunderten sich die anderen Mädchen nicht allzu sehr, wo sie blieb. Vielleicht gingen sie auch davon aus, dass sie sie versetzt hatte.
Ihr Pech. Sie hatte etwas Wichtiges zu erledigen. Etwas, was ihr Leben verändern könnte. Sie würde einfach nur –
Ihr Fuß blieb an einer Wurzel hängen. Monica stürzte vornüber, konnte sich gerade noch rechtzeitig mit den Händen abstützen, aber sie verdrehte sich schmerzhaft den Knöchel und schürfte sich die Knie auf. »Autsch! Verdammter Mist!« Sie zog scharf die Luft ein. »Das darf doch nicht wahr sein!«
Leise stöhnend drehte sie sich auf den Rücken, zog die Knie an die Brust und betastete ihren Knöchel. Ob das ein Zeichen war? Vielleicht sollte sie sich lieber nicht mit Tyler treffen …
Das musst du entscheiden, Monica, du ganz allein. Aber das bist du ja gewohnt. Deine Eltern haben dich nie bei irgendetwas unterstützt, weder deine durchgeknallte Mutter noch dein versoffener Vater, der ständig seinen Job verliert.
Vorsichtig drehte sie den Knöchel hin und her. Es tat höllisch weh, aber zum Glück schien nichts gebrochen. Ihre Knie bluteten, aber sie würde es überleben. Etwas unsicher rappelte sie sich hoch und ging hinkend weiter, vorsichtiger diesmal.
Tyler.
Ob er noch auf sie wartete?
Monica seufzte. Sie hatte sich Hals über Kopf in ihn verliebt, bis über beide Ohren und mit einer solchen Leidenschaft, dass sie schier verrückt war vor Begierde. Vor Lust. Dass er eine andere hatte, war für sie kein Hinderungsgrund.
Aber das war Schnee von gestern.
Oder nicht?
Bei ihrem letzten heimlichen Treffen hatte sie ihm die Neuigkeit überbracht, und er war entsetzt gewesen. Nun fürchtete sie, er würde vielleicht gar nicht erst auftauchen. Abwesend rieb sie ihren flachen Bauch und dachte an das Kind, das sie verloren hatte. Tränen traten in ihre Augen, doch sie drängte sie zurück.
Sie war dumm gewesen. Ein liebeskranker Dummkopf. Einen Augenblick lang überlegte sie, ob sie ihm etwas vormachen, ihm die Wahrheit verschweigen sollte in der Hoffnung, mit ihm Sex zu haben und erneut schwanger zu werden. Wenn er sie erst mal geheiratet hätte, wäre es doch gleich, ob das Baby pünktlich oder ein paar Wochen später auf die Welt kam. Natürlich konnte sie auch so tun, als würde sie erst nach der Hochzeit eine Fehlgeburt erleiden. Sie krümmte sich innerlich bei dieser Vorstellung, aber sie war bestimmt nicht die erste Frau, die sich auf diese Weise einen Ehering erschlich. Außerdem würde er sich so sehr in sie verlieben, dass er nie wieder ohne sie sein wollte. Eine Ehe mit Ty wäre das Ticket zu einem besseren Leben – ein Leben, das all die anderen Zicken für selbstverständlich hielten. Sie verstanden nicht, was sie durchmachte, und wahrscheinlich konnten sie es auch gar nicht verstehen. Sie hatte ihnen nichts von sich erzählt, hatte nicht zugegeben, dass ihre Mutter als Kellnerin schuftete, um die Familie durchzubringen, während ihr Vater, ein dem Alkohol verfallener Ire, damit beschäftigt war, jedem Rock hinterherzujagen, der ihm über den Weg lief. Nein, das musste niemand wissen. Und dann wurde sie schwanger. Und träumte für ein paar wundervolle Wochen davon, sich von der bitterarmen Monica O’Neal in die wohlhabende Mrs. Tyler Quade zu verwandeln.
Ach, wem machte sie etwas vor?
Es war zu spät. Der Sommer war fast zu Ende, das Camp würde in paar Tagen schließen, nach Elles Verschwinden holten die ersten Eltern bereits ihre Kinder ab.
Monica ging um die letzte Biegung, dann kam auf einer Lichtung die alte Kapelle in Sicht, das Dach silbern erleuchtet vom Mondschein. Hier fanden schon lange keine Gottesdienste mehr statt, das Gebäude war halb verfallen. Und jetzt … jetzt diente es ihnen als heimlicher Treffpunkt, hier hatte sie ihre Rendezvous mit Tyler.
Rendezvous? Wie romantisch! Hier hast du mit Tyler gevögelt, würde es eher treffen. Hier habt ihr es hinter dem Rücken seiner ach so tollen Verlobten getrieben bis zum Umfallen, und du kommst doch, wenn du ganz ehrlich mit dir bist, auch jetzt nur aus einem einzigen Grund her: dich wieder von ihm flachlegen zu lassen, um erneut schwanger zu werden. Auch wenn du es anfangs nicht darauf angelegt hast, hast du doch insgeheim gehofft, dass genau das passieren würde. Rendezvous. Pah! Mach dir doch nichts vor!
Sie versuchte, nicht auf die nörgelnde Stimme zu hören, und humpelte mit klopfendem Herzen auf die Eingangstür zu.
Würde er da sein?
Auf sie warten?
Wumms!
Sie hörte ein dumpfes Geräusch und schaute sich erschrocken um.
Was zum Teufel war das?
Ihr Puls hämmerte wie verrückt.
War jemand dort draußen? Ein Mensch oder ein Tier? Ein Reh vielleicht oder ein Rothirsch? Oder etwa ein Puma? Laut Reverend Dalton waren in letzter Zeit gleich mehrere gesichtet worden …
Monica hielt den Atem an und lauschte, doch außer ihrem eigenen Herzschlag, dem Rauschen des Windes und dem Tosen der Brandung war nichts zu hören. Sie ließ die Augen über den dichten Wald schweifen, der die Lichtung umgab, aber es war nichts zu sehen.
Was immer das Geräusch verursacht hatte, war fort. Oder lauerte wartend im Verborgenen.
Worauf sollte es warten? Auf dich? Nun reiß dich mal zusammen! Langsam, aber sicher wirst du wirklich paranoid!
Doch trotz der strengen Ermahnung spürte Monica, wie ihre Haut anfing zu kribbeln. Ihre Nackenhärchen stellten sich auf. Beherzt griff sie nach dem Türknauf. Die schwere Holztür öffnete sich quietschend. Monica trat ein. In der alten Kapelle war es stockdunkel. Sollte sie die Maglite einschalten? Nein, lieber nicht.
»Tyler?«, flüsterte sie. Keine Antwort. Nur das Pfeifen des Windes, der durch die Dachsparren strich. Drinnen roch es nach feuchter Erde, Moder und Schimmel. »Ty?«
Immer noch keine Antwort.
Monica zog die Tür hinter sich zu und schluckte angestrengt.
Mondlicht fiel durch ein großes Buntglasfenster an der Rückseite der Kapelle, das eine weinende Maria zeigte.
Monica erinnerte sich an die Nachmittage, die sie hier, in dieser fast vergessenen Kapelle, vor den Augen Marias mit Tyler verbracht hatte.
»Ty?« Vorsichtig tastete sie sich vor in Richtung Altar. »Bist du hier?«
Blöde Frage. Wäre er hier, hätte er sicher längst geantwortet.
Hatte er sie versetzt? Hatte er vorhin das Geräusch verursacht? Versteckte er sich, um sich auf sie zu stürzen und zu Tode zu erschrecken?
»Wenn das ein Spiel ist, ist es nicht lustig«, flüsterte sie, angestrengt in die Dunkelheit lauschend. Nichts war zu hören, aber sie spürte, dass sie nicht allein war. »Ty?« Ihre Stimme zitterte. Nervös leckte sie über ihre trockenen Lippen. Plötzlich nahm sie aus dem Augenwinkel eine Bewegung war. Ein Schatten zuckte über die Buntglasscheiben.
Ach du liebe Güte!
Beinahe wäre ihr das Herz stehengeblieben. »Ty?« Trotz der feuchten, kühlen Luft brach ihr erneut der Schweiß aus. Sie konnte kaum atmen, als sie zwischen den Kirchenbänken zum Altar schritt, beinahe wie eine Braut. Für den Bruchteil einer Sekunde sah sie sich neben Ty, ihrem Bräutigam, vor dem Geistlichen stehen, der sie zu Mann und Frau erklären würde. Er trug einen Smoking und das schiefe Grinsen, das sie so sehr liebte, in seinen Augen standen Freudentränen.
Auch in ihre Augen traten jetzt Tränen, allerdings keine Tränen der Freude, sondern Tränen der Trauer und der Furcht.
»Bist du hier, Ty?«, fragte sie in die Stille hinein, entschlossener jetzt. »Wir müssen unbedingt reden. Ich muss dir sagen, dass ich –«
Die Spitze ihres Laufschuhs stieß an etwas Hartes, das in den schmalen Gang zwischen den Kirchenbänken hineinragte. Beinahe wäre sie gestolpert, doch sie konnte sich gerade noch an einer Banklehne festhalten. »Was zum Teufel –« Sie zog die Taschenlampe aus der Tasche und richtete den Strahl auf den Boden der Kapelle.
Das Licht fiel auf einen nackten Fuß. Ein Schrei drang aus Monicas Kehle und hallte hoch zur Decke. Der Strahl wanderte ein nacktes Männerbein hinauf über einen halb auf der Seite liegenden nackten Körper und landete schließlich auf Tys Gesicht, das zur Decke gerichtet war. Seine Augen waren weit aufgerissen und auf die weinende Madonna im Buntglasfenster geheftet.
»Nein!«, schrie sie und ließ ihre Maglite fallen. Monicas Magen drehte sich um. »Nein, nein, nein!« Ihre Knie gaben nach.
Reiß dich zusammen, vielleicht ist er ja gar nicht tot. Jetzt sei nicht feige – fühl seinen Puls.
Ihr Blick fiel auf den dunkelroten Fleck neben ihm. Blut. Er ist tot! O Gott, o Gott, o Gott! War das etwa ein Messer in seinem Rücken?
Zitternd kroch sie näher an ihn heran. »Ty«, wisperte sie. »Ty …« Zaghaft streckte sie die Hand aus und berührte seine Haut. Die noch warm war.
Nein!
Das passierte doch nicht wirklich. Niemals! Das musste ein Traum sein, ein ganz schrecklicher Alptraum. Bebend vor Angst, berührte sie seine Brust und spürte die kurzen, lockigen Haare unter ihren Fingerspitzen. »O Gott, Ty, bitte, bitte … Das ist ein Alptraum … ganz bestimmt …« Ihre Stimme brach. Verzagt beugte sie sich zu seinem Gesicht vor, hielt ihr Ohr dicht an seine Nase in der Hoffnung, ihn atmen zu hören. Die Augen konzentriert zusammengekniffen, kniete sie in seinem Blut.
Doch, da war etwas. Ein kaum spürbarer Luftstrom drang aus seiner Nase. Oder täuschte sie sich?
Bitte, lieber Gott, bitte mach, dass er atmet!
Der Fleck neben ihm wurde größer, also musste sein Herz doch noch schlagen! Das hatte sie im Erste-Hilfe-Kurs gelernt. Oder breitete es sich lediglich aus, weil der Boden uneben war? »Ty, ich bin’s, Monica!« Sie legte die Finger an seinen Hals und suchte nach seinem Puls, aber sie fand ihn nicht.
Er war tot. Definitiv. Und er würde nie erfahren, dass er doch nicht Vater wurde.
Das Messer. Jo-Beth. Ach du liebe Güte! Ob sie ihn umgebracht hatte? Doch nicht etwa ihretwegen?
Ihr wurde übel. Beinahe hätte sie sich übergeben. Sie wusste, dass sie Hilfe holen, einen Rettungswagen rufen musste, aber war es dafür nicht ohnehin zu spät?
»Es tut mir leid, Ty, so schrecklich leid«, murmelte sie. Tränen traten in ihre Augen und liefen über ihre Wangen.
Wie hatte so etwas Schreckliches passieren können? Und vor allem, warum?
Du weißt, warum. Weil Jo-Beth herausgefunden hat, dass er sie mit dir betrügt. Deshalb hat sie sich das Messer besorgt – um ihn abzustechen!
Sollte sie versuchen, die Blutung zu stillen, oder sollte sie ihn einfach so liegen lassen und zurücklaufen –
Knarz!
Sie wirbelte herum.
Was zur Hölle war das?
Das Geräusch war ganz in der Nähe gewesen. Vor der alten Kapelle.
Das Herz schlug ihr bis zum Hals.
Wer war noch hier? Freund oder Feind?
Monica zog sich an der Rückenlehne der Kirchenbank hoch und ging zum Eingang der Kapelle. »Wer ist da?«, hauchte sie angstvoll, bereit, die Beine in die Hand zu nehmen.
»Monica«, flüsterte eine Stimme aus der Dunkelheit.
Ihre Haut kribbelte.
Die Stimme klang hämisch, zufrieden.
»Ich wusste, dass du kommen würdest.«
Kapitel vier
Cape Horseshoe
Jetzt
Lucas
Caleb Carter glaubte nicht an Regeln. Tatsächlich hielt er jeden, der diese strikt befolgte, für einen rückgratlosen Korinthenkacker. Das galt vor allem für die Jagd- und Fischereigesetze und das Leben in der freien Natur. In seinen Augen bestand die Regierung aus einem Haufen von Großstadtpflanzen und Bürohengsten, die noch nie einen Fuß in die Wildnis von Oregon gesetzt, noch nie ein Gewehr an die Schulter gehoben und noch nie eine Krebsreuse aus dem Wasser gezogen, geschweige denn einen Elchbullen erlegt und gehäutet hatten.
Weicheier.
Die verfluchten Politiker hatten doch keine Ahnung. Nicht, was sein Leben hier, im Westen der USA, betraf, und das stank ihm gewaltig. Wer von denen schlug sich schon ausschließlich mit dem durch, was die Natur ihm bot, abgekoppelt vom Versorgungsnetz? Genauso störte es ihn, wie sehr die verschlafene Kleinstadt, die er als kleiner Junge gekannt hatte, gewachsen war – inzwischen hatte Averille eine McDonald’s–Filiale und sogar einen eigenen Sheriff. Natürlich musste man sich auch in Averille stets an das Gesetz halten, aber nun hatte er das Gefühl, dass alles überhandnahm. Sein Leben viel zu sehr beeinflusste. Wie viele Immobilienagenturen, Versicherungsgesellschaften und Coffeeshops brauchte eine Stadt? Auf die überkandidelten Yuppies mit ihren trendigen aromatisierten Latte macchiato konnte er gut und gern verzichten. Er hätte nie gedacht, dass Averille, gute fünf Meilen vom Pazifik entfernt, einmal einen solchen Aufschwung erleben würde, aber als der Holzhandel und damit verbunden die Sägemühlen eine neuerliche Konjunktur erlebten, kehrten die Arbeiter zurück und brachten die anderen mit, die Ingenieure, Juristen und Buchhalter.
Die kleine Stadt wuchs. Das eigentlich Schlimme aber war, dass all die neuen Einwohner Besitzansprüche erhoben und Zäune um ihre Grundstücke zogen, so dass niemand mehr darauf jagen oder fischen konnte. Für wen zum Teufel hielten die sich eigentlich? Gott hatte dieser Erde reiche Ernte geschenkt, von der alle satt werden konnten, und wenn Caleb wie jeden Abend vor seinem Bett niederkniete, das Gewehr auf der Decke, betete er zum Herrn und dankte ihm für diese Fülle.
Obwohl er wusste, dass es Menschen gab, die sie ihm rauben wollten.
Aber sollten die Vereinigten Staaten von Amerika ihre Bürger nicht unterstützen? Gehörte dieses Land nicht ihnen allen? Genau das hatten ihre Vorfahren doch beabsichtigt! Nein, Caleb würde sich sein Leben nicht wegnehmen lassen. Schon gar nicht von irgendeiner dämlichen Holzgesellschaft, die Betreten-verboten-Schilder an Baumstämme nagelte oder Maschendrahtzäune zog.
Auf keinen Fall.
Wütend spuckte er einen dicken Tabakstrahl in die Brennnesseln und Brombeerranken. Er wollte zum Strand mit der kleinen Höhle, nicht viel mehr als eine Grotte, die bei Flut unter Wasser stand. An diesem abgelegenen Ort, den nur sehr wenige Menschen kannten, erntete er Klaffmuscheln – auch außerhalb der Saison, derartige Beschränkungen gab es für ihn nicht.
Mit Schaufel und Rucksack ausgestattet stapfte er weiter, das Gewehr mit Sucher über die Schulter gehängt für den Fall, dass ihm im Wald ein Reh oder ein Hase, vielleicht sogar ein Rothirsch über den Weg lief – ja, ja, es war noch keine Jagdsaison, aber wen interessierte das schon? Ihn auf alle Fälle nicht.
Der Waldweg öffnete sich auf eine breite Sandebene vor einer Klippe. Von dort aus gelangte man über einen Trampelpfad hinunter zu einer Bucht mit einem schönen Strand, wo man im Sommer wunderbar schwimmen konnte. Die Klippe ragte weit ins Meer hinein und sah vom Meer aus wie ein die Bucht umfassendes Hufeisen – Cape Horseshoe.
Caleb machte sich an den Abstieg. Unten angekommen, kletterte er über einen großen Haufen Treibholz, den das Meer an Land gespült hatte, und blieb stehen, um den Blick aufs Wasser zu genießen. An diesem nebeligen Oktobertag ganz früh am Morgen verschmolz der Ozean mit dem Horizont zu einer unendlichen Weite. Er spürte die Gischt auf seinem Gesicht, schmeckte das Salz auf seiner Zunge und fühlte sich glücklich und voller Energie. Das hier war Gottes Land. Daran bestand kein Zweifel. Und es war sein privater Jagdgrund, ganz gleich was all die lächerlichen Gesetze und Beschränkungen sagten. Es ging das Gerücht, dass die Gegend vom Geist eines jungen Mädchens heimgesucht wurde, das sich vor zwanzig Jahren von der Selbstmordklippe gestürzt hatte. Angeblich spukte es an ebendiesem Strand, und natürlich wurden nie ein Fußabdruck oder sonstige Spuren hinterlassen. So etwas taten Geister nicht.
Caleb glaubte nicht an diese Geschichte, doch er war froh, dass sie kursierte, denn sie hielt die Leute von der Grotte fern, so dass er in Ruhe seine Klaffmuscheln ernten konnte.
Er glaubte auch nicht an die Geschichte über einen entflohenen Häftling, einen Mörder, der aus Eifersucht seine Freundin erstochen haben sollte. Auch er wurde hin und wieder in diesen Wäldern gesichtet, mal mit einem blutigen Schlachtermesser, mal mit einer Machete in der Hand, und ab und an hieß es, dass er einen blutigen, abgetrennten Kopf bei sich trug.
Caleb schnaubte.
Das war alles in den Köpfen dieser dämlichen Teenager entstanden. Kamen an den Strand, um sich zu bekiffen oder zu besaufen oder irgendwelche spirituellen Séancen abzuhalten, und dann erfanden sie Geistergeschichten. Die ihre Wirkung nicht verfehlten.
Und das war gut so. Inzwischen verirrte sich kaum noch jemand in »sein« Jagdrevier.





























