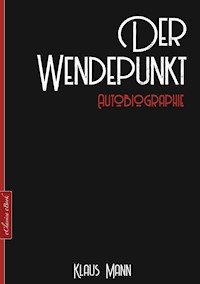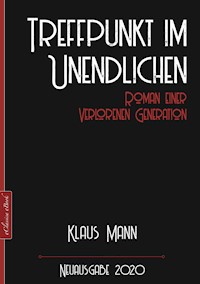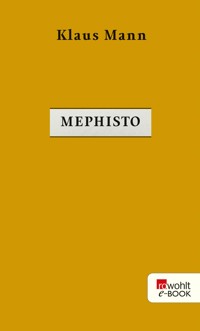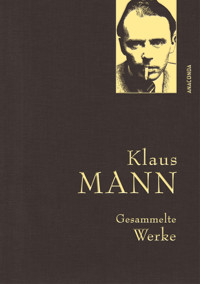9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Aufsätze, Reden, Kritiken
- Sprache: Deutsch
Klaus Manns essayistische Schriften vom Beginn des Exils 1933 bis zum Sommer 1936 spiegeln eine Zeit unermüdlicher Aktivität. Er gibt die Zeitschrift "Die Sammlung" heraus und schreibt den "Mephisto"-Roman; daneben entstehen die hier gesammelten Feuilletons, Reden und literarischen Porträts. Klaus Mann mischt sich in die politisch-ästhetischen Kontroversen der Zeit. Seine publizistische Arbeit hat ein zentrales Thema: die Bedingungen der Kunstproduktion "drinnen und draußen", im gleichgeschalteten Nazi-Deutschland und in der Emigration.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 659
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Klaus Mann
Zahnärzte und Künstler
Aufsätze, Reden, Kritiken 1933–1936
Herausgegeben von Uwe Naumann und Michael Töteberg
Über dieses Buch
Klaus Manns essayistische Schriften vom Beginn des Exils 1933 bis zum Sommer 1936 spiegeln eine Zeit unermüdlicher Aktivität. Er gibt die Zeitschrift «Die Sammlung» heraus und schreibt den «Mephisto»-Roman; daneben entstehen die hier gesammelten Feuilletons, Reden und literarischen Porträts. Klaus Mann mischt sich in die politisch-ästhetischen Kontroversen der Zeit. Seine publizistische Arbeit hat ein zentrales Thema: die Bedingungen der Kunstproduktion «drinnen und draußen», im gleichgeschalteten Nazi-Deutschland und in der Emigration.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2019
Copyright © 1993, 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Covergestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Coverabbildung tanatat/Shutterstock
ISBN 978-3-644-00347-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Vorwort
«Nie lebte Klaus intensiver, angespannter, tätiger als in den ersten Jahren der Emigration; darum wohl auch: nie glücklicher», schreibt Golo Mann in seinen 1975 publizierten Erinnerungen an seinen Bruder und kommt zu dem Urteil: «Der Herausforderung der deutschen Tyrannei hielt er nicht nur stand, sie erst führte ihn auf die ihm erreichbare Höhe.»
Klaus Mann war in der Weimarer Republik ein literarischer Außenseiter, ein Enfant terrible gewesen. Indiskret, kapriziös und vom Vaternamen begünstigt hatte er seinen Weg als Schriftsteller begonnen. Im Exil aber fand er seine Aufgabe: Er wurde ein Repräsentant der aus Deutschland vertriebenen Literatur.
Am 13. März 1933 verließ Klaus Mann Deutschland – knapp sechs Wochen, nachdem die Nazis die Macht übernommen hatten. In den folgenden Jahren lebte er vorwiegend in Amsterdam. Doch hielt er sich auch häufig in Paris und an der Côte d'Azur auf, besuchte die Schweiz (wo seine Eltern ab Herbst 1933 in Küsnacht bei Zürich wohnten), kam als Gast nach Moskau und nach Barcelona, reiste nach Wien, Prag, Budapest – um nur die wichtigsten Stationen zu nennen.
Die äußere Unstetigkeit scheint Klaus Mann, der sich schon in seiner Jugend aufs internationale Pflaster wagte und ausgedehnte Reisen unternahm, in seiner literarischen Produktivität kaum beeinträchtigt zu haben. Trotzdem: Exil bedeutet immer Entwurzelung und Verunsicherung. Den Schock, der damit verbunden ist, konnte er schneller überwinden als viele andere Intellektuelle, die damals Nazi-Deutschland verließen. Auch Klaus Mann wäre lieber in Berlin oder München geblieben. An der Richtigkeit seiner Entscheidung zweifelte er jedoch zu keinem Zeitpunkt. «Die Emigration war nicht gut. Das Dritte Reich war schlimmer», heißt es lakonisch in seiner Autobiographie «Der Wendepunkt».
Die Gegnerschaft zum Faschismus gab Klaus Manns Leben und Schreiben einen klaren Sinn. Er sprach auf Kongressen und bei Vortragsabenden; er schrieb für fast alle wichtigen Blätter der Exilpresse; sein Name stand unter antifaschistischen Aufrufen und Proklamationen; er dichtete Szenen und Lieder für das Kabarett seiner Schwester Erika, die «Pfeffermühle». In dem Zeitraum, der im vorliegenden Essayband dokumentiert wird – vom Frühjahr 1933 bis zum Herbst 1936 –, entstanden drei wichtige Romane: «Flucht in den Norden», «Symphonie Pathétique» und «Mephisto».
Im September 1933 erschien das erste Heft einer Zeitschrift, die Klaus Mann selbst herausgab und redigierte. Sie trug den programmatischen Titel «Die Sammlung». Die monatlich veröffentlichten Hefte enthielten Aufsätze über Literatur und Politik, dazu aktuelle Polemiken, neue literarische Texte, Rezensionen und Glossen. Bemerkenswert ist die Vielfalt von Positionen und Richtungen, die in der «Sammlung» zu Wort kamen – der Herausgeber nahm den im Titel formulierten Anspruch ernst und machte aus seiner Zeitschrift ein echtes Forum der antifaschistischen Literatur.
«Vor einem so starken und so ruchlosen Feinde, wie der Faschismus einer ist, auf relativ geringen Meinungsverschiedenheiten untereinander bestehen, anstatt sich zusammenzutun zur Abwehr: das wäre eine Dummheit von schon unmoralischem Ausmaß.» Dieser Überzeugung, die er in einem Mitte 1935 publizierten Aufsatz formulierte, waren Klaus Manns Aktivitäten der ersten Exiljahre verpflichtet. Er betätigte sich, wo er nur konnte, als Vermittler – vorurteilslos und aufrichtig. Und immer wieder beklagte er den Mangel an geistiger Toleranz, den er bei vielen Weg- und Kampfgefährten der Emigration feststellen mußte.
«Schöngeistig, aber militant» – so hat Klaus Mann das Konzept der «Sammlung» auf den Punkt gebracht. Er selbst näherte sich in den frühen Exiljahren sozialistischen Positionen. Das bedeutete keine parteipolitische Festlegung; aber er war doch zunehmend fasziniert von der Idee des Sozialismus – wie auch vom Versuch ihrer Realisierung in der Sowjetunion. Klaus Manns «Notizen in Moskau», im Oktober 1934 in der «Sammlung» veröffentlicht, sind ein Zeugnis der politischen Neuorientierung ihres Autors. «Denn ich spüre doch wieder, daß es eine Zukunft gibt», lautete der emphatische Schlußsatz des Berichts über die Moskau-Reise.
Seine großen Vorbilder waren, mehr denn je, der Onkel Heinrich Mann und der französische Schriftsteller André Gide. Von beiden übernahm er den Anspruch, eine Synthese zwischen Individualismus und Kollektivismus, zwischen der bürgerlichen Französischen Revolution und der sozialistischen Russischen Revolution zu suchen und zu propagieren. Beide übrigens, Heinrich Mann wie Gide, hatte Klaus Mann für das Patronat der Zeitschrift «Sammlung» gewinnen können (als dritter für dieses Amt stellte sich Aldous Huxley zur Verfügung).
Ein unkritischer Parteigänger der Sowjetunion war Klaus Mann nie – auch nicht in der Zeit, als er die Volksfront-Strategie der Kommunisten unterstützte. Er sei gern bereit, «Differenzen zurückzustellen. Es ist nicht ihre Stunde», schrieb er dem deutschen, im Moskauer Exil lebenden KP-Funktionär Hans Günther am 31. Juli 1934. Doch verschwieg er, wo es ihm geboten schien, keineswegs die gravierenden Unterschiede, die ihn – in politischen wie in ästhetischen Fragen – von den Kommunisten trennten. Auch davon zeugen sehr deutlich die «Notizen in Moskau».
Besonders empfindlich reagierte er Ende 1934, als ihn Informationen über eine restriktive Wende in der Sexualpolitik der Sowjetunion erreichten. Eine zentrale staatliche Verordnung vom 7. März 1934 bestimmte, daß alle Republiken ihr Strafgesetzbuch durch einen Homosexuellen-Paragraphen zu ergänzen hatten. Klaus Mann, der aus seiner eigenen homoerotischen Veranlagung nie ein Hehl gemacht hatte, registrierte die Nachricht mit äußerster Betroffenheit: «In dem Lande, das wir für das aufgeklärteste und fortgeschrittenste der Welt halten möchten, hat man die Liebesform, von der wir sprechen, aufs neue unter grausame Strafe gestellt.» Sein Aufsatz «Homosexualität und Faschismus», aus dem dieses Zitat stammt, wurde zu einem leidenschaftlichen Plädoyer für wirkliche Toleranz. In dem Umgang einer Gesellschaft mit ihren Außenseitern und Minderheiten sah Klaus Mann zu Recht einen Gradmesser für ihre Humanität.
Die Zeitschrift «Sammlung» erschien in Amsterdam, in der deutschsprachigen Abteilung des Querido-Verlags. Dort gelang es Fritz H. Landshoff, der bis Anfang 1933 den Kiepenheuer Verlag in Berlin geleitet hatte, ein engagiertes literarisches Programm aufzubauen, in dem viele wichtige Werke der Exilliteratur veröffentlicht wurden. Auch Klaus Manns Bücher der ersten Exiljahre erschienen bei Querido. Zwischen Landshoff und Klaus Mann entwickelte sich eine enge, lebenslange Freundschaft.
Der Absatz der «Sammlung» war nicht kostendeckend. Nach zwei Jahrgängen mußte der Verlag die Zeitschrift einstellen; im August 1935 erschien das letzte Heft. Die Verluste waren inzwischen so beträchtlich geworden, daß sie die Existenz des Buchverlags bedrohten. Für Klaus Mann war das Ende der «Sammlung» eine bittere Enttäuschung. Mangelnder Qualität war das finanzielle Fiasko gewiß nicht geschuldet – vielmehr wertete der Herausgeber das Ende seines Blattes als Beweis, «daß eine literarische Monatsrevue unter den heutigen Umständen ohne erhebliche Zuschüsse nicht lebensfähig ist» (Brief an Lion Feuchtwanger, 19. August 1935). Und wer hätte im Exil solche Zuschüsse aufbringen sollen?
Solche Probleme kannten jene Autoren nicht, die in der Heimat geblieben waren und sich mit den braunen Machthabern arrangiert hatten. «Ihre Einnahmen sind sicherer und sehr viel größer als unsere, und sie haben einen festen ‹Markt›, auf den sie rechnen können. Sie haben den Rundfunk, viele Theater und große Zeitungen», heißt es in dem programmatischen Artikel «Drinnen und draußen». Den Exil-Schriftstellern dagegen standen nur beschränkte Publikationsmöglichkeiten zur Verfügung. «Wir haben nicht viel. Wir sind arm. Unser Markt ist zerstreut über den Kontinent und über den ganzen Planeten.» Trotzdem wollte Klaus Mann nicht tauschen mit den Dichtern, die sich den Anordnungen der Reichsschrifttumskammer beugten: «Es ist besser, die Wahrheit ins Ungewisse zu rufen, als einer kompakten unwissenden Masse bezahlte Lügen zu erzählen.»
In dem Essay «Zahnärzte und Künstler», der diesem Band den Titel gab, stellt Klaus Mann die Frage nach der moralisch-politischen Verantwortung des Künstlers. Die Überzeugung, daß jeder Künstler für mehr einzustehen habe «als nur für seine Geschäftsinteressen», wurde in der Exilzeit zur Grundlage für Klaus Manns Denken. «Stellung nehmen!» hieß denn auch der Imperativ, mit dem er seinen Beitrag zu einer Zeitungsumfrage über «Die Mission des Dichters 1934» überschrieb. Er selbst engagierte sich leidenschaftlich, mischte sich ein in die politischästhetischen Auseinandersetzungen der Zeit. Berühmt wurde seine öffentliche Kontroverse mit Gottfried Benn, der 1933 als Propagandaredner für die Nazis auftrat. Der oft zitierte Brief Klaus Manns an den früher bewunderten Dichter wird in diesem Buch erstmals authentisch und ohne Auslassungen wiedergegeben: In den bisherigen Abdrucken wurden die Namen der erwähnten Schriftsteller durch drei Punkte ausgespart.
Nicht zufällig ging der Autor in seinem Aufsatz «Zahnärzte und Künstler» ausführlich auch auf Gustaf Gründgens ein. In Gründgens, mit dem er in den zwanziger Jahren befreundet war und zusammen Theater spielte, sah Klaus Mann den Typus des Intellektuellen verkörpert, der Geist und Moral verrät zugunsten der eigenen Karriere. Gründgens war 1933 in Nazi-Deutschland geblieben und stieg dort zum gefeierten, hochdekorierten Star auf. Daß ein Künstler, der sich derart mit den Mächtigen arrangiert, einen Teufelspakt eingeht – diese Überzeugung wurde 1936 zum Ausgangspunkt für Klaus Manns Roman «Mephisto», sein bis heute bekanntestes literarisches Werk.
«Zahnärzte und Künstler» ist die bisher umfassendste Edition der Publizistik Klaus Manns aus dem frühen Exil. Aufgenommen wurden mehr als 100 Beiträge, darunter einige Erstdrucke aus dem Nachlaß. Auf Vollständigkeit ist die Sammlung nicht angelegt.
Das editorische Konzept des vorliegenden Buches entspricht dem des Bandes «Die neuen Eltern», mit dem die Neuausgabe von Klaus Manns essayistischen Schriften vor einem halben Jahr begann. Die Texte sind weitgehend chronologisch angeordnet; dem Leser wird es so möglich, dem Autor auf den Wegen und Abwegen seines Denkens zu folgen. Das auf diese Weise entstehende, manchmal verblüffende Nebeneinander von Texten verschiedenster Thematik und Ambition ist durchaus beabsichtigt.
Der vorliegende Band schließt ab mit dem Zeitpunkt, als Klaus Mann an Bord des Dampfers «Statendam» den Atlantik überquert, um in den USA erstmals eine ausgedehnte Vortragstournee zu absolvieren. Es ist noch kein endgültiger Abschied von Europa, aber eine Situation, in der ihm die persönliche wie die weltpolitische Zukunft höchst ungewiß scheinen. In seinem Tagebuch notiert Klaus Mann am Tag der Abfahrt von Rotterdam: «Gedankenvoll und etwas traurig. Was kommt nun?»
Hamburg, im Januar 1993 Uwe Naumann/Michael Töteberg
1933
München, März 1933
Der zehnte März 1933. Wir sind in der Schweiz Skifahren gewesen; an diesem Tag – gerade an diesem – reisen wir nach München zurück. Wir haben, dort oben, die politischen Nachrichten verfolgt und am Radio erfahren, wie die deutschen Wahlen ausgegangen sind. Aber die heroische Reinheit und Unbeteiligtheit der großen Gebirgslandschaft ließ uns etwas gleichgültiger sein gegen Meldungen, deren Inhalt für das Leben der Nation wie für unser eigenes Leben entscheidend war. – Zeitungen in St. Margarethen. Was in uns noch an heroisch-idyllischer Stimmung war, ist mit einem Schlage zerstört. Wir erfahren von der veränderten Situation in München; vom Rücktritt der katholischen Regierung, von deren Mut und Klugheit wir zu viel erwartet hatten; von der Einsetzung des General Epp als Kommissar – jenes Generals, dessen äußerst militärische und zum Letzten entschlossene Physiognomie wir noch aus jener Zeit in Erinnerung hatten, da er, bald nach dem Krieg, als Führer der «weißen Truppen» im reaktionären München eingezogen war. – Die Reise verläuft weiter in einer sowohl gedrückten als gespannten Stimmung: typische Stimmung der katastrophalen Momente, der Kriegsausbrüche und der großen Bankrotte, gemischt aus Bitternis und, trotz allem, sensationslüsterner Neugierde.
München scheint ruhig. Aber wenn man genauer hinhorcht, spürt man die Spannung, die Unruhe aller dieser Menschen, die sich, auf dem Bahnhofsplatz schon, durcheinanderdrängen – eine Spannung, die sicher bei vielen eine glückliche, zukunftsfreudige ist, bei vielen aber auch eine verzweifelte. – Wir hatten München so sehr anders gekannt, und gerade während der letzten Monate: als einen Zufluchtsort derer, die den preußischen Faschismus nicht ertragen wollten. Der Katholizismus bewährte hier das, was an liberalen Elementen in ihm ist. München war eine Oase. Das durfte keinesfalls lange dauern. Nicht nur, weil man es in Berlin nicht geduldet hätte; auch München selbst hätte seine Rolle, die uns so ehrenvoll schien – die als Zufluchtsstätte der Freiheit – nicht auf die Dauer ertragen. Es gibt in seinem Wesen zu viele Züge, die solcher Rolle strikt widersprechen. Ein Teil des Münchener Charakters war immer entschlossen reaktionär. Man versteht es in Deutschland, reaktionär auch ohne «Preußengeist» zu sein; es läßt sich sogar mit der «Gemütlichkeit» vereinigen.
Nun also begrüßten uns von den Dächern der öffentlichen Gebäude die Hakenkreuzfahnen, die im Winde ihres Triumphes flatterten, und von allen Anschlagsäulen die Aufrufe, die General Epp «an sein Volk» richtete. – Der Chauffeur, der uns von der Bahn abholte, hatte ein verstörtes Gesicht, er war wirklich ganz blaß. «Wenn ich den Herrschaften einen Rat geben darf», sagte er mit recht weißen Lippen, «halten Sie sich in den nächsten Tagen zurück.» –Zu Hause, als wir das Radio anstellten, schrien uns die Stimmen der Männer an, von denen ein unbegreifliches Volk sich hat allen Ernstes einreden lassen, daß es «Führer» seien. Das ist nicht auszuhalten. – Man ruft Freunde an. – In öffentlichen Lokalen mag man sich nicht mehr treffen, und wenn man nun in den vertrauten Zimmern beisammen ist, kommt man sich schon als «Verschwörer» vor. Die Telephongespräche sind überwacht, man spricht in Andeutungen und dunklen Formeln. – Es wird uns schnell klar, daß wir nicht nur stimmungsmäßig, sondern auch in einem realeren Sinn zu leiden haben würden. Die ersten jener Nachrichten werden bekannt, die später als «Greuelpropaganda» bezeichnet wurden; man hätte es aber niemals nötig gehabt zu übertreiben – wie es dann natürlich geschehen ist: das, was wahr ist, genügt. – Mancher, mit dem man sich in Verbindung setzen will, ist schon verhaftet, zum Beispiel der Anwalt, der uns in den letzten Jahren beriet. Andere Verhaftungen wirken noch überraschender, etwa die des Direktors der Münchener Kammerspiele, Otto Falckenberg, eines durchaus unpolitischen Künstlers und Ästheten von außerordentlichem Niveau und großem Ansehen, der am liebsten den «Sommernachtstraum» inszenierte (Falckenberg wurde übrigens nach einigen Tagen wieder freigelassen, was ihn aber überhaupt jemals verdächtig gemacht hatte, war einfach seine Beziehung zum Geist), oder die eines Redakteurs der «Münchener Neuesten Nachrichten», dessen Leitartikel uns immer bis zu einem solchen Grade nationalistisch erschienen waren, daß wir sie kaum zu Ende lesen konnten. – Einer unserer Freunde hatte selbst, und mit Entsetzen, auf offener Straße jene blamable und ungeheuerliche Szene mitangesehen, als jener jüdische Anwalt, dessen Martyrium inzwischen durch die Weltpresse gegangen ist, barfuß mit abgeschnittenen Hosen von SA-Männern spazierengeführt wurde, auf der Brust das Schild, auf dem stand, daß er Jude sei – wofür er nichts kann – und daß er sich nie wieder über einen Nazi beschweren wolle – wozu er zunächst keine Gelegenheit mehr haben wird.
In diesem von General Epp regierten München waren wir vom 11. bis zum 13. März. So lange brauchten wir, um uns darüber klarzuwerden, daß wir zunächst das Land verlassen müßten, das im Begriff ist, alles das zu zerstören, was seinen Wert, seinen Reiz und seine Würde ausgemacht hat unter den Völkern der Erde.
Kultur und «Kulturbolschewismus»
Der Ausdruck «Kulturbolschewismus» ist die Waffe, mit welcher die heute Deutschland beherrschenden Mächte jede geistige Leistung unterdrücken, die nicht ihren eigenen politischen Tendenzen dient. Was «Kulturbolschewismus» eigentlich ist, wäre schwierig zu definieren. Wie das ganze Pathos dieses «neuen Deutschland» ist auch dieser Begriff am leichtesten aus dem Negativen zu erklären. (Das neue deutsche Pathos bewährt sich sehr viel leichter gegen als für etwas: gegen den Marxismus, gegen den Versailler Vertrag, gegen die Juden.) Der Geist des «Kulturbolschewismus» ist also zunächst einmal kein rein nationalistischer Geist – womit er eigentlich schon gerichtet ist. Im übrigen braucht der Kulturbolschewist mit Bolschewismus nicht das Allermindeste zu tun zu haben, und hat es tatsächlich auch nur in den allerseltensten Fällen; es genügt, wenn er gar zu viel mit Kultur zu tun hat, die an sich schon verdächtig macht. Jedenfalls verdient er es, zugrunde zu gehen, weil er «undeutsch» ist, auch nicht «aufbauwillig», «jüdisch-analytisch», ohne Ehrfurcht vor den guten alten Überlieferungen (als da sind: Corpsstudenten und Parademärsche), nicht genug «erdgebunden», nicht genug «dynamisch» und deshalb – gräßlichster aller Vorwürfe! – «pazifistisch»! – Der Kulturbolschewist ist mit Frankreich, den Juden und Sowjetrußland verschworen. Er ist sowohl Marxist als Anarchist (alles wird in einen Topf geworfen). Er bekommt täglich Geld von den Freimaurern, von den Zionisten und von Stalin. Er ist auszurotten.
Interessanter, als diesem in seiner völligen Unklarheit grotesken Begriff des «Kulturbolschewismus» nachzugehen, ist es festzustellen, was er in Deutschland an kulturellen Werten jetzt schon alles vernichtet hat. Wir wollen dabei hier nicht von Organisationen sprechen, die ihrem Wesen nach zwischen Geist und Politik stehen und deren Ehrgeiz vielleicht dahin geht, zwischen diesen beiden in Deutschland so getrennten Elementen zu vermitteln – etwa der Liga für Menschenrechte, der Roten Hilfe, den verschiedenen pazifistischen Verbänden: ihre Unterdrückung könnte noch als eine im Interesse der Herrschenden notwendige Aktion aufgefaßt werden, die sich eben um den Geist nicht kümmern darf. Es genügt, wenn wir uns auf das rein kulturelle Gebiet beschränken. Die neuen Herren scheinen sich, gerade auf diesem Gebiet, sehr reich zu fühlen; oder aber: ihr Gewissen ist gerade hier noch unempfindlicher, als wir es sonst kennen.
Ein Gebiet, auf dem mit besonderer Brutalität «durchgegriffen» wird (wie ein so hübscher Lieblingsausdruck des neuen Jargons lautet), ist natürlich das der Jugenderziehung. Es ist von entscheidender Wichtigkeit, daß man den kindlichen Köpfen und Herzen einzig und allein die Bekanntschaft mit jenen Idealen vermittelt, die man heute die «neuen» nennt – etwas paradoxerweise, da es ja eigentlich die ältesten sind. Verboten wurden in Berlin, schon einige Tage nach der nationalsozialistischen «Machtergreifung», die Karl-Marx-Schule, die pädagogisch ein vorzügliches Niveau hielt, sowie die Heinrich-Zille-Schule. Alle anderen freiheitlichen Schulen in Berlin oder im Reich sind bedroht oder schon geschlossen. Besonders mißtrauisch ist man gegen die Freien Schulgemeinden, die sich den Geist der ersten Jugendbewegung bewahren, etwa gegen Wickersdorf oder die Odenwaldschule, wo ein Geist der humanen Toleranz und der Friedensliebe herrscht. Diese Institute gelten geradezu als Brutstätten des Kulturbolschewismus und als abstoßend undeutsch – obwohl gerade sie, wie wir hoffen wollen, die typisch deutschen sind oder doch im Ausland dafür galten. Sogar der sehr konservative Kurt Hahn, der seine Landschule Salem am Bodensee durchaus nach englischem Muster leitet und die Verdächtigung, revolutionären Ideen zuzuneigen, durchaus nicht verdient, mußte vorübergehend ins Gefängnis.
Was die Wissenschaft und im besonderen die Universitäten betrifft, so ist ihr Niveau schon durch den Antisemitismus bedroht, der gerade hier besonders wütend ist. Die deutschen Universitäten waren seit Jahren eine Hochburg der Reaktion. Prominente jüdische Gelehrte wurden an der Ausübung ihres Amtes gehindert, und zwar von Burschen, die auf dieser Erde keinen Verdienst hatten außer dem, der arischen Rasse anzugehören, und auch das ließe sich noch bezweifeln. Der Skandal in Breslau um den Professor Cohn trug sich vor dem offiziellen Herrschaftsantritt Adolf Hitlers zu; ebenso manch anderer Skandal dieser Art in Heidelberg, München, Hamburg usw. Gerade in diesen Kreisen war man auf den neuen Ton vorbereitet. – Als Albert Einstein, dessen Vermögen man beschlagnahmt hat und der auf seine deutsche Staatszugehörigkeit verzichtete, seinen Austritt aus der Akademie erklärte, antwortete diese dem berühmtesten Gelehrten Deutschlands, daß sie keinen Anlaß habe, diesen Austritt zu bedauern. So haben wir unsererseits keinen Anlaß, es zu bedauern, wenn das deutsche gelehrte Leben international sehr bald nicht mehr in Frage kommen wird.
Das Schicksal der großen linksgerichteten oder liberalen Verleger scheint noch nicht ganz entschieden. Es wäre gar zu optimistisch anzunehmen, daß sie weiter werden bestehen können. Wenn man sie nicht einfach verbietet, wird man sie langsam abwürgen, was nicht besser ist: die Buchhändler werden ihre Produktion boykottieren oder tun es schon. Zu Bücherverboten ist man noch wenig gekommen, weil diese Materie den neuen Führern zu ferne liegt. Doch hüten sich die Verleger, noch Bücher auszuliefern, die besonders anstößig sein könnten. Die Werke von Lion Feuchtwanger, «Erfolg» und «Der jüdische Krieg», sind praktisch verboten. Die Bücher des satirischen Lyrikers Kästner wurden in einer kleinen Stadt sogar auf offenem Marktplatz verbrannt. Die Namen fast aller deutschen Autoren, die das Ausland kennt, sind im neuen Deutschland verpönt und stehen auf schwarzen Listen: von Wassermann, Thomas und Heinrich Mann über Emil Ludwig, Stefan Zweig, Arnold Zweig, Alfred Kerr, Georg Kaiser, Bert Brecht bis zu Bruckner und Hasenclever. Die Liste könnte beliebig verlängert werden. Kulturbolschewisten, «Novemberlinge», «Asphaltliteraten» sind sie alle und haben dem deutschen Volk stets nur Unehre gebracht (indem sie ihm zum Beispiel den Nobel-Preis und die Aufmerksamkeit der ganzen Welt verschafften). Thomas Mann, den die Prager Presse unlängst den unabsetzbaren und unersetzlichen Sendboten des deutschen Geistes nannte, wird im «Angriff» mit Vorliebe als «Schmierfink» bezeichnet. Was der germanische Faschismus als Ersatz für solche Schmierfinken seiner Nation und der Welt anbietet, sind Autoren wie Hans Heinz Ewers (der berühmt dämonische Edelpornograph, der elende Verfasser der «Alraune») und Hanns Johst, der schon durch die Titel seiner Stücke verrät, wes Geistes Kind er ist: seine letzte Komödie war sehr niedlich «Der Herr Monsieur» genannt und verspottete «die deutsche Ausländerei» – ich möchte nicht wissen, wie.
Die deutsche Presse existiert nicht mehr, jede Meinungsfreiheit, auch die bescheidenste, ist mit einem bemerkenswerten Radikalismus (der den der Italiener womöglich noch übertrifft) unterdrückt. Die Zeitungen der Linksparteien sind bekanntlich samt und sonders verboten. Die «große liberale Presse» ist aufgekauft, oder, soweit dies noch nicht, doch gezwungen, mit den Faschisten durch dick und dünn zu gehen (sogar der antisemitische Boykott wurde von ihnen mit keinem Wort kritisiert); jedenfalls ohne jeglichen Widerstand eines unrühmlichen und wohlverdienten Todes verstorben. Die Regierungszeitungen lügen schon prinzipiell. Es gibt kein Mittel, sich zu orientieren. Verboten sind selbstverständlich die Zeitschriften, die bis zuletzt eine tapfere Haltung und ein hohes Niveau behielten: «Tage-Buch» und «Weltbühne»; ihre Herausgeber geflohen oder im Gefängnis. Nicht viel besser geht es den katholischen Blättern. Im Fall von Zeitschriften, die gezwungen wurden, ihre Leitung zu wechseln, ist charakteristisch die Wahl der Nachfolger, die man ihnen diktierte: so wurde – um ein Beispiel unter sehr vielen zu nehmen – als Nachfolger des Herausgebers der «Literarischen Welt», Willy Haas, eines sehr verdienstvollen und geistig erfahrenen Literaten, ein gewisser Eberhart Meckel eingesetzt, ein junger Mann Anfang zwanzig, der nicht mehr als einige Gedichte veröffentlicht hat und für den nichts spricht, als daß er einwandfrei blond ist.
Den Theatern wird ihr Repertoire meistens von einem «Kampfbund für deutsche Kultur» diktiert; übrigens würden sie es auch sonst nicht wagen, andere als nationalistische Stücke aufzuführen. Die Intendanten, soweit sie jüdisch oder politisch nicht einwandfrei sind, müssen gehen, darunter die Verdienstvollsten und Besten, wie Gustav Hartung in Darmstadt, der André Gides «Oedipe» herausgebracht hat – wenn sie nicht auch noch verprügelt werden, wie es dem Direktor Barnay in Breslau erging. Nicht einmal der ganz große Ruhm schützt, wie der Fall Max Reinhardt beweist, dem man verbietet, in dem Deutschen Theater, das er begründet hat, zu inszenieren. Auch schauspielerisches Genie wird den jüdischen deutschen Schauspielern nicht wieder auf eine deutsche Bühne verhelfen: Elisabeth Bergner, Pallenberg, Kortner, die Massary (um nur die größten Namen zu nennen) würden ausgezischt werden – wenn man es überhaupt noch einmal so weit kommen ließe, daß sie sich zeigten. Männer wie Piscator können schon seit längerer Zeit in Deutschland nicht mehr arbeiten.
Der Rundfunk, der ohnedies nicht eben fortschrittlich war, ist völlig zum Propagandawerkzeug der Regierung geworden. Jüdische Sprecher oder Autoren sind ausgeschieden. Wenn Hitler oder Göring nicht gerade Reden halten, wird der «Schlageter» von Hanns Johst aufgeführt. Intendanten von geistigem Ehrgeiz, wie der Leiter des Berliner Rundfunks, Flesch, konnten sich schon vor der «Machtergreifung» nicht mehr halten. – Ein Propagandawerkzeug, auf das viel ankommt, ist auch der Film. Jüdische Firmen werden zugrunde gerichtet, damit das Monopol der Ufa vollkommen sei. Der Nero, zum Beispiel, hat man ihren Spitzenfilm, «Das Testament des Doktor Mabuse», ohne jeden einleuchtenden Grund verboten. Verboten sind weiter: alle Russenfilme, alle Filme, die pazifistischer Gesinnung verdächtig sind (angefangen mit «Im Westen nichts Neues»), sowie fast alle, die in proletarischem Milieu spielen (wie Bert Brechts Film «Kuhle Wampe»). Man scheint die Produktion auf Operetten und nationalistische Hetzfilme beschränken zu wollen. Es war typisch, daß, als Herr Goebbels neulich in einer Rede – gewiß versehentlich – unter den Filmen, die als Vorbild dienen könnten, auch den «Potemkin» erwähnte, diese skandalisierende Bemerkung in dem Bericht, den der «Angriff» über die Rede brachte, weggelassen wurde.
Man scheut nicht einmal vor der Schändung der Musik zurück, der Kunstart, zu der die Deutschen das sentimentalste und respektvollste Verhältnis haben. Einige der größten deutschen Dirigenten sind Juden. Diese werden von nun an im Auslande arbeiten müssen. Der Fall Bruno Walters hat am meisten Aufsehen gemacht. Die Fälle von Klemperer, Kleiber, Blech sind nicht weniger sensationell. Berlin darf nicht nur kein geistiges Zentrum mehr sein; es soll auch seinen Rang als Musikstadt einbüßen. Der boykottierte Dirigent muß nicht einmal Jude sein, es genügt, wenn sonst irgend etwas an ihm einigen SA-Männern mißfällt: der Fall von Fritz Busch, dem seine Tätigkeit als Generalmusikdirektor der Dresdener Oper unmöglich gemacht wurde. Sogar Toscanini wird boykottiert, weil er seinerseits gegen den Boykott Bruno Walters zu protestieren wagte. Ohne Frage wird es der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter-Partei eine Kleinigkeit sein, dem musikverständigen deutschen Publikum einen Dirigenten vom Range Toscaninis zu präsentieren. – Mit den Orchesterleitern ändert sich auch das musikalische Repertoire. Kulturbolschewisten wie Hindemith (der besonders verabscheut wird) dürfen nicht mehr aufgeführt werden. Neben Richard Wagner wird man vorzüglich dessen Sohn Siegfried pflegen, der bei der Partei hohes Ansehen genießt.
Selbstverständlich ist, daß es der Malerei nicht anders gehen darf als allen übrigen Kulturgebieten. Auch hier heißt es: Schluß mit den Experimenten, zurück zur guten alten Zeit, die Siegesallee wird wieder Mode! Das erwachende Deutschland hat ein starkes Penchant zum Kitsch. Bei einem verhafteten Literaten wurde als besonders kompromittierend festgestellt, daß man an seinen Wänden Blätter von George Grosz gefunden habe – wobei sicher nicht nur die politische Gesinnung des Grosz, sondern mehr noch seine «revolutionäre» Zeichentechnik anstößig wirkte. Paul Klee, Kokoschka, Beckmann haben von den deutschen Mauern zu verschwinden. Wer weiß, ob Cézanne und van Gogh noch geduldet werden. – Die Hamburger Sezession wurde verboten, ehe sie noch eröffnet war: sie stand im Verdacht des Kulturbolschewismus. Die Galerie Flechtheim in Berlin ist geschlossen. In Dessau wurden die Noldes, Kokoschkas usw. aus dem Museum gerissen und von den wackeren SA-Leuten beschmiert. Das Wort «Expressionismus» – von dem die guten Nazis so wenig wie von dem Wort «Marxismus» wissen, was es bedeutet – wird synonym mit «Bolschewismus» gebraucht. – Noch mißtrauischer ist man in der Architektur gegen moderne Bestrebungen. Das flache Dach, zum Beispiel, gilt von vornherein als eine Art Landesverrat – Gott weiß warum. Architekten wie Poelzig oder Gropius haben im Neuen Deutschland nichts mehr zu suchen, das andere «aufbauwillige» Kräfte braucht. Die Schließung des Dessauer Bauhauses war nur der Auftakt zur Vernichtung neuer architektonischer Tendenzen.
Man sieht: es wird nichts ausgelassen, wir könnten unsere bittere Liste über Tanz und Photographie bis zu Kunstgewerbe und Körperkultur fortsetzen. Kultur und Politik sollen «gleichgeschaltet» werden (um ein anderes neudeutsches Lieblingswort zu gebrauchen). Dies durchzuführen hat man ohne Frage die Macht. Es fragt sich nur, wer auf die Dauer darunter zu leiden haben wird. Wenn uns nicht alles täuscht, wird es Deutschland sein. Denn bekanntlich ist es leichter zu zerstören als aufzubauen. Was aber produziert das Neue Deutschland an kulturellen Werten statt der anderen, die es zerstört? Unsere Skepsis, was diese neuen Werte betrifft, ist abgrundtief. Denn es ist nicht «ein» Geist, der hier gegen einen andersgearteten kämpft, sondern der Ungeist kämpft hier gegen den Geist, und wenn kein Wunder geschieht, bleibt er Sieger.
Brief an Gottfried Benn
Le Lavandou, den 9. 5. 33
Lieber und verehrter Herr Doktor Benn,
erlauben Sie einem leidenschaftlichen und treuen Bewunderer Ihrer Schriften mit einer Frage zu Ihnen zu kommen, zu der ihn an sich nichts berechtigt als eben seine starke Anteilnahme an Ihrer geistigen Existenz? Ich schreibe diese Zeilen nur in der Hoffnung, daß Sie mich als verständnisvollen Leser Ihrer Arbeiten etwas legitimiert finden, eine offene Frage an Sie zu richten. – In den letzten Wochen sind mir verschiedentlich Gerüchte über Ihre Stellungnahme gegenüber den «deutschen Ereignissen» zu Ohren gekommen, die mich bestürzt hätten, wenn ich mich hätte entschließen können, ihnen Glauben zu schenken. Das wollte ich keinesfalls tun. Eine gewisse Bestätigung erfahren diese Gerüchte durch die Tatsache, die mir bekannt wird, daß Sie – eigentlich als einziger deutscher Autor, mit dem unsereins gerechnet hatte – Ihren Austritt aus der Akademie nicht erklärt haben. Was mich bei der protestantischen Frau Ricarda Huch nicht verwundert und was ich von Gerhart Hauptmann, der seine Rolle als der Hindenburg der deutschen Literatur mit einer bemerkenswerten Konsequenz zu Ende spielt, nicht anders erwartet hatte, entsetzt mich in Ihrem Falle. In welcher Gesellschaft befinden Sie sich dort? Was konnte Sie dahin bringen, Ihren Namen, der uns der Inbegriff des höchsten Niveaus und einer geradezu fanatischen Reinheit gewesen ist, denen zur Verfügung zu stellen, deren Niveaulosigkeit absolut beispiellos in der europäischen Geschichte ist und vor deren moralischer Unreinheit sich die Welt mit Abscheu abwendet? Wieviel Freunde müssen Sie verlieren, indem Sie solcherart gemeinsame Sache mit den geistig Hassenswürdigen machen – und was für Freunde haben Sie am Ende auf dieser falschen Seite zu gewinnen? Wer versteht Sie denn dort? Wer hat denn dort nur Ohren für Ihre Sprache, deren radikales Pathos den Herren Jonst und Vesper höchst befremdlich, wenn nicht als der purste Kulturbolschewismus in den Ohren klingen dürfte? Wo waren denn die, die Ihre Bewunderer sind? Doch nicht etwa im Lager dieses erwachenden Deutschlands? Heute sitzen Ihre jungen Bewunderer, die ich kenne, in den kleinen Hotels von Paris, Zürich und Prag – und Sie, der ihr Abgott gewesen ist, spielen weiter den Akademiker dieses Staates. Wenn Ihnen aber an Ihren Verehrern nichts liegt – sehen Sie doch hin, wo die sich aufhalten, die Sie Ihrerseits auf so hinreißende Art bewundert haben. Heinrich Mann, dem Sie wie kein anderer gehuldigt haben, ist doch mit Schanden aus eben derselben Organisation geflogen, in der Sie nun bleiben; mein Vater, den Sie zu zitieren liebten, wird in dem Lande nur noch beschimpft, für dessen Ansehen er in der Welt allerlei geleistet hat – wenn auch nicht so viel, wie seine neuen Herren nun wieder zu zerstören wußten. Die Geister des Auslands, die doch auch Ihnen wichtig gewesen sind, überbieten sich in den schärfsten Protesten – denken Sie doch an André Gide, der gewiß nie zu den platten «Marxisten» gehört hat, die Sie so schrecklich abstoßend fanden.
Da sind wir ja wohl beim entscheidenden Punkt. Wie gut habe ich Ihre Erbitterung gegen den Typus des «marxistischen» deutschen Literaten (fatalster Vertreter: Kracauer) immer verstanden, und wie sehr habe ich sie oft geteilt. Wie blöde und schlimm war es, wenn diese Herren in der «Frankfurter Zeitung», im «Börsencurier» oder in ihren verschiedenen «Linkskurven» Dichtungen auf ihren soziologischen Gehalt hin prüften. Das war ja wirklich zum Kotzen, und niemand hatte mehr unter denen zu leiden als ich. Mit Beunruhigung aber verfolgte ich schon seit Jahren, wie Sie, Gottfried Benn, sich aus Antipathie gegen diese aufgeblasenen Flachköpfe in einen immer grimmigeren Irrationalismus retteten. Diese Haltung blieb rein geistig und hatte für mich eine große Verführungskraft, wie ich gestehe – aber das hinderte nicht, daß ich ihre Gefahren spürte. Als ich unlängst in der «Weltbühne» den Aufsatz über Sie und Ihre «Flucht zu den Schachtelhalmen» las, konnte ich dem, der da gegen Sie polemisierte, beim besten Willen so ganz Unrecht nicht geben – ja: wenn ich genau nachdachte, fiel mir ein, daß ich eigentlich recht ähnliche Dinge ziemlich viel früher über Sie geschrieben hatte. Es scheint ja heute ein beinah zwangsläufiges Gesetz, daß eine zu starke Sympathie mit dem Irrationalen zur politischen Reaktion führt, wenn man nicht höllisch genau acht gibt. Erst die große Gebärde gegen die «Zivilisation» – eine Gebärde, die, wie ich weiß, den geistigen Menschen nur zu stark anzieht –; plötzlich ist man beim Kultus der Gewalt, und dann schon beim Adolf Hitler. – Ist es nicht doch ein bißchen so, wie ein geistreicher Autor (kein «Marxist») an dieser Küste neulich zu mir sagte: «Der Benn hat sich einfach so viel über den Döblin geärgert, daß er schließlich Nazi darüber wurde.» Ich verstehe ja sehr gut, daß man sich ausgiebig über den Döblin ärgern kann, aber doch nicht gleich bis zu dem Grade, daß man den Geist überhaupt darüber verrät. Mich könnte kein Kracauer, kein Ihering je so weit bringen. Im Gegenteil: während der Ihering heute Mittel und Wege findet, sich so ein bißchen faschistisch umzufrisieren – und vielleicht wird morgen schon bei ihm die «Nation» stehen, wo gestern das «Klassenbewußtsein» stand –, weiß ich nun so klar und so genau wie nie, wo mein Platz ist. Kein Vulgärmarxismus kann mich mehr irritieren. Ich weiß doch, daß man kein stumpfsinniger «Materialist» sein muß, um das Vernünftige zu wollen und die hysterische Brutalität aus tiefstem Herzen zu hassen.
Ich habe zu Ihnen geredet, ohne daß Sie mich gefragt hatten; das ist ungehörig, ich muß noch einmal um Entschuldigung bitten. Aber Sie sollen wissen, daß Sie für mich – und einige andre – zu den sehr Wenigen gehören, die wir keinesfalls an die «andere Seite» verlieren möchten. Wer sich aber in dieser Stunde zweideutig verhält, wird für heute und immer nicht mehr zu uns gehören. Aber freilich müssen Sie ja wissen, was Sie für unsere Liebe eintauschen und welchen großen Ersatz man Ihnen drüben dafür bietet; wenn ich kein schlechter Prophet bin, wird es zuletzt Undank und Hohn sein. Denn, wenn einige Geister von Rang immer noch nicht wissen, wohin sie gehören –: die dort drüben wissen ja ganz genau, wer nicht zu ihnen gehört: nämlich der Geist.
Ich wäre Ihnen dankbar für jede Antwort.
Meine Adresse:
Hotel de la Tour, Sanary s.m. (VAR)
Ihr
Klaus Mann
Antwort auf die «Antwort»
Diese Äußerung ist ohne Frage die weitaus schwächste literarische Arbeit, die mir von Gottfried Benn bekannt geworden. Die neue Gesinnung mag herzerhebend sein; jedenfalls wirkt sie drückend auf das Niveau. 1914 war das meistens nicht anders. Wer da plötzlich in die patriotische Ekstase geriet, wurde ein schwacher Schriftsteller – wenigstens so lange die Ekstase dauerte. – Die noch geglückteste Stelle in Benns Artikel ist die, wo er noch einmal – zum wievielten Mal? – seine Vision des mythischen Menschen skizziert; aber eben sie ist pures Selbstziel, routiniertes Pathos, unfrisch. Wo er schlicht werden möchte und so herzhaft vom Volk, den Jahreszeiten und den einfachen Dingen spricht, ist er schon ganz vom «Völkischen Beobachter» beeinflußt, seine Stimme bibbert, er wird völlig konventionell. Andere Stellen wieder kann man nur als demagogisch bezeichnen, sie sind wirklich nicht mehr ganz anständig; ich meine vor allem die, wo er den Rundfunkhörern und den Lesern der «Deutschen Allgemeinen Zeitung» vor Augen führt, wie wir Emigranten da in sündigem Luxus in den Badeorten sitzen und zum Kriege gegen Deutschland hetzen. Über Leute, die sich in ihrem Land nicht mehr wehren können und die meistens nicht mehr wissen, wovon morgen zu Mittag essen, solche Verleumdungen in die Welt zu setzen, scheint mir – gelinde gesagt – unvornehm.
Ja, man muß es schon aussprechen: Benns Erklärung ist derart, daß es sich kaum lohnte, sie hier wiederzugeben – wenn sie nicht so ungeheuer symptomatisch wäre. Wenn es daheim so wirr und nicht mehr ganz anständig schon in den Köpfen von Rang aussieht – wie dann erst in den anderen. Behüte uns der Himmel vor diesem neuen biologischen Typ!
Benn meint, daß er meine Terminologie nicht mehr verstünde. Mich macht seine Ausdrucksweise erst recht fassungslos. Wenn einer schon so weit ist, daß er das Dritte Reich, diese höllischste Blamage einer zweitausendjährigen Geschichte, für «eine der großartigsten Realisationen des Weltgeistes überhaupt» hält – dann gibt es mit ihm wohl kaum noch eine Verständigungsmöglichkeit. Wenn man den Hitler als ein Genie bezeichnet, das sich von Napoleon nur noch dadurch unterscheidet, daß es legitim und echt volkstümlich ist, dann treibt man entweder satanische Scherze, oder aber man ist der lächerlichsten aller Massenpsychosen mit einem Radikalismus verfallen, der mir schlechthin ungesund scheint. – Wir haben all das Schöne und Große nicht miterlebt, wir können es nicht beurteilen? Was für eine Behauptung! Als ob wir nicht seit Jahren von Rundfunkrede zu Rundfunkrede mitverfolgt hätten, wie eine Horde von Wilden die Ideale schlechthin der Menschheit bedrohte. Nun ist es soweit, aus der Drohung ist Herrschaft geworden, die Barbarei ist komplett – und da verkünden diese Dichter und Denker, das Wort Barbarei habe überhaupt gar keine Bedeutung mehr, das sei novellistischer Schnickschnack – und erklären sich so mit ihr, der Barbarei selbst, identisch.
Was für Behauptungen sie aufstellen, welche Argumente sie benutzen! Dieser Scherz mit den Rund- und Spitzbogen – was soll denn das, das ist ja gar keine Parallele, erst denkt man, man liest nicht recht, wie kann man denn so was Schiefes, Sinnloses niederschreiben. – Wie platt dies alles, wie ausgeleiert, dieses ewige Triumphgeheul, die Französische Revolution sei vorüber – die Russische vielleicht auch? –, und nun mal Schluß mit der Humanitätsduselei, der Tod im Feld ist der schönste. Das hat ja alles Herr von Papen schon gesagt. Der Mensch ist tiefer, als die Aufklärung dachte – das wissen wir ja, Teufel noch mal, unseren Bachofen, unseren Dacqué haben wir selbst gelesen, aber das ist doch alles kein Grund, daß die Menschen wie die Viecher leben sollen. Immer der alte Kniff, immer die alte Verdrehung. Man stellt uns so hin, als seien wir recht flache Materialisten, ganz neunzehntes Jahrhundert, hoffnungslos spießig; als behaupteten wir: der Mensch besteht aus der Vernunft, er ist nur Vernunft – wenn wir uns zu sagen erlauben: Das äußere Zusammenleben der Menschen ist durch die Vernunft zu regulieren, nicht durch einen irrationalen Schwindel, hinter dem sich ja doch im Grunde ganz andere und sehr praktische Motive verbergen. Weil wir nicht für imperialistische Kriege sind, sollen wir keine Ahnung von der Tiefe des Menschen, von seiner Transzendenz, seiner Metaphysik haben. Genug davon, jetzt aber mal genug, in den «Münchener Neuesten Nachrichten» stand das schon immer, Pg. Rosenberg war auch dieser Ansicht – und nun sagt es Benn.
Welche Entwürdigung eines enormen Talents – ich finde, daß es erschütternd ist. Jede Pointe eine Plattheit, ein Danebenhauen. «Meinen Sie – fragt er mich aus Königswusterhausen –, sie (die Geschichte) sei in französischen Badeorten besonders tätig?» Wie er nur so tückisch fragen mag, eine rhetorische Frage nennt man das wohl, denn das fühlt doch jeder Rundfunkhörer: Nein. In den französischen Badeorten, da ist die Geschichte gewiß besonders untätig, dort schläft sie, das ist ja klar, und mit ihr die Emigranten. Das erinnert mich an den österreichischen Offizier, der während des Krieges sagte: «Eine russische Revolution? Wer soll denn die machen? Vielleicht der Herr Trotzki im Café Central?» Ja, sehen Sie, da saß die Weltgeschichte eben mal im Café Central und nicht in der Wiener Hofburg; und in dem kleinen Hotelzimmer, das Lenin in Zürich bewohnte, da saß sie doch vielleicht auch ein wenig. Hat heute das Braune Haus sie gepachtet? Man kann ja Überraschungen erleben, wo und wie sie plötzlich wirksam wird.
Wieviel Plattheit in all dem, wieviel Zynismus! Die Stelle etwa über die Arbeiter, die Gottfried Benn als Kassenarzt kennt und denen es jetzt so viel besser geht als vorher, weil sie nämlich in «Staatsbürgerstimmung» arbeiten – selbst die «ehemaligen» Kommunisten –: wie übel das klingt, wie verräterisch, wie so ganz und gar nicht überzeugend. Oder die Redensarten von der «Untergangsbereitschaft» eines Volkes, das man in eine neue Katastrophe zu hetzen im Begriffe ist, in der es – wie wir also erfahren – so gerne vorschriftsmäßig verrecken möchte. – Und zuletzt, um pro domo zu reden, diese ziemlich infame Bemerkung, daß auch uns «nicht viel» passiert wäre, wenn wir nur brav zu Haus geblieben wären. Sechs Wochen Schutzhaft vielleicht nur, aus Gnade und Barmherzigkeit, und dann nie mehr den Mund auf tun dürfen? Mir langt's. – Und das schreibt der Autor revolutionärer Essays und Gedichte in einem Augenblick, da seine Kollegen Renn, Mühsam, Ossietzky (in dessen Zeitschrift er schrieb) noch immer in den Höllen der Konzentrationslager gemartert werden. Wir aber sollen kein Recht haben, dies zu kritisieren, dies anzuklagen – und warum? Man höre doch –: weil wir uns die Kultur dieses Landes angeeignet haben, weil wir vielleicht selbst ein kleines Stück dieser Kultur sind. Die Neger aber und die Eskimos – die hätten vielleicht – meint Benn – ein Recht zu solcher Kritik, das er gerade uns Deutschen abspricht. Vor dieser Logik stehen wir sprachlos.
Nein, wer nicht von Fackelzug zu Fackelzug mitbelogen, mitbenebelt worden ist, kann da nicht mit. Nicht entschieden genug können wir da «Leben Sie wohl!» rufen. Wir wollen, noch beim Abschiednehmen, fair sein und wollen nicht annehmen, daß Opportunismus der Beweggrund für diese befremdliche Verirrung eines großen deutschen Schriftstellers ist. Ich setze seine absolute Ehrlichkeit voraus, er verkauft sich nicht, möchte ich meinen, sosehr er sich auch verirrt. Aber zu sagen ist, daß diese Verirrung doppelt peinlich wirkt in einem Moment, wo sie so viel Vorteile und Angenehmes für den sich Verirrenden mit sich bringt. Noch einmal: ich glaube nicht, daß diese Vorteile Einfluß auf ihn üben konnten. Aber diese für ihn moralisch so gefährliche Situation hätte ihn, der materiell gewonnen hat, dahin bringen müssen, eine andere Sprache, eine Sprache etwas weniger von oben herab, zu uns zu sprechen, die wir, doch wohl durch unsere Gesinnung, alles verlieren. – Ich will ihm sogar glauben, daß er keine neuen Freunde erwartet, während er seine alten verliert. Er wird bald sehr einsam sein – ein Mensch von Rang ist einsam in diesem Staat, sogar wenn er mit ihm zu sympathisieren glaubt. Er wird viel leiden. Fehler von solchem Ausmaß bleiben nicht ungebüßt. «Privatliebhaberei oder Richtung auf den Staat» – diese Alternativen ruft er mir zu: Ganz recht – da heißt es sich entscheiden. Richtung auf welchen Staat, fragt sich nur. Welcher Diktatur opfern wir unser Höchstes, die Freiheit?
Gottfried Benn, indem er sich dieser Diktatur zur Verfügung stellt, bringt ein falsches, ein perverses, ein im wesentlichen Sinn verwerfliches Opfer. Er haßte die Ordnung so sehr, daß er nun für die brutal organisierte Unordnung optiert. Diese Sünde ist unverzeihlich.
Zwei kleine Bücher
Die Stimmung der Zeit ist den beiden hübschen kleinen Büchern, die der Rowohlt Verlag anbietet, nicht eben günstig. Trotzdem – oder gerade deshalb – empfangen und öffnen wir sie mit einer gewissen Gerührtheit und einer fast freundschaftlichen Sympathie. Eure Stimmen sind zart, kleine Bücher, und werden sicherlich von aufdringlicheren Stimmen leicht übertönt werden. Doch der Klang eurer Stimmen ist rein – nicht sehr erregend, aber auf eine etwas melancholische Art angenehm unserem Ohr. – Das eine Buch, «Lyrische Novelle», ist von der jungen Schweizerin Annemarie Schwarzenbach, die sich durch eine frühere Arbeit, «Freunde um Bernhard», schon Anerkennung verschaffte. Franz Hessel, der Autor des anderes Buches, «Ermunterungen zum Genuß», hat seit langem viele Freunde bei allen, die etwas vom Lesen verstehen. Er gehört zu den Wenigen, die im deutschen Sprachgebiet die große Tradition der kleinsten Form mit Anmut und Gescheitheit fortsetzen, und wir müssen ihn also in die Familie der Peter Altenberg und Polgar rechnen (wobei zu bemerken ist, daß wir ihn nicht ganz von der Genialität Altenbergs, dafür aber reiner, weiter fort vom Journalismus als Polgar finden). Diese Kunstform der Skizze, die wir genauer als ein heiter-belehrendes Traktat bezeichnen sollten, schien mehr in Wien zu Hause als in Berlin. Aber es zeugt für den Prozeß, den Berlin durchzumachen im Begriffe war – diesen Prozeß der Auflockerung, des Europäisch-Werdens, der nun mit so beispielloser Brutalität abgebrochen wurde –, daß eben nun auch dort so liebeszarte und lebenskluge Gebilde entstehen konnten, wie sie sonst nur in Wien oder Paris entstehen und verstanden werden konnten.
Genießen wir also, entgegen dem Zeitgeschmack, noch einmal diese Erfahrenheit in den kleinsten Dingen, die jeder Seite des Buches ihren Reichtum und ihre Schönheit gibt. Lernen wir mit ihm, diesem sinnigen Großstädter, die «Kunst des Spazierengehens», die er so gut kennt und so reizend empfiehlt, – diese ruhevolle und aufmerksame Haltung der «ambulanten Nachdenklichkeit», dieses melancholische und kluge Epikureertum. Gehen wir mit ihm in die «Schule des Genusses», «diese holde und strenge Zucht». Während er unbeteiligt scheint, dieser gemächlich Schlendernde, nimmt er in Wahrheit Anteil an allem – nicht nur an den Menschenschicksalen, von denen er uns erzählt, sondern auch an dem Leben der Dinge – der Straßen, Häuser und der Gegenstände –, das so viel schwerer zu erraten ist. Wie schön ist es, wenn er in einem Traum das Bild des sommerlich verlassenen Berlin erstehen läßt, die große, glühende Stadt selber spricht zu ihm: «Ich große Stadt freue mich auf die Zeit, in der ich leer werde von Menschen und voll von mir selbst.» Was wird da nicht alles beschworen und angeredet: der Reiz der Jahreszeiten, junges Gemüse und Christbaumschmuck; Sprichwörter, mit denen sich spielen läßt; die sich nur scheinbar wandelnden, in Wahrheit ewig gleichen Formen der Liebe; das Meer, der gute Regen und immer wieder die Stadt, deren Geheimnisse dieser Dichter aus einer so genauen und tiefen Erfahrung kennt. Und zwischen all diesen Studien, die das Irdische auf eine fast fromme Art feiern, steht ein Kapitel wie das über das kindlich-hingerissen erlebte Pfingstfest, in dem die Ergriffenheit vor dem Geist wie die Ergriffenheit vor einem irdischen Schauspiel – vor einem Gewitter, einem Regenbogen – wird.
Von einer ähnlichen Ergriffenheit vor den irdischen Dingen ist auch die lyrische Erzählung der Annemarie Schwarzenbach, nur daß hier der Ton nicht weise-betrachtsam, sondern knabenhaftbegeistert, bittertraurig oder glücksberauscht ist. Die Handlung ist beinah nichts: ein Junge aus gutem Hause – eine Varietésängerin von merkwürdig kaltem, unnahbarem Liebreiz –: das ist alles. Weiter scheint es nichts zu geben auf dieser Welt – und mit einem innig sich verströmenden Gefühl wird die Geschichte dieser hoffnungslosen, bitter-süßen Liebe erzählt. Wie gern verzeihen wir die ganze Naivität dieses ersten, wonnevollen Schmerzes, die Unbedenklichkeit dieses knabenhaften Subjektivismus. Mit wieviel Rührung hören wir noch einmal diese Melodie, da sie doch noch einmal, und immer wieder, so frisch, so wahrhaftig kommt. Die Weise kenne ich doch! – aber sie wird noch einmal neu, diese ganze Stimmung zwischen Hamsun und Rilke, zwischen «Pan» und «Malte Laurids Brigge». In diesen Gegenden ist sie seelisch zu Hause, aber erzählerisch verzichtet sie auf Manieriertheit, die die jungen Leute sonst wohl so gerne von diesen Meistern mitbringen. Der Stil hat Leichtigkeit, Duft und Rhythmus, aber er bleibt wohltuend einfach, ja: von einer gewissen Sachlichkeit bei allem Überschwang, eher an den besten Amerikanern, etwa an Hemingway, geschult. – Man könnte gegen dieses junge Buch einwenden, daß die Figuren, die es uns vorstellt, niemals recht plastisch werden, nicht einmal die des geliebten Mädchens. Der Subjektivismus dieser lyrischen Beichte geht so weit, daß die Existenz der anderen nie als solche, nie als die Tatsache eines fremden Schicksals ernst genommen wird, sondern immer nur in bezug auf die Gefühle, die sie in dem Erzählenden und Erlebenden auslöst. Das ist der typische Fehler solcher Erstlingswerke, deren Charme ohne ihn vielleicht nicht denkbar wäre. Eine andere Eigenschaft des Buches, die mich etwas stört, ist seine fast penetrante Atmosphäre von sozialer Sorglosigkeit, die auf manche geradezu anziehend wirken mag. Alle haben sie ihre Autos, essen in netten Restaurants und verkehren in der englischen Botschaft. Das spricht freilich an sich noch nicht gegen die Stärke ihrer Gefühle, die trotzdem tödlich sein kann. Mir ist aber der Leser vorstellbar, der, durch soviel feines Leben enerviert, etwa sagte: Junger Herr – wenn du nicht so sorglos auf dem materiellen Gebiet wärest, würdest du über deine Herzenssorgen wesentlich leichter hinwegkommen. Nichts entwertet einen großen Schmerz so leicht, als wenn man ihm einen gar zu luxuriösen Rahmen gibt. – Die schönsten Stellen des Buches sind die, die von Berlin weg und in die Landschaft hinaus gehen. Einige dieser Landschaftsschilderungen sind von so großer Schönheit, daß sie allein genügen würden, um das Dichtertum dieses ephebischen jungen Autors zu beweisen. Alle Mittel sind da, und wir zweifeln nicht daran, daß Annemarie Schwarzenbach sie noch in einer bedeutenderen Weise verwenden wird als heute, da sie ihr dazu gedient haben, ihre junge Not und ihre schwelgerische Traurigkeit auf eine so hübsche Art darzustellen.
Alfred Döblin: «Unser Dasein»
Ein Handwerksmann ruht über seinem Werkzeug aus, um sich zu fragen: Was bin ich? Was ist Ich? Was bedeutet denn in dieser Welt mein Dasein? – Staunend, gerührt, hingerissen steht er vor dem Phänomen dieses Ichs, diesem «weltunmittelbaren Wunder», das da Teil der Natur ist und ihr Gegenstück. So beginnt er zu philosophieren.
Die Philosophie Döblins zeigt auf eine großartig einleuchtende Weise immer wieder die ersten Ursachen, aus denen das spekulative Nachdenken kommt; sie gibt eine Art Entstehungsgeschichte der Spekulation überhaupt. Keine andere Philosophie, kein System, nicht Marx und nicht Plato werden vorausgesetzt. Der Handwerksmann kommt ganz von selbst zu all seinen Überlegungen, Fragen, Sorgen, Schlüssen, Skrupeln und Erleuchtungen. Was bedeutet mein Ich? fragt er hartnäckig, und was soll unser Dasein? – Der Sinn des Buches ist ein ungemein einfacher: dem Ich, dem eigenen wie dem fremden, dazu zu verhelfen, daß es sich selber enträtsle; ihm einen Weg zu weisen für seine ununterbrochene, mystische und höchst reale Aktion. «Wir wollen hier aber nicht ein System hinstellen, sondern einen Weg beschreiten», heißt es deshalb. Nun ist festzustellen, wie weit es dem Buch gelingt, diese seine bedeutende Absicht durchzuführen.
Döblins Buch hat nicht einen Stil, sondern mehrere. Seine Form ist halb populäres Philosophem, halb Ballade. Eine gewisse Holzschnitt-Manier ist gewollt; an einigen Stellen – etwa dort, wo aus einer energischen, farbigen und konzentrierten Prosa etwas lahme Knüppelverse werden – artet diese Manier zur fast albernen Koketterie aus. Dort spürt man eine lutherische Markigkeit peinlich beabsichtigt. An anderen Stellen – etwa in dem jüdischen Kapitel, wo es dem Autor ganz ernst um seinen Gegenstand wird – ist diese grimmige Kraft und Einfachheit, die mit ihrem Gegenstand hart umspringt, ihn anschreit, beutelt und liebevoll-zornig mit ihm hadert, blutvoll da, echt, legitim. – Wieder andere Abschnitte gibt es, wo aus dem populären Philosophem großer wissenschaftlicher Essay wird. Dort sehen wir neben den Dichter und den Schriftsteller Döblin den Arzt Döblin treten, den Naturwissenschaftler. Er versenkt sich in psycho-physische Details des Menschenwesens, das seine unersättliche Neugierde fesselt. Von Exkursionen dieser Art bleibt besonders die sehr wesentliche und neue Untersuchung über das Pubertätsproblem im Gedächtnis. – Anderswo wieder bewährt sich plötzlich Döblin der Epiker. Es wird nicht mehr betrachtet, sondern erzählt. Und viele dieser Stellen sind schönste Erzählung; man lese etwa daraufhin das Kapitel von der Sommerliebe.
Unter der allumfassenden Überschrift «Unser Dasein» kann man viele Themen vereinigen; es muß gesagt werden, daß Döblin dies etwas wahllos getan hat. Das jüdische Kapitel ist stark und von einer großen aktuellen Bedeutung. Aber es behandelt doch ein Spezialproblem, die Problematik eines bestimmten Volkes. Ebensogut wären andere Spezialthemen heranzuholen gewesen. Das Buch hat einen gewissen enzyklopädistischen Ehrgeiz, dem es dann nicht ganz gerecht wird. Das hindert nicht, daß einige dieser «Spezial»-Kapitel, als in sich geschlossene Studien betrachtet, meisterhaft und der genauesten Betrachtung wert sind. Ich denke vor allem an den Abschnitt über die Kunst, vielleicht den schönsten des Buches, aus einer sehr tiefen Erfahrung geschrieben. Es verlockt mich sehr, gerade auf diesen reichen Abschnitt näher einzugehen, aus ihm zu zitieren, Stellung zu nehmen. Kunst – diese «Ergänzung einer unvollständigen Individualität», diese «Bewegung und Hinwendung, dieser Drang des unselbständigen Individuums auf Vollkommenheit» –: wie unerschöpflich steht das geheimnisvoll-klare Phänomen noch einmal und wieder vor uns; wie neu, wie kühn finden wir es betrachtet, verehrt und gedeutet. Wieviel, was man über Sendung und Wesen der Kunst in letzter Zeit behauptet oder gefordert hat, wird daneben oberflächlich, schief, unwahr. «Das Entweder-Oder von Kunst als Spiel und Kunst als Pädagogik und Didaktik ist Unsinn. Ist etwa Spiel keine Belehrung?» – So einfach liegen die Dinge, wenn man sie von einer hohen Warte aus sieht.
Unser Dasein – ich finde, daß eine Hybris in dem kurzen Titel liegt. Denn nichts Geringeres ist unternommen, als unser Ich mit der ganzen unendlichen Welt zu konfrontieren, deren Teil und Widerpart es ist. Sonnensysteme, Pflanzen und Kristalle; das Wunder des Lichts, das Geheimnis der Zeit: alles muß da einbezogen werden, alles steht zur Debatte. Zur Debatte steht das Individuum, wie es als Materie und als Mysterium, als Tier, als Seele, als kollektives Wesen und als Einsamkeit sich über diesen Planeten bewegt und seine undeutbare Sendung erfüllt – oder versäumt. Triumph der Ich-Werdung – Schmach der Ich-Werdung –: so und so können wir es empfinden, beleuchten, vor uns selbst stilisieren. Daß wir Ich wurden, ist ja ohne Frage das zugleich Gräßlichste und Großartigste, was uns überhaupt widerfahren konnte. Dadurch daß wir uns als Ich wissen, triumphieren wir über die Natur und sind von ihr ausgestoßen. («Nein, wir kommen nicht aus der reinen Hand der Natur, wir sind Parias, und kein Bauen von Kirchen und Beten macht das gut.»)
Das Thema des Zusammenlebens, der Koexistenz hat ohne Frage von allen Themen die meiste Aktualität. Gerade hier aber wird Döblin leider ein wenig unklar. Man könnte vereinfachend sagen, daß er ein leidenschaftlicher Anti-Kollektivist ist – («In den straffsten Staaten leben die einsamsten Menschen») –; darin, wenn auch nur darin der Ideologie des Kommunismus ebenso fern und feindlich wie der des Faschismus. Worauf er hinaus will, ist etwa die Lehre von einem Individualismus, der das einzelne Ich antreibt, sich mit allem Pathos ernst zu nehmen, sich zu bewehren, zu wachsen, sich zu vollenden; der es aber andererseits zur Ein- und Unterordnung erzieht und es reinigt vom Egoismus. Diese Lehre, dieser Rat ist aber nirgends ganz klar, nirgends ganz überzeugend ausgesprochen.
Es ist deshalb denkbar, daß junge Menschen, die sich gierig an dem geistigen Reichtum und der belehrenden Schönheit dieses Buches labten, es dann doch etwas ungetröstet und enttäuscht verließen. Döblin, dieses eigensinnige und starke Haupt, hat einen sehr gefährlichen Hang, geistige Konfusionen anzurichten. Seine Philosophie, merkwürdig an der Grenze zwischen Idealismus und einem entschlossenen Realismus, regt jedenfalls mächtig an; etwas unsicher bin ich aber, ob sie wirklich weiterhilft.
Was nimmt der orientierungsbedürftige junge Leser als Kernspruch mit, an den er sich halten könnte? «Alles will wieder zur Erde. Wer sich dem entzieht, entzieht sich dem Leben und der Ewigkeit», so ruft ihm das Buch «Unser Dasein» zu, das alles Irdische feiert, das Diesseits, die diesseitige Aktion. Die Position, die Döblin uns am eifervollsten widerrät, ist die kontemplative. Er will die Aktion, er fordert zu ihr auf; aber dann will er sie doch wieder nicht allein um ihrer irdischen Konsequenzen willen, sondern wie als Symbol einer anderen unendlichen Handlung. So scheint er sie herabzusetzen, während er zu ihr anspornt. Dies könnte verwirren, zumal es an keiner Stelle wirklich unzweideutig formuliert ist. Das Buch ändert oft seinen Gesichtspunkt, es ist wirklich lebensvoll und auf eine großartige Weise konfus – wie unser Dasein. Bücher von solchem Anspruch aber sind wohl eigentlich da, um zu klären.
Die Sammlung
Diese Zeitschrift wird der Literatur dienen; das heißt: jener hohen Angelegenheit, die nicht nur ein Volk betrifft, sondern alle Völker der Erde. Einige Völker aber sind so weit in der Verirrung gekommen, daß sie ihr Bestes schmähen, sich seiner schämen und es im eignen Lande nicht mehr dulden wollen. In solchen Ländern wird die Literatur vergewaltigt; um sich der Vergewaltigung zu entziehen, flieht sie ein solches Land. In dieser Lage ist nun die wahre, die gültige deutsche Literatur: jene nämlich, die nicht schweigen kann zur Entwürdigung ihres Volkes und zu der Schmach, die ihr selber geschieht. Der Widergeist selber zwingt sie zum Kampf. Schon ihr Auftreten, ja, schon die Namen derer, die sie repräsentieren, werden zur Kriegserklärung an den Feind. – Eine literarische Zeitschrift ist keine politische; die Chronik der Tagesereignisse, ihre Analyse oder die Voraussage der kommenden macht ihren Inhalt nicht aus. Trotzdem wird sie heute eine politische Sendung haben. Ihre Stellung muß eine eindeutige sein. Wer sich die Mühe machen wird, die Hefte unserer Zeitschrift zu verfolgen, soll nicht zweifeln dürfen, wo wir, die Herausgeber, und wo unsere Mitarbeiter stehen. Von Anfang an wird es klar sein, wo wir hassen und wo wir hoffen, lieben zu dürfen.
Der Geist, der über Deutschland hinaus Europa wollte – und zwar ein von der Vernunft regiertes, nicht imperialistisches Europa – und der, eben deshalb, im neuen Deutschland verfemt, verachtet, jeder Verfolgung ausgesetzt war, bis er dort buchstäblich nicht mehr atmen konnte – dieser Geist darf sich in den Ländern, die ihm Gastfreundschaft gewähren, nicht nur dadurch manifestieren, daß er das Hassenswürdige immer wieder, immer noch einmal analysiert und anklagt, daß er sich beschwert, streitet und fordert; er muß sich auch – jenseits dieser permanenten Bitterkeit, zu der man ihm Anlaß gegeben hat – und wieder als das bewähren, was zu sein er behauptet als jenes kostbarste Element, das fortfährt, produktiv zu sein, während es kämpft; das blüht, während eine Übermacht es ersticken möchte, und, kämpfend-spielend, ein Licht hat, das die Finsternis überdauert.
Die wir sammeln wollen, sind unter unseren Kameraden jene, deren Herzen noch nicht vergiftet sind von den Zwangsvorstellungen einer Ideologie, die sich selber «die neue» nennt, während sie in Wahrheit alle bedenklichen Zeichen der «Überständigen» trägt, und die wir verabscheuenswert finden; jene, die nicht glauben, daß Phantasie, Tiefe und die Vernunft einander ausschließen; die, in einem allgemeinen Chaos, dem Geiste treu geblieben sind und weiter seine strengen und schönen Pflichten lieben. Diese Jungen wünschen wir heranzuziehen, wo immer wir sie finden. Gleichzeitig aber werden wir den Älteren, Reifen, schon durch ihr Werk Bestätigten dankbar sein, wenn sie uns ihre Hilfe, ihre Sympathie, ihre Mitarbeit zur Verfügung stellen. Die trennenden Linien – die nun schon klaffende Abgründe sind – laufen heute nicht zwischen den Generationen, sondern quer durch die Generationen hindurch. – Sammeln wollen wir, was den Willen zur menschenwürdigen Zukunft hat statt dem Willen zur Katastrophe; den Willen zum Geist statt dem Willen zur Barbarei und zu einem unwahren, verkrampften und heimtückischen «Mittelalter»; den Willen zum hohen, leichten und verpflichtenden Spiel des Gedankens, zu seiner Arbeit, seinem Dienst, statt zum Schritt des Parademarsches, der zum Tode durch Giftgas führt im Interesse der gemeinsten Abenteurer; den Willen zur Vernunft statt dem zur hysterischen Brutalität und zu einem schamlos programmatischen «Anti-Humanismus», der seine abgründige Dummheit und Roheit hinter den schauerlichsten Phrasen kaum noch verbirgt.
Wer diese Dummheit und Roheit verabscheut, bleibt deutsch – oder er wird es erst recht –; auch wenn ihm von dem mißleiteten Teil der eignen Nation dieser Titel vorübergehend aberkannt wird. Eben für dieses verstoßne, für dieses zum Schweigen gebrachte, für dieses wirkliche Deutschland wollen wir eine Stätte der Sammlung sein – nach unsren Kräften.
Wir wissen aber – und es ist unser Trost –, daß nicht nur in unseren Reihen so gefühlt und gedacht wird. Wir müssen uns, Angehörige aller Nationen, die wir, noch verstreut, in den verschiedenen Ländern und Erdteilen arbeiten, als einen Trupp empfinden, als ein «Fähnlein von Aufrechten», das, in einer Lage von akuter Bedrohtheit, etwas von dem, was uns lebensnotwendig und heilig ist, hinüberretten will in eine andere Zukunft, an die wir, trotz allem, glauben.
Gottfried Benn oder Die Entwürdigung des Geistes
Im Mai dieses Jahres schrieb ich an den Dichter Gottfried Benn einen Brief. Die Verehrung, die ich für ihn gehabt hatte, machte es mir zum Bedürfnis und gab mir das Recht, ihn um Aufklärung zu bitten, ob Gerüchte, die mir über seine geistig-politische Stellungnahme zu Ohren gekommen waren, den Tatsachen entsprächen. Die Aufklärung, um die ich ihn als Leser, als Bewunderer, fast als Freund privat ersucht hatte, gab er mir in Form eines offenen Briefes, «An die Emigranten», den er im Rundfunk verlas und der in der «Deutschen Allgemeinen Zeitung» publiziert wurde. Der peinlichen Aufgabe, auf diesen Brief Gottfried Benns, der mich durch die Tiefe seines sprachlichen und moralischen Niveaus, durch die Unhaltbarkeit und Verwirrtheit seiner Argumente und durch die Infamie seiner lügenhaften Angriffe gegen im eignen Land Wehrlose entsetzt hatte, meinerseits zu erwidern, war ich enthoben: andere sagten, was zu sagen war, Benn wurde mit Erwiderungen überschüttet. Ich konnte schweigen, und mit meiner Enttäuschung über den einst Hochgeschätzten allein fertig werden.
Dieser Brief, diese Ansprache an uns «Emigranten» bildet das zweite Stück in dem Buch «Der neue Staat und die Intellektuellen». Ihm vorangestellt ist eine andre Rundfunkrede, die den Titel des Buches trägt und womöglich noch platter, geistig noch magerer, auch noch bösartiger ist. Beide Arbeiten zusammen nennt der Autor «das Resultat» seiner «fünfzehnjährigen gedanklichen Entwicklung». Ein bescheidnes Resultat, muß man sagen. Es wird nicht üppiger, wenn man den letzten Aufsatz des Buches, den schlimmsten und schlechtesten, «Züchtung»,