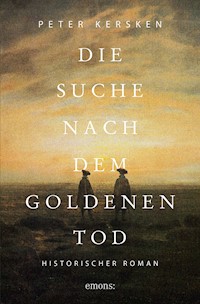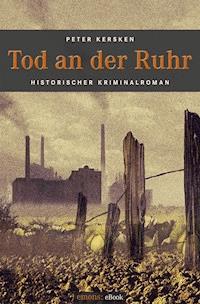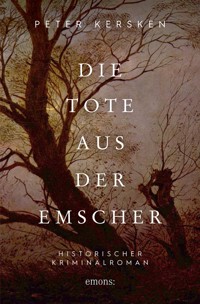Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historischer Kriminalroman
- Sprache: Deutsch
Sommer 1966: Kohlenhalden im Ruhrgebiet, Zechen werden dichtgemacht, Bergleute gehen auf die Straße. Und unter einer Brücke im Oberhausener Stadtteil Sterkrade liegt ein toter Junge. Die Mutter des Kindes glaubt an eine Strafe Gottes, Oberinspektor Manni Wagner hat daran seine Zweifel und stößt auf eine Geschichte, die bereits 1947 begann. Er ermittelt in einer Schrebergartenkolonie und einer Duisburger Hafenbar, stellt sich in der Eifel schrecklichen Erinnerungen und verpasst das Finale der Weltmeisterschaft. Während in Wembley ein Tor fällt, das keines ist, sitzt er einem Mörder gegenüber. Der dritte Teil der Ruhrgebietssaga von Peter Kersken: Hochspannend und sehr berührend werden Zeitgeschichte und persönliche Schicksale der der Menschen im Ruhrgebiet zu einem großartigen Kriminalroman verknüpft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Kersken, geboren 1952 in Oberhausen im Ruhrgebiet, studierte Philosophie und Literaturwissenschaft in Freiburg und Köln und arbeitete als Redakteur bei einer Kölner Tageszeitung. Er lebt als freiberuflicher Autor in der Eifel. Im Emons Verlag erschienen »Tod an der Ruhr« und »Im Schatten der Zeche«.
Dieses Buch ist ein Roman, und alle darin geschilderten Ereignisse sind frei erfunden. In besonderem Maße gilt das für Handlungen und Äußerungen der auftretenden oder erwähnten Personen, auch wenn einige von ihnen nicht der Phantasie des Autors entsprungen sind. Darüber hinaus sind Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen rein zufällig.
© 2012 Hermann-Josef Emons Verlag Alle Rechte vorbehalten Umschlagfoto: Hans Dieter Baroth Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch eBook-Erstellung: CPI – Clausen & Bosse, LeckISBN 978-3-86358-166-4
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter
»Ein Autor nimmt nicht Wirklichkeit,
er hat sie, schafft sie,
und die komplizierte Dämonie
auch eines vergleichsweise realistischen Romans
besteht darin,
daß es ganz und gar unwichtig ist,
was an Wirklichem in ihn hineingeraten,
in ihm verarbeitet,
zusammengesetzt,
verwandelt sein mag.
Wichtig ist,
was aus ihm an geschaffener Wirklichkeit
herauskommt und wirksam wird.«
EINS
Der Fall war abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft hatte die Ermittlungen eingestellt.
Manfred Wagner war wütend. Er warf seine Zigarettenkippe achtlos auf die grauen Betonplatten. Ein paar Tauben stürzten sich flügelschlagend auf die ungenießbare Beute. Ein junges Tier pickte nach dem glimmenden Stummel. Wagner klatschte in die Hände. Die Vögel flatterten aufgeschreckt hoch. Er stand auf, trat die Kippe aus und setzte sich wieder auf die Parkbank am Rande des Friedensplatzes.
Ein Vierzehnjähriger konnte doch nicht aus Versehen von einer Brücke fallen! Und dass der Junge gesprungen war, nein, das konnte auch nicht sein!
Wagner zog eine neue Güldenring aus dem Zigarettenpäckchen und zündete sie an. Die Tauben kamen wieder herangehüpft und beäugten ihn.
Ein junger Mensch, der hing doch an seinem Leben, verdammt noch mal! Wagner hatte nicht vergessen, wie sehr er den Tod gefürchtet hatte. Wie blutjunge Kerle damals um ihr Leben gebetet hatten, wie sie wimmernd durch die Schützengräben gekrochen waren, wie sie schreiend ihr Leben verloren hatten, das alles hatte er nicht vergessen. Das würde er niemals vergessen.
Nein, es konnte nicht sein, dass im Sommer des Jahres 1966, in dem junge Menschen erwachsen wurden, die den Krieg nicht erlebt hatten, die Hunger und Kälte nicht kannten, die nicht einmal ahnten, was Hoffnungslosigkeit bedeutete, dass in dieser Zeit ein vierzehnjähriger Junge sein Leben wegwarf.
Was bedeutete es schon, dass die Oberhausener Kriminalpolizei bei der Untersuchung des Todesfalls Joachim Hüwel keinen Anhaltspunkt für ein Fremdverschulden gefunden hatte?
Missmutig schaute Wagner zur dunkelbraunen Backsteinfassade des Polizeipräsidiums hinüber.
»Der Fall ist abgeschlossen«, hatte Kriminalrat Kerkhoff während der Morgenbesprechung erklärt, und er hatte keinen Zweifel an der Endgültigkeit seiner Auffassung zugelassen. Er hatte die Aktenmappe, die vor ihm auf dem Tisch gelegen hatte, zugeschlagen und Wagners Kopfschütteln nicht zur Kenntnis genommen.
»Der Junge ist jetzt seit zwanzig Tagen tot. Wir haben getan, was zu tun war. Die kriminaltechnischen Untersuchungen vor Ort, die Obduktion der Leiche, unsere Ermittlungen im Umfeld des Joachim Hüwel, all das hat zu nichts geführt. Hinweise auf ein Tötungsdelikt haben sich nicht ergeben.«
»Hinweise auf eine Selbsttötungsabsicht des Jungen auch nicht«, hatte Wagner mürrisch gesagt.
»Nach meiner Überzeugung war es ein tragischer Unglücksfall, eine Folge jugendlichen Leichtsinns. Wir haben nicht einen einzigen Anhaltspunkt dafür gefunden, dass beim Sturz des Jungen von der Brücke auf die Bahngleise jemand nachgeholfen hat. Der Entscheidung der Staatsanwaltschaft, die Ermittlungen einzustellen, ist deshalb aus kriminalpolizeilicher Sicht vorbehaltlos zuzustimmen«, hatte Kerkhoff unmissverständlich festgestellt.
Für Wagner hatte er sich ein gönnerhaftes Lächeln abgerungen. »Ihr Eifer ehrt Sie ja, Herr Oberinspektor«, hatte er gesagt. »Aber auch Sie müssen sich damit abfinden, dass nicht jede Ermittlung mit der Überführung eines Täters enden kann.«
»Darum geht es doch gar nicht, Herr Rat«, hatte Wagner entgegnet.
Kerkhoff hatte abgewinkt, hatte mit einer flüchtigen Handbewegung alle weiteren Überlegungen und Einwendungen zum Fall Hüwel für unerwünscht erklärt.
»Sehen Sie die Angelegenheit doch mal positiv, Wagner! Unsere Ermittlungen haben zu dem erfreulichen Ergebnis geführt, dass kein Fremdverschulden vorliegt. Also können wir die Akte Joachim Hüwel schließen und sie zu den aufgeklärten Fällen legen. Das ist es, was für uns zählt.«
Dann hatte der Kriminalrat plötzlich den grünen Zettel in der Hand gehabt und gut gelaunt damit herumgewedelt. »Und Ihren Antrag, Wagner, den hab ich jetzt doch noch unterschrieben. Ab Montag können Sie drei Wochen Urlaub machen. Und weil Sie am Wochenende sowieso dienstfrei haben, ist schon morgen der letzte Arbeitstag für Sie.«
»Ach«, hatte Wagner gesagt.
An seinen Urlaubsantrag hatte er schon eine ganze Weile nicht mehr gedacht. Er hatte ihn am sechzehnten Juni eingereicht, am Tag bevor der Junge zwischen den Bahngleisen gefunden worden war.
»Ist Ihnen das jetzt zu kurzfristig?« Kerkhoff hatte ihn enttäuscht angesehen. »Ich versteh das ja, und zwingen will ich Sie nicht«, hatte er gesagt. »Wenn man am Donnerstag erfährt, dass man am Samstag in Urlaub fahren kann, bleibt natürlich keine Zeit mehr, um irgendwas zu planen und zu buchen. Aber solange wir mit dem Fall Hüwel beschäftigt waren, konnte ich Ihren Urlaubsantrag nicht unterschreiben. Das sehen Sie doch ein?«
Ohne den Kriminalrat anzusehen, hatte Wagner wortlos genickt.
Eine Reise zu buchen, war nie seine Absicht gewesen. Hin und wieder mal mit dem Motorrad hinauszufahren aus der Stadt an den Niederrhein, vielleicht mal bis ins Sauerland oder nach Holland rüber, sich den Wind um die Nase wehen zu lassen, einen Wind, der nicht nach Rauch und Ruß und Kohlenstaub stank, der nach Blüten und Gräsern und nach frischem Heu duftete, das hatte er sich vorgestellt.
»Und am Montag fängt die Weltmeisterschaft an«, hatte Kerkhoff gesagt. »Allein dafür lohnt es sich doch schon, Urlaub zu machen. Sechzig Stunden Fußball bis zum Endspiel, abwechselnd im ersten und im zweiten Programm. Jede Menge Direktübertragungen. Ist das nicht phantastisch?«
»Ich hab kein Fernsehgerät«, hatte Wagner gesagt.
»Wie auch immer, lieber Oberinspektor. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie jetzt Ihre drei Wochen nehmen könnten. Es würde gut passen. Sie wären zu Beginn der Sommerferien wieder im Haus. Dann könnten die Kollegen in Urlaub gehen, die schulpflichtige Kinder haben.«
Unschlüssig hatte Wagner sich eine Zigarette angezündet.
»Denken Sie drüber nach! Bis Dienstschluss brauche ich Ihre Entscheidung«, hatte Kerkhoff gesagt.
Wagner schaute auf seine Armbanduhr. Noch knapp zwei Stunden waren es bis zum Feierabend.
Die Tauben liefen zu einer Parkbank, auf die sich eine Frau im weinroten Kostüm gesetzt hatte. Sie strich ihren Rock glatt. Er endete kurz oberhalb der Knie. Sie war in Wagners Alter, und er bemerkte, dass sie schöne Beine hatte.
Seine Bedenken im Fall Joachim Hüwel waren berechtigt. Davon war er überzeugt. Es ärgerte ihn, dass Kerkhoff sie mit einer läppischen Handbewegung abgetan hatte. Es ging ihm gegen den Strich, dass er von einem auf den anderen Tag seinen Urlaub antreten sollte. Andererseits gefiel ihm der Gedanke, das Präsidium gerade jetzt ein paar Wochen lang nicht sehen zu müssen.
Er betrachtete gedankenverloren das lang gestreckte Backsteingebäude an der Ostseite des Friedensplatzes, von den Rundbögen im Erdgeschoss bis hinauf zu den Gauben auf dem Dach, und ließ seinen Blick an den spärlichen Ornamenten im Mauerwerk entlanggleiten bis hinüber zur prunkvollen Fassade des Amtsgerichtes, das die Grünanlage schon im Norden begrenzt hatte, als die Oberhausener sie noch Kaiserplatz, Industrieplatz und Adolf-Hitler-Platz genannt hatten.
Wagner saß auf einer Bank in der Nähe der Wasserspiele, ungefähr da, wo der bronzene Schwan, den die Stadt zu ihrem hundertsten Geburtstag geschenkt bekommen hatte, seinen langen Hals weit nach hinten bog. Hinter dem großen Vogel ragten die beiden achtgeschossigen Türme des Europahauses in den diesigen Himmel, Wahrzeichen einer aufstrebenden Industriestadt, die an die Zuversicht der fünfziger Jahre erinnerten.
Wagner hielt vergeblich nach der Sonne Ausschau. Es war längst nicht mehr so warm wie in den vergangenen Wochen. Im Juni hatte eine ungewöhnliche Hitze den Menschen zu schaffen gemacht. Drückende Schwüle hatte sich übers Ruhrgebiet gelegt, Gewittergüsse hatten Straßen und Keller überschwemmt. Seit Anfang Juli zeigte die Sonne sich nur noch selten. Als Wagner am Morgen zum Präsidium gefahren war, hatte er sie über den Kühltürmen der Hüttenwerke entdeckt, eine blasse Scheibe hinter schmutzigen Schwaden, die im Laufe des Tages immer dichter und dunkler geworden waren. Es sah nach Regen aus. Urlaubswetter war das nicht.
Die Frau im weinroten Kostüm warf den Tauben Brotreste zu. Wagner beobachtete die aufgeregten Tiere. Sie trippelten ungeduldig vor den Füßen der Frau auf und ab.
Sie trug hochhackige Sommerschuhe und nahtlose Perlonstrümpfe.
Er war schon fast zwei Wochen nicht mehr bei Ilona gewesen. Er sollte sie wieder einmal besuchen, am Sonntag vielleicht. An Sonntagen hatte sie nie viel zu tun.
***
Manfred Wagner hatte seinen Schreibtisch aufgeräumt. Den Schnellhefter mit den Befragungsprotokollen im Fall Hüwel schob er in seine Kollegmappe.
»Die nehme ich mit. Das sind nur die Durchschläge«, sagte er zu Artur Trappe. »Die braucht ja niemand mehr. Die Originale sind ordnungsgemäß in der Akte Hüwel abgelegt.«
»Drei Wochen bist du jetzt weg? Womit hast du dir das bloß verdient?«
»Nu mach mal halblang, Artur. Das ist mein erster Urlaub, seitdem ich in Oberhausen bin. Und ich bin jetzt schon ein ganzes Jahr bei euch.«
»Fährst du weg?«
»Ich weiß nicht. Wenn das Wetter besser wird, mach ich vielleicht ein paar Touren mit dem Motorrad.«
»Junggeselle müsste man sein!«
»Wieso das denn?«
»Du kannst dir einen dicken Ford leisten und dazu noch ein Motorrad. Davon kann ich als Familienvater nur träumen.«
»Das ist doch Unsinn. Den Taunus hab ich gebraucht gekauft, und meine Adler-Maschine hat schon zwölf Jahre auf dem Buckel. Ich hab mich einfach nicht von dem alten Hobel trennen können, als ich mir das Auto angeschafft habe.«
»Und wenn das Wetter nicht besser wird?«
»Faulenzen, lesen, mal ins Kino gehen und viel Musik hören mit meinem neuen Stereo-Gerät. Dazu komme ich sonst viel zu selten.«
»Fußball gucken?«
»Vielleicht.«
Trappe sah ihn verständnislos an. »Mensch, Manfred, so eine Weltmeisterschaft kann man sich doch nicht entgehen lassen. Wir haben in England die Möglichkeit, nach zwölf Jahren endlich mal wieder ins Endspiel zu kommen. Also, ich bin schon richtig aufgeregt. Am Montag geht es los.«
»Du weißt doch, dass ich keinen Fernsehapparat habe.«
»Dann kommst du eben zu mir. Ich würde mich freuen. Bei uns wird auf jeden Fall geguckt. Die Leni und die Jungs sind ganz verrückt auf Fußball. Wenn Länderspiele sind, kommt mein Schwiegervater meistens vorbei, manchmal auch ein paar Nachbarn. Bei uns ist jedenfalls immer richtig Stimmung in der Bude, fast wie auf dem Fußballplatz.«
»Mal sehen. Danke jedenfalls für die Einladung.«
»Du musst unbedingt mal kommen. Sonst sehen wir uns ja jetzt fünf Wochen nicht mehr.«
»Wieso fünf?«
»Wenn du wieder hier bist, bin ich für zwei Wochen weg. Camping im Sauerland. Mit der Familie. Kriminalrat Kerkhoff hat den Urlaub schon genehmigt.«
»Also, wenn das so ist, dann lade ich dich jetzt zu einem kleinen Abschiedsessen ein. In den Wienerwald. Was hältst du davon?«
Artur Trappe strahlte. »Bei uns gibt’s freitags immer Fisch, heute wahrscheinlich wieder mal eingelegte Heringe mit Pellkartoffeln. Das ist noch nie mein Fall gewesen.«
Das Restaurant in der Helmholtzstraße war in dieser frühen Nachmittagsstunde nur mäßig besetzt. Wagner hängte seinen beigefarbenen Popelinemantel an die Garderobe, strich sich vorm Spiegel die Haare glatt, stellte stirnrunzelnd fest, dass immer mehr graue Fäden im dunklen Braun schimmerten, und nahm sich vor, in der nächsten Woche zum Friseur zu gehen.
Trappe hatte einen freien Tisch in einer Nische bei den Fenstern gefunden und studierte schon die Speisekarte, als Wagner sich ihm gegenüber auf die Sitzbank schob.
»Backhendl nehm ich und ein Bier«, sagte Trappe und schob die Karte zu Wagner rüber.
»Brauch ich nicht. Ich bestell mir Hähnchenleber mit Reis und eine Cola.«
»Innereien?« Artur Trappe schüttelte sich.
»Hab ich schon als Kind gern gegessen«, sagte Wagner achselzuckend. »Die Großeltern hatten Hühner. Wenn eins geschlachtet wurde, war die Leber immer für mich. Schön knusprig durchgebraten.«
Ein blondes Mädchen im Dirndlkleid notierte die Bestellungen sorgfältig in seinen Notizblock.
»Was hast du mit den Befragungsprotokollen vor?«, fragte Trappe, während die Bedienung in der Küche verschwand.
»Ich will sie mir noch mal angucken.«
»Du glaubst immer noch nicht, dass der Tod des Jungen ein Unfall war?«
»Kann ich mir nicht vorstellen. Das Brückengeländer an der Weierstraße ist über einen Meter hoch. Da kann man doch nicht einfach so drüberfallen.«
»Vielleicht ist der Joachim Hüwel da rumgeturnt, hat irgendwelchen Blödsinn gemacht. Vielleicht ist er ja auch gesprungen.«
»Vielleicht, vielleicht«, wiederholte Wagner bissig. »Genau das ist doch das Problem. Vielleicht war es so, vielleicht war es auch anders. Das ist mir zu wenig, um die Ermittlungen einzustellen.«
»Du hast dich da in was verrannt, Manfred. Wir sind drei Wochen lang der Möglichkeit nachgegangen, dass der Junge einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte, und haben keinen Anhaltspunkt dafür gefunden. Nein, Manni, du warst von Anfang an viel zu betroffen von der Sache. Die Familie deines Bruders ist gut bekannt mit den Hüwels, dein Neffe war der beste Freund des toten Jungen. Deshalb fehlt dir die nötige Distanz zu dem Fall. Und du weißt ganz genau, dass nichts Gescheites dabei rauskommt, wenn wir nicht mit kühlem Herz und klarem Kopf Fakten sammeln und analysieren.«
Die junge Frau im Dirndl brachte Bier und Cola. Sie wickelte Messer und Gabeln in Papierservietten ein und legte sie auf den Tisch.
»Essen kommt gleich«, sagte sie.
Wagner nickte geistesabwesend. Ein kühles Herz, nein, das hatte er wohl nicht in dieser Angelegenheit. Aber war sein Kopf deswegen weniger klar? Natürlich hatte ihn der Tod des vierzehnjährigen Joachim Hüwel berührt. Es war ihm nahegegangen, den Jungen zwischen den Bahngleisen unter der Weierstraße liegen zu sehen, es war ihm schwergefallen, mit den Eltern zu sprechen. Nein, ein Routinefall war das für ihn nie gewesen.
Herauszufinden, was da passiert war, war ihm von Anfang an nicht nur ein kriminalistisches, sondern auch ein ganz persönliches Anliegen gewesen. Er hatte dieses unsinnige Ende eines jungen Lebens begreifen wollen. Und das wollte er immer noch.
»Mit der Familie meines Halbbruders hat das nichts zu tun«, sagte er zu Trappe. »Mit den Holtbrinks hab ich seit fast zwanzig Jahren keinen Kontakt mehr. Den Jungen, meinen Neffen, den kenne ich nicht einmal. Die Kinder vom Heinrich und der Gertrud waren noch nicht geboren, als ich damals weg bin.«
»Es geht mich ja nichts an«, entgegnete Trappe, »aber ich versteh nicht, was du gegen die Holtbrinks hast. Dein Bruder und deine Schwägerin, also ich meine, das sind doch keine schlechten Menschen. Ich hab einen ganzen Nachmittag bei den beiden im Wohnzimmer gesessen und mit ihnen geredet und mit dem Jungen. Da kriegt man schon einiges mit von den Leuten, von ihren Einstellungen und so. Grundsolide, fleißig und anständig, das war mein Eindruck. Eine nette Familie.«
»Ja, so sind sie wohl, die Holtbrinks«, sagte Wagner. »So waren sie auch schon vor zwanzig Jahren. So solide, fleißig und anständig waren sie, dass ich vor ihnen weggelaufen bin.«
»Versteh ich nicht.« Trappe runzelte die Stirn.
»Musst du auch nicht«, sagte Wagner. »Die Holtbrinks sind bestimmt keine üblen Leute, und eigentlich hab ich auch gar nichts gegen sie.«
»Jetzt hör aber auf, Manfred! Es ist doch offensichtlich, dass du nichts mit denen zu tun haben willst. Als es darum ging, die Holtbrinks im Fall Hüwel zu befragen, hast du mich gebeten, das zu übernehmen.«
»Ich wollte nicht nach zwanzig Jahren plötzlich bei meinem Bruder und meiner Schwägerin vor der Tür stehen, die Dienstmarke zücken und sagen: Schönen guten Tag miteinander. Ich hab euch ein paar Fragen zum Tod von Joachim Hüwel zu stellen.«
»Dass jemand mit seinem einzigen Bruder keinen Kontakt hat, auch wenn er nur ein Halbbruder ist, das versteh ich nicht. Nein, es tut mir leid, Manfred, so etwas geht mir nicht in den Kopf.«
Wagner nippte an seiner Cola. »Wir haben uns eben aus den Augen verloren«, sagte er nach einer Weile.
Das war vielleicht nicht die ganze Wahrheit. Aber wer kannte die schon? Er kannte seine Wahrheit, seine Erinnerungen an damals, an den Frühsommer 1947, als Heinrich aus der Gefangenschaft zurückgekommen war und ihm die Hölle heißgemacht hatte. Der brave Schuhmacher Heinrich Holtbrink! Nach fünf Jahren Krieg und zwei Jahren Gefangenschaft hatte er plötzlich vor der Tür gestanden. Am nächsten Tag hatte er seine Werkstatt aufgeräumt, sich die blaue Arbeitsschürze umgebunden und damit begonnen, Schuhe zu flicken, so als hätte es die vergangenen sieben Jahre nicht gegeben. Und ihm, dem jüngeren Bruder, der damals gerade zweiundzwanzig geworden war, hatte er vom ersten Tag an in den Ohren gelegen, dass er sich nicht so gehen lassen dürfe, dass andere noch viel Schrecklicheres durchgemacht hätten, dass er sich wieder eine anständige Arbeit suchen müsse, dass er am besten wieder als Technischer Zeichner zur Hütte ginge. Einen Ganoven hatte Heinrich ihn genannt wegen seiner Schwarzmarktgeschäfte, wegen der kleinen Gaunereien und Diebstähle. Als gottlosen Strolch hatte der ältere Bruder ihn beschimpft und ihm prophezeit, er werde auf die schiefe Bahn geraten.
Dann hatte die Militärregierung junge Männer für den Polizeidienst gesucht, und er hatte sich beworben und war angenommen worden. Heinrich hatte dröhnend gelacht, als er es erfahren hatte.
Ein paar Tage später hatte Wagner seinen alten Pappkoffer gepackt und war gegangen. Er hatte seinen Dienst in Essen angetreten, die Polizeischule absolviert, war später von Essen nach Duisburg versetzt worden und jahrelang nicht ein einziges Mal auf die Idee gekommen, seinen Bruder und dessen Familie zu besuchen.
Irgendwann hatte er dann doch das Bedürfnis verspürt, Heinrich und Trude wiederzusehen und deren Kinder kennenzulernen, aber da war es zu spät gewesen. Es war zu viel Zeit vergangen, um eben mal bei den Holtbrinks vorbeizuschauen und ihnen einen guten Tag zu wünschen. Und dann hatte er sich gedacht, dass es so vielleicht auch besser wäre, dass der katholische Schuhmachermeister Heinrich Holtbrink und der lasterhafte Polyp Manfred Wagner, der in seinem Leben mehr Freudenhäuser als Gotteshäuser besucht hatte, sich ohnehin nichts mehr zu sagen hätten.
»Es ist schade, dass du deinen Neffen nicht kennst«, sagte Trappe. »Der Michael, der würde dir gefallen, der ist helle und nicht aufs Maul gefallen, obwohl er gerade erst vierzehn geworden ist.«
»Worüber hast du mit ihm gesprochen?«
»Über dies und das. Schule, Messdiener, Fußball. Er kennt alle Spieler von Rot-Weiß Oberhausen und natürlich auch alle unsere Jungs, die in England sind. Er hat mir sein Sammelalbum von der Araltankstelle gezeigt. Na ja, und über den Joachim Hüwel haben wir auch ein bisschen geredet. Aber das ist dem Michael schwergefallen. Ihm sind dabei die Tränen gekommen. Deshalb war ich sehr zurückhaltend. Ihn viel zu fragen, hätte ja auch nichts gebracht. Der Junge war erschüttert und verwirrt.«
»Alle Befragten waren ziemlich durcheinander«, sagte Wagner nachdenklich. »Die Eltern, die Nachbarn, die Lehrer und Mitschüler, die standen doch alle unter Schock, nachdem es gerade passiert war. So wie du haben auch die Kollegen Rücksicht genommen. Da bin ich mir sicher. Wer will schon Menschen, die so etwas Schreckliches zu verdauen haben, mit seinen Fragen quälen!«
»Machst du den Kollegen und mir deshalb Vorwürfe?«
Wagner schüttelte entschieden den Kopf. »Nein, gar nicht! Ich hab doch die Eltern vom Joachim auch nicht mit Fragen gelöchert. Die waren ja auch total am Ende, der Willy und die Mia Hüwel. Ganz vorsichtig hab ich versucht, mit ihnen über den Jungen zu reden. Mehr war gar nicht möglich. Und beim Vermieter der Hüwels, beim alten Krumpen, war es genauso. Der war auch völlig fertig. Heute könnte man vielleicht anders mit den Leuten sprechen. Inzwischen hatten sie immerhin drei Wochen Zeit, die Angelegenheit zu verarbeiten.«
»Mit dem Krumpen kannst du nicht mehr reden.«
»Wieso nicht?«
»Arnold Krumpen, vierundsechzig Jahre alt, von der Wilhelmstraße in Sterkrade. Das ist doch der Vermieter von den Hüwels, oder?«
»Ja.«
»Der ist tot.«
Wagner schüttelte ungläubig den Kopf und suchte in seinen Jackentaschen nach der Zigarettenschachtel.
»Die Todesanzeige hab ich heute im General-Anzeiger entdeckt«, sagte Trappe. »Krumpen ist am Mittwoch gestorben. Morgen wird er beerdigt.«
Wagner zog eine Zigarette aus dem Güldenringpäckchen.
»Jetzt wird nicht geraucht«, sagte die Blondine im Dirndlkleid freundlich. »Einmal Backhendl und eine Portion Hähnchenleber.«
ZWEI
Michael Holtbrink schwenkte das Weihrauchfass nicht. Bei jedem seiner Schritte schaukelte es nur sachte an den schlanken Messingketten.
Zäher Qualm kroch durch die Löcher des Gefäßes hinaus in die Sommerluft, stieg in trüben Duftwölkchen aufwärts und verlor sich zwischen schwarzen Kleidern, grauen Kostümen und dunklen Anzügen.
Ein überraschend weiter blauer Himmel wölbte sich an diesem Samstagvormittag über das nördliche Ruhrgebiet und den Oberhausener Stadtteil Sterkrade.
Etwa zwanzig Menschen gingen hinter dem Eichensarg von Arnold Krumpen her, der auf einer schwarzen Sargkarre über die holprigen Wege des Friedhofs an der Wittestraße zum offenen Grab geschoben wurde.
Einer von ihnen war Michael Holtbrink, der als Messdiener neben Kaplan Winkel dem Sarg folgte. Der Duft von Blumengebinden und frisch gewundenen Kränzen wehte ihm in die Nase. Er vermischte sich mit dem flüchtigen Aroma des Weihrauchs und den Ausdünstungen der Trauergemeinde, deren Taschentücher mit Kölnisch Wasser getränkt waren und deren Kleider nach Mottenkugeln stanken, zu jenem Beerdigungsgeruch, der Michael seit langem vertraut war.
Früher war er gern als Messdiener im schwarzen Rock und im weißen Chorhemd bei Seelenämtern und Begräbnissen dabei gewesen. Hinter sonnenbestrahlten und schneebedeckten Särgen hatte er etwas von der Größe des Todes und der Gewalt des letzten Abschieds gespürt und war doch leichten Herzens geblieben. Ein Kind war er gewesen, das selbst noch nie um einen Toten geweint hatte, das noch nie für immer Abschied genommen hatte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!