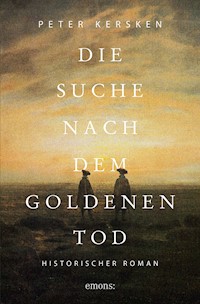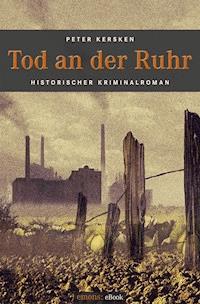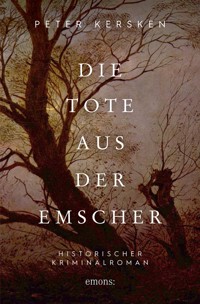Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Juli 1952. Die Förderräder drehen sich wieder, die Schlote rauchen. Der junge Journalist Hermann Leschinski ist in diesem heißen Sommer jeden Tag mit seinem Moped im Kohlenpott unterwegs. Als er von den sechzigtausend Mark erfährt, die angeblich in einem Pappkoffer am Ruhrufer gefunden wurden, vermutet er ein Verbrechen hinter der Geschichte. Doch erst ein Mord im Essener Gruga-Park und sein Besuch in einer Duisburger Zechensiedlung bringen ihn auf die richtige Fährte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Kersken, geboren 1952 in Oberhausen im Ruhrgebiet, studierte Philosophie und Literaturwissenschaften in Freiburg und Köln und arbeitete als Redakteur bei einer Kölner Tageszeitung. Er lebt als freiberuflicher Autor in der Eifel.
www.peterkersken.de
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2016 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: Fotoarchiv Ruhr Museum, Essen, Rudolf Holtappel, photocase.de/faniemage Umschlaggestaltung: Nina Schäfer Lektorat: Dr.Marion Heister eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-110-9 Historischer Kriminalroman Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Für Elke Ja, das Leben geht weiter. Ich erzähle Geschichten und liebe
EINS
Ich habe über Trümmerfrauen und die Sieger von Seifenkistenrennen geschrieben, über Spätheimkehrer, die sich im Ruhrgebiet der Nachkriegszeit nicht mehr zurechtfanden, und über Glückspilze, die im Fußballtoto gewonnen hatten. Ich habe grüne Witwen mit Wespentaillen interviewt, die sich in Neubausiedlungen über ein eigenes Bad freuten und von einem eigenen Fernsehapparat träumten. Das war in den fünfziger Jahren. Damals gab es die ersten Selbstbedienungsläden, die ersten Impfungen gegen Kinderlähmung und zum Ende des Jahrzehnts die ersten Feierschichten auf den Zechen im Revier. Als junger Reporter der Ruhr-Post habe ich darüber berichtet.
Ich bin Kindern begegnet, die in der verpesteten Luft des Kohlenpotts an Rachitis und Leukämie erkrankt waren, und Teenagern, die bei einem Konzert der Beatles in Ohnmacht gefallen waren. Das passierte in den Sechzigern. Es gab immer noch Unglücke unter Tage und immer häufiger Unfälle auf den Straßen, auf denen immer mehr Fahrzeuge unterwegs waren. Ich habe darüber geschrieben, ebenso wie über das letzte Grubenpferd, die ersten Gastarbeiter und die ersten Kumpel, die stempeln gehen mussten.
In den Siebzigern habe ich junge Leute interviewt, die ihren Sommerurlaub an den Ufern des Rhein-Herne-Kanals verbrachten, und Männer und Frauen, die sich in Bürgerinitiativen zusammenschlossen, um ihre Zechensiedlung vor dem Abriss zu retten. Ich habe Reportagen über luxuriöse, neue Einkaufsparadiese, über die erste Taubenklinik im Revier und über die Auswirkungen des ersten Smogalarms verfasst. Die Stahlkrise war ein Dauerthema in den Wirtschaftsteilen der Zeitungen, ich habe über die Menschen geschrieben, die von ihr betroffen waren.
Dann kamen die achtziger Jahre, und ich musste über Massenentlassungen und Arbeitsloseninitiativen berichten, über ganze Viertel, die verelendeten, über Städte, deren Sozialämter überfordert waren und deren Straßenlaternen abgeschaltet wurden, weil kein Geld mehr da war. Trotz allem träumte man im Revier eine Weile davon, Austragungsort der Olympischen Spiele zu werden. Ich habe auch darüber geschrieben, genauso wie über die ersten Frauenbüros in den Rathäusern, über neue S-Bahn-Verbindungen, Skat-Weltmeisterschaften und den Besuch des Papstes.
Als die Neunziger begannen, war der alte Kohlenpott untergegangen, und kurz darauf kam auch das Ende für die Ruhr-Post, für die ich mehr als vier Jahrzehnte gearbeitet hatte.
Ich wurde in Rente geschickt, mit dreiundsechzig. Mir war es recht. Mein Revier gab es nicht mehr, über das Leben im neuen Ruhrgebiet sollten die Leute berichten, die sich besser darin zurechtfanden als ich.
Meine Geschichten waren geschrieben. Das dachte ich jedenfalls damals.
Ich zog nach Sterkrade in die Bremener Straße, in das Haus, das einmal meinen Großeltern gehört hatte. Es war schon in meinen Kinder- und Jugendtagen der Mittelpunkt meines Lebens gewesen und es eigentlich auch immer geblieben.
Ich reparierte die alten Karnickelställe meines Opas und begann, Deutsche Riesenschecken zu züchten.
Vom Reisen habe ich nie viel gehalten. Ich war immer der Meinung, dass es zwischen den Höhenzügen der Ruhr und den Niederungen der Lippe so viele schöne Gegenden und dazu eine so große Ansammlung von Sehenswürdigkeiten gibt, dass meine Lebenszeit vermutlich nicht ausreichen würde, sie alle zu entdecken. Mich irgendwo in der Ferne herumzutreiben, hielt ich für bloße Zeitverschwendung.
Trotzdem baute ich eine automatische Fütterungsanlage für die Karnickel, die es mir ermöglichte, hin und wieder für ein paar Tage nach Bochum oder nach Bonn zu fahren, wo meine beiden Töchter mit ihren Familien leben.
Dann tauchten irgendwann die Geschichten wieder auf, die ich nicht geschrieben hatte.
Ja, es gab sie, ich hatte sie nur im Lauf der Jahrzehnte vergessen. Sie waren ungeschrieben geblieben, weil sie damals, in ihrer Zeit, zu verwerflich oder zu aufrührerisch für die Ruhr-Post gewesen waren, weil sie vielleicht die sittlichen oder die religiösen Gefühle der Leser verletzt hätten, oder weil sie irgendjemandem hätten schaden können, weil es Mut gebraucht hätte, sie zu schreiben, mehr Mut, als ich hatte, oder weil sie so verrückt und seltsam waren, dass kein Mensch sie geglaubt hätte.
Jetzt bin ich ein alter Mann, und die Geschichten, die nicht geschrieben sind, lassen mir keine Ruhe. Nein, sie sind nicht so wichtig, dass sie unbedingt erzählt werden müssten, nein, das ist es nicht. Ich gehöre nicht zu den senilen Narren, die, den Sensenmann schon im Nacken, noch mit letzter Kraft ihre Lebenserinnerungen zu Papier bringen müssen, weil sie glauben, die Nachwelt könne keinesfalls darauf verzichten. Nein, meine Geschichten braucht niemand, sie werden die Welt nicht um einen Deut besser machen.
Aber sie sind nun mal da, und manch eine von ihnen erstaunt und fasziniert mich heute nach all den Jahren noch so sehr, dass es mir ein Vergnügen ist, sie zu erzählen.
Von den merkwürdigen Vorkommnissen um einen alten Pappkoffer voller Geld erfuhr ich zum ersten Mal im Sommer 1952, ein paar Wochen, nachdem ich einundzwanzig Jahre alt geworden war.
In der Chefetage der Ruhr-Post waren ein paar ältere Herren kurz zuvor auf die Idee gekommen, die Zeitung ein bisschen unterhaltsamer zu machen. Die seriöse Information war das Markenzeichen des Blattes, und das sollte auch so bleiben. Aber irgendwo zwischen der Politik und dem Lokalen, zwischen Wirtschaft, Sport und Kultur sollte es künftig auf zwei Seiten menscheln. Unerwartetes Glück, herzzerreißende Tragödien, Kurioses, Außergewöhnliches und Glamouröses sollten die Leser ergötzen.
Die beiden neuen Seiten hießen »Buntes aus der Welt« und »Buntes aus dem Revier«. Als verantwortlicher Redakteur wurde Horst Brömmel, bisher Chef in der Lokalredaktion Oberhausen, nach Essen beordert. Für ihn lohnte sich der Umzug: Er wurde offiziell zum Leiter des neuen Ressorts »Vermischtes« ernannt, bekam eine spürbare Gehaltserhöhung und durch Vermittlung des Verlags eine der damals noch äußerst raren Wohnungen in der Essener Innenstadt.
Horst Brömmel war ein leidenschaftlicher Zeitungsmacher und ein leidenschaftlicher Liebhaber der gediegenen deutschen Küche und blonder Frauen. Verheiratet war er nicht. »Es gibt so viele Kriegswitwen, die getröstet werden müssen, da kann ich doch nicht heiraten«, pflegte er zu antworten, wenn er nach dem Grund seines Junggesellendaseins gefragt wurde.
Als er von Oberhausen nach Essen umzog und seinen neuen Job antrat, war er Anfang vierzig. Sein dunkles Haar war noch so voll, dass die Geheimratsecken sich wegkämmen ließen, und seine Figur war trotz seiner Vorliebe für Schweinebraten noch gut in Form. Die schlechten Zeiten waren gerade erst vorbei, und Horst Brömmel begann Anfang der fünfziger Jahre, wie die meisten Deutschen, erst ganz allmählich fett zu werden.
Später heiratete er dann doch noch. Als er fast fünfzig war und sein Gewicht die Zwei-Zentner-Marke bereits deutlich überschritten hatte, legte er sich auf eine Witwe fest, die mit einem Geschäft für Damenmode in Wattenscheid zu einigem Wohlstand gekommen war.
Ohne Horst Brömmel wäre ich kein Journalist geworden. Er war der Mann, der mich im Herbst 1949 zur Zeitung geholt hatte.
Damals wohnte ich bei meinen Großeltern in der Bremener Straße, hatte im Jahr zuvor die Mittelschule abgeschlossen und keine Vorstellung davon, was aus mir einmal werden sollte. Ich verdiente mir ein paar Mark als Aushilfe in einer Tischlerei, schleppte Bretter in die Werkstatt und fuhr als Packer mit, wenn Möbel ausgeliefert wurden. Außerdem versorgte ich die Hühner und Opas Karnickel, wenn er auf Schicht war, und ich fütterte die beiden Schweine, die meine Großeltern jedes Jahr im Frühjahr als kleine Ferkel kauften und im Herbst von einem Metzger schlachten ließen. Eigentlich war meine Oma fürs Vieh zuständig, aber wenn sie gerade mit Waschen, Bügeln, Putzen, Kochen oder Backen beschäftigt war, fragte ich sie, ob ich die Tiere füttern solle, und sie sagte jedes Mal: »Ja, mein Jung, dat wär nett von dir.«
Da sie eigentlich immer irgendwas im Haushalt zu tun hatte, hörte ich irgendwann auf, sie zu fragen, und es spielte sich ein, dass ich Schweine, Hühner und Karnickel versorgte, wenn ich nicht gerade als Möbelpacker unterwegs war. Oma Hilde fühlte sich trotzdem weiter fürs Vieh verantwortlich, was zur Folge hatte, dass wir beide tagtäglich am Abendbrottisch einen kurzen Dialog führten, der in etwa immer den gleichen Wortlaut hatte.
»Has’e Hühner schon gefüttert, Jung?«
»Hab ich.«
»Und die Schweine?«
»Auch.«
»Karnickel?«
Darauf nickte ich, oder ich sagte: »Hat Opa gemacht.«
»Dann sind alle versorgt?«
»Alle.«
»Has’e’n Stall auch schon abgeschlossen?«
»Mach ich nach’m Abendbrot.«
»Dann machs’e auch die Luke zu?«
»Ja sicher.«
»Auf dich kann man sich verlassen, Hermann. Dat ist gut. Jetzt iss mal tüchtig!«
Das Vieh war in einem Ziegel-Anbau hinterm Wohnhaus untergebracht. Die Hühner konnten durch eine Luke nach draußen in einen umzäunten Auslauf, außer nachts. Dann verschloss ein Holzbrett die Luke, damit der Fuchs nicht zu den Hühnern konnte.
Fürs Ausmisten der Ställe war ich zuständig. Den Mist fuhr ich mit der Schubkarre auf einen Haufen am Ende des Grundstücks. Im Sommer duftete er bis zum Haus herüber, im Herbst wurde er über die Gartenbeete verteilt und untergegraben. Das war die letzte Arbeit auf dem Land bis zum nächsten Frühjahr. Mein Opa sagte immer »unser Land«, er wäre nie auf die Idee gekommen, von »unserem Garten« zu reden. Ein Garten war etwas für feine Pinkel, die Rosen züchteten. In seinem Wortschatz gab es auch keine »Schrebergärten«, die hießen »Mietland«.
In dem Jahr, in dem ich die Schule abgeschlossen hatte, ich wurde siebzehn und mein Opa einundsechzig, übernahm ich auch einen großen Teil seiner Arbeit auf dem Land, vor allem das Umgraben, das Setzen der vorgezogenen Kohl- und Gemüsepflänzchen und das Mähen des Roggens mit der Sense.
Er bedankte sich nie bei mir, klopfte mir aber manchmal auf die Schulter, wenn ich, verschwitzt von der Landarbeit, zurück zum Haus kam, gab mir eine Flasche Bier oder bot mir eine Zigarette an.
Hin und wieder sagte er auch: »Dat is gut, dat du dat jetz machs. Die Plackerei mit’m Spaten und mit der Sense und dat dauernde Bücken beim Pflanzen, dat macht mir mittlerweile ganz schön zu schaffen, besonders wenn ich schon acht Stunden Schicht in e Knochen hab.«
Fast alles, was es damals bei uns zu essen gab, war vom eigenen Land, von der jungen Melde im Frühjahr, dem ersten frischen Gemüse des Jahres, bis zum Porree und zum Grünkohl, die bis in den Winter hinein direkt vom Beet in den Kochtopf kamen.
Was wir sonst noch brauchten, um den Winter zu überstehen, lagerte im Keller: Kartoffeln in einer Holzkiste, Sauerkraut im Kappesfass und Unmengen Einmachgläser. Sie waren gefüllt mit Schnibbelbohnen und dicken Bohnen, Möhren und Erbsen, mit roter Beete und Stielmus, das bei Oma Hilde Ströppmus hieß, mit Apfelkompott, Birnen, Pflaumen und Kirschen.
Auch Schweinerippchen, Leberwurst, Blutwurst und Sülze wurden nach dem Schlachten eingekocht. Geräuchertes, gepökeltes und luftgetrocknetes Fleisch und die Würste, die der Metzger gemacht hatte, hingen in einer kleinen Kammer unterm Dach, gleich neben meinem Zimmer.
In einem Kellerraum lagerten Holz und Kohlen, Deputatkohle, die mein Opa als Bergmann auf der Zeche Jacobi immer im Herbst kostenlos geliefert bekam.
»Kohlen im Keller, Kappes im Fass, Würste im Kabüffken unterm Dach und en paar fette Karnickel im Stall, wat wills’e mehr?«, sagte mein Opa gern, und manchmal fügte er nach einer Weile ein wenig leiser hinzu: »Wat gewesen is die letzten Jahre, dat is jetz vorbei.«
Es ging uns gut, da waren wir drei, Opa Leschinski, Oma Hilde und ich, uns einig. Von mir aus hätte das Leben so weitergehen können, es gab keinen Grund, irgendwas zu ändern. Opa fuhr jeden Tag mit dem Fahrrad zur Zeche, Oma sang manchmal alte Lieder, während sie kochte oder bügelte, und ich erledigte gern die anfallenden Arbeiten im Stall und auf dem Land. Das gab mir das gute Gefühl, ein vollwertiges Mitglied unseres Trios zu sein.
Das Geld, das ich in der Tischlerei verdiente, durfte ich behalten. Ich bezahlte damit Kino- und Kneipen- und Friseurbesuche, den Sprit für mein Moped, und hin und wieder kaufte ich mir auch ein neues Hemd, eine Hose oder eine modische Jacke, um den Mädchen zu gefallen.
Die Jugendfreunde, mit denen ich damals um die Häuser zog, gingen mir ständig auf die Nerven, weil sie meinten, ich würde in der Tischlerei und in Opas Garten nur meine Zeit verplempern, obwohl ich doch mit mittlerer Reife auch was Vernünftiges machen könnte, zum Beispiel eine Lehre als Industriekaufmann oder technischer Zeichner bei der Hütte.
Meine Großeltern hingegen bedrängten mich nie, nur hin und wieder sagte Opa: »In deinem Alter, da bin ich schon jeden Tach eingefahren, da gab et nich viel zum Nachdenken. Vatter war Bergmann und hat immer gut verdient, also bin ich nach e Schulzeit mit auf e Zeche.«
»Du has ja auch keine mittlere Reife gehabt«, sagte Oma dann. »Jetz lass den Jung ma in Ruhe! Bei den Möglichkeiten, die er hat, warum sollte er da irgendwat über t Knie brechen? So wie et jetz is, is et doch gut. Und der Hermann liegt ja auch nich auf e faule Haut rum.«
»So’n Schmonses«, sagte Opa dann ärgerlich. »Als hätt ich dat gesacht, dat der Hermann faul is. Ich bin doch froh, dat er so fleißig mithilft. Dat weiß er aber auch. Ich will nur nich, dat er später ma sacht, er hätt nix Vernünftiges lernen können, weil er hier den ganzen Tach im Stall und auf’m Land malochen musste.«
»So’n Blödsinn werd ich nie sagen, Opa«, versprach ich dann, und damit war das Thema vom Tisch.
Im Herbst 1949 veranstalteten meine Freunde und ich auf dem Tackenberg ein Seifenkistenrennen. Das war damals ein angesagter Volkssport, und wir bekamen so viele Meldungen, dass ein kompletter Rennsonntag mit mehreren Durchläufen in verschiedenen Klassen zustande kam. Um möglichst viele Zuschauer anzulocken, verfasste ich eine kurze Mitteilung für die Presse. In der Woche vor dem großen Ereignis fuhr ich mit dem Moped ins Stadtzentrum und klapperte die Lokalredaktionen der in Oberhausen erscheinenden Tageszeitungen ab. Die Veröffentlichung des Veranstaltungshinweises wurde mir in allen drei Redaktionen zugesagt, und in den beiden ersten versprach man auch, einen Reporter zu den Rennen zu schicken.
Die Oberhausener Lokalausgabe der Ruhr-Post gab es erst seit ein paar Monaten. Dorthin fuhr ich zuletzt. Ich trug einer jungen Dame mein Anliegen vor.
»Gehen Sie damit bitte zu Herrn Brömmel, unserem Redaktionsleiter«, sagte sie und wies auf einen schlanken, dunkelhaarigen Mann, der mit zwei Fingern ungestüm auf die Tastatur einer Schreibmaschine einhackte.
So lernte ich Horst Brömmel kennen.
Er las meine Pressemitteilung durch und nickte.
»Machen wir.«
»Können Sie am Sonntag auch einen Reporter zum Tackenberg schicken?«
Brömmel deutete auf meinen kurzen Text.
»Haben Sie das geschrieben?«
Ich nickte.
»Sie haben also ’ne Schreibmaschine?«
»Ist ein uraltes Ding von meiner Mutter.«
»Schreibt noch tadellos«, stellte Brömmel fest. »Sie übrigens auch.«
Ich verstand ihn nicht und zuckte mit den Schultern.
»Na, der Veranstaltungshinweis hier, der ist gut. Was, wo, wann. Da steht alles Wichtige drin. Wenn die Leute das lesen, wissen sie, was sie erwartet.«
»Na, deshalb hab ich ihn ja geschrieben.«
»Und weshalb sollte nach dem Rennen auch noch etwas darüber in der Zeitung stehen?«, fragte Brömmel.
»Damit die Leute erfahren, wie es gewesen ist«, antwortete ich.
»Die wollen aber nicht nur eine Liste mit den Namen der Sieger. Die wollen wissen, ob es Karambolagen gegeben hat, ob die Straße nass war, ob Favoriten enttäuscht haben oder Außenseiter überraschend ganz vorn gelandet sind, ob vielleicht eine Kiste kurz vor dem Ziel auseinandergebrochen ist, ob es besonders verrückte Modelle zu bestaunen gab und wie die Stimmung im Publikum war.«
»Ist klar«, sagte ich.
»Na, dann schreiben Sie das mal«, sagte Brömmel.
»Ich?«
»Ja, ich schicke einen Fotografen vorbei, und Sie schreiben den Text. Sagen wir mal, so rund hundert Druckzeilen, also etwa fünfzig Zeilen mit sechzig Anschlägen auf der Schreibmaschine. Größter Zeilenabstand und ganz nach links gerückt. Rechts muss Platz für Korrekturen bleiben.«
»Ich weiß nicht, ob ich das kann.«
»Sie können das«, sagte Brömmel. »Am Montag, spätestens um zwei, sind Sie hier mit dem Text. Geht das?«
»Am Montagmittag schon?«
»Ja, wann sonst? Wir sind eine Tageszeitung und kein Wochenblättchen.«
»Ich könnte es vielleicht versuchen«, sagte ich zögerlich.
»Jetzt lassen Sie das Vielleicht mal weg! Sie schreiben einen schönen Bericht über das Seifenkistenrennen, und am Montagmittag sind Sie damit hier. Kann ich mich darauf verlassen?«
Ich antwortete Horst Brömmel mit einem zaghaften Kopfnicken.
Woher ich den Mut nahm, dem Vorschlag Brömmels zuzustimmen, weiß ich bis heute nicht. Eigentlich war ich fest davon überzeugt, dass ich überhaupt nicht dazu in der Lage war, einen Zeitungsartikel zu verfassen. Bereut habe ich mein Kopfnicken nie.
Mein Bericht erschien am Dienstag nach dem Rennen in der Oberhausener Lokalausgabe der Ruhr-Post. »Jubelnde Sieger und humpelnde Bruchpiloten am Tackenberg« lautete der Titel, und direkt darunter stand: »Von Hermann Leschinski«.
Ich war mächtig stolz, und mein Opa abonnierte am nächsten Tag die Ruhr-Post. Für ihn stand sofort fest, dass ich den Beruf meines Lebens gefunden hatte.
»Jung, wenn die dich bei de Zeitung haben wollen, dann mach dat bloß! Da kanns’e dein Geld verdienen, ohne dat e dich dreckig machen muss. Und ’ne interessante Arbeit is dat auch.«
Horst Brömmel wollte mich tatsächlich. Mein Text hatte ihm gefallen. Er hatte ihn nur an wenigen Stellen korrigiert und ein paar Kürzungen vorgenommen. Als er erfuhr, dass ich die mittlere Reife, noch keine feste Arbeitsstelle, aber ein eigenes Motorrad hatte, rieb er sich die Hände und sagte, unvermittelt zum vertraulichen Du übergehend: »So einen wie dich können wir brauchen. Aus dir mach ich einen Journalisten.«
Ich wurde freier Mitarbeiter der Lokalredaktion. Jeden Morgen zwischen neun und zehn rief ich aus einer Telefonzelle Horst Brömmel an, um zu hören, was es zu tun gab. Meistens hatte er einen oder auch zwei Termine für mich. Ich bekam fünf Pfennige für die gedruckte Zeile. Das war nicht gerade viel, aber da ich für die Zeitung fast immer abends unterwegs war, konnte ich weiterhin nachmittags ein paar Stunden in der Tischlerei arbeiten. Beide Jobs zusammen brachten mir rund hundert Mark im Monat ein. Das hätte zwar nicht gereicht, um eine Familie zu ernähren, aber das hatte ich vorläufig auch nicht vor. Und da meine Großeltern mich weiterhin alles behalten ließen, was ich verdiente, hatte ich mehr Geld in der Tasche als die meisten schwer arbeitenden Familienväter, die den Großteil ihres Lohnes zu Hause ablieferten.
Im November 1951 lud Horst Brömmel mich in eine ziemlich feine Gaststätte auf der Marktstraße ein. Ich fuhr weisungsgemäß nicht mit dem Moped, sondern mit der Straßenbahn von Sterkrade nach Oberhausen, traf Brömmel in bester Laune an, aß den Rheinischen Sauerbraten, den er mir empfahl, trank ein paar Bier und sträubte mich nur zaghaft gegen den Wachholder, den er nach dem Essen bestellte. Beim zweiten Schnaps forderte er mich auf, ihn künftig zu duzen, und beim dritten eröffnete er mir, dass es so nicht mit mir weitergehe.
»Hermann, du bist jetzt schon über zwei Jahre bei uns, und im Sommer wirst du volljährig. Da musst du allmählich mal an deine Zukunft denken. Oder willst du ewig für ein paar Pfennige Zeilenhonorar durch die Gegend fahren und über langweilige Vorstandswahlen, senile Goldhochzeiter und prämiierte Brieftauben schreiben?«
»Ich mach das gern, das wissen Sie doch.«
»Du.«
»Bitte?«
»Das weißt du doch, heißt das. Ich bin der Horst.«
»Ach so, ja. Entschuldigung! Horst. Ich arbeite gerne als Journalist, das weißt du doch.«
»Natürlich weiß ich das. Und du machst das prima, hast eine wirklich gute Schreibe. Und inzwischen hast du auch ein Gespür für die richtigen Themen, für das, was die Leute lesen wollen. Aber genau das ist mein Problem. Dauernd triffst du bei deinen Terminen die Kollegen von der Konkurrenz, und die lesen natürlich auch, was du schreibst. Sie kennen dich und haben inzwischen längst mitgekriegt, dass du gut bist. Es wird bestimmt nicht mehr lange dauern, bis dir jemand eine feste Anstellung anbietet, und dann bist du weg.«
»Nein, bin ich nicht, Horst. Erstens hab ich alles, was ich kann, von dir gelernt, zweitens gefällt mir mein Leben, so wie es ist, und drittens hast du mir schon ein paar Mal gesagt, dass ich irgendwann bestimmt eine Anstellung bei der Ruhr-Post bekomme, dass es nur eine Frage der Zeit ist.«
Horst Brömmel nickte.
»In der Redaktion Oberhausen wird demnächst eine Stelle frei. Einer der Kollegen geht nach Essen in die Zentrale«, sagte er.
»Und? Kannst du das entscheiden, wer die frei werdende Stelle kriegt?«
»Wenn ich sage, dass du der richtige Mann dafür bist, dann wird der Verlag dich einstellen.«
»Das ist ja großartig.«
»Ich habe aber nicht die Absicht, dich für die Stelle vorzuschlagen.«
»Ach so«, sagte ich enttäuscht.
»Ich bin der Kollege, der nach Essen geht, und ich würde dich gern mitnehmen«, sagte Horst Brömmel.
An dem Abend erfuhr ich alles über das geplante Ressort »Vermischtes« und die beiden neuen Seiten »Buntes aus der Welt« und »Buntes aus dem Revier«.
Brömmel hatte bereits das Wichtigste mit dem Verlag geklärt.
»Du kriegst einen Vertrag als Pauschalist. Hundert Mark Fixum in der Woche. Brutto. So um die siebzig dürftest du dann nach allen Abzügen in der Lohntüte haben.«
»Die Essener stellen mich ein, ohne mich zu kennen?«
»Geh mal davon aus, dass die Chefredaktion sehr genau verfolgt, was in den Lokalausgaben vor sich geht. Wenn in Oberhausen jede Woche mehrere Artikel von Hermann Leschinski erscheinen, immer ordentlich recherchiert und gut geschrieben, dann wird das von den Herren sehr wohl registriert. Die wissen genau, wen sie sich da einkaufen. Außerdem wollen sie unbedingt mich für die Ressortleitung, und ich will dich als Mitarbeiter. Also ist die Sache klar. Du musst dich zwar noch beim Chefredakteur und beim Herausgeber vorstellen, aber das ist nur Formsache.«
Mir gefiel die Vorstellung, siebzig Mark in der Woche zu verdienen. Ein paar Tage vor jenem denkwürdigen Abend mit Horst Brömmel in der Gaststätte auf der Marktstraße hatte ich in einer Sterkrader Kneipe einen alten Klassenkameraden von der Volksschule wiedergetroffen. Er hatte auf der Hütte gelernt, war jetzt Sandformer, arbeitete von montags bis samstags im Akkord, hatte vor ein paar Monaten geheiratet und war gerade Vater geworden. Er hatte mir stolz erzählt, dass er jede Woche fast hundert Mark in der Lohntüte hätte und damit gut für seine junge Familie sorgen könne. Da waren siebzig Mark für einen alleinstehenden jungen Kerl wie mich, der nichts Richtiges gelernt hatte, ein geradezu märchenhaftes Einkommen.
Trotzdem war ich von Brömmels Plan nicht wirklich begeistert. Ich wollte nicht nach Essen umziehen. In Sterkrade fühlte ich mich wohl. Das Haus meiner Großeltern in der Bremener Straße war mein Zuhause.
Schon als Kind, als ich mit meinen Eltern in einer Etagenwohnung auf der Holtenstraße gewohnt hatte, war ich am liebsten bei Oma und Opa gewesen.
Wenn ich schnell gelaufen war, am Reinersbach entlang, hatte ich kaum mehr als zehn Minuten von der Wohnung meiner Eltern bis zum Häuschen meiner Großeltern gebraucht. Ich war fast immer gerannt, weil ich nie schnell genug in der Bremener Straße sein konnte. Bei meinen Großeltern war ich in einer Welt, die mir gefiel, nicht mehr mitten in der lärmenden Stadt, sondern schon fast auf dem Land, nicht mehr eingezwängt zwischen Mietshäusern und den dreckigen Backsteinmauern der Hütte, sondern umgeben von alten Bäumen, großen Gärten und Wiesen, auf denen man im Herbst selbstgebaute Drachen steigen ließ.
Das Haus, in dem ich mit meinen Eltern wohnte, stank nach Bohnerwachs, in der Bremener Straße roch es nach frischem Mist oder nach Bratkartoffeln. In der Holtenstraße durfte ich keinen Krach machen, nicht mit Schuhen durchs Treppenhaus rennen und in der Wohnung nicht herumtoben, weil unter uns die Hausbesitzer wohnten. Ich durfte mich nicht dreckig machen, weil meine Mutter nicht jede Woche waschen konnte, und um sieben Uhr gab es Abendessen, um punkt sieben, weil Kinder lernen mussten, sich an Regeln zu halten.
Meine Oma schmierte mir immer eine Stulle, wenn ich Hunger hatte, egal wie spät es war. Sie freute sich, wenn ich herumtobte, lärmte und mich schmutzig machte, weil sie dann wusste, dass es mir gutging. Ein Treppenhaus gab es bei den Großeltern nicht, nur eine Tür, durch die man rein oder raus lief, frisches Gemüse von den Gartenbeeten direkt in die Küche trug und Küchenabfälle zum Vieh in den Stall. Und es kam niemand auf die Idee, dass man Schuhe an- oder ausziehen müsse, wenn man durch die Türe ging, weil beide Seiten gleichermaßen zum Alltag gehörten und zum Leben, das Drinnen und das Draußen.
Als ich nach dem Krieg mit vierzehn, nach fast drei Jahren in der Kinderlandverschickung, zurück nach Sterkrade kam, gab es meine Eltern und die Wohnung in der Holtenstraße nicht mehr. Mein Vater war in Russland gefallen, und meine Mutter war kurz vor Kriegsende bei einem der vielen Bombenangriffe auf das Ruhrgebiet ums Leben gekommen. Ich war eine Weile sehr traurig, aber mir war immer klar, dass es noch viel schrecklicher für mich gewesen wäre, wenn es bei meiner Rückkehr Oma und Opa und das Häuschen in der Bremener Straße nicht mehr gegeben hätte.
So war ich einerseits über Brömmels Angebot hocherfreut, fühlte mich aber andererseits äußerst unwohl bei dem Gedanken, aus Sterkrade fortziehen zu müssen, zumal ich gerade jetzt den beiden Alten, die immer für mich da gewesen waren, durch meine Hilfe auf dem Land und im Stall endlich etwas zurückgeben konnte.
Horst Brömmel ahnte, was mir quer saß.
»Du kannst bei deinen Großeltern wohnen bleiben«, sagte er.
»Wie soll das denn gehen?«
»Dein Einsatzgebiet ist ja nicht Essen, sondern das ganze Ruhrgebiet. Es ist also im Grunde egal, ob du in Duisburg oder in Dortmund oder irgendwo dazwischen wohnst, solange du mit deinem Motorrad dahin fährst, wo es was zu recherchieren gibt.«
»Ich dachte, als Pauschalist bekäme ich einen festen Arbeitsplatz in der Redaktion und müsste jeden Tag da erscheinen.«
»Ja, so ist das vorgesehen«, sagte Brömmel. »Aber das ist doch kein Problem. Du brauchst eine halbe Stunde von Sterkrade bis zum Verlagsgebäude in der Kettwiger Straße. Und wenn es abends mal spät wird oder wenn das Wetter schlecht ist oder wenn du noch einen Termin in Essen hast, dann kannst du bei mir übernachten.«
»Bei dir?«
»Der Verlag hat zugesichert, mir eine Dreizimmerwohnung in der Innenstadt zu besorgen.«
Ich sah ihn erstaunt an. Wohnraum war knapp in den Revierstädten der Nachkriegszeit, äußerst knapp sogar. Erst ein paar Tage zuvor hatte die Ruhr-Post über den Stand des Wiederaufbaus in Essen berichtet. Von den zweihunderttausend Wohnungen, die es dort früher mal gegeben hatte, war im Krieg fast die Hälfte zerstört worden. Inzwischen waren zwar viele wiederhergestellt, aber immer noch gab es in der Stadt zahlreiche Trümmergrundstücke und deutlich weniger bewohnbare Räume als Einwohner. Da erschien es mir reichlich übertrieben, dass ein einzelner Mann drei Zimmer für sich allein bekommen sollte.
Brömmel winkte ab. »Ich weiß, was du denkst«, sagte er. »Natürlich ist die Wohnung zu groß für mich. Das Arbeitszimmer brauche ich wirklich nicht. Da stelle ich meine beiden Bücherregale rein, eine Schlafcouch und einen Schrank. Das wäre ideal für einen Untermieter, der zwei- oder dreimal die Woche in Essen übernachtet, vorausgesetzt, ihn stören meine Bücher nicht. Was hältst du davon?«
»Deine Bücher würden mich nicht stören«, sagte ich.
Am nächsten Tag sprach ich mit meinen Großeltern über Brömmels Angebot.
»Mensch Jung, dat is doch großartig, mach dat bloß!«, sagte Opa. »Und Essen, dat is wat anderes als Sterkrade, schon fast ’ne Weltstadt, genau dat Richtige für’n jungen Kerl.«
»Aber dann kann ich euch nicht mehr so viel helfen wie jetzt.«
»Dat Vieh kann ich ja auch wieder machen oder der Opa, wenn er demnächst in Rente geht«, sagte Oma. »Und die Hälfte von ’ne Woche bis’e ja auch noch hier und am Wochenende auch meistens, wenn ich dat richtig verstanden hab.«
In der Ruhr-Post-Ausgabe von Donnerstag, dem 15.Mai 1952, erschienen zum ersten Mal die beiden Seiten »Buntes aus der Welt« und »Buntes aus dem Revier«.
Horst Brömmel und ich wurden schnell ein gut harmonierendes Team, zu dem noch Trudi Tippel aus Bergeborbeck als Redaktionssekretärin stieß. Sie war Mitte dreißig, hatte bisher in der Verwaltung eines Krankenhauses gearbeitet und sich auf die Stelle bei der Ruhr-Post beworben, weil sie einen Arbeitsplatz suchte, an dem nicht ein Tag verlief wie der andere. Nicht nur sie selbst hatte sofort das Gefühl, dass sie bei uns richtig war, auch Brömmel und ich merkten schnell, dass wir mit ihr einen guten Fang gemacht hatten. Schon nach einer Woche stellte Horst Brömmel fest, für ihn sei es schwierig, die eine Hälfte seiner Mitarbeiter zu duzen und die andere zu siezen. Seitdem redeten wir drei uns mit unseren Vornamen an.
An Tagen, an denen nichts Besonderes auf dem Programm stand, fuhr ich um kurz vor halb neun in der Bremener Straße los und war gegen neun in der Redaktion. Zuerst arbeiteten Brömmel und ich uns durch die Konkurrenzblätter, auch durch deren Lokalausgaben, immer auf der Suche nach Artikeln und kleinen Meldungen, hinter denen sich vielleicht etwas Interessantes für unsere bunten Seiten verbarg.
Wenn sich in Dortmund ein Rentner beim Spaziergang ein Bein gebrochen hatte, wenn es in Wanne-Eickel eine neue Tankstelle gab, deren Inhaber ein ehemaliger Bergmann war, wenn in Bochum Dahlhausen ein Wanderzirkus gastierte, wenn in Oberhausen ein ertrinkender Hund von seinem Herrn aus dem Rhein-Herne-Kanal gerettet worden war oder wenn in Duisburg eine Kriegerwitwe und Mutter von vier Kindern ihren dritten Kurzwarenladen eröffnet hatte, dann wurden wir neugierig.
Wie kann man sich beim Spazierengehen ein Bein brechen? Warum geht ein Kumpel vom Pütt weg und wird Tankstellenpächter? Was ist das für ein Mensch, der in den Kanal springt, um seinen Hund zu retten? Wie lebt man in einem Zirkuswagen am Ruhrufer? Wie schafft es eine Witwe mit vier Kindern, ihr Schicksal in die Hand zu nehmen und eine erfolgreiche Geschäftsfrau zu werden?
Die Fragen, die uns beim Lesen der Zeitungen durch den Kopf gingen, die würden sich bestimmt auch unsere Leser stellen. Davon waren wir jedenfalls überzeugt, und deshalb versuchten wir, auf den bunten Seiten diese Fragen zu beantworten.
Irgendwann kam ich dahinter, dass es nicht nur auf den redaktionellen Zeitungsseiten Reizvolles zu entdecken gab, sondern auch im Anzeigenteil. Stellenangebote, Hausverkäufe, Nachrufe, Fundsachen, Verkäufe, Heiratsgesuche, in allen Rubriken erschienen hin und wieder Annoncen, bei denen ich mich fragte, was dahinter stecken könnte.
Jeden Vormittag rief ich in den Lokalredaktionen der Ruhr-Post an und fragte nach den besonderen Themen des Tages. Meistens gab es da nicht viel Buntes, aber manchmal bat ich die Kollegen, aus ihrem lokalen Aufmacher eine Zusammenfassung für uns zu machen. Der Brand eines Bauernhofes beispielsweise, eine große Sache in Recklinghausen, wurde auf den bunten Seiten zu einer kurzen Nachricht. Wären dort noch dreißig Kühe eingeschlossen gewesen, hätte ich mich allerdings sofort aufs Moped geschwungen und wäre an den Ort des Geschehens gefahren. Eine dramatische Rettungsaktion wäre eine Geschichte für uns gewesen, ein Ereignis, von dem wir annahmen, dass es auch die Leser in Mülheim und in Bochum interessierte.
Die meisten Kollegen in den Außenredaktionen der Ruhr-Post reagierten freundlich auf meine tägliche Anfrage. Vor allem die freien Mitarbeiter schrieben gern für uns, denn das Zeilenhonorar für Artikel in der Gesamtausgabe war mit zehn Pfennigen doppelt so hoch wie das Honorar in den Lokalausgaben.
Einige ältere Redakteure gaben sich jedoch jeden Tag aufs Neue äußerst zugeknöpft, wenn ich sie anrief.
»Buntes aus dem Revier wollen Sie? Was soll der Kokolores, junger Mann? Das ist genauso blöd, als würden Sie in der Wüste nach Wasser suchen oder an der Emscher nach Elefanten Ausschau halten.«
Ich beklagte mich bei Horst Brömmel über die unfreundlichen Kollegen, der beschwerte sich beim Chefredakteur, und der verfasste ein Rundschreiben. Darin wurden alle Mitarbeiter in den Außenredaktionen darauf hingewiesen, dass es zu ihren Aufgaben gehöre, das Ressort »Vermischtes« umgehend von außergewöhnlichen lokalen Ereignissen in Kenntnis zu setzen und, falls dies von den Herren Brömmel oder Leschinski gewünscht werde, Artikel über solche Ereignisse für die bunten Seiten zu verfassen.
Danach redeten auch die mürrischen alten Redakteure einigermaßen freundlich mit mir und gaben bereitwillig Auskunft über ihre wichtigsten Tagesthemen.
Horst Brömmel durchforstete ständig die Nachrichten, die aus dem Fernschreiber kamen, und da auch damals schon in der großen weiten Welt Tag für Tag viel Unglaubliches, Verrücktes, Tragisches und Komisches geschah, gab es immer reichlich Material für die Seite »Buntes aus der Welt«.
Genug Buntes aus dem Revier zu finden, blieb dagegen eine Herausforderung.
Oft mussten wir uns mit wenig aufregenden Themen aus den Lokalredaktionen begnügen. Manchmal tricksten wir auch ein wenig herum und machten ein Ereignis, das irgendwo auf der Welt stattgefunden hatte, zu einer regionalen Angelegenheit. Wenn sich beispielsweise eine Schauspielerin scheiden ließ, die irgendwann mal zu einer Filmpremiere in Essen gewesen war, dann genügte ein Foto aus dem Archiv, das die Dame vor der Lichtburg zeigte, um aus ihrer Scheidung eine bunte Geschichte aus dem Revier zu machen.
Hin und wieder sagte Brömmel zu mir: »Hermann, setz dich aufs Motorrad und fahr durch die Gegend, von mir aus nach Sterkrade zu Oma und Opa. Oder geh in die Kneipe. Hör zu, worüber die Leute reden. Wenn wir wissen, was sie ärgert, über was sie sich aufregen und über wen sie schimpfen, dann wissen wir, worüber wir schreiben müssen.«
Ich fuhr damals oft kreuz und quer durchs Ruhrgebiet, redete mit Maurern, die Neubausiedlungen hochzogen, mit Bergleuten, die nach der Schicht mit einer Flasche Bier in der Hand an der Trinkhalle standen, mit Bauern, die unterm rußig grauen Kohlenpotthimmel ihre Kühe molken, oder mit Kindern, die auf Trümmergrundstücken nach Eisenteilen suchten, um sie an den Klüngelskerl zu verkaufen.
Aus vielen zufälligen Begegnungen wurden Reportagen, die nur selten spektakulär, aber oft anrührend oder erheiternd waren, es wurden Porträts von Menschen daraus, in deren Hoffnungen und Alltagssorgen sich die Leser der Ruhr-Post wiederfinden konnten.
Auf den alten Pappkoffer voller Geld stieß ich allerdings weder bei meiner täglichen Lektüre der Konkurrenzblätter noch bei meinen Anrufen in den Lokalredaktionen noch bei einer meiner zahlreichen Motorradfahrten durchs Revier.
Dass wir auf ihn aufmerksam wurden, ist allein Horst Brömmels journalistischem Instinkt zu verdanken.
An einem warmen Frühsommermorgen Ende Juni 1952 saß er hemdsärmelig vor einem Stapel Zeitungen, hielt in der linken Hand eine glimmende Zigarette und blätterte mit der rechten durch die Lokalausgaben der Ruhr-Post.
»Idioten«, knurrte er plötzlich.
Trudi Tippel und ich saßen uns an zwei Schreibtischen gegenüber, die deutlich kleiner waren als Brömmels Protz-Exemplar, das sich über beinahe ein Drittel unseres Redaktionsraumes erstreckte.
Die Sekretärin sah mich erschrocken an und zog fragend und zugleich abwehrend die Schultern hoch.
»Wen meinst du?«, fragte ich. »Uns beide?«
»Die Kollegen im Lokalen«, sagte Brömmel ärgerlich. »Über so eine Sache müssen die uns doch informieren, die Schwachköpfe. Seitdem ihnen das Rundschreiben vom Chef auf den Tisch geflattert ist, sind sie ja alle guten Willens, aber anscheinend sind manche zu blöd, eine aufregende Geschichte zu erkennen.«
Er faltete die Zeitung, in der er gerade geblättert hatte, zusammen und warf sie auf meinen Schreibtisch.
»Essener Lokalausgabe, Seite zwei, oben rechts. Ist nur eine kurze Polizeinachricht«, sagte er.
Als ich die Meldung gefunden hatte, äugte Trudi Tippel neugierig über den Schreibtisch.
»Lies mal laut vor«, sagte Brömmel.
»Die Polizei in Essen sucht den Besitzer eines Koffers. Dieser ist bereits im Juli vergangenen Jahres herrenlos aufgefunden und vom ehrlichen Finder beim Fundbüro abgegeben worden. Bis zum heutigen Tag hat sich der Eigentümer des Gepäckstückes nicht gemeldet, obwohl dessen Inhalt von erheblichem Wert ist. Falls der rechtmäßige Besitzer bis zum Fünfzehnten des kommenden Monats nicht ermittelt werden kann, geht die Fundsache in den Besitz des Finders über. Personen, die etwas über die mögliche Herkunft des Koffers aussagen können, werden gebeten, sich bei der Essener Polizei zu melden.«
»Ein Inhalt von erheblichem Wert? Was soll das denn sein?«, fragte Trudi Tippel.
»Gute Frage«, sagte Brömmel.
»Komische Meldung«, sagte ich.
»Inwiefern?«, fragte Brömmel.
»Sie ist ziemlich schwammig. Wo der Koffer gefunden wurde, wie er aussieht, was drin ist, alles das erfährt man nicht.«
»Schmuck vielleicht«, sagte Trudi Tippel.
»Eine genaue Beschreibung des Fundortes und des Fundstückes hätte vermutlich zur Folge, dass noch heute tausend Leute bei der Polizei erscheinen und behaupten würden, genau so ein Ding an genau der Stelle verloren zu haben. Deshalb ist die Nachricht so vage gehalten«, sagte Horst Brömmel.
»Vielleicht geht es ja um Geld, um einen Koffer voller Geld«, sagte Trudi Tippel.
»Bis zum heutigen Tag hat sich der Eigentümer des Gepäckstückes nicht gemeldet, obwohl dessen Inhalt von erheblichem Wert ist«, las ich kopfschüttelnd noch einmal vor.
»Was meinst du Trudi, ist das eine Geschichte für uns?«, fragte Brömmel.
»Ich glaube schon. Ich wüsste jedenfalls gerne, was da Wertvolles drin ist, in dem Koffer.«
»Mich interessiert noch viel mehr, wieso der Mensch, der den Koffer verloren hat, sich nach fast einem Jahr immer noch nicht gemeldet hat«, sagte Horst Brömmel. »Wenn mir etwas abhandenkäme, das von erheblichem Wert ist, dann würde ich doch alles dransetzen, es wiederzubekommen.«
»Das riecht nach einer verrückten Geschichte«, sagte ich. »Die Frage ist nur, wie man da an Informationen kommen kann. Die Polizei wird sich bedeckt halten, solange sich der Besitzer nicht gemeldet hat.«
»Ist nicht ein alter Freund aus deinen Sterkrader Kindertagen bei der Essener Kripo?«, fragte Brömmel.
»Paul Weyermann«, sagte ich und wiegte skeptisch den Kopf. »Ein richtiger Freund ist er eigentlich nicht. Er ist ein paar Jahre älter als ich, ich schätze drei. Jedenfalls sind wir so weit auseinander, dass wir als Jungen nie miteinander befreundet waren. Aber wir kennen uns ganz gut, weil er in der Nähe meiner Großeltern gewohnt hat und genau wie ich in Osterfeld auf der Mittelschule war. Wir sind damals beide mit dem Fahrrad gefahren und haben uns oft auf dem Schulweg getroffen. In den letzten Jahren hab ich ihn aber nur noch selten gesehen.«
ZWEI
Zwei- bis dreimal in der Woche übernachtete ich in der Maxstraße in der Essener Innenstadt.
Horst Brömmel hatte mir einen Schlüssel zu seiner Wohnung gegeben. Sie lag in der ersten Etage eines dreistöckigen Hauses, das im Krieg zerstört, im letzten Jahr neu aufgebaut und gerade erst bezugsfertig geworden war.
Durch die Korridortür betrat man einen kleinen Flur, von dem aus es nach rechts in mein Zimmer, geradeaus in die Küche und nach links ins Badezimmer ging. Wohnungen mit Bad waren damals eine Rarität. In vielen alten Wohngebäuden waren die Klosetts noch im Treppenhaus zwischen den Etagen, jeweils eins für mehrere Familien. Gebadet wurde am Wochenende in der Zinkbadewanne, die aus dem Keller heraufgeholt und in der Küche aufgestellt wurde.
In Brömmels Küche deutete lediglich der Spülstein in einer Zimmerecke darauf hin, welcher Zweck diesem Raum ursprünglich zugedacht worden war. Brömmel hatte aus ihm ein anheimelndes Wohnzimmer mit modernen Druckgrafiken an den Wänden, mit Sitzecke, Bücherbord, Schallplattenschrank und Radio gemacht. Eine elektrische Kochplatte und ein Tauchsieder standen neben dem Spülbecken auf einem Schränkchen. Darin lagerten Bohnenkaffee, Muckefuck und ein paar Lebensmittel fürs Frühstück, Brot und Butter, Marmelade und Käse, etwas Wurst und manchmal ein paar Eier. Mehr Küche brauchte Horst Brömmel nicht. Er aß in der Kantine im Verlagshaus oder in einem der Restaurants in der Essener Innenstadt.
Hinter dem Wohnraum lag sein Schlafzimmer. Ein paar Mal habe ich einen Blick hineingeworfen, betreten habe ich es nie.
»Klare Regeln, sonst funktioniert unser Zusammenleben nicht«, hatte Horst Brömmel mir am ersten gemeinsamen Abend in seiner Wohnung erklärt.
»Das Arbeitszimmer ist dein Zimmer. Wenn du hier bist, ist es für mich tabu. Kannst dir also ruhig mal ein Schätzchen mitbringen, falls es sich ergeben sollte. Das ist mir egal. Dasselbe gilt umgekehrt für mein Schlafzimmer. Darin hast du nichts verloren, egal ob ich Besuch habe oder allein bin. Du kannst dich gern im Wohnzimmer aufhalten, Radio hören oder dir ein Brot schmieren, wenn ich nicht zu Hause bin. Wenn ich selbst im Wohnzimmer sitze und lese oder Musik höre, kannst du natürlich auch reinkommen, aber bitte immer vorher anklopfen. Es könnte dort nämlich, wenn ich Damenbesuch habe, auch schon mal zu delikaten Situationen kommen. Also nur eintreten, wenn ich dich hereinbitte! Die Badewanne kannst du jederzeit benutzen, aber, wenn ich hier bin, bitte vorher Bescheid sagen. Ich hab nämlich keine Lust, aufs Klo zu müssen, wenn du gerade ins Wasser gestiegen bist. Wenn du morgens von hier aus in die Redaktion gehst, möchte ich, dass du vorher was isst. Hungrige Mitarbeiter machen mich nämlich nervös. Wenn ich auch hier bin, können wir zusammen frühstücken, wenn ich schon weg bin oder anderswo übernachtet habe, weißt du ja, wo du alles findest.«
Ich war mit Brömmels Regeln einverstanden, und er gab mir den Wohnungsschlüssel. Auf den Mietpreis von monatlich zwanzig Mark fürs Zimmer hatten wir uns schon vorher geeinigt. Da hatte ich allerdings noch nicht gewusst, dass Badewanne und Frühstück inklusive waren. Schon ohne diese beiden Extras wäre der Mietpreis in Ordnung gewesen, mit ihnen war er äußerst günstig, ohne Frage ein Freundschaftspreis.
Unsere kleine Wohngemeinschaft funktionierte genauso problemlos wie unsere Zusammenarbeit in der Redaktion. Wenn ich in Essen übernachtete, kam ich meistens sehr spät und müde in der Maxstraße an und ging sofort ins Bett. Wenn ich mal früher am Abend in die Wohnung kam, war Brömmel meistens nicht zu Hause. Die Gelegenheit nutzte ich gern, um ein Bad zu nehmen.
Hin und wieder bekam ich mit, dass Horst Brömmel Damenbesuch hatte. Die Frauen blieben nie bis zum Morgen bei ihm. Irgendwann in der Nacht brachte er sie durch den Flur vor meinem Zimmer zur Korridortür.
Wenn wir zusammen frühstückten, hörten wir Radio und redeten nicht viel. Das war mir angenehm. Bei Horst Brömmel gab es jeden Morgen Bohnenkaffee zum Frühstück, eine Tasse für ihn und eine für mich. Das war sensationell. Ein Pfund Kaffeebohnen kostete damals sechzehn Mark, ungefähr so viel, wie ein Bergmann oder ein Stahlarbeiter am Tag verdienten. Oma und Opa hatten zwar auch meistens »richtigen Kaffee« im Haus, aber getrunken wurde der nur sonntags und zu besonderen Anlässen. Sonst gab es in der Bremener Straße Muckefuck.
Den trank Brömmel nur abends, weil er nach Bohnenkaffee nicht schlafen konnte. Und ich trank ihn, wenn ich beim Frühstück allein in seiner Wohnung war. Er hätte vermutlich auch nichts gesagt, wenn ich mir allein einen richtigen Kaffee aufgebrüht hätte, aber ich wäre mir schäbig vorgekommen. Für zwanzig Mark im Monat ein Zimmer in der Essener Innenstadt plus Bad plus Bohnenkaffe zu jedem Frühstück, das wäre dann doch zu viel des Guten gewesen. Zumal es auch noch gute Butter gab. Bei Oma und Opa gab es nur Margarine. Die hatte Brömmel gar nicht im Haus.
Ich fühlte mich wohl in der Wohnung in der Maxstraße, vom ersten Tag an. Trotzdem fuhr ich so oft wie möglich nach Sterkrade. Das Häuschen meiner Großeltern mit meiner kleinen Kammer unterm Dach war mein Zuhause, und ich wollte, dass es so lange wie möglich so blieb. Nur die alte Zinkbadewanne, die in einem kalten, engen Raum im Anbau stand, zwischen Klo und Schweinestall, die benutzte ich kaum noch. Das Badewasser musste im Einkochkessel auf dem Küchenherd erhitzt und zur Wanne geschleppt werden. Dabei half ich zwar immer öfter den beiden Alten, aber ich selbst badete fast nur noch in der Maxstraße und genoss es jedes Mal, vorher auf dem Klo zu sitzen und zuzuschauen, wie das warme Wasser aus dem Hahn unterm Boiler hervorplätscherte.
Die Großeltern waren froh, dass ich nicht öfter in Essen blieb. Oma Hilde freute sich vor allem, dass ich immer Hunger hatte, wenn ich kam.
»So is et gut«, sagte sie jedes Mal, wenn ich mit am Tisch saß. »Nur für uns zwei Alten zu kochen, dat macht gar keinen richtigen Spaß.«
Opa machte dann gern den Witz: »Der arme Jung kriegt in Essen bestimmt nicht genug zu essen.«
Oma schien das tatsächlich zu glauben. Sie hätte mir am liebsten für die Tage, an denen ich nicht nach Sterkrade kommen konnte, jedes Mal was mitgegeben, in Opas altem Henkelmann.
»Du has doch gesacht, dat dein Brömmel so ’ne elektrische Platte hat. Und en Kochpott hat er bestimmt auch.«
»Nein, Oma, hat er nicht, ehrlich nicht.«
»Dat macht ja nix. So’n Henkelmann kann man auch auf e Kochplatte stellen, zum Aufwärmen. Is ja Blech, dat hält die Hitze aus. Muss’e nur aufpassen, dat e dir nich die Finger dran verbrennst.«
»Nein, Oma, das geht nicht. Beim Brömmel in der Wohnung wird überhaupt nicht gekocht.«
»Meins’e, der macht dann Fissematenten? Has’e’n denn schon ma gefragt? Vielleicht hat er ja gar nix dagegen.«
»Nein, Oma, es wär mir peinlich, ihn danach zu fragen. Und es ist ja auch wirklich nicht nötig. Das Essen in der Verlagskantine ist zwar längst nicht so lecker wie deins, aber ich werde satt. Für ein paar Tage in der Woche geht das schon.«
»Aber dann nimms’e dies Mal wenigstens ’ne Wurst mit. Wir haben oben noch so ’ne schöne harte Plockwurst hängen, genau so, wie du se gerne has. Dann kris’e wenigstens beim Frühstück wat Anständiges in e Rippen. Und da kanns’e ja auch zwischendurch ma drangehen, wenn e Hunger has. Aber pass auf, dat dein Brömmel dir die nich wegfuttert.«
»Ja gut, Oma, dat ist dann aber die letzte von euren Würsten, die ich mit nach Essen nehme. Bis zum Herbst jedenfalls, bis wieder geschlachtet wird. Ich kann euch doch nicht eure letzten Dauerwürste wegschleppen.«
An dieser Stelle mischte Opa Leschinski sich ein und beendete damit die Diskussion.
»Die Ferkels machen sich richtig gut, sind schon ganz schön fett geworden. Die scheinen nix dagegen zu haben, dat se jetz von mir versorgt werden und nich mehr von dir. Sollen wir ma im Stall gucken gehen?«
»Waren wir doch erst vor ein paar Tagen, Opa.«
»Ich glaub, dat die Viecher seitdem schon wieder wat zugelegt haben. Und die Karnickel kanns’e auch ma gucken. Da wirs’e staunen. Die Kleinen sind schon richtig munter geworden.«
Opa war seit Anfang Juni in Rente.
Als wir vor den Karnickelställen standen, fragte ich ihn: »Und? Hast du Sehnsucht nach der Zeche?«
»Hälts’e jetz deinen Opa für bekloppt? Oder wat soll die Frage?«
Mehr als vierzig Jahre hatte er unter Tage gearbeitet, die meiste Zeit davon als Hauer. Als sein Rücken kaputt war, mit Ende fünfzig, hatte er auf Jacobi den Posten eines Wiegemeisters bekommen.
»Jetz hab ich en feinen Lenz«, hatte er mir damals erzählt. »Brauch nur noch zu gucken, wat die Lastwagen wiegen, wenn se leer bei uns reinkommen und wenn se mit Kohle beladen wieder rausfahren. Den Unterschied schreib ich auf’n Ladezettel, und den schick ich in die Abteilung von e Verwaltung, wo die Rechnungen geschrieben werden. Dat is alles. Is en Vertrauensposten, da setzen se nur Leute hin, von denen se wissen, dat se sich auf die verlassen können. Da werd ich die Zeit bis zur Rente gut rumkriegen.«
Im Schweinestall schien es mir so, als wären die Ferkel in den vergangenen drei Tagen tatsächlich schon wieder fetter geworden.
»Nee Hermann, ich hab dat zwar ganz gern gemacht als Wiegemeister die letzten Jahre, aber ehrlich, ich hab die Zeche noch nich einen Tach vermisst«, sagte Opa. »Ich hab ja auch genug zu tun auf’m Land und um et Haus rum. Und dat Vieh muss jeden Tach versorgt werden. Heute war ich den ganzen Morgen unterwegs und hab Kettensalat für de Karnickel gestochen. Irgendwat is immer zu machen. Und die Oma is auch froh, wenn se ma’n bissken Hilfe hat. Vorige Tage hab ich sogar die Wäsche aufgehängt, dat erste Mal in meinem Leben. Die Oma hat daneben gestanden und genau aufgepasst, und Kommandos hat se gegeben wie so’n ollen General. Hier muss noch en Klämmerken hin, da muss’e schön stramm ziehen, damit dat nich knubbelt, und so weiter. Aber wat soll et, solang se mich rumkommandiert, is’e gesund. Am Schluss hat se mich sogar richtig gelobt und gesacht, dat Wäscheaufhängen, dat könnt ich jetz öfter machen.«
Die Hühner saßen im Stall auf der Stange, beäugten Opa und gackerten leise vor sich hin, während er sie abzählte.
»Alle drin«, stellte er fest und schob das Holzbrett vor die Luke.
»Langeweile hab ich bis jetz jedenfalls noch nich gehabt«, sagte er. »Wenn wirklich ma gar nix zu tun is, les ich Zeitung, und in e Bücherei hab ich mich auch angemeldet. Dat wollt ich immer schon machen. Lesen tu ich nämlich gern, ich hab nur die ganzen Jahre viel zu wenig Zeit dafür gehabt. Aber demnächst will ich mir öfter ma Bücher ausleihen, Krimis am liebsten oder so Romane über frühere Zeiten. Bis jetz bin ich noch nich dazu gekommen, weil dat Wetter immer so schön war. Da setz ich mich lieber auf et Fahrrad, fahr ma runter in e Stadt, um irgendwat zu besorgen, oder nur so rum, um zu gucken, wat sich tut. Also Jung, dat kanns’e mir glauben, ich kann richtig gut ohne den Pütt leben.«
Ich glaubte ihm. Wir setzten uns auf die Bank beim Apfelbaum, dessen langer Abendschatten sich bis ins Roggenfeld hinein streckte. Opa bot mir eine Zigarette an, Oma Hilde sang in der Küche eines ihrer alten Lieder, die beiden Ferkel grunzten im Stall. Es war alles wie immer. Ich war zwar nicht mehr so oft hier wie früher, dafür war Opa Leschinski jetzt jeden Tag zu Hause. So war alles im Gleichgewicht geblieben, und es erschien mir damals geradezu unmöglich, dass sich jemals etwas ändern könnte am Gleichmaß des Lebens in der Bremener Straße.
Die Renten waren Anfang der fünfziger Jahre noch bescheiden, trotzdem fehlte es den beiden Alten an nichts. Sie hatten ihr Häusken, ihr Land und ihr Vieh, und Opa bekam seine Deputatkohle von der Zeche Jacobi auch als Rentner.
»Kohlen im Keller, Kappes im Fass, Würste im Kabüffken und en paar fette Karnickel im Stall, dat is immer noch alles, wat wir brauchen, die Oma und ich«, sagte er, während der Schatten des Apfelbaums sich in der Dämmerung auflöste. »Und jetz haben wir dat alles, ohne dat ich dafür auf e Zeche malochen muss. So gut wie heute, Hermann, is et uns noch nie im Leben gegangen.«
Ein paar Tage nachdem Horst Brömmel die Zeitungsnotiz über den mysteriösen Koffer entdeckt hatte, half ich an einem Samstagnachmittag meinem Opa bei der Landarbeit. Er lockerte mit der Hacke den Boden, ich zog das Unkraut aus.
Oma hatte gedeckten Apfelkuchen gebacken. Als sie uns an den Kaffeetisch rief, sagte Opa: »Schluss für heute. Feierabend.«
»Wir können nach dem Kaffeetrinken weitermachen«, schlug ich vor.
»Nee, können wir nich«, sagte Opa. »Is mir zu heiß. Außerdem wills’e doch mit deine Kumpels ausgehen. Da ruhs’e dich besser noch en bissken aus, sonst bis’e ja heute Abend ganz groggy.«
»Ja, ist vielleicht besser«, sagte ich. »Es ist wirklich furchtbar heiß.«
»Wat habt ihr denn vor?«
»Kino wahrscheinlich und nachher irgendwo ein paar Bierchen.«
»Wat läuft denn im Kino?«
»Die Försterchristel.«
»So ’ne olle Schmonzette. So wat gucks’e dir an?«