
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
«Glänzend erzählt, für Kinder und für Erwachsene auch.» Golo Mann Im Frühling 1942 geschehen in El Peso in Kalifornien aufregende Dinge. Es ist zwar Krieg, aber der ist zum Glück weit weg in Europa. Dafür gibt es hier die »Neue Welt«, einen Kinderstaat, der von Rombout, Björn, Tschutschu, Nelson, Ivan, Betsy, Madeleine, Chris und ihren Freunden organisiert und regiert wird. Hier fühlen sich die Kinder in Sicherheit. Doch das Gefühl trügt. Denn der geheimnisvolle Mr. X soll den Terror mitten unter sie tragen. Als die Kinder ihm auf die Spur kommen, beginnt ein dramatischer Wettlauf mit der Zeit. Ein spannender, hochpolitischer Exilroman für junge und junggebliebene Leser – geschrieben mitten im Zweiten Weltkrieg als Aufruf zur Unterstützung der Hitler-Gegner weltweit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Erika Mann
Zehn jagen Mr. X
Über dieses Buch
Im Frühling 1942 geschehen in El Peso in Kalifornien aufregende Dinge. Es ist Krieg, aber der ist zum Glück weit weg in Europa. Dafür gibt es die «Neue Welt» – das ist die Schule von Rombout, Björn, Tschutschu, Nelson, Ivan, Betsy, Madeleine, Chris und den anderen, ein «Kinderstaat», von Kindern organisiert und mitregiert. Hier fühlen sie sich in Sicherheit. Doch das trügt. Ein geheimnisvoller Mr. X soll den Terror mitten unter sie tragen. Die «Gang» kommt ihm auf die Spur – und es beginnt ein dramatischer Wettlauf mit der Zeit.
Ein spannender, hochpolitischer Exilroman für junge Leser, geschrieben mitten im Zweiten Weltkrieg als ein Aufruf zur Unterstützung der Hitler-Gegner weltweit.
Weitere Informationen finden Sie unter www.fischerverlage.de/kinderbuch-jugendbuch
Biografie
Erika Mann wurde am 9. November 1905 in München geboren. Sie arbeitete zunächst als Schauspielerin und Journalistin. Anfang 1933 gründete sie in München das Kabarett «Die Pfeffermühle»; wenige Wochen später ging sie mit der gesamten Truppe ins Exil. Ab 1936 lebte sie überwiegend in den USA, als Vortragsrednerin und Publizistin. Während des Zweiten Weltkriegs wirkte sie unter anderem an den Deutschland-Programmen der BBC mit und war Kriegsberichtserstatterin für die Alliierten. 1952 kehrte sie mit den Eltern zurück nach Europa. Am 27. August 1969 starb sie in Zürich.
Inhalt
[Widmung]
1. Kapitel So sieht die Stadt aus
2. Kapitel Es gibt eine Menge brühwarmer Neuigkeiten in El Peso
3. Kapitel Eine Schlagzeile, die nie gedruckt wurde
4. Kapitel Aufstellung nehmen!
5. Kapitel Eine richtige Party
6. Kapitel Rombouts Geschichte
7. Kapitel Iwans Geschichte
8. Kapitel Ein weiterer Gast erscheint; George erzählt seine Geschichte
9. Kapitel Der grosse Rat
10. Kapitel Wo steckt Chris?
11. Kapitel Statt eines Pullovers
12. Kapitel Inspektor Snow und Detektiv Tiff
13. Kapitel Der geheimnisvolle Mr. X
14. Kapitel Von Einbruch, Gummi und Blech
15. Kapitel Komm schon, Nelson!
16. Kapitel Willkommen, Eltern!
17. Kapitel Das Konzert
18. Kapitel Mr. Baluster zu Ehren
19. Kapitel Flieg, Flugzeug, flieg
20. Kapitel Der Sturm bricht los
21. Kapitel Der Teufel
22. Kapitel Inzwischen ...
23. Kapitel Die letzte Meile
24. Kapitel Der Vorhang fällt
Anhang
Nachwort
Einige Sach- und Worterklärungen
Für Virginia
1. KapitelSo sieht die Stadt aus
Ich glaube, es ist besser, wenn ich euch den wirklichen Namen der Stadt und die Namen ihrer Bürger nicht verrate. Denn wenn auch die Geschichte, die ich erzählen möchte, die Stadt sehr berühmt gemacht hat, so sind ihre Einwohner doch ganz einfache, durchschnittliche Menschen, denen es nicht recht wäre, wenn man sie in einem Buch zur Schau stellte. Die Namen der Kinder aber werde ich nicht ändern, sondern sie so nennen, wie sie sich selber nennen – wenn sie nicht gerade in der Schule sind. Was die Lehrer und die Stadtleute betrifft, die Fabrikarbeiter und die Küstenwachen, die Polizisten und Seine Ehren den Bürgermeister, den zuständigen FBI-Mann, den Herrn, der in besonderer Mission aus Washington kam, und den farbigen Portier des Hotels, in dem ich damals abstieg, sowie eine Menge anderer wichtiger Persönlichkeiten, werde ich mich einfach an ihre Titel und Spitznamen halten oder irgendwelche Abkürzungen gebrauchen, damit sie sich, wenn sie dieses Buch lesen, erkennen können, ohne von der übrigen Welt erkannt zu werden. Denn die übrige Welt interessiert sich ja nur für die Geschichte, und auf die kommt es an.
Es trug sich alles in der Stadt zu, die ich euch hiermit als «El Peso» vorstelle, obwohl sie eigentlich – ach, egal. Wenn ich euch sage, dass in El Peso das Meer nicht weit ist, errät man leicht, dass es irgendwo in Kalifornien liegen muss, wo es all diese komisch klingenden Namen gibt, die man vor langer Zeit von den Spaniern übernommen hat. El Peso ist eine kleine Stadt, man könnte sie sogar ein Dorf nennen, gäbe es nicht das Hotel «Ambassador», das zu riesig und großstädtisch ist, als dass es in einem einfachen Dorf denkbar wäre. El Peso hat etwas über viertausend Einwohner, doch meist drängen sich Leute in den Straßen, die gar nicht hier wohnen. Wohin sonst sollten die Männer der Küstenwache gehen, wenn sie dienstfrei haben? Ihr Stützpunkt liegt knapp sieben Meilen nördlich von El Peso. Und was sollten eurer Meinung nach die Fabrikarbeiter tun, wenn sie nicht in der Fabrik sind? Es ist kein Vergnügen, sich die ganze Zeit in den Wohnbaracken herumzudrücken. Das Werk ist neu, versteht ihr, und der Präsident, die Direktoren, die Ingenieure und die Arbeiter mussten ganz schnell untergebracht werden. Also wurden Hunderte von Holzbaracken gebaut, die gut genug sind, um darin zu schlafen, aber in der Freizeit geht man, wenn man keine Lust zum Schlafen hat, nach El Peso. Der Präsident, die Direktoren und ein paar von den Ingenieuren sind Stammgäste im «Ambassador»; doch die meisten Ingenieure und die Arbeiter ziehen den «Kristallpalast» vor, der nicht nur ein Kino ist, sondern auch das beste Café der Stadt hat und außerdem eine klitzekleine Bar, die wie die Kajüte eines altmodischen Dampfers gestaltet ist.
Natürlich dürfen Kinder diese Bar nie betreten, wohingegen ich recht häufig dorthin ging – nicht wegen der Drinks, aus denen ich mir nicht allzu viel mache, sondern wegen der Leute, die man dort trifft, und wegen alldem, was «mittschiffs» vor sich geht. Denn die Bar heißt «Mittschiffs», und diejenigen, die sie hartnäckig «Mistschiff» nennen, machen nur Spaß. Sie ist sicherlich kein Aufenthaltsort für Kinder; trotzdem sind zwei Schüler der Neuen Welt schon mal dort gewesen. Aber das sollte ich jetzt noch nicht erzählen, denn diese Geschichte begann mitnichten an dem Abend, an dem ich Chris und Rombout im «Mittschiffs» entdeckte, sondern bereits viel, viel früher. Ich habe den Abend nur erwähnt, weil er wirklich wichtig war und man ihn nicht oft genug erwähnen kann. Außerdem sind beide, Chris aus New York City im Staat New York und Rombout, der von weit, weit her kommt, sehr wichtige Jungen, wie ihr bald herausfinden werdet. Ihre Schule, die Neue Welt, wurde zu der Zeit gegründet, als ganz in der Nähe das große Flugzeugwerk gebaut wurde und das «Ambassador», modernisiert und vergrößert, sein gegenwärtiges imponierendes Aussehen erhielt.
Die Neue Welt ist keine sehr große Schule, obwohl sie alle Klassen vom ersten Grundschuljahr bis zum letzten Oberschuljahr umfasst. Sie wird wie ein College geführt, denn die Kinder leben dort ganz wie in einem College. Die meisten von ihnen sind aus allen Teilen des Landes dorthin gekommen, als ihre Väter nach El Peso gerufen wurden, um Flugzeuge zu bauen. Für die Erwachsenen war es zumutbar, in die improvisierten Unterkünfte neben dem Werk zu ziehen, aber die Einwohner von El Peso fanden, für die Kinder müsse etwas getan werden. Sie mussten zur Schule gehen. Sie mussten irgendwo in der Nähe der Schule wohnen. Und sie brauchten vieles, was ihnen das Werksgelände nicht bieten konnte, zum Beispiel Spielplätze und Spaß.
So verwandelte sich das große alte Haus auf dem Hügel in eine Schule mit Klassenzimmern, Schlafsälen, einer Kapelle und einer Turnhalle. Mr. G. P. Hunch wurde zum Direktor gewählt, obwohl er eigentlich nicht wie ein Lehrer aussieht. Mit seinem sonnenverbrannten, wettergegerbten Gesicht und seinen scharfblickenden blauen Augen erinnert er eher an einen Kapitän. Es war, glaube ich, Mr. Hunch, der vorschlug, die Schule «Neue Welt» zu taufen. Ich erinnere mich noch an seine Worte: «Schließlich ist es eine ganz neue Welt, die wir hier errichten, eine Welt, in der Kinder in der Gemeinschaft von Kindern leben und aufwachsen, ein richtiger Kinderstaat, von Kindern organisiert, regiert und in Gang gehalten.»
Den meisten Leuten gefiel die Idee. Aber ob ihr nun mit Mr. Hunch einer Meinung seid oder nicht: Auf jeden Fall sind die Kinder der Neuen Welt die eigentlichen Helden dieser Geschichte, und wenn ich sage «Helden», dann meine ich Helden, nicht bloß «Hauptpersonen» oder etwas ähnlich Farbloses.
Überlegen wir mal kurz: Gibt es noch irgendwas, das ihr wissen müsst oder an das ich euch erinnern sollte, bevor ich euch jetzt nach El Peso in Kalifornien mitnehme? Dort ist es das ganze Jahr hindurch schön warm, aber das ist euch natürlich bekannt. Der Stille Ozean ist noch blauer als der Himmel und nicht immer so friedlich, wie sein Name uns glauben machen will. Die Palmen in El Peso sind besonders riesig und majestätisch. Die beiden, die direkt vor dem Hauptgebäude der Neue-Welt-Schule stehen, sind regelrecht berühmt: Sie sind die ältesten, größten und schönsten Palmen im ganzen Bezirk, und wahrscheinlich deshalb haben die Kinder der Neuen Welt beschlossen, sie oder vielmehr den in ihrem Schatten liegenden Platz zum offiziellen Versammlungsort der Schulregierung der Neuen Welt zu machen.
Das ist so ungefähr alles, denke ich. Und nun: her mit der Geschichte!
2. KapitelEs gibt eine Menge brühwarmer Neuigkeiten in El Peso
Es war Frühlingsanfang 1942, ein paar Monate nach Pearl Harbor. Ich hielt mich schon eine ganze Weile in El Peso auf und hatte bereits eine Menge Leute kennengelernt. Als ich an diesem besonderen Tag durch die Empfangshalle des «Ambassador» ging, winkte mir also Seine Ehren der Bürgermeister aus seinem Schaukelstuhl zu und rief: «Seien Sie gegrüßt!»
Und Mr. Sheepbot, der Präsident des Flugzeugwerks, der rechts neben dem Bürgermeister saß, sagte: «Was gibt’s Neues in Washington, Miss Gutinformiert?»
Ich merkte natürlich, dass er mich aufzog, denn wenn es jemanden in El Peso gibt, der Bescheid weiß über alles, was irgendwo auf der Welt passiert, dann ist es Präsident Sheepbot, ein äußerst mächtiger, aber umgänglicher Herr. Also lachte ich und erklärte, ich sei nur eine Reporterin, die sich alle Mühe gäbe, ihre unmaßgebliche Zeitung in Washington über Neuigkeiten in El Peso zu unterrichten.
«Es gibt welche!», sagte Seine Ehren der Bürgermeister. «Es gibt eine Menge brühwarmer Neuigkeiten, die ich Ihnen für Ihren heutigen Bericht mitteilen könnte.»
Hastig zog ich mein Notizbuch und meinen Bleistift aus der Tasche. Ganz gespannte Aufmerksamkeit, wartete ich auf die genauen Tatsachen.
«Jawohl», fuhr der Bürgermeister fort, «ich könnte sie Ihnen mitteilen, wenn ich nur wollte!» Er lächelte freundlich und wandte sich dann Mr. Sheepbot zu, der angefangen hatte, in seinem Stuhl hin und her zu schaukeln, was ich für einen zarten Wink hielt, die Sache fallenzulassen.
Es ist schrecklich für einen Reporter zu hören, dass es «eine Menge Neuigkeiten» gibt, wenn er nicht an sie heran kann.
«Euer Ehren», sagte ich aufgeregt, «Herr Bürgermeister – könnten Sie nicht wenigstens …»
Da drang ein sonderbares leises Geräusch an mein Ohr, das hinter Mr. Sheepbots Schaukelstuhl hervorkam: Es klang, als hätte ein Huhn zu gackern begonnen, aber im nächsten Augenblick wieder damit aufgehört.
«Oh, hallo!», sagte ich, denn jetzt bemerkte ich Mr. Sheepbot junior, Nelson Sheepbot, der hinter dem Stuhl auf dem Fußboden saß und sich Comics ansah. Um ganz aufrichtig zu sein: Damals hatte ich keine allzu hohe Meinung von Nelson, obwohl ich ihm nicht das Geringste vorwerfen konnte. Er war ein hübscher Junge, groß für seine zwölf Jahre, blauäugig und blond. Ich weiß nicht, warum ich ihn für arrogant hielt und ihm nicht ganz über den Weg traute. Er hatte so eine Art, ein gelangweiltes Gesicht zu machen, wenn man mit ihm sprach, und wenn er seinerseits mit jemandem sprach, machte er weder den Mund noch die Augen richtig weit auf. Außerdem hatte er etwas Blasses, Farbloses an sich, so als hätte man ihn mit Mehl bestäubt.
«Hallo», sagte Nelson und musterte mich mit schläfrigem Blick.
Nach seiner ausdruckslosen Miene zu urteilen, fand er die Comics nicht besonders komisch. Er hat über mich gelacht!, fühlte ich; wahrscheinlich kennt er die Neuigkeiten, nach denen ich mich abzappele; hält es für viel komischer als die Comics, dass man sie mir nicht verraten will … In diesem Augenblick konnte ich Nelson absolut nicht ausstehen. Also sah ich ihn mit dem superfreundlichen, honigsüßen Tantenblick an, den jeder Junge verabscheut, und sagte: «Keine Sorge, Nellie, ich komme schon dahinter!»
Natürlich hasste es Nelson, wenn man ihn Nellie nannte, denn das ist ein Mädchenname, und es ist ziemlich beleidigend für einen Jungen, so angeredet zu werden.
Ich warf Seiner Ehren dem Bürgermeister einen letzten flehenden Blick zu in der Hoffnung, er könnte sich hinsichtlich der Neuigkeiten eines Besseren besonnen haben, doch er war in ein Gespräch mit Präsident Sheepbot vertieft.
«Vielleicht», sagte der Präsident, «vielleicht haben Sie recht, obwohl mir persönlich die Idee nicht gefällt; das hier ist eine Verteidigungszone, und hier sollte nicht einfach so ein Haufen Fremde einfallen dürfen, egal wie groß sie sind!»
Die Antwort des Bürgermeisters konnte ich nicht verstehen, dabei hätte ich gern noch weiter zugehört.
Während ich auf die Tür zuschritt, überlegte ich, worüber Mr. Sheepbot wohl gesprochen haben mochte. «Ein Haufen Fremde …» und «egal wie groß sie sind …» Seltsam, nicht wahr? Vielleicht war ein Zirkus unterwegs nach El Peso mit einer Menge fremder Riesen und Zwerge, und der Präsident wollte nicht, dass sie in seiner Verteidigungszone Vorstellungen gaben. Ich beschloss, meinen Freund, Mr. Horatio Roosevelt Fairchild, zu fragen, ob das der Fall sei.
Horatio stand wie gewöhnlich an der Drehtür; er ist der farbige Portier des «Ambassador» und ein Muster an Anständigkeit und Hilfsbereitschaft. Ich verließ mich voll und ganz auf Horatio, der es mich immer rechtzeitig wissen ließ, wenn ein prominenter Gast im «Ambassador» abgestiegen war.
Während er die Drehtür für mich in Bewegung setzte, würde er mir beispielsweise zuflüstern: «Der Sekretär des Sekretärs des stellvertretenden Außenministers von Südafrika ist gerade in den Speisesaal hinaufgegangen!» Dann nutzte ich diese Information sofort aus, eilte in den zweiten Stock hinauf und überraschte den Diplomaten beim Essen; ich entlockte ihm ein paar erstaunte Bemerkungen, die ich meiner Zeitung nach Washington kabeln konnte, mit dem Zusatz, «gutinformierte Kreise in Südafrika» hätten der Korrespondentin ein Exklusivinterview gewährt. Versteht ihr? Als Reporterin muss man sich zu helfen wissen. Und ganz besonders dann, wenn man einen Boss hat, wie ich ihn hatte. Mr. Bruce L. MacLaughlin, der Chefredakteur, war äußerst anspruchsvoll, doch ich hätte fast alles getan, um ihn zufriedenzustellen.
«Was gibt’s Neues?», fragte ich und blieb bei Horatio an der Tür stehen. Er lächelte mir zu und zeigte dabei die weißesten Zähne, die es auf der Welt gibt. In seiner schönen purpurroten Livree sah er wie ein exotischer Prinz aus.
«Tut mir leid, Ma’am», sagte er, «heute liegt nichts Neues an.»
«Horatio!», rief ich vorwurfsvoll. «Denk bitte nach! Krame in deinem Gedächtnis! Du weißt sehr gut, dass der Zirkus, der berühmte internationale Zirkus, jeden Augenblick hier eintreffen kann, oder?»
Da ich Reporterin bin, tue ich oft so, als wüsste ich über eine bestimmte Sache genau Bescheid, nur um die wirklichen Tatsachen aus jemandem herauszukriegen, den ich im Verdacht habe, bestens informiert zu sein. Ihr versteht, was ich meine.
Doch Horatio glaubte wohl, ich sei verrückt geworden.
«Zirkus, Ma’am?», fragte er, und seine Stimme klang verstört. «Internationaler Zirkus? Es gibt keinen, jedenfalls nicht hier, Ma’am, hier war nie ein Zirkus, und ich schwöre, ich habe von keinem gehört.»
Aber ich gab noch nicht auf.
«Vielleicht würdest du es nicht Zirkus nennen», sagte ich sanft, «obwohl ich nicht weiß, wie du sonst diesen Haufen Fremde nennen würdest, die nicht normal groß sind und die in unsere Stadt einfallen werden!»
Diese meine Bemerkung schien Horatio ernstlich zu beunruhigen.
«Fühlen Sie sich heute nicht wohl?», fragte er mich. «Wahrscheinlich überarbeitet. Schonen Sie sich lieber etwas, Ma’am.»
Da er wirklich besorgt aussah, versprach ich ihm, das zu tun, und trat auf die Straße hinaus.
3. KapitelEine Schlagzeile, die nie gedruckt wurde
Vom «Ambassador» bis zum «Kristallpalast» waren es nur anderthalb Häuserblocks. Also beschloss ich, dorthin zu gehen und meinen Zorn über die geheim gehaltenen Neuigkeiten des Bürgermeisters mit einer Tasse Kaffee herunterzuspülen.
Als ich am Warenhaus Gaylord vorbeiging, kam gerade Christopher Senhouse heraus. Augenscheinlich hatte Chris eine ganze Menge eingekauft, und das, was er gekauft hatte, hing rings um seinen Körper – über seinen Armen, seinen Schultern und um seinen Hals. Er sah sehr komisch aus, denn er war buchstäblich in Stoff eingewickelt, in Stoffbahnen, die in allen Farben prangten – rot und blau und weiß und orange und weiß Gott noch was. Er kam sich aber offenbar gar nicht komisch vor, sondern war so tief in ernste Gedanken versunken, dass er mich überhaupt nicht bemerkte.
«Herrje, Chris», rief ich, «was um Himmels willen hast du denn vor?»
«Ach, guten Tag, Depesche!», sagte Chris. Dass er mich «Depesche» nannte, war ganz normal. Ich erinnere mich nicht mehr, wer es aufgebracht hatte, aber die meisten Kinder aus der Neuen Welt nannten mich so.
«Was ich vorhabe?», fragte Chris. «Warum?»
Er wollte es mir nicht erzählen, deshalb wiederholte er einfach meine Frage und fügte von sich aus noch eine zweite hinzu. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Leute sich so verhalten, wenn sie einer Frage aus dem Wege gehen und Zeit gewinnen wollen? Also ich habe das oft beobachtet, und deshalb ließ ich ihm keine Zeit.
«Wofür brauchst du denn diese Stoffbahnen?», erkundigte ich mich rasch.
«Ach – die Stoffe?» Chris schien sich jetzt erst an seinen Einkauf zu erinnern.
«Natürlich hätten sie mir das auch eingepackt», erklärte er. «Aber ich wollte es nicht. Papier ist jetzt knapp, verstehst du, deshalb lassen wir uns unsere Sachen nicht mehr einwickeln.»
Immer wenn eins der Kinder aus der Neuen Welt «wir» sagt, könnt ihr sicher sein, dass alle Kinder der Schule damit gemeint sind.
«Regierungsbeschluss?», fragte ich.
«Klar!», sagte Chris. «Also bis dann, Depesche!» Er schien es eilig zu haben.
«Wart doch mal einen Augenblick!», bat ich. «Wie wär’s mit einem Eis? Außerdem hast du meine Frage noch nicht beantwortet, nicht wahr?»
Das Eis hielt Chris für eine tolle Idee. Also gingen wir zum «Kristallpalast».
Christopher Senhouse war erst elf, als sich diese Geschichte zutrug, aber eine ganze Menge Erwachsene, darunter auch ich, sahen in ihm einen richtigen Freund. Er fuhr mit den Fischern aus, sogar wenn der Pazifik in Aufruhr war, oder er sauste mit dem Rad nach Hell’s Bay und besuchte die Küstenwachen. Chris hat schwarzes Haar und sehr helle graugrüne Augen. Seine Nase hat einen kleinen Sattel aus Sommersprossen, und seine Arme und Beine sind immer ganz schön zerschrammt und zerkratzt. Denn Chris ist ein erstklassiger Boxer, Kletterer, Taucher, Rettungsschwimmer und noch verschiedenes andere, und das ist nur möglich, wenn man sich hin und wieder ein paar blaue Flecken holt.
Aber ein guter Schwindler ist er nicht. Das entdeckte ich nach dem vierten Eis.
«Chris, alter Junge», fing ich wieder an, «du wolltest mir doch erzählen, weshalb du diesen ganzen Stoff gekauft hast!»
Chris starrte auf seinen leeren Teller. «Es ist gute, haltbare Qualität», sagte er, «und es ist immer nützlich, so was im Vorrat zu haben. Man kann es für alles mögliche gebrauchen.»
Er errötete nicht direkt, als er diesen Unsinn vorbrachte, nur seine Ohren wurden rot, als schämten sie sich über das, was da aus dem Mund ihres Besitzers kam.
«Aber Chris», sagte ich, «hast du denn kein Vertrauen mehr zu mir?»
Chris schüttelte den Kopf.
«Ich soll nicht …», stotterte er, «ich meine, natürlich vertraue ich dir … aber ich darf dir doch nicht erzählen … ich darf es überhaupt niemandem erzählen. Es ist ein Geheimnis, verstehst du? Ein wichtiges Experiment, das geheim gehalten werden soll, bis wir wissen, wie es ausgeht. Wenigstens hat er das gesagt …»
«Wer ist ‹er›?», fragte ich.
«Na, Geepy», erwiderte Chris. Er meinte natürlich den Direktor G.P. Hunch, dem es nichts ausmacht, dass seine Schüler ihn «Geepy» nennen.
«Heute Morgen erst hat er die Versammlung einberufen», fuhr Chris fort, «wir hatten einen Riesenspaß, und es war ganz aufregend, vor allem für mich, verstehst du. Denn ich wurde zum Vorsitzenden des Komitees für Auslandsfragen gewählt. Wir haben nämlich jetzt so ein Komitee, und das hat mich delegiert, das alles hier zu beschaffen.»
Er sagte tatsächlich «delegiert» und «beschaffen», und solche Wörter gebrauchte er nur, wenn eine Sache wirklich ernst wurde. Ich begriff, dass ich meine Strategie ändern musste, wenn ich die Geschichte aus ihm herausholen wollte.
«Also, es war schön, dich zu sehen!», sagte ich wie abschließend. «Lassen wir die Stoffbahnen. Da du mir nicht vertraust, will ich dein Geheimnis gar nicht wissen. Sicherlich ist es auch nicht so wichtig.»
«Da irrst du dich aber gewaltig!», rief Chris. «Weißt du, warum? Weil Bahnen sich auf Fahnen reimt und weil wir Fahnen aus dem Stoff machen. Eine Menge Fahnen! Alliierte Fahnen. Britische und chinesische und russische und so weiter! Die Neue Welt soll eine Schule für die ganzen Vereinten Nationen werden, und deshalb müssen wir alle Fahnen haben, die es gibt. Wir können doch unsere Verbündeten nicht ohne ihre Fahnen lassen; außerdem müssen wir die Schule anständig ausschmücken, wenn die Vereinten Nationen einen Sieg errungen haben oder so was. Wir brauchen die Fahnen auch für den Empfang. Ich muss mich jetzt beeilen. Wir haben nur noch ein paar Tage Zeit, und wir müssen eine Riesenmenge Fahnen machen!»
«Wart mal!», sagte ich und dachte ganz schnell nach. Was hatte Direktor Sheepbot zu Seiner Ehren dem Bürgermeister gesagt? Hatte er nicht gewisse Leute erwähnt, «einen Haufen Fremde – egal wie groß sie sind»? Jawohl! Und ich dumme Gans hatte auf Zwerge und Riesen getippt, anstatt ganz einfach an Kinder zu denken!
«Wart mal!», wiederholte ich. «Wir wollen sehen, ob ich deine Geschichte richtig verstanden habe. Chris, wenn es das ist, was ich denke, dann finde ich es großartig! Die Neue Welt öffnet ihre Tore für Kindervertreter der Vereinten Nationen – stimmt’s?»
Chris nickte.
«Und ihr erwartet in Kürze eine ganze Menge Neuankömmlinge? Gäste, Kinder aus allen Teilen der Welt – ist das richtig?»
«Nein», sagte Chris, «keine Gäste. Sie kommen für lange zu uns, vielleicht sogar für sehr lange. Sie sind hier unsere Kameraden, und wir sind ihre. Und wenn sie dann später mal in ihre Heimatländer zurückgehen, wissen sie Bescheid über das Leben in Amerika, und wir wissen Bescheid über ihr Leben. Sie erzählen es ihren Leuten und wir unseren. Dann gibt’s keine Missverständnisse mehr zwischen den Vereinten Nationen. Wenigstens hat Geepy das gesagt.»
«Wann kommen sie denn an?», fragte ich.
«Dienstag», sagte Chris. «Ich bin gespannt, was der Chinesenjunge im Baseball draufhat. Oder vielleicht ist es auch ein Mädchen mit ganz kleinen Füßen – in China mögen sie’s, wenn ein Mädchen kleine Füße hat, nicht wahr? Sie operieren die Füße und schnippeln daran herum, bis nur noch ein Stückchen Fuß übrig ist. Ganz schön verrückt. Glaubst du, den Russen wird es hier sehr heiß vorkommen? Na, warten wir’s ab!»
Er wickelte sich wieder in seine bunten Stoffbahnen ein. «Also dann, Depesche!», sagte er. «Und bitte, zu niemandem ein Wort!»
«Du kannst dich auf mich verlassen, Christopher!», versprach ich feierlich, und dabei fühlte ich mich wie ein Fischer, der einen Riesenfisch gefangen hat und ihn wieder ins Wasser wirft. Da stand ich nun mit der besten Neuigkeit, die ich seit langem ergattert hatte, und durfte sie nicht meiner Zeitung in Washington telegraphieren. Denn ein Versprechen ist ein Versprechen, unter allen Umständen, besonders aber, wenn man es einem Freund wie Chris gegeben hat, und noch dazu, wenn es eine derart wichtige Angelegenheit betrifft. Dabei wäre das eine so schöne Schlagzeile geworden! Ich zog meinen Bleistift und mein Notizbuch hervor. Träumerisch malte ich quer über die erste Seite:
Die Neue-Welt-Schule in El Peso
bereit für die vereinten Kinder!
Es las sich fabelhaft. Und mein Boss hätte sich so darüber gefreut! Aber niemand durfte es lesen! Deshalb hielt ich die Seite über den Aschenbecher, zündete sie an und sah zu, wie sie langsam verbrannte.
4. KapitelAufstellung nehmen!
Es war Dienstag. Endlich war der große Tag gekommen. Obwohl der Zug erst um 9.34 Uhr einlaufen sollte, war ich schon kurz nach neun auf dem Bahnhof. Ein Zug verfrüht sich manchmal, nicht wahr? Und diesen wollte ich um gar keinen Preis verpassen.
Als ich in den Warteraum trat, waren Chris und Betsy bereits da.
Aber ihr habt ja Betsy noch nicht kennengelernt. Höchste Zeit, dass ich sie euch vorstelle, denn ihr werdet ihr im Verlauf dieser Geschichte noch oft begegnen.
Betsy Bird war – und ist wahrscheinlich immer noch – Christopher Senhouses Freundin, seine Gefährtin, die an vielen seiner Abenteuer teilnahm. Sie hat ein Gesicht wie ein Kätzchen – ihre grünlichen Augen sind groß und etwas schräg, und ihr glattes Haar ist so weich wie ein Pelz. Zu Anfang hatte Betsy es in der Neuen Welt ziemlich schwer gehabt, denn sie war so unordentlich, dass sie ihre Sachen überall im Haus herumliegen ließ und sich nie erinnern konnte, wo sie sie gelassen hatte. In der Schule vergaß sie immer, welches Fach gerade dran war, und erschien im Sozialkundeunterricht mit der Küchenschürze, weil sie glaubte, jetzt sei Kochstunde. Doch glücklicherweise wurde Betsy bald zur Vorsitzenden des Komitees für Schönheit und Anstand gewählt, das alle Kinder in den Versammlungssaal führt, sich um alles Verlorengegangene und Wiedergefundene kümmert und darauf achtet, dass jedes Mädchen bei festlichen Anlässen ein rotes Kleid trägt. Mit der Last dieser Verantwortung auf den Schultern fand Betsy, dass sie nun ein Beispiel geben müsse, und wurde musterhaft ordentlich.
«Das ist ja wohl die Höhe!», sagte Chris, als er mich erblickte. «Depesche, du bist schrecklich! Hier gibt’s nichts für dich zu sehen. Es ist alles ganz … anonym, oder wie man das nennt …»
«Inkognito?», schlug ich vor.
«Jawohl!» Chris nickte. «Es ist alles inkonkto! Deshalb ist nicht mal Geepy zum Empfang mitgekommen, und wir haben auch keine von unsern Fahnen mitgebracht. Die eigentliche Begrüßung findet in der Schule statt, verstehst du?»
Ich sagte, ich verstünde sehr wohl. «Aber ich musste sowieso hierher», erklärte ich. «Es ist nämlich jemand im Zug, den ich sprechen muss, ein berühmter Feuerwehrhauptmann oder so was. Außerdem dachte ich, ich könnte vielleicht mit Sprachen helfen. Du weißt, ich spreche etwas Holländisch, auch etwas Französisch, und ich glaube, ich kenne etwa sechzehn russische Wörter.»
Betsy kletterte von ihrem hohen Sitz herunter. «Das ist wunderbar», zwitscherte sie. «Mein Gott, es ist beinahe neun Uhr zwanzig. Nur noch vierzehn Minuten!»
Wir gingen auf den Bahnsteig.
Die letzten paar Minuten wurden zur Ewigkeit. Es ist komisch mit Bahnhöfen: Man hat immer Angst, diese letzten paar Minuten könnten entschwinden, sich einfach in nichts auflösen, während man noch im Warteraum sitzt, deshalb beeilt man sich, an die Gleise zu kommen. Aber wenn man erst einmal da ist, zieht sich sogar eine Minute so in die Länge, als würde sie nie enden.
Ein fernes Brummen verwandelte sich in ein immer lauter werdendes Donnern, und dann dampfte mit lautem Gebimmel die Lokomotive um die Ecke. Tief seufzend hielt sie auf dem Bahnhof von El Peso.
Nur ein Fahrgast stieg aus dem Zug, ein junger Mann, der mir irgendwie bekannt vorkam. Es war ein schlanker, schmallippiger, mittelgroßer, unauffälliger junger Mann, der die Stadt offenbar nicht kannte, denn er sprach ihren Namen nicht richtig aus: Er fragte den Schaffner, ob das hier «El Paaeeso» sei. Er hatte kein Gepäck bei sich und trug keinen Hut, nur einen Mantel, der etwas zu groß für ihn und ganz bestimmt zu warm war. Ich fasste ihn nur deshalb ins Auge, weil es nichts anderes zu sehen gab.
Chris und Betsy waren bereits ein paarmal von einem Ende des Bahnsteigs zum andern gelaufen, und der Zug wollte gerade wieder abfahren, da kletterte aus einem der letzten Wagen eine ältere Dame, gefolgt von einer Schar Kinder. Sie trug einen Kneifer und einen imposanten Hut, auf dessen Rand sich zwei Vögelchen schnäbelten.
«Kinder», rief sie mit hoher, aufgeregter Stimme, «hört zu, Kinder! Lauft jetzt nicht weg!»
Die Kinder dachten nicht im Traum daran, wegzulaufen; sie standen dicht gedrängt und stumm da.
«Lauft nicht weg!», wiederholte die Dame. «Aufstellung nehmen!» Es klang wie ein Schlachtruf.
Die Kinder «nahmen Aufstellung»; jedes von ihnen trat hinter einen kleinen Berg von Gepäckstücken und wartete auf weitere Befehle. Man sah jetzt, dass es sechs waren – zwei Mädchen und vier Jungen. Da ich mich der Gruppe erst nähern wollte, wenn Chris und Betsy von ihrer Expedition zum andern Ende des Zuges zurückgekommen waren, beobachtete ich einfach, was nun geschah.
Die Dame mit dem Kneifer nahm ein Blatt Papier aus ihrer riesigen Krokodillederhandtasche und rief die Namen auf.
«Björn!», rief sie, und ein flachshaariger, etwa zehnjähriger Junge hob die rechte Hand. «George!», rief die Dame, und ein etwas kleinerer Junge antwortete: «Hier!»
George ist Engländer, dachte ich, und Björn ist sicher Norweger, denn Björn heißt auf norwegisch «Bär» – mal sehen, wer der nächste ist.
Die Liste der Dame war offenbar alphabetisch geordnet; der nächste Name begann mit einem I.
«Ei – wan!», rief sie. Die Kinder lachten. Nur Iwan blieb ernst. «I!», korrigierte er. «I-wan!»
Er war groß und kräftig, dieser Iwan, sein Gesicht mit den breiten Backenknochen, der breiten Stirn und dem festen Kinn war das eines jungen russischen Bauern. Iwan war der Einzige, der kein Gepäck bei sich hatte.
Nach Iwan kam Madeleine an die Reihe. Das kleine Mädchen war die weitaus Jüngste von allen. Sie sah aus, als sei sie erst sieben, aber dabei war sie schon neun, wie ich später erfuhr. Madeleine war winzig und hatte ein winziges Gesicht, das unter der schwarzen Baskenmütze sehr blass wirkte. Ihre Augen waren ebenfalls schwarz und lebhaft wie die einer Feldmaus.
«Oui, Madame!», sagte sie.
In diesem Augenblick erschienen Chris und Betsy.
«Rombout!», rief die Dame, und ein schlaksiger Junge mit einem orangefarbenen Bändchen im Knopfloch machte eine kleine Verbeugung. Orange, das wusste ich, war die Nationalfarbe der Niederländer, die Traditionsfarbe des königlichen Hauses Oranien.
Die Dame hielt inne und blickte suchend über ihren Kneifer hinweg. «Und – Tschutschu!», schloss sie triumphierend.
Tschutschu gab einen Laut von sich, der Chinesisch sein musste. Aber ihre Füße waren ganz normal, nicht kleiner, als es sich für ein Mädchen von elf Jahren gehörte. Sie trug keine exotischen Gewänder, sondern sah in ihrem schicken grauen Kostüm wie eine kleine Dame aus.
«Ah», rief Chris ganz außer Atem, «da seid ihr ja endlich!»
Betsy blieb schüchtern hinter ihm stehen; sie überließ alle notwendigen Schritte dem Vorsitzenden des Komitees für Auslandsfragen.
Christopher machte es sehr gut.
«Ich bin Christopher Senhouse», sagte er gewandt, «und das hier ist Betsy Bird wir sind hier um euch im Namen der Neuen Welt willkommen zu heißen habt ihr Hunger ich meine seid ihr müde können wir was für euch tun also gehen wir!»
Er sagte das alles ohne Pause, in einem Atemzug, und wandte sich mehr an die ganze Gruppe als an die Dame mit dem Kneifer.
«Danke, mein Junge!», sagte die Dame und nickte so heftig mit dem Kopf, dass die beiden Vögelchen auf ihrem Hut fortzufliegen drohten. «Ich bin Mrs. Caboose, Mrs. Melvyn Caboose vom Akobekall, und das hier sind Björn, George, Ii-wan …»
Die Kinder lachten, weil Mrs. Caboose diesmal den Namen richtig ausgesprochen hatte.
«Iii-wan», wiederholte die Dame, «Madeleine, Rombout und Tschutschu. Sie alle sind dank der unentwegten Bemühungen des Akobekall hierhergekommen!»
Jetzt war es Betsy, die ein bisschen lachen musste. Immer noch hinter Chris’ Rücken versteckt, versuchte sie ihr Kichern zu unterdrücken. Auch Chris griente. «Akobekall?», fragte er schließlich. «Was ist Akobekall?»
Die Dame sah etwas gekränkt aus. «Mein lieber junger Mann», rief sie, «willst du wirklich behaupten, du hättest noch nie vom Akobekall gehört?»
Chris, Betsy und ich schüttelten alle drei den Kopf.
«Das ist natürlich das Amerikanische Komitee für die Betreuung von Kindern aus alliierten Ländern!», erklärte die Dame mit unglaublicher Schnelligkeit. «Akobekall, wenn ihr nichts dagegen habt!»
«Tausend Dank!», sagte Chris ziemlich unsinnig.
Eine kleine Weile herrschte Schweigen. Niemand schien zu wissen, wie es jetzt weitergehen sollte. Nun ist der Augenblick für mich gekommen, dachte ich. Ich stellte mich Mrs. Caboose vor, brachte acht meiner sechzehn russischen Wörter bei Iwan an, erzählte Rombout auf Niederländisch, ich sei eine alte Bewunderin der Königin Wilhelmina der Niederlande, und fragte die kleine Madeleine auf Französisch, ob ich ihr vielleicht mit ihrem Gepäck helfen könnte. «Il n’y a pas de porteur», sagte ich elegant, «hier gibt’s keinen Gepäckträger!»
Chris nahm Tschutschus Taschen und Bündel, und Betsy nahm Mrs. Cabooses Mantel. Iwan belud sich nicht nur mit den zahlreichen Koffern der Akobekall-Dame, sondern bot auch noch George an, ihm seine Sachen tragen zu helfen.
«Nimm den Koffer hier, alter Junge, ich fürchte, der ist zu schwer für mich», ermutigte ihn George. Es klang ungeheuer britisch und er wirkte recht hochmütig, als er, seine kleine Reisetasche schwingend, den hübschen Kopf hoch erhoben, mit festem Schritt den Bahnsteig entlangmarschierte.
Wir gingen am Zeitungsstand vorbei und liefen auf Mr. Johnson auf, Jim Johnson, dem das Fotogeschäft in der Hauptstraße gehörte. Jim war offensichtlich in Hochstimmung. Seine kleinen Schweinsäuglein funkelten vor Fröhlichkeit; und er trug eine hübsche weiße Nelke im Knopfloch. Er sah so überraschend unternehmungslustig aus, dass ich mich umdrehte und noch einen Blick auf ihn warf, bevor ich den Bahnhof verließ. Erst da bemerkte ich den jungen Mann, der gerade angekommen war, jenen schlanken, schmallippigen, mittelgroßen, unauffälligen jungen Mann, der mir irgendwie bekannt vorgekommen war. Auch er trug jetzt eine weiße Nelke, aber ich hätte schwören mögen, dass er sie erst in dieser Minute gekauft hatte. Ich erinnerte mich genau, dass mir sein etwas zu großer Mantel aufgefallen war – an dem war keine Nelke zu sehen gewesen. Er schritt geradewegs auf den Zeitungsstand und auf Jim Johnson zu.
«Sie haben’s also geschafft!», hörte ich Jim sagen. «Herzlichen Glückwunsch!»
Dann zogen beide Männer ihre Nelken aus dem Knopfloch und schenkten sie der Zeitungsverkäuferin.
Ich beeilte mich, wieder zu der Kinderkarawane vor dem Bahnhof aufzuschließen.
Während wir auf Charles warteten, den Gärtner, Wachmann und Chauffeur der Neuen Welt, der mit dem Kleinbus die Auffahrt hochfahren sollte, gewannen die Neuankömmlinge ihren ersten Eindruck von El Peso. Rombout schien von den Palmen höchst angetan zu sein.
«Orange?», fragte er und zeigte auf sein orangefarbiges Bändchen. «Orangenbäume?»
Er war etwas enttäuscht, als er die Wahrheit erfuhr, um so mehr, da Chris ihm erklärte, Orangenbäume seien viel kleiner als Palmen. «Eher wie große Büsche!», sagte er.
Björn war entzückt und ganz überrascht, als er unsere Berge sah, den Halbkreis hübscher schneebedeckter Gipfel, der unsere Stadt im Osten einrahmt.
«Wie Norwegen!», sagte er und suchte nach englischen Worten. «Zu Hause sagten mir einige Persönlichkeiten, Amerika besitzt keine Berge, Amerika ist gänzlich vollkommen flach …» Er lächelte glücklich.
George brüllte vor Lachen. «Richtig», jubelte er, «das ganze große Amerika nichts als Morast – nichts als Ebene. Eine Menge Leute sind sich darin einig! Verstehen Sie», sagte er und wandte sich mir zu. «Björn hat Englisch aus dem Wörterbuch gelernt; ist es nicht traumhaft, was dabei herausgekommen ist?»
Björn nahm ihm den Spott offenbar nicht krumm. «Sehr schön, viel wie Norwegen», wiederholte er nur.
Jetzt endlich kam Charles angefahren. Beim Anblick des Kleinbusses wurde Mrs. Caboose etwas nervös.
«Wartet, Kinder», rief sie mit ihrer hohen Stimme aufgeregt, «hört mal her, alle! Wo ist mein Mantel? Mein Gott, ich muss ihn im Zug vergessen haben; ach, hier ist er, danke, mein Kind! Hat jeder seine Gepäckstücke? Warum antwortest du mir nicht, Madeleine? Ist dir nicht gut? Ach natürlich, sie versteht ja kein Englisch, das arme Ding. Niemand darf neben dem Fahrer sitzen, niemand, verstanden! Wie war doch noch dein Name, junger Mann? Sag dem Chauffeur, er soll vorsichtig fahren, ja?» Die Vögelchen auf ihrem Hut tanzten, als sie über ein Gepäckstück stolperte.
Christopher reagierte würdevoll. «Charles fährt immer vorsichtig!», erklärte er.
Schließlich war der Kleinbus vollgeladen. Mrs. Caboose war als Letzte eingestiegen; jetzt stand sie neben Charles und überblickte die Szene, so wie ein General ein Schlachtfeld überblickt.
Chris, der neben Iwan und Rombout saß, beugte sich zur Seite und öffnete das Fenster.
«Na tschüs denn, Depesche!», rief er. «Komm bald mal vorbei, ja? Und vielen Dank dafür, dass du in so vielen Sprachen geredet hast.»
Charles trat aufs Gaspedal. Mit einem schrillen kleinen Schrei landete Mrs. Caboose, nicht sehr sanft, fürchte ich, auf dem Sitz neben dem Fahrer.
Ich stand da und winkte mit dem Taschentuch. «Tschüs, Kinder, und viel Glück!», sagte ich, aber es war schon zu spät, niemand hörte mich.

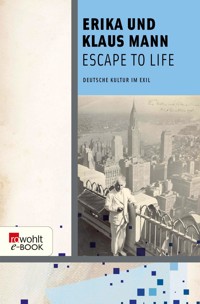













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













