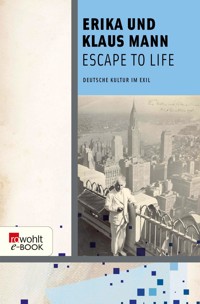4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Herbst 1927 brachen Erika und Klaus Mann zu einer gemeinsamen Weltreise auf. Über ein Dreivierteljahr lang fuhren sie durch die USA, besuchten Hawaii, Japan, Korea und die Sowjetunion. Sie trafen Prominente von Greta Garbo bis Emil Jannings, und sie entdeckten viel Unbekanntes. Nach ihrer Rückkehr schrieben die Geschwister über ihre Erlebnisse einen anekdotenreichen, launigen Bericht. In der vorliegenden Ausgabe dieses einzigartigen Dokuments sind auch die 35 Fotos aus der Erstausgabe von 1929 wieder enthalten, und Uwe Naumann berichtet in seinem Nachwort über unbekannte Hintergründe der ungewöhnlichen Reise.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Erika Mann • Klaus Mann
Rundherum
Abenteuer einer Weltreise
Reportagen
Mit Originalfotos
Nachwort von Uwe Naumann
Über dieses Buch
Im Herbst 1927 brachen Erika und Klaus Mann zu einer gemeinsamen Weltreise auf. Über ein Dreivierteljahr lang fuhren sie durch die USA, besuchten Hawaii, Japan, Korea und die Sowjetunion. Sie trafen Prominente von Greta Garbo bis Emil Jannings, und sie entdeckten viel Unbekanntes. Nach ihrer Rückkehr schrieben die Geschwister über ihre Erlebnisse einen anekdotenreichen, launigen Bericht. In der vorliegenden Ausgabe dieses einzigartigen Dokuments sind auch die 35 Fotos aus der Erstausgabe von 1929 wieder enthalten, und Uwe Naumann berichtet in seinem Nachwort über unbekannte Hintergründe der ungewöhnlichen Reise.
Vita
Erika Mann wurde am 9. November 1905 in München geboren. Sie arbeitete zunächst als Schauspielerin und Journalistin. Anfang 1933 gründete sie in München das Kabarett «Die Pfeffermühle»; wenige Wochen später ging sie mit der gesamten Truppe ins Exil. Ab 1936 lebte sie überwiegend in den USA, als Vortragsrednerin und Publizistin. Während des Zweiten Weltkriegs wirkte sie unter anderem an den Deutschland-Programmen der BBC mit und war Kriegsberichtserstatterin für die Alliierten. 1952 kehrte sie mit den Eltern zurück nach Europa. Am 27. August 1969 starb sie in Zürich.
Klaus Mann, geboren am 18. November 1906 in München als ältester Sohn von Katia und Thomas Mann, begann seine literarische Laufbahn als Enfant terrible in den Jahren der Weimarer Republik. Nach 1933 wurde er ein wichtiger Repräsentant der von den Nazis ins Exil getriebenen deutschen Literatur. Seine bedeutendsten Romane schrieb er in der Emigration: «Symphonie Pathétique» (1935), «Mephisto» (1936) und «Der Vulkan» (1939). Im Mai 1949 starb Klaus Mann in Cannes an den Folgen einer Überdosis Schlaftabletten.
Impressum
Die Erstausgabe eschien 1929 im S. Fischer Verlag, Berlin
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Mai 2019
Erweiterte Neuausgabe Oktober 2001
Copyright © 1982, 1996 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung any.way, Hamburg
Umschlagabbildung ullstein bild - Eduard Wasow; Mark Carrel/Shutterstock
ISBN 978-3-644-00439-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Unserer Mutter Mielein gewidmet
1
Schauplatz: Ein Landerziehungsheim in Feldafing am Starnberger See, während der Ferien als Hotel benutzt.
Personen: Die Direktrice des Landerziehungsheimes, während der Ferien Leiterin des Hotels; Erika.
Direktrice: Ich bin auch eine starke Verehrerin Ihres Herrn Vaters.
Erika: Hm.
Direktrice: Wir gehen immer in seine Vorträge.
Erika: Welchen haben Sie denn zum Beispiel gehört?
Direktrice: Wir wollten alle zusammen in seinen Vortrag über München als Niedergangsstadt, aber es war ja wieder überfüllt.
Erika: Hm. (Nimmt stumm einen Bleistift, um mitzuschreiben, schaut sie innig und erwartungsvoll an.)
Direktrice: Viele finden ja den Thomas Mann zu kraß, aber ich bin selber ziemlich modern.
Erika (schreibt stumm, ohne den Blick von ihr zu lassen).
Direktrice: Der Heinrich Mann ist allerdings noch krasser. Der ist Realist bis auf die Knochen. Aber schließlich kommt man ja in den Zeiten nicht anders weiter.
Erika (klappt das Notizbuch zu).
Hierzu kam, daß es uns verboten war, in den Gängen des Landerziehungsheims in Bademänteln spazierenzugehen; daß die «Münchener Neuesten Nachrichten» ganz ungerecht zu unseren Darbietungen standen; daß unsere Freundin Gretel Walter, Brunos ausgezeichnete Tochter, uns so anschaulich von Hollywood erzählt hatte. Wir erinnerten uns also, daß Boni and Liveright uns vor einiger Zeit aufgefordert hatte, Vorträge in den Staaten zu halten, wahrscheinlich um die Aufmerksamkeit der Leute ein bißchen mehr auf ein kleines Buch zu lenken, was in Deutschland «Kindernovelle» geheißen hatte und in New York als «The Fifth Child» herauskam.
Wir telegraphierten kurz entschlossen an den Verlag, daß wir bereit seien zu kommen und recht viel Geld haben wollten. Am selben Tage reisten wir nach München, wo wir verschiedenes zu tun hatten. Zunächst begaben wir uns in Schenkers Reisebüro und bestellten Schiffskarten für vierzehn Tage später; dann erhandelten wir bei Ackermanns Nachfolger «1000 Worte Englisch», broschiert, im Ullsteinhause erschienen. Dann trafen wir uns mit einigen Bekannten im Hofgarten, denen wir schlicht, aber mit einem gewissen Pathos erklärten, ein lang verschwiegener Plan sei spruchreif geworden, monatelange Verhandlungen hätten zum guten Ergebnis geführt, und wir reisten noch diesen Monat. Dasselbe telegraphierten wir auch unserer verehrten Großmutter in die Arcisstraße und unsern lieben Eltern nach Kampen.
Alles dieses unternahmen wir aus schlauer Berechnung, indem wir uns selber gleichsam überlisten wollten. Denn wir sagten uns, vollkommen richtig: wir sind imstande, diese Reise, die wir doch sehr gerne machen möchten, zu verbummeln, wenn wir uns nicht bei groß und klein auf sie festlegen und als die Blamierten dastünden, unternähmen wir sie dann nicht.
Am nächsten Tage kam die Antwort von Liveright. Er sei von Herzen interessiert, – aber die season sei overcrowded, dieses Jahr ginge es nicht. Wir drahteten prompt zurück: Vielen Dank, wir kommen nun also, verbrannten sein Telegramm, erzählten allen Bekannten, die Tournée wüchse uns fast schon etwas über den Kopf, und packten gleich unsere Koffer.
In Berlin und Hamburg gab es noch sentimentale Geselligkeit, in Cuxhaven verlud man uns mit unsern vierzehn Gepäckstücken und der Ziehharmonika auf die «Hamburg», wir wurden photographiert, und die Leute sangen: «Muß i denn zum Städtele hinaus?» – Ein Herr, der uns bis Cuxhaven begleitet hatte, erzählte später, es sei sehr hübsch und stimmungsvoll gewesen.
Wir fuhren zweiter Klasse, weil man uns glauben gemacht hatte, es sei dort ebenso schön wie in der ersten, was sich als ein Irrtum erwies. Erika hatte ihre Kabine mit einer Frau aus Pforzheim und deren zwei halbwüchsigen Töchtern, die alle drei die Eigenart besaßen, noch nie im Kino gewesen zu sein und sehr zur Seekrankheit zu neigen, sich aber andrerseits gerade vor dieser Krankheit ganz besonders zu fürchten. – Klaus wohnte mit einem jungen Metallarbeiter aus München-Giesing, der ihm übrigens sehr sympathisch war, und zwei Herren aus dem New Yorker Getto, beide mit goldenen Zähnen. Das Essen war ziemlich gut. Nach dem ersten Dinner schrieb uns ein gewisser Herr Schofel ein Brieflein, er sei auch gebildet und passe, so wie wir, nicht recht ins hiesige Milieu.
Wir machten uns inzwischen schwerwiegende Sorgen. Man hatte uns gesagt, amerikanische Journalisten seien höflich nur gegen wohlhabende Leute, wenn sie uns aber zweiter Klasse ankommen sähen, könnten sie uns leicht für ärmlich halten. Denn daß sie rudelweise, uns zu interviewen, an Bord eilen würden, war doch wohl ausgemacht. Nach langem Tüfteln setzten wir folgende Depesche auf: «Von Reise außerordentlich ermüdet; möchten sämtliche Reporter erst im Hotel empfangen.» – Das war etwas, anderes blieb noch zu überlegen.
Bekanntlich müssen alle Fremden, die in Amerika beachtet werden wollen, eine Puschel haben, ein «hobby», aber etwas Ausgefallenes muß es sein. Tenor Slezak hatte sich für eine weiße Ziege entschieden, Roda Roda trägt die rote Weste sowieso, Emil Ludwigs Frau ist Afrikanerin, Graf Keyserling kann nur bestimmte Sektmarken trinken. Was blieb uns also? – Wir schwankten zwischen Schildkröten, einer Stutzuhr und einer Bruthenne. Dann fiel uns die Sache mit den Zwillingen ein. Es mußte etwas Rührendes haben, wenn wir als Zwillinge reisten, auf den Plakaten wirkungsvoll aussahen, von Gott gewollt und dabei sensationell, gerade durch seine Bescheidenheit würde dieser Trick unfehlbar wirken. Wir kabelten Liveright: «Haben vergessen, Euch mitzuteilen, daß Zwillinge sind.»
Nachdem wir uns solcherart von den Sorgen befreit hatten, stürzten wir uns etwas mehr in den Taumel der Geselligkeit. Unsere Deckstühle standen dort, wo es zur ersten Klasse hinaufging, so daß wir sowohl mit unseren Kameraden aus der zweiten als auch mit einigen feinen Bekannten, die erster fuhren, Kontakt behielten. Diese fanden es besonders raffiniert von uns, dort unten zu liegen, da oben eine öde Steifheit herrschte, und kamen des Tags zum Plaudern an unsere Stühle, während sie uns abends delikate kleine Essen im Grillroom gaben. Bei solchen Schmausereien spielte die strahlendste Rolle ein rheinischer Industrieller, der geborene Karnevalskönig und Weinkenner, ebenso gutmütig wie genußsüchtig. Hauptteilnehmer war Gustav Schützendorf, der höchstgeliebte Escamillo und Mephisto unserer Kindertage, der zu seinem Engagement an die Metropolitan-Oper fuhr; bei ihm war die lustige und schöne Grete Stückgold, Metropolitan-Star auch sie. – Manchmal spielten wir auch Schiffstennis und Kegel, das hat uns aber dann die Rote versaut. Dieses Geschöpf, eine der frechsten Pforzheimerinnen, mischte sich, ganz rotgekleidet, unter uns, trieb mit uns den eleganten Sport des Oberdecks und bat uns auch noch, sie zu photographieren. All das erweckte, nicht zu Unrecht, Neid und Gehässigkeit ihrer Freundinnen, die brachten die ganze Affäre vor den Kapitän, und mit ihr wurde uns das Betreten der First-Class-Reviere verboten.
Eines Morgens – hatte man überhaupt noch daran geglaubt? – standen die Konturen der Wolkenkratzer im Grau, und vom Nebel verschönt, hob die Freiheitsstatue den Arm. Wenn uns einen Augenblick auf dieser Reise feierlich zumute war, so damals. Wir ahnten etwas: New York.
Die wundervolle Nervosität der Ankunft ergriff uns mit den andern; die Feindschaft mit der Roten war vergessen, Herr Schofel nahte sich mit dem Blumenstrauß. Schützendorf winkte mit kostbarem braunen Handschuh, ein paar Journalisten waren trotz des warnenden Telegramms gekommen, aber wir waren viel zu aufgeregt, um englisch zu sprechen.
Am Kai erwarteten uns: der Freund Ricki, der in New York seit ein paar Monaten sein Wesen trieb, Mister Friede, Teilhaber bei Liveright, blendender junger Mann mit Schnurrbärtchen und Verführerlächeln, schließlich ein Abgesandter der Universität Princeton, dessen Qualitäten ins Auge fielen. Ricki umarmte uns, dabei weinten wir alle.
2
In den Zimmern des Astor-Hotels glühen grüne Lämpchen auf, wenn für den Besucher unten in der Office etwas abgegeben wird, ein Brief, eine «message», ein Telegramm. Dann kann er auf einen Klingelknopf drücken, der neben dem Lämpchen angebracht ist, und die Nachricht wird ihm gebracht.
Wenn du die Klappe zu deinem Schreibtisch aufmachst, geht auch drinnen elektrisches Licht an, eine witzige kleine Rampenbeleuchtung. Die altbewährte Schreibtischlampe täte es auch; doch so macht es mehr Spaß. «Dem Kind im Manne –»
Aber wenn du aus der Tür dieses Astor-Hotels trittst, hast du direkt den Broadway vor dir. Wenn dir pathetische Gefühle kommen bei diesem Anblick, unterdrücke sie nicht. Es war Alfred Kerr, der feststellte, er habe am Broadway oder unten in Wall Street «eine neue Schönheit» geschaut. Wenn auch du diese Empfindung hast, verkleinere sie nicht. Sei andächtig, wenn du zwischen diesen unglaublichen Gebäuden spazierengehst, diese steilen Perspektiven hinunterschaust, die etwas von einer neuen und strengen Gotik haben: sei andächtig und gerührt.
Später dann, wenn du eine Zeitlang spazierengegangen bist, sollst du natürlich zu räsonieren anfangen: über die schlechte Justiz, das Negerproblem, die Sensationspresse, die Prohibition und den primitiven Geschmack. Aber erst, wenn du ziemlich viel spazierengegangen bist.
Unser Freund Ricki trug Blumen aus. Die deutsche Dame, bei der er angestellt war, erwies sich ihm, seiner schwarzen Glutaugen und seines Mundes wegen, als gar zu schwärmerisch zugetan; aber er verdiente ganz nett, und es war lustiger als Tellerabwaschen, das hatte er auch schon gemacht. Er brachte weiße, rote und gemusterte Sträuße zu Opernpremieren, Hochzeiten, Tees; manchmal bekam er stattliche Trinkgelder, die er gern einsteckte. – Zuweilen fand er sich mit einigen Blumentöpfen im Astor-Hotel ein und wollte Tee mit kleinen Kuchen haben. Die verantwortlichen Herren unten waren etwas betreten, wenn er so, Haar in die Stirn und keß aufgemacht, mit seinen Blumenarrangements durch die Lobby trabte. Aber sie gewöhnten sich an ihn, ließen ihn sogar in unsere Stuben, wenn wir ausgegangen waren, und meldeten uns dann, «this fellow» sei oben. Es stellte sich heraus, daß sie ihn für unsern Bruder hielten, und er war es ja wirklich beinahe. Sogar nahm ihr empfindliches Moralgefühl nicht einmal Anstoß daran, wenn er bei uns oben übernachtete, was öfters vorkam, da er sehr weit draußen wohnte und abends meist zu faul war, heimzugehen.
Ricki brachte uns mit seinen Freunden zusammen.
Der eine, ein sehr zartes Kind aus Berlin, war Ausläufer für eine große Firma in Wall Street. Besonders gefiel uns der kleine Student Henry, der kindisch weit aufgerissene schwarze Blitzaugen hatte, auch ein lieblich schlaues Gesicht und zudem einen jener enormen Studentenpelzmäntel, auf den er hemmungslos stolz war; dieses läßt sich verstehen, denn solche Pelze, die nur amerikanische junge Leute tragen, haben einen eigenen Charme, indem sie einerseits ein kapriziös damenhaftes, andrerseits ein rauh nordpolfahrerisches Aussehen geben. – Henry bedeutete die erste Begegnung mit dem Typ des amerikanischen student, von dem wir nachher noch reden werden. Wir merkten gleich, daß er uns gut gefallen würde. – Dann hing Ricki sehr an einem Griechen, der irgendwo an der Stadtperipherie Limonade und Eis verkaufte. Dieser lebhafte und sentimentale Mensch hätte Ricki nötigenfalls tagelang ohne Gegenleistung ernährt, er schickte seiner Mutter wöchentlich eine Kleinigkeit nach Griechenland und hatte ein ganz unvergleichliches Mienenspiel, auch Achselzucken, skeptische und enthusiastische Handbewegungen wie keiner sonst.
Aber wir können die netten jungen Leute nicht alle aufzählen, ihre Zahl ist Legion. Vielleicht werden wir von dem einen oder dem andern noch später berichten. Jedenfalls mangelte es an Umgang nicht.
Wir zogen herum: vom Negerviertel in die Italienerstadt, vom chinesischen Theater in die Metropolitan-Oper, von der Fünften Avenue ins stinkende Getto. New York ist eine der allerallerschönsten Städte (ästhetisch gewertet, abgesehen also von schlechter Justiz, Negerproblem, Sensationspresse und Prohibition). Nirgends fanden wir den Begriff der Stadt so erfüllt: alle Völker durcheinandergemischt und lauter Lichtreklamen dazwischen.
Sicher ist New York nicht sehr typisch amerikanisch, in gewissem Sinn ist Berlin «amerikanischer». Ein alter Schwindel ist auch, daß es ein so besonders rasendes Tempo habe; dergleichen ist nur so oft behauptet worden, bis man es glaubte. Daß es auf der Höhe von Neapel liegt, vergißt man; es hat einen südlich unseriösen Einschlag, etwas Träges, Schiebendes, Vergnügungssüchtiges; sogar der wundervolle Lichtreklamenunfug scheint oft nicht mehr dem Geschäft zu dienen, sondern spielender, eitler, großartig kindischer Selbstzweck zu sein. – Man hat die Geräusche New Yorks zu scharf und ratternd stilisiert und weitererzählt. Daß es viele Autos gibt, stimmt; aber weil es viele sind, fahren sie langsam, tuten auch gar nicht, sonst würde einem das Trommelfell springen. – Berlin rattert viel mehr, wörtlich und symbolisch genommen.
Wir essen Reis und uralte Eier im chinesischen Restaurant, verdächtig süße Konfitüren im syrischen; in den großen Cafeterias hat man sich selbst zu bedienen, man bekommt etwas fettige und widerliche Blechtabletts, aber geeiste Milch, Melonen und wundervolle, billige Austern. Manchmal speisen wir auch elegant, in französisch aufgemachten Lokalen, aber eigentlich ist es dort am wenigsten lustig.
Wir gewannen Einblick in die «falsche Bohème», der wir manchen drolligen und manchen hübschen Abend zu verdanken haben; schließlich auch manche Freundschaft, die man dauerhaft wissen möchte. – Der Begriff der «Bohème» ist ja sogar in Städten, in denen er immerhin noch Existenzberechtigung hat, etwas Antiquiertes, Abseitiges und mumienhaft Komisches. Und nun in New York erst. Hier gilt dieses Wort gar nicht mehr, ist ein verstaubtes Opernrequisit. Nur noch der Künstler hat Daseinsberechtigung, der am Leben der Nation Anteil nimmt, es pädagogisch beeinflußt, indem er seine Probleme Gestalt werden läßt. – Trotzdem macht es einer ganzen Gruppe Menschen Freude, inmitten von Wolkenkratzern «Künstlervölkchen» zu spielen, Schwabing, Montparnasse zu kopieren. Ihr Viertel heißt Greenwich Village. Der Spießer geht, wie ins Panoptikum, hin.
Unser ausgezeichneter Freund Friede, derselbe, der uns mit Verführerlächeln am Kai erwartet hatte, gehörte auch ein bißchen dazu. Er war, mit feinem Schnurrbärtchen, ovalem Gesicht und schmelzenden Augen, der allerreizvollste Typ Angelsachse, ein bißchen ästhetizistisch, Snob in irgendeiner Ecke seines Wesens, aber im übrigen von einem echten und in manchen Augenblicken sogar überwältigenden Charme – aus Gefallsucht gütig, kokett und menschenfreundlich, genießerisch und empfindsam; und Mrs. Friede mindestens ebenso anziehend.
Bei ihm gab es diese typischen New Yorker kleinen Bohèmefeste, mit viel Whisky, viel Gin, nachher sahen sich Herren und Damen gemeinsam Fuchsens pikant illustrierte Sittengeschichte an. Bei solchen Festen war es, wo wir viele unserer Freunde kennenlernten.
Monsieur Galentière singt so wunderhübsch Pariser Chansons. Er rekelt sich dabei auf dem Sofa und nähert sich kosend allem, was in seiner Nähe liegt. Später erfährt man, daß er eine sehr künstliche und geistreiche Prosa schreibt und alle europäischen Intellektuellen kennt.
Ihm befreundet ist der Verleger Joseph Brewer, der gerne witzige und ausgefallene Dinge herausbringt. Seine expressionistischen Geschäftslokale sind eine kleine Sehenswürdigkeit, und wen man bei Mr. Friede nicht kennengelernt hat, trifft man einen Tag später beim Empfang des Mr. Brewer.
Um einige Schattierungen düsterer und seriöser ist der irische Poet und Kritiker Ernest Boyd. Dieser hat einen roten Vollbart und verfaßt grundgescheite Artikel. – Waldo Frank, dem großes Talent nachgesagt wird, ist der Typ «leicht sentimentaler Naturbursche». Anita Loos, die auf Photographien fasziniert, ist in Wien.
Lassen wir dahingestellt, ob der Reporter und Dichter Sylvester Viereck wirklich ein Vetter unseres Exkaisers ist; auf jeden Fall war er Wilhelms Vorkämpfer und Propagandist in Amerika und sogar schon zu Zeiten, da es noch weniger harmlos war. Er hat von Sigmund Freud sich das Attest ausstellen lassen, daß er unzweifelhaft einen Vaterkomplex habe; unter diesem Vorwand läßt er sich mit Bernard Shaw und dem Papst ein, allerdings auch mit Mussolini, der ihm zu knabenhaft sein sollte. Nervös und ehrgeizig wandert er durch die Kontinente, wo es geht, mit Weltberühmtheiten anbandelnd. Nach Kaiser Wilhelm ist es Lord Alfred Douglas, einstmals mit soviel Zärtlichkeit «Bosie» genannt, den er am herzlichsten protegiert.
Übrigens hat Sylvester Viereck wirklich schöne Gedichte gemacht. Seit langer Zeit arbeitet er an einem Epos, das die erotischen Abenteuer des Ewigen Juden behandelt. Es steht zu hoffen, daß dieses Epos stark autobiographischen Charakter tragen wird.
Außerhalb und oberhalb steht Mencken, in dessen Hotelzimmer wir einmal zu Mittag aßen und vorzüglichen Rotwein tranken. Er hat jene wundervolle Vitalität, die wir schon bei Sinclair Lewis in Berlin geliebt hatten. Wie sind europäische Prominente (Deutsche besonders)? Zugeknöpft, steif, aus Hemmungen hochmütig und unberechenbar. Die amerikanischen haben Witz und Elan, allerdings weniger Hintergrund und Geheimnis. Sinclair Lewis, der ein Erzähler von ganz großem Stil ist, benimmt sich lustig, wie ein Gassenjunge; ebenso Mencken, der gefürchtetste und geliebteste Kritiker, Satiriker und Ankläger des puritanisch-imperialistischen Amerikas. Er erzählt Anekdoten, führt ein zwar geistreiches, aber unruhiges und unkonzentriertes Gespräch, das amüsant von einem Gegenstand zum andern springt. Wenn einer auf die Prohibition die Rede bringt, reagiert er wie auf die rote Fahne der Stier. Er erklärt diese Einrichtung als heuchlerische und verderbliche Farce; außerdem, sagt er, wisse er unter Tausenden Amerikanern, die ihm bekannt seien, nicht einen, welcher nicht tränke – seine alte Großmama inklusive.
Senken wir geheimnisvoll unsere Stimme, denn wir wollen von Rudolf K. Kommer aus Czernowitz reden, dem Freund und Helfer Max Reinhardts. Man darf nicht behaupten, daß er zur New Yorker «falschen Bohème» gehöre; er gehört überall und nirgends hin. Den charmanten Seehundskopf schief gehalten, die Zigarette zwischen den Lippen hängend, residiert er im Ambassador-Hotel, seelenruhig immer, durch nichts aus der Fassung zu bringen, gibt bei «Voisin» erlesene kleine Luncheonparties, kennt alle Welt, vom Winkeljournalisten bis zu Otto H. Kahn, ist jedermann dienlich, hilft jedem, ohne Gegenleistung zu fordern, schreibt nichts, übersetzt nicht einmal; hat seine Finger in Hollywood und Paris, in Berlin und Venedig, in Salzburg, London und Wien. Er ist, dies soll einstens auf sein Grab geschrieben sein, eine der letzten undurchschaubaren Existenzen unserer Zeit.
Den Palast seines gewaltigen Freundes und Gönners Otto H. Kahn zu sehen, ist ein Abenteuer. So blasiert sind wir nicht, daß es uns nicht doch ein bißchen eiskalt den Rücken hinunterläuft, wenn bei einem schlichten Privatmann, der sich im Leben als liebenswürdig beredter, sympathisch ergrauter Herr präsentiert, die Rembrandts und Frans Hals, Montegnas und Botticellis an den Wänden herumhängen.
Die Existenz der ganz großen amerikanischen Vermögen hat in unserer Zeit etwas Schwindel- und sogar Furchterregendes, gerade wenn man mit Männern zusammenkommt, die über diese phantastische Geldmacht gebieten und die meist sanft, kunstliebend und warmherzig sind. Es ist Tatsache, daß die Gewalt, die solchen Leuten eignet, der unserer früheren absoluten Fürsten gleichkommt oder sie übertrifft. Ihnen ist nichts unmöglich – und daß dergleichen im Jahre 1928 zulässig ist, erweckt Schrecken. Die Idee drängt sich auf, daß eine Situation, die sich so ungeheuerlich zugespitzt hat, reif dafür ist, in ihr Gegenteil umzuschlagen.
Über so viel Prominenz sind wir von den alten Freunden abgekommen. – Haben wir eigentlich, daß Ricki Maler ist, schon erwähnt? Er macht wunderliche und groteske, dabei exakte und magisch klare Traumlandschaften, darin Krüppel spazieren und Bäume ihr stummes, intensives Leben führen.
Wir fanden es also nicht länger passend für ihn, Blumen auszutragen, und überredeten ihn, in das Geschäft eines großen Münchener Bilderhändlers einzutreten, der ihn brauchen zu können behauptete. Nachher stellte sich heraus, daß er ihn als Ausläufer und Klosettputzer haben wollte; am ersten Tag schon gab es Erstaunen, als Ricki, an einem Rubens vorüberschlendernd, die Bemerkung fallen ließ: «Ja, ja – bei dem kann man doch noch was lernen –», eine Glosse, die der alte Händler nachher kichernd allen seinen Kunden erzählte: «Wissen Sie, was unser Klosettputzer heute gesagt hat? – Beim Rubens könnte er doch noch was lernen!»
In gemeinsamer Arbeit verfaßten wir einen maßvollen, aber strengen Brief an den taktlosen Greis, in dem wir ihm klarmachten, daß er sich in Ricki geirrt habe und sich darum von ihm trennen müsse.
Wir hatten in New York schon den Eindruck, als sei Amerika mit modernen malerischen Genies nicht sehr üppig gesegnet – während seine Literatur doch den Vergleich mit jeder zeitgenössisch-europäischen verträgt –, dieser Eindruck hat sich, als wir später eine große Ausstellung in Chikago sahen, traurig bestätigt. Das originellste zeichnerische Talent, das wir in New York angetroffen haben, hieß Eva Herrmann – und so deutsch war sie auch sonst. Dieses bemerkenswerte Mädchen, welches von einer schwierigen und seltenen Schönheit ist, hat nicht nur von uns, sondern auch von Vater, Onkel und Umgebung die denkbar unverschämtesten und begabtesten Karikaturen gemacht. Die Nachmittage in ihrem Atelier vergißt man nicht mehr; es liegt im achtunddreißigsten Stock eines Broadway-Hotels, man schaut in die Straße wie in einen Abgrund, darin schlängelt sich abends, leuchtendes, rasendes Band, die Autoarmee.
Jetzt, in der Rückschau, scheinen diese ersten Wochen in New York die größten, wichtigsten und schönsten Eindrücke der ganzen Reise zu enthalten und in sich zu sammeln.
Die Begegnung mit New York muß für jeden jungen Europäer Erlebnis von einschneidender Bedeutung sein, oder er ist ein hoffnungslos Verstockter. Streifzüge durch New York sind nicht wie Streifzüge durch eine andere Stadt. Es ist, als sei die Abenteuerlichkeit aller Städte zusammengedrängt und man könnte darin Spazierengehen.
Wir schauen vormittags einen Rembrandt, einen Picasso beim Kunsthändler an und nehmen den Nachmittagstee im Heim der Christlichen Jungen Mädchen, wohin eine Professorengattin uns eingeladen hat – es gibt Semmeln und Milchkaffee; eine junge Dame, die als Krankenschwester um die Welt fährt, sagt plötzlich, während der Mahlzeit: «Wie finden Sie, Frau Professor, daß ich von Jahr zu Jahr glücklicher werde?» – Wir essen beim großen Kahn in Wall Street zu Mittag, andächtig gestimmt, weil um uns herum die Finanzschicksale von fünf Erdteilen sich entscheiden – wir steigen aufs Woolworth-Building, um das Riesenhafte von oben zu schauen; wir sind nachts in Harlem, dem schwarzen Viertel, oder am Hafen, um die Schiffe abfahren zu sehen, oder in der Carnegie-Hall, um eine Beethoven-Symphonie, von Toscanini dirigiert, zu hören. Wir sitzen im chinesischen Theater, wir fahren ans Meer, wir streunen in Warenhäusern herum und im Gebäude der «Times»-Redaktion, um zuzuschauen, wie mit Maschinengeratter «geistige Nahrung» für Millionen hergestellt wird.