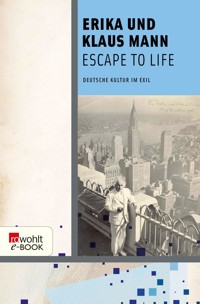
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
"Escape to Life" ist ein Who´s Who der deutschen Kultur im Exil. Erika und Klaus Mann porträtieren die wichtigsten Persönlichkeiten der von Hitler in die Emigration getriebenen geistigen Elite Deutschlands. Kaum ein bedeutender Name fehlt in der hier aufgeführten Allianz gegen den Faschismus. Von Albert Einstein bis Bertolt Brecht, von Carl Zuckmayer bis George Grosz reicht die Liste der Künstler und Wissenschaftler, die in sehr persönlich gehaltenen Essays vorgestellt werden. Als das Buch 1939 erstmals erschien, sollte es den amerikanischen Lesern ein Bild geben von Vielfalt und Reichtum der deutschen Kultur im Exil. Heute ist es ein einzigartiges Dokument: die umfassendste, farbigste Darstellung des "Anderen Deutschland", die während der Zeit des Dritten Reiches geschrieben wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 688
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Erika und Klaus Mann
Escape to Life
Deutsche Literatur im Exil
Über dieses Buch
»Escape to Life« ist ein Who’s Who der deutschen Kultur im Exil. Erika und Klaus Mann porträtieren die wichtigsten Persönlichkeiten der von Hitler in die Emigration getriebenen geistigen Elite Deutschlands. Kaum ein bedeutender Name fehlt in der hier aufgeführten Allianz gegen den Faschismus. Von Albert Einstein bis Bertolt Brecht, von Carl Zuckmayer bis George Grosz reicht die Liste der Künstler und Wissenschaftler, die in sehr persönlich gehaltenen Essays vorgestellt werden. Als das Buch 1939 erstmals erschien, sollte es den amerikanischen Lesern ein Bild geben von Vielfalt und Reichtum der deutschen Kultur im Exil. Heute ist es ein einzigartiges Dokument: die umfassendste, farbigste Darstellung des »Anderen Deutschland«, die während der Zeit des Dritten Reiches geschrieben wurde.
Vita
Erika Mann wurde am 9. November 1905 in München geboren. Sie arbeitete zunächst als Schauspielerin und Journalistin. Anfang 1933 gründete sie in München das Kabarett »Die Pfeffermühle«; wenige Wochen später ging sie mit der gesamten Truppe ins Exil. Ab 1936 lebte sie überwiegend in den USA, als Vortragsrednerin und Publizistin. Während des Zweiten Weltkriegs wirkte sie unter anderem an den Deutschland-Programmen der BBC mit und war Kriegsberichtserstatterin für die Alliierten. 1952 kehrte sie mit den Eltern zurück nach Europa. Am 27. August 1969 starb sie in Zürich.
Klaus Mann wurde geboren am 18.11.1906 in München als ältester Sohn Thomas und Katia Manns. Er schrieb mit 15 Jahren erste Novellen. Es folgten die Gründung eines Theaterensembles mit Schwester Erika, Pamela Wedekind und Gustaf Gründgens, 1929 unternahm er eine Weltreise »rundherum«. In der Emigration (mit den Stationen Amsterdam, Zürich, Prag, Paris, ab 1936 USA) wurde er zur zentralen Figur der internationalen antifaschistischen Publizistik. Er gab die Zeitschriften »Die Sammlung« (1933–35) und »Decision« (1941–42) heraus, kehrte als US-Korrespondent nach Deutschland zurück.
1949 beging er aus persönlichen und politischen Motiven Selbstmord, nachdem er in dem von Pessimismus erfüllten Essay »Die Heimsuchung des europäischen Geistes« noch einmal zur Besinnung aufgerufen hatte. Mann sagte sich früh vom Daseinsgefühl der Eltern-Generation los und stellte die Lebenskrise der »Jungen« in der stilistisch frühreifen »Kindernovelle« und in der Autobiographie des Sechsundzwanzigjährigen »Kind dieser Zeit« dar. Seine wichtigsten Romane schrieb Mann im Exil: »Symphonie Pathétique«,»Mephisto. Roman einer Karriere« und »Der Vulkan«. In der Autobiographie Der Wendepunkt gelangt Klaus Manns Diktion zu Reife und gelassener Sachlichkeit. Er sprach stellvertretend für eine Generation, die in den 20er Jahren ihre prägenden Eindrücke empfing, mit einem engagierten Freiheitsbewusstsein zu neuen Ufern aufbrechen wollte und zwischen den Fronten einer zerrissenen Nachkriegswelt an der Machtlosigkeit des Geistes verzweifelte.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Mai 2019
Die deutsche Originalausgabe erschien 1991 in der edition spangenberg, München
Copyright © 1996 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Covergestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Coverabbildung Münchner Stadtbibliothek/Monacensia/KM F 197 (Albert Einstein auf dem Rockefeller Center, New York City)
ISBN 978-3-644-00260-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Zu dieser Ausgabe
Widmung
Motto
Vorwort
Interview mit uns
Schauplatz Europa
Kapitel I Der Reichstag brennt!
Kapitel II Vorgewarnt
Kapitel III Späte Emigranten
Kapitel IV Freiwillige Emigranten
Kapitel V Bildnis des Vaters
Kapitel VI Kultur im Dritten Reich
Kapitel VII Von der anderen Seite
Kapitel VIII Das Ende Österreichs
Kapitel IX Solidarität
Kapitel X Die Toten
Kapitel XI Aktivität in Europa
Kapitel XII Europa ist eng
Exil in Amerika
Kapitel XIII Maler und Musikanten
Kapitel XIV Aus dem Tagebuch Eines Deutschen Studenten in Princeton
Kapitel XV Musik in New York
Kapitel XVI Hollywood
Kapitel XVII Schriftsteller
Kapitel XVIII Politik
Kapitel XIX Theater in New York
Kapitel XX Leben und Freunde in den USA
Kapitel XXI Krieg ohne Waffen
Epilog
Appendix I Sympathisierende Deutsche im Ausland
Appendix II Deutsche als Wissenschaftler in Amerika
Nachwort
Personenregister
Zu dieser Ausgabe
Um Escape to Life ranken sich viele Legenden. Dies wohl auch, weil von dem erfolgreichsten Buch, welches Erika und Klaus Mann gemeinsam verfaßten, bisher keine deutschsprachige Ausgabe existierte.
In den sechziger Jahren ging es dem Verlag und Martin Gregor-Dellin als Herausgeber der Klaus Mann-Werkausgabe darum, den in Westdeutschland wenig beachteten Schriftsteller unter literarischen Aspekten bekannt zu machen. Das essayistische Werk wurde über mehrere Jahre hinweg in Auswahlausgaben veröffentlicht, in die auch kürzere Teilstücke aus Escape to Life Aufnahme fanden. Inzwischen sind annähernd alle literarischen Texte und Briefe sowie der größte Teil der Tagebücher publiziert. Klaus Mann ist von einer jungen Generation neu entdeckt worden und findet Beachtung als außergewöhnlicher Mensch, Künstler und homo politicus, der als Vermittler eines »besseren« Deutschlands die meisten seiner Zeitgenossen an Bedeutung überragte. Auch von Erika Mann sind inzwischen die Briefe sowie ihr Buch Zehn Millionen Kinder und eine Dokumentation über ihr kabarettistisches Unternehmen Die Pfeffermühle erschienen.
Deshalb sehen Verlag und Herausgeber den Zeitpunkt gekommen, Escape to Life als deutsche Originalausgabe zu veröffentlichen, in der Sprache also, in der es ursprünglich geschrieben wurde. Als Erika und Klaus Mann im November 1937 den Plan zu einer umfangreichen Darstellung des deutschen Exils faßten, sollte dieser »Who’s Who des Exils« möglichst rasch erscheinen. Deshalb bedienten sich die Geschwister der vertrauten Muttersprache. Die schottische Schriftstellerin Mary Hottinger-Mackie besorgte die Übersetzung ins Amerikanische, die jedoch von mancher Seite als farblos oder gar unzutreffend kritisiert wird. Am 14. April 1939 erschien Escape to Life im Bostoner Verlag Houghton Mifflin.
Für etwa 95 Prozent der amerikanischen Ausgabe liegt im Münchner Klaus Mann-Archiv der deutsche Urtext vor. Er weist keine durchgehende, sondern eine kapitelweise Paginierung auf, was ein Zusammenfügen der unter den Autoren aufgeteilten Beiträge erleichterte. Einige Briefe, Zitate und wenige Abschnitte sind offenbar direkt der amerikanischen Druckvorlage beigefügt worden. Sie sind bis heute nicht auffindbar und mußten deshalb ins Deutsche rückübersetzt werden. Diese Aufgabe hat dankenswerterweise Monika Gripenberg übernommen. Verschollen ist ebenfalls ein Teil der Typoskripte für die oben erwähnten Auszüge, die schon in den Essaybänden der Werkausgabe abgedruckt waren. Von dort wurden sie, im Vertrauen auf die bewährte Texttreue dieses Unternehmens, in die vorliegende Buchausgabe übernommen.
Es war den Autoren wohl bewußt, daß ihre Niederschrift als Übersetzungsvorlage diente. Das Typoskript weist orthographische Flüchtigkeiten, Amerikanismen sowie stilistische Unebenheiten auf, die manchmal bereits eine gewisse Distanz zur deutschen Sprache signalisieren; außerdem voneinander abweichende Schreibweisen, welche auf die unterschiedliche Autorenschaft zurückgehen und naturgemäß in der amerikanischen Übersetzung nicht mehr erscheinen. In diesen Fällen wurde die deutsche Fassung überarbeitet und stillschweigend vereinheitlicht.
Um den Charakter als Zeitdokument zu bewahren, war für den Text und den Umfang die amerikanische Erstveröffentlichung maßgebend, wobei deren Irrtümer, soweit sie eindeutig zu erkennen waren, verbessert wurden. Einige Passagen des deutschsprachigen Typoskripts hatten seinerzeit keine Aufnahme in die Buchausgabe von 1939 gefunden.
Da Erika und Klaus Mann stets, auch in privaten Aufzeichnungen, den Titel der amerikanischen Ausgabe verwendeten, wurde dieser hier übernommen, obgleich eine dreiseitige Disposition des Werks – weniger schön – »Flucht ums Leben« überschrieben ist. Von uns hinzugefügt wurde der Untertitel »Deutsche Kultur im Exil«. Um etwas von der zeitgeschichtlichen Atmosphäre dieses außergewöhnlichen Buches auch in der deutschen Ausgabe lebendig zu erhalten, haben wir sämtliche Fotos mit ihren englischsprachigen Bildunterschriften übernommen.
Heribert Hoven
Eberhard Spangenberg
To all the Others
So gut wie jeder, der vor 1933 das repräsentierte, was man weltweit unter deutscher Kultur verstand, ist heute ein Flüchtling.
Dorothy Thompson
Vorwort
Preface
Dieses Buch zu schreiben war für uns eine schöne und schwere Aufgabe.
Es war eine schöne Aufgabe: denn wir durften von unseren Freunden und Kameraden erzählen, von vielen Menschen, die uns nahestehen; wir durften von unserer Sache sprechen – und das bedeutet: nicht nur von der Sache der Exilierten, sondern auch von der Sache der wirklichen deutschen Kultur.
Die Aufgabe, die wir zu bewältigen hatten, war schwer. Erdrückend groß ist das Material, das sich uns bietet. Unser Bericht befaßt sich vorwiegend mit den deutschen Künstlern und Intellektuellen, die ihre Heimat verlassen mußten.
Diese »Emigration« hat den Charakter einer Völkerwanderung. Es verhält sich ja keineswegs so, daß etwa im Jahre 1933 eine bestimmte Menschengruppe das Reich verlassen und in irgendwelchen anderen Ländern dauernd Unterkunft gefunden hätte. Vielmehr: seit 1933 hört diese Bewegung, diese Flucht, diese Tendenz »Weg von Deutschland! Fort vom Nazi-Barbarismus!« nicht mehr auf. Immer zahlreicher werden die, die im Reiche nicht mehr bleiben können – oder wollen. Andererseits wird der Machtbereich der Hitler-Diktatur immer größer. Vorgestern kamen die neuen Emigranten aus Österreich; gestern die aus der Tschechoslowakei; heute treffen die Opfer der neuesten Nazi-Pogrome aus den deutschen Städten ein – und wen müssen wir morgen erwarten? Vielleicht dauert es nicht mehr lange, und auch aus Straßburg oder Zürich, Amsterdam oder Kopenhagen werden die jüdischen, katholischen oder politischen Flüchtlinge sich melden … Und die italienischen Juden? Werden sie alle dazu bereit oder fähig sein, sich in Abessinien anzusiedeln?
Unter solchen Umständen kann es komplette, zuverlässige Statistiken über die Exilierten kaum geben. Nicht einmal der Begriff »Emigrant« ist klar und eindeutig festgelegt. Anfangs zählte man nur die politischen Flüchtlinge; die jüdischen galten als »Freiwillige« – obwohl diese Bezeichnung, gerade im Zusammenhang mit den neuesten deutschen Ereignissen, wie bitterer Hohn klingen muß. – Was übrigens Europa betrifft, so scheint es dort fast unmöglich, authentisch festzustellen, wie viele Flüchtlinge sich in einem Lande niedergelassen haben, da es ja gerade die Niederlassung ist, die den meisten von ihnen verboten wird. Viele – gar zu viele! – werden von einem Land ins andere gehetzt, dürfen nirgendwo bleiben, werden zu einem Vagabunden-Dasein gezwungen. Die Ruhelosen, Immer-Wandernden kann man nicht wohl katalogisieren.
Was wir versucht haben, ist: einen Querschnitt durch die Vielschichtigkeit der deutschen Emigration, ein möglichst lebendiges Bild von der Vielfalt ihrer Gesichter und ihrer geistigen Kräfte zu geben. Wir wollten zeigen und anschaulich machen: es sind nicht einzelne Personen, die aus irgendwelchen Gründen vertrieben wurden. Opfer des Nazi-Fanatismus ist vielmehr eine komplexe Kultur – die wahre deutsche Kultur, die immer ein schöpferischer Teil der europäischen Kultur und der Welt-Kultur war.
Diese Kultur ist nun also über die Welt verstreut worden. Es scheint ungeheure Schwierigkeiten zu machen, ihre Repräsentanten aufzunehmen, ihnen ein neues Wirkungsgebiet zu gewähren. In diesem historischen Augenblick, da das Problem der »refugees« wieder von so furchtbarer Aktualität ist, sollte man nicht vergessen, was viele Länder im Laufe ihrer Geschichte Emigranten, politischen oder religiösen Flüchtlingen zu verdanken hatten. Vielleicht erklärt sich aus historischen Reminiszenzen solcher Art die besondere und dankenswerte Gastlichkeit, mit der die Vereinigten Staaten von Amerika unsere Kameraden empfangen. Man erinnert sich vielleicht in Amerika: es sind Emigranten, die dieses Land groß gemacht und ihm immer wieder neues Leben zugeführt haben … Viele von den Deutschen, die nach dem Jahre 1848 Zuflucht und Asyl im Land der Freiheit und der »unbegrenzten Möglichkeiten« gefunden haben, sind gute, hoch geachtete amerikanische Bürger geworden. Mögen auch die deutschen Dichter und Forscher, Musiker und Philosophen, Schauspieler und Maler, Regisseure und Architekten, Ärzte und Anwälte, Ingenieure und Handwerker, die es – wie ihre Vorfahren – in Deutschland nicht mehr aushalten konnten, sich in ihrer neuen Heimat bewähren – wie ihre Großväter es so wacker getan haben.
Die Welt ist voll vom Lärm der Nazi-Propaganda. Mit dem »gigantischen« Reklame-Apparat des Doktor Goebbels können und wollen wir nicht konkurrieren. Auch brauchen wir keine Reklame. Wir wollen nur der Welt möglichst genau und ganz aufrichtig zeigen, was wir sind; was wir können; was wir wollen. Unter uns sind Menschen sehr verschiedener Art und Gesinnung. Die meisten möchten nützliche Bürger eines anderen, freieren Landes werden – ohne darüber ihre unglückliche, erniedrigte Heimat gänzlich zu vergessen. Einige von ihnen haben Großes geleistet; andere bereiten sich vielleicht auf bedeutende Leistungen vor. Sie alle gehen durch eine bittere Schule. Solche, die unreif oder oberflächlich waren, als sie Deutschland verließen, werden reifer in der harten Zeit des Exils. Sie lernen schätzen, was man ihnen in der Heimat gestohlen hat: die Freiheit!
ERIKA UND KLAUS MANN
New York City, November 1938
Rockefeller Center Observation Roof
ALBERT EINSTEIN
›Exiled into Paradise!‹
Prolog
Interview mit uns
We are Interviewed
Es ist in einer kleinen Stadt des amerikanischen Mittleren Westens. Wir halten uns hier nur ein paar Stunden auf, zwischen den Zügen. Uns ist ein wenig traurig zu Sinn; es regnet, und ein kalter, aggressiver Wind fährt durch die Straßen. Wir haben uns eine Stube gemietet, weil das Wetter so schlecht und wir zu herabgestimmt sind, um es am Bahnhof oder im Kino auszuhalten.
Klaus sagt: »Wir müssen schleunigst nach Neuseeland telegraphieren, – es wird schrecklich teuer sein.« »Nach Neuseeland?« fragt Erika. »Warum in aller Welt sollten wir nach Neuseeland telegraphieren?« »Ach«, erwidert Klaus, »ich habe Dir noch nicht gesagt, Freund Anton ist in Neuseeland und möchte dort an irgendwen empfohlen sein.« Erika scheint kaum verwundert. »Soso«, macht sie bloß, »Anton ist jetzt also in Neuseeland.«
Anton, das ist ein Freund aus München, ein Schriftsteller und Philosoph, viel älter als wir, übrigens halb-erblindet, und es war schwer genug für ihn, sich in München zurechtzufinden.
Wir schreiben das Telegramm auf und schicken es nach Neuseeland. »Gib einmal die Landkarte her!« sagt Klaus, da dies erledigt ist. »Wo sind wir hier? In X., richtig; und gar nicht weit von hier, 400 Meilen oder so, liegt Y.« Erika versteht. »O«, sagt sie, »Y. Dort sitzt unsere Freundin Anna und kocht.« Anna ist Doktor der Philosophie; sie hat in Heidelberg ihre Examina gemacht und war schon wohlbestallte Professorin, als Hitler zur Macht kam. Nun ist sie Köchin bei freundlichen Menschen in diesem Örtchen Y. im tiefsten amerikanischen Mittelwesten. »Und wieviele, die noch auf deutschen Lehrstühlen sitzen, beneiden sie um ihren schönen Posten.« Klaus stellt es ohne Ironie fest; es ist die Wahrheit. »Ich glaube sogar«, fügt Erika hinzu, »daß viele Emigranten, denen in Europa das Arbeiten verboten ist, unsere Anna beneiden. Sie verdient sich doch ehrlich ihre Existenz und darf sich obendrein frei bewegen. Unser August dagegen schreibt aus dem Haag, wo er vorübergehend von der Mildtätigkeit seiner Freunde lebte, daß er, da er natürlich im Haag nicht bleiben durfte, kürzlich nach Paris reisen wollte. Sein Visum hatte er, aber das belgische Durchreisevisum konnte er nicht kriegen. Was tat er? Er fuhr zu Schiff. Auf einem großen holländischen Übersee-Dampfer fuhr er von Rotterdam nach Le Havre. Es ist zu verrückt!«
Ja, es ist verrückt. Und wenn der Erdteil Europa nicht selber verrückt sein sollte (was noch sehr dahinsteht), das Leben unserer Freunde, der Exilierten, in ihm ist es jedenfalls. Im Grunde, so stellen wir fest, haben alle Emigranten in allen europäischen Ländern drei große Lebensaufgaben, drei Pflichten, denen sie nachkommen müssen, wollen sie nicht an Hitler ausgeliefert werden. Die Pflichten heißen: (1) nicht arbeiten, (2) nicht der öffentlichen Wohlfahrt zur Last fallen, (3) und vor allem, nicht bleiben. Ist es nicht verrückt?
Aber ist nicht auch, daß wir hier sitzen, ein wenig verrückt? Gehören wir hierher, in dies fremde Zimmer dieser fremden Stadt? Gestern haben wir, vierzig Stunden entfernt von hier, einen Vortrag gehalten, in einer fremden Sprache; heute müssen wir uns trennen. Erika fährt weiter nach dem Westen, Klaus reist in nördlicher Richtung.
Es wird allmählich dämmrig in unserem kleinen Zimmer, aber wir mögen das Licht nicht andrehen, uns ist verzagt zu Mute. »Daß man keinen Menschen hier kennt!« sagt Klaus. »Nicht einen einzigen. Es wäre doch hübsch, wenn jetzt jemand käme, – irgendein freundliches Gesicht sich zeigte; es wäre gut, wenn einer käme und berichtete etwas Angenehmes.« Erika nickt. »Oder«, sagt sie, »wenn es schon nichts Angenehmes zu berichten gäbe, – er ließe uns erzählen. Manchmal kommt mir vor, alles könnte ein Spürchen klarer und leichter werden, wenn man wenigstens erzählen dürfte.« Klaus lacht. »Ein Interviewer müßte her!« sagt er. »Gib es nur zu, Du sehnst Dich ganz einfach nach der Presse!« Aber Erika ist ernst geblieben. »Ein Interviewer«, sagt sie, – »schon recht; aber kein gewöhnlicher Interviewer dürfte es sein; ich sehne mich nach dem idealen Interviewer.«
Das Telephon klingelt. Klaus meldet sich und legt nach kurzer Pause etwas bestürzt den Hörer wieder hin. »Er ist da«, sagt er, »Dein Interviewer ist zur Stelle.«
In überraschender Geschwindigkeit hat der Interviewer die vierzehn Stockwerke im Lift zurückgelegt und klopft schon an die Tür.
Er ist sehr gutaussehend: groß, dunkles Haar, helle Augen, – man könnte nicht sagen, welches Alter er hat, denn einerseits wirkt er jung und elastisch, andererseits eignet seinem Wesen eine gewisse vertrauenerweckende Ruhe, eine feine Gelassenheit und Balanciertheit, wie gute Menschen sie haben, die in Ehren grau geworden sind. Seinen Fragen merkt man das wirkliche Interesse, die warme Anteilnahme an. Dabei sind sie niemals aufdringlich, es fügt sich von selbst, daß wir ihm beinahe alles erzählen, was wir von uns wissen. Er spricht Deutsch zu uns, – mit dem Akzent unserer bayrischen Heimat. Das stimmt uns zutraulich. Etwas überraschend ist, daß er »Du« zu uns sagt, denn wir erinnern uns nicht, ihn je vorher gesehen zu haben. Wir spüren aber, daß es ihm irgendwie zukommt, und möchten nun auch gar nicht mehr, daß er uns anders anredete.
Als erstes stellt er eine rechte Interviewer-Frage, er wünscht, daß wir allmählich Vertrauen zu ihm fassen, und will nichts überstürzen.
»Welches ist Deine Lieblings-Stadt?« sagt er und wendet sich an Erika.
Erika sagt: »München. Ich bin dort geboren und aufgewachsen. Bis zu meinem achtzehnten Jahr habe ich nirgends als dort gelebt. München ist wunderschön. Ich habe die alten Häuser dort sehr geliebt und die Berge, die beinahe bis in die Stadt wachsen. Sogar die Schule war lustig in München. Ich bin immer sehr faul gewesen, aber ich wußte mit den Lehrern umzugehen. Außerdem war ich gut in Deutsch und Mathematik. Während des Krieges und nachher in den Revolutions- und Inflationsjahren hatten wir beinahe nie genug zu essen. Wir gingen auch immer barfuß, weil es keine Schuhe gab, vom Frühling bis spät in den Herbst hinein. Wir waren unzertrennlich voneinander – und von unseren Fahrrädern, auf denen wir immer in München unterwegs waren.«
Der Interviewer: »Was wolltest Du werden, als Du noch ein Kind warst?«
Erika: »Ich wollte immer Schauspielerin werden. Wir haben viel Theater gespielt in München; da wir damals schon vier Kinder waren, stellten wir allein eine ganze Truppe dar. Mit unseren Freunden führten wir die schönsten Stücke auf, Was Ihr wollt oder Minna von Barnhelm. Unsere Freunde, das waren die Töchter von Bruno Walter, der unser Nachbar und seinerseits mit unsern Eltern intim befreundet war. Ich spielte den Wachtmeister Werner und sah, mit einem schwarzen Schnurrbart um den Mund, meinem Vater sehr ähnlich.«
Der Interviewer: »Wann hast Du angefangen, Dich für Politik zu interessieren?«
Erika: »Ich habe mich in Deutschland beinahe bis zuletzt gar nicht für Politik interessiert. Ich war der irrigen Auffassung, daß Politik Sache der Politiker wäre und daß ich mich in fremder Leute Angelegenheiten nicht mischen sollte. So haben viele bei uns gedacht, und so kam Hitler zur Macht.«
Der Interviewer: »Als Du mit der Schule fertig warst – es war ein Skandal, daß man Dich das Abitur bestehen ließ; Du warst in keiner Weise genügend vorbereitet – gingst Du, nicht wahr?, zum Theater zu Max Reinhardt nach Berlin. Dort bliebst Du ein Jahr, – dann kam Bremen, und dann Hamburg. Warst Du glücklich in Hamburg?«
Erika (der nicht so unheimlich zumute ist, wie es natürlich wäre – denn woher weiß der Mensch dies alles so genau?): »Glücklich? Doch, ich hatte geheiratet in Hamburg, wie Sie zu wissen scheinen. Mein Gatte war Schauspieler, wie ich. Er war sehr begabt und anziehend. Wir haben viele schöne Sachen zusammen gespielt. Er hieß Gustaf Gründgens. Heute ist er Chef der Berliner Staatstheater und ein großer Nazi.«
Der Interviewer: »Ihr ließt Euch scheiden?«
Erika: »Ja, sein Charakter war nicht besonders erfreulich. Daher konnte er auch Nazi werden, obwohl er vorher sehr links gestanden hat. Wir ließen uns scheiden. Ich ging heim nach München, trat dort am Staatstheater auf und an den Kammerspielen. Ich spielte die Königin im Don Carlos oder die Heilige Johanna von Shaw. Ich liebte die Bühne über alles. Trotzdem fuhr ich viel mit dem Auto in der Welt herum.«
Der Interviewer: »Warum hat Ford Dir ein Auto geschenkt?«
Erika: »Weil ich ein Rennen für ihn gefahren hatte, eine Zehntausend-Kilometer-Fahrt durch Europa in zehn Tagen. Verzeihen Sie, woher wissen Sie das mit dem Auto?«
Der Interviewer (ohne auf Erikas Frage einzugehen): »Du hattest für Ford einen ersten Preis gemacht, und zur Belohnung hat er Dir das Auto geschenkt?«
Erika (nickt benommen) : »Außerdem hatte ich von den Etappen meine Berichte an die Zeitung telephoniert. Ich schrieb damals auch schon, – kleine Aufsätzchen und Geschichten.«
Interviewer: »Und Euer Buch Rundherum?«
Erika: »Ja, richtig. ›Rundherum‹ sind wir auch gefahren; rund um die Erde, die uns damals herrlich erschien. Die Fremde ist herrlich, solange es eine Heimat gibt, die wartet.«
Der Interviewer: »Hast Du lieber geschrieben oder lieber Theater gespielt?«
Erika: »Am allerliebsten wollte ich beides tun. Ich wollte aufführen, was ich selber geschrieben hatte.«
Der Interviewer: »Du fingst an, Theaterstücke herzustellen?«
Erika: »Es sollte mich wundern, wenn Sie die Pfeffermühle nicht kennen, das kleine politisch-literarische Theater, das ich dann gegründet und geleitet habe, da Sie doch sonst so erfreulich vertraut sind mit meinem Leben. Übrigens war sie in Europa recht bekannt, die Mühle. Es gab 1034 Vorstellungen in Europa, noch nach Hitler; bis der Protest der deutschen Regierung dem ein Ende setzte.«
Interviewer (lacht leise): »Ich weiß, natürlich weiß ich. Aber sag mir, wie es kam, daß Du Dich mit einem Mal für Politik interessiertest, was war geschehen?«
Erika: »Hitler war nahe. Wir kannten ihn, und wir wußten, daß er den Untergang bedeuten würde. Viel zu spät haben wir unsere Kräfte gegen ihn gespannt, unsere viel zu schwachen Kräfte.«
Interviewer: »Wann habt Ihr Deutschland verlassen, unter welchen Umständen? Was habt Ihr gedacht dabei? Wußtet Ihr, daß Ihr Euer Land lange, lange nicht wiedersehen würdet?«
Erika: »Wann werden wir es wiedersehn?«
Der Interviewer: »Ich bin es, der die Fragen stellt, nicht Du.«
Erika: »Nach dem Reichstagsbrand wurden viele unserer Freunde verhaftet, – aber uns war noch immer nicht klar, was Terror ist und wie völlig er herrscht. Ich ging in den Straßen von München umher und erzählte jedem, der es hören wollte, die Nazis hätten den Reichstag angezündet, und nun gäben sie die Schuld den Kommunisten. Das allein hätte mich das Leben kosten können (aber da war, außerdem, die Pfeffermühle). Erst als der Ritter von Epp als Hitlers Statthalter in München einzog und als von allen öffentlichen Gebäuden unserer ehrwürdigen Stadt die Hakenkreuzfahne wehte, die wir seit so langem kannten, als Sinnbild der dummen, mordlustigen Barbarei, entschlossen wir uns zur Flucht.«
Der Interviewer: »War es ein schwerer, ein schrecklicher Entschluß? War es bitter, ihn zu fassen?«
Erika: »Nein, es war nicht bitter. Bitter war, daß das Hakenkreuz herrschte. Wo es aber herrschte, konnte man nicht bleiben. Wegzugehen war nicht bitter.«
Der Interviewer: »Und Eure Eltern? Waren sie in München damals?«
Erika (sieht ihn tadelnd an): »Sie wissen natürlich besser als ich, daß unsere Eltern damals zufällig in der Schweiz gewesen sind. Wir riefen sie an und sagten ihnen, das Wetter sei unfreundlich und gescheiter wäre es, jetzt nicht zurückzukommen. Sie weigerten sich lange zu verstehen. Es wurde ein teures Telephongespräch, denn das Wetter in Arosa war ebenfalls schlecht, und unsere Eltern wollten durchaus die Heimreise nicht vertagen. Erst als wir versprachen, uns unsererseits der häßlichen Witterung nicht länger auszusetzen, in die Schweizer Berge zu kommen und dort deutlich zu reden, ließen sie sich gewinnen.«
Der Interviewer: »Du hast München nicht wiedergesehen, seit Du es an jenem 12. März des Jahres 1933 verließest?«
Erika: »Doch, ich bin zurückgegangen. Viel später war ich noch einmal in München.«
Der Interviewer: »Aus Narretei?«
Erika: »Ich glaube nicht. Mein Vater hatte das Manuskript seines Josephs-Romanes in unserem Haus an der Isar gelassen, als er sich für ein paar Ferienwochen, wie er meinte, nach Frankreich und in die Schweiz begab. Das Haus wurde bewacht und bespitzelt. Uns war verboten, von unserem Besitz das Kleinste kommen zu lassen, alles sollte nun den Nazis gehören. Gut – oder vielmehr, schlecht. Nur das Manuskript wollten wir ihnen nicht lassen.«
Der Interviewer: »Du fuhrst zurück?«
Erika: »Ich fuhr zurück. Eine dunkle Brille setzte ich auf und meinte, sie würde mich unkenntlich machen. In Wirklichkeit machte sie mich nur auffällig. Aber so dumm ist man. Es war ungemütlich. Und den Augenblick, in dem ich, meinen treuen alten Hausschlüssel benutzend, das Tor aufsperrte, ohne daß die Nazi-Wache es merken durfte, – und den anderen, in dem ich die Treppen hinaufschlich, auf denen so viele Szenen meiner Kindheit sich abgespielt haben, das dicke Manuskript zu mir steckte und diebisch leise in mein Zimmer lief mit dem Schatz, werde ich so leicht nicht vergessen. In meinem Zimmer blieb ich ein paar Nachtstunden in völliger Dunkelheit. Auf der Straße durfte ich mich nicht blicken lassen, bei meinen Freunden durfte ich mich nicht melden, um sie nicht in Ungelegenheiten zu bringen. Zwischen ein und zwei Uhr morgens schließlich machte ich mich auf den Weg.«
Der Interviewer: »Und warst nicht froh, daheim zu sein, wenn auch nur für eine unruhevolle Nacht?«
Erika: »Es war eine abscheuliche Nacht. Die Nazis feierten gerade ein Fest. Sie waren betrunken auf allen Gassen unterwegs. Ich lief hinaus vor die Stadt, wo mein kleiner Wagen stand, der zu wohlbekannt war, als daß ich ihn hätte mit hereinnehmen können. Den Hut tief in die Stirn gezogen, in einen weiten Regenmantel gehüllt, war ich auf der Suche nach einem schützenden Taxi und fand keines, das nicht voll von Nazis gewesen wäre.«
Der Interviewer: »Aber der Coup glückte?«
Erika: »Er glückte. Ich packte das dicke Manuskript, in Zeitungspapier eingewickelt, unter den Sitz meines braven Ford zu den öligen Werkzeugen. An den Grenzen herrschte damals die fürchterliche Ordnung noch nicht, die mich heute, zeigte ich mich dort, das Leben kosten würde. Die Beamten, zu denen ich bayrisch sprach, sagten, daß sie es wohl verstünden, wenn ich eine Bergtour machen wollte, es sei begreiflich.«
Der Interviewer: »Du selber hattest gar nichts geschrieben, nicht das kleinste Manuskriptchen, das Dir der Rettung wert erschienen wäre?«
Erika: »Ich hatte gerade ein Kinderbuch veröffentlicht, einen Abenteurer-Roman für Kinder, Stoffel fliegt übers Meer, der es innerhalb dreier Monate auf zehntausend Exemplare gebracht hatte. Eine andere Erzählung für Kinder plante ich erst. Ich nahm sie im Kopf mit über die Grenze.«
Der Interviewer: »Hast Du viele Freunde durch Hitler verloren?«
Erika: »Meine besten Freunde leben in der Verbannung. Viele hat man in Deutschland eingesperrt oder umgebracht. Manche haben sich ›gleichschalten‹ lassen. Aber mit ihnen geht es, wie mit dem Ganzen: es ist abscheulich, daß Hitler sie hat, da er sie aber hat, ist die Trennung von ihnen nicht schwer, und meine Freunde sind sie gewesen.«
Der Interviewer: »Du hast ungezählte Geschwister, wo sind sie?«
Erika: »Sie haben sie gewiß gezählt, – es sind fünf. Zwei von ihnen sind noch sehr jung, neunzehn und zwanzig Jahre alt, beide Musiker. Michael will Geiger werden, und Elisabeth spielt mit Leidenschaft und Talent Klavier. Die Nächstjüngste heißt Monika. Sie ist im Begriff, einen jungen ungarischen Kunsthistoriker zu heiraten. Dann kommt Golo, Doktor Golo, der sehr klug und gelehrt ist. Als Hitler kam, ging er nach Frankreich, wo er als Professor in der École supérieure St. Cloud bei Paris und an der Universität Rennes tätig war. Jetzt ist er in Amerika und wird an verschiedenen Colleges Vorträge historischen und philosophischen Charakters halten.«
Der Interviewer: »Und Deine Mutter? Mir ist, als hättest Du mir von Deiner Mutter noch gar nicht gesprochen?«
Erika: »Von ihr müßte ich stundenlang erzählen.«
Der Interviewer: »Ich habe sehr viel Zeit. Ich kenne auch Deine Mutter und weiß, daß sie wunderbar ist.«
Erika: »Nicht wahr? Ich glaube, daß sie ganz ungewöhnlich ist. Aber vielleicht glaubt das jeder von seiner Mutter.«
Der Interviewer: »Immerhin ist ungewöhnlich, was sie leistet. Sechs Kinder in Zeiten wie diesen. Dabei ist sie zart von Natur. Wenn ich mich recht erinnere, war sie ziemlich krank nach dem Krieg. Sie wog nur neunzig Pfund und mußte in ein Lungensanatorium gebracht werden. Kennst Du die Briefe, die sie aus Davos an Deinen Vater geschrieben hat? Er hat vieles von ihrem anschaulichen Inhalt im Zauberberg verwendet.«
Erika: »Nein, die Briefe kenne ich nicht. Ich wußte nicht, daß außer meinem Vater sie jemand kennt.«
Der Interviewer: »Wir haben Deine Mutter damals auch dort besucht. Sie sehnte sich sehr nach ihren Kindern.«
Erika: »Wir haben ihr, fürchte ich, immer ziemlich viel Kummer gemacht. Aber sie ist für jeden von uns beinahe das Beste im Leben. Und jeder von uns ist ihr ›Liebling in seiner Art‹. Das ist einer von ihren tröstlichen Scherzen.«
Der Interviewer: »Sie findet Zeit, einen jeden von Euch zu betreuen und außerdem die Sekretärin, Managerin und Gehilfin Deines Vaters zu sein? (Ohne nach der Uhr zu sehen.) Es ist jetzt vier Minuten nach sechs. Ich muß nicht fort. Ich habe Zeit, – aber Dein Zug, nicht wahr, geht um sieben Uhr, Klaus hat Zeit bis acht Uhr.«
Erika: »Himmlische Güte. Das ist richtig. Und ich habe beinahe noch nichts erzählt. Kennen Sie meinen Gatten?«
Der Interviewer: »Wystan Auden? Ich bin mit ihm in Spanien gewesen. Auch nach China habe ich ihn begleitet. Als ihr heiratetet, war ich verhindert. Das war vor zwei Jahren, wenn ich nicht irre.«
Erika: »Ja, in einem kleinen Ort in England. Er war damals Lehrer in einer Landschule. Er lehrte die kleinen Jungens: How to write and to speak English.«
Der Interviewer: »He knows, how to write English. Viele von seinen Gedichten sind herrlich. Ich fürchte, Du wirst oft gar nicht ganz im Stande sein, das zu ermessen, aber seine Stücke solltest Du lieben, sie sind schlichter im Sprachlichen, aber auch in ihnen ist diese Mischung aus reiner Poesie und Sorge um den Zustand der Welt. Er ist ein Lyriker mit sozialem Gewissen, ein Dichter mit pädagogischer Verantwortung, ein Träumer, der die Verpflichtung spürt, hinunterzusteigen in die düsteren und unfreundlichen Gefilde, in denen Politik gemacht wird.«
Erika: »Sie kennen ihn gut. Er wird bald nach Amerika kommen, hoffe ich. Gemeinsam wollen wir arbeiten, Vorträge halten, herumreisen.«
Der Interviewer: »Du bist viel herumgereist in diesen Jahren. Erst in Europa …«
Erika: »Wir waren mit der Pfeffermühle in Holland und in der Schweiz, in Österreich und der Tschechoslowakei, in Belgien und sogar in Luxemburg. Das hat aufgehört.«
Der Interviewer: »In Zürich ist es eines Tages ziemlich blutig zugegangen. Die Schweizer Nazis hatten auf Veranlassung und mit Hilfe der Deutschen einen großen Skandal gemacht, der sich vierzehn Tage lang jeden Abend wiederholte. Ich erinnere mich, daß man scharf geschossen hat und daß die Polizei Dir nicht mehr erlaubte, daheim zu wohnen. Du solltest unterwegs entführt und über die deutsche Grenze geschleppt werden.«
Erika: »Ja, es war ein richtiger Krieg. Als wir ihn gewonnen hatten (denn uns in die Flucht zu schlagen, war den Scharfschützen nicht gelungen), verfügte ein neues Gesetz, daß wir in Zürich nicht mehr spielen dürften. Wir waren Ausländer und also in jedem Fall schuld, wenn es Unzuträglichkeiten gesetzt hätte. Auch in den anderen Ländern führten die Dauerbeschwerden der deutschen Botschaften allmählich dazu, daß wir ›verboten‹ wurden. Wir hatten die Nazis vier Jahre lang zu sehr geärgert, denn wir hatten ein großes Publikum, das uns anhing, in allen Städten und Städtchen, in denen wir spielten.«
Der Interviewer: »Ausgebürgert hat man Dich auch?«
Erika: »Freilich, und zwar, als ich durch Auden schon Engländerin war. Hitler scheut vor nichts zurück und wird nächstens den Papst exkommunizieren lassen.«
Der Interviewer: »Nach Amerika bist Du im Herbst 1936 gekommen?«
Erika: »Seitdem lebe ich hier. Ich liebe Amerika.«
Der Interviewer: »Danach habe ich Dich nicht gefragt.«
Erika: »Aber ich möchte es sagen. Ich habe so viele Freunde hier. Zum ersten Mal seit der Flucht aus Deutschland bin ich irgendwo beinah zu Hause. Ich habe auch viel gearbeitet, Vorträge gehalten und ein Buch geschrieben.«
Der Interviewer: »Ein Buch mit einem traurigen Gegenstand.«
Erika: »Ich war wochenlang krank, als ich anfing, School for Barbarians zu schreiben. Es ist arg genug, Nazi-Zeitungen für Erwachsene zu lesen. Aber zu sehen, mit welch scheußlichem Gift man die Kinder dort speist, ist eine wirkliche Qual.«
Der Interviewer: »Ich bin Dir, meine Liebe, für Deine Mitteilungen sehr zu Dank verpflichtet.«
Erika: »Jetzt kommt Klaus an die Reihe. Aber wir dürfen die Züge nicht versäumen.«
Der Interviewer: »Klaus soll erzählen. Ich werde ihn durch Fragen nicht aufhalten.«
(Es ist im Zimmer ziemlich dunkel geworden. Die Gestalt des Interviewers verschwimmt ein wenig vor unseren Blicken.)
Das Folgende hatte Klaus dem Interviewer zu sagen:
»Ich werde im Herbst des Jahres 1938 zweiunddreißig Jahre alt. Zurückblickend erscheint mir der Weg schon ziemlich weit bis hierher, und doch könnte er ungefähr noch einmal so weit sein, wenn nichts Besonderes dazwischenkommt. Vielleicht befinde ich mich erst kaum auf der Mitte des Weges; vielleicht ist auch das Ende schon nahe. Es könnte überraschend schnell da sein, und sein Antlitz könnte grauenvolle Züge haben. Wir tun gut daran, stets mit seinem plötzlichen Kommen zu rechnen. Übrigens haben die Verhältnisse, unter denen wir aufgewachsen sind und heute leben, uns das Vertrauen in die Stabilität des Bestehenden genommen. Das Bestehende ist nicht stabil. Es schwankt. Wir haben sein Schwanken unter den Füßen gespürt, als wir kaum zu leben und zu denken begannen. Das war eine etwas schauerliche Impression, dabei nicht ganz unamüsant: etwa dem halb belustigten und doch sehr tiefen Schrecken vergleichbar, den man bei einem Erdbeben empfindet.
Meine Jugend – eine Kriegs- und Nachkriegs-Jugend – war etwas unordentlich. Die geistigen Interessen fingen an, bei mir dominierend zu werden, als ich in Berührung mit der Sphäre der deutschen Jugendbewegung kam. Dieser Kontakt stellte sich her in zwei Landschulen – Freien Schulgemeinden –, die ich besuchte. Auf Wanderungen mit empfindsamen Gleichgesinnten oder in einer etwas hektisch erregten Einsamkeit begeisterte ich mich für Nietzsche und Walt Whitman, für Frank Wedekind und Stefan George, für Rilke und Novalis, für die deutschen Mystiker des ausgehenden Mittelalters und die deutschen Expressionisten des Jahres 1923, für Dostojewski und den Dänen Herman Bang, der vielleicht die stärkste literarische Liebe meiner Jugend war. Natürlich schrieb ich damals selber schon, und ich hatte übrigens auch früher schon geschrieben. Ich habe geschrieben, seit ich mich erinnern kann. Als ich siebzehn Jahre alt war, fing ich an zu publizieren: zunächst in Zeitungen – ich hatte eine Stellung als Theaterkritiker an einem Berliner Mittagsblatt; aber bald kamen die ersten Bücher. Es erschien ein Band kurzer Erzählungen – Vor dem Leben –, ein erster Roman – Der fromme Tanz – und ein ›romantisches Theaterstück‹, Anja und Esther, in dem ich mit meiner Schwester und Pamela Wedekind, der Tochter Frank Wedekinds, zusammen als Schauspieler auftrat. Wir spielten das Stück, das in vielen Städten, auch außerhalb Deutschlands, gegeben wurde, lange Zeit in Hamburg; später auf einer Tournee, die wir mit einer zweiten dramatischen Produktion von mir, der Komödie Revue zu Vieren, unternahmen.
Jeder tut und schreibt als Zwanzigjähriger Dinge, die ihm peinlich sind, wenn er dreißig ist, und über die er lachen mag, wenn er das vierte oder fünfte Jahrzehnt hinter sich gebracht hat. Einem Schriftsteller muß es genügen, wenn ihm von seinen frühen literarischen Äußerungen später nicht alles abgeschmackt scheint. Ich habe, zwischen meinem zwanzigsten und fünfundzwanzigsten Jahr, einiges gemacht, dessen ich mich heute noch nicht ganz schäme. Ein kleines Buch, Kindernovelle, zum Beispiel – das unter dem Titel The Fifth Child auch unter den Englisch-Lesenden einige Freunde gefunden hat – ist mir nicht unangenehm geworden. Als ich mich, noch als halber Junge, an die Aufgabe wagte, einen Roman über Alexander den Großen zu schreiben, mutete ich mir ohne Frage zu viel zu. Das Resultat dieser gar zu ehrgeizigen Bemühung mag fragwürdig sein; immerhin fiel es so aus, daß auch eine englische Ausgabe des Buches in New York erscheinen konnte und eine französische, zu der Jean Cocteau die Einleitung schrieb.
Es kamen die Jahre der ersten Reisen und der entscheidenden Begegnungen mit Menschen. Ich verlobte mich mit Pamela Wedekind, die dann aber durchaus nicht mich, sondern den Schriftsteller Carl Sternheim heiratete und heute Mitglied der Berliner Staatstheater ist. Das Reisen, das zu Anfang Abenteuer gewesen war, wurde bald zum gewohnten Lebenszustand. Ich lebte, schon ›vor Hitler‹, mehr im Ausland als in München oder Berlin, und ich habe mehr Zeit in Hotelzimmern zugebracht als im Haus meiner Eltern. Eine eigene Wohnung habe ich nie gehabt. Eine Sammlung von literarischen Aufsätzen, Reisebriefen und Vorträgen gab ich unter dem charakteristischen Titel Auf der Suche nach einem Weg heraus. Ich schrieb Erinnerungen an meine Kindheit und nannte sie Kind dieser Zeit. Es erschienen Erzählungen und noch ein Roman und noch ein Theaterstück, das eine Dramatisierung der Enfants terribles von Cocteau war.
Die Nazis haben mich nie gemocht; die Aversion war immer gegenseitig. Erstens war ich ihnen nicht ›Blut und Boden‹-haft genug. Außerdem schrieb ich Artikel gegen sie. Ich interessierte mich, als sehr junger Mensch, für die meisten Dinge mehr als für Politik. Aber ich wußte immer, daß ich in einem Nazi-Deutschland nicht würde leben können. Ich verabscheute alles, was die Nazis repräsentieren – und die Nazis wollen alles zerstören, was mir das Leben lebenswert macht. Seit meinem neunzehnten Jahr habe ich mich öffentlich – wenn auch sicherlich noch mit schwacher Stimme und mit ungenügenden Argumenten – gegen Reaktion, Imperialismus und Militarismus, gegen Nationalismus und Ausbeutung geäußert. Die Nazis hätten mich wahrscheinlich umgebracht, wenn sie meiner hätten habhaft werden können. Ich verließ das Reich am 13. März des Jahres 1933 und habe es seitdem nie mehr betreten.
Im Exil, das nun begann, habe ich also keineswegs eine ›politische Wandlung‹ durchgemacht – wie manche Kritiker es in freundlichem oder unfreundlichem Sinne behauptet haben –; das politische Interesse hat sich nur intensiviert und vertieft, und es ist mehr ins Zentrum meines inneren Lebens getreten. Freilich war ich immer der Ansicht, daß der Kampf nicht alles ist. Uns ist aufgetragen, nicht nur das Schlechte anklägerisch zu entlarven, sondern auch das Gute nach unseren Kräften weiter zu betreiben. Unser inneres Leben würde veröden und verarmen, wenn wir uns darauf beschränken wollten, immer wieder nur zu rufen: Hitler ist schrecklich! Hitler ist miserabel! Wir haben anderes zu tun. Die Werte und Traditionen, die wir vor dem Zugriff des Faschismus bewahren wollen, müssen wir schöpferisch fortsetzen.
Trotzdem ist nicht zu vermeiden, daß oft auch noch in unseren persönlichsten und lyrischen Äußerungen die Kampf-Situation, in der wir uns befinden, spürbar wird. Eine Monatszeitschrift, Die Sammlung, die ich während zweier Jahre in Amsterdam herausgab, von Herbst 1933 bis zum Herbst 1935, sollte nicht nur die gute deutsche Literatur fortsetzen, sondern zugleich den Kampf gegen Hitler führen. Der erste Roman etwa, den ich im Exil geschrieben habe, Flucht in den Norden, ist eine psychologische Liebesgeschichte; aber das Politische spielt hinein, es steht vielleicht eigentlich im Zentrum der Komposition: etwas wie ein politischer Liebesroman ist entstanden. In einem anderen Buch, – Mephisto, Roman einer Karriere (1936) –, ist das politisch-polemische Element noch stärker. (Held der Erzählung ist jener Typus des ehemals links gesinnten deutschen Künstlers und Intellektuellen, der, aus Ehrgeiz und Opportunismus, seinen Frieden mit dem Nazi-Regime macht.) Auch in dem großen Roman, den ich jetzt vorbereitete, sollen die aktuell politischen Themen sich mit denen vermischen, die wir zeitlos nennen: mit den ewig menschlichen Themen – Liebe, Tod, Schmerz, Einsamkeit, Hoffnung. – In anderen Büchern wiederum habe ich versucht, mich der politischen Sphäre und den Problemen des Tages ganz zu entziehen, um vorübergehend eine reinere Luft zu atmen. Der Tschaikowsky-Roman Symphonie Pathétique – englisch bei Victor Gollancz, London, 1938 – handelt von Musik und von den Leiden eines großen, einsamen, sehr rührenden Menschen. Von den Leiden und vom halb grotesken Untergang einer gleichfalls rührenden, wenngleich weniger großen Persönlichkeit – des bayrischen Königs Ludwig II. – handelt eine Erzählung, Vergittertes Fenster (1937).
Die deutsche Regierung hat mich ausgebürgert – eine etwas hilflose und sogar leicht komische Geste, wenn man bedenkt, welches Maß von Zorn sie ausdrücken sollte. Ich bin Bürger eines anderen Staates, der Tschechoslowakischen Republik, geworden. Ich lebe in vielen Ländern – in Frankreich, in der Schweiz, in Holland, am meisten in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich habe nicht das Gefühl, heimatlos zu sein; erstens, weil die deutsche Heimat, als innerer Besitz, unverlierbar ist; dann aber auch, weil ich niemals nur Deutschland als meine Heimat empfunden habe.
Weder die Spiele noch die Schmerzen lassen mich je vergessen, wie unerbittlich der Ernst der Lage und wie groß meine Verantwortung ist. Jeder antifaschistische deutsche Schriftsteller muß heute seine Kräfte bis zum äußersten spannen, und ich weiß mich, aus besonderen Gründen, besonders dazu verpflichtet. – Wenn der Sohn eines großen Schriftstellers seinerseits Bücher schreibt, zucken viele die Achseln. In Frankreich kommt es häufiger vor, daß ganze Familien literarisch produktiv sind; in Deutschland ist es selten gewesen und galt beinah als etwas unschicklich. Auch in der übrigen Welt ist die Mischung aus einer etwas herablassenden Protektion und Über-Kritik, mit der man dem Sohne eines berühmten Mannes meistens begegnet, eher hemmend als fördernd. Damit muß man fertig werden. Jeder muß mit seinem Schicksal fertig werden, und jedes hat seine Komplikationen. – Kommt man zum Ziel? Die Frage ist, was man unter Ziel versteht.
Mir scheint oft, ich kann das meine schon nicht mehr völlig verfehlen. Die Leiden und die Aufschwünge, die Enttäuschungen und die Stunden eines kurzen, aber gerade deshalb sehr süßen Glückes sind schon zu überreichlich für mich da gewesen, als daß alles sinnlos gewesen sein könnte. Die skeptische Frage: Wozu das alles? – habe ich immer als frivol und platt empfunden. Das Leben, samt all seinen Anstrengungen, Beglückungen und dem Übermaß seiner Qualen, muß seinen rätselhaften Sinn in sich selber haben. Da in dieser Schöpfung keine Kraft verlorengeht – warum sollten die Kräfte unseres Herzens sich ziellos verirren und ganz verloren sein? Wenn mich am Schluß jemand fragte – ein Erzengel oder ein ›idealer Interviewer‹ –: Hast du gern gelebt? – dann werde ich, noch erschöpft von den Strapazen dieses Daseins oder schon erfrischt von Wonnen, die dem Sterblichen unvorstellbar sind, die Antwort geben: Dieses Erdenleben war eine niederträchtige Angelegenheit. In aller Ewigkeit werde ich dankbar dafür sein, daß ich es so gründlich mitmachen durfte.
Denn, höchst seltsamer Weise, kann so ein vergänglicher Mensch, der sein Leben, Minute für Minute, Jahr für Jahr, zu bestehen hat wie ein hartes Pensum, sich nichts Ärgeres und nichts Schöneres vorstellen als sein Leben.«
Schauplatz Europa
The European Scene
Kapitel IDer Reichstag brennt!
The Reichstag’s on Fire!
Der Februar 1933 war für unsere Stadt München ein merkwürdiger, ja ein guter Monat gewesen. Am 30. Januar war Hitler Reichskanzler geworden, er saß in Berlin und regierte. Aber, das wußten wir alle, er »hatte« die Katholiken »nicht«. Das katholische Bayern, das einer in Preußen zentralisierten Regierung in jedem Fall abgeneigt gewesen wäre, – das Regime Adolf Hitlers lehnte es mit besonderer Heftigkeit ab. Nicht nur, daß dies Regime antichristlich war, – es war zu wohl bekannt in Bayern. Sein »Führer« hatte in München seine politische Tätigkeit begonnen, – hier hatte er die Versammlungen und die Putsche seiner politischen Jugend abgehalten, und hier hatte er sein Ehrenwort gebrochen (sich nach der Haftentlassung aus der Festung Landsberg jeder politischen Betätigung zu enthalten). Die Bayern wußten, wer dieser Adolf Hitler war, und sie verachteten ihn. Während also das Schreckensregiment des neuen Kanzlers in Nord- und Mitteldeutschland auf keinen nennenswerten Widerstand stieß (die materielle Situation war schlecht gewesen, vorher, und vielleicht würde sie jetzt besser werden; das deutsche Volk, politisch unerzogen und romantisierend, sehnt sich nach irgendeinem Erlöser), verhielt Bayern sich feindselig. »Wenn Hitler es wagen sollte, uns einen Reichskommissar aus Preußen zu schicken, dann werden wir ihn wegen Landfriedensbruch an der bayrischen Grenze verhaften lassen!« erklärte Ende Februar der bayrische Ministerpräsident Held, während seine Anhänger jubelten.
München war lustig im Februar 1933, es war trotzig und überdies war es einig. Sogar Gruppen, die sich bis dahin feind gewesen waren, schienen zusammenhalten zu wollen, gegen den Nazifeind. Der Lustigkeit, dem Trotz und dem Zusammenhalten kam der Umstand zugute, daß Fasching war, und im Zeichen des Karnevals, der Verkleidung und des Mummenschanz war es leicht, lustig, trotzig und einig zu erscheinen.
Am 1. Januar, neunundzwanzig Tage also vor Hitlers »Machtübernahme«, hatten wir in der ehrwürdigen alten Bonbonnière (Rücken an Rücken mit dem Hofbräuhaus, in dem der »Führer« seine Antrittsrede als Kanzler hielt) ein kleines politisch-satirisches Theater eröffnet, das Die Pfeffermühle hieß und das so großen Erfolg in München hatte, weil es die Stimmung dieser Wochen getreulich widerspiegelte, es war lustig und trotzig, und es forderte zur Einigkeit auf.
Die Vorstellung am Abend des 27. Februar war vorüber, unser kleines Haus war überfüllt gewesen, wir hatten all die Szenchen und Lieder aufgeführt, in denen wir gegen die Nazi-Diktatur zu Felde zogen, unsere Angriffe kamen maskiert daher, wir erzählten Märchen und Fabeln, aber jeder, der sie hörte, wußte, was gemeint war. Auch unsere Zuhörer im Parkett waren maskiert. Als Indianer, Rokokoherren oder Zigeunerinnen verkleidet saß unser Publikum beim Wein; Katholiken, Liberale, Sozialisten fanden sich bei uns zusammen, gemeinsam applaudierten sie uns gegen Hitler. Der Karneval war seinem Höhepunkt nahe und gleichzeitig seinem Ende. Der 27. Februar, das war der Rosenmontag, der Tag der großen Bälle. Vom Rosenmontag über den Faschingsdienstag bis zum Aschermittwoch »machte man durch« in München, an Schlaf war nicht zu denken für alle, die wußten, was Fasching ist. In dieser Nacht traf man sich auf dem großen Fest der »Kammerspiele« im Regina-Palast-Hotel. »Tout-München« war dort, das ganze künstlerisch-geistig-politisch interessierte München, – die Maler aus Schwabing, die Schriftsteller, die Schauspieler, die Universitätsleute. Waren auch Nazis unter denen, die sich im Tanze drehten? Aber sie hielten sich unerkannt, denn sie wußten, daß sie verhaßt und verachtet waren. Vielleicht, daß sie hinter schwarzen Halbmasken Verschwörerblicke tauschten, während man die anmutig verschlungenen Figuren der Française exekutierte. »Brennt es schon?« mag einer dem anderen zugeflüstert haben, und der andere darauf: »Lichterloh«, aber der Tanz ging weiter.
Es war ein ausgelassenes, ein wildes Fest, die Kehrausstimmung des sterbenden Karnevals allein gab keine Erklärung ab für so radikale, so hektische Lustigkeit. Es war nicht der Abschied vom Fasching, den wir so grimmig heiter begingen, es war der Abschied vom Leben in einem freien Deutschland, der Abschied von allem, was uns lieb gewesen war, – der Abschied von »zuhaus«. Wir wußten es nicht, aber geahnt müssen wir es haben.
»Der Reichstag brennt«, sagte der Clown zu Erika, mit dem sie Tango tanzte. »Laß ihn brennen«, sagte sie und klingelte mit den Glöckchen an seiner Kappe, »laß ihn brennen – wieso brennt er denn?« »Der Reichstag brennt … Der Reichstag brennt!« riefen im Rhythmus der Tanzmusik all die Maskierten. Dann sangen sie kleine Loblieder, die der Feuerwehr galten. »Die wird das Kind schon schaukeln!«
Einer kam von draußen mit neuen Nachrichten. »Die Kommunisten haben ihn angezündet«, sagte er, »man hat sie schon gefangen.« Wir kannten den Menschen nicht, der da zu uns trat. Über den korrekten Frack trug er einen sehr roten Domino. »Die Kommunisten?« fragten wir. Die Musik pausierte. Es war plötzlich still im Saal. »Ja«, sagte der Fremde und lachte verächtlich, »natürlich, die Kommunisten. Wer denn wohl sonst?« Dann verschwand er in der bunten Menge. Seinen roten Mantel konnte man hier und dort aufzüngeln sehen, wie ein böses kleines Feuer.
Unsere Gesichter waren fahl am Morgen dieses Faschingsdienstags. Ihre Blässe zeigte das Grauen vor dem Aschermittwoch, der nahe war. Er brach an, und der Geruch von Trümmern, Asche und Blut, den er verbreitete, liegt noch über Deutschland, jetzt, nach sechs Jahren.
Die Haftbefehle gegen jene, die beseitigt werden sollten, lagen in Berlin schon vor, vierundzwanzig Stunden ehe der Reichstag brannte. Man wollte »schlagartig durchgreifen« und keine Zeit verlieren. Da man genau wußte, wann das Feuer ausbrechen würde, das man selber gelegt hatte, war es leicht, den Augenblick zu fixieren, in dem alles eingesperrt werden sollte, was mißliebig war. Die Kommunisten, die Juden, die Sozialisten, die Pazifisten, die Freidenker, die Liberalen, sie alle gemeinsam wurden der Brandstiftung geziehen, und sie alle mußten zur Verantwortung gezogen werden. Die Menschenjagd begann, und am Morgen des 28. Februar holten die Burschen von der SA die Schlafenden zu vielen Hunderten aus ihren Betten. Viele von denen, die damals verhaftet wurden, hätten fliehen können.
Der Schriftsteller Erich Mühsam hätte fliehen können, er war gewarnt worden. Einer aus Nazikreisen hatte geplaudert, etwas Teuflisches werde sich zutragen, die Nachricht war herumgekommen. Mühsam wußte, daß er seiner Freiheit und seines Lebens kaum mehr sicher sein dürfte. Aber der vertrauensvolle, menschenfreundliche und stolze alte Mann zögerte. »Ich habe nichts getan«, erklärte er den Freunden, die dringlich zur Abreise rieten, »was gegen das Gesetz wäre. Jetzt zu fliehen, könnte aussehen wie das Eingeständnis einer Schuld. Ich bin aber unschuldig. Außerdem möchte ich hierbleiben und arbeiten, ich möchte helfen, das deutsche Volk aufzuklären über den fürchterlichen Irrtum, den es begangen hat, indem es sich vorübergehend der Barbarei auslieferte. Ich möchte nicht fort von Deutschland.«
Als die Nachrichten über das »Teuflische«, das bevorstand, sich mehrten, bestanden die Freunde darauf, daß Mühsam sich in Sicherheit brächte. Sie wußten: nicht auf Schuld oder Unschuld würde es ankommen. Mühsam, der Anarchist, der Gesellschaftskritiker und Moralist, dessen warnende Stimme seit mehr als drei Jahrzehnten nicht verstummen wollte, ihn würde die Hitler-Diktatur nicht leben lassen. Er war »unschuldig«, gewiß, unschuldig nicht nur am Nazifeuer im Reichstag, unschuldig auch der politischen Konspiration. Erich Mühsam war kein Politiker. Er hatte seinen Traum von einer freien, glücklichen und gerechten Menschheit, und er lebte ihn mit solcher Innigkeit, – seine Erfüllung forderte er mit solcher Strenge, daß jedes Regime (das kaiserliche erst, das republikanische dann) ihn unbequem finden mußte. Was aber jetzt unbequem war, das mußte sterben, da Hitler und die Seinen an der Macht waren.
Am Nachmittag des 27. Februar war es soweit. Mühsam war überzeugt, daß er gehen müsse. Geld hatte er nicht, aber ein Billett dritter Klasse nach Prag hatten die Freunde ihm besorgt. Er war dabei zu packen. Viel wollte er nicht mitnehmen, ein paar Bücher und Briefe, als ein Bursche bei ihm eintrat, einer seiner Schützlinge, ein Feind des Regimes, und hastig die Tür hinter sich schloß. Mühsam blickte auf und wurde blaß. »Du bist hier?« sagte er und: »Bist Du verrückt? Willst Du Dich umbringen lassen?« Der Bursche schüttelte den Kopf. »Ich bin nicht verrückt«, sagte er, »und keinesfalls möchte ich mich umbringen lassen, aber ich kann nicht fort, – ich habe kein Geld.«
Der Bursche hat später erzählt, wie Mühsam sich betragen hat an diesem Nachmittag. In seinem bärtigen Christuskopf sprachen die hellen Augen mit großer Dringlichkeit und Wärme. Ein paar Sekunden lang ruhte sein Blick auf dem Gesicht des Jungen. »Du würdest gehn?« fragte er. Und da der Junge nickte, zog er ein Billett aus der Tasche, das Billet dritter Klasse nach Prag, mit dessen Hilfe er sich an diesem Abend hätte retten sollen. Der Bursche fragte nicht viel. Von Mühsams Wohnung aus lief er geradewegs zum Bahnhof.
Erich Mühsam verbrachte die Nacht vom 27. zum 28. Februar statt im Schnellzug Berlin–Prag in seinem Bett. Morgens um fünf erschien bei ihm das Rollkommando der SA.
Es liegt in der Natur des »Nationalsozialismus«, daß er die Reinen, die Menschenfreundlichen und vertrauensvoll Unschuldigen am glühendsten haßt. Erich Mühsam gehörte zu jenen, die durch einen noblen Idealismus, durch einen kindlichen Glauben an den schließlichen Sieg des Guten auf der Welt, diejenigen, die mit so viel Eifer dem Schlechten dienen, ganz besonders gereizt hat. Mühsam war Jude. Aber er gehörte nicht dem aggressiv intellektuellen Typ an, den man im Deutschland von heute »zersetzend« nennt, er war eher von der Art der Propheten, weise, gütig, allumfassend. Wäre er »frech« gewesen – vielleicht hätte er es leichter gehabt. Seine Geduld und Freundlichkeit gerade brachten seine Quäler zur Weißglut. Man weiß von vielen, die dabei waren (Kameraden, die mit Mühsam die Haft teilten), wie unmenschlich gerade dieser von Anfang an gequält worden ist. Man hat ihn bespuckt und beschmutzt, man hat seinen Bart haarweise ausgerissen, man hat ihn gezwungen, Spottverse gegen sich selbst zu deklamieren, und als er sich weigerte, das »Horst-Wessel-Lied« zu singen, hat man ihn zum Tode verurteilt. Mit seinen eigenen Händen mußte der zarte Alte sich sein Grab schaufeln. Gewiß war er damals sehr bereit zu sterben, und dankbar wäre er gewesen, wenn eine schnelle Kugel das Ende barmherzig gemacht hätte. Aber die Peiniger lachten. »Noch nicht!« riefen sie, »noch lange nicht, Du Judensau!« Seiner Gattin schrieb Mühsam (ein menschlicher Wärter hat den Brief weitergegeben): » … was immer geschehe, eines dürft Ihr gewiß sein: nie, niemals werde ich mich selbst ums Leben bringen!«
Gäbe es also nicht die Zeugen, die gesehen haben, wie an einem Wintermorgen des Jahres 1937 Erich Mühsam, nachdem er unter den Peitschenhieben und Fauststößen der Hitlergarden ohnmächtig zusammengebrochen war, in die Toilette geschleppt wurde, wo man dem Halbtoten einen Strick um den Hals legte und wo man ihn an der Tür aufhängte; gäbe es nicht die Augenzeugen der Untat, dieser Brief allein und das Versprechen, das er enthält, wären Beweis dafür, daß er tierisch ermordet worden ist.
Er war ein guter Mensch, Erich Mühsam. Zu seinem Andenken setzen wir ein Gedicht von ihm her, das ergreifend ist in seiner prophetischen Leidensbereitschaft.
Gebeugte Menschen mit stumpfem Blick
Hocken in dumpfen Spelunken.
Den Neid im Auge, die Not im Genick,
Von elendem Fusel betrunken.
Da tönt eine Stimme von außen herein:
›Kopf hoch! Ihr seid nicht verloren.
Ich füll Eure Becher mit goldenem Wein.
Auch Euch ist der Heiland geboren.
Hinaus ins Freie und folgt mir nach,
Wo Schätze liegen!‹
Die Stimme des Mannes, die also sprach,
Hat plötzlich geschwiegen.
Ein Scherge führt ihn gefesselt fort. –
Den Menschen aber da drinnen
Klingt seiner Rede lockendes Wort
Wie ferner Traum in den Sinnen.
Sie senken den Kopf auf des Tisches Brett
Und trinken mit heiserem Lachen …
Ein Jude zog aus von Nazareth,
Die Menschen glücklich zu machen.
Die Menschenjagd ging weiter. »Wir sind so viele«, sagten sich hoffnungsvoll die Gefangenen, die im Berliner Columbia-Haus, in den Polizeigefängnissen und SA-Wachtlokalen überall im Land zusammengepfercht saßen, »es sind unser so viele, und wir kommen aus beinahe allen politischen Gegenden! Gewiß hat man uns nur geholt, um uns auszufragen oder um uns hierzuhaben, in diesen Tagen der Unruhe und der Unsicherheit. Wir werden freikommen, sobald alles sich geklärt und herausgestellt hat. Man kann uns doch nicht, man kann doch nicht Tausende von deutschen Bürgern, die keines Vergehens schuldig sind, auf die Dauer gefangen halten!« Diejenigen unter den Unglücklichen, die wußten, was Nazi-Herrschaft bedeutet, waren weniger optimistisch. »Doch, man kann«, sagten sie, »die Nazis können.« Ihnen antworteten die andern: »Schon mit Rücksicht auf das Ausland kann man nicht. In den Prozessen, die kommen müssen, wird offenbar werden, daß wir schuldlos sind.
Es haben Prozesse stattgefunden. In einem von ihnen ist offenbar geworden, daß der kommunistische Abgeordnete Torgler, der sich ausgeliefert hatte, als die Menschenjagd begann, vollkommen unschuldig war am Reichstagsfeuer. Torgler, ein weicher und verträglicher Mensch, der sich widerstandslos von einem Nazi-Advokaten, dem Doktor Sack, verteidigen ließ, wurde freigesprochen, »mit Rücksicht auf das Ausland«? Oder weil selbst Nazi-Richter eine Grenze kennen des offen und schamlos verübten Unrechts? Aber der Aufatmende sah die Freiheit nicht wieder.
Der Ausgang des Reichstagsbrand-Prozesses und eines andern, des kläglich mißlungenen Rundfunk-Korruptions-Prozesses, hatte den Machthabern den Spaß an derlei kostspieligen und blamablen Arrangements verdorben. Also hat man der Mehrzahl der Verhafteten den Prozeß gar nicht erst gemacht. Sie sind unschuldig, einer wie der andere. Die Unschuld des sozialdemokratischen Abgeordneten Carlo Mierendorff, der zu den Opfern der Treibjagd vom 28. Februar gehört, ist von den Hitler-Leuten niemals ernstlich bestritten worden. Ihnen war zuwider, daß er ein kluger, beredter und warmherziger Vertreter der »sozialen Demokratie« war, der sie ans Leben wollten. Also sperrten sie ihn ein, also halten sie ihn bis heute gefangen.
Auch den Vorstand der kommunistischen Partei, den Arbeiterführer Ernst Thälmann, halten sie bis heute gefangen, ohne daß sich der Richter fände, der ihn »schuldig« spräche. Dem Ernst Thälmann, der das Vertrauen der Arbeiter hatte und den seine politischen Widersacher als einen tapferen und loyalen Gegner schätzten, war nichts vorzuwerfen. Der Mann aus dem Volke, norddeutscher Quadratschädel, Hafen- und Transportarbeiter von Beruf, ganz und gar unjüdisch, ganz und gar nicht »zersetzend«, ein unerschrockener Kämpfer für die Rechte seiner Klasse im Rahmen der demokratischen Ordnung, hatte nichts, er hatte rein gar nichts verbrochen. Überdies lieferte er den lebendigen Beweis dafür – so gut wie Torgler, so gut wie Hunderte von verhafteten Kommunisten, daß Kommunismus und Judentum de facto nichts miteinander zu schaffen haben. Kaum einer von den führenden Kommunisten in Deutschland ist jüdischer Abstammung gewesen. Hitlers Fiktion vom »kommunistischen Weltjudentum« und vom »verjudeten Kommunismus« ist ebenso leicht zu widerlegen, wie seine Behauptung, daß Deutschland im Begriffe war, bolschewistisch zu werden. Seltsamer Weise nur verliert keine seiner Behauptungen von ihrer Wirkungskraft dadurch, daß sie nachweislich und vorsätzlich unwahr ist.
Ernst Thälmann – Teddy –, der populärste und integerste unter den deutschen Arbeiterführern, wird seit sechs Jahren unschuldig gefangen gehalten. Mehr: der Versuch, ihn einer Schuld zu überführen, ist von denen, die seinen Kerker bewachen, nicht gewagt worden.
Man hatte gehofft, von den Gefangenen kompromittierende Angaben über ihre Freunde und Gesinnungsgenossen erpressen zu können. Da man selber so gar nichts objektiv Nachteiliges über sie wußte, griff man zum altbewährten Mittel der Folter, um die Opfer gesprächig zu machen.
Den jungen Schauspieler Hans Otto, einen schönen und blonden jungen Heldendarsteller, einen der ganz wenigen »nordischen« Idealgestalten, welche die deutsche Bühne aufzuweisen hatte, verhaftete man, weil er Kommunist war. Vor allem aber mag man sich gesagt haben: So ein Komödiant ist aus weichem Stoff. Er wird erzählen, wenn wir ihn uns erst zugerichtet haben. Man hat ihn in wenigen Tagen derart zugerichtet, daß, so sagte uns einer seiner Mitgefangenen, seine leibliche Mutter ihn nicht würde haben erkennen können. Man hat buchstäblich versucht, ihn um den Verstand zu bringen. »Zerschlagen, zerschunden, zerstoßen, zerschnitten wie er war«, berichtete der Mitgefangene, »hatte er nur noch einen Gedanken im Kopf, einen einzigen, aber der saß fest: Ich will nicht reden, ich will nichts verraten, keinen Namen sagen, keine Adresse sagen, nichts sagen.« »Ich sehe sein Gesicht noch vor mir«, sagte uns der Freund, »sein zerstörtes Gesicht war völlig wahnsinnig vor Schmerz, – überschwemmt außerdem von Blut, Schweiß und Tränen. Als die Nazis merkten, daß dieser da nicht sprechen würde, haben sie ihn wohl aus dem Fenster geworfen. Mag sogar sein, daß er selber sich hat fallen lassen, – er war nicht mehr bei klarem Bewußtsein, – ich weiß es nicht. Fest steht nur, daß sie ihn umgebracht haben und daß er einer von unseren Besten gewesen ist.«
Gab es Zeiten, in denen das Unrecht denen Gefahr brachte, die es übten? Gab es Aufruhr in Frankreich, weil man einen Juden, einen einzelnen, zu Unrecht beschuldigt und verurteilt hatte? Aber die Moral, die von den Diktatoren kommt, ist neu! »Recht ist, was uns nützt!« ruft der Diktator. Und allen Ernstes glaubt er, daß es ihm nütze, die besten seines Landes zu morden, die Guten unter Verschluß zu halten und alle Stimmen zum Schweigen zu bringen, die anders klingen als seine eigene. Wie sehr er sich irrt! Und wie beinahe jede seiner Äußerungen, kommt auch diese der Wahrheit sehr nahe, sobald man sie in ihr genaues Gegenteil verkehrt. »Nur was recht ist, kann uns nützen!« Das ist die Wahrheit. Das schreiende Unrecht, das in Deutschland seit sechs Jahren täglich geschieht, ist nicht nur deshalb so herzzerreißend, weil es gegen Anstand und Menschenwürde geht, sondern weil es so gar nicht »nützt«, weil es so gräßlich, so tödlich schadet, weil es Deutschland und die Welt in einen Zustand versetzt, der lebensgefährlich ist.
Manchmal, ganz selten, tut die Welt eine Geste, die zeigen soll, daß sie ihrerseits den Satz »Recht ist, was uns nützt« nicht billigt. Solch eine Geste lag in der Verleihung des Friedens-Nobel-Preises an den Märtyrer des Hitler-Regimes, Carl von Ossietzky.
Ossietzky, Nachfahr einer alten aristokratisch-preußischen Offiziers-Familie, war Pazifist. Der begabte und leidenschaftliche Mensch hatte sich niemals »links«, er hatte sich nie im Sinne des Marxismus betätigt. Als verantwortlicher Leiter der Zeitschrift Die Weltbühne





























