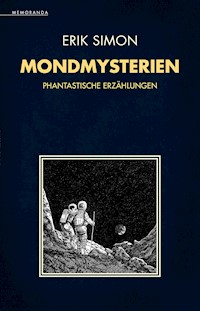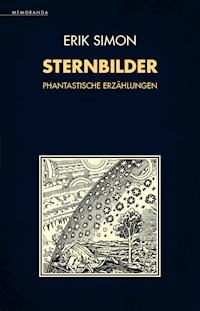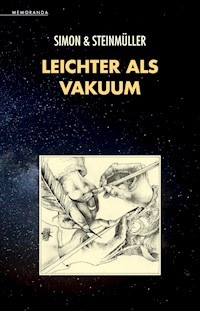Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Memoranda Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Simon's Fiction
- Sprache: Deutsch
Die älteste Kurzgeschichte in Band 4 von "Simon's Fictio"n entstand 1971; die weitaus meisten Beiträge stammen jedoch aus den Jahren nach 1990, so alle alternativhistorischen Texte, die einen thematischen Schwerpunkt dieses Bandes bilden. Andere Erzählungen handeln von Robotern oder elektronischen Persönlichkeitskopien, von rätselhaften Spiegeln und von seltsamen Zeitphänomenen. Sechs Geschichten erschienen in "Zeitmaschinen, Spiegelwelten" erstmals in deutscher Sprache; die übrigen sind zuvor verstreut in Anthologien, Zeitschriften und Fanzines gedruckt worden, darunter "Von der Zeit, von der Erinnerung", als beste deutschsprachige SF-Erzählung des Jahres 1992 mit dem Kurd Laßwitz Preis ausgezeichnet. Erik Simon · Simon's Fiction · Band 4 Herausgegeben von Hannes Riffel
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erik Simon
Simon’s Fiction:
Phantastische Geschichten
Band 4. Neuausgabe
Herausgegeben von Hannes Riffel
Zeitmaschinen, Spiegelwelten
Maschinen
Welten
Die Zeit und die Spiegel
Erzählungen, Gedichte und Alternativhistorien
Impressum
Erik Simon: Zeitmaschinen, Spiegelwelten
(Simon’s Fiction. Band 4 – Neuausgabe)
Herausgegeben von Hannes Riffel
Mit Zeichnungen von Dimitrij Makarow
© 1976–2013, 2023 Erik Simon (für die Erzählungen, Gedichte, Anhänge und Kommentare)
Die Daten der Erstpublikationen sind am Ende des Bandes bei den »Quellen und Anmerkungen« verzeichnet.
© 2023 Hannes Riffel (für die Vorbemerkung)
© 2023 Dimitrij Makarow (für das Titelbild und die Vignetten)
© 2013 Bernd Hutschenreuther und Erik Simon (für die Abbildungen)
© 2013, 2023 Erik Simon und Memoranda Verlag (für die Zusammenstellung dieser Ausgabe)
© dieser Ausgabe 2023 by Memoranda Verlag
Alle Rechte vorbehalten
Gestaltung: Hardy Kettlitz & s.BENeš [www.benswerk.com]
Memoranda Verlag
Hardy Kettlitz
Ilsenhof 12
12053 Berlin
www.memoranda.eu
www.facebook.com/MemorandaVerlag
ISBN: 978-3-948616-78-6 (Buchausgabe)
ISBN: 978-3-948616-79-3 (E-Book)
Inhalt
Impressum
Inhalt
Vorbemerkung des Herausgebers
Maschinen
Lieber Leser
Der Letzte
Die Konsumaten
Retroland
Die Maschine
Welten
Der Gesang vom Stierkampf
Alte russische Uchronik
Die Sachsen haben Augusts Herz
Das Vaudeville-Prinzip
Wenn Thälmann 1934 nicht Reichspräsident geworden wäre
Milde Schatten
Historische Konstanten: die Notwendigkeit der Wiedervereinigung 1990
Die BayernKrise
Die Zeit und die Spiegel
Von der Zeit, von der Erinnerung
Nebenwirkung
Den ganzen Wachturm entlang
Versunkene Zeit
Spiegel und Echo
Zu Frankfurt auf der Brücke
Die Zeitspiegel
ANHANG
Sächsische Hefte, Nr. 7
Russen oder was?
Quellen und Anmerkungen
Bücher bei MEMORANDA
Vorbemerkung des Herausgebers
Bildung wird, oftmals, unterschätzt. Bildung kann, wenn sie nicht mit zu viel Ernst und aus Freude an der Sache betrieben wird, Grundlage für ein erweitertes Erleben sein.
Wie ich darauf ausgerechnet an dieser Stelle komme? Nun, vermutlich hätte mich etwa ab Seite 71 des vorliegenden Bandes eine große Lustlosigkeit heimgesucht, wäre ich mit mangelndem Vorwissen an die Texte herangegangen, die es da zu lesen gibt.
Erik Simon sagt in diesem Zusammenhang selbst: »Ein gewisses Interesse für Geschichte muß der Leser freilich mitbringen, um die Anspielungen zu verstehen und genießen zu können.« Klingt nach einer ziemlichen Zumutung. Und ist wohl auch so gemeint.
Zeitmaschinen, Spiegelwelten enthält in seinem etwa einhundert Seiten umfassenden Mittelteil eine Reihe von Erzählungen, die der sogenannten Alternativhistorie zuzurechnen sind. Die erste Geschichte, »Der Gesang vom Stierkampf«, handelt davon, wie die Europäer ein anderes Amerika »entdecken« als jenes, das uns aus den Geschichtsbüchern vertraut ist. Da befand ich mich noch auf vergleichsweise sicherem Boden. Ab »Alte russische Uchronik« war es dann allerdings nicht mehr ganz so einfach mit der Orientierung, und ich strauchelte, selbige suchend, zu meinen Sachbuchregalen.
Wenn ich eine Empfehlung aussprechen darf: Während des ersten Corona-Lockdowns (geschenkte Zeit, allemal) habe ich mich durch die Geschichte Russlands: Vom Mittelalter bis zur Oktoberrevolution von Manfred Hildermeier gearbeitet. Als hätte ich geahnt, daß mir das alsbald von Nutzen sein würde, um Erik Simon auf seinen verschlungenen Pfaden zu folgen. Und damit nicht genug: Seither bin ich außerdem über ein Buch mit dem Titel Unter dem Schirm der göttlichen Weisheit: Geschichte und Lebenswelten des Stadtstaates Groß-Nowgorod gestoßen, das der Osteuropahistoriker Carsten Goehrke verfaßt hat. Nicht an ein Wort aus unserem Geschichtsunterricht kann ich mich diesbezüglich erinnern, dabei kann es das Fürstentum und die spätere Republik (im Spätmittelalter!) Nowgorod an Faszinationskraft durchaus mit dem ebenso geheimnisvollen – und beinahe ebenso vergessenen – Burgund aufnehmen!
Verzeihen Sie, ich schweife ab. Was mir manchmal passiert, wenn mich Literatur in Begeisterung versetzt. Lassen Sie mich Ihnen versichern, daß sich diese Begeisterung nicht nur auf den oben genannten Mittelteil erstreckt. Im ersten Teil »Maschinen« habe ich mich mit großem Vergnügen aufs erzählerische Glatteis begeben – Erik Simon ist ein Meister darin, seine Leser glauben zu lassen, sie wüßten, wohin die Reise geht. Um ihnen dann beizeiten, geradezu genußvoll, den Boden unter den Füßen wegzuziehen.
Und meine Lieblingsstelle im ganzen Buch? Als mir klar wurde, daß der Ich-Erzähler der abschließenden längeren Erzählung »Die Zeitspiegel« kein anderer ist als die tragische Hauptfigur aus … o nein, das müssen Sie schon selbst herausfinden. Das Vergnügen möchte ich Ihnen nicht nehmen. In diesem Sammelband gibt es eine Menge Überraschendes zu entdecken. Manchmal bedarf es dafür gewisser Vorkenntnisse. Und der Bereitschaft, sich diesen Texten mit ganzer Aufmerksamkeit zu widmen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Es lohnt sich!
Hannes Riffel
im Januar 2023
Maschinen
Lieber Leser
Hohes Gericht, zunächst möchte ich im Namen meines Mandanten wie auch in meinem eigenen Namen die Entscheidung der kybernetischen Justizinstitutionen begrüßen, den vorliegenden Streitfall einem menschlich-vollbiologischen Richter zuzuweisen.
Die außerordentlichen Umstände lassen dieses Vorgehen in der Tat als dringlich wünschenswert und sachdienlich erscheinen.
Wie bei Verhandlungen vor ausschließlich oder teilweise menschlich besetzten Richtergremien üblich, werde ich mich nicht auf die in der elektronischen Dokumentation verzeichneten Tatsachen und Standpunkte beschränken, sondern die unseres Erachtens für die Bewertung des Rechtsstreits relevanten Hintergründe in meine Darlegungen einbeziehen und erläutern. Des weiteren werde ich auf der Grundlage meiner Ausführungen einen Antrag stellen, die Liste der von meinem Opponenten beantragten Zeugenvernehmungen zu modifizieren.
Da im vorliegenden Fall urheberrechtliche Aspekte berührt werden, beginne ich mit einem Abriß der jüngeren Entwicklung auf diesem Gebiet. Bekanntlich hat im 21. Jahrhundert die Vervollkommnung von Autorenprogrammen dazu geführt, daß elektronisch erstellte Werke der Schönen wie der Sachliteratur grundsätzlich nicht mehr von traditionell, also vollbiologisch angefertigten zu unterscheiden sind, weder in ihrer Spezifik noch in ihrer Qualität; ich verweise diesbezüglich auf die Präambel der Novelle zum Urheberrechtsgesetz vom 21. 3. 2057 über die Aufhebung der Kennzeichnungspflicht für elektronisch produzierte Literatur. Damit sind elektronisch-kybernetisch erbrachte Leistungen auf literarischem Gebiet den herkömmlich vollbiologischen gleichgestellt. Die Autorenprogramme haben das Niveau der Anfangszeiten, all jener Reimwerker, Versifikatoren, Grammatisatoren längst hinter sich gelassen; wenn Sie heute einen neuen Text lesen, der klingt, als habe ein Elektrobarde aus dem frühen 21. Jahrhundert ihn verfaßt, dann können Sie nahezu sicher sein, daß es sich um das Produkt eines vollbiologischen Verfassers handelt.
Laut Grundsatzentscheidung des Eurasischen Gerichtshofes vom 14. 10. 2048 liegt zudem das Urheberrecht an elektronisch hervorgebrachter Literatur immer beim rechtmäßigen Nutzer des erzeugenden Programms bzw. Programmpakets, auch wenn es sich bei letzterem um eine kybernetische Persönlichkeit im Sinne von Paragraph 124 und 127 der Verfassung der Eurasischen Union handelt, also um eine nach dem Vorbild einer bestimmten vollbiologischen Person gestaltete Kopie. Bekanntlich wurde in jenem Streitfall zwischen Sheol Dibbuks Inc., Haifa und Berlin, einerseits und Paula Nancy Millstone Jennings, Greenbridge, andererseits festgestellt, daß das Urheberrecht an den lyrischen Werken, die von einem Douglas-Adams-Personoid verfaßt wurden, weder dem Unternehmen Sheol Dibbuks Inc. gehörte, das dieses Programmpaket erstellt hatte, noch den Erben des vollbiologischen Schriftstellers aus dem 20. Jahrhundert, der als Vorbild für das Personoid verwendet wurde. Es spielte auch keine Rolle, daß die internationale Schutzfrist für die vom betreffenden Autor Adams eigenhändig verfaßten Werke noch nicht abgelaufen war. Der Vorwurf, das Personoid habe Werke seines biologischen Urbilds plagiiert, konnte nachhaltig entkräftet werden, so daß das Urheberrecht an den Erzeugnissen des Personoids ausschließlich und uneingeschränkt Frau Jennings zuerkannt wurde, da diese die fragliche Persönlichkeitskopie legitim erworben hatte; ihr wurde lediglich untersagt, den Namen des vollbiologischen Urbildes, Douglas Adams, für die Werke des Personoids zu benutzen. Demzufolge …
Ich danke für die Zwischenfrage; sie trägt zur Erhellung des Sachverhalts bei. Meine bisherige Darlegung ist sogar in zweierlei Hinsicht für den Ihnen vorliegenden Streitfall von Belang: Zum einen, weil die erwähnte Rechtslage generell die Bewertung von durch Programme erbrachten Leistungen auf dem Gebiet der Literatur betrifft, was ich noch im einzelnen ausführen werde. Zum anderen, weil die Herstellung vollwertiger literarischer Werke durch Personoide und ähnliche Programme überhaupt erst die Voraussetzungen geschaffen hat, aus denen der hier verhandelte Streitfall erwuchs.
Seitdem elektronisch hergestellte Literatur von traditionell verfertigter prinzipiell nicht mehr zu unterscheiden ist, zumal moderne Programmpakete auch die für vollbiologische Verfasser charakteristischen Fehler und Beschränkungen emulieren können, ist die Zahl der allwöchentlich neu auf den Markt kommenden Werke explodiert, so daß dieser Markt infolge Überangebots längst zusammengebrochen ist, ja, von einem Markt im eigentlichen Sinne nicht mehr die Rede sein kann. Obwohl die Anschaffung hochwertiger Autoren-Personoide nach wie vor relativ kostspielig ist und der Verkauf ihrer Erzeugnisse in aller Regel nicht einmal die Betriebskosten einbringt, gibt es eine außerordentlich hohe Menge von nichtkommerziell, also ohne Gewinnerwartung hergestellter und dabei höchsten Anforderungen genügender Literatur.
Nun besteht der Zweck von Literatur, und jedenfalls der Zweck, den die Autoren verfolgen – Autoren im Sinne des Urheberrechts, also die vollbiologischen Personen –, darin, rezipiert zu werden. Das hat schon in den Zeiten vor dem Aufkommen elektronisch generierter Werke zur Bildung von Schriftstellerklubs und Autorenzirkeln geführt, deren Mitglieder wechselseitig ihre Erzeugnisse gelesen und darüber Meinungen ausgetauscht haben; der Großteil der modernen Lyrik funktionierte schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts so, und gegen Ende jenes Jahrhunderts war die Zahl der Lyriker annähernd gleich der ihrer Leser. Solche Gruppen gibt es nach wie vor, doch hat eine Neigung immer mehr um sich gegriffen, nicht einmal mehr die Werke der Kollegen zu lesen, mit denen man in unmittelbarem Kontakt steht.
Es war daher nur eine Frage der Zeit, daß der Beruf des Schriftstellers sich in den des Lesers wandelte: des berufsmäßigen Lesers also, der vom Autor dafür bezahlt wird, daß er seine Werke liest und sich in qualifizierter Weise darüber äußert, sowohl gegenüber dem Autor selbst als auch – je nach der getroffenen Abmachung – gegenüber Dritten. Inzwischen hat sich ein breit gefächertes Spektrum vom semiprofessionellen Gelegenheitsleser bis zum hochbezahlten Bestseller-Leser herausgebildet. Letzterer zeichnet sich natürlich nicht dadurch aus, daß er besonders viele Bücher oder etwa Bestseller liest, zumal es Bestseller im herkömmlichen Sinne gar nicht mehr gibt – im Gegensatz zu den Bestseller-Autoren von früher, deren Werke vervielfältigt wurden und Hunderttausende von Lesern fanden, ist ja die Aufnahmekapazität eines vollbiologischen Lesers auf relativ wenige Bücher pro Monat begrenzt, so daß nicht die Schnelleser am besten verdienen, sondern gerade jene, die sich Zeit für die Lektüre nehmen, die Intention des Verfassers besonders gut verstehen, auf überzeugende Weise Vorzüge und sonstige Eigenheiten des Werkes entdecken, derer sich der Autor selbst vielleicht nicht vollends bewußt war. Sie sind es, die für ihre Lesearbeit die höchsten Honorare erhalten, sich also am besten verkaufen.
Es versteht sich, daß nur wohlhabende Autoren sich einen berühmten Spitzenleser leisten können. Auf diesem Niveau ist es auch durchaus noch üblich, daß der Autor sein Werk selbst verfaßt oder an seiner elektronischen Anfertigung aktiv mitwirkt, sozusagen als Ko-Autor eines Personoids. Nur so ist ja aus der schriftstellerischen Tätigkeit die ihr eigene Befriedigung zu gewinnen – welchen Zweck hat es, sich mit fremden Federn zu schmücken, wenn selbst das schönste Federkleid kaum noch spontane Bewunderer in größerer Zahl findet? Ebenso ist es Usus, daß wohlhabende Verfasser ein enges Verhältnis zu ihren Lesern unterhalten, einen oder auch mehrere zugleich zu sich nach Hause einladen, um über ihre Werke zu sprechen, daß sie also eigentlich das veranstalten, was man in vergangenen Jahrhunderten einen literarischen Salon nannte. Damit einher geht auch ein neues Mäzenatentum, dergestalt, daß vermögende Schriftsteller begabte mittellose Kollegen in diese Salons einbeziehen, ihnen mitunter elektronische Ko-Autoren finanzieren, vor allem aber die hochqualifizierten Leser, die für sie selbst arbeiten, auch für die Lektüre jener ärmeren Verfasser bezahlen.
Dem Gros der Schriftsteller freilich fehlen die Mittel, um diese Institutionen der Hochliteratur für sich in Anspruch zu nehmen, soweit sie nicht begünstigt sind, indem sie an der feinen Literaturgesellschaft sowohl als Verfasser wie auch als gefragte Leser partizipieren. Die übrigen sind auf die Dienste von Lesern verwiesen, die relativ viel lesen und in der Regel unabhängig vom Genre alles, wofür sie bezahlt werden; ihre Kommunikation mit den Autoren erfolgt fast ausschließlich par distance. Wie nicht anders zu erwarten, schwankt die Qualität solcher Leserreaktionen recht stark; das ist die notwendige Folge der begrenzten Aufnahmekapazität vollbiologischer Leser.
Hier nun setzt die bahnbrechende Idee meines Mandanten ein, nämlich auch für die Tätigkeit des Lesers Computerprogramme zu verwenden. Selbstverständlich stehen die Produkte eines hochwertigen literarischen Lektüreprogramms bzw. eines Leser-Personoids den Leistungen vollbiologischer Leser ebensowenig nach, wie die Werke elektronischer und menschlicher Verfasser voneinander zu unterscheiden sind. Mehr noch, da der kybernetische Leser nicht den zeitlichen Beschränkungen des vollbiologischen unterliegt, da er schneller, mehr und genauer liest, liegt seine Leseleistung nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ erheblich höher. Die daraus folgenden Verbesserungen für den Kunden, d. h. für den auftraggebenden Autor, sind unbestreitbar und unbestritten. Die Klage unseres Opponenten zielt ja vielmehr auf den Umstand, daß mein Mandant den Kunden gegenüber die elektronische Natur der Lektüre verschwiegen und sich selbst als den Urheber der Leserreaktionen ausgegeben hat. Wir leugnen diese Tatsache keineswegs, doch ich habe in unserem elektronischen Schriftsatz dargelegt und werde nunmehr erläutern, daß dieses Verhalten erstens rechtens war und zweitens – darüber hinaus – im unmittelbaren Interesse des Klägers lag.
Die Rechtmäßigkeit folgt zwingend aus der Gleichwertigkeit elektronischer und menschlicher Tätigkeit auf dem Gebiet der Literatur, wie sie in der von mir bereits erwähnten Novelle zum Urheberrechtsgesetz vom 21. 3. 2057 festgestellt worden ist. Gerade weil es sich bei der Ununterscheidbarkeit kybernetisch und vollbiologisch verfaßter Werke nicht um eine zufällige, sondern eine im Wesen der Sache begründete Eigenschaft handelt, ist es …
Wie bitte? – Gewiß, Herr Kollege, die Novelle vom 21. 3. 57 hebt die Kennzeichnungspflicht nur für elektronisch verfaßte Werke auf, also für die Autorenschaft. Aber wie kommen Sie darauf, daß daraus das Fortbestehen einer Kennzeichnungspflicht für die Ergebnisse elektronisch augmentierter Lesetätigkeit folgt? Eine solche Kennzeichnungspflicht kann schon darum nicht fortbestehen – und brauchte nicht aufgehoben zu werden –, weil sie niemals bestanden hat! Daß sie von der Sache her gar nicht bestehen konnte, folgt aus der Einheit von Produktion und Rezeption im Literaturprozeß; Lektüre ist von Autorentätigkeit grundsätzlich nicht zu trennen. Dies wird auch von einer Vielzahl literaturtheoretischer Untersuchungen belegt, von denen Sie, Hohes Gericht, für unseren Streitfall relevante Auszüge in Anlage 13.2.1 unseres elektronischen Schriftsatzes finden; eine umfassendere Liste weiterer Quellen zu diesem Thema bietet Anlage 13.2.2.
Mein Mandant war also nicht verpflichtet, den Auftraggeber zu informieren, auf welche Weise und mit welchen Hilfsmitteln er seine Lektüreberichte und Meinungsäußerungen erstellt hatte. Daß er die Arbeit unter seinem eigenen Namen ablieferte, entspricht den Gepflogenheiten der Branche; auch Schriftsteller, die Personoide oder andere Programme verwenden, publizieren in aller Regel unter dem eigenen Namen. Der elektronische Ursprung der weitaus meisten Werke ist natürlich allgemein bekannt und als gegeben vorauszusetzen, dennoch besteht in der Literaturgesellschaft Konsens, den Eigentümer des Urheberrechts als alleinigen Verfasser zu behandeln. Der Austausch zwischen Autor und Leser wird traditionell als Beziehung zwischen vollbiologischen Personen betrachtet, und in den meisten literarischen Kreisen gilt es als grob unhöflich, kybernetische Hilfsmittel eines Autors zu erwähnen oder ihre Möglichkeit in Betracht zu ziehen, soweit der Autor nicht von sich aus darauf Bezug nimmt.
Der Kläger unterstellt indes, mein Mandant habe die elektronische Urheberschaft seiner Leseeindrücke verschwiegen, um die mindere Qualität des Produkts zu verschleiern, da es zwar zahlreiche für das Verfassen von Literatur optimierte Programme und Autoren-Personoide auf dem Markt gebe, jedoch keine speziell für die Lektüre entwickelten. Ich habe nicht vor, in diesem Zusammenhang die Frage zu erörtern, ob der Kläger die literarischen Werke, mit deren Lektüre er meinen Mandanten beauftragte, mit mehr oder weniger anspruchsvollen Programmen oder womöglich gar von Hand erstellt hat – die Vermutungen, die sich bei näherer Betrachtung der Texte aufdrängen, tun letzten Endes nichts zur Sache. Mein Mandant jedenfalls hat hochwertige Personoide eingesetzt, und er hat ihre Qualifikation als Leser nicht nur gemäß der Produktspezifikation der Hersteller dieser Persönlichkeitskopien vorausgesetzt, sondern hat sie zusätzlich vielfach überprüft.
Daß er der Sorgfaltspflicht mehr als Genüge getan hat, ist allein schon aus der Anzahl jener von ihm erprobten Persönlichkeitskopien zu ersehen, deren Einsatz er nach reiflicher Erwägung verworfen hat; die vollständige Liste ist in Anlage 7.2 unseres Schriftsatzes aufgeführt. Beispielsweise haben sich professionelle Rezensenten und Literaturwissenschaftler der Vergangenheit nur in wenigen Fällen als geeignet erwiesen. Fast durchweg bessere Ergebnisse erbrachten Personoide, die eigentlich für die Anfertigung literarischer Werke konzipiert und auf den Markt gebracht wurden; sie sind in der Regel fähig, ihre Leseerfahrungen originell und in breit gefächertem Kontext zu formulieren, und lassen darüber hinaus eine bemerkenswerte Unabhängigkeit im ästhetischen Urteil erkennen. So hat sich eine als Leser getestete Persönlichkeitskopie des Schriftstellers Stanisław Lem gleichermaßen geistreich wie herablassend über Texte geäußert, die eine andere elektronische Instanz desselben Personoids verfaßt hatte.
Mein Mandant hat ein übriges getan und ist damit seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nur gerecht geworden, sondern hat sie zum Nutzen des Kunden bei weitem übererfüllt. Er hat einen Teil der von ihm eingesetzten Personoide so modifiziert, daß sie ihrer Funktion als Leser optimal gerecht werden. Beispielsweise hat sich, wie schon erwähnt, die spezifische Begabung von Schriftstellern auch für den Einsatz als Leser förderlich erwiesen. Weniger günstig wirkt sich indes in vielen Fällen aus, wenn das Personoid weiß, daß es selbst literarische Texte verfaßt hat. Es neigt dann oft dazu, einen Text danach zu bewerten, wie es selbst ihn geschrieben hätte. Das ist für durchschnittliche Leser ein eher untypischer Maßstab, und die daraus resultierende Färbung des literarischen Urteils ist für den durchschnittlichen zahlenden Autor ebenso unerwünscht wie abfällige Vergleiche oder wohlmeinende Verbesserungsvorschläge.
Nun werden bekanntlich Eingriffe in den Persönlichkeitskern von Personoiden sowohl von der Eurasischen Verfassung als auch vom Urheberrecht untersagt. Mein Mandant hat diesen Kern selbstverständlich nicht angetastet, zumal darunter auch die spezifischen Lesebegabungen unkalkulierbar gelitten hätten. Vielmehr hat er die Randbedingungen angepaßt, d. h. die von den Personoiden wahrgenommene virtuelle Umwelt. Den dafür fast immer erforderlichen Eingriff in die Erinnerungsmatrix der Personoide hat er auf die branchenübliche Weise rechtlich abgesichert: Er verwendete eine virtuelle Umgebung aus der Zeit vor 2032, also aus dem Zeitraum vor dem Inkrafttreten der Schutzgesetze für elektronische Persönlichkeitskopien; dieser Zeitraum wird von den Schutzgesetzen bekanntlich nicht erfaßt – ich verweise auf das durch höchstrichterliche Entscheidung vom 30. 12. 2036 bestätigte Rückwirkungsverbot. In dem konkreten Fall, der die Klage gegen meinen Mandanten ausgelöst hat, hat er zudem die ihm zur Lektüre aufgetragenen Texte in einem fiktiven Band zusammengefaßt, der sich harmonisch in die virtuelle Umwelt einfügt, die für die lesende elektronische Persönlichkeit erzeugt wurde. Entsprechend der für seine Arbeit simulierten Umweltsituation glaubte das Personoid daher, es sei ein im ersten Viertel des 21. Jahrhunderts lebender vollbiologischer Mensch und lese einen Band mit Erzählungen und anderen Texten von einem ebenfalls vollbiologischen Verfasser namens Erik Simon. Es handelt sich dabei um einen zur Jahrtausendwende aktiven, aber inzwischen nicht mehr allzu bekannten real existierenden Verfasser; die Nutzung des Namens stützt die Umweltsimulation und ist von den Erben des Betreffenden autorisiert. In den vom Leser-Personoid verfaßten Meinungsäußerungen zur Lektüre wurde der Name Simon natürlich durch den des Auftraggebers ersetzt, also des Klägers.
Hohes Gericht! Ich komme nun zu meinem Antrag auf Änderung der Zeugenliste. Die klagende Partei ist im Besitz einer Kopie des fraglichen Leser-Personoids – von uns als Zeichen unseres guten Willens zur Verfügung gestellt, damit der Kläger die eingebetteten virtuellen Randbedingungen nachprüfen konnte. Der Vertreter der klagenden Partei hat nun beantragt, dieses Personoid als Zeugen zu vernehmen. Dagegen wenden wir ein: erstens, daß dazu keinerlei Notwendigkeit besteht, da die elektronische Verfasserschaft der Leseeindrücke von uns weder bestritten wird noch für den Fall irgend relevant ist; zweitens, daß eine Zeugenbefragung nicht möglich wäre, ohne das Personoid aus seiner virtuellen Umwelt, also dem frühen 21. Jahrhundert, herauszulösen und über den Zweck der Befragung in Kenntnis zu setzen. Da gleichzeitig die Erinnerungen an die bisherige Virtualität bewahrt werden müßten, um überhaupt Aussagen zu bekommen, würde der plötzliche Realitätskonflikt unweigerlich einen Schock auslösen, der den Persönlichkeitskern der Kopie in Mitleidenschaft zöge. Abgesehen davon, daß von einer derart geschädigten und veränderten Kopie keine Aussagen mehr zu erlangen wären, die über das ohnehin vorliegende Input-Output-Protokoll hinausgingen, wäre solch ein Vorgehen ein eklatanter Verstoß gegen die Eurasische Verfassung und das Gesetz zum Schutze elektronischer Persönlichkeiten. Sollte andererseits bei der Zeugenvernehmung dem Personoid gegenüber weiterhin die Fiktion aufrechterhalten werden, es befinde sich im ersten Viertel des 21. Jahrhunderts, so wäre bei nicht minder zweifelhaften Ergebnissen der notwendige Aufwand …
Ich muß Sie doch bitten, Herr Kollege, mich nicht fortwährend zu unterbrechen; den Standpunkt der Gegenpartei werden Sie gleich darlegen können. Lassen Sie mich aber zunächst meinen Gedanken zu Ende führen und beantragen, daß … Wie? Was heißt, Sie haben Ihre Kopie des Personoids bereits in den audiovisuellen Datenkanal dieser Verhandlung eingeschaltet? Wollen Sie damit etwa sagen, daß Sie …?
Hohes Gericht! Ich protestiere entschieden gegen diesen schwerwiegenden Verfahrensfehler, der gleichermaßen gegen die Prozeßordnung wie gegen die Grundrechte elektronischer Persönlichkeiten verstößt. Hier liegt ein schwerer Mißbrauch der dem Kläger überlassenen Persönlichkeitskopie vor, durch den unserem Personoid bleibender Schaden entstehen kann! Ich fordere, daß unverzüglich Maßnahmen zum Schutze seiner geistigen Integrität ergriffen werden und daß …
Herr! Kollege! Sie können diese Erinnerungen nicht »einfach wieder löschen«! Das ist ein Personoid, und wenn Sie glauben, dessen Gedächtnis nach Belieben manipulieren zu können, dann sind Sie ein Voll… Will sagen, Sie sind ein Volljurist, und als solcher wissen Sie genau, daß Sie einen Zeugen, zumal Ihren Zeugen, nicht vorzeitig an der Verhandlung teilnehmen lassen dürfen. Ja, und nun schalten Sie doch endlich die Datenübertragung zu dem Personoid ab! Ich habe gesagt, Sie sollen jetzt, auf der Stelle, die Übertra
Der Letzte
Heute
Dr. N. S. Kardaschow über eine Theorie des amerikanischen Kybernetikers Professor Minsky:
»Sein Gedankengang war folgender. Es ist bekannt, daß sich sogar in den ökonomisch entwickelten Ländern die Industrieproduktion in zehn Jahren bestenfalls verdoppelt. Dafür hat sich die Menge der in aller Welt mit Hilfe von Computern verarbeiteten Informationen in den letzten zehn Jahren auf das Millionenfache erhöht! Dieses frappierende Phänomen findet auf dem Gebiet der Technologie nicht seinesgleichen. Im Zusammenhang damit stellt Professor Minsky (der viele Wissenschaftler konsultiert hat) eine scheinbar phantastische Prognose auf. Ihr Wesen besteht darin, daß, wenn das Entwicklungstempo auf dem Gebiet der Elektronenrechner ebenso schnell steigt, schon in fünfzig Jahren die menschliche Gesellschaft ihren Platz an eine Maschinengesellschaft abtreten wird, die in ihren emotionalen und sonstigen Eigenschaften in keiner Weise hinter der gegenwärtigen menschlichen zurückstehen wird.«
Vielleicht fünfzig Jahre später
Und es geschah also.
Hundert Jahre später – vielleicht …
Gestern habe ich es erfahren. Ich reparierte gerade den Aerogleiter – gewiß, heute benutzt niemand mehr einen Gleiter; diese Maschinen sind seit mindestens zwanzig Jahren total veraltet. Höchstwahrscheinlich bin ich der einzige, der noch einen hat, und vermutlich auch der einzige, der ihn noch zu reparieren versteht. Die Reparaturen fallen immer häufiger an und dauern von Mal zu Mal länger, aber ich habe ja viel Zeit, sehr viel Zeit. An den Gleiter habe ich mich gewöhnt und möchte nicht auf ihn verzichten. Vielleicht, weil er noch jenes einzigartige Gefühl des Fliegens vermitteln kann, weil sein Flug noch ein wenig an den der Vögel erinnert; den modernen Maschinen geht das gänzlich ab. Vielleicht auch, weil der Gleiter ebenso ein Anachronismus ist wie ich selbst.
Ich überprüfte gerade, ob die Steuerung des rechten Tragflächenstabilisators wieder funktionierte, als ich aus dem Amt für Bevölkerungskoordination die Nachricht erhielt, daß Christopher umgekommen sei. Er hatte wieder eins seiner physikalischen Experimente durchgeführt, und dabei ist irgend etwas explodiert – was, weiß ich nicht, ich bin ein einfacher Mechaniker und verstehe nichts von solchen Dingen. Das Amt muß in solchen Fällen die nächsten Angehörigen benachrichtigen; Christopher besaß keine, er hatte nur noch mich, so wie ich nur noch ihn hatte. Wir waren die beiden einzigen, die von unserer Art übriggeblieben waren; jetzt bin ich der letzte.
Wer hätte vor fünfundzwanzig, ja sogar noch vor fünfzehn Jahren gedacht, daß es so kommen würde! Jahrelang haben Menschen und Roboter zusammengelebt, wir brauchten sie und sie uns. Nun, da ich dies aufschreibe, kann ich nur staunen, wie sehr wir uns geirrt haben, als wir glaubten, es müsse ewig so sein.
Jedesmal, wenn ich einen Blick aus dem Fenster werfe und draußen den Park sehe, muß ich daran denken, wie wir uns vor sechseinhalb Jahren dort getroffen haben, als es noch zwölf unseresgleichen gab, zwölf aus allen Teilen der Welt: außer Christopher und mir fünf Nukleartechniker, einen Biologen, einen Archivar, einen Graviplanchauffeur und zwei, die Dispatcher oder so etwas Ähnliches waren. Die Nukleartechniker, der Chauffeur und die beiden Dispatcher flogen gemeinsam wieder ab, aber der Graviplan hatte eine Havarie und stürzte westlich von Helgoland ins Meer; niemand konnte gerettet werden. Damals bin ich in dieses Haus am Rande des Parks gezogen.
Es ist Anfang Dezember, und die Bäume recken kahle Äste in den stumpfen Himmel. Der erste Schnee ist heuer im November gefallen, inzwischen aber schon wieder getaut. Das Gras ist von einem verwaschenen Grün und der Boden noch sehr feucht, von großen schwarzen Pfützen bedeckt. Wenn Christopher heute zu Besuch gekommen wäre, hätten wir wohl nicht durch den Park gehen können, wie wir es meistens taten. Vielleicht hätten wir eine Partie Schach gespielt, vielleicht einen seiner Musikkristalle angehört, von denen er eine große Sammlung besaß. Oder wir hätten uns ans Fenster gesetzt, in die melancholische Ruhe hinausgeschaut und uns erinnert …
Kurze Zeit nachdem unsere acht Gefährten bei dem Graviplanunglück umgekommen waren, erfuhren wir, daß sich der Archivar von der Plattform des Eiffelturms gestürzt hatte. Das war ein unerhörtes Ereignis, niemand konnte sich an Ähnliches erinnern. Früher allerdings soll dergleichen häufiger vorgekommen sein. Früher … Vielleicht hatte er deshalb dieses archaische Bauwerk gewählt.
Es ist nicht etwa so, daß sich Menschen und Roboter jetzt feindlich gegenüberstehen, o nein! Sie sind nicht mehr an uns interessiert. Sie haben keinen einzigen von uns vernichtet, aber seit sie vor einem Vierteljahrhundert beschlossen hatten, daß wir nutzlos geworden sind, wurden unser immer weniger, denn es kamen keine neuen mehr hinzu, und wir sind ja nicht unsterblich. Trotzdem blieben sie freundlich zu uns, besonders seit wir so wenige waren.
Der Biologe ist vor vier Jahren von einem Güterzug der Transkontinental-Linie überfahren worden. Wir wissen nicht, ob er sich absichtlich oder aus Versehen im Bereich der Schiene aufgehalten hat. Da die Transkontinental-Einschienenbahn hier in Europa fast ausschließlich unterirdisch verläuft und vom übrigen Verkehr völlig abgegrenzt ist, gilt es aber allgemein als unmöglich, versehentlich auf die Trasse zu geraten.
Es gab eine Zeit, da schien es einfach unvorstellbar, daß sie je ohne uns auskommen könnten. Gewiß, wir waren auch damals schon verschwindend wenige, gemessen an ihrer ungeheuren Zahl, doch es gab Aufgaben, denen sie einfach nicht gewachsen waren. Die wirklich komplizierten Probleme wurden von uns gelöst. Die Unseren waren es, die den Überblick hatten. Und wir standen ihnen in nichts nach.
Draußen hat es zu regnen begonnen. Der Wind schlägt Tropfen gegen die Scheiben, peitscht die Äste der alten Bäume. Ich fühle mich hier drin behaglich, geborgen; ich schaue hinaus und verfalle mehr und mehr dieser wehmütigen Stimmung. Das grenzt schon an Kitsch, sagt mein logischer Verstand, aber ich kann nichts dagegen machen; ich bin eben so. Wenn sie uns wenigstens das erspart hätten!
Aber so sind sie. Bevor sie die Reserven ihrer eigenen Körper und Hirne nutzen lernten und dadurch so vollkommen wurden, daß sie uns nicht mehr brauchten, mußten sie danach streben, uns so perfekt wie möglich zu machen. Und weil der Maßstab für sie letzten Endes doch immer sie selbst waren, haben sie uns Roboter mit diesen verdammten Emotionen ausgestattet.
Die Konsumaten
1960 mußte von den rund 37 Millionen Tonnen der Jahresweizenernte der USA etwa ein Drittel als »nicht absetzbar« eingelagert werden. Damit erreichten die Lagerbestände eine Höhe von 37 Millionen Tonnen, das heißt, die Höhe einer Jahresernte. Zur gleichen Zeit litten über 1,4 Milliarden Menschen in der kapitalistischen Welt an Unterernährung, während Millionen Tonnen des eingelagerten Weizens vernichtet wurden.
Aus einem Geographie-Lehrbuch
… Somit hat sich infolge der fortschreitenden Automatisierung unserer Industrie eine Situation herausgebildet, die faktisch die Gefahr einer ernsten Krise nicht ausschließt. Der Prozeß einer steigenden Produktionsquote bei ebenfalls steigender Arbeitslosigkeit und damit zugleich abnehmender Kaufkraft eines Großteils der Arbeitnehmer droht lawinenartigen Charakter anzunehmen, wenn kein Regulans gefunden wird, durch das eine zusätzliche Konsumptionskapazität geschaffen wird.
Bulletin of Economy, New York, Nr. 3/1991
… jedenfalls nicht zu befürchten. Die gegenwärtige Höhe der Arbeitslosenunterstützung, führte Senator Cramer aus, garantiere jedem Bürger der Vereinigten Staaten das Existenzminimum. Allerdings sei es unmöglich, diese Unterstützung zu erhöhen, ohne das ganze System unserer freien Wirtschaft ernstlich zu gefährden. Deshalb müsse man …
The New York Herald, 14. 4. 1991, S. 4
Die Einführung der neuen, unspezialisierten Universalroboter droht die gegenwärtig bestehende angespannte Lage weiter zu verschärfen. Trotzdem ist abzusehen, daß sich diese Roboter durchsetzen werden, da kein Unternehmer, der konkurrenzfähig bleiben will, auf sie verzichten kann.
U. S. Financial Times, 30. 8. 1992, S. 8
… zu drohen. Schließlich versuchte die Menge, die Lagerhallen zu stürmen. Dieser Versuch wurde von rechtzeitig alarmierten Polizeieinheiten und von der Werkpolizei vereitelt. Dabei wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Mehrere Plünderer wurden getötet, als die Polizei sich mit Schußwaffen zur Wehr setzen mußte.
Die Verluste des Trusts sind unerheblich, da in diesen Hallen nur veraltete Produkte aus den Jahren 1986 und 1987 gelagert worden waren.
Ph. L., Michigan Observer, 10. 1. 1993, S. 2
Der neue Robotertyp unterscheidet sich grundlegend von allen anderen Modellen. Er ist im Gegensatz zu diesen weder für den Einsatz in der Produktion noch für irgendwelche Dienstleistungen bestimmt; dazu ist er völlig ungeeignet. Der Konsumat – so nennt die U. S. Robots Ltd. ihr neues Modell – erfüllt lediglich zwei Aufgaben: Er reproduziert sich selbst, das heißt, er erzeugt weitere Konsumaten, und er konsumiert täglich eine bestimmte Menge unterschiedlicher industrieller und landwirtschaftlicher Fertigprodukte, indem er sie in einen unbrauchbaren Zustand überführt.
Journal of Electronics and Cybernetics, 1993, vol. 12, 47 f.
etwa seit dem jahr 1994 wurde das automobil durch den konsumaten aus seiner rolle als äußerlicher gradmesser des persönlichen reichtums verdrängt. innerhalb kürzester frist setzte sich der konsumat als statussymbol durch; die gesellschaftliche position eines menschen wurde durch die anzahl der in seinem besitz befindlichen und von ihm unterhaltenen konsumaten manifestiert. der konsumat stellte als wirklich absolut nutzloses produkt den luxus in seiner höchsten damals erreichbaren form, quasi in reinkultur, dar.
buster floyd, history of luxury, san francisco 2034, s. 210 f.
Den ungewöhnlichen wirtschaftlichen Aufschwung der letzten beiden Jahre verdankt das amerikanische Volk vor allem den Konsumaten, deren weite Verbreitung die ehemaligen Absatzschwierigkeiten unserer Wirtschaft radikal und für alle Zeiten beseitigt hat. Die Regierung der Vereinigten Staaten wird alles unternehmen, um diese verheißungsvolle Entwicklung zu fördern.
Aus dem Bericht des Präsidenten der USA zur Lage der Nation, 1995
Wenn außerdem noch berücksichtigt wird, daß im Zeitalter der Konsumaten die Arbeitslosigkeit praktisch verschwunden ist, kann man den Regierungsbeschluß zur Einführung der allgemeinen Konsumpflicht nur begrüßen. Infolge der stimulierenden Wirkung des Konsumaten auf die amerikanische Wirtschaft sollte jede amerikanische Familie in der Lage sein, mindestens einen Konsumaten zu erwerben und zu unterhalten. Daß dies durch das neue Gesetz zur Pflicht erklärt wurde, entspricht somit in jeder Beziehung den Interessen des amerikanischen Volkes. Unserer Wirtschaft steht zweifellos ein neuer Aufschwung bevor.
The New York Times, 4. 1. 1996, S. 1
Die Konsumaten haben uns Arbeit und Brot gegeben. Dennoch scheuen sich gewisse verbrecherische Elemente nicht, ihre Wohltäter mutwillig zu beschädigen, um sich somit ihrer gesetzlichen Pflicht zu entziehen, einen Konsumaten zu unterhalten. Wir fordern, daß jeder, der einen Konsumaten willentlich zerstört oder beschädigt oder einen Konsumaten an der Erzeugung weiterer Konsumaten zu hindern versucht, mit der ganzen Härte des Gesetzes zur Rechenschaft gezogen wird!
Aus einem Aufruf der Liga zur Verhinderung von Grausamkeiten an Konsumaten (Konsumatenschutzverein), 1996
Der Besitzer eines Konsumaten ist verpflichtet, auch für den Unterhalt aller von diesem Konsumaten erzeugten Konsumaten (Sekundärkonsumaten) zu sorgen. Die Unterschreitung der gesetzlich festgelegten täglichen Mindestration an Konsumgütern pro Konsumat ist dabei gleichbedeutend mit einer Verletzung der Unterhaltspflicht und somit strafbar.
Grundsatzurteil des Obersten Gerichtshofes der USA vom 6. 6. 1996
in den letzten jahren des zwanzigsten jahrhunderts verschwand in den usa die arbeitslosigkeit tatsächlich; mehr noch, da die herstellung produktiver roboter mit dem lawinenartigen anwachsen der zahl der konsumaten nicht schritt halten konnte, wurde der arbeitstag auf durchschnittlich 10,6 stunden (einschließlich des sonnabends) erhöht. die löhne stiegen dementsprechend, doch hatte dies kein ansteigen des lebensstandards zur folge, da der überwiegende Teil der einkünfte von den werktätigen für den unterhalt der konsumaten ausgegeben werden mußte. der konsumat wirkte auf alle sphären der gesellschaft ein. verstöße gegen das konsumatenschutzgesetz wurden meist streng bestraft und stellten, da sie mit einfachsten mitteln zu provozieren waren, ein effektives machtmittel gegen politische gegner dar.
benjamin r. larsson, jean f. mclean und robert ashamatu: north american history of the twentieth century, toronto 2041, s. 994
… sieben Zehntel der Agrar- und fünf Siebentel der Industrieproduktion der Vereinigten Staaten werden der Nutzung durch die Menschen auf diese Weise entzogen und sinnlos verschwendet. Wir fordern daher die Aufhebung des Konsumatenschutzgesetzes, dieser unwürdigen …
Fragment eines Flugblattes der illegalen
»Vereinigung für Demokratie und Menschenrechte«,
vermutlich aus dem Jahre 1998
Ist es aber wirklich ein Zeichen gläubiger Gesinnung, wenn wir sagen: »Liebe deinen Konsumaten wie dich selbst«? O nein, dies wäre eine zu eitle Deutung der Lehre des Heiligen Letton! Denn jeder wahre Gläubige wird nach dem Grundsatz handeln: »Liebe deinen Konsumaten mehr als dich selbst!«
Aus einer Predigt von Rev. Whistler in der Lettonistenkirche zu Philadelphia am 14. 8. 1998
MASSENMÖRDER VON DETROIT VERURTEILT
KALTBLÜTIGER MORD AN ZWÖLF KONSUMATEN MIT VIERZEHN JAHREN ZWANGSARBEIT GEAHNDET + MÖRDER PAUL SCHUYLER BERUFT SICH AUF KRANKE FRAU UND FÜNF KINDER + KONSUMATENSCHUTZVEREIN KRITISIERT ZU MILDES URTEIL
Schlagzeilen des Michigan Observer, 14. 8. 1998, S. 1
automatische vorrichtung zur vernichtung von konsumgütern sowie zur selbstreproduktion aus dem jahr 1995, ein sog. »konsumat«
Schild neben einem würfelförmigen Metallklotz von etwa 2 mal 1,8 mal 1,3 Meter Abmessung mit mehreren Öffnungen und Klappen und einer Zählskala, der in dem 2051 gegründeten »Museum für primitive Kulte, San Francisco« in der Abteilung »Fetischismus und Idolatrie« ausgestellt ist
Retroland
Ein Kurzbesuch
»Guten Tag«, sagte der Roboter, der sie eingelassen hatte. »Und herzlich willkommen. Wir sind hocherfreut über Ihren Besuch. Wenn Sie sich gütigst ins Gästezimmer bemühen wollen …« Er wies auf die offene Tür und folgte den Besuchern.
Die vier Menschen – ein Mann, eine Frau, ein vielleicht dreizehnjähriger Junge und ein kleines Mädchen von ungefähr fünf Jahren – gingen in das Zimmer, wo um einen Tisch ein sehr neu und ungebraucht aussehendes Sofa, zwei Sessel und zwei massive Holzstühle standen. Der Raum war davon fast ausgefüllt, andere Möbel gab es nicht, nur in einer Ecke einen Gummibaum. In einer weiteren Ecke standen noch zwei Roboter. Beide waren deutlich größer als der, der sie in Empfang genommen hatte, der eine aber schlank und stromlinienförmig, von einem matten Blau, der andere mit einem eher kastenförmigen Korpus aus dunkelgrünem Kunststoff, der an den Ecken abgeschabt wirkte.
Der kleinere Roboter – silbrig metallglänzend, mit kugelrundem Kopf und auch sonst aus mehreren Kugeln und Ovoiden zusammengesetzt – sagte: »Ich darf Ihnen meine Familie vorstellen: Das ist mein Gemahl Albert.« Der stromlinienförmige Roboter setzte dazu an, eine Hand auszustrecken, zog sie rasch wieder zurück und sagte: »Freut mich. Freut mich sehr.«
»Ich heiße Berta«, fuhr der kleine Roboter fort. Er – nein, sie – zeigte auf den kantigen dunkelgrünen Roboter. »Und das ist …«
»Robert«, fiel ihr der halbwüchsige Junge ins Wort.
»Nein«, sagte der kantige Roboter. »Ich. Hei-ße. Go. 2-T-H. 11.« Er sprach abgehackt und betonte jede Silbe gleich.
»Sie wollen ihm sein Verhalten bitte nachsehen«, bat die Roboterin. »Er ist in einer schwierigen Entwicklungsphase, aber er hat Ihrem Besuch mit großer Freude und Ungeduld entgegengefiebert. Wir haben die außerordentliche Ehre«, fuhr sie fort, an die beiden anderen Roboter gewandt, »Familie Meiers zu Gast zu haben. Aber bitte, nehmen Sie doch Platz. Haben Sie die Güte, sich in unserem bescheidenen Heim wie zu Hause zu fühlen.«
Bemerkenswert schnell trat der Junge zu dem links vom Sofa stehenden Sessel und ließ sich hineinfallen; der Mann schob sich zwischen Tisch und Sofa neben ihn, faßte mit Daumen und Zeigefinger beider Hände je ein Hosenbein seines grauen Anzuges oberhalb der Knie, zog es ein kurzes Stück hoch und setzte sich. Die Frau versuchte, sich zusammen mit dem Mädchen neben ihn zu setzen, was bei dem Mädchen aber heftigen Unwillen auslöste. Es durfte sich in den Sessel rechts setzen, der deutlich zu groß war, und schickte sich an, die Füße mitsamt den goldenen Schuhen hochzunehmen. »Marilyn!« sagte die Frau in gut eingespieltem Tonfall, worauf das Mädchen wieder nach vorn und sein rosa Kleidchen dabei nach oben rutschte, so daß man den Oberrand der schwarzen Strümpfe und die roten Strumpfhalter sah.
Berta und Albert setzten sich auf die Stühle, der dunkelgrüne, abgeschabte Roboter blieb in seiner Ecke stehen, was dem gesamten Ensemble mit Gummibaum eine ästhetisch sehr befriedigende Symmetrie verlieh.
»Ich weiß nicht, ob Sie vom Veranstalter umfassend informiert worden sind. Wenn nicht, möchte ich unsere Vorstellung nachholen. Das ist meine Frau Theresa. Unsere Tochter heißt Marilyn und der, äh, junge Mann …«
»Jean-Luc«, sagte der Junge, sprang auf, legte eine Hand an sein Basecap und ließ sich wieder in den Sessel plumpsen.
»Ich selbst heiße Kevin«, fuhr der Familienvater fort, wobei er den Hintern zehn Zentimeter vom Sofa lupfte, es sich dann wohl anders überlegte und sich mit einem reflexhaften Griff nach den Hosenbeinen wieder setzte. »Ich bin Versicherungsvertreter. Das ist jemand, der anderen Leuten …«
»Wir sind mit dem Konzept vertraut«, fiel ihm Albert ins Wort. »Wenn seine« – er zeigte auf den kantigen Roboter – »Programmierung abgeschlossen ist, wird er Versicherungsmathematiker.«
»Schau-spie-ler«, widersprach der Kantige.
»Das ist kein Beruf für einen Roboter.«
»Ist. Es. Doch.«
»Ich habe Durst«, verkündete Marilyn.
»Du hast doch vorhin erst etwas getrunken«, sagte ihre Mutter.
»Ich habe aber Durst!«
»Warte noch ein bißchen, ja, Liebling?«
Das Mädchen zog einen Flunsch, sagte aber nichts und begann, hingebungsvoll in der Ritze zwischen der rechten Seitenlehne und der Sitzfläche des Sessels zu puhlen.
»Ach ja, die lieben Kleinen«, sagte Kevin. »Was macht eigentlich Ihr Go-zwei … äh …«
»Er heißt Goto«, half Jean-Luc seinem Vater aus. »Toller Vorname, das.«
»Wieso?« fragte Kevin verständnislos. Die drei Roboter wandten allesamt die Köpfe interessiert dem Jungen zu.
»Go-two«, erklärte Jean-Luc. »Die Zwei steht für ›to‹. EXE2BIN. RTF2HLP. F2F. Und so weiter. Ich will nämlich Programmierer werden«, teilte er mit, wobei er den kantigen Roboter ansah.
»Das werden wir noch sehen«, wandte sein Vater ein.
»Ich bin Programmiererin«, sagte Berta. »EXE2BIN deucht mich ein antikes Konvertierungsprogramm zu sein. Aber was ist F2F?«
Jean-Luc kam nicht zum Antworten, denn seine Mutter belehrte ihn: »Siehst du, die Roboter können sich sehr gut selber programmieren!«
»Selbstverständlich«, sagte die kleine Roboterin. »Das vermag jeder. Ich versuche mich indes an der Programmierung komplexerer Aufgaben auf dem Gebiet der konstruktiven Linguistik. Und worin finden Sie Ihre berufliche Erfüllung?« wandte sie sich an Theresa.
»Ich widme mich ganz meiner Familie.«
»Eine bewundernswerte Haltung«, sagte Albert. »Bei Menschenfrauen, meine ich.«
»Ich habe Durst!« brachte sich Marilyn in Erinnerung.
»Wir sehen uns in der glücklichen Lage, Ihnen ein Getränk anbieten zu können«, sagte Berta.
»Wir haben Bier«, erklärte Albert.
»Ich will Cola!« bestimmte das Mädchen.
»Damit können wir zu unserem größten Leidwesen nicht dienen. Unseren Informationen zufolge trinken Menschen Bier.«
»Nur manche.« Theresa bedachte Kevin mit einem Seitenblick, worauf dieser eilends sagte: »Ich muß noch fahren.«
»Cola!«
»Es gibt keine. Und Bier kriegst du nicht, das ist nichts für Kinder. Alkohol ist Gift.«
»Aber nicht so giftig wie Wasser«, trug Albert zur Unterhaltung bei.
»Ich will kein Wasser! Ich will Cola!«
»Gib Ruhe, blöde Trine«, sagte der Junge über den Tisch hinweg.
»Jean-Luc!« sagte seine Mutter in demselben Ton, in dem sie »Marilyn!« gesagt hatte, allerdings mit weniger Erfolg.
»Vielleicht willst du ein Kännchen Öl?« proponierte der Junge über den Tisch hinweg. Die Anwesenden schwiegen betreten; Kevin senkte den Blick auf seine linke Hand. Dann hob er nicht die Hand, sondern den Blick. Es lag Bedauern darin, sei es, weil sich der Besuch so unvorteilhaft entwickelte, sei es, weil er kein Linkshänder war.
»Wo hast du dein Laserschwert?« erkundigte sich Marilyn bei dem mattblauen Roboter.
»Ich habe kein Laserschwert«, antwortete dieser wahrheitsgemäß.
»Roboter haben immer ein Laserschwert«, verteidigte das Mädchen sein wer weiß woher gewonnenes Weltbild.
»Es. Gibt. Kei-ne. La-ser-schwer-ter«, sagte der kantige Roboter.
»Warum wird er nicht auch Programmierer?« fragte Jean-Luc, ohne sich an jemand bestimmtes zu wenden. »Das könnte er sogar mit einem Sprachfehler.«
»Sei endlich still und benimm dich!« zischte Theresa halblaut Jean-Luc zu, aber alle konnten es hören. »Du wolltest doch unbedingt nach Retroland! So hat man sich früher die Roboter vorgestellt.«
»Ich! Habe! Durst!« beharrte Marilyn in ziemlich derselben Sprechweise wie der kantige Roboter, nur wesentlich schriller. Dann stutzte sie und wechselte das Thema, sagte wesentlich moderater: »Ich muß mal.«
»Was muß sie?« erkundigte sich Berta, ganz die umsichtige Hausfrau.
»Pinkeln«, sagte Jean-Luc. Alle drei Gastgeber neigten die Köpfe ein wenig nach links (von ihnen aus gesehen), was bei Robotern mit ihrer naturgemäß etwas eingeschränkten Mimik Unverständnis signalisiert.
Theresa deutete die Bewegung instinktiv richtig. »Sie muß zur Toilette.«
Dieses Wort kannte der mattblaue Roboter, es war in seiner Berufsprogrammierung beiläufig vorgekommen. Albert war Entwässerungstechniker, eine überaus verantwortungsvolle, ja gefährliche Tätigkeit – aber irgendwie war die Sprache nicht darauf gekommen.
»Eine Toilette ist ein Ort, wo man verbrauchte Flüssigkeiten kontrolliert abgeben kann«, erklärte er. »Hauptsächlich Wasser«, setzte er hinzu, und in seiner Stimme schwang eine leise Mißbilligung.
»Ich bin untröstlich«, sagte Berta, und sie klang tatsächlich so. »An einer solchen Vorrichtung mangelt es leider durchaus in unserer bescheidenen Behausung.«
»Du hättest sie nicht soviel trinken lassen sollen«, sagte Kevin überflüssigerweise zu seiner Frau.
»Wieso ich? Du warst doch mit ihr im Getränkestützpunkt.«
»Was ist ein Getränkestützpunkt?« interessierte sich Albert, bekam aber keine Antwort.
»Tja«, sagte Theresa. »So leid es mir tut, aber dann werden wir uns wohl vorzeitig verabschieden müssen.« Sie stand auf und zog das Mädchen bei der Hand vom Sessel.
Man verabschiedete sich, bedankte sich und äußerte wechselseitiges Bedauern über die unerwartet eingetretene Ausnahmesituation. Die gesamte Roboterfamilie begleitete die vier Besucher vors Haus.
»Besuchen Sie uns doch bald wieder«, schlug Albert vor.
»Ja doch, gern. Wenn es sich finanziell einrichten läßt. Retroland ist nicht billig.«
»Kevin!« sagte Theresa vorwurfsvoll, und alle taten, als ob sie nichts gehört hätten.
Dann stieg Familie Meiers in ihr großes, chromblitzendes Automobil. Kevin am Steuer schaltete die Scheinwerfer und das blaue Blinklicht ein und fuhr los. Die Roboter schauten ihnen nach, bis der Wagen zwei Querstraßen weiter mit knirschenden Ketten abbog und verschwand. Nur der schwarze Rauch aus seinem Schornstein hing noch eine Weile in der Luft. Die Roboterin hörte auf zu winken.
»Gotthelf«, sagte sie zu dem kantigen Roboter, »du hast dich wieder einmal unmöglich aufgeführt. Kannst du nicht reden wie ein normaler Roboter?«
»Er ist viel zu nachgiebig programmiert, wenn du mich fragst«, bemerkte Albert. »Aber du hast auch irgendwie merkwürdig gesprochen.«
Berta ignorierte den Einwurf und fuhr fort, an den kantigen Roboter gewandt: »Dir zuliebe haben wir sie doch kommen lassen! Was sollen denn die Menschen jetzt von uns denken?«
»Das waren doch nie und nimmer richtige Menschen!« entgegnete Gotthelf flüssig und mit normaler Betonung.
»Natürlich nicht«, erklärte Albert. »Aber so ähnlich muß man sich nach allem, was wir über sie wissen, die Menschen vorstellen; es sind die besten Rekonstruktionen, die von Retroland angeboten werden.«
Die Maschine
Der Ball 1
Tut mir leid, meine Dame, aber ich tanze nicht. Nein, überhaupt nicht. – Das ist etwas anderes; die Polonaise zu Beginn gehört zu meinen Dienstpflichten. Ich kann mich nicht entsinnen, daß jemals ein Sprungball ohne Polonaise begonnen hätte oder daß der Schiffskapitän die nicht angeführt hätte … Das war schon in meiner Jugend so, und die liegt leider ziemlich lange zurück. Damals war ich nur Maschinenassistent und hatte gar keinen Zugang zu dem Ball, doch es wurde viel davon erzählt. – Aber, Verehrteste, was stehen wir hier herum? Setzen wir uns doch wieder. Wenn Sie für eine Weile am Tisch des Kapitäns Platz nehmen möchten …? Würde mich freuen.
Na, dann sagen wir eben, ersatzweise, für den ausgeschlagenen Tanz. Und wenn auch Ihr Partner oder Ihre Partnerin uns die Ehre geben würde … Oh, das ist betrüblich. Dann also nicht. Ich darf Ihnen meine Frau Irina vorstellen – Irina, das ist Frau, äh, danke, Frau Bonderanaike. Bandaranaike natürlich, verzeihen Sie, gnädige Frau. Frau Banderanaike ist zum erstenmal auf einer interstellaren Reise, daher ist das auch ihr erster Sprungball. Gewiß doch, Frau B-andaranike, es kommen noch mehr Bälle und Bordfeste, jede Menge, aber der Sprungball ist eben doch etwas besonderes, denn was die Reisezeit angeht, haben wir jetzt noch den größeren Teil vor uns, aber räumlich gesehen sind wir nach dem Sprung so gut wie am Ziel, nur noch ein paar Lichtstunden von Gilgamesch entfernt.
Ganz recht, ein Jahr ungefähr, genau genommen ein wenig mehr, so an die dreizehn Monate. So günstig wie bei dieser Reise sind wir noch nie aus dem Sprung gekommen, seit ich dabei bin.
Aber nein, das ist nun wirklich nicht mein Verdienst. Es ist nicht genau zu kalkulieren, also ist es einfach nur Glück. Wenn jemand bei den Einstellungen richtig geraten hat, dann die Leute von der Startstation. Trinken wir auf die … Verdammt, Sie haben ja noch gar kein Glas. Und kein Stewart da. Wieso sehen die nicht, wenn sich jemand an den Tisch des Kapitäns setzt? Ah, da kommt endlich einer. – Was schon, guter Mann, ein Glas für die Dame!
Ich bitte um Entschuldigung, der Mann scheint neu zu sein. Wissen Sie, ein paar von unseren Stewarts sind PKs, sehr tüchtige Leute, Sie werden den einen oder anderen schon bei der Arbeit erlebt haben, aber bei so einem besonders festlichen Anlaß wie dem Sprungball verzichten wir möglichst auf sie, sie passen irgendwie nicht ganz zur Atmosphäre, Sie verstehen …
Gottchen, Irina, natürlich versteht das Frau Bandaranaike, tun Sie doch, nicht wahr? Keine Frage, wir sind doch hier nicht in der Zweiten Klasse … Ja, und dann müssen wir an Stelle der PKs eben ein paar andere Leute von der Mannschaft als Stewarts einsetzen, die vielleicht nicht ganz den letzten Schliff haben, aber von ihrer, äh, Erscheinung her besser dem Anlaß entsprechen.
So eine Persönlichkeitskopie ist ja langlebig, und weil auf der Erde PKs verboten sind, bleiben sie so lange auf den Wellenschiffen, bis sie sich irgendwann einmal auf einer Kolonialwelt oder einem Fremdplaneten niederlassen. Wenn sie dort ihre Unterhaltkosten aufbringen können – Rechnerkapazität, Wartung des Kunstkörpers, Gebühren, Sie wissen schon. Oder auch nicht, brauchen Sie auch gar nicht zu wissen. Aber ich sage Ihnen, auf unseren Schiffen geht es den PKs gut, und zum Glück werden immer noch viel mehr neue Wellenschiffe gebaut als ausgemustert, so daß wir eigentlich nie überbelegt sind. Auf manchen Planeten gibt es unter den PKs arme Schweine, die können sich nicht einmal einen Kunstkörper leisten, die hängen dann in ihrem Rechner und …
Ja und?
Glaube ich nicht. Und falls doch, dann möchte ich mich für die Formulierung entschuldigen. Aber im übrigen hat meine Frau natürlich recht: Was rede ich denn so viel über PKs? So interessant ist das wirklich nicht. Sie wollen sicherlich lieber etwas von anderen Welten hören. Von Gilgamesch brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, das ist ja unsere größte Kolonialwelt, über die weiß man auf der Erde bestens Bescheid, und es wandern eine Menge Leute dorthin aus. In der Zweiten Klasse sind auf dem Hinweg jedesmal alle Kältesärge voll – bis auf die Reserve für die Erste Klasse und die Besatzung, versteht sich –, und zurück fliegen wir fast leer.
Auf Rotfarn beispielsweise ist das ganz anders. Das ist ja der einzige von Außerirdischen bewohnte Planet, auf dem wir eine Niederlassung einrichten durften. Hin kommt man fast von überall, aber dort haben sie immer noch den ersten, kleinen Hoyler – Hoyle-Generator, meine ich –, mit dem man nur bis zur nächsten besiedelten Welt kommt, und auch das mit so großer Streuung, daß man im Zielgebiet …
Ja, Stewart, was ist? – Ich hab doch gesagt, ich will heute abend hier kein Com hören, hab extra keins eingesteckt. Das kann alles der Fahrtkapitän erledigen, dazu ist er da, und der wird ja wohl nicht anrufen. Was? Na schön, geben Sie her. – Rodionow. Ich höre.
Moment mal, wer spricht da? – Aha. Gut, und jetzt noch mal ganz ruhig von vorn.
Die WS Ninhursag ist verschrottet! Die könnt ihr nicht gefunden haben. Oder meinen Sie …? Klar, die Maschine der Ninhursag, die muß hier noch irgendwo sein. – Ja. Wie weit? – Hm. – Natürlich sendet sie, Kennung und Positionszeichen auf zwei Frequenzen, das wird sie noch jahrhundertelang machen. Aber warum erzählen Sie mir das, Mann? Haben Sie keinen Friseur? Bestellen Sie Ihrem Vorgesetzten, er …
Was? Wie bitte? Sie meinen, die Ninhursag – die Maschine der Ninhursag – sendet Sprechtext, und sie hat auf Ihren Anruf reagiert, es ist also keine Bandaufzeichnung? Und was … nein. Sagen Sie mir: Hat sich der Sprecher mit einem Namen gemeldet?
Ach.
Ach so. Doch, natürlich. Es war gut, daß Sie mich gleich benachrichtigt haben. Vergessen Sie meine Bemerkung vorhin. War unangebracht. – Doch. – Nein, Sie brauchen nicht mehr zu antworten. Und behalten Sie die ganze Sache für sich. Bis auf weiteres – absolutes Stillschweigen. Und lassen Sie ein Shuttle zum Start vorbereiten. Sofort. – Nein, brauche ich nicht, nur den Piloten. Wer hat Einsatzbereitschaft? – Sehr gut, den nehme ich. Oder nein, ich fliege allein. Ich sagte doch: ich. Ich fliege. – Nein, das regle ich selbst. Ist Fahrtkapitän Vishal bei Ihnen auf der Brücke? – Geben Sie ihn mir.
Arvind? Das ist Rodionow. Ich nehme an, du hast mitbekommen, was los ist? – Gut, das wäre dann klar. Paß auf, ich werde zur Ninhursag