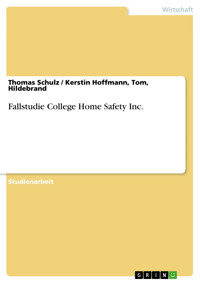4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Alzheimer heilen. Den Krebs besiegen. Jahrzehnte länger leben.
Lange Zeit konnten wir von solchen Durchbrüchen in der Medizin nur träumen. Doch bereits in den nächsten Jahren werden viele dieser Träume Wirklichkeit werden, denn im Silicon Valley wird gerade die Medizin neu erfunden. Mithilfe von Algorithmen, künstlicher Intelligenz und Unmengen an Daten entwickeln Start-ups und Konzerne wie Google, Microsoft, Apple und Co. bahnbrechende Therapien und verblüffende neue Diagnosemöglichkeiten. Thomas Schulz, langjähriger Silicon-Valley-Korrespondent des SPIEGEL, hat Einblicke in die geheimen Forschungslabore erhalten. In seinem Buch zeigt er, worauf Patienten hoffen dürfen, und erklärt, welche Chancen und Risiken die Zukunftsmedizin für jeden von uns birgt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 383
Ähnliche
Zum Buch
Aus dem Silicon Valley kommt die nächste Revolution, die unser Leben radikal verändern wird: die Neuerfindung der Medizin. Technikriesen wie Google und Microsoft, aber auch unzählige Start-ups entwickeln eine datenbasierte Computer-Medizin, die perfekt auf den einzelnen Patienten zugeschnitten ist. Bereits jetzt lassen sich durch neue Diagnosemöglichkeiten Veränderungen im Körper erkennen, bevor sie zu Krankheiten werden. Spektakuläre neue Therapien und hoch wirksame Medikamente versprechen, uns schon bald ein gesünderes, deutlich längeres Leben zu bescheren.
SPIEGEL-Reporter Thomas Schulz verfügt über exklusive Zugänge zu den Investoren, Konzernchefs und Forschern der boomenden Gesundheitsbranche im Silicon Valley. In seinem Buch zeigt er nicht nur, welche Therapien demnächst verfügbar sein werden – er gibt auch einen dringend benötigten Überblick, vor welche Herausforderungen diese Gesundheitsrevolution Politik, Wirtschaft und Gesundheitswesen stellen wird. Denn damit jeder Patient von der Zukunftsmedizin profitieren kann, müssen jetzt die richtigen Weichen gestellt werden.
Zum Autor
Thomas Schulz, geboren 1973, berichtete fast ein Jahrzehnt als Korrespondent für den SPIEGEL aus den USA: Zunächst ab 2008 aus New York, bevor er 2012 nach San Francisco wechselte, um die SPIEGEL-Redaktionsvertretung im Silicon Valley aufzubauen. Als SPIEGEL-Reporter schreibt Schulz seit dem Frühjahr 2018 über Risiken und Chancen des Fortschritts sowie die Auswirkungen der digitalen Revolution auf Gesellschaft, Politik und Kultur. Er ist ausgezeichnet mit dem Henri-Nannen-Preis, dem Holtzbrinck-Preis für Wirtschaftspublizistik sowie als Reporter des Jahres. Bei DVA erschien 2015 sein vielbeachteter und hoch gelobter Wirtschaftsbestseller »Was Google wirklich will«.
Thomas Schulz
ZUKUNFTS- MEDIZIN
Wie das Silicon Valley Krankheiten besiegen und unser Leben verlängern will
Deutsche Verlags-Anstalt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2018 Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München, und SPIEGEL-Verlag, Hamburg, Ericusspitze 1, 20457 Hamburg Umschlag: Büro Jorge Schmidt, München Umschlagmotiv: iStock.com/Matjaz Slanic Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-22292-5V004www.dva.de
Inhalt
Einleitung Das Zeitalter der digitalen Medizin beginnt jetzt
Digitale Biologie Wie die Zelle zur Software wird und warum der Kampf gegen Alzheimer im Silicon Valley geführt wird
Maschinen-Medizin Wie künstliche Intelligenz und die Macht der Algorithmen das Gesundheitssystem verändern
Angriff der Tech-Riesen Warum Google, Apple, Microsoft, Facebook & Co. in die Medizin drängen
Das Zeitalter der Genetik Wie wir unsere DNA manipulieren, um einen besseren, gesünderen Menschen zu schaffen
Der Kampf gegen Krebs Welche neuen Therapien Ärzte und Patienten hoffen lassen
Synthetische Biologie Wie eine Leber aus dem Drucker, künstliche Spermien und ein Modem fürs Gehirn unseren Körper reparieren – und erweitern – sollen
200 Jahre leben Wie wir alle immer älter werden und Silicon-Valley-Utopisten die Unsterblichkeit planen
Der digitale Patient Warum die Zukunftsmedizin personalisiert, präzise und präventiv sein wird
Medizin im Jahr 2030 Warum Deutschland auf die Gesundheitsrevolution nicht vorbereitet ist – und was nun zu tun ist
Register
Für Sam
Wie groß sind die Fortschritte der Menschheit, wenn wir auf den Punkt sehen, von dem sie ausging, und wie klein betrachten wir den Punkt, wo sie hin will.
FRANZ GRILLPARZER
Es ist schon ein großer Fortschritt, den Willen zum Fortschritt zu haben.
SENECA
Einleitung
Das Zeitalter der digitalen Medizin beginnt jetzt
Jeden Januar ist in der Innenstadt von San Francisco ein seltsames Schauspiel zu beobachten: Für drei Tage füllen sich die Straßen bis tief in die Nacht mit 20000 aufgeregt diskutierenden Menschen, Rock-Festival-Stimmung liegt in der Luft. Wer genau hinhört, erwischt immer wieder die gleichen seltsamen Wortschnipsel: »Proteinausprägung«, »T-Zellen«, »Antigene«, »PD-1-Inhibitor«. In fast allen Bars, Restaurants und Galerien versammeln sich Mediziner, Biologen, Wissenschaftler, die Eingangsschilder sind überklebt mit neuen Namen: Merck, Genentech, Max-Planck-Institut, Harvard University.
Der Grund für diesen Ausnahmezustand ist die JP Morgan Healthcare, die größte Konferenz für Biotechnologie und Medizinforschung der Welt, ein dezentrales, chaotisches Forschungsfest mit Hunderten Veranstaltungen an Dutzenden Orten. Es gibt keine Webseite, keine Eintrittskarten. Aber alle Protagonisten, die an der menschlichen Gesundheit forschen, die mit der Medizin Geld verdienen oder das Gesundheitssystem regulieren, finden im Januar den Weg nach San Francisco: Pharmakonzerne, Universitäten, Forschungslabore, Start-ups, Politiker. Auf den Bühnen und in den Konferenzsälen werden große, zukunftsweisende Themen diskutiert, »Designing the Human Future« etwa oder »Die nächsten Schritte im Krieg gegen den Krebs«. Aber die eigentliche Veranstaltung findet jenseits der Podien statt, bei privaten Partys und Gesprächen hinter verschlossenen Türen.
So wie bei dieser Feier in der Suite eines Luxushotels. Vor der Tür reichlich Sicherheitspersonal, dahinter knapp 30 Gäste: Vier führen Milliardenkonzerne, zwei haben einen Nobelpreis, zwei weitere gelten als sichere Kandidaten, ihn noch zu erhalten. Ein spontanes Get-together nach Mitternacht, erst wenige Stunden vorher flogen SMS und E-Mails hin und her, Zugang nur mit den richtigen Verbindungen. Und einer Flasche Champagner, schnell an der Hotelbar besorgt, aber bitte nicht den billigsten.
Die Stimmung brodelt, ein Stimmenwirrwarr, doch diskutiert wird nur ein Thema: wie sich mit neuen Gentherapien der Krebs nicht einfach besser bekämpfen, sondern niederringen, besiegen, ja heilen lassen kann. Schließlich zückt einer der Forscher einen Textmarker und beginnt, Formeln an die Hotelwände zu malen, zögert kurz, doch ein Pharmaboss ruft: »Scheiß drauf, mach weiter, ich übernehme die Renovierungskosten!« Eine nervöse Energie durchdringt den Raum, eine seltsame Mischung aus fiebrigem Enthusiasmus und konzentrierter Anspannung.
Ähnlich ist die Atmosphäre in diesen Tagen fast überall, wo an der menschlichen Gesundheit geforscht wird: in den Laboren der Universitäten und Biotech-Start-ups, in den Forschungsinstituten und in den Konzernzentralen der Pharmakonzerne. Unter Biologen und Medizinern herrscht ein bislang nie da gewesener Optimismus, befeuert von zahllosen Entwicklungen in zahllosen Bereichen, die alle gleichzeitig auf sie einprasseln und die vieles möglich machen, was doch gerade eben noch völlig utopisch schien: Krebs zu heilen, Zellen zu programmieren, künstliche Organe zu züchten, das Gehirn mit Maschinen zu verbinden, Gene zu manipulieren, Krankheiten per Knopfdruck zu besiegen, das Leben um 20, 30 Jahre zu verlängern. Die Menschen nicht nur gesünder, sondern klüger, hübscher, jünger zu machen.
Egal, wen man fragt, nahezu einhellig sehen Experten, Forscher, Wissenschaftler die Medizin am Beginn einer Revolution. Die Menschheit ist auf dem Weg in eine technologisierte, datengetriebene, digitale Gesundheitswelt mit neuen Möglichkeiten für die Diagnose und die Therapie von Krankheiten und mit Medikamenten, die uns ein längeres, gesünderes Leben bringen sollen.
»Wir stehen am Beginn einer transformierenden Ära in Wissenschaft und medizinischer Technologie«, sagt der Chef der amerikanischen Arzneimittelzulassungsbehörde.
»Eine medizinische Revolution hat begonnen«, sagt die Leiterin des Dana-Farber-Instituts, des führenden Krebsforschungszentrums der USA.
»Der wissenschaftliche Fortschritt ist gigantisch«, sagt der Chef des Pharma-Riesen Roche.
»Die technische Entwicklung hat ein neues Zeitalter der Medizin eingeleitet«, sagt der Forschungschef von Microsoft.
»Wir haben die Fähigkeit entwickelt, die Evolution zu kontrollieren«, sagt Jennifer Doudna, Mit-Erfinderin der Crispr-Technologie, einer Art Gen-Schere, mit der sich das Erbgut von Pflanzen, Tieren, Menschen zurechtschneiden lässt.
Was ist da im Gange? Woher kommt dieser plötzlich so enorme Optimismus, dieser Enthusiasmus? Waren es nicht dieselben Forscher und Experten, die bislang immer bedauernd betonten, dass medizinische Forschung unendlich schwer und die Biologie zu kompliziert sei, um sie wirklich zu entschlüsseln?
Doch heute ist alles anders. Wir stehen am Beginn gewaltiger Veränderungen, nicht nur in der Medizin, sondern in allen Bereichen unseres Lebens. Das ist die zentrale Erkenntnis, die sich mir nach mehr als einem halben Jahrzehnt als SPIEGEL-Korrespondent im Silicon Valley, im Nexus des globalen Fortschritts, unweigerlich aufgedrängt hat.
Denn wir sind an einem Punkt angelangt, an dem Entwicklungen aus Jahrzehnten zusammenfließen, an dem neue Technologien aus allen möglichen Bereichen verschmelzen: aus Chemie, Physik, Materialwissenschaften, Robotik. Im Englischen gibt es ein Wort für diesen Prozess, für das gleichzeitige Zusammenfließen und Beschleunigen, und es dient als eine Art Zauberwort hier im Silicon Valley, das hervorgeholt wird, wann immer es den nächsten, scheinbar überraschenden Fortschrittssprung zu erklären gibt: Convergence.
Die Digitalisierung hat zwei Jahrzehnte gebraucht, um langsam durchzusickern in jeden Winkel, jede Ecke der Zivilisation. Jetzt beginnt sie, ihre beschleunigenden Kräfte wirklich freizusetzen. Hierin liegt die eigentliche Erklärung für die rasante Entwicklung, die wir gerade erleben, in der Medizin ebenso wie in vielen anderen Bereichen: Der Fortschritt verläuft nicht geradlinig, sondern exponentiell. Er bewegt sich in Verdopplungssprüngen, die mit der Zeit immer gewaltiger werden.
Als Metapher hilft die Geschichte von der Erfindung des Schachspiels. Der Legende nach verhandelte der Erfinder des Schachspiels seine Bezahlung mit dem Kaiser von Indien so: »Alles, was ich will, ist ein Häufchen Reis. Lass uns die Menge ermitteln, indem wir ein Reiskorn auf das erste Feld des Schachbretts legen, auf das zweite zwei Körner, auf das dritte vier, auf das vierte acht, und so immer weiter mit den Verdopplungen, bis zum letzten, dem 64. Feld.«
Auf den ersten Feldern liegen also sehr wenige Reiskörner. Das war die bisherige Geschichte des Fortschritts in den vergangenen 10000 Jahren Menschheitsgeschichte: Er wächst zwar exponentiell, aber es fühlt sich linear an, weil der Verdopplungseffekt in der Summe immer noch relativ klein ist. Richtig interessant wird es erst in der zweiten Hälfte des Schachbretts. Dort explodieren die Zahlen: Nach 32 Schachfeldern kommen bereits Milliarden Reiskörner zusammen. Viele Wissenschaftler sind der Meinung, dass wir zu Beginn dieses Jahrzehnts die zweite Hälfte des Schachbretts erreicht haben, dass die exponentiellen Sprünge, die der Fortschritt macht, nun so atemberaubend sind, dass man sie immer schwerer begreifen kann.
Doch zu spüren sind die Folgen des sich rasant steigernden Fortschritts schon jetzt. Und im nächsten Jahrzehnt werden sie noch deutlicher werden und sich auf alle Lebensbereiche erstrecken. Nirgends jedoch werden sie existentieller sein als in der Medizin und in der Biologie.
Das vergangene Jahrhundert war davon geprägt, dass wir gelernt haben, zwei grundsätzliche Bausteine der Welt zu verstehen: das Atom und das Byte. Beide Entdeckungen haben uns gezeigt, welch große Folgen es haben kann, kleinste Einheiten zu beherrschen. Nun sind wir auf dem Weg, die dritte Grundeinheit zu beherrschen: das Gen. Wenn es uns gelingt, die Kontrolle über die biologische Information zu erlangen, wird das die Welt erneut grundlegend verändern. Dann wird der Mensch zum Schöpfer, der die nächste Stufe der Evolution selbst in die Hand nimmt.
Dass dieses Buch zum wesentlichen Teil im Silicon Valley spielt, sollte heute kaum noch überraschen. Schon lange hat sich die Region um San Francisco zum Zentrum des globalen Fortschritts aufgeschwungen. Nicht nur, weil sich hier mit Tausenden von Konzernen und Start-ups das Rückgrat der Technologieindustrie befindet, sondern weil sich hier auch die Visionäre und Utopisten sammeln, die Größenwahnsinnigen und Rücksichtslosen. Weil das Geld hier in Strömen fließt wie nirgends sonst auf der Welt, Abermilliarden an Wagniskapital jedes Jahr. Ein perfekter Nährboden für große Ideen und weltverändernde Entwicklungen.
Die Entschlüsselung der Biologie ist die nächste Weltveränderungsidee im Silicon Valley, der Mensch wird dabei vor allem als Rechenaufgabe gesehen. Die Logik geht so: Die heranrollende biologische Revolution ist eine digitale Revolution. Riesige Datenmengen auszuwerten wird jeden Tag leichter, die Rechenkraft explodiert, künstliche Intelligenz, die neue Wunderwaffe, hilft dabei. Wer beherrscht all diese Instrumente besser als die Tech-Riesen?
Zugleich ist die Medizin eine globale Billionenbranche. Und damit ein riesiges Geschäftsfeld. Gesundheitsausgaben machen in den meisten Ländern den größten Teil des Bruttosozialproduktes aus. In den USA etwa fließen 20 Prozent der Staatsausgaben in das Gesundheitssystem. Deswegen arbeiten sie in den Konzernzentralen in San Francisco und Seattle nun an medizinischer Grundlagenforschung: Wie lässt sich Krebs besiegen? An medizinischen Geräten: Wie lassen sich Blutwerte, Insulin, Herzschlag rund um die Uhr analysieren? An medizinischer Datenverarbeitung: Wie lassen sich Patienteninformationen, klinische Studien, Forschungsergebnisse maschinell auswerten?
Bereits vorhanden sind ganze Datenbanken voll genetischer Informationen, Milliarden und Abermilliarden Gigabyte an DNA-Analysen, an Wissen über unser Erbgut. Neue Mischformen wissenschaftlicher Disziplinen sind entstanden, wie die synthetische Biologie oder die Bio-IT, die dieses Wissen ständig erweitern, auswerten und zu neuartigen Therapien und Medikamenten entwickeln.
Schon heute lassen sich Tumore bis ins Detail analysieren, können Patienten mithilfe ihrer eigenen, gentechnisch aufgerüsteten Immunzellen erfolgreich den Krebs bekämpfen. Gentherapie ist eine alte Idee, die von klugen Köpfen bereits vor Jahrzehnten ersonnen wurde, aber lange als technisch unmöglich beiseitegelegt werden musste. Das ist die erste Hälfte der medizinischen Revolution: totgesagte Visionen, die nun auf einmal möglich werden.
Hinzu kommen, als zweiter Teil, ganz neue Ideen wie diese: Forscher entwickeln Moleküle, die in die Zellen geschleust werden und dem Körper als Anleitung dienen, sein eigenes Medikament zu produzieren. Das klingt nach Science-Fiction, nach einer Idee, die noch vor wenigen Jahren jeder Mediziner, jeder Biologe für verrückt erklärt hat. »Die Fortschritte der vergangenen zehn Jahre waren geradezu surreal«, sagt Stephane Bancel, Chef von Moderna, dem Biotech-Start-up, das diese Technologie entwickelt hat. »Es fühlt sich an, als lebten wir heute bereits in einem anderen Zeitalter als noch 2006.«
Von hier ist der Weg nicht weit zu extremeren Visionen: die Grenzen der Biologie zu sprengen und das Leben nicht um zehn, sondern um 50 Jahre verlängern zu können. Bis der Tod nur noch ein technologisches Problem ist? Es gibt einige, die so denken im Silicon Valley, und längst nicht alle sind Utopisten. Google etwa gründete eine Tochterfirma, um die Lebensverlängerung zu erforschen, dort arbeiten keine Spinner, sondern einige der führenden Genetiker der Welt.
Einig sind sich Utopisten und Pragmatiker, Techno-Biologen und Schulmediziner in einem: Der Weg zu einem längeren, gesünderen Leben geht über eine personalisierte Medizin, mit auf den einzelnen Menschen zugeschnittenen Therapien, die auf Analysen des Erbguts und anderer individueller Daten beruhen. Das bedeutet eine grundlegende Abkehr von der Welt der Massenmedikamente, in der eine Behandlung für möglichst viele Menschen wirken muss. Mindestens ebenso systemverändernd wird sein, dass die personalisierte digitale Medizin nicht nur reaktiv, sondern vor allem proaktiv ist: Sie setzt darauf, Krankheiten wie Krebs oder Herzerkrankungen in einem möglichst frühen Stadium zu erkennen, in dem sie leichter zu bekämpfen sind.
Wie wird diese neue Gesundheitswelt für den Patienten aussehen? Genauso, wie wir uns heute nicht mehr vorstellen können, wie es war, ohne Handy gelebt zu haben, werden wir uns in einigen Jahren fragen, wie wir uns beim Arzt behandeln lassen konnten, ohne auf einen riesigen Datenschatz zugreifen zu können: die Analyse unserer DNA, die Zusammensetzung unseres Mikrobioms, Grundzüge des persönlichen Proteoms. Bei der Diagnose werden neue medizinische Sensoren helfen, die wir am oder gleich im Körper tragen oder die einfach ins Smartphone integriert sind. Sie messen Bewegung, Herz, Blutdruck und warnen, wenn die Werte aus dem Ruder laufen.
Daten, so viel ist klar, sind der Schlüssel für diese Zukunftsmedizin: ausgelesen aus Geräten, Genomen, Sensoren und zahllosen Tests zu allen möglichen Biomarkern. Am besten zu Hause zu machen, ruckzuck, in den USA gibt es bereits Gentests und Mikrobiom-Analysen in der Drogerie, gesammelt, ausgewertet, analysiert von Maschinen, aufbewahrt und verarbeitet von Unternehmen. Mit unseren Gesundheitsdaten wird Geld zu verdienen sein. Ist das der Preis, den es zu zahlen gilt? Persönliche Daten gegen Gesundheit?
Der Arzt wird in dieser Welt nicht mehr nur Heiler und Arzneiverschreiber sein, sondern auch Gesundheitscoach und Datenmanager. Oder wird er am Ende zumindest teilweise durch die Maschine ersetzt? Die Informatik befindet sich in der nach Expertenmeinung größten Transformation seit der Erfindung des Computers, dank künstlicher Intelligenz. Kluge Maschinen sind dabei, Ärzte in immer mehr Bereichen zu ergänzen. Und werden ihnen manche Aufgaben bald schon ganz abnehmen.
Was für enorme Versprechungen stecken in dieser Maschinenmedizin: neue Medikamente, weil Software nach neuen Wirkstoffkombinationen suchen kann. Neue Behandlungspläne, weil Algorithmen die individuelle Krankheitsgeschichte analysieren und mit der von Tausenden anderen Patienten vergleichen. Arbeitserleichterung für Ärzte, weil Software durch Gesichtsanalyse genetische Erkrankungen erkennt oder CT-Scans von Tumoren analysiert.
Auch wenn einige schon vor dem Missbrauch unserer Daten oder der Übermacht der Maschinen warnen, überwiegen doch deutlicher die Hoffnungen, schon weil Computerisierung bislang immer alles effizienter und billiger gemacht hat. Ständig steigende Gesundheitskosten sind das drängendste strukturelle Problem alternder Gesellschaften. Wenn durch Technologie die Kosten für den Einzelnen wie auch für die Gesamtheit gesenkt werden, wer würde sich dem entgegenstellen?
Klar ist: Diese neue Welt rast heran, ohne dass absehbar wäre, wie sie gestaltet wird. Und von wem. Wer Gewinner sein wird, wer Verlierer. Deswegen ist dies im Kern ein Buch über den Fortschritt, den es zu verstehen, zu bewältigen und vor allem auch zu debattieren gilt.
Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten, und das ist gut so: Die Geschichte belegt, dass es der Menschheit mit jeder Dekade immer besser geht. Das zunehmende Tempo des Fortschritts erhöht aber auch den Druck enorm, sich früher mit möglichen Zukunftsszenarien zu beschäftigen. Über Therapien mit Stammzellen wird seit 20 Jahren diskutiert, weil sich die Technologie nur so langsam entwickelte. Aber wenn nun in einem Jahr passiert, was gerade noch zehn Jahre brauchte, dann können wir nicht in Ruhe abwarten, sondern müssen möglichst früh darüber diskutieren, welche gesellschaftlichen und ethisch-moralischen Probleme die neuen Entwicklungen aufwerfen.
Denn die auf uns zurollenden gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen, ethischen Fragen könnten größer, grundsätzlicher nicht sein: Wird sich jeder ein längeres, gesünderes Leben leisten können? Oder wird die Gesundheit zum Statussymbol? Soll alles, was medizinisch möglich ist, auch getan werden? Selbst wenn es um Eingriffe in die Keimbahn oder um ungeborenes Leben geht? Wer darf darüber mitbestimmen, welche Experimente, welche Therapien zulässig sind und welche nicht? Wer formt den Weg in diese Zukunft der Medizin?
Natürlich wird auch jetzt wieder vieles, was längst im Gange ist, eine Zukunft, die sich bereits zu formen beginnt, abgetan als wilder Wissenschaftsoptimismus. Als Ideologie von Futuristen und aufgeregtes Geplapper der Ahnungslosen, Unkritischen. Als Hype aus dem Silicon Valley, gemacht, um Produkte zu verkaufen. Das war schon einmal so, zu Beginn der Internet-Revolution. Als viele die Digitalisierung kleinredeten, als sie erst über die Weltveränderungs-Ambitionen von Google, dann über die von Facebook lachten. Als das erste iPhone manchen als unausgereiftes Spielzeug ohne große Zukunft galt.
Sicher wird nicht alles funktionieren, was sich die Forscher nun in ihren Laboren erträumen. Und es wird Irrwege geben, teils gefährliche. Doch selbst wenn das, was sich nun am Horizont abzeichnet, doch erst in 15 Jahren Realität wird statt in fünf und dabei auch noch ganz anders kommt als gedacht: Nur jetzt lässt sich die Zukunft noch mitgestalten. Bevor sie wieder gestaltet wird, von wenigen.
Wie sollen wir also umgehen mit diesem neuen Zeitalter der Genetik, das nun anbricht? Auf dessen Höhepunkt eine neue Medizin stehen wird. Oder ein neuer Mensch. Das ist keine rhetorische Zuspitzung, sondern wohl bald schon Realität. Mit Crispr, einer Art Gen-Schere, lassen sich Gene zielgenau wie in einem Textverarbeitungsprogramm per Suchen und Ersetzen einfach herausschneiden oder verändern und damit die grundlegenden Eigenschaften von Pflanzen, Tieren, Menschen manipulieren. Die Technologie ist kaum fünf Jahre alt, doch in China und den USA experimentieren sie damit bereits an Embryonen. Eingriffe in die Keimbahnen, vererbbare Veränderungen an der Natur, sind für die Wissenschaftler keine große Herausforderung mehr.
Wie weit ist der Weg von hier zu ewiger Jugend? Zu einer Welt ohne Krebs? Zu Designerbabys? Zur Eugenik? Man braucht keinen Doktor in Molekulargenetik und auch kein Philosophiestudium, um zu verstehen: Wenn wir erst unser eigenes Schicksal entziffern können, wie es in unserem Erbgut steht, und dann lernen, dieses Schicksal technologisch selbst neu zu schreiben, ändert sich der Weg der Menschheit grundsätzlich.
»Wenn man sich vor Augen führt, welche immensen Herausforderungen in diesem Zusammenhang auf uns zukommen, wundert man sich, dass es dazu noch keine intensivere Debatte gibt«, sagt Peter Dabrock, Theologe und Ethiker an der Universität Erlangen-Nürnberg und Vorsitzender des Deutschen Ethikrats.
Das zu ändern, über diese entstehende neue Zukunftswelt zu informieren, die Mosaiksteine zusammenzufügen und eine breitere Debatte zu eröffnen, ist das Ziel dieses Buches. Entsprechend ist »Zukunftsmedizin« kein Gesundheitsratgeber und auch kein Buch über das Pharmageschäft und seine vielen Schattenseiten. Es geht nicht um einzelne Geschäftsmodelle und um die Frage, welche Ideen, Projekte, Technologien im Detail funktionieren werden, ob sich das eine oder andere konkrete Medikament durchsetzt.
Vielmehr soll dieses Buch einen Überblick geben, was sich anbahnt und warum. Es wird in geheime Forschungslabore und Werkstätten führen, zu Nobelpreisträgern und den Chefs der mächtigsten Unternehmen der Welt, hinter die Kulissen der vielversprechendsten Start-ups und Konzerne schauen. Die Grundlage dafür liefern meine über fast ein Jahrzehnt gesammelten Einblicke in die Unternehmenszentralen und Labore des Silicon Valley, die vielen Begegnungen und Gespräche mit den Protagonisten der digitalen Revolution, von Google-Gründer Larry Page über Facebook-Anführer Mark Zuckerberg bis Microsoft-Chef Satya Nadella. Hinzu kommen über 150 Interviews mit Forschern, Unternehmensführern, Investoren, mit Biotech-Experten, Medizinern, Ethikern.
Dabei gilt es zum Auftakt des Buches, im Kapitel »Digitale Biologie«, zunächst die Grundlagen dieses sich anbahnenden Zeitenwandels zu beleuchten: den Mikrokosmos Silicon Valley mit seiner einzigartigen Mischung aus Ideologie und enormen Geldströmen. Ein perfekter Nährboden für die Entwicklung der Technologien, die nun unsere Welt noch einmal so grundsätzlich verändern werden wie das Internet: Wieso künstliche Intelligenz auf einmal solche Sprünge macht und was dies für unsere Gesundheit bedeutet, beschreibt das zweite Kapitel »Maschinen-Medizin«. Darauf folgt, im Kapitel »Angriff der Tech-Riesen«, warum deswegen nun Google, Apple, Microsoft, Facebook und die führenden Geldgeber des Silicon Valley in die Medizin drängen – und woran genau sie arbeiten. Die Macht der digitalen Instrumente lässt die Biologie des Menschen berechenbarer werden, eröffnet den Weg etwa zu Gentherapien: Die DNA zu beherrschen, sie nicht nur zu analysieren, sondern auch zu manipulieren, ist der Kern der Datenmedizin, so zeigt das vierte Kapitel »Das Zeitalter der Genetik«. Wenn diese neue Zukunftsmedizin ihre Versprechungen erfüllen soll, muss sie dies vor allem im Kampf gegen den Krebs beweisen. Große Sprünge in den vergangenen Jahren, beschrieben im fünften Kapitel »Der Kampf gegen Krebs«, machen Hoffnung. Das sechste Kapitel »Synthetische Biologie« wirft einen Blick weiter nach vorne, auf grundlegend neue Ideen, die bereits erforscht werden, aber noch einige Jahre in der Zukunft liegen: die Züchtung künstlicher Organe und die Ergänzung oder gar Verbesserung des Menschen mithilfe von Implantaten. Werden wir dank der Zukunftsmedizin länger leben? Die meisten Experten im Kapitel »200 Jahre leben« sagen Ja, die Lebenserwartung werde sich deutlich steigern, vielleicht bis auf 120 Jahre. Manche im Silicon Valley hoffen dagegen auf 200, irgendwann sogar 500 Jahre Lebenserwartung. In jedem Fall wird die Zukunftsmedizin präziser sein, individueller. Und proaktiv. Das achte Kapitel »Der digitale Patient« zeichnet detailliert auf, wie sich all die neuen Instrumente für den Patienten zusammenfügen. Es sind zweifelsohne große Veränderungen, und sie bringen vielleicht auch große Verwerfungen: Was nun zu tun ist, welche Aufgaben sich für die Politik und uns alle stellen, wird zum Abschluss diskutiert, mit einem Blick auf die »Medizin im Jahr 2030«. Dabei stellt sich vor allem die Frage: Wird sich jeder die Zukunftsmedizin leisten können?
Auffallend war im Zuge der Recherchen, dass sich all diese Protagonisten des sich anbahnenden Zeitenwandels und seiner Bedeutung sehr bewusst sind. Auch das unterscheidet sie von großen Teilen der Gesellschaft, die von den massiven Veränderungen in der Medizin noch kaum etwas wissen. Zu Recht werden große Hoffnungen in den Fortschritt in Wissenschaft und Forschung gesetzt, aber wenn die Mehrheit der Menschen immer weniger versteht, gar nicht verstehen kann, was passiert, dann geht auch die zentrale Frage, wer davon profitieren wird, an immer mehr Menschen vorbei. Und die Gefahr, dass die Profiteure letztlich nur eine Bildungselite, ein paar wenige Wohlhabende oder eine Handvoll US-Konzerne sein werden, wächst.
Es liegt an uns und unserem Wissen über die medizinische Revolution, die auf uns zukommt, ob diese neue digitale Gesundheitswelt ein Traum oder ein Albtraum werden wird.
1. Kapitel
Digitale Biologie
Wie die Zelle zur Software wird und warum der Kampf gegen Alzheimer im Silicon Valley geführt wird
Start-up kann ein irreführender Begriff sein in diesen Tagen des ungebremsten Booms und der großen Hoffnungen im Silicon Valley, in denen das Geld scheinbar vom Himmel fällt. Wer hinter dem Wort noch Garagen und Pizzakartons und Ikea-Schreibtische vermutet, wird schnell enttäuscht. Stattdessen kann es in einem Unternehmen, kaum zwei Jahre alt, so aussehen: ein Glaspalast mit langen weißen Gängen, gesäumt rechts und links von glänzenden Laboren, besetzt mit über 100 Forschern, nicht wenige von ihnen Stars in ihrem Feld. Ein drei Meter hohes Kernspinresonanzspektroskop, Stückpreis zwei Millionen Dollar, brummt hinter einer Glastür.
Es geht auch nicht um die Entwicklung von Apps in diesem Start-up am Rande der Bucht von San Francisco, sondern um den Kampf gegen Alzheimer, eine der am schnellsten wachsenden Volkskrankheiten der westlichen Welt. Die Lebenserwartung des Menschen steigt erheblich mit jeder Generation, aber je älter der Mensch, desto anfälliger wird sein Gehirn für Verschleißerscheinungen: Das Gedächtnis schwindet, das Ich zerfällt. Die neurodegenerativen Krankheiten, zu denen Alzheimer zählt, drohen zur großen Nemesis der alternden westlichen Gesellschaften zu werden: Die Zahl der Demenzerkrankten wächst seit Jahren dramatisch, denn es gibt keine wirksamen Therapien. Jahrzehntelange Experimente brachten keinen Durchbruch, Forschungsgelder in Milliardenhöhe verpufften nahezu ergebnislos.
Alleine die Hoffnung, dass sich das ändert, bringt Investoren dazu, bislang kaum vorstellbare Summen bereitzustellen. Aber es sei ganz sicher mehr als Hoffnung, »die Chance ist endlich da«, wirksame Medikamente gegen Alzheimer, Parkinson und andere neurodegenerative Erkrankungen rückten in Reichweite, sagt Alexander Schuth, Gründer und Chief Operating Officer von Denali Therapeutics. Und es gibt viele, die ihm glauben. Rund 220 Millionen Dollar nur als erste Anschubfinanzierung sammelten Schuth und seine beiden Mitgründer ein, innerhalb weniger Tage im Januar 2015. In kaum mehr als einem Jahr wurde aus Denali ein Einhorn: So werden die extrem seltenen, jungen Unternehmen genannt, die rasend schnell aufsteigen und bereits kurz nach der Gründung und mit wenigen Mitarbeitern schon mehr als eine Milliarde Dollar wert sind. Facebook brauchte 396 Tage um die Milliardengrenze zu überspringen. Denali: 390 Tage.
Dabei hatten Schuth und seine Mitgründer zunächst nur einen Testballon starten wollen, um zu sehen, ob ihre Ideen und Forschungspläne auf Interesse stoßen, aber das Geld strömte nur so zu ihnen hin, aus allen Richtungen: von Google, vom Investmentfonds des Staates Alaska. Und von Bill Gates. Der Microsoft-Gründer engagiert sich in vielen medizinischen Forschungsfeldern, aber Alzheimer entwickelte sich zuletzt zum Schwerpunkt. »Es ist ein riesiges Problem, ein wachsendes Problem und eine enorme Tragödie für die Menschen«, sagt Gates. Nicht nur seine Stiftung investierte erheblich in die Demenzforschung, Gates nahm auch Geld aus seinem Privatvermögen in die Hand, steckte zum Beispiel 50 Millionen Dollar in den Dementia Discovery Fund, einen Wagniskapitalfonds, der staatliche und privatwirtschaftliche Forschungsinitiativen zusammenbringen will. Er sei »optimistisch«, dass mit fokussierter und gut finanzierter Innovation Therapien gefunden werden können. Der Microsoft-Gründer flog extra ein für ein Treffen mit Schuth und seinen Mitgründern, ließ sich zwei Stunden erklären, warum ihre Technologie vielversprechend sei und sein Geld verdient habe. Wie immer, wenn Gates sich persönlich engagiert, war das Treffen hoch geheim. Sein Sicherheitsteam inspizierte vorab die Umgebung und schickte Essenswünsche: einen Cheeseburger, bitte. Außer den Gründern wusste niemand von dem Besuch, einer von Schuths Kollegen fiel fast ins Pissoir, als sich plötzlich Bill Gates neben ihm erleichterte.
Nicht nur das Treffen mit Gates war erfolgreich für Schuth, viele andere waren es auch. An einem Mangel an willigen Geldgebern wird Denali nicht scheitern. Im Silicon Valley gibt es genügend Investoren, die bereit sind, erhebliche Summen in die Zukunft zu investieren, die den Vorwärtsdrang der Forscher unterstützen und das finanzielle Risiko ihrer Experimente mittragen. Und genau deswegen ist Schuth auch nicht mehr Arzt an der Charité in Berlin, wo er einst Medizin studierte. Schuth ging Ende der 1990er Jahre in die USA, um zu lernen und zu forschen, und machte Karriere bei Genentech, einem Biotechnologie-Riesen und Milliardenkonzern, der eine neue Generation von Krebsmedikamenten entwickelt.
Schuth stieg auf zum Leiter der Geschäftsentwicklung im Bereich neurologische Krankheiten und lernte dabei Marc Tessier-Lavigne kennen, den Chefwissenschaftler des Konzerns, ein bekannter Neurologe und einer der weltweit führenden Experten für die Entwicklung und Reparatur des Gehirns. Als Professor an der University of California in San Francisco (UCSF) und später an der Stanford University machte er grundlegende Entdeckungen zur Biologie des Nervensystems und wie sich die neuronalen Schaltkreise des Menschen entwickeln. Als Leiter der Forschung von Genentech übersah er Tausende Wissenschaftler und ein Milliardenbudget, und doch gelang es ihm nicht, die durchschlagende Waffe gegen die neurodegenerativen Krankheiten Alzheimer und Parkinson zu finden, nach denen er seine ganze Karriere suchte.
Vielleicht wäre es besser, diese Suche in einem kleinen, schnelleren Vehikel voranzutreiben, in einem Biotech-Start-up, wo sich wenige kluge Köpfe auf eine hoffentlich revolutionäre Idee fokussieren können? Dieser Gedanke treibt Tessier-Lavigne und Schuth über Jahre um. Bis Anfang 2015, als sich nicht nur der Forschungsansatz deutlich genug herauskristallisiert, um gemeinsam Denali zu gründen, sondern auch das Netzwerk, um die nötigen Köpfe dafür einzusammeln. Denn Tessier-Lavigne ist zu diesem Zeitpunkt bereits Präsident der Rockefeller University in New York, einer der führenden Forschungsuniversitäten des Landes. Doch für ihn ist es nur ein Zwischenschritt zum vielleicht begehrtesten Akademikerposten überhaupt: Anfang 2016 wird Tessier-Lavigne Präsident der Stanford University – der wahrscheinlich führenden, sicherlich aber einflussreichsten Universität der Welt in diesen Tagen der digitalen Vorherrschaft.
Stanford ist der Nexus des Silicon Valley, hier laufen all die Netzwerke aus Forschern, Gründern, Geldgebern und Konzernführern zusammen. Ein prächtiger, weitläufiger Campus am Fuß immergrüner Hügel hinter der Pazifikküste, 3310 Hektar im spanischen Kolonialstil, gesäumt von zahllosen Palmen. Elegante Innenhöfe sind eingerahmt von manikürten Rasenflächen und glänzenden Rodin-Statuen, es duftet stets nach Blüten, auch im Januar. Stanfords Forscher sind führend in vielen Feldern, in Informatik, Mathematik, Physik, Biologie und Medizin. Und sie nutzen diesen wissenschaftlichen Vorsprung, um die wirtschaftliche Dominanz dieses nordkalifornischen Biotops auszubauen: Jedes Jahr werden etliche Start-ups von Stanford-Studenten gegründet, startet die Uni gezielt Spin-offs, an denen sie finanziell beteiligt ist. Diese Verzahnung ist kein neues Konzept, sondern wurde hier in den vergangenen Jahrzehnten perfektioniert. Bereits in den 1930er Jahren begann der Dekan des Fachbereichs Ingenieurwissenschaften, Studenten und Professoren zu drängen, parallel zur Forschung eigene Unternehmen zu gründen. So entstanden etwa Hewlett-Packard und Google, gegründet von den beiden Stanford-Doktoranden Larry Page und Sergey Brin.
Tessier-Lavigne, der Mediziner und Biotechnologie-Experte, wurde nicht zufällig genau jetzt zum Stanford-Präsidenten ernannt. Denn das Silicon Valley und Stanford bereiten sich auf die nächste Welle des Fortschritts vor. Tessier-Lavigne sagt es so: »Wir sind im goldenen Zeitalter der Erforschung von Krankheiten, dank der Sequenzierung des menschlichen Genoms und anderer mächtiger Technologien.« Schmal und hochgewachsen, mit silbergrauem Seitenscheitel und hohen Wangenknochen, ist Tessier-Lavigne eine markante Erscheinung, er wirkt ernst und intensiv. Auf Fragen antwortet er fast immer druckreif. Die Zukunft sieht er so: »Wenn wir die nötigen Investments machen, werden wir verstehen können, wie sich Tumore ausbreiten, werden wir lernen können, wie Nervenzellen funktionieren, und die Geheimnisse des Immunsystems entschlüsseln. Und dieses Wissen brauchen wir, um den Krebs zu unterwerfen, die Demenz zu besiegen und Impfungen gegen HIV zu entwickeln.« Tessier-Lavigne hält den technologie-getriebenen Fortschritt »in dieser Zeit der enormen wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Chancen« für eine gesellschaftliche Aufgabe. Und eine staatliche, wie er vor dem amerikanischen Kongress betonte: »Um in diesem goldenen Zeitalter der Biomedizin die Vorherrschaft zu bewahren, müssen die notwendigen Mittel bereitgestellt und strukturellen Rahmenbedingungen geschaffen werden.«
Das gilt es also nicht zu vergessen bei aller Hoffnung auf den medizinischen, technischen und digitalen Fortschritt der ganzen Menschheit: Technologie ist auch ein Machtinstrument. Industrielle Dominanz verschafft gesellschaftlichen Vorsprung. Wer das versteht und die richtigen Rahmenbedingungen schafft, wird erfolgreicher sein als andere. Nirgends hat sich das deutlicher gezeigt als im Silicon Valley, dem Kernstück der wirtschaftlichen und kulturellen Vorherrschaft der USA.
Klar ist: Wer eng mit Stanford verbunden ist, geht gleich mit einem Vorsprung ins Rennen um unternehmerischen Erfolg in der digitalen Welt. Und dass ein Start-up, an dem der Stanford-Präsident beteiligt ist, besonders große Aufmerksamkeit erhält, verwundert nicht. Dennoch: 217 Millionen Dollar als Anfangsfinanzierung für die Denali-Gründer, nur um erst einmal mit der Arbeit anzufangen, das klingt verrückt, auch wenn die Empfänger bekannte Forscher sind. Selbst für Wissenschaftsveteranen war das eine rekordverdächtige und aufsehenerregende Summe, 2015 zumindest.
Nur zwei Jahre später, 2017, scheint das bereits normal, denn inzwischen fließen alle paar Monate Hunderte Millionen Dollar in neue Start-ups. In Gründungen wie AnaptysBio, das Immuntherapien gegen Krebs entwickelt, oder Grail, wo an neuen Krebstests geforscht wird. Hunderte Biotech-Unternehmen sind entstanden, viele im Silicon Valley, aber auch in Europa, in Deutschland. Nicht alle sammeln am ersten Tag 200 Millionen Dollar ein, aber viele mindestens 40, 60, 80 Millionen. Und es dauert nicht Monate, bis sie mit ihrer Forschung loslegen, sondern Tage, eine neue Welt, in der scheinbar alles im Laufschritt passiert: Vier Wochen nachdem Schuth und seine Mitgründer ihre Ideen vorgestellt hatten, strömten die ersten Forscher in die neu eingerichteten Labore, nun sind es fast 200, fast alle promovierte Mediziner, Biologen, Informatiker, Chemiker.
»Die Wissenschaft bricht auf«, sagt Schuth. Und sie bringt neue Wege zum Vorschein, die bislang unsichtbar waren. Teils buchstäblich. Die Diagnose von Alzheimer erfolgt per Autopsie, so stand es im Lehrbuch, als Schuth in den 1990er Jahren Medizin studierte. Heute lässt sich mit neuen Computerverfahren auch in lebende Köpfe schauen.
Mehr als 100 Jahre ist es her, dass der bayrische Arzt Alois Alzheimer erstmals über diese »eigenartige Erkrankung der Hirnrinde« sprach, die häufigste Ursache für Demenz, mit gnadenlosem Verlauf, an dessen Ende das Selbst der Erkrankten im Nichts verschwindet. Bei der Behandlung und Heilung dieser Krankheit ist die Medizin bis heute jedoch kaum einen Schritt weitergekommen. Neurodegenerative Krankheiten sind ein Forschungsfeld, das Wissenschaftler verzweifeln lässt. 99,6 Prozent aller in einer Studie untersuchten Behandlungsversuche zwischen 2002 und 2012 schlugen fehl. Über 100 experimentelle Therapien scheiterten in den vergangenen 20 Jahren. Was für eine niederschmetternde Statistik.
Über 100 Millionen Menschen werden bald weltweit an Alzheimer erkrankt sein, und es gibt keine einzige wirksame Therapie? So viel ist klar: Wer als Erster ein Medikament auf den Markt bringt, das Alzheimer heilen oder zumindest stoppen kann, wird Milliarden verdienen. Trotzdem gaben selbst die großen Pharmakonzerne ihre Forschungen an dieser Krankheit zwischenzeitlich auf. Zu komplex und zu unzugänglich schien bislang das menschliche Gehirn. Und zu speziell: Tiere erkranken nicht an Alzheimer-Demenz. Es fehlt an Modellen und Testobjekten.
Was hat sich im Vergleich zu damals geändert? »Was zuletzt scheiterte, wurde entwickelt mit dem Wissen der 1990er Jahre«, sagt Schuth und meint damit: Es könnte auch genauso gut aus den 1950er Jahren stammen, verglichen mit dem Wissen von heute liegen zwischen der damaligen Forschung und den heutigen Ansätzen Welten. Vor allem dank der Genetik, die eine besonders rasante Entwicklung genommen hat: Ein menschliches Genom zu sequenzieren, also das gesamte Erbgut zu analysieren, kostete vor zehn Jahren noch viele Millionen Dollar. Heute sind es wenige Hundert. Zehntausende von Patienten können nun für Studien genetisch analysiert werden, schneller und billiger, als es jemals zuvor möglich war. Auf diese Weise wurden inzwischen über 30 Gene entdeckt, die zu Alzheimer beitragen, 35 Gene, die zu Parkinson beitragen, und 34 zu ALS. Zum Vergleich: Die Zahl der Genmutationen, die man Ende der 1990er Jahre mit der jeweiligen Krankheit in Verbindung brachte, betrug 3, 0 und 1.
Die Genetik liefert nicht automatisch Therapien, aber sie verschafft Einblick in die Biologie der Krankheit. Erst wenn man weiß, wie die Krankheit entsteht und verläuft, kann man gezielt nach Angriffspunkten suchen, an denen Medikamente ansetzen. Einen ähnlichen Weg ging bereits die Krebsforschung im vergangenen Jahrzehnt; die Entdeckung der sogenannten Onkogene, der Krebsgene, beflügelte die Forschung. Denali richtet seinen Fokus nun auf die Degenogene: Das Start-up will Medikamente entwickeln, die auf Mutationen von Genen zielen, die neurodegenerative Krankheiten mitverursachen. Es ist kein Zufall, dass viele der wichtigen Köpfe des Start-ups zuvor bei Genentech arbeiteten, einem führenden Hersteller von Krebsmedikamenten und Pionier der Biotech-Industrie.
Die zweite Innovation, auf der die Hoffnungen der Forscher ruhen, ist das Imaging, die diagnostische Bildgebung: Mithilfe dieser Technologie kann man, teils sogar live, in die Köpfe, bis in einzelne Gehirnzellen schauen. Ein großer Schritt, denn wie schwer ist es, etwas zu erforschen, das man nicht sehen kann. »Selbst im Studium konnte ich von so etwas nur träumen«, sagt Stacy Henry, dabei ist ihr Studium kaum fünf Jahre her. Nun steht sie in einem Denali-Labor vor »Big Bird«, einer Art elektronischem Supermikroskop, und streichelt die Maschine. Das Gerät ist nicht größer als ein Bierkasten, aber Big Bird analysiert 1000 Zellproben gleichzeitig und spuckt umgehend die Detailaufnahmen von Molekülen und Zellstrukturen auf einen großen Monitor aus. Faszinierende Bilder, als wären es Aufnahmen ferner Galaxien vom Hubble-Weltraumteleskop: Bizarre Strukturen leuchten lila und grün. »Ein Traum« für Henry, sie leitet die zellbiologische Parkinson-Forschung bei Denali. Die Maschine leistet in zehn Minuten, was vor wenigen Jahren noch eine Woche dauerte.
Und doch ist das nur der Beginn der Entwicklung, längst werden in der Alzheimer-Forschung noch ganz andere Wege beschritten: Das Start-up Alzeca etwa hat für seine Nanopartikel-Bildtechnologie viele Millionen Dollar eingesammelt: Die Nanopartikel zielen auf sogenannte Amyloid-Plaques, die ein wesentliches Erkennungsmerkmal von Alzheimer sind, und machen sie in Kernspintomografien sichtbar. In China eröffnete eine Art Gehirnscan-Fabrik, in der hochauflösende Aufnahmen wie am Fließband produziert werden, um schnell und billig Gehirne in 3-D zu kartografieren. So wie die Genomsequenzierung zum Alltagsinstrument wurde, weil die DNA-Analyse nicht mehr Monate, sondern Stunden dauert, soll die Gehirnkartografierung Neurologen zu verstehen helfen, wie neuronale Prozesse ablaufen. Bislang bedeuteten solche Kartografierungsprozesse oft monatelange, aufwendige Arbeit: Wissenschaftler müssen dafür zum Beispiel teils nur millimetergroße Mäusehirne mit einer Diamantklinge in 15000 extrem dünne Scheiben schneiden, in jeder Schicht Merkmale mit Chemikalien markieren, dann mit dem Mikroskop Aufnahmen erstellen und diese schließlich wieder zu einem dreidimensionalen Bild zusammensetzen. In der chinesischen Bildfabrik wird diese Arbeit nun von Maschinen gemacht. Ähnliche Fabriken sollen auch andernorts entstehen.
»Industrielle Datenerzeugung wird die Neurowissenschaften verändern«, sagt Hongkui Zeng, Molekularbiologin am Allen Institute for Brain Science in Seattle. Mit dieser Flut an Daten sollen riesige »Zell-Atlanten« entstehen: Wenn die Strukturen des Gehirns kartografiert sind, werden sich auch die Funktionen besser verstehen lassen, so die Hoffnung. Indem Neuronentypen zwischen verschiedenen Gehirnen verglichen werden, könnte es Wissenschaftlern gelingen, die Folgen einer Krankheit für Zellstrukturen zu erkennen, sagt Jürgen Goldschmidt, Forscher am Leibniz-Institut für Neurobiologie in Magdeburg.
Die menschliche Biologie immer besser im Detail sehen zu können spielt generell eine große Rolle in der Medikamentenentwicklung. Der Nobelpreis für Chemie ging 2017 an drei Forscher, die ein »Kryo-Elektronenmikroskop« entwickelt haben: Es liefert dreidimensionale Bilder der Moleküle, die Lebewesen, auch unsere menschliche Biologie, antreiben, und spielt deshalb seit einigen Jahren eine große Rolle in der Entwicklung neuer Medikamente. Denn mit der neuen Technologie lassen sich erstmals deutliche Nahaufnahmen kleinster Biomoleküle machen, sei es von der Oberfläche von Viren oder von Proteinen, die Antibiotikaresistenzen verursachen. Das Mikroskop ist ein essenzielles neues Instrument, »um die Chemie des Lebens zu verstehen und Pharmazeutika zu entwickeln«, betont auch das Nobel-Komitee bei der Preisbegründung.
All diese neuen Fähigkeiten – in Gehirne zu schauen, Genome rasend schnell zu analysieren, die Tonnen von Daten zu sortieren – eint eine gemeinsame Basis: der Fortschritt in der Computertechnologie. Erst die digitale Revolution hat die neuen Bildtechniken hervorgebracht, hat den Weg für schnelle und billige Gensequenzierungen geebnet und die Auswertung der immer größer werdenden Flut von Daten ermöglicht.
Doch so beeindruckend diese Maschinen und Verfahren auch sind, sie finden nicht von selbst neue Therapien, sie machen es den Forschern nur einfacher. Denali beschäftigt deswegen Fachleute wie Thomas Sandmann, ein »Computational Biologist«: Er ist gleichzeitig Biochemiker und IT-Spezialist. Sandmann arbeitete vorher bei Google in der Medizinforschung. Das klingt zunächst verwunderlich: Google forscht in der Medizin? Mit Hochdruck sogar, genauso wie Microsoft, Facebook und IBM. Die Suche nach den beste Leuten geht dabei in beide Richtungen: Die Mediziner brauchen Informatiker, und die Informatiker stellen Mediziner ein. Am begehrtesten ist, wer beides kann.
Gerade wühlt sich Sandmann durch Gehirnzellen-Experimente von israelischen Wissenschaftlern, sie haben ihre Forschungen veröffentlicht, und Sandmann schickt nun seine Algorithmen durch die Datensätze, um nach tieferen Mustern zu suchen. Es ist eine mühselige Suche, denn die meisten Experimente produzieren zu viele Daten. Wonach soll man eigentlich suchen? »Nach Korrelationen, die größer sind als der Zufall«, sagt Sandmann, es ist die Antwort eines Statistikfachmanns, aber genau so, mit der Suche nach Korrelationen, haben sich in den vergangenen Jahren doch einige grundlegende Erkenntnisse gewinnen lassen. Zum Beispiel, dass die »kognitive Reserve« den Verlauf von Alzheimer bestimmt: Wer mehr Gehirnzellen hat, verkraftet es besser, wenn sie abzusterben beginnen. Woran sich das zeigt: Je besser ein Mensch ausgebildet ist, desto langsamer schreitet die Krankheit bei ihm voran.
Auch das Immunsystem trägt wohl ungewollt zum Fortschreiten der Krankheit bei. Das Problem sind bestimmte Zellen im zentralen Nervensystem, die etwa Infektionen bereinigen sollen, aber Entzündungen im Gewebe hervorrufen, wenn sie nicht richtig funktionieren. Wissenschaftler suchen nun nach Wegen, das Immunsystem zu beeinflussen, damit es nicht versehentlich das Gehirn schädigt. »Entzündungsprozesse spielen eine zentrale Rolle beim Altern« und nähmen entsprechend auch bei Alzheimer eine unterliegende Rolle ein, sagt George Perry, Professor für Neurowissenschaften an der University of Texas und Leiter des »Journal of Alzheimer’s Disease«.
Dazu passt diese Grunderkenntnis, die sich herauskristallisiert hat: Viel Bewegung ist eine wichtige Gegenmaßnahme, denn sie wirft den Abbau nicht mehr funktionierender Zellbestandteile an, die sogenannte Autophagozytose. Denali verwendet viel Zeit auf die Erforschung dieses Prozesses, denn wenn er nicht richtig läuft, stottern die Gehirnprozesse. An einer der Genmutationen, die neu entdeckt worden ist, zeigt sich das besonders deutlich. Die Mutation heißt LRRK2, sie mindert »interzellularen Verkehr«, und das führt am Ende vermehrt zu Parkinson. Wenn man LRRK2 ausschalten kann, so die Hoffnung, lässt sich vielleicht Parkinson ausschalten.
Sport kann also neurodegenerativen Erkrankungen vorbeugen, man muss nur früh genug damit anfangen: »Im mittleren Alter«, sagt Schuth, er ist Ende 40 und fährt, wann immer es geht, mit dem Rennrad ins Büro, die Bucht von San Francisco entlang, 25 Kilometer gegen den Wind, »als Vorsorgemaßnahme«.
Schuth kann lange über die Eigenarten des menschlichen Gehirns reden, dass es durchschnittlich nur 1,4 Kilo wiege, aber 20 Prozent der Nährstoffe im Blut benötige (»Verrückt!«), dass die winzigen Blutgefäße im Gehirn 600 Kilometer lang seien, um die Neuronen einzeln zu versorgen (»Faszinierend!«). Und was für Chancen sich nun bieten (»Fantastisch!«). Das klingt, als habe nach 15 Jahren San Francisco der kalifornische Optimismus abgefärbt auf den gebürtigen Frankfurter. Aber das Silicon Valley hat schon immer solche Menschen angezogen: die schneller vorwärtswollen, für die das Glas immer halb voll ist.
Gründete er seine Firma deswegen in Kalifornien statt in Deutschland, wollte er ausbrechen aus dem Land der Zweifler? Nein, eine Flucht war es nicht, sagt Schuth, aber der »Silicon-Valley-Faktor« spielt eine große Rolle, diese besondere Weltsicht hier: »Fortschritt ist immer gut, morgen ist immer besser als heute.« Die Entscheidungsfreudigkeit, einfach loszulegen, auch wenn das Risiko enorm ist. Das klingt eher nach kulturellen Differenzen, aber die machen einen großen Unterschied: In Deutschland kratzen Biotech-Gründer oft mühselig ein, zwei Millionen Euro zusammen, in Kalifornien gibt es 100 Millionen oder 200, weil die Geldgeber sagen: »Let’s just do it.«
Deswegen wurde das Silicon Valley zum Mittelpunkt der digitalen Revolution, und deswegen ist es auf dem Weg, auch die Revolution in der Biotechnologie anzuführen: Nicht weil hier die Forscher prinzipiell klüger und die Ideen besser wären, sondern weil hier das Geld so üppig fließt wie sonst nirgendwo. Deswegen werden die klügsten Forscher und die besten Ideen angezogen wie von einem riesigen Magneten. Weil aus dieser Kombination ein Nährboden geschaffen wird, der explosives Wachstum fördert und Tatendrang belohnt.
Kann wirklicher, weltverändernder Fortschritt nur in solch einem Umfeld entstehen, in dem Zweifel beiseitegeräumt werden und man einfach losstürmt?
Diese Frage wird sich in Zukunft noch weit häufiger stellen, wenn neue technische Verfahren neue Therapien ermöglichen, wenn immer mehr Start-ups nach der Zukunft der Medizin suchen und die Investoren dafür Milliarden verteilen. Denn viele dieser neuen Wege in der medizinischen Forschung werden beschritten werden, ohne lange zu diskutieren. Auch wenn Zweifel sinnvoll und angebracht wären. Die Crispr-Technologie etwa, die Gen-Schere zur Manipulation von Erbgut, wurde erst 2012 entdeckt und ist doch schon ein unverzichtbares Instrument der Forschung, um eine maßgeschneiderte Grundlage für Experimente zu schaffen: etwa indem man im Labor einfach und schnell Zellen nachbaut, die mit Alzheimer-Genmutationen ausgestattet sind. Oder um an der Blut-Hirn-Schranke zu forschen: Was über das Blut ins Gehirn soll, muss aktiv transportiert werden, sonst bleibt es an der Schranke hängen. Ein Schutzmechanismus für unser Gehirn, der bislang viele Demenz-Therapien scheitern ließ. Bis heute ist die größte Herausforderung aller Therapien für neurodegenerative Krankheiten, das Medikament überhaupt bis ins Gehirn zu bekommen.
Denali hat deswegen vor allem Wissenschaftler zusammengebracht, die auf die Blut-Hirn-Schranke spezialisiert sind. In diesem Forschungsbereich versuchen sie nun zu entwickeln, was sich »proprietary technology« nennt und meist über den Erfolg von Start-ups entscheidet: spezielle Technologie, die kein anderer beherrscht. Um diese Technologie zu erproben, haben sich die Denali-Wissenschaftler »eine Maus gebaut«: Sie haben eine gentechnisch veränderte Maus geschaffen, die über eine menschliche Blut-Hirn-Schranke verfügt. Ein enormes Hilfsmittel für die Forscher, vor Kurzem noch undenkbar, aber nun dank der Crispr-Technologie gar nicht sonderlich kompliziert. Ein paar schnelle Schnitte an der Mäuse-DNA, und schon wirkt das Hirn des Nagetiers menschlich, zumindest für Versuchszwecke. So lässt sich nun testen, wie für Menschen gemachte Moleküle an die Quelle der Krankheit transportiert werden können. Da sich die genetischen Veränderungen weitervererben und Mäuse sich schnell vermehren, gibt es inzwischen Tausende Tiere, an denen sich forschen lässt, eine ganze Population. Die Hürde, nicht am Menschen forschen zu können, die die Wissenschaftler jahrelang zurückgehalten hat, wurde durch ein paar kleine Eingriffe in der DNA einer Maus überwunden. Das Tiermodell, wonach sich die Mediziner so lange gesehnt haben, im Labor geschaffen, ganz einfach. Wahnsinn! Wahnsinn?
Die Nächte sind kurz für Schuth, drei, vier Stunden Schlaf, Arbeit sieben Tage die Woche, das Rad dreht sich zu schnell, um eine Pause zu machen. Seine Frau, eine Gynäkologin, forscht bei seinem alten Arbeitgeber Genentech an Krebs, am Küchentisch frotzelt das Paar dann über solche Themen: »Krebsforschung ist leicht heute, Alzheimer wirklich schwer.« Der Protest bleibt aus, zu viel Wahrheit steckt in der Aussage: Die Onkologie ist wirklich sehr viel weiter. Und das Vorbild, von dem es für die Demenzforscher zu lernen gilt.
Vielleicht die zentralste Erkenntnis der modernen Krebsforschung ist, dass die Krankheit viele Ursachen hat, selbst in ein und derselben klinischen Ausprägung: Brustkrebs ist nicht gleich Brustkrebs. Die Genforschung zeigt, dass offenbar bei jedem Patienten eine ganz individuelle Konstellation von genetischen und umweltbedingten Ursachen vorliegt. Deswegen hilft es bei der Therapie wenig, immer nur mit dem gleichen groben Instrument ranzugehen, dem Chemotherapie-Hammer für alles. Stattdessen setzen Pharmaforscher und Mediziner zunehmend auf maßgeschneiderte und ursachenbezogene Therapie. Von so einer personalisierten Medizin träumen Ärzte schon lange, zumindest in der Krebstherapie wird sie nun Realität.