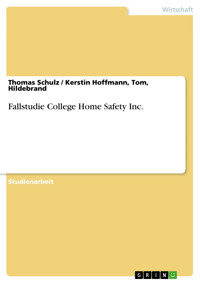Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eine weite Reise Eine Bahnreise nach Berlin führt an vielen Orten der persönlichen Geschichte eines Menschen vorbei. Es sind die auf den ersten Blick banalen Geschichten, die jeder in seiner Familie, in seiner Ausbildung und in seinem Beruf erlebt haben könnte. In ihrer Sammlung sind die Rückblicke alles andere als normal oder banal. Sie schildern nicht nur das Ereignis selbst, sondern das Empfinden einer Generation, die sich jetzt in die Rente verabschiedet. Jahrzehnte des äußeren Friedens, des beruflichen Erfolgs und der familiären Bindungen werden geschildert. Dabei kann der Autor auf Erfahrungen in West- und Ostdeutschland zurückgreifen. Sehr konkret wird menschliches Fehl-Verhalten zum Beispiel in beruflichen Situationen geschildert und es werden daraus Erkenntnisse abgeleitet, die uns dazu bringen sollen, unser Verhalten und Denken zu reflektieren. Zusammenfassend wird schließlich die Spannung zwischen unseren Erkenntnissen und Handlungen beleuchtet. Die These dabei, "Es gibt kein Erkenntnisdefizit, sondern ein Handlungsdefizit", wird mit einem Traktat "Die zehn Wahrheiten" abgearbeitet. In dem Text finden sich viele Menschen mit ihren Erfahrungen, aber auch mit ihren Ansichten wieder. Für wieder andere ist der Text provokativ, weil er an die eigenen Defizite erinnert. Der Protagonist berichtet über sich selbst. Die Rückblicke sind keine Erinnerungen, sondern eine bewertende Bestandsaufnahme aus der gegenwärtigen Perspektive des Jahres 2021. Alle Schilderungen sind vom Autor selbst erlebt. Auf die Namen der beschriebenen Personen wurde verzichtet, weil ihr Handeln und Denken exemplarisch ist. Viele werden sich darin erkennen. Nicht eine bestimmte Person ist wichtig, sondern die Haltung und Denkweise, die diese repräsentiert. Aus gleichem Grund wurde auf genaue Ortsangaben dort verzichtet, wo die Ortsangabe keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn ergeben hätten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eine weite Reise
für uns
und
die nächste Generation
Alle im Buch genannten Beispiele haben sich wirklich ereignet.
Der Auftritt der handelnden Personen ist als exemplarisch für allzu
menschliches Verhalten zu verstehen und eignet sich so als Muster
für Viele und Vieles.
Eine weite Reise
Auf geht´s
Zuhause
Erstmals in Hamburg
Busfahrten
Fortschritt
Berufsanfang
Stern
Im Bus
Aufwärts
Lehren ziehen
Kinder
Daten
Autos
Schule
Noch einmal: Schule
Quiz
Lehrer
Reisen
Prüfungen
Besichtigungen
Berliner Tor
Jobs
Nachwuchs
Abfahrten
Überraschungen
Kommunikation
Medien
Entspannung
Durch Bergedorf
Familienleben
Außendienst
Selbstbedienung
Manager
Sachsenwald
Grenzen
Mauer
Wende
Vorbilder
Freund und Feind
Export
Mobil
Angekommen
Konsum
Wechsel
Heimat
Konsequenzen
Am Ziel
Auf geht´s
Mir wäre es lieber gewesen, jemand hätte den Nobelpreis in diesem Jahr dafür bekommen, einen Duschkopf erfunden zu haben, der beim Einhängen in den oberen Armaturenhaken nicht noch einige Tropfen so absondert, dass sie den ausgestreckten Arm bis unter die Achsel ablaufen. Vielleicht hätte diese Erfindung ja auch verhindert, dass beim Duschen der Duschkopf immer wieder vom Schlauch verdreht wird. Auf eine solche lebensverbessernde Erfindung zu hoffen, war ebenso hoffnungslos wie darauf zu hoffen, dass es eines Tages eine Fischkonservendose geben würde, deren Deckel zu entfernen war, ohne dass ein paar Spritzer der Soße sich über das Küchenbuffet verteilten. Was hatte ich schon von der Entdeckung und Beschreibung schwarzer Löcher in unendlicher Ferne?
Mehr hatte ich an diesem Montagmorgen nicht zu beklagen. Alles andere war wie seit mehr als 60 Jahren nahe der Perfektion. Obwohl ich das natürlich für die ersten Lebensjahre nur aus den Erzählungen meiner Eltern ableiten kann. Die meisten Jahrzehnte kann ich aber kritisch selbst bewerten und dabei immer wieder glücklich feststellen, bis hierher war es ein glückliches Leben, nur getrübt durch die statistische Sicherheit, dass mich das Schicksal von diesem Niveau nur noch nach unten ziehen konnte.
Der heutige Montag bot kein Anzeichen für ein Abschwellen meiner dauerhaften Glückssträhne. Ich konnte ausschlafen, während andere schon am Fließband für einen Lohn schuften mussten, der am Tagesende nicht einmal die Hälfte meines Verdienstes ausmachen würde. Sofort kamen mir bei dem Gedanken Erinnerungen an meine Schüler- und Studentenjobs. Ich musste allerdings meine Erinnerung nicht besonders herausfordern. Vor meinen Augen lief gerade der Postbote mit einem Berg von Paketen vor sich auf den Armen, die ihn zwangen seitlich daran vorbei zu sehen, wodurch die Statik des Paketberges stark gefährdet schien. Warum sollte ich für Gerechtigkeit plädieren, wenn sozialer Ausgleich, eine andere Einkommensverteilung oder gleiche Bildungschancen für alle für mich mit einer Verschlechterung einhergehen würden?
Heute bestand die Ungerechtigkeit darin, dass ich ohne Hektik mein Frühstück einnehmen konnte, danach gemütlich zum Bus schlendern und dann bis zum Hauptbahnhof fahren konnte. Mein Ziel war Berlin. Hier sollte ich die Vorbereitung einer Veranstaltung begleiten, die erst auf einen Tag später terminiert war und auf der Tagesordnung meinen Vortrag über meine berufliche Wirkungsstätte vorsah. Ich hatte also eine komfortable Zeitplanung, die absehbar keinerlei Stress erzeugen sollte.
Da ich Vortragender war, wäre ich vielleicht mit dem Aufbau meines Vortrages, mit dessen Ablauf, mit dem Suchen nach dem besonderen Gag beschäftigt, wenn nicht an diesem Tag lediglich eine Einweisung des Veranstalters geplant gewesen wäre. Der Vortrag selbst war erst für morgens am nächsten Tag geplant. Es gab Zeiten, da wäre ich auch erst am nächsten Morgen losgefahren, wäre sehr früh auf der Autobahn gewesen und nach Berlin gerast.
In Ruhe zu frühstücken, nicht mehr vor der Abfahrt des Zuges ins Büro zu gehen, sondern noch einen Rundgang in Berlin einzuplanen, entsprach genau meinem Vorhaben, alles in Zukunft etwas ruhiger angehen zu lassen. Es war für ein gutes Gefühl, umzusetzen, was ich mir vorgenommen hatte. Es fühlte sich wie eine Befreiung von äußeren Zwängen an. Sich das erlauben zu können, war nicht das Ergebnis meiner jetzigen Tätigkeitsbeschreibung, sondern Ausprägung meiner über Jahrzehnte gesammelten, kritisch ausgewerteten und für mich nutzbar gemachten Erfahrung. Dazu gehörten auch anstrengende Jahre, in denen es aber immer wieder glückliche, nicht der eigenen Leistung zuzuschreibende Umstände gab. Ich hatte immer Glück, wenn auch das Glück manchmal allein darin bestand, richtig eingeschätzt zu haben, wann man es besser nicht herausforderte.
Freiräume für außerberufliche Ziele gab es nicht erst ab einem Alter von 60 Jahren, mit dem die Aufgabe höherer Karriereziele verbunden war. Sie gab es immer in meinem Leben und ein Teil des von mir empfundenen Glücks basierte auf der Gewissheit, dem Beruf immer wieder Chancen für private Vorhaben abgetrotzt zu haben. In der Abwägung einen besonders guten, karrierefördernden Betriebsbesuch zu machen oder diesen so kurz wie irgendwie vertretbar zu gestalten, um mit meinem Sohn möglichst viel Zeit für eine Tour durch den Harz zu haben, gab es bis heute keinerlei Zweifel daran, was mir wichtiger war. Am Schreibtisch für meine Karriere zu intrigieren oder den Schwimmunterricht in der Klasse meiner Tochter durchzuführen, war ohne eine Sekunde des Zögerns zu entscheiden.
Um 12.06 Uhr wollte ich am Hauptbahnhof in den ICE nach Berlin steigen. Um 16.00 Uhr wurde ich in Berlin erwartet. Ein üppiger Zeitraum für die Anreise. Natürlich kaufte ich kein Ticket mit Zugbindung. In Kassel auf dem ICE-Bahnhof Wilhelmshöhe zu stehen und vom Personal zu hören, ich dürfe nicht in den einfahrenden Zug einsteigen, weil meine Fahrkarte mit Zugbindung darin nicht gültig sei, war schwer zu akzeptieren, weil der einfahrende Zug durch seine Verspätung kurz nach der planmäßigen Abfahrt meines Zuges kam, an den ich gebunden war. Der einfahrende Zug kam fast leer an und fuhr ohne mich fast leer weiter. Es war ein nachhaltiger Lernprozess damals als es keinen rationalen Grund dafür gab, auf dem Bahnsteig in der Kälte dieses Manöver als zahlender Bahnkunde ertragen zu müssen. Wer lässt sich schon gerne schikanieren? Oder anlügen? Wenn die Durchsage bei Wittenberge über Monate kam, dass es hier eine unvorhersehbare Verzögerung gab, war das so schlecht gelogen und für jeden der Berlin-Hamburg-Vielfahrer erkennbar. Ursache für die Verzögerung war eine riesige Baustelle, die geplant war, über Monate betrieben wurde und immer die gleiche Verzögerung an immer der gleichen Stelle nach sich zog. Es gab nur eine Konsequenz für eine angemessene Reaktion: mit der Bahn fahren nur noch, wenn dringend notwendig.
Heute war es notwendig. Die Spesenregeln meines Arbeitgebers schrieben die Nutzung des preiswertesten Verkehrsmittels vor. Das war die Bahn mit Bahncard des Arbeitgebers. Außerdem gab es am Zielort in Berlin, weder am Hotel am Kudamm noch beim Gastgeber in der Friedrichstraße einen Parkplatz.
Ich freute mich auf einen Krimi, den ich zu zwei Dritteln gelesen hatte und den ich in den zwei Tagen in Berlin durchlesen wollte. Die Tasche war gepackt. Der Krimi nahm darin schon den meisten Platz ein. Ansonsten war mein USB-Stick das einzige berufliche Utensil.
Da die Zeit bis zur Abfahrt des Busses ausreichend bemessen war, wurde beim Ankleiden getrödelt bis der Gang zur Bushaltestelle unvermeidlich nur noch in Eile möglich war. Vielleicht ist es ein ehernes Gesetz, das Zeit und Pflicht verbindet, indem was zu tun ist, auf den spätesten Zeitpunkt oder die kürzeste Zeitspanne konzentriert wird. Denn es war klar, unter acht Minuten war der Weg zum Bus nicht zu schaffen. Tückischer weise sah man ihn nicht in der Ferne ankommen und konnte seine Gehgeschwindigkeit der Busankunft nicht anpassen. Man sah die Haltestelle aus 500 Metern Entfernung, nicht aber den Bus, der auf sie von einer Querstraße aus zufuhr. Kam der Bus früher als planmäßig, was oft wegen leerer Haltestellen im Landgebiet vorkam, hatte man ihn unweigerlich verpasst. Also galt es frühzeitig im Wartestand zu sein und so die Unzuverlässigkeit öffentlicher Personenbeförderung zu kompensieren.
Ich kannte den Unterschied. Die ersten Jahre in Hamburg nutzte ich für meine Fahrten zur Schule die Buslinie 9. Meist einen roten Magirus mit schwarzem Dach, in dem kleine Fenster an jeder Seite eine lichte Reihe bildeten. Eine hydraulisch betätigte Falttür gab einen steilen, mehrstufigen Einstieg frei. Ein enger Gang führte danach durch den wie ein Reisebus bestuhlten Raum zu einem hoffentlich freien Sitzplatz. Stehplätze waren baulich nicht vorgesehen. Man stand im Gang, was zu heftigem Gedränge beim Aussteigen führen konnte. Die weinroten Kunststoffsitzbezüge konnten Flicken haben, die wie Reparaturstellen an einem Schlauchboot aussahen. Sie wurden mit üppigem Verbrauch von Kleber großzügig an vielen Stellen auf die Sitze geklebt, wellten sich am Rand nach einiger Zeit auf, boten so eine Angriffsfläche für alle die gerne etwas während der Busfahrt pulen wollten und mussten erneuert werden. Die Sitze waren ein wahrer Flickenteppich.
Hydraulische Türen! Als ich sie damals nutzte, kannte ich das Wort noch nicht. Als ich viele Jahrzehnte später sogar hydraulisch von pneumatisch unterscheiden konnte, mied ich Busse, wann immer möglich.
Zuhause
Nach der Hälfte des Fußweges zum Bus lag der Ortskern meines Heimatdorfes. An keinem Ort hatte ich bisher länger gelebt, als in dem Haus, das unsere Familie vor mehr als dreißig Jahren bauen ließ und bezogen hatte. Damals hatte ich schon hier gelebt. Auf einer Fahrradtour, kam ich mit meiner Frau an einem Grundstück vorbei, in das hinein ein Makler ein Verkaufsschild gepflockt hatte. Wir waren damals auf dem Heimweg in unsere 2-Zimmer-Wohnung, in einem Haus, das ein Gärtner für seine Mitarbeiter bauen ließ. Genau einen Kilometer hinter dem zum Verkauf stehenden Grundstück.
Ich hatte in der Sonnabendausgabe der Bergedorfer Zeitung eine Annonce gelesen, mich am selben Sonnabend mit meinem tornadoroten VW-Käfer auf den Weg in die Elbmarsch gemacht und war sofort von der Wohnung angetan. Neu, hell, sauber, Garten, Garage und vor allem zwei gleich große Zimmer. Ich sah die erste eigene Wohnung.
Mir gefiel die Wohnung damals sofort. Ich rief bei meiner damaligen Freundin an, verabredete mich mit ihr, holte sie mit dem Auto in ihrer Wohnung in Hamburg Eimsbüttel ab und fuhr mit ihr zur annoncierten Wohnung. Sie wohnte damals mit einer Freundin in einer Altbauwohnung mit Balkon in einem der bei Studenten sehr begehrten Stadtteile.
Größer konnten die Unterschiede zwischen der Wohnung dort und der auf dem Lande nicht sein. Weder sie noch ich hatten irgendeine Beziehung zu den Marschlanden, außer vielleicht, dass wir ab und zu Rama kauften und auf dem Deckel die Tracht der Gegend sahen.
Die Anfahrt durch Rothenburgsort und die Gewerbegebiete von Billbrook mit dem Kraftwerk Tiefstack beunruhigten mich. Wollte man hier wohnen, wenn man wie meine Freundin in Groß-Flottbeck aufgewachsen war und sich in Eimsbüttel in Nähe zu U-Bahn und Szenekneipen wohl fühlte?
Heute kann ich gar nicht mehr nachvollziehen, wie die Entscheidungsprozesse damals liefen. An Probleme erinnere ich mich jedenfalls nicht. Wir mieteten die Wohnung und richteten sie ein: Jeder für sich sein Zimmer, gemeinsam die Küche, das Bad und den Flur. Vom ersten Tag an fühlten wir uns so wohl darin, dass wir, während wir darin wohnten, heirateten und Kinder bekamen. Diese machten allerdings einen Umzug innerhalb des Hauses notwendig. Wir tauschten unsere Wohnung im Erdgeschoss mit den Nachbarn über uns, denen drei Zimmer zur Verfügung standen.
Der Umzug war für den 1. Januar verabredet. Während unsere Umzugshelfer alle bereit standen, mussten die Nachbarn erst einmal geweckt werden, bevor der gleichzeitige Umzug von der einen in die andere und von der anderen in die eine beginnen konnte.
Nun gab es auch ein Kinderzimmer und ein spektakuläres Wohnzimmer mit einer kompletten Glasfront, hinter der ein Balkon die gesamte Hausbreite überbrückte. Der Blick ging über den Garten und den wenig befahrenen Deich zum Küsterbrack, einem nur von Privatland umgebenen See. Zugang zum Brack hatten wir auch. Unser Vermieter war Anwohner des Bracks.
Noch heute habe ich keine Erklärung, welche Substanz der Gedanke hatte, ein Haus bauen zu wollen. Ich hatte den Job nicht bekommen, für den ich studiert hatte, meine Frau war durch die zwei Kinder von Beruf Mutter. Ich verdiente zwar als Verkäufer nicht schlecht, hatte aber kein verlässliches Einkommen. Außerdem war damals völlig unklar, wann ich den angestrebten Lehrerberuf im Beamtenstatus würde ausüben können. Gegen einen Hausbau sprach auch das nicht vorhandene Eigenkapital, keinerlei handwerkliches Geschick für Eigenleistungen und ein Zinssatz von damals üblichen 7,5%.
Zurückblickend waren es in meinem Leben immer die glücklichsten Entscheidungen, wenn jede. auch berechtigte, Bedenkenschwere außer Acht gelassen wurde und eine mutige Entscheidung intuitiv, dem eigenen Verlangen und Hoffen folgte. Wir wollten das Haus.
Wir wollten heiraten, weil es außer Liebe keinen Grund gab. Meine Freundin war nicht schwanger, sie hatte ihr Studium nicht abgeschlossen, ich war kurz vor dem zweiten Staatsexamen mit der sicheren Aussichtslosigkeit, in meinem Beruf in Kürze arbeiten zu können. Es war wunderbar, ohne sachlichen Grund oder einer wie auch immer gearteten Verpflichtung in die Ehe zu gehen.
Jahre später fand ich den theoretischen Hintergrund für meine mindestens in Teilen unbewusst zustande gekommenen Entscheidungen. Daniel Kahnemann beschrieb in seinem Bestseller „SCHNELLES DENKEN–LANGSAMES DENKEN“ die beiden menschlichen Entscheidungskanäle. Hier den bewussten, von uns zu steuernden Denk- und Entscheidungsprozess, der zu nachvollziehbaren Ergebnissen führte. Da die im Hintergrund unbewusst ablaufenden, auf Erfahrungen und Instinkten beruhenden Handlungsempfehlungen. Bauchgefühl nennen das einige oder weibliche Intuition. Untersuchungen haben ergeben, dass wir uns auf die im Hintergrund ablaufenden Entscheidungen sehr gut verlassen können. Unser erster spontaner Gedanke basiert nämlich auf die im Hintergrund ablaufenden tausenden Abwägungen unserer Erfahrungen. Unser bewusstes Denken fußt auf einem kleinen Bruchteil langsam addierter Erfahrungen und Erkenntnisse. Seien wir also mutig und verlassen uns viel öfter auf das, was wir fühlen als auf das, was wir vermeintlich schlau ersinnen.
Wie der Entschluss zum Kauf des Grundstücks herbeigeführt wurde, ist mir heute entschwunden. Nie zuvor hatte ich so viel Geld ausgegeben. Nie zuvor hatte ich mich finanziell so auf Dauer gebunden. Aber es gab wahrscheinlich die Annahme, es nie als Bindung zu empfinden. Es gab die Sicherheit, die richtige Entscheidung zu treffen. Der Entschluss war alles andere als gedankenlos zustande gekommen. Es waren aber nicht Pläne, Rechnungen oder Zukunftsprognosen, die entschieden. Wir wollten in einem Haus mit Garten dann leben, wenn diese Umgebung am wichtigsten ist. In Kombination mit dem befriedigenden Gedanken, sich selbst die Miete zu zahlen, war die Idee sogar vernünftig unterlegt. Aus heutiger Perspektive mit Blick zurück auf spielende Kinder und mit Blick voraus auf die Rentenerwartungen, erwies sich die Entscheidung als die wichtigste und klügste materielle meines Lebens. Bis heute waren wir uns stets des Luxus´ bewusst, in einem großen Haus mit viel Bewegungs- und Gestaltungsraum leben zu können. Glück muss gestaltet und gebaut werden.
Es gab nicht die Abarbeitung eines Plans, sondern mehr das Hineinschnuppern in eine neue Welt der Hypotheken, Notare und Grundstücksverträge. Von nichts hatten wir eine Ahnung. Nach und nach wurden die Schritte zum Erwerb recherchiert. Jede neue Erkenntnis wurde verarbeitet. Notwendiges wurde möglich und dann auch wie selbstverständlich angegangen.
Irgendwann hatten wir dann das Grundstück erworben. So verkürzt, lässt es mich heute manchmal vergessen, wie sehr dessen Erwerb bis zuletzt fraglich war. Immerhin mussten wir beim Notar sehr lange auf die Beendigung des Termins der Vorbesitzer warten, an den sich die notarielle Abwicklung unseres Grundstückkaufs anschließen sollte. Wir saßen gemeinsam in einem vergilbten Wartezimmer, als der Notar aus seinem Büro kam und uns fragte, ob wir bereit wären, einen höheren als den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen. Die in Scheidung lebenden Vorbesitzer konnten sich nicht auf die Aufteilung des Grundstückserlöses einigen. Ich lehnte damals ab. Ohne Überlegung, ohne Sorge um den Verlust des Grundstücks. Es war wieder das spontane, emotionale, wenig taktische, aber dafür werthaltige Vorgehen: „Abgemacht ist abgemacht, wir geben keine Mark mehr.“ Der Notar hatte keine andere Antwort erwartet und entschuldigte sich für sein unseriöses Verhalten, wie er es selbst nannte. Wenige Minuten danach wurde der Kauf des Grundstückes zu den ursprünglich ausgehandelten Bedingungen abgewickelt.
Nach so vielen Jahren ist das spannendste an dieser Anekdote, die Antwort auf die Frage, wie unser Leben verlaufen wäre, hätte der Streit der Vorbesitzer den Kauf des Grundstücks verhindert. Natürlich ergibt eine nicht erlebte Vergangenheit keinerlei verlässliche Annahme. Den Gedanken kurz aufzurufen, verursachte mir aber mehr kribbeln als damals, als im schäbigen Vorzimmer der Notarstube innerhalb weniger Sekunden eine für die dann bis heute folgenden 35 Jahre eine fundamentale Entscheidung fürs Leben getroffen wurde. Literarisch ausgeschmückt hätte Stefan Zweig hier Stoff für ein Kapitel seines Buches „Sternstunden der Menschheit“ gefunden. Und es sollten weitere Sternstunden folgen, die jeweils eine wichtige Weichenstellung im Leben bedeuteten und deren nachhaltige Prägung fürs Leben zum Zeitpunkt ihres Durchlaufens nicht immer vollständig erfasst werden konnte.
Die wichtigste Entscheidung war die Heirat. Nicht als solche, sondern die Verbindung mit meiner Frau. Leider darf ich weder über sie noch über unsere Ehe etwas schreiben, weil sie natürlich völlig recht hat in ihrer Festlegung, das ginge niemanden etwas an. Mich entbindet diese Haltung davon, hier eine anstrengende Suche nach Superlativen für meine Frau in Worte fassen zu müssen. In einer literarischen Verarbeitung meines Glücksgefühls bei dem Gedanken an sie hätte ich Goethe in den Schatten stellen müssen, was ich mir nicht zugetraut hätte.
Auch wenn ich hier so lange lebte, wie an keinem Ort jemals zuvor, so hatten mich die Orte meiner Kindheit stärker geprägt. Wäre es anders gewesen, hätte ich vielleicht niemals ein Haus in dieser Umgebung gebaut. Meine Kinder sollten in dieser Umgebung aufwachsen und sich eher von ihr als von irgendeiner anderen prägen lassen.
Unsere Werturteile entwickeln wir immer aus den uns möglichen Vergleichen. So vergleiche ich unser Haus mit meinen Stationen davor, nicht mit Schloss Windsor oder einer Villa am Strand von Malibu. Ich weiß aber sicher, dass eine andere Gestaltung meiner Lebensumstände mich nicht hätte glücklicher aufwachsen und leben lassen. Mit über 65 Jahren kann ich das für mich zusammenfassen: Ein glückliches Leben war´s.
Der Weg zum Bus zeigte im Februar eine wenig attraktive Szenerie. Die Felder waren mit ihren vergessenen Anbauresten unansehnlich, die Wege nass und deren Ränder von Schneeresten aufgeweicht. Den auf wenigen Metern vorhandenen Sandfußweg benutzte ich besser nicht, weil ich meine Schuhe sauber halten wollte.
Die Blätter und Zweige der Rosensträucher der Rosenschule glänzten in künstlichem Glanz und zeigten jedem, der es sehen wollte, wie wirksam Giftspritzen sind. Jeder sah seit Jahren den Gärtner und seine Hilfen mit dem Gifttank auf dem Rücken die Rosen einnebeln. Ich selbst konnte mehr als 35 Jahre auf diesen Flächen die Vergiftung unseres Trinkwassers mitansehen, ohne dass dem Einhalt geboten wurde. Viele Jahre davon waren Grüne in der Bundesregierung oder in der Hamburger Landesregierung. Es ist Zeit für eine Umweltbewegung, die nicht auf gut dotierte Politiker-Pöstchen schielt.
Erstmals in Hamburg
Eine Bushaltestelle war das Erste, was ich in meinem Leben von Hamburg sah. Als meine Eltern einen Umzug von Berlin nach Hamburg erwogen, nahmen sie mich eines Tages mit nach Norddeutschland. Wir wohnten in einem kleinen Hotel. Als ich morgens noch in der Dunkelheit aufstand und zum Fenster heraus sah, konnte ich auf eine Bushaltestelle blicken. Es regnete stark und die Leute stiegen mit Schirm, nassen Trenchcoats und hochgehalten Kragen in den Bus. Es war die perfekte Szenerie für einen Werbespot mit dem eindrucksvoll für die Notwendigkeit von Hustensaft oder Grippemitteln hätte geworben werden können.
Dass auch Schüler dabei waren, erinnerte mich an mein Schule schwänzen. Später hatte ich dann gelernt, dass die beobachtete Szene sich in Trittau und nicht in Hamburg abspielte. Heute wundere ich mich in Ehrfurcht vor der Speicherleistung eines menschlichen Gehirns noch genau an die Szene. Das banale Bild von in den Bus einsteigenden Fahrgästen über Jahrzehnte speichern zu können, schien sinnlos. Das Wunder ist nicht allein im Alter der Bilder, die uns begleiten zu sehen, sondern auch in der unzähligen Menge der gespeicherten Bilder. Gesammelt im Alltag und auf Reisen, verknüpft mit Geräuschen, Gerüchen und Gefühlen. Kombinationen, die bis heute kein Smartphone speichert. Denke ich an die Berliner U-Bahn, kann ich sie riechen. Erinnere ich mich an Wanderungen in Cornwall, spüre ich den Regen in meinem Gesicht. Fahre ich in Gedanken eine Skipiste bergab, spüre ich den Kantengriff meiner Skier.
Erst wer sich einmal die Zeit genommen hat, eine Blume auf einer Wiese ohne Zeitdruck zu betrachten, kann nachvollziehen, was anzuerkennen mir als einziges Zeit meines bisherigen Lebens nie schwerfiel. Die Bewunderung für die Leistungen der Natur stumpfte nie ab, wie etwa das Interesse an zeitweise sehr beliebten Beschäftigungen.
Die Bushaltestelle an meinem Wohnort war eine der letzten in Hamburg, die noch nicht zu einer Werbestätte geworden war. Hier gab es noch die beschmierten Scheiben und die Eternitplatten, die die Scheiben ersetzen mussten, die jugendlichem Drang nicht standgehalten hatten. Ja, hier war die Welt noch in Ordnung. Wie viel Zeit ich wohl schon an Bushaltestellen verbracht hatte? Jedes Mal wurde ich zur Ruhe gebracht. In dieser Wartesituation lag die Chance, meine Umgebung zu erkunden. Vorbeifahrende Autos, das Verhalten anderer Wartender und deren Aussehen boten Abwechslung und jede Beobachtung für sich hatte sicher ihre Geschichte. „Wohin fährt sie jetzt mit dem Auto?“, „Warum sitzen darin drei Erwachsene?“, „Welches Buch liest er gerade neben mir?“, „Mit wem telefoniert sie geradezu ausgelassen fröhlich am Morgen?“, „Fahren die Drei gemeinsam an einen Arbeitsplatz?“, „In dem Anzug muss er ja heute etwas Besonderes vorhaben“. Im Warten lag immer auch eine Chance auf etwas zu stoßen, das wir im vorüber hetzen nie gesehen und erlebt hätten.
Als ich in den 60er-Jahren mit meinen Eltern in ein Neubaugebiet nach Hamburg zog, war meine Einstiegsstelle für die Fahrt zur Schule oder nach Hamburg die erste Haltestelle, also der Beginn der Buslinie. Die Linie 9 hielt in Sichtweite und fuhr dann in die gleiche Richtung, in die ich zur Haltestelle ging. Die dort mit dem Bus ausgetragenen Wettrennen sind heute nur noch Erinnerung und das gelassene Verpassen einer Busabfahrt ist heute der nicht mehr zu leugnende Beweis für mein Altern.
Manchmal erinnere ich mich an Busfahrten, die wie aus einem anderen Leben vor mir auftauchten. Mir fallen die Stunden ein, die ich auf Nachtbusse wartete, wenn ich von meiner Freundin kam. Oder ich erinnere mich an morgendliche Busfahrten nach Mölln, mit denen ich meinen Arbeitstag als Holzstapler in der Parkettfabrik Höhns begann. Gespeichert ist in diesem Zusammenhang die morgens im Dunkeln gefahrene Strecke auf der B207, die von den Ausdünstungen der Fahrgäste von innen beschlagenen Scheiben, die an jeder Haltestelle in den Bus drängenden Schüler, der weite Weg zur Parkettfabrik durch neblige Felder und schließlich der Duft des frischen, feuchten Holzes, das sich noch vormittags mit dem Schweißgeruch der Akkordarbeiter vermischte.
Hier verdiente ich mir Geld. Vermittelt durch die Kontakte meines Vaters, stapelte ich auf Akkord Holz. Eine Palette Weichholz brachte 7,- DM, eine aus Hartholz 12,- DM. Noch heute sehe ich die älteren Frauen, die mit Kopftuch in kleinen Gruppen kamen und deren Arbeitstempo mich herausforderte. Ein kleiner, still für mich erfundener Wettbewerb, der die Strapazen des Bückens und Schleppens übertünchte und den ich, bestenfalls palettenweise, gewann. Nach einer Wettbewerbsetappe musste ich mich dann wieder zurückfallen lassen in ein Tempo, das hinter dem der „Alten" zurückblieb. Der Wettbewerb ist längst vorbei, der mit ihm einhergehende Respekt ist stellvertretend für alle hart arbeitenden Menschen in mir geblieben. In jenen Jahren erster Jobs ist nicht nur die Grundlage für Respekt gelegt worden, sondern auch für eine meist stille Dankbarkeit, in meinem Leben nie lange auf harte körperliche Arbeit angewiesen gewesen zu sein. Die Dankbarkeit ging oft einher mit Abneigung, gegen die, die bei der geringsten Belastung das Jammern anfingen. Stöhnten Studenten wegen ihrer Seminararbeiten, fielen mir immer die Arbeiter bei der Kerzenfabrik Gies ein, die, während die Studenten klagten, betonhart gefrorene Parafinsäcke aus Kühlcontainern holten und eiserne Wendeltreppen hoch schleppten.
Als vor wenigen Jahren die vor unserem Haus vom Herbststurm gefällte Eiche zu Kleinholz zerlegt und von mir gestapelt wurde, roch ich wieder die Hartholzpaletten des Parkettwerks. Fünfzig Jahre lagen zwischen der ersten Begegnung mit Eichenholz und der Verarbeitung des Bruchholzes auf unserem Grundstück. Das Gehirn war fähig dazwischen eine Brücke zu schlagen, indem es Düfte speicherte und automatisch wieder ins Bewusstsein holte. Wo waren diese Düfte gespeichert und wie? Wunderbar.
Früh hatte ich Einblick in die Arbeitswelt genommen. Als Schüler bin ich für fünf Mark die Woche mit dem Fahrrad drei Kilometer weit nach Bergedorf gefahren. Hin zum Buchladen Nordmann, der in einem alten, kaum erhaltenswerten Hause in Bergedorf einen kleinen Laden betrieb. Es war einer von zwei Buchläden in Bergedorf. Den anderen, Fachbuchhandlung Boeisen, gab es viele Jahre am Schloss, bis er dem Internet zum Opfer fiel. Zuvor verschwand spurlos Nordmann. Heute steht dort, wo damals der Verkehr durch eine Einbahnstraße nach Norden rollte, das Marktkauf-Center. Die Straße ist längst Fußgängerzone. Mein erster Job öffnete Hintergründe und brachte mir, Puzzlestücken gleich, Erkenntnisse, die damals für mich noch kein schlüssiges Gesamtbild ergaben.
Da war der Studienrat im Villenviertel, der fast jeden Tag ein Buch gebracht bekam und nie Trinkgeld gab. Der Titel und der weinrote Strickwesten tragende grauhaarige Mann flößten Achtung ein. Was für ein Titel: Studienrat! Jahre später machte ich mich auf den Weg vom Bücherboten zum Studienrat. Vom Tellerwäscher zum Millionär wäre besser gewesen. Immerhin würde ich es später während meines Studiums bis zum Tellerwäscher bringen.
Jetzt nur nicht die Chronologie meiner Jobs durcheinanderbringen. Die vielen Jobs waren mit sehr vielen wichtigen Erfahrungen verbunden. Sie bahnten mir den Weg aus einem Arbeiterhaushalt in ein akademisches Umfeld. Nie fühlte ich mich gezwungen, Jobs anzunehmen. Ich war aber auch sehr neugierig auf das, was in der Arbeitswelt so alles ablief. Und Geld in der Tasche zu haben, über das ich allein bestimmen konnte, fühlte sich immer gut an. Viele Jahre später versuchten mir einige Dozenten weiß zu machen, dass die Gehaltshöhe in der Arbeitswelt kein wichtiges Kriterium für die Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit wäre. Für mich war der Gedanke daran, was ich gerade in Augenblicken schwerer Arbeit verdiente eine hohe Motivation durchzuhalten. Das blieb auch in verantwortungsvolleren Aufgaben so. In so mancher sinnloser Diskussion, während vieler einschläfernder Sitzungen oder versuchter Demütigungen durch Vorgesetzte rettete mich die Rechnung, wie viel Geld ich gerade mühelos verdiente. Ohne die Motivation durch ein gutes Gehalt, hätte ich die letzten vierzig Berufsjahre nicht schadlos überstanden, wäre vielleicht verzweifelt oder depressiv verfallen.
Als Bücherbote hatte ich ganz Bergedorf mit dem Fahrrad zu befahren, bis zur Grenze nach Schleswig-Holstein, sechs Tage die Woche. Am Sonnabend gab es dafür fünf Mark in bar. Das ging so lange gut, bis eines Tages in meinen Satteltaschen Bücher gefunden wurden, die ich Tage zuvor wegen abwesender Empfänger nicht abliefern konnte. Die Bücher waren feucht geworden, abgewetzt und nicht mehr auszuliefern. Meine Eltern kamen für den Schaden auf und ich gab die Büchertour auf. An einen Vorwurf meiner Eltern erinnerte ich mich in diesem Zusammenhang nicht.
An der Bushaltestelle konnte man es jetzt im Februar schon gut aushalten. Es war zwar noch kalt, aber die Sonne strahlte schon in einer Helligkeit, die sie nur im Frühling hatte. Alles erschien klar konturiert. Nichts konnte mehr im winterlichen Grau verschwinden.
Als der Bus kam, hob ich meinen kleinen Koffer, an dem noch immer der Aufkleber der Gepäckaufbewahrung des Frankfurter Flughafens klebte, wartete auf die sich öffnende Tür des Busses und sah wieder einmal in das überraschte Gesicht des Busfahrers, der an diesen Haltestellen selten Menschen ohne Monatskarte einsteigen sah.
Früher hatte ich auch eine Monatskarte. Als Schüler durften oder mussten wir mit dem Bus zur Schule nach Bergedorf fahren. Ob wir durften oder mussten, war mir gar nicht mehr klar. Jedenfalls musste jeden Wintermonat eine Wertmarke am Bergedorfer Bahnhof gekauft werden. Der Bogen, der per Stempel der Schule die Berechtigung für den Kauf der Zwei-Zonen-Monatskarte darstellte, wurde dem durch dickes Glas vor seinen Kunden geschützten Verkäufer durch eine Öffnung, die dem Geldaustausch diente, zugeschoben. Hoheitsvoll wurde ein Stempel auf das vorgegebene Feld mit dem aktuellen Monatsnamen gesetzt und nach Barzahlung erhielten wir Schüler eine hellgelbe, quadratische Marke, die sofort leicht nach unten versetzt - alles war genau vorgeschrieben - über die Marke des Vormonats geklebt wurde. Mit dem Geschmack des angeleckten Klebstoffs im Mund wurde die Karte zugeklappt und in ihre Schutzhülle zurückgeschoben.
Die Monatskarten waren damals durch das Foto Ausdruck wilder Kreativität. Gegenseitiges übertrumpfen durch alte, den Inhaber entstellende Fotos, war immer angesagt, wenn gemeinsames Busfahren anstand. Dem Schüler-Monats-Karten-Wettbewerb folgte Jahre später der mit den alten Führerscheinfotos in alten grauen oder rosafarbenen Formaten. Dieser Wettbewerb drohte durch kleine Plastikkärtchen in Vergessenheit zu geraten.
Busfahrten
3,50 € hatte ich früher für die Fahrt bis zum Hauptbahnhof zu zahlen. Jetzt beinhaltete mein Bahnticket die Citycard, die kostenfreie Nutzung der existierenden Nahverkehrssysteme am Abfahrtsort und am Zielort. Die Citycard war ein seltenes Beispiel für eine positive Auswirkung politischer Entscheidungen. Die Einführung des Pfands auf Dosen und Plastikflaschen war ein anderes positives Beispiel. Ansonsten sorgten politische Entscheidungen für höhere Krankenkassenbeiträge und fahrradunfreundliche Städte, auch wenn das Gegenteil erreicht werden sollte. Die Politik überließ internationalen Hotelkonzernen die besten Innenstadtstandorte, die sich hervorragend für Wohnbebauung und damit für lebendige Viertel geeignet hätten und pflasterte stattdessen Grüngebiete mit eng an eng stehenden Wohnsilos zu. Positive Folgen politischen Handelns aufzuzeigen fiel schwer. Gangsterbanden konnten ziemlich unbehelligt ihre Clanarbeit verrichten und Verdächtigen konnte kein Prozess gemacht werden, weil die Justiz Fristen verstreichen ließ. In Schulbussen wurden Schülermassen eingepfercht zu den Schulen transportiert, wie nicht einmal Vieh transportiert werden durfte. Eine wahrlich schlechte Werbung für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs. Konsequenz: sobald man konnte floh man vor dem teuren unzuverlässigen S-Bahnen und Bussen, sparte sich die 12 Euro für eine Tageskarte für zwei Personen und fuhr mit dem Auto in die Stadt.
Für die Größe der Verwaltungsapparate und die Menge an Politikern gab es keine guten Arbeitsergebnisse. Jedenfalls nicht für die, die sich keinen Lobbyisten am Regierungssitz leisten konnten. Wer entschied darüber, dass die Straße, an der wir wohnten, eine Tempo-30-Zone, mehrfach frisch asphaltiert wurde innerhalb weniger Jahre? Wer ließ monatelang eine Straßenbeleuchtung mit Laternen im Abstand von höchstens 40 Metern in einem Naturschutzgebiet installieren, durch das gar kein Auto fahren durfte? Wer gab Geld aus für den Umbau einer Kreuzung, die nach monatelangem Umbau ein wesentlich größeres Verkehrshindernis als zuvor darstellte? Wenn mir sofort aus dem Umkreis meines Hauses etliche Beispiele von Steuerverschwendung einfielen, wie groß musste das Problem bundesweit sein? Das Thema „sinnlose Verschwendung“ oder „Schildbürgerstreich“ eignete sich hervorragend für Fernsehberichte, die ihre Komik aus den grotesken Beispielen unsinniger Brücken, unvollendeter Straßen, die im Nichts endeten, Fahrradwegen, in deren Mitte Laternen gesetzt wurden und vielen fast unglaublichen Entscheidungen zogen. Fehler passierten überall. Das Erschütternde daran waren aber zwei Tatsachen: Obwohl alle die Gefahr unsinniger Verschwendung kannten, passierten diese Dinge immer wieder. Zweitens fehlte in den Berichten darüber jeder Hinweis darauf, dass Verantwortliche für den Diebstahl von Steuergeldern zur Verantwortung gezogen wurden.
Politiker müssen zuerst an sich denken, an ihren sicheren Listenplatz bei der nächsten Wahl. Ihr Horizont ist also auf einen Zeitraum von vier Jahren beschränkt. Deshalb bleibt, nachdem den von der Presse aufgerufenen Themen nachgehetzt wurde, zu selten Zeit, eigene Themen zu setzen und diese zu verfolgen. Ein Systemfehler demokratischer Verfassungen, der radikalen Parteien als Nährboden diente.
Mein Arbeitgeber bezahlte mir mein Ticket. Auf Kosten anderer zu reisen, war auch eines meiner Privilegien. Das Gefühl brauchte ich dringend, denn es war eines der wenigen Argumente, die ich für meinen Arbeitsplatz in den letzten Jahren fand. Erst der Vergleich zu anderen Arbeitsplätzen ließ mich das ertragen, was ich an Ungerechtigkeiten und an Inkompetenz erlebt hatte. Ich saß vormittags in einem warmen Bus, einen kleinen Koffer neben mir, der den anderen Busfahrgästen anzeigte, ich würde weiter fahren als nur bis zu einer der Haltestellen, die innerhalb der nächsten halben Stunde angesteuert wurden. Dass das besser war als Holz stapeln, war mir jederzeit bewusst. Ich konnte es genießen und schaffte es nur durch dieses Bewusstsein letztlich wirklich privilegiert zu sein.
In der Zeit, in der ich diesen Gedanken nachhängen konnte, hungerten Menschen, krümmten sich Menschen vor Schmerzen, drohten, sich vor Kummer aufzulösen, verzweifelten an der Welt oder schleppten Güter auf ihren Buckeln für ein Entgelt, das es ihnen unmöglich machte, diese Güter, die sie schleppten, selbst zu erwerben. Klar war ich privilegiert. Allein schon deshalb, weil ich einige dieser Gedanken nicht aus eigenem Erleben ableitete, sondern aus meinem Interesse für die Welt. Hunger und Schmerzen, Verzweiflung und Angst hatte ich nicht kennengelernt. Ich war ein Glückskind, was schon an Region und Zeitraum lag, durch die ich schritt. Aber was hat man von dieser Situation, wenn man sie nicht als Glück erkennt und dann genießen kann, immer mehr will oder an allem etwas auszusetzen hat?
Der Bus war nicht voll, doch er füllte sich sehr gleichmäßig über die nächsten Stationen. Schon zwei Stationen nach meinem Einstieg betrat eine Erinnerung an meine intensivste Zeit im Heimatdorf den Bus. Die Frau betrieb hier bis vor kurzem einen Laden und war Drehscheibe allen Tratsches, der unter die Leute kommen sollte. Sie kannte jeden und alles in der Umgebung und war uns so wohl gesonnen, dass wir bei jedem Treffen auf den neuesten Stand gebracht wurden. Man hatte mich gewarnt aufs Dorf zu ziehen. Jeder wüsste dort alles über jeden. Jeder beobachtete jeden. So war es tatsächlich, aber leider nicht mehr vollständig. Beobachtet zu werden, kann einen dann beruhigen, wenn man nichts zu verbergen hatte. Beobachtet zu werden, heißt auch, dass die Nachbarn auf mein Haus aufpassen und ich keine Sorge haben musste, monatelang in meiner Wohnung zu verwesen, bevor mich zufällig jemand fand. Sich bei den Begegnungen zu grüßen, schafft eine freundlichere und friedliche Umgebung als sie im Gedränge eines Einkaufszentrums entstehen kann. Wer guten Willens ist, kann dagegen nichts haben.
Die Frau hielt das Ladengeschäft geöffnet, ihr Mann arbeitete als selbständiger Handwerker. Ihre Tochter ging mit meiner in die Grundschule, bevor sich ihre Wege in Richtung Gymnasium und Gesamtschule trennten. Warum fiel mir aber jetzt ein, dass ich mit dieser Frau auch gemeinsam in einer Musikgruppe gespielt hatte? Sonst kam die Erinnerung nur in irgendeiner Verbindung mit Weihnachten vor. Weihnachten war nämlich Saison für die Flötengruppe. Heiligabend hatten wir zwei Auftritte. Man konnte mich zu einem Festvortrag nach Berlin schicken und mich dabei vor einen vollbesetzten Festsaal treten lassen, aber der Gedanke, vor Publikum musizieren zu müssen, brachte mich aus der Fassung. So kam auch kein Widerstand meinerseits, als die Gruppe sich auflöste. Obwohl ich gemeinsames Musizieren als Inkarnation der Harmonie ansah und jeden Musiker beneidete, der mit anderen zusammen symphonische Klänge erzeugte, waren die Auftritte für mich eine Qual. Es verdarb mir Weihnachten und so war ich nicht nur Dulder des Auflösungsprozesses der Musikgruppe, sondern hatte ihn durch aktives Nichtstun auch befördert. Weihnachten ohne Auftritt empfand ich seitdem als Befreiung, aber nicht ohne ein wenig Wehmut an das Ende meiner „Musikerkarriere“.
Mit dem Nachlassen körperlicher Möglichkeiten, mit dem erzwungenen Aufgeben von Fußball und Tennis und dem Verfall skiläuferischer Qualitäten häuften sich die Seufzer, ich hätte doch mehr in das eigene Musizieren investieren sollen. Wäre ich doch ein fleißigerer Akkordeonschüler gewesen. Warum hatte es mir keine Freude bereitet, einen großen, schweren Akkordeonkoffer an meinen Freunden vorbei, die gerade Fußball spielten, drei Stockwerke hoch in einen Berliner Altbau zu schleppen, um mir dort in einem düsteren, plüschigen Ambiente die Vorwürfe eines verrenteten Klavierlehrers anzuhören, der mir wiederholt vorwarf, „Lustig ist das Zigeunerleben“ noch immer nicht fehlerfrei und richtig betont spielen zu können?
Doch reflexartig kam bei dem Gedanken wie immer sofort der Konter mit der eigenen sportlichen Vergangenheit, die mich nicht nur körperlich, sondern auch zeitlich voll beanspruchte. Für beides, Musizieren und Sport treiben war meine Jugend zu kurz.
Ein Blick durch die Scheiben des Busses bewies mir, dass es noch einige Zeit brauchen würde, bis das Wetter wieder angenehme Touren durch die Gegend zuließ. Ich würde zwar die nächste Gelegenheit nutzen, um mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, doch wäre das eine der Vernunft geschuldete Pflicht bei meinen Blutzuckerwerten. An diesem Punkte gab es eine Schnittstelle zu allen Zweiflern an Darwins Evolutionstheorie. Warum hatte sich das genussvolle Schlemmen und das beglückende Faulenzen nicht allem Quälenden als überlegen erwiesen? Warum war es gesünder, Fahrrad zu fahren statt Eis zu essen?
Bevor die ersten städtischen Wohnblöcke erschienen, mussten erst einmal häuserleere Straßenabschnitte passiert werden. Es tat den Augen gut, den Blick weit ins Land schweifen lassen zu können. Für sie war es wahrscheinlich wie eine Kur nach viel zu langem Starren auf Bildschirme. An Weitblicke konnte ich mich nie gewöhnen. Ich bin der festen Überzeugung, als betagter Greis jeden Tag von morgens bis abends an einem Fenster zubringen zu können, vor dem nichts Besonderes passiert. Ich würde immer etwas entdecken. Passend zu diesem Gedanken fiel mir ein, wie ich erst kürzlich meine Familie auf die, wie ich es nannte, sensationelle nächtliche Beleuchtung der Tatenberger Schleuse aufmerksam machte. Beiderseits des von zwei Schleusentoren eingeschlossenen Wasserbeckens standen in gleichmäßigem Abstand Laternen, deren elektrisches Licht in sattem Gelb abgegeben wurde und sich durch Spiegelung im Wasser in seiner Wirkung mehr als verdoppelte. Die Krönung dieses Farbspiels schaffte die am Tor angebrachte kleine, aber strahlkräftige Ampel, deren Rotlicht, wie von Künstlerhand drapiert, perfekt zur Szenerie passte, die Symmetrie lockerte und die gelbe Strenge lebendig werden ließ. Ich hatte schon angehalten und das mit meinem Fotohandy festgehalten. Fotografisch war das zwar eine Katastrophe, aber über die Aufnahme war das Bild auch in meinem Kopf gespeichert. Außerdem war ich darauf vorbereitet, die Szene auch mit meinem Fotoapparat einzufangen. Den hatte ich jetzt zwar dabei, aber als der Bus über die Schleuse fuhr, gab es im Tageslicht keine Verbindung zwischen dem Bild, das ich sah und dem, das ich im Kopf hatte.
Fortschritt
Um wenigstens in meiner Phantasie die Möglichkeit zu erhalten, ich wäre für einen kreativen Job geeignet, bilde ich mir ein, ich hätte Fotograf werden können. Dass ich in Richtung Lehrer und Verkäufer abtrieb, folgte wohl meiner richtigen Selbsteinschätzung, mit einem festen Jobauftrag und einer monatlich verlässlichen Gehaltszahlung ruhiger und zufriedener leben zu können. Es wurde ein Motiv für den Wechsel von einem gutverdienenden Verkäufer mit stark schwankendem monatlichen Provisionseinkommen zum Verkaufsleiter, verbunden mit monatlich gesichertem Gehaltsverzicht.
Meinen ersten Fotoapparat kaufte ich mir noch als Zehnjähriger in Berlin. Da ging ich ohne Ankündigung und Begleitung in einen Fotoladen, in die der Wohnung meiner Eltern nächsten Hauptverkehrsstraße, und kaufte mir von meinem ersparten Taschengeld eine Kodak Instamatic 50. Der Apparat nahm Kodak-Kassetten auf, war damals für Leute gedacht, die das Einfädeln der Filme überforderte und hatte nur eine Einstellmöglichkeit. Anhand eines kleinen Schalters auf der Vorderseite der Kamera, war die Wahl zwischen Sonne und bedeckten Himmel gegeben. Die Einstellung „Bedeckter Himmel" löste einen Blitzimpuls aus. Über eine sich bei ihrer Arbeit zerstörende Blitzbirne hätten Blitzaufnahmen gemacht werden können, wenn das Geld für einen Blitzwürfel gereicht hätte. Dafür reichte es damals bei mir natürlich nicht. Meine Erinnerung ließ mich jetzt im Stich, als ich an den Kaufpreis dachte. Es müssen genau 40,00 DM gewesen sein. Nein, das verwechselte ich jetzt mit meiner ersten Uhr, einer Kienzle mit 17 Steinen. Die hat, da war ich mir immer sicher geblieben, genau 40,00 DM gekostet. Auf jeden Fall hatte ich damals ein Vielfaches meines monatlichen Taschengeldes in die Kodak Instamatic 50 investiert. Das hat meinem Vater so imponiert, dass er mich spontan mit Geld für eine Ledertasche aus dem Originalzubehör ausstattete. Erst später als Vater konnte ich ungefähr nachvollziehen, wie jemand fühlt, dessen Erziehung dazu führt, dass sich sein Kind statt Eiskrem oder Puffreis einen Fotoapparat kauft. So etwas stellt jede verbale Rückmeldung zur Erziehung wie sie von Verwandten kommen kann, „was habt ihr für tolle Kinder“, oder von den Kindern selbst, „danke, Mami, danke Papi“ in den Schatten.
Der Fotoapparat steckt noch heute in seiner Ledertasche und beides sieht aus, als hätte ich es erst gestern in dem Fotoladen in der Reinickendorfer Straße erworben. Die Gedanken an Kameras und ans Fotografieren wuchsen dann mit mir mit. Als jugendlicher Schüler kam ich an keinem Fotoladen vorbei, ohne mir die Voigtländers, die Rolleis oder die Agfas anzusehen und deren technischen Werte zu vergleichen. Leisten konnte ich mir damals aber keinen dieser Apparate. Außerdem hatte ich ja meine Kodak Instamatic 50. Die damals aktuellen Kameras wurden von Spiegelreflexkameras mit integriertem Belichtungsmesser verdrängt, dann von Kameras, die automatisch fokussierten, dann von Kameras, die einen digitalen Aufnahmesensor besaßen und schließlich von Smartphones, deren Linsen und Sensoren ein Vielfaches an Auflösung einer Spiegelreflexkamera von vor 15 Jahren besaßen. Eine Technik frisst die nächste. Das war Fortschritt, den man nie voraussehen konnte, der aber in der Rückschau, durch seine kurzen Zyklen sehr beeindruckte oder einem den Atem nahm.
Als Student erwarb ich nach langem Auswerten aller Angebote die beste damals für mich realisierbare Möglichkeit, eine Yashica FR1. Ergänzt wurden Gehäuse und 1,8/55mm-Wechselobjektiv nach und nach durch ein 200mm-Tele, ein Braun-Blitzgerät, einen Fernauslöser und eine stahlgekofferte Schultertasche, um alles zu schützen. Die Ausrüstung wurde überallhin mitgenommen. Bei meiner Greyhound-USA-Durchquerung war dieser Koffer rucksackfüllend überall dabei. Selbst beim Ski laufen wurde die Ausrüstung mit auf die Piste genommen.
Was aus Sicht eines Smartphoneknipsers ein unverständlicher Aufwand sein mag, war für mich damals keine besonders aufwendige Leistung. Es fehlte schlicht die einfachere Alternative zu Fotos von Reisen oder dem Bewegen auf Skipisten. Die Auflösung der Spannung, oft Wochen nach der analogen Aufnahme zu sehen, was aus dem Bild geworden war, war wie ein zusätzliches Urlaubserlebnis. Die Filme mussten sicher aus der Kamera geholt werden und richtig aufbewahrt nach Hause gebracht werden, manchmal mussten sie auch durch die Röntgenapparate an den Flughafen-Sicherheitskontrollen. Sie mussten, zum Beispiel in der Fotoabteilung eines Kaufhauses, jeder Film für sich in eine Tüte gepackt werden, diese musste mit Namen und Adresse beschriftet werden und es musste der Auftrag geklärt werden: Selbstverständlich den Film entwickeln, dann die Negative zu Farbfotos vergrößern, 9 x 13 cm oder 10 x 15 cm groß auf Hochglanz- oder Mattem-Fotopapier. Schließlich durfte nicht vor dem Einwerfen in den Schlitz in der Abteilung vergessen werden von jeder Filmauftragstüte den Kontrollstreifen abzureißen, denn dieser trug die gleiche Nummer, die auch auf die Tüte gedruckt war. Ohne diesen Abschnitt gab es keine Verbindung zum abgegebenen Film. Etwa eine Woche nach dieser Prozedur konnte man mit Hilfe der kleinen, abgetrennten Streifen, aus hunderten von Tüten die nach Nummern sortierten eigenen Fotos heraussuchen und sich erstmals die Ergebnisse des Aufwands ansehen. Ein normaler Urlaub von drei Wochen ergab damals etwa fünf Filme. An der Kasse waren in diesem Fall dann etwa 21,00 D-Mark je Tüte zu bezahlen für insgesamt etwa 5 x 36 Bilder. Diafilme konnte man auch gerahmt zurückerhalten. Aus heutiger Sicht ein Riesenaufwand. Er führte damals dazu, dass Motive genauer bewertet wurden, bevor der Auslöser an der Kamera gedrückt wurde. 180 Bilder wie damals für den gesamten Urlaubszeitraum werden heute von Vielknipsern an jedem Urlaubsvormittag geschossen. Bessere Bilder kommen letztendlich dabei meiner festen Überzeugung nach aber nicht heraus.
Irgendwann wurde meine Yashica dann für eine Canon EOS 10 mit Autofocus und Zoom in Zahlung gegeben. Mit jeder Automatik mehr nahm Jahr um Jahr die Begeisterung fürs Fotografieren ab und ist heute auf dem Niveau einer Digital-Kompaktkamera gesunken und ich habe mich schon dabei ertappt beim nächsten Mobiltelefonkauf auch auf eine gute integrierte Kamera zu achten.
Als Dozent fragte ich Anfang der 90er-Jahre meine jugendlichen Zuhörer, wer von ihnen mehr als zwei Uhren besaß. Damals gab es tatsächlich einige wenige, die mehr als eine Armbanduhr ihr Eigen nannten. Die glaubten mir wahrscheinlich auch als letzte, dass die Generation ihrer Vorväter meist nur eine Uhr besaß. Vielleicht war es die, die zur Konfirmation geschenkt wurde oder zum erfolgreichen Schulabschluss oder zum mehrjährigen Firmenjubiläum. Unseren Vätern und Müttern wäre eine Zweituhr meist verschwenderisch vorgekommen. Es kam die Zeit, da eine swatch immer häufiger passend zum Outfit gekauft wurde. Socken, Hemd und Uhr mussten farblich zueinander passen. Dieser Trend stoppte aber nicht bei den Armbanduhren.
Heute befinden sich in meinen Schränken sieben Fotoapparate, die sich im Laufe des Lebens angesammelt hatten, weil immer wieder eine technische Innovation Kauflust weckte. Sieben Kameras vorrätig und es wurde immer häufiger mit dem Smartphone geknipst. Der Wandel zu übertriebenem Konsum konnte aber auch an vier Fahrrädern, drei Computern oder gar den zwei vollständig gefüllten Kleiderschränken gemessen werden. Von Jahr zu Jahr wuchs in mir der Gedanke, eigentlich mit weniger mehr zu haben, mehr Zeit, mehr Kreativität, mehr Bewegungsspielraum und ein besseres Gewissen, gegenüber der Umwelt, was ja im Kern bedeutet, der nachfolgenden Generation Gutes zu tun.
Es war auch ein gutes Gefühl geworden, die Anbieter überflüssiger Artikel nicht zu fördern. Warum Importeure von Jeans unterstützen, wenn diese in Asien Kinder ausbeuteten? Warum überhaupt eine Jeans kaufen, wenn man nicht wirklich eine Jeans dringend benötigte? Warum Fleisch essen, wenn Mäster mit Tierfutter, das auf kriminell gerodeten Regenwaldplantagen angebaut wurde, viel zu viele Tiere auf grotesk engem Raum quälten und noch dazu mein Trinkwasser durch Unmengen von Gülle vergifteten? Gülle, die bei einer für Mitteleuropa ausreichenden Nahrungsmittelproduktion gar nicht anfallen würde. Die Überproduktion ist verursacht durch die Gier europäischer Landwirte, die den Weltmarkt mit teilweise subventionierten Lebensmittelexporten überschwemmen und damit die kleinbäuerlichen Strukturen in Entwicklungsländern zerstörten. Diese Zustandsbeschreibung ist keinem Parteiprogramm oder einer Gruppe intellektueller Spinner entnommen. Sie gibt das Bild wider, dass kritische Fernsehdokumentationen liefern, sie fast zusammen, was Schulbücher lehren und spiegelt eigene Erfahrungen. Die Wahrheit in dieser Beschreibung wird nicht einmal von Profiteuren des Systems geleugnet. Diese haben sich in ihrer Lobbyarbeit schlicht darauf konzentriert, die Abschaffung der Systematik zu verhindern. Und die Gedankenlosigkeit in Verbindung mit der Bequemlichkeit der Verbraucher, Angewohnheiten nicht zu verändern, lässt die Lobbyisten erfolgreich wirken.
In der Schule hatte ich schon in der 7.Klasse einen Fotokurs besucht. Was an Bildgestaltung vermittelt wurde, hat ergänzt durch eigene Kreativität, Jahrzehnte lang mein Fotografieren beeinflusst. Arbeiten in der Dunkelkammer der Schule oder später in der eines Schulfreundes, die dieser sich in einem Altonaer Keller eingerichtet hatte, haben jahrelang eine emotionale Bindung ans Bildgestalten wach gehalten. Immerhin hatte ich noch zusätzlich zum Smartphone einen Fotoapparat dabei, wenn wir wanderten, Ski liefen oder wenn ich nach Berlin unterwegs war.
Im Bus wurde es langsam zu warm. Alle Fahrgäste waren für die Außentemperatur gekleidet. Nur der Busfahrer saß an seinem Platz und herrschte über die Heizungseinstellung, die er an seiner Arbeitskleidung ausrichtete. Es waren ja nur wenige Minuten, bis ich einen Halt nutzen würde, um in die S-Bahn zu wechseln.
Als Kind hatte ich mich gerne auf der Plattform Berliner Doppeldeckerbusse aufgehalten, die in meiner Kindheit noch nicht durch Türen verschlossen waren. Manchmal verhinderte zwar der Fahrkartenverkäufer, dass einfach zwischen zwei Haltestellen, etwa an Ampeln oder in Staus, aufgesprungen wurde, meist war er jedoch im Bus unterwegs und verkaufte Fahrkarten. Dann waren fliegende Wechsel, Auf- und Absprünge möglich. Als Mutprobe sprangen wir an Ampeln schon mal vom Bus und tänzelten sinnlos neben der Plattform. Ich musste lächeln, wenn ich mir vorstellte, wie verkrampft oder zumindest lächerlich die Bewegungen ausgesehen haben mussten, die doch besonders großspurig wirken sollten. Wenn schon das Verlassen der Plattform nicht möglich war, so brachte doch das Hinauslehnen in den Fahrtwind den erwünschten Kick. Auf jeden Fall wollte jedes Kind an der Haltestelle seiner Wahl den Ausstieg durch einen mutigen Sprung vom noch fahrenden Bus bewältigen. Was damals in den Kindern steckte ist durch Sicherheitstechnik und nachträglich eingebaute Türen nach und nach verschüttet worden. Heute muss man eben das Cable Car in San Francisco nehmen, deren Trittbretter bei Touristen beliebter sind als die Sitzplätze. Oder man befährt den Brocken im Harz auf den Plattformen zwischen den Anhängern der Brockenbahn. Letzte kleine Abenteuer jenseits der sicherheitsbetonten Vorschriften für Passagiere.
Oder man betreibt S-Bahn surfen! Ist es vielleicht das paradoxe Ergebnis unseres Sicherheitsstrebens, das für die Toten des S-Bahnsurfens ursächlich ist. Als ich in der Jugend mit der S-Bahn nach Hamburg fuhr, konnte ich mir meinen täglich benötigten Kick holen, indem ich, bevor die Bahn im Bahnhof hielt, die Tür öffnete und mit besonders lockerem Schwung auf den Bahnsteig sprang, dabei hoffentlich die Restgeschwindigkeit der Bahn richtig einschätzte und die eigene Laufgeschwindigkeit nicht überbewertete. Heute sind die Fahrgäste bis zum Stillstand der Bahn eingesperrt. Wo holen die Jugendlichen sich heute ihren Kick? Müssen sie Sitze aufschlitzen? Müssen sie den Inhalt von Farbdosen versprühen?
Berufsanfang
Kein Gedanke verkürzte mir heute die Busfahrt. Das war auch gut so, denn ich hatte mich noch immer nicht entschieden, ob ich mit dem Bus bis zum Hauptbahnhof durchfahren würde, was meiner Bequemlichkeit heute gut entsprach oder ob ich am S-Bahnhof wirklich aussteigen würde und den unbequemeren, aber schnelleren Weg mit der S-Bahn nehmen würde. Ich hatte ja genug Zeit und war gespannt darauf, welche Entscheidung ich spontan beim Halt des Busses am Bahnhof treffen würde. Es sind alltägliche Augenblicke, die der Bedeutung von Zeit eine magische Bedeutung verleihen. Sie klärt Fragen, sie löst Probleme, sie hält Überraschungen für uns bereit und jedes Mal dürfen wir darüber fasziniert sein, dass uns die gerade eingetretene Entwicklung wenige Sekunden zuvor noch unbekannt war. Nach neunzig Minuten Fußball wissen wir, wer Weltmeister geworden ist. Es bedarf nur dieser kurzen Zeitspanne, um aus einer ungeduldigen, mit fieberhafter Aufregung erwarteten Lösung eine weltweit registrierte Binsenweisheit werden zu lassen. Wir müssen dafür nicht einmal irgendeine Anstrengung leisten. Beim 100 m-Sprintendlauf während olympischer Spiele dauert es sogar nur 10 Sekunden und wochenlange Spekulationen werden allein durch die Zeit zu dokumentierter Gewissheit. Die Zeit schafft unwiderrufliche Fakten. In 65 Jahren waren es sehr viele Fakten und ich war heilfroh, dass es nur wenige Augenblicke gab, in denen der innige Wunsch aufkam, die Zeit nur einige wenige Sekunden zurückdrehen zu können. In Erinnerung sind mir selbstverschuldete Autounfälle, die alle ausschließlich Blechschäden verursachten. Bessere Beispiele für Glück im Unglück kann es nicht geben und auf diesem Niveau ist die Unmöglichkeit, die Zeit zurückzudrehen, auch akzeptabel. Ich stieg aus und ging zum Bahnsteig.
Mit 28 Jahren hatte ich geheiratet. Als ich am Tag nach meiner Hochzeit zu meinem Chef ging und ihm für den fulminanten Blumenstrauß dankte, den die Firma zur Hochzeit übersandte, wusste der Chef von nichts und blickte ahnungslos ins Leere. Da war ich erst zehn Tage in der Firma, hatte aber gerade gelernt, dass die wichtigste Person in einem Unternehmen die Chefsekretärin ist. Die hatte nicht nur den Blumengruß realisiert, sondern auch noch die Situation im Chefbüro gerettet, indem sie durch die geöffnete Tür unseren gemeinsamen Chef durch einen kurzen Zuruf informierte und der Situation so jede Peinlichkeit nahm und ihr sogar durch ein Lächeln etwas Komisches verlieh. Die Chefsekretärin wusste alles was von Seiten des Chefs kam und was im Kollegenkreis kursierte. Wenn Wissen also wirklich Macht bedeutete, war sie die mächtigste Person im Unternehmen, mit der man es sich besser nicht verdarb.
Ich hatte mich immer für die Familie entschieden, sofern mir die Wahl gelassen wurde. Oft blieb diese Wahl nicht und ich musste mich von der Familie trennen, um für sie da zu sein. So fuhr ich Sonntagnacht nach Stuttgart, München oder Berlin nachdem ich die Kinder mit einer Geschichte zu Bett gebracht hatte. Meine Frau blieb mit zwei Kleinkindern und der gesamten damit verbundenen Arbeit zurück.
Die Trennung fiel mir jedes Mal sehr schwer, aber Geld verdienen zu müssen war alternativlos und ich disziplinierte mich immer wieder mit dem Gedanken an die Möglichkeiten, die ein guter Verdienst der Familie verschaffte: Haus, Garten, Urlaub, Tagesausflüge. Die Verantwortung wahrnehmen durch kaum zu verantwortende, übermüdete Nachtfahrten ist ein bis heute an mir nagender Widerspruch. Vermutlich ist er allein damit zu rechtfertigen, dass der unvernünftige Teil gesund überstanden wurde und mir bis heute keine realistische Alternative zum damaligen Verhalten eingefallen ist.
Nach dem Ende des Referendariats, das mir vorübergehend als Studienreferendar den Beamtenstatus auf Zeit samt Privatversichertenstatus eingebracht hatte, war ich gezwungen, mich nach Arbeit umzusehen. Seit dieser Zeit, in der ich alle Arztrechnungen einsah, sehe ich als eine wirkungsvolle Sparmaßnahme im Gesundheitswesen an, allen Patienten mindestens eine Kopie der Arztrechnungen, die die Kasse der Patienten bezahlen soll, den Patienten zur Einsicht und eventuell zum Einspruch zur Kenntnis zu geben. Viel mehr Erleuchtung brachte mein Beamtenstatus nicht und ich bin sicher, unsere Gesellschaft braucht diesen Status nicht. Nur die Beamten brauchen ihn für ihr Gefühl der Beschäftigungssicherheit und der hohen Altersbezüge. Zwei Motive, die sicher dafür sorgen werden, dass Beamte sich heftig zu Lasten aller anderen Gesellschaftsschichten gegen eine Veränderung ihres Status´ wehren würden. Warum sollen sich Politiker mit denen anlegen, die in Behörden politische Ideen zu Taten werden lassen sollen? Wenn die meisten der heute arbeitende Beamte in den Ruhestand gehen, sind Politiker, die heute Veränderungen durchsetzen, längst am Ende ihrer in Legislaturperioden gemessenen Amtszeit. Aus Beamten Angestellte des öffentlichen Dienstes zu machen, bedeute aber, sofort mit Zahlungen an die Sozialversicherungssysteme die Lohnkosten des Bundes, der Länder und der Kommunen stark zu belasten. Die Entlastungen für die öffentliche Hand folgen erst mit der Verrentung und den Rentenzahlungen aus der Rentenversicherung. Soweit wollen Politiker nicht denken, die heute jeden Cent für sinnige und unsinnige Wahlgeschenke benötigen.
Unsere Hochzeit war längst geplant, als noch nicht klar war, dass ich dem ersten Hamburger Studienseminar angehören würde, das komplett nicht in den Schuldienst übernommen werden würde. Kollegen, die ich an der Schule traf, hatten zuvor noch Einstellungen erreicht, wenn sie die richtigen Fächer unterrichteten. Gefragte Unterrichtsfächer waren Physik, Musik, Mathematik, aber auch Sport und das hatte ich als Fach für die gymnasiale Oberstufe studiert. Damals half es auch nicht, dass der Schuldirektor meiner letzten Schulstation mich gerne eingestellt hätte, weil ich eine wichtige Stütze der erfolgreichen Lehrerfußballmannschaft war, die es in meiner Referendarzeit bis in die Endrunde der Hamburger Hallenfußball Meisterschaft gebracht hatte. In der Finalrunde besorgte der Schulleiter allerdings durch zwei Eigentore selbst das Ende des Höhenfluges. Noch heute bekam ich eine Gänsehaut bei dem Gedanken, ich selbst hätte diese Eigentore verursacht. Ein jähes Ende meiner guten Beziehung zur Schulleitung wäre die sichere Folge gewesen.
Jahre nach meinem Referendariat saß ich diesem Schulleiter gegenüber und offenbarte ihm, dass ich mich als sein Nachfolger beworben hatte, allerdings erfolglos wie sich herausstellen sollte. Von allen Stellen, um die ich mich während meiner Zeit bei Mercedes bewarb, war es die des Schulleiters des Luisen-Gymnasiums, der ich am meisten nachtrauerte.
Eine Gesetzesänderung machte damals die Bewerbung für solche Positionen für mich möglich. Es war der politische Wille der Hamburger Schulsenatorin, externe Fachkräfte zur Professionalisierung der Schulen in Dienst zu stellen. Allerdings war der Apparat ihrer Behörde dagegen, die Umsetzung auch anzugehen. Ich wurde damals zu einem Gespräch in die Behörde eingeladen und saß einer Kommission gegenüber, die sehr deutlich zu verstehen gab, dass meine Bewerbung interessant und legal sei, sie dennoch keine Chance haben würde. Ich erfuhr, nach Ablauf der Bewerbungsfrist einziger Bewerber auf diese Position zu sein. „Wir werden aber noch andere finden." Sie suchten lange, fanden dann spät einen Afrikaheimkehrer, der vielleicht nicht qualifizierter, aber eben einer aus ihren Reihen war.
In meine persönliche Enttäuschung mischte sich Frust über das Eigenleben behördlicher Apparate. Insbesondere der beim Bewerbungsgespräch anwesende Personalrat empfand es als ungeheuerlich, dass sich jemand von extern bewarb und eine Position besetzen wollte, deren Besetzung für seine Kollegen gesichert werden musste. Der Personalrat konnte seine Aufregung und Abneigung gegen die von der Behördenleitung vorgegebenen Ausrichtung im Gespräch nicht verbergen. Er rutschte während seiner Wortbeträge unruhig auf seinem Stuhl hin und her. Seine Formulierungen regten ihn selbst derart auf, dass es ihm den Atem nahm.
Es war für mich leider nicht die letzte Begegnung mit Personal- und Betriebsräten. In der Handwerkskammer ließ mich mein Chef