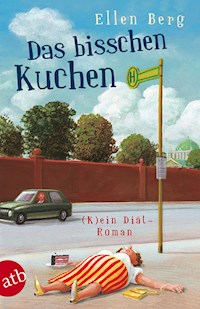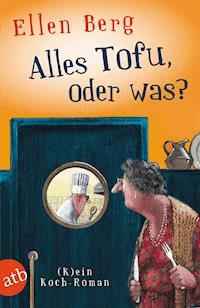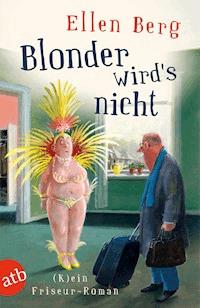10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Legal, illegal – total egal!
Elisabeth ist siebzig und eigentlich noch ganz fit. Doch das Leben scheint gelaufen, als ihre Töchter sie gegen ihren Willen in ein Altersheim stecken. Endstation? Aber doch nicht mit Elisabeth! Bald schon schmiedet sie Fluchtpläne, zusammen mit einigen skurrilen Mitbewohnern. Einer von ihnen ist ein rasend attraktiver älterer Herr, der ihr Herz im Sturm erobert. Die eigenwilligen Senioren träumen vom goldenen Herbst im sonnigen Süden. Fragt sich nur, wie sie an genügend Geld für ihre Flucht kommen. Wild entschlossen hecken sie einen kriminellen Plan aus ...
Mit Witz, Charme und einer ordentlichen Portion krimineller Energie beginnt der irre Trip in die Freiheit ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Ellen Berg
Zur Hölle mit Seniorentellern!
Roman
Leseprobe
1
Es gibt Tage, die sollte man am besten aus dem Kalender streichen und dann ganz, ganz schnell vergessen. Heute war so ein Tag. Seit langem hatte Elisabeth sich vor ihrem siebzigsten Geburtstag gefürchtet, aber was gerade passierte, übertraf ihre schlimmsten Alpträume. Nein, sie hatte ihren Geburtstag nicht feiern wollen. Und was machten ihre drei erwachsenen Töchter? Quälten sie mit einer „Überraschungsparty“. Nun saß sie in einem furchtbaren Lokal, eingeklemmt zwischen Gästen, die sie größtenteils gar nicht kannte, während die liebe Verwandtschaft abwechselnd Schneisen durchs Kuchenbüffet pflügte und sich in taktlosen Reden überbot.
Als ob es nicht schon reichte, siebzig zu werden. Siebzig! In ihrem Herzen war sie keinen Tag älter als siebzehn, jedenfalls fühlte es sich oft so an. Leider schien das außer ihr niemandem aufzufallen, wie den unvermeidlichen Reden zu entnehmen war.
„Alle wollen alt werden, aber keiner will alt sein“, tönte ihr Schwiegersohn Wolf-Dieter gerade. „Immerhin haben wir Respekt vor dem Alter – solange es sich um Rotwein und Antiquitäten handelt.“
Sehr witzig. Wolf-Dieter war Mitte vierzig, ein rotgesichtiger, korpulenter Mann, der ein ausgeprägtes Talent besaß, sich zur Wurst zu machen. Zur Feier des Tages trug er einen zu engen schwarzen Anzug und eine schwarze Krawatte. Er sah aus, als wäre er im Konfirmationsanzug zu einer Beerdigung angetreten.
Und war es das nicht auch, eine Beerdigung? Zumindest taten alle so, als ob Elisabeth Schliemann schon mit einem Bein im Grab stünde. Brüllten ihr ständig was ins Ohr, obwohl sie überhaupt nicht schwerhörig war. Erkundigten sich besorgt nach ihrem Gesundheitszustand, obwohl sie sich mopsfidel fühlte. Und dann diese Kindergartensprache, als sei das Hirn spätestens mit sechzig im Dämmermodus. Aber am schlimmsten war der Versuch, ihr Alter auf die lustige Tour zu kommentieren.
In Wolf-Dieters glasigen Augen sah man die Distanzlosigkeit eines Mannes, der zu viel Prosecco und zu wenig Grips im Kopf hatte. Offenbar war er fest entschlossen, die Rolle des Partykrachers zu spielen. „Kommt eine Frau zum Arzt: Herr Doktor, wie alt kann ich werden? Fragt der Arzt: Rauchen Sie? Nein, antwortet die Frau. Trinken Sie? Nein. Männergeschichten? Niemals! Sagt der Arzt: Wieso wollen Sie dann alt werden?“
Wieherndes Gelächter fegte über die Kaffeetafel. Die Gäste, neben ein paar Verwandten allesamt Freunde von Elisabeths Töchtern und Schwiegersöhnen, klopften sich auf die Schenkel. Schon klar, dachte Elisabeth. Für euch bin ich scheintot. Die überflüssige Alte mit dem Ticket für den Friedhof. Ihr Groll steigerte sich unaufhörlich. Warum war keiner auf die Idee gekommen, ihre alte Schulfreundin Heidemarie einzuladen? Oder wenigstens ein paar Bekannte aus ihrer Wandergruppe? Nie hatte sie sich so einsam gefühlt wie in dieser angeheiterten Gästeschar, die sie deutlich spüren ließ, dass sie zwar der Ehrengast war, aber schon lange nicht mehr richtig dazugehörte.
Seufzend betrachtete sie die silberne Siebzig, die direkt vor ihrer Nase in einem scheußlichen Strauß gelber Chrysanthemen steckte. Dann wanderte ihr Blick durch das Lokal. Es war im altdeutschen Landhausstil eingerichtet – olle Gobelinsessel, vergilbte Häkelgardinen, nachgemachte Petroleumlampen. Als ob dieses Museum des schlechten Geschmacks gerade richtig für eine Frau ihres Alters sei.
Wenigstens war Wolf-Dieter endlich mit seiner Rede fertig. Schwer atmend sank er auf den Stuhl gegenüber und sah Elisabeth erwartungsvoll an. Mit diesem fragenden Blick, den Männer nach dem Liebesakt aufsetzen: Na, wie war ich? Elisabeth schaute demonstrativ an ihm vorbei und fixierte die billige Pseudo-Petroleumlampe, die hinter seinem geröteten Gesicht baumelte. Aber so leicht ließ sich Wolf-Dieter nicht übergehen.
„Ein Knaller, meine Rede, was?“, grinste er breit. „Und das beste Geschenk kommt erst noch. Hat Suse es dir schon erzählt? Das mit dem Platz im Seniorenheim?“
Susanne, seine Frau und Elisabeths älteste Tochter, verpasste ihm einen unsanften Seitenhieb mit dem Ellenbogen. Um Gotteswillen, falscher Text!, signalisierte ihr entsetzter Gesichtsausdruck.
Von einem Moment auf den anderen begann Elisabeths Herz wild zu klopfen. Krampfhaft umklammerte sie ihre Handtasche, bemüht, sich ihre aufsteigende Panik nicht anmerken zu lassen. „Seniorenheim? Wovon redest du?“
Wolf-Dieter schüttelte verlegen den Kopf, Susanne schwieg peinlich berührt. Elisabeths Älteste war eine attraktive Frau Anfang vierzig mit nussbraunem Pagenschnitt und lebhaften blauen Augen. Es war Elisabeth immer ein Rätsel gewesen, was ihre Tochter ausgerechnet an diesem unerträglichen Wolf-Dieter fand. Jegliche Farbe war inzwischen aus Susannes Gesicht gewichen. Schuldbewusst kniff sie die Lippen zusammen.
„Suse?“ Elisabeths Stimme zitterte vor Erregung. „Kannst du mir bitte mal erklären, was hier los ist?“
Plötzlich war es totenstill an der Tafel. Alle Gäste verfolgten gespannt, was sich am Tischende abspielte, wo eine versteinerte Jubilarin sichtlich um Fassung rang.
Susanne räusperte sich. „Eigentlich wollten wir es dir erst morgen sagen. Naja, was soll’s, jetzt weißt du es ja sowieso schon. Wir finden, dass du allmählich zu alt wirst, um allein zu leben. Ich meine, seit Papa tot ist …“
„… geht es mir blendend“, vervollständigte Elisabeth den Satz.
Sie hatte ihren leicht tyrannischen Mann nie vermisst, seit der Himmel freundlicherweise beschlossen hatte, ihn eines Morgens nicht mehr erwachen zu lassen. Von da an war sie sogar richtiggehend aufgeblüht. Sie wanderte, tanzte, belegte Kurse in der Volkshochschule und gab einigen Nachbarskindern kostenlosen Nachhilfeunterricht. Über ihr Alter dachte sie selten nach. Warum auch? Sie fühlte sich großartig, ihr Verstand funktionierte einwandfrei. Es gab keinen Grund, sich Sorgen zu machen.
„Was heißt hier blendend?“, mischte sich Gabriele ein. Sie war hochblond, gertenschlank und ein Jahr jünger als Susanne, aber mindestens so patent und selbstbewusst wie ihre ältere Schwester. Nie um ein kesses Wort verlegen, riss sie die Diskussion an sich. „Stimmt, Mama, du bist noch ganz gut beieinander. Fragt sich nur, wie lange noch. Und dann? Wir haben alle unsere eigenen Familien. Wer soll für dich einkaufen, wenn du nicht mehr gehen kannst? Wer soll dir helfen, deine Wohnung in Ordnung zu halten? Und wenn du, äh, inkontinent wirst …“
„Schluss jetzt!“, schnitt Mara ihr das Wort ab. Elisabeths Nesthäkchen war die einzige in diesem Töchtertrio, die so etwas wie Taktgefühl besaß. Aufgebracht blies sie sich eine rötlichblonde Locke aus der Stirn. „Es ist Mamas Geburtstag, schon vergessen? Solche Dinge sollten wir nicht bei einer Feier besprechen.“
Ein unangenehmes Schweigen legte sich über den Tisch. Nur eine Wespe, die taumelnd von Teller zu Teller flog, summte munter vor sich hin. Elisabeth war am Boden zerstört. Es war ein Komplott, ein mieses, feiges Komplott! Hinter ihrem Rücken wollte man über ihre Zukunft entscheiden. Da hatte sie allerdings auch noch ein Wörtchen mitzureden.
„Danke, Mara“, sagte sie leise. „Aber du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass ich hier in aller Gemütsruhe Sahnetorten verdrücke, wenn ich weiß, dass ihr mich klammheimlich ins Altersheim verfrachten wollt.“
„Seniorenresidenz“, verbesserte Susanne ihre Mutter. „Wir hatten dich schon seit längerem auf die Warteliste gesetzt. Und da gestern ein Insasse gest… , nun ja, jedenfalls wird eine Wohnung frei. Du wirst es lieben. Das volle Programm: Seniorentanz, Seniorenlesekreis, Seniorenteller. Ein wahres Paradies für die ältere Generation.“
Jedes Wort traf Elisabeth wie ein Boxhieb ins Sonnengeflecht. „Ich will aber nicht in so ein Heim, wo alle nur auf den Tod warten“, protestierte sie. „Dafür fühle ich mich einfach noch zu jung.“
Genau das richtige Stichwort für den ewig witzelnden Wolf-Dieter. „Falsch.“, konterte er grinsend. „Auf die Resterampe kommt man schneller, als man denkt. Ein Mann ist so alt, wie er sich fühlt, eine Frau ist so alt, wie sie sich anfühlt!“
Keiner wagte, offen loszulachen, aber ein paar Gäste feixten verstohlen. Elisabeth reichte es. Diese Party war eine einzige Demütigung. Wütend sprang sie auf und marschierte schnurstracks zur Toilette, eisern bemüht, ihre Tränen zurückzuhalten. Glücklicherweise war der Vorraum mit den Waschbecken leer. Kraftlos stützte sie sich auf dem Rand eines Beckens auf und schaute in den Spiegel.
War sie wirklich fällig fürs Heim? Was sie sah, wirkte zwar nicht gerade taufrisch, aber alles andere als reif für die Resterampe. Frisch geföhntes graues Haar umrahmte ihr Gesicht mit den ausdrucksvollen blauen Augen. Auf ihrer bemerkenswert glatten Haut hatte der Geburtstagsprosecco einen rosigen Schimmer hinterlassen. Ihr leichtes Übergewicht kaschierte sie geschickt mit einem rot-weiß gepunkteten Wickelkleid. Alles in Ordnung soweit. Nur, dass die anderen offenbar nichts weiter in ihr sahen, als eine hilflose Greisin, die schnellstens entsorgt werden musste.
Traurig horchte sie auf das Gelächter aus dem Festsaal. Vermutlich schoss Wolf-Dieter gerade die nächste Pointe über alte Leute ab. Das war nicht ihre Party. Das war auch nicht ihre Welt. Und plötzlich wusste Elisabeth, was zu tun war.
*
Sie machte sich nicht mal die Mühe, nach ihrem Mantel zu suchen. So wie sie war, huschte Elisabeth nach draußen auf die Straße. Dort atmete sie erst einmal tief durch. Sollten die doch feiern, bis ihnen die Torte zu den Ohren wieder herauskam. Ohne mich, dachte sie grimmig und winkte ein Taxi heran, das gerade um die Ecke bog. Es hatte kaum angehalten, als Elisabeth auch schon den hinteren Wagenschlag aufriss, sich auf den Rücksitz fallen ließ und knallend die Tür hinter sich zu schlug.
„Was ist?“, rief sie dem Fahrer zu. „Worauf warten Sie? So fahren Sie schon los!“
Seelenruhig drehte sich der Taxifahrer zu ihr um. „Nun mal langsam, junge Frau, wohin soll’s denn gehen?“
Erst jetzt sah Elisabeth, dass es ein älterer Herr war, mit schlohweißem Haar und einem Gesicht, in das ein zweifellos wechselvolles Leben tiefe Falten gegraben hatte. Neugierig musterte er die aufgewühlte alte Dame, auf deren Wangen sich hektische rote Flecken abzeichneten.
„Einfach losfahren“, zischte Elisabeth. „Hauptsache weg von hier.“
„Haben Sie was angestellt?“, erkundigte sich der Fahrer belustigt. „Ladendiebstahl, Bankraub oder so was?“
Unruhig spähte Elisabeth zum Eingang des Lokals. Ob man ihr Verschwinden schon bemerkt hatte? Sie warf dem Mann einen drohenden Blick zu. „Wenn Sie jetzt nicht auf der Stelle losfahren, steige ich wieder aus.“
„Schon gut.“ Brummelnd legte er den Gang ein. „Also Richtung Hauptsache-weg-von-hier. Wird sofort erledigt.“
Ohne weitere Vorwarnung schoss er mit einem Kavalierstart los und steuerte so rasant die nächste Kurve an, dass Elisabeth sich am Vordersitz festhalten musste, um nicht der Länge nach zur Seite geworfen zu werden. Wer auch immer dieser Mann war, er musste früher Rennfahrer gewesen sein. Hupend und blinkend raste er durch den dichten Verkehr, vollführte halsbrecherische Überholmanöver und rammte fast einen Bus, bevor er schließlich mit einer Vollbremsung zum Stehen kam.
„Und jetzt?“, fragte er, während er seinen Rückspiegel so einstellte, dass er Elisabeth beobachten konnte.
Gute Frage. Leider hatte sie keinen blassen Schimmer, was sie antworten sollte. Zurück in ihre Wohnung wollte sie nicht. Die Aussicht, den Rest des Tages allein auf der Couch zu verbringen, war wenig verlockend. Was dann?
Ratlos zuckte sie mit den Schultern. „Irgendwohin. Haben Sie einen Vorschlag?“
Ein feines Lächeln glitt über das Gesicht des Fahrers. „Mit Verlaub, Sie sehen so aus, als ob Sie einen Schnaps gebrauchen könnten.“
Einen Schnaps? Elisabeth trank fast nie Alkohol. Der Prosecco, mit dem man auf ihren Geburtstag angestoßen hatte, war im Grunde schon zu viel des Guten gewesen. Ihr Kopf saß ziemlich wackelig auf den Schultern, ihre Knie fühlten sich an wie Zuckerwatte.
Wieder musste Elisabeth an die Feier denken. Bestimmt suchte man schon nach ihr. Eine Sekunde lang überlegte sie, ihr neues Handy aus der Tasche zu holen, um ihre Töchter anzurufen. Das Handy war ein Geburtstagsgeschenk von Susanne. Ein „Seniorenhandy“ mit großen bunten Tasten. Es sah aus wie ein Spielzeug für Zweijährige. Bei der grünen Taste hatte Susanne ihre eigene Nummer eingespeichert, alles sollte angeblich kinderleicht sein. Schon deshalb hatte Elisabeth überhaupt keine Lust, es zu benutzen.
Sie schluckte. „Hm, ich weiß nicht …“
„Verstehe.“ Wieder lächelte der Fahrer. „Sie wissen nicht wohin, und Sie wissen nicht, was Sie wollen. Ist doch schon mal ein Anfang. Ich möchte ja nicht aufdringlich sein, aber ich könnte Sie in eine nette kleine Kneipe kutschieren, wir kippen einen zusammen, und dann bringe ich Sie nach Hause.“
Hui, der ging aber ran. Was sollte man davon halten? Misstrauisch beäugte Elisabeth das Gesicht des Mannes im Rückspiegel. Er wirkte völlig harmlos. Fast sogar sympathisch. Was hatte sie schon zu verlieren? Egal, wie jung sie sich fühlte – sie war definitiv nicht mehr in dem Alter, in dem sie unsittliche Übergriffe fürchten musste.
„Also gut“, lenkte sie ein. „Aber nur einen einzigen Schnaps. Und könnten Sie bitte etwas langsamer fahren? Mir ist jetzt schon ganz schlecht.“
„Zu Befehl, Lady.“ Er salutierte scherzhaft. „Falls irgendwer hinter ihnen her war, haben wir ihn eh längst abgehängt.“
„Waren Sie mal Rennfahrer?“, platzte es aus ihr heraus.
„Nee, bei den Johannitern, Rettungswagen. Da lernt man so einiges. Erste Hilfe zum Beispiel.“
„Aha.“ Nun musste auch Elisabeth lächeln. „Ihre Erfahrungen mit Erster Hilfe scheinen sich vor allem auf hochprozentige Getränke zu beziehen.“
„Ist nicht die schlechteste Rettungsmaßnahme“, erwiderte der Taxifahrer lässig, während er den Wagen wieder in Bewegung setzte. „Man kann Sorgen zwar nicht in Alkohol ertränken, aber man kann sie wenigstens drin schwimmen lassen.“
Was Schnäpse betraf, hatte Elisabeth nicht mal das Seepferdchen. Dafür aber mehr Sorgen, als irgendwer gebrauchen konnte. Altersheim, hämmerte es in ihrem Kopf. Meine eigenen Kinder wollen mich loswerden. Sie unterdrückte ein Schluchzen. Was sollte sie bloß tun? Auf keinen Fall würde sie in so eine dämliche Seniorenresidenz ziehen, nur weil gerade irgendwer gestorben war.
Zehn Minuten später hielt das Taxi vor einer Kneipe, über der ein grell blinkendes Neonschild verkündete, man kehre hier „Bei Inge“ ein. Das Haus sah heruntergekommen aus, von der Kneipentür blätterte die Farbe ab. Noch vor einer Stunde hätte Elisabeth geschworen, dass sie niemals solch einen billigen Schuppen betreten würde.
Der Fahrer stieg aus, umrundete den Wagen und hielt Elisabeth ritterlich die Tür auf.
„Benno“, sagte er knapp und streckte ihr die Hand hin. „Kannst ruhig Du zu mir sagen. Und mit wem habe ich das Vergnügen?“
Noch vor einer Stunde hätte Elisabeth auch geschworen, niemals einen Wildfremden zu duzen.
„Lissy“, antwortete sie. „Danke, Benno. Du bist ein echter Gentleman. Das Vergnügen ist ganz meinerseits.“
„Also gut, Lissy, dann mal rein in die gute Stube.“
Die Kneipe erwies sich als düstere, aber irgendwie gemütliche Angelegenheit. An den dunkel getäfelten Wänden hingen alte Blechschilder, ein paar blank geschrubbte Holztische drängten sich in dem winzigen Schankraum. Dominiert wurde das Ganze von einem Tresen, hinter dem eine mittelalte, rothaarige Frau residierte. Sie war in schwarzes Leder gekleidet.
„Hi Benno“, begrüßte sie Elisabeths Begleiter. „Haste etwa heute ne Eroberung dabei?“
„Das ist Lissy, und wir brauchen einen Schnaps“, erwiderte er, ohne mit der Wimper zu zucken. „Am besten einen Klaren.“
Sie setzten sich an einen der Tische. Mittlerweile war Elisabeth nicht mehr so sicher, ob dieser kleine Ausflug eine gute Idee gewesen war. Was tat sie eigentlich hier? Hatte sie komplett den Verstand verloren? Am besten, sie machte sich aus dem Staub, bevor es peinlich wurde.
Aber schon kam Inge hinter dem Tresen hervor, mit wiegenden Hüften und einem Tablett, auf dem zwei beängstigend große Gläser mit einer durchsichtigen Flüssigkeit standen. Die hautenge Ledermontur betonte die üppigen Kurven der Wirtin, auf ihrem Dekolleté baumelte ein blutroter Herzanhänger.
„Wohl bekomm’s“, sagte sie und stellte die Gläser auf den Tisch. Aufmunternd lächelte sie Elisabeth zu, wobei sie einen silbernen Eckzahn entblößte.
„Ex“, befahl Benno. „Sonst kriegt man das Zeug nicht runter.“ Er hob sein Glas und prostete Elisabeth zu. „Auf dich!“
Sie verzog den Mund. „Hm, ich glaube …“
„Nich lang schnacken, Kopf in’n Nacken!“ Benno setzte das Glas an und trank es in einem Zug aus. „Jetzt bist du dran.“
„Also schön. Aber beschwer dich bitte nicht, wenn du mich liegend nachhause transportieren musst. Ich vertrage nämlich nichts.“
Todesmutig stürzte Elisabeth das Getränk herunter. Es brannte fürchterlich in ihrer Kehle, verätzte ihre Magenwände und trieb ihr heiße Tränen in die Augen. Hustend stellte sie das Glas auf den Tisch zurück. Dabei bemerkte sie, dass sie mittlerweile ernsthafte Probleme mit der Feinmotorik hatte. Nicht gut. Gar nicht gut. Zeit, zu gehen!
Sie kramte ihr Portemonnaie heraus. „Ich bezahle, keine Widerrede. Heute ist nämlich mein Geburtstag.“
„Ach, nee.“ Benno kniff die Augen zusammen. „Dann alles Gute zum Vierzigsten.“
Das war natürlich ein völlig übertriebenes Kompliment. Bei jedem anderen hätte Elisabeth die Nase gerümpft über so viel Schmierlappigkeit. Aber Benno konnte man es einfach nicht übelnehmen.
„Sehr nett, vielen Dank. Schade nur, dass meine Töchter so tun, als wäre ich mindestens hundert. Für die bin ich ein Gruftie.“
Benno schien keine Mühe zu haben, eins und eins zusammenzuzählen. „Dann bist du also vor deinen Töchtern geflohen?“
Verblüfft über so viel Geistesgegenwart, starrte Elisabeth ihn an. „Stimmt genau.“
„Aber das ist doch noch nicht alles, oder?“, fragte Benno.
Jetzt brach es aus Elisabeth heraus wie Lava aus einem Vulkan. Alles erzählte sie, von der lieblosen Feier bis zu Wolf-Dieters geschmacklosen Sprüchen. Von ihrer Enttäuschung, ihrem Zorn, von dem hinterhältigen Seniorenheimplan. Zwei Schnäpse und eine halbe Stunde später ging es ihr wesentlich besser. Benno hatte aufmerksam zugehört, sie nicht ein einziges Mal unterbrochen. Es tat gut, jemandem sein Herz auszuschütten. Dummerweise hatte sich Elisabeth währenddessen dermaßen zugeschüttet, dass sich alles um sie drehte.
„Ich glaubich mussma los“, presste sie mit dem letzten Rest Contenance hervor. Sie drehte sich zum Tresen um, wo Inge mit stoischer Ruhe Biergläser polierte. „Die Rechnnnung, bidde!“
„Geht aufs Haus, Geburtstagskind“, widersprach die Wirtin. „Kannst jederzeit wiederkommen und dich revanchieren.“
Dieser Satz war das Letzte, woran sich Elisabeth erinnerte, als sie Minuten, vielleicht auch Stunden später von einem messerscharfen Schmerz geweckt wurde. Und von etwas, das wie „Schnell, einen Krankenwagen“ klang.
„Binnich krank“, murmelte sie matt.
Unter größter Anstrengung öffnete sie die Lider und blinzelte in grelles Licht. Eigentümlich verdreht lag sie im Hausflur, direkt vor ihrer Wohnungstür. Ihre Hüfte schmerzte so stark, dass ihr gleich wieder schwarz vor Augen wurde. Als sie das nächste Mal erwachte, beugte sich ein Sanitäter in einer feuerroten Jacke über sie.
„Oberschenkelhalsbruch, schätze ich“, sagte er dumpf.
Neben ihm kniete Frau Wollersheim, Elisabeths Nachbarin, im rosa Frotteebademantel und mit schreckgeweiteten Augen. „Frau Schliemann! Hören Sie mich?“
„Binnich schwerhöhrich“, murmelte Elisabeth mit schwerer Zunge. „Wieso’n denkn alle …“
„Hat ganz schön geladen, die Dame“, grinste der Sanitäter.
„Oh Gott, was ist denn nur passiert?“ Frau Wollersheim war außer sich. „Frau Schliemann, haben Sie die Nummer von Ihrer Tochter Susanne dabei?“
Fahrig wühlte Elisabeth in ihrer Handtasche, angelte das Seniorenhandy heraus und drückte auf den grünen Knopf. „Suuuse? Jaaa-ch binnns. Hicks. Nu regdich malbiddenich auf. Die brinnng mich jetzt ins, hicks, Dings, na, Krannngenhaus.“
Eine wütende Welle aus Fragen und Vorwürfen quoll aus dem Handy. Elisabeth reichte es dem Sanitäter. „Sagense netterweise, wohinnse mich fahrn?“
Es war vernünftig, was sie tat. In Anbetracht ihres Zustandes war es sogar überraschend vernünftig. Und der schrecklichste Fehler ihres Lebens. Das dämmerte ihr allerdings erst, als sie am nächsten Morgen erwachte, in einem Krankenhausbett, umringt von ihren drei Töchtern.
„Was hast du dir bloß dabei gedacht?“, fauchte Susanne, kaum dass Elisabeth zu sich gekommen war.
Gabriele stemmte die Hände in die Hüften. „Und wie du riechst, ekelhaft, wie eine ganze Kneipe!“
Nur Mara fragte mitfühlend, wie es ihr gehe. Elisabeth hatte darauf keine Antwort. Sie war völlig benommen von dem Medikamentencocktail, der durch eine Kanüle in ihren Arm floss. Vor ihren Augen verschwammen die Gesichter der drei Frauen zu einem bunten Aquarell.
„Fassen wir mal zusammen“, hörte sie wie aus weiter Ferne Susannes resolute Stimme. „Erst verlässt sie heimlich ihre eigene Geburtstagsparty, dann betrinkt sie sich, und nun hat sie auch noch einen Oberschenkelhalsbruch. Mama ist orientierungslos, nicht mehr zurechnungsfähig und wird nach menschlichem Ermessen für immer gehbehindert sein. Ich weiß nicht, was ihr denkt, aber meiner Meinung nach sollte sie vom Krankenhaus direkt ins Seniorenheim ziehen.“
„Nein, nein, nein“, rief Elisabeth verzweifelt. „Es war alles ganz anders. Ich will in meiner Wohnung bleiben, hört ihr?“
Niemand antwortete. Alles, was sie wahrnahm, war konspiratives Gemurmel, das wie eine Gewitterwolke über ihr schwebte.
Es gibt eben Tage, die man aus dem Kalender streichen sollte. Doch der siebzigste Geburtstag ließ sich weder löschen, noch würde ihn Elisabeth jemals vergessen. Denn es war der Tag, an dem ein missgünstiges Schicksal und drei wild entschlossene Töchter ihr die Freiheit raubten.
2
Das Leben war wunderbar, wenn man fliegen konnte. Elisabeth schwebte mit der Anmut einer Schwalbe über die besonnte Küste. Das Meer glitzerte, ein Blütenhauch streifte sie, und sie ging etwas tiefer, um auf einem Oleanderbusch zu verweilen. Im Handumdrehen wechselte sie die Gestalt, setzte einen Sonnenhut aus gelbem Stroh auf und schlenderte über die Strandpromenade, vorbei an Eisverkäufern und spielenden Kindern. Sie war erfüllt von der Leichtigkeit des Seins, von einer unbändigen Lebenslust. Am liebsten hätte sie getanzt.
Warum eigentlich nicht? Ein Orchester stimmte schon seine Instrumente, ein überwältigend gutaussehender Kavalier in einem hellen Sommeranzug verbeugte sich vor ihr, umfasste zart ihre Taille, und sie tanzten mit bloßen Füßen im Sand. Er roch gut, dieser Herr. Elisabeth schmiegte sich in seine Arme, fasziniert von dem kleinen Menjoubärtchen auf seiner Oberlippe. Cha-Cha-Cha! Seine locker gebundene, rotweiß gepunktete Fliege tanzte im Rhythmus der unwiderstehlichen Musik, machte sich selbstständig und flatterte davon, bevor …
„Hallo, aufwachen.“
Eine weibliche Stimme. Sie kam aus einer anderen Welt. Langsam, ganz langsam kehrte Elisabeth in die Realität zurück. Ihr Körper fühlte sich bleischwer an, vor ihren Augen tanzten zuckende Sterne. Was auch immer die Ärzte ihr hier verabreichten, die Medikamente versetzten sie in einen Drogenrausch, der sich gewaschen hatte. Oder war das etwa schon das Ende des berühmten Tunnels gewesen, den Sterbende beschreiben, nachdem man sie ins Leben zurückgeholt hat? Ein paradiesisches Jenseits, hell und heiter, mit Blumen und Musik?
„Wer stört meine Totenruhe?“, murmelte sie.
„Ich bin’s, Schwester Klara. Übrigens, Frau Schliemann, Sie sind nicht tot.“
„Dann wecken Sie mich erst wieder auf, wenn ich’s bin.“ Elisabeth wollte weiterschlafen, weiterträumen, von Sonne, von südlichen Stränden und einem unwiderstehlichen Kavalier.
„Nee, nee, Frau Schliemann, Zeit für die Untersuchung.“
Diesmal war es eine männliche Stimme. Widerstrebend schlug Elisabeth die Augen auf. Neben Schwester Klara stand Dr. Weber, ein junger, tief gebräunter Arzt, der ungeduldig auf seine Armbanduhr schaute. Seit der Operation untersuchte er sie täglich. Seiner Miene nach zu urteilen, war er allerdings nicht gerade begeistert von Elisabeths Genesungsfortschritten. Sie zog die Bettdecke ein Stück zur Seite. Der Mediziner streifte sich Latexhandschuhe über, tastete konzentriert ihre rechte Hüfte ab, dann richtete er sich auf.
„Sie werden einen Rollstuhl brauchen, Ihre Töchter haben sich schon darum gekümmert.“
„Einen Rollstuhl.“ Elisabeths Stimme wurde brüchig. „Aber – aber Sie haben doch gesagt, dass ich bald wieder gehen kann.“
„Hat leider nicht geklappt“, sagte der Arzt, während er die Latexhandschuhe auszog und auf den Nachtschrank warf. „Tja, aus einem ramponierten Oldtimer kann selbst ich keinen Porsche zaubern.“
„Ist das etwa Ihre Art, mich aufzuheitern?“
Dr. Weber verschränkte die Arme vor seinem blütenweißen Arztkittel und setzte ein verschmitztes Grinsen auf. „Alte Leute sind wie alte Autos – etwas undicht, geben komische Geräusche von sich und sind nun mal nicht die schnellsten.“
Er war der einzige im Zimmer, der herzhaft über diese Bemerkung lachte. Wieder sah er auf seine Armbanduhr, einen chromblinkenden Chronometer, der sicher ein Vermögen gekostet hatte. „Ich habe in den vergangenen drei Wochen getan, was möglich war. Länger können wir Sie nicht hierbehalten. Bis elf Uhr muss das Zimmer geräumt sein.“
Jetzt war Elisabeth hellwach. „Das heißt, ich bin – entlassen?“
Der Arzt nickte, mit diesem unverbindlichen Wird-schon-wieder-Blick. „Alles Gute. Probieren Sie’s mit ein bisschen Gymnastik. Könnte helfen.“ Und schon war er verschwunden.
So ein gefühlloser Kerl. Elisabeth hätte ihm gern eine Standpauke gehalten, über den hippokratischen Eid und ein paar andere Dinge, die der Arztberuf ihrer Ansicht nach mit sich brachte. Eine Portion Menschlichkeit zum Beispiel. Aber Dr. Weber gehörte offenbar zu der Sorte Medizinern, die sich mit den gebrochenen Knochen anderer Leute nur beschäftigten, um das Ferienhaus im Süden zu finanzieren. Jedenfalls hatte er bei seinen Visiten mehr Worte über seine dämliche Datscha auf Ibiza verloren als über Elisabeths Oberschenkelhals. Nun warf er sie auch noch im hohen Bogen raus.
„Und für den habe ich mir heute die Beine rasiert“, grollte Schwester Klara. „Gefühllos, aalglatt, ein echter Flegelfall. Wo andere ein Herz haben, hat der eine Tiefkühltruhe.“ Ihr pausbäckiges Gesicht nahm einen kummervollen Ausdruck an. „Schade, dass Sie uns verlassen, Frau Schliemann. Aber Sie freuen sich bestimmt, dass Sie wieder nach Hause dürfen, oder?“
„Sicher, ich freue mich“, antwortete Elisabeth leise.
Dabei hatte sie Angst, richtig Angst, zum ersten Mal in ihrem Leben. Solange sie im Krankenhaus war, musste sie sich keine Gedanken über die Zukunft machen. Heute war die Schonfrist jäh beendet. Und nun?
Sie fühlte sich wie aus dem Nest geschubst. Fröstelnd sah sie sich in dem weißgetünchten Einzelzimmer um. Drei Wochen hatte sie hier zugebracht. Drei lange Wochen, in denen immer mal wieder Besuch hereingeschneit war: ihre Töchter, ihre Enkelkinder, sogar zwei, drei Bekannte aus der Wandergruppe. Alle hatten ihr versichert, sie sehe prächtig aus. Alle hatten Blumen mitgebracht, der Tisch am Fenster bog sich unter Sträußen, die in Plastikvasen steckten. Und alle hatten die Patientin im Unklaren darüber gelassen, wie es weitergehen würde.
Mehrfach hatte Elisabeth ihre Töchter beschworen, sie unter keinen Umständen in das Seniorenheim zu verfrachten. Die Reaktion war immer die gleiche gewesen: unbestimmtes Lächeln, vage Ausflüchte, beruhigendes Schultertätscheln.
Das Frühstück, das Schwester Klara wenig später brachte, kam Elisabeth vor wie eine Henkersmahlzeit. Der Appetit war ihr gehörig vergangen. Sie nahm nur einen Schluck von dem dünnen, lauwarmen Pfefferminztee. Beklommen sah sie der Schwester zu, die damit begonnen hatte, das Nachtschränkchen auszuräumen. Klara war ein Engel in hellblau, immer freundlich, immer geduldig, mit einem eigenwilligen Humor. Manchmal hatten sie zusammen gekichert wie Teenager. Dann hatte Elisabeth fast vergessen, in welch misslicher Lage sie sich befand.
„Sie werden mir fehlen, Schwester Klara“, sagte sie, während sie den schwenkbaren Tisch mit dem Frühstückstablett von sich schob. „Ehrlich.“
Die Krankenschwester angelte sich einen Becher Joghurt vom Tablett. „Och, ich war doch nur Ihr Pausenclown. Sie haben Ihre Familie, und bestimmt auch ganz viele Freunde.“ Sie riss den Deckel auf und leckte ihn ab, bevor sie den Joghurt genussvoll auslöffelte.
„Das Problem in meinem Alter ist, dass einem die Freunde wegsterben“, seufzte Elisabeth. „Und wenn sie noch leben, erkennen sie einen nicht wieder.“
„Na, immerhin haben Sie drei Töchter.“
„Die haben ihr eigenes Leben, Mann, Kind, Beruf. Susanne arbeitet bei einem Steuerberater, Gabriele ist Maklerin, Mara ist der kreative Kopf einer Werbeagentur. Außerdem wissen sie alles besser und würden mich am liebsten ins Altersheim abschieben. Ohne mich. Ich werde es allein hinkriegen.“
„Ganz bestimmt.“ Schwester Klara holte einen kleinen Zettel aus ihrem Kittel, kritzelte etwas darauf und reichte ihn Elisabeth. „Das ist meine Telefonnummer, falls Sie Hilfe brauchen. Einkaufen, duschen oder sowas. Ich verdiene mir ein bisschen nebenher damit.“
„Danke, Sie sind ein Schatz.“ Elisabeth faltete den Zettel zusammen und ließ ihn in ihre Handtasche auf dem Nachttisch fallen. „Könnten Sie mir bitte beim Anziehen helfen? Im Schrank müssten meine Sachen sein.“
Schwester Klara ging zum Wandschrank und holte das rotweiß gepunktete Kleid heraus. Bewundernd hielt sie es hoch. „Alter Falter! Ich finde es super, dass Sie sich noch so modisch anziehen.“
„Nun ja, ich hab’s nicht so mit Stützstrumpf-Beige“, erwiderte Elisabeth mit einem gewissen Stolz.
In der Tat sah es in ihrem Kleiderschrank zuhause ausgesprochen farbenfroh aus. Sie hatte nie verstanden, warum sich Menschen ab sechzig in sandfarbenen Freizeitjacken und Popelinemänteln unsichtbar machten. Beim Anblick des Kleides wurde ihr jedoch heiß und kalt. Unversehens war alles wieder da. Die unterirdische Geburtstagsfeier. Ihre Flucht. Ihr feuchtfröhlicher Ausflug mit – wie hieß er noch? Bernd? Bodo? Sie kam einfach nicht auf den Namen. Mit diesem Abend hatte jedenfalls alles angefangen. Was hatte sie sich da bloß eingebrockt?
Halte durch, sprach sie sich Mut zu. Du schaffst das schon. Komm erst mal auf die Beine. Fragte sich nur, wie. Allein das Anziehen war eine Tortur, obwohl Schwester Klara ihr geschickt half. Von gehen, laufen oder gar tanzen konnte überhaupt nicht die Rede sein. Sie hatte einen schlecht verheilten Oberschenkelhalsbruch und nach drei Wochen Bettruhe den Muskeltonus verkochter Spaghetti. Fit war was anderes.
Plötzlich ging alles ganz schnell. Susanne erschien, einen Rollstuhl vor sich herschiebend. In Windeseile packte sie Elisabeths Sachen zusammen und hievte ihre Mutter mit Hilfe von Schwester Klara in den Rollstuhl. Währenddessen plauderte Susanne unablässig über das Wetter, über die Grippeepidemie im Büro und über die Schicksalsfrage, ob man möglicherweise den einen oder anderen Blumenstrauß mitnehmen sollte.
„Du hast es also gewusst“, unterbrach Elisabeth den Redefluss. „Dass ich heute entlassen werde. Und mir kein Sterbenswörtchen gesagt?“
„Es kam – unverhofft.“
Eine glatte Lüge, das wussten sie beide.
„Suse“, Elisabeth klammerte sich so fest an die Griffe des Rollstuhls, dass ihre Knöchel weiß hervortraten. „Wohin bringst du mich?“
Ihre Tochter zwinkerte nervös. Sie trug einen gut geschnittenen grauen Hosenanzug, ihr rötlicher Pagenkopf war perfekt frisiert. Nur ihr Lächeln wirkte irgendwie schief.
„Du wirst es lieben, versprochen. Dort wird man sich bestens um dich kümmern.“
„Dort …?“ Fragend hob Elisabeth die Augenbrauen.
„Schwester Klara, würden Sie uns bitte alleinlassen?“, bat Susanne.
Die Krankenschwester nickte. Auf ihren Zügen malte sich pures Mitleid ab: „Alles Gute, Frau Schliemann.“
„Nehmen Sie bitte einen Blumenstrauß mit, den größten“, sagte Elisabeth. „Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll.“
Schwester Klara schüttelte traurig den Kopf. „Nein, nein, die Blumen sind doch für Sie. Alles Gute nochmal. Passen Sie auf sich auf. Sie sind mir wirklich ans Herz gewachsen, wissen Sie …“
Unschlüssig blieb sie stehen, so, als wollte sie noch etwas sagen. Aber nach einem kurzen Blickwechsel mit Susanne drückte sie Elisabeth nur die Hand und lief hinaus. Sobald sich die Tür hinter ihr geschlossen hatte, kühlte die Stimmung merklich ab.
„Eine allzu redselige Person“, befand Susanne.„Für wen hält die sich? Aber du hättest sie wohl am liebsten adoptiert, was?“
„Suse, sieh mich bitte an. Du bringst mich doch nach Hause, oder?“
„Wozu? Die Seniorenresidenz ist erstklassig“, sprudelte Susanne los. „Wir haben deinen Krempel ausgemistet, den Umzug organisiert, alles eingeräumt, die Gardinen aufgehängt, ein orthopädisches Bett besorgt, ehrlich, das war eine Riesenarbeit, du solltest uns dankbar sein.“
Die Worte prasselten auf Elisabeth ein wie ein Eiswürfelschauer. „Nein“, protestierte sie. „Ich will in meine Wohnung!“
„Da sind Gabriele, Mara und ich ganz anderer Auffassung“, erwiderte Susanne resolut. „Mama, sieh den Tatsachen ins Auge. Es ist das Beste so.“
„Für mich oder für euch?“, fragte Elisabeth scharf.
Susanne holte tief Luft. Zwischen ihren akkurat gezupften Augenbrauen erschien eine Zornesfalte. „Wie hat sich Madame das denn vorgestellt? Im vierten Stock ohne Fahrstuhl? In einer Wohnung, die so vollgestopft ist, dass man sich kaum darin bewegen kann, geschweige denn mit einem Rollstuhl?“
„Was heißt überhaupt ausgemistet?“, rief Elisabeth. „Ihr habt doch wohl nichts weggeworfen, oder?“
In diesem Moment steckte Gabriele den Kopf zur Tür herein, in Jeans und roter Lederjacke. „Beeilt euch mal ein bisschen. Ich habe ein behindertengerechtes Taxi bestellt, es wartet schon unten.“
Hinter ihr erschien Mara. „Draußen ist es kalt, man muss ihr eine Decke überlegen.“
„Sie braucht keine Decke, ich habe ihr einen Mantel mitgebracht“, widersprach Gabriele.
„Und was ist mit Schuhen? Sie hat ja nur Puschen an“, warf Susanne ein.
„Halt, stopp!“ Mit all ihrer Willenskraft stemmte sich Elisabeth halb im Rollstuhl hoch. „Will vielleicht mal jemand hören, was ich möchte?“
Die drei verstummten überrascht.
„Ihr bringt mich sofort in meine Wohnung“, sagte Elisabeth mit tonloser Stimme. „Und dann holt ihr die Möbel zurück und den übrigen ‚Krempel‘, wie ihr meine Sachen netterweise nennt. Aber dalli, wenn ich bitten darf.“
Susanne sah Gabriele an, Gabriele warf Mara einen unsicheren Blick zu, und Mara betrachtete eingehend die Spitzen ihrer Schlangenlederpumps, die sie zu einem eleganten schokoladenbraunen Kostüm trug.
„Also gut, ich sag’s ihr.“ Susanne straffte ihre Schultern. „Deine Wohnung ist schon neu vermietet, Mama. Der Bruder von Frau Wollersheim ist eingezogen. Ein echter Glücksfall. Normalerweise ist es nämlich gar nicht so einfach, auf die Schnelle einen Nachmieter zu finden.“
Elisabeth war wie vor den Kopf geschlagen. Meine Wohnung, dachte sie, während sich ihre Augen mit Tränen füllten, meine schöne Wohnung!
„Das werde ich euch nie verzeihen“, flüsterte sie. „Mein eigen Fleisch und Blut hintergeht mich. Und schickt mich ins Heim.“
Mara ging in die Hocke, beruhigend streichelte sie die Hände ihrer Mutter. „Schau es dir doch erstmal an. Ich finde es ganz, ganz toll. Wirklich.“
„So toll, dass du selbst einziehen würdest?“, fragte Elisabeth bitter. Sie wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel.
„Mutter, es ist ein Traum“, schwärmte Gabriele. „Denk doch mal: Seniorenlesekreis, Seniorentanz, da bleibt kein Wunsch offen.“
„Wie soll ich denn bitteschön tanzen in meinem Zustand?“, stieß Elisabeth hervor.
„Abmarsch“, befahl Susanne. „Diese Diskussion führt zu nichts.“
Und los ging’s über die endlosen Krankenhausflure, in denen es nach Bohnerwachs, Desinfektionsmitteln und Verzweiflung roch.
*
Die Seniorenresidenz Bellevue übertraf Elisabeths schlimmste Befürchtungen. Von außen hatte das mehrstöckige Gebäude gar nicht so übel ausgesehen mit seiner weiß gestrichenen Fassade und den Balkonen, über denen rotweiß gestreifte Sonnenmarkisen hingen. Doch sobald sie das Heim betreten hatten, fühlte sich Elisabeth wie im Wartezimmer von Doktor Tod. Überall in der zugigen, unpersönlichen Eingangshalle lungerten uralte Leute herum. Manche starrten apathisch vor sich hin, andere führten Selbstgespräche, ein paar begafften stumpf die Neuankömmlinge. Es war einfach trostlos. Und wie es roch! Dagegen waren die Krankenhausflure eine Parfümerie gewesen. Elisabeth witterte eine unheilvolle Mischung aus Hoffnungslosigkeit und Langeweile. Über weitere Aromen wollte sie lieber gar nicht erst nachdenken.
„Hey, super, da wären wir!“, sagte Susanne viel zu begeistert, um glaubwürdig zu sein. „Ich habe Bescheid gesagt, man erwartet uns schon.“
Gabriele und Mara schwiegen.
Elisabeth stand unter Schock. Sie war ja selbst nicht mehr die Jüngste, hatte es jedoch immer vermieden, sich mit dem Thema Alter zu beschäftigen. Auch an den üblichen Seniorenbespaßungen hatte sie nie teilgenommen. Keine Kaffeefahrten. Keine bunten Nachmittage, bei denen man gutgläubigen Rentnern überteuerte Rheumadecken andrehte. Elisabeth hatte ein aktives, selbstbestimmtes Leben geführt. Jetzt war sie in einem deprimierenden Greisenreservat gelandet. Sie konnte kaum atmen, so schwer wurde es ihr ums Herz.
Eine ziemlich korpulente Dame in den Fünfzigern segelte auf sie zu. „Sie müssen Frau Schliemann sein. Ihre Töchter haben mir schon so viel von Ihnen erzählt! Ich bin Annette Fröhlich, die Direktorin. Herzlich willkommen.“
Frau Fröhlich trug ihr dunkelblondes Haar raspelkurz, ihr linkes Ohrläppchen zierte ein Ohrring aus bunten Plastikperlen. In der knallgelben Grobstrickjacke und ihrem blaurosa geblümten Jeansrock wirkte sie eher wie eine Kindergärtnerin. Mit ausladenden Gesten zeigte sie auf den Eingangsbereich. „Und? Wie gefällt es Ihnen bei uns?“
Elisabeth betrachtete die abwaschbaren, türkisfarbenen Plastiksessel, den Empfangstresen, auf dem eine verstaubte Topfpflanze vor sich hinkümmerte und die klinisch weißen Raufaserwände, an denen scheußliche abstrakte Drucke hingen.
Sie seufzte. „Ich habe Tankstellen gesehen, die stilvoller eingerichtet waren.“
„Mama!“ Susanne knetete verlegen ihre Hände. „Nichts für ungut, Frau Fröhlich, meine Mutter muss die neue Situation erstmal verarbeiten.“
„Ja, ja, das wird schon“, bekräftigte die Direktorin, völlig unbeeindruckt von Elisabeths katastrophaler Laune. „Ihr Appartement liegt im fünften Stock, nach Süden, Frau Schliemann. Jetzt beginnen die sonnigen Zeiten! Sie werden sich hier sehr wohl fühlen!“
Ein alter, kahlköpfiger Herr in einer grauen Strickweste schlurfte vorbei. Er streifte den Rollstuhl mit einem feindseligen Blick durch seine Hornbrille. „Schon wieder ein Rolli“, schimpfte er. „Dauernd fahren die einem in die Hacken. Könnten Sie vielleicht mal für die gehobene Klientel sorgen, die der Prospekt des Hauses versprochen hat, Frau Direktorin?“
„Einen wunderschönen guten Tag, Herr Martenstein“, rief die Heimleiterin übertrieben laut. Dann senkte sie die Stimme. „Ein netter Mann. Sie werden sich bestimmt anfreunden. Er war früher Studienrat, am Gymnasium. Überhaupt haben wir hier ein sehr gehobenes Publikum.“
In diesem Moment ertönte in einer Ecke des Empfangsbereichs erregtes Geschrei. Drei ältere Damen zankten sich, dass es nur so schepperte. Eine grell geschminkte Greisin in einem nachtschwarzen seidenen Morgenmantel löste sich aus der Gruppe und stolzierte laut fluchend in Richtung Empfangstresen. Als sie Elisabeth entdeckte, blieb sie stehen.
„Glückwunsch“, sagte sie spitz. „Sie haben die Eintrittskarte für ein unwürdiges Schauspiel gelöst.“ Schrill auflachend raffte sie ihren Morgenrock zusammen und stürmte hinaus.
Elisabeth schüttelte den Kopf. „Wo soll das enden, wenn es schon so anfängt?“
„Fräulein Fouquet war früher Opernsängerin“, erklärte die Direktorin. „Sie liebt das Drama. Kein Grund zur Beunruhigung.“
„Nur, dass wir uns richtig verstehen“, erwiderte Elisabeth eisig. „Das hier mache ich nur solange mit, bis ich wieder laufen kann. Dann ziehe ich sofort aus. Klar soweit?“
Frau Fröhlich tauschte bedeutungsvolle Blicke mit Susanne, Gabriele und Mara. „Natürlich. Selbstverständlich.“
Dabei verstand sich von selbst, dass niemand im Ernst annahm, Elisabeth würde jemals wieder woanders wohnen als in der Seniorenresidenz Bellevue.
„Wir gehen dann mal nach oben“, beschloss Susanne. „Sobald meine Mutter in ihren eigenen vier Wänden ist, sieht die Welt schon ganz anders aus.“
Leider sah die Welt noch weit düsterer aus, als Elisabeth ihr Appartement in Augenschein nahm. Es war winzig. Ein Wohnklo mit Schlafnische. Nur ein Bruchteil ihrer Möbel hatte hineingepasst. Eine Schuhkommode blockierte den kleinen Vorflur. Im Wohnzimmer quetschten sich ihre rote Samtcouch, ihr Küchentisch nebst vier Stühlen, ein Bücherregal und ein Vitrinenschrank auf engstem Raum zusammen. Das Schlafzimmerchen, eine bessere Besenkammer, wurde fast völlig von einem monströsen orthopädischen Bett eingenommen – in allen möglichen Varianten elektrisch verstellbar. Statt Elisabeths großem Kleiderschrank aus weißem Schleiflack stand ein hässlicher, schmaler Schrank aus Kunststoff in der Ecke. Schon ein erster flüchtiger Blick genügte, um festzustellen, dass nur zwei Bilder den Umzug überlebt hatten, dass jede Menge Garderobe verschwunden war, dass Bücher, Fotoalben, Geschirr, Nippes und tausend andere Dinge fehlten.
„Wo sind meine ganzen Sachen geblieben?“, fragte sie fassungslos.
„Ach, weißt du, bei Ebay kann man heutzutage …“, begann Mara, doch Gabriele schnitt ihr das Wort ab. „Haben wir eingelagert. Bekommst du alles zurück, wenn du wieder ausziehst.“
Elisabeth glaubte ihr kein Wort. Aber sie war zu schwach, um weiter nachzuhaken. Überhaupt fühlte sie sich noch ziemlich schwach. Nach den ereignislosen Tagen im Krankenhaus war das hier etwas viel auf einmal.
„Tja, ich müsste dann mal los“, verkündete Susanne. „Mein Chef hat mir nur einen halben Tag freigegeben.“
Gabriele hüstelte. „Ich komme mit, bin schon spät dran mit meinem Kosmetiktermin.“
„Auch in der Agentur warten sie längst auf mich. Bevor ich gehe, bringe ich dich noch in den Speisesaal, Mama“, sagte Mara. „Um zwölf gibt es Mittagessen, da kannst du gleich deine Mitbewohner kennenlernen.“
„Nichts da, ich esse hier, allein“, knurrte Elisabeth.
Was sie unten in der Eingangshalle gesehen hatte, reichte ihr vollauf. Sie wusste nicht, was schlimmer war: die leeren, völlig ausdruckslosen Gesichter oder die verbiesterten, zänkischen Gestalten. Die reine Geisterbahn.
Aber Mara hatte den Rollstuhl schon in Richtung Flur bugsiert. „Mach das Beste draus, Mama. Knüpf ein paar Kontakte. Das bringt dich auf andere Gedanken.“
Kontakte? In diesem Irrenhaus? Innerlich kochend ließ sich Elisabeth zum Speisesaal fahren. Etwas anderes blieb ihr auch gar nicht übrig. Sie konnte ja schwerlich die Beine in die Hand nehmen und flüchten. Unablässig fragte sie sich, wie das alles hatte passieren können. Sicher, in ihrem Leben waren einige Klippen zu meistern gewesen, doch alles hatte sich immer zum Guten gefügt. Im Rückblick war ihre Vergangenheit nahezu perfekt. Bis auf die Tatsache, dass sie zur Gegenwart geführt hatte.
Schon rauschte der Lift ins Erdgeschoss, schon durchquerten sie die Eingangshalle und erreichten eine Minute später den Speisesaal. Es war ein weitläufiger, cremefarben gestrichener Raum, in dem ein paar Kübel mit Grünpflanzen die einzige Abwechslung darstellten. Die Heimbewohner saßen an Vierertischen zusammen, dazwischen flitzten Serviererinnen mit dampfenden Tellern hin und her. Das Stimmengewirr erstarb, als Mara den Rollstuhl durch die Tischreihen schob. Unzählige Augenpaare richteten sich auf den Neuzugang. Das reine Spießrutenlaufen.
„Hierher!“ Professionell munter winkte Frau Fröhlich ihnen zu. „Hier am Fenster ist Ihr Tisch!“
Elisabeth hatte einen Kloß im Hals. Alles in ihr sträubte sich, diesen Wahnsinn mitzumachen. Doch Mara steuerte unbeirrt auf den Tisch zu, an dem ausgerechnet die streitlustige Operndiva saß, neben dem granteligen Herrn aus der Eingangshalle und einer älteren Dame in einer Pelzjacke, die in ihrem Rollstuhl eingeschlafen war. Die Direktorin rückte einen freigebliebenen Stuhl beiseite, sodass Mara ihre Mutter direkt an den Tisch schieben konnte.
„Ich möchte Ihnen Frau Schliemann vorstellen.“ Frau Fröhlich deutete auf Elisabeth. „Eine reizende Dame, eine echte Bereicherung für unser Haus. Frau Schliemann, darf ich bekannt machen - Ihre Tischgenossen Lila Fouquet, Hans Martenstein und Ella Janowski. Die Gute leidet unter Narkolepsie, deshalb…“
„… weiß man nie: Schläft sie noch, oder stirbt sie schon?“, fiel ihr Hans Martenstein ins Wort.
„Ein Trauerspiel, wenn es nicht so eine jämmerliche Komödie wäre.“ Fräulein Fouquet lachte hysterisch. Die einstige Diva hatte ihren schwarzseidenen Morgenmantel mit einer giftgrünen Tunika vertauscht, dazu trug sie einen goldfarbenen Turban. Ihre Lippen schimmerten dunkelviolett. „Bühne frei für die Schrecken des Alters! Willkommen im Club der lebenden Leichen!“
„Und jetzt eine weitere lebende Leiche auf Rädern“, murrte Hans Martenstein mit einem abfälligen Blick auf Elisabeth.
Das anschließende Schweigen war derart geräuschvoll, dass es Elisabeth in den Ohren dröhnte. Oh, Gott. Ohgottogott. Sie war sprachlos. Hilfesuchend sah sie sich zu Mara um. Es war ihrer jüngsten Tochter deutlich anzumerken, wie unbehaglich sie sich fühlte. Bestimmt hatte sie sich das Ganze ein bisschen anders vorgestellt.
„Mara, könntest du mich bitte wieder nach oben bringen?“, flehte Elisabeth leise. Es war einfach unvorstellbar für sie, in dieser grauenvollen Tischgesellschaft zu essen.
Leider hatte die Direktorin das gehört. „Kommt nicht in Frage“, widersprach sie.
„Einsamkeit ist der stille Schmerz einer alternden Gesellschaft, Geselligkeit ist die beste Medizin dagegen.“
Es klang hohl und auswendig gelernt, so, als läse sie ihren eigenen Seniorenheimprospekt vor. Zwar hielt auch Elisabeth eine Menge von Geselligkeit, jedoch unter der Voraussetzung, dass sie sich gefälligst selbst aussuchen konnte, mit wem sie ihre Zeit verbrachte. Die Tischordnung des Altersheims war wie ein Blind Date, und in der Lotterie der einsamen alten Herzen hatte sie eindeutig nur Nieten gezogen.
„Seien Sie unbesorgt“, wandte sich Frau Fröhlich nun an Mara. „Ihre Mutter wird sich schnell eingewöhnen. Sie sollten jetzt besser gehen.“
In diesem Moment erwachte die schlafende Dame. Erstaunt rieb sie sich die Augen und rückte ihren Pelzkragen zurecht. Dann entdeckte sie Elisabeth. „Habe ich was verpasst? Wer sind Sie?“
„Das ist Frau Schliemann“, antwortete die Direktorin geduldig. „Ihre neue Tischgenossin.“
„Freut mich, Sie kennenzulernen“, sagte die alte Dame und nickte prompt wieder ein.
„Narkolepsie, die Neigung zum spontanen Einschlafen“, dozierte Herr Martenstein. „Eine äußerst interessante Erkrankung, auch Schlummersucht genannt. Unheilbar, mäßig unterhaltsam, aber immerhin: Wer schläft, sündigt nicht, oder?“
Fräulein Fouquet rollte mit den Augen. „Es fing ganz harmlos an. Überall machte sie ein kleines Nickerchen, irgendwann auch hinter dem Steuer ihres Wagens. Seither sitzt sie im Rollstuhl.“
„Tja, also, ich, äh, ich ver-verschwinde dann mal“, stammelte Mara sichtlich verwirrt. Sie strich sich eine Locke ihres rötlichblonden Haars aus der Stirn. „Ich ruf dich morgen an, Mama, versprochen.“
Bevor Elisabeth wusste, wie ihr geschah, hauchte Mara ihr einen Kuss auf die Wange und wandte sich zum Gehen.
„Dann guten Appetit“, rief Frau Fröhlich mit ihrer Kindergärtnerinnenstimme. „Es gibt Frühlingssalat und falschen Hasen. Der ganze Stolz der Küche.“
Damit verabschiedete auch sie sich. Elisabeth nahm es kaum wahr, sie sah Mara hinterher, die eiligen Schritts den Speisesaal verließ, ohne sich auch nur einmal umzudrehen. Das war’s also. Jetzt war sie allein. Eingesperrt im Käfig voller Narren.
„Cosi fan tutte – so machen’s alle“, kommentierte Fräulein Fouquet Maras zügigen Abgang. „Erst zieht man sie groß, dann behandeln sie einen wie Kleinkinder.“
„Na ja, in Ihrem Fall ist das auch angebracht, wertes Fräulein“, ätzte Hans Martenstein. „Schließlich müssen Sie wieder Windeln tragen.“
„Sie alter Romantiker!“ Lila Fouquet tat so, als wollte sie ihn mit ihrer Papierserviette schlagen, dann warf sie sich in Pose und schmetterte Elisabeth entgegen: „Reich mir die Hand, mein Leben, komm auf mein Schloss zu mir.“
Die alte Dame in der Pelzjacke öffnete die Augen. „Hab ich was verpasst? Wer sind Sie? Ich muss sagen, Sie haben Talent!“
„Talent?“ Fräulein Fouquet verzog die lilafarben geschminkten Lippen. „Talenteee! Und sie entwickeln sich alle langsam zurück.“
Ella Janowski hörte es nicht mehr, sie war schon wieder in sich zusammengesackt. Erst jetzt sah Elisabeth, dass diese seltsame Dame mit einer Art Sicherheitsgurt an ihrem Rollstuhl festgeschnallt war.
Herr Martenstein hatte unterdessen eine Plastikflasche mit Desinfektionsmittel herausgeholt, seine Serviette damit angefeuchtet und reinigte sein Besteck. „Man kann nicht vorsichtig genug sein“, ließ er Elisabeth wissen. „In solchen Großküchen geht es meist sehr unhygienisch zu. Mein Enkel sagt immer: Opa, nimm dich in Acht, das Seniorenheim ist Bakterien-City.“
Elisabeth brachte keinen Ton heraus. Das konnte doch alles nicht wahr sein. War das hier eine dieser Fernsehshows mit versteckter Kamera? Leider sah es nur danach aus. Wer wollte schon eine Show mit schrulligen alten Leuten sehen? Eben. Ihr Überlebensinstinkt sagte ihr, dass sie schnellstens hier raus musste. Fünf Minuten länger in dieser Geisterbahn des Grauens, und sie würde selbst verrückt werden.
Ein dickleibiger junger Mann mit einer Nickelbrille trat an den Tisch. „Frau Schliemann?“ Er streckte Elisabeth seine schwammig feuchte Hand entgegen. „Mein Name ist Müller-Neuenfels. Ich bin Therapeut, Fachgebiet Altersdepression. Sie können mich jederzeit ansprechen, wenn Sie Probleme haben.“
„Nein danke“, antwortete Elisabeth finster. „Kein Bedarf.“
Depressionen waren gar kein Ausdruck für ihren desolaten Gemütszustand, aber sie hatte nicht die Absicht, diesem halbgaren Typen auf die Nase zu binden, wie hundeelend sie sich fühlte.
Der junge Mann sah sie zweifelnd an. „Kein Bedarf? Da habe ich aber was ganz anderes gehört.“
Soeben machte Elisabeth die Erfahrung, dass alles immer noch schlimmer kommen konnte. Reichte es denn nicht, dass sie einem feindlichen Schicksal ausgeliefert war, hart am Rande eines Nervenzusammenbruchs? Musste dieser Mann das auch noch öffentlich ausposaunen? Sie ahnte, wer dahinter steckte. Ein Komplott mehr, das ihre Töchter ausgeheckt hatten, zusammen mit dieser unausstehlichen Frau Fröhlich.
„Naja, nichts für ungut.“, Herr Müller-Neuenfels legte eine Visitenkarte auf den Tisch. „Nur für den Fall.“ Damit trollte er sich.
„Therapeut, ha!“ Lila Fouquet zog die dick gepuderte Nase kraus. „Ein Schmalspurpsychologe ist er! Wir nennen ihn den Nimm‘s-nicht-so-schwer-Bär. Geben Sie sich bloß nicht mit dem ab.“
„Der einzige Trost ist, dass solche lachhaften Milchgesichter meine Rente zahlen“, brummte Hans Martenstein, während er akribisch sein Besteck wienerte.
In diesem Moment erschien eine Serviererin und verteilte vier Teller auf dem Tisch. „Bitte sehr, bunter Frühlingssalat nach Art des Hauses.“
Immer noch völlig perplex starrte Elisabeth auf ihren Teller, wo zwei kleine Tomaten zwischen angewelkten Salatblättern vereinsamten.
„Dieser Salat hat den Herbst seiner Karriere eindeutig erreicht“, stichelte Fräulein Fouquet. „Und Sie, werte Frau Schliemann?“
3
Es gibt Leute, die das Leben einen langen, ruhigen Fluss nennen. Elisabeth war eindeutig an den Ufern des Nirwanas gestrandet. Sie fühlte sich wie auf einer einsamen Insel, weit weg vom normalen Leben, ja, fernab der menschlichen Zivilisation. In der Nacht hatte sie wieder vom besonnten Strand im Süden geträumt, vom Fliegen und vom Tanzen, vom puren Glück. Nun saß sie schon seit Stunden untätig am Fenster und sah nach draußen, ohne wirklich etwas zu sehen. Die Zeit schien stillzustehen.
Tag zwei im Seniorenheim Bellevue, dachte sie, der zweite Tag vom kümmerlichen Rest meines Lebens. Endstation. In mannshohen Lettern pflanzte sich das Wort vor ihrem inneren Auge auf. ENDSTATION.
Ein Pfleger hatte sie gestern nach dem Essen zurück ins Appartement geschoben, ihr einen schönen Nachmittag gewünscht und war dann wieder abgezogen. Seither hatte sie ihre Wohnung nicht mehr verlassen. Am Abend hatte der Pfleger sie ins Bett gebracht, am Morgen war es ein anderer Pfleger gewesen, der sie wieder in den Rollstuhl gesetzt hatte. Die Tabletts mit Abendbrot und Frühstück standen immer noch unberührt auf dem Tisch. Das Mittagessen im Speisesaal hatte sie geschwänzt. Hungrig war sie ohnehin nicht, und auf die Kommentare ihrer Tischgenossen konnte sie wahrlich verzichten.
ENDSTATION. Dabei hatte sie doch noch so viel vorgehabt! Wehmütig dachte Elisabeth an die ganzen Pläne, die sie noch vor Kurzem geschmiedet hatte. Mit der Wandergruppe an die Amalfiküste bei Neapel reisen. Einen Italienischkurs in der Volkshochschule belegen. Im Tanzclub ihre goldene Ehrennadel für die 40-jährige Vereinszugehörigkeit in Empfang nehmen. Denn Elisabeth tanzte für ihr Leben gern. Foxtrott, Walzer, Cha-Cha-Cha. Seit vierzig Jahren. Vorbei.
Am Morgen hatte sie ein paar wackelige Schritte probiert, in Anwesenheit des Pflegers. Und feststellen müssen, dass sie es allein allenfalls vom Waschbecken bis zur Toilette schaffte. Ihre vollmundige Ankündigung, sie werde demnächst wieder laufen, war nichts weiter als eine Illusion. So sehr sie es sich auch wünschte – nie wieder würde sie ohne den verdammten Rollstuhl irgendwohin kommen.
Auf einmal durchzuckte sie ein nachtschwarzer Gedanke: War es nicht besser, ihrem Leben ein Ende zu bereiten? Was konnte sie denn noch erwarten außer einem unwürdigen Countdown, an den Rollstuhl gefesselt, umzingelt von verhaltensauffälligen Alten, von den eigenen Kindern aufgegeben? Dann lieber gleich in die Kiste springen. Am besten, sie sammelte ab jetzt die Schlaftabletten, die man ihr seit dem Krankenhausaufenthalt verschrieb. Was machen schon ein paar durchwachte Nächte, ging es ihr durch den Kopf. Schlafen kann ich auch noch, wenn ich tot bin.
Ein heftiges Pochen an der Tür riss sie aus ihren trüben Überlegungen. Wer mochte das sein? Vielleicht Mara? Ja, bestimmt! Ihre Jüngste hatte schließlich am Tag zuvor das Elend gesehen, in dem ihre Mutter gelandet war. Auf einmal schöpfte Elisabeth neue Hoffnung. Mara, ihr Nesthäkchen, würde sie aus diesem Jammertal erlösen! Hektisch setzte sie den Rollstuhl in Bewegung, wendete ihn etwas ungeschickt, riss dabei die Tischdecke nebst einer Blumenvase vom Tisch und erreichte ächzend die Wohnungstür.
„Mara? Bist du’s?“
„Liliana Alessandra Eleonore Fouquet“, ertönte eine krächzende Stimme.
Elisabeths Vorfreude fiel in sich zusammen wie ein missratenes Soufflé. Diese aufgedonnerte Drama-Queen war die letzte Person, die sie jetzt sehen wollte.
„Ein andermal“, rief sie. „Ich halte gerade Mittagsschlaf!“
„Wie man ja deutlich hören kann“, kam es sarkastisch von der anderen Seite der Tür. „Nun machen Sie schon auf. Wir müssen uns unterhalten.“
Da war Elisabeth allerdings ganz anderer Meinung. Mucksmäuschenstill horchte sie, ob sich das Problem von selbst erledigen würde. Tat es aber nicht. Mit bemerkenswerter Energie hämmerte Fräulein Fouquet an die Tür. So leicht ließ sich diese aufdringliche Dame nicht abwimmeln.
Elisabeth löste die Verriegelung, drückte die Klinke herunter und zog die Tür auf. „Was ist denn los?“
„Das fragen Sie noch?“ Mit angriffslustig funkelnden Augen stand die einstige Diva vor ihr. In der rechten Hand schwenkte sie eine Flasche Sekt. „Man muss doch blind sein, um nicht zu sehen, dass Sie sich kurz vor dem Schlussvorhang befinden.“
„Wie bitte?“
Statt zu antworten, klemmte sich Fräulein Fouquet die Sektflasche unter den Arm, umfasste die Griffe des Rollstuhls und schob Elisabeth ins Wohnzimmer zurück. Neugierig sah sie sich um. Als erstes entdeckte sie die Tischdecke auf dem Boden und die heruntergefallene Blumenvase. Anschließend musterte sie das karge Mobiliar, um schließlich ihre violett umrandeten Augen auf Elisabeth zu richten.
„Diesen Ort sogleich verlasset, denn Gefahren Euch umgeben!“, sang sie lauthals.
Keine Frage, die Dame hatte einen gehörigen Knall.
„Moment mal, Sie können hier nicht einfach so reinplatzen“, schnaubte Elisabeth.
Fräulein Fouquet hob theatralisch die Hände. „Das waren Violettas Worte in La Traviata, neunter Aufzug. Verehrte Frau Schliemann, ich habe zu lange auf der Bühne gestanden, um mich mit der Rolle des Zuschauers zu begnügen. Sie sind offensichtlich in einen äußerst heiklen Zustand geraten. Und ich werde etwas dagegen tun.“
Das wurde ja immer schöner. „Was fällt Ihnen ein? Schon mal was von Privatsphäre gehört?“
Ungerührt nestelte Fräulein Fouquet am Verschluss der Sektflasche, bis der Korken mit einem lauten Plopp entwich. Sie sah sich um, holte zwei Teetassen aus dem Vitrinenschrank und füllte sie mit Sekt. Dann reichte sie Elisabeth eine Tasse.
„Fort mit den Sorgen, hoch das Glas“, trällerte sie. „Das ist aus La Bohème. Trinken Sie einen Schluck. Dann reden wir.“
„Und wenn ich keine Lust darauf habe?“
Fräulein Fouquet leerte ihre Tasse, bevor sie antwortete. „Dies ist keine Sache von Leben und Tod, dies ist wesentlich ernster.“
Aha. Zögernd nippte Elisabeth an dem Sekt. Eigentlich war es eine nette Geste, nur, dass ihr diese Frau gehörig auf die Nerven ging. Schon allein der schaurige Anblick war mehr, als ein normaler Mensch verkraften konnte. Rötlich getönte schüttere Haarsträhnen lugten unter dem goldenen Turban hervor. Zu einem feuerroten Kaftan trug Fräulein Fouquet Unmengen klimpernder Armreifen, ihre Füße steckten in bestickten rosa Seidenpantoffeln. Gerade schenkte sie sich nach und löste drei Tabletten in dem Sekt auf.
„Das sind Stimmungsaufheller“, wisperte sie. „Herr Martenstein hat Zugang zum Medikamentenschrank. Wir nennen sie die kleinen Sonnenstrahlen für verschattete Seelen. Möchten Sie auch ein paar?“
„Um Himmels willen, nein!“
Lila Fouquet nahm auf der Couch Platz. „Ich habe Herrn Martenstein übrigens auf Sie angesetzt. Er hilft bei der Verwaltung aus und hat sich Ihre Akte besorgt.“
„Also wirklich. Und was ist mit dem Datenschutz?“
Ein kehliges Lachen folgte. „Ist nur zu Ihrem Besten, Schätzchen. Als erstes müssen wir Sie aus dem Ding da rausholen.“ Fräulein Fouquet tippte den Rollstuhl mit ihrem rechten Seidenpantoffel an. „Dann schauen wir weiter.“
Elisabeth winkte müde ab. „Im Krankenhaus hat man mir gesagt, dass ich ein museumsreifer Oldtimer bin, der in die Garage gehört.“
„Ihre Röntgenbilder legen andere Schlussfolgerungen nahe. Verflixt, wo bleibt denn nur der rettende Held?“
„Wer?“
„Na, Martensteinchen, unser Oberlehrer.“
Wie auf Kommando klopfte es. Ohne Elisabeths Einverständnis abzuwarten, huschte Fräulein Fouquet zur Tür und öffnete sie.
„Das wurde aber auch Zeit“, begrüßte sie ihren Tischgenossen. „Sie hätten fast Ihren Auftritt verpasst.“
Der ältere Herr schlurfte ins Wohnzimmer, blieb vor Elisabeth stehen und deutete eine Verbeugung an. „Habe die Ehre.“
Noch immer trug er seine graue Strickweste, die er heute mit einer verwaschenen blauen Jogginghose und abgetretenen, ehemals weißen Gesundheitslatschen kombinierte. Mit seinem gänzlich kahlen Kopf und der Hornbrille hätte man ihn für einen honorigen Rechtsanwalt halten können –lwürde nicht sein fragwürdiger Kleidungsstil eine andere Geschichte erzählen.
„Ein Tässchen Sekt?“, säuselte Fräulein Foquet.
„Ein hervorragendes rezeptfreies Mittel zur Stabilisierung altersbedingter Kreislaufschwäche“, wurde sie von Herrn Martenstein belehrt. „Danke, gern.“
Er legte eine graue Mappe auf den Tisch, ließ sich von Fräulein Fouquet eine Tasse geben und sank neben sie auf die Couch.
Elisabeth fühlte sich ziemlich überrumpelt. „Ich verstehe nicht ganz, was Sie hier eigentlich wollen.“
Die beiden tauschten einen verschwörerischen Blick. Elisabeth wurde einfach nicht schlau aus ihnen. Beim Mittagessen am Vortag hatte sie den Eindruck gewonnen, dass man nicht gerade begeistert über ihre Anwesenheit war. Und jetzt kamen ihre Tischgenossen mit Sekt um die Ecke? Wollten die ihr etwa was verkaufen? Oder sie bestehlen? Man musste auf der Hut sein. Sie kannte das bizarre Pärchen ja kaum.
Unruhig rutschte Elisabeth auf ihrem Sitz hin und her. „Also, was führt Sie zu mir?“
Lila Fouquet überprüfte den Sitz ihres Turbans, betrachtete eingehend ihre leise klirrenden Armreifen, dann nahm sie Haltung an. „Wir haben uns heute Mittag gefragt, wo Sie bleiben.“
„Wir dachten schon, Sie wären wieder ausgezogen“, ergänzte Hans Martenstein. „Was in Anbetracht des zweifelhaften Ambientes nicht verwunderlich wäre.“
„Stimmt genau“, pflichtete Lila Fouquet ihm bei. „Aber Sie sind immer noch da. Wie man sieht.“
Eine kleine Pause entstand. Elisabeth schielte verstohlen nach dem Telefon, das unerreichbar hoch oben auf dem Regal in der anderen Ecke des Wohnzimmers stand. Ihr Handy lag ebenso unerreichbar im Schlafzimmer neben dem Bett. Seit Jahren wehrte sie sich gegen einen Notfallknopf, den man um den Hals tragen konnte, wie Susanne ihr mehrfach empfohlen hatte. Jetzt bedauerte Elisabeth zutiefst, dass sie ihn nicht besaß.
„Nun“, Hans Martenstein erhob sich, angelte sich die Mappe vom Tisch und schlug sie auf. „Ihre Töchter – nehme ich an – haben alle Fragebögen gewissenhaft ausgefüllt, was uns einen detailgenauen Einblick in Ihr Leben erlaubt. Ausbildung zur Bürokauffrau. Seit acht Jahren verwitwet. Bis zu Ihrem Sturz haben Sie allein gewohnt, in der Erdinger Straße 3. Mitgliedschaften im Wanderverein Watzmann und im Tanzclub Blau-Weiß. Diverse Kurse an der Volkshochschule: EDV für Anfänger, Einführung in den orientalischen Tanz, Seidenmalerei. Ehrenamtliche Arbeit: Nachhilfeunterricht für Nachbarskinder. Keine Vorerkrankungen, keine Anzeichen von Demenz, dafür massive Symptome einer depressiven Verstimmung. Ich gehe davon aus, dass Sie gegen Ihren Willen hier sind. Richtig?“ Zufrieden mit seinem kleinen Vortrag, setzte er sich wieder hin.
Elisabeth war empört. „So eine Frechheit! Das alles geht Sie gar nichts an! Wie können Sie es wagen, in meiner Akte herumzuschnüffeln?“
„Sie sind verrrzweifelt, Sie haderrrn mit Ihrem Schicksal, Sie trrragen sich mit finsterrren Gedanken“, rief Lila Fouquet, wobei sie so laut sprach und die Rs so effektvoll rollte, als müsste sie die Mailänder Scala mit ihrer Stimme füllen.
„Ich glaube, Sie gehen jetzt besser“, zischte Elisabeth mit mühsam unterdrücktem Zorn. „Sonst schlage ich Alarm.“
Weder Fräulein Fouquet noch Herr Martenstein ließen sich von dieser Drohung sonderlich beeindrucken. Wie festgetackert hockten sie auf der Couch.
. „Die gute Nachricht Nummer eins.“ Hans Martenstein zog ein Röntgenbild aus der Mappe und hielt es gegen das Licht. „Die Bruchstelle ist leicht verkapselt, im Übrigen aber recht glatt verheilt, stellt also kein grundsätzliches Hindernis für die Wiederherstellung Ihrer Mobilität dar. Hat man Ihnen eine Reha verschrieben?“
„Sie meinen – eine Rehabilitationskur, um wieder laufen zu lernen? Nein“, antwortete Elisabeth verblüfft.
Warum war sie eigentlich nicht selbst darauf gekommen? Und warum hatten ihre Töchter diese Möglichkeit mit keinem Wort erwähnt? Weil es für sie bequemer war, wenn ihre Mutter ruhiggestellt im Rollstuhl saß? Und nicht auf dumme Gedanken kam?
„Sehen Sie“, triumphierend schob Herr Martenstein das Röntgenbild zurück in die Mappe. „Da setzen wir an. Ab jetzt wird trainiert. Täglich. Bald springen Sie wieder herum wie eine junge Gazelle.“
Elisabeth hatte sich kaum von dieser Ankündigung erholt, als Lila Fouquet wieder das Wort ergriff. „Und damit Ihr zweifellos vorhandener Geist nicht zu kurz kommt, bieten wir Ihnen hiermit die Mitgliedschaft im Einstein-Club an.“ Sie füllte die Tassen erneut. „Das ist übrigens eine große Ehre. Wir sind ein kleiner, feiner Club. Unbefugte haben keinen Zutritt.“
Elisabeth verdrehte entnervt die Augen. Wer wollte schon Mitglied in einem Club sein, dem Lila Fouquet angehörte?
„Wir lesen die Klassiker der Literatur und lösen Denksportaufgaben“, erklärte Hans Martenstein. „Außerdem unternehmen wir Exkursionen.“
Erwartungsvoll schaute er Elisabeth an, während er sich einen großen Schluck Sekt genehmigte.
„Nein, danke.“ Sie bewegte den Rollstuhl vorsichtig ein Stück zurück, bis sie die Tischkante in ihrem Rücken spürte. „Das ist alles furchtbar nett, aber ich eigne mich nicht für Seniorenkram. Und von sportlichen Betätigungen bin ich weiter entfernt als der Mops vom Mond. Wenn Sie mich dann bitte mal allein lassen würden …“
Fräulein Fouquet brach in Gelächter aus. „So ein zähes Biest! Habe ich es Ihnen nicht gleich gesagt?“
„Das macht Sie richtig sympathisch“, amüsierte sich Hans Martenstein. „Hören Sie, Frau Schliemann, es steckt etwas mehr dahinter.“ Er dämpfte seine Stimme. „Unser Engagement für Sie ist nicht ganz uneigennützig. Seit längerem schon arbeiten wir an einer Exit-Strategie.“
Elisabeth fühlte sich wie ertappt. Ihr wurde ganz schwummrig zumute. „An einer … Sie meinen, Sie möchten, Sie wollen - sich umbringen?“
Mit weit aufgerissenen Augen starrten die beiden ungebetenen Gäste sie an. Jetzt reichte es aber wirklich. Man konnte nicht behaupten, dass Elisabeth zu unbeherrschten Gefühlsausbrüchen neigte, doch das hier brachte sie komplett aus der Fassung.
„Raus!“, brüllte sie. „Auf der Stelle! Und falls ich jemals freiwillig aus dem Leben scheide, dann ganz bestimmt nicht mit Ihnen!“
Lila Fouquet legte mit gespielter Schwerhörigkeit eine Hand hinters Ohr. „Oh, ich habe Sie nicht verstanden, weil drei Straßen weiter ein Schmetterling auf einem Blatt gelandet ist.“
„Lassen Sie es gut sein, Lila“, wies Hans Martenstein sie zurecht. „Frau Schliemann, wir meinen nicht den Exit ins Jenseits, wir sprechen vom Ausbruch aus der Seniorenresidenz Bellevue. Natürlich ist es Ihnen unbenommen, den Rest Ihres noch jungen Lebens wegzuwerfen. Wir hingegen haben beschlossen, uns aus diesem Gefängnis zu befreien. Dafür brauchen wir einen guten Plan, eine ganze Stange Geld und tatkräftige Mitstreiter.“
„Wir erwägen, eine Bank zu überfallen“, fügte Lila Fouquet so beiläufig hinzu, als spräche sie über das Wetter. „Wir zählen auf Ihre Diskretion. Und auf ein paar brillante Ideen. Im Gegensatz zu den anderen Heimbewohnern scheinen Sie ja geistig einigermaßen auf der Höhe zu sein.“
Das war ein Paukenschlag. Elisabeth musste diese brisanten Informationen erstmal verdauen. Was sie gerade erfahren hatte, klang völlig absurd, wenn nicht komplett verrückt. Eigentlich gefiel ihr der Gedanke, wie sie widerstrebend feststellte. Ausbrechen! Das Seniorenheim hinter sich lassen! Freiheit! War sie nicht insgeheim von dieser Idee besessen, seit ihre Töchter sie hier abgeliefert hatten wie ein Postpaket?
Andererseits war klar wie Korn, dass eine abgetakelte Operndiva und ein greiser Hobbydetektiv in Gesundheitslatschen kaum die geeigneten Komplizen für eine spektakuläre Flucht waren. Und die Sache mit dem Banküberfall war vollends irre. Ging‘s noch? Wofür hielten die sich? Für Bonny und Clyde? Ein Bankraub! So etwas Hirnrissiges! Allein die Vorstellung, wie der gemächlich herumschlurfende Hans Martenstein vor der Polizei flüchtete, war eine Lachnummer.