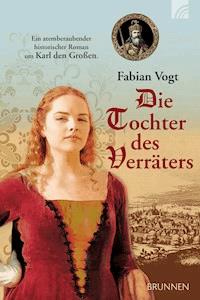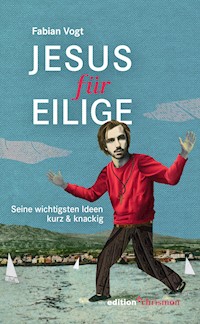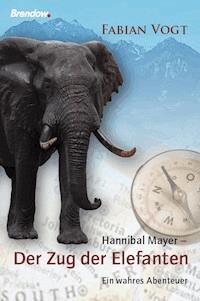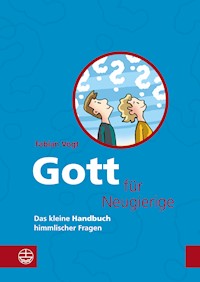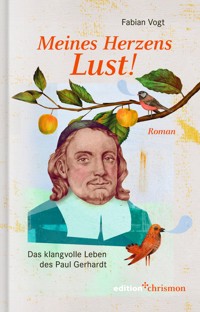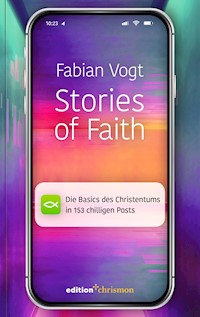Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Brendow, J
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Als die Uhr am Silvesterabend des Jahres 2000 zwölfmal schlägt, beginnt für alle ein neues Jahr – nur nicht für Max. Entsetzt muss der junge Wissenschaftler feststellen, dass er stattdessen ein Jahr in die Vergangenheit gereist ist. Damit nicht genug: Von nun an wacht er jeden Morgen 365 Tage weiter in der Vergangenheit auf. Was soll das? Wieso ausgerechnet Max? Verwirrt taumelt er durch die Jahrhunderte, bis er im Mittelalter einen alten Mönch trifft, der ihm rät, Jesus persönlich um Rat zu bitten. So wendet sich der Zeitreisende Richtung Jerusalem.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Antoon van Dyck: „CharlesI. at the Hunt“, ARTOTHEK
Für Miriam
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-86506-924-5
Copyright © 2016 by Joh. Brendow & Sohn Verlag GmbH, Moers
Einbandgestaltung: Brendow Verlag, Moers
Titelfoto: „CharlesI. at the Hunt“, ARTOTHEK
Satz: Brendow Web & Print, Moers
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2016
www.brendow-verlag.de
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Anmerkung
Prolog
1. Jahr: Wer? (2000–1635)
2. Jahr: Wohin? (1634–1270)
3. Jahr: Was? (1269–905)
4. Jahr: Warum? (904–540)
5. Jahr: Wann? (539–175)
6. Jahr: Wie? (174–48)
Epilog
Biografie von Max Temper
Landkarte
Anmerkung
Obwohl viele Personen, denen mein Held Maximilian während seiner Reise begegnet, in die Biografien historischer Charaktere geschlüpft sind, handelt es sich um fiktive Figuren. Ihre Lebensdaten sind zwar im Wesentlichen korrekt, die meisten Eigenschaften und Erlebnisse wurden aber dazugedichtet.
Das gilt auch für die geschichtlichen Zusammenhänge: Bei allem Bemühen um Genauigkeit gibt mein Roman eher einen Einblick in grundlegende Prozesse der europäischen Vergangenheit als in historische Datierungen. So ist es zum Beispiel unwahrscheinlich, dass Lukian im Jahr 175 noch durch Kleinasien gezogen ist – auch wenn die Möglichkeit besteht.
Andererseits, wer weiß: Vielleicht stimmt ja doch alles.
Prolog
1640 Der Wind hatte gedreht und trieb jetzt aus dem offenen Meer größere Wellen vor sich her, sodass die Fleute, ein kleiner holländischer Dreimaster, zu schlingern anfing. Fluchend kamen einige Seeleute aus dem Inneren des Schiffs, um die Stellung der Segel zu korrigieren. Die schrille Stimme des Mannes an der Ruderpinne huschte wie das Kreischen eines Vogels über Deck, bevor das schnelle Gefährt nach wenigen Augenblicken wieder gleichmäßig gegen die Bewegungen des Wassers anstampfte.
Am Bug des Schiffes stand ein junger Mann, der von all dem nichts bemerkte. Er starrte konzentriert vor sich in die milchige Luft und wartete darauf, dass sich die Konturen der englischen Küste zeigten. Doch jedes Mal, wenn er zwischen den tief liegenden Wolken und den leichten Regenfäden etwas zu erspähen meinte, verschwamm das Trugbild wieder. Ungehalten schüttelte er sein dichtes blondes Haar und zog den Schultermantel, der herabgeglitten war, enger um sich. Die Feuchtigkeit der Luft ließ ihn zittern.
Der Reisende war nach der neuesten Mode gekleidet – mit Schoßwams, knielanger Hose, Stulpenstiefeln und einem weißen Kragen, der sich wie zwei Hände um seinen Hals legte. Trotzdem sahen die vornehmen Kleidungsstücke abgetragen aus. Um sich zu vergewissern, dass ihn niemand beobachtete, drehte er sich kurz um und blickte prüfend über das vollgestellte Deck, bevor er eine Taschenuhr aus seinem Wams zog und verstohlen darauf schaute.
‚Ich werde London niemals vor zwölf erreichen‘, durchfuhr es ihn, als er sah, dass es bereits kurz nach sechs war, ‚heute Nacht sterbe ich!‘ Der Gedanke gefiel ihm. Er zuckte mit den Achseln, steckte die Uhr zurück und entspannte sich. ‚Vielleicht ist es besser so. Ich ertrage dieses verfehlte Dasein ohnehin nicht mehr. Ich gehöre hier nicht her! Jeder Mensch braucht einen Ort, an dem er zu Hause ist.‘
Seine Finger krallten sich um die raue Reling, und sein Blick glitt in die schäumenden Strudel, die sich hinter dem eintauchenden Bug der Fleute bildeten; kleine auseinander driftende Bewegungen, in denen winzige Algenstücke hin- und hergerissen wurden. Unzählige Luftblasen sprudelten unter dem Boot hervor, als sprängen sie zur Seite.
Der junge Mann wankte leicht. ‚Ein Leben, das man nicht selbst bestimmen kann,ist keines. Oder doch? Nein! Wenn man nur noch vom Sog der Zeit mitgerissen wird, verliert man sich. Ich kann nicht leben, ohne zu wissen, warum!‘
Er zog den Mantel am Hals zusammen und blickte auf die vibrierenden Schiffsplanken hinunter. Seine Finger zuckten fast unmerklich zurück, als sie sich berührten. ‚Irgendjemand spielt ein Spiel mit mir und ich kann nichts dagegen tun. Obwohl: Eines bleibt mir immer noch.‘ Er schauderte, weil ihn der Gedanke so selbstverständlich in Besitz nahm: ‚Wenn ich jetzt hier ins Wasser springen würde, dann hätte ich wenigstens ein kleines Stück Freiheit, einen kurzen Augenblick einen eigenen Willen. Ich wäre ein einziges Mal Herr der Lage.‘
Der Reisende spürte vor Erregung nicht, dass er die Fäuste geballt hatte und sie an den Körper presste: ‚Ich bin nur ich, wenn mein Dasein einen Einfluss auf diese Welt hat. Alles andere ist unerträglich, ja, wahrscheinlich ist meine Hilflosigkeit das Allergrausamste. Ich bin hier und kann nichts dagegen tun. Ich will hier weg und bin völlig machtlos. Aber nicht bis zum Letzten: Ich kann meinem Leben selbst ein Ende setzen. Vielleicht bewahre ich mir damit das bisschen Stolz, das mir geblieben ist.‘
Der Reisende grübelte noch einige Minuten, in denen er immer mehr zusammenzufallen schien, dann zuckte er noch einmal leicht mit den Schultern, richtete sich mit einem Ruck wieder auf und öffnete bestimmt und mit kleinen, ruhigen Bewegungen die Knöpfe seines Wamses.
Als er den Mantel und das Gewand abgelegt hatte, zog er die Stiefel aus und stellte sie ordentlich neben das Ankertross. Er versuchte ein letztes Mal, am dunkler werdenden Horizont eine feste Linie oder ein Licht zu finden, doch der Wind durchzog die Luft nach wie vor mit Schlieren aus Wasser und Dunst und versperrte die Sicht.
Der fröstelnde Mann seufzte hörbar, dann ergriff er gelassen ein vor ihm zum Mast gespanntes Tau und stieg auf die Reling. Plötzlich musste er lachen. Es schien alles so einfach; einfach, einen Schritt nach vorne zu machen, einfach, diese widernatürliche Welt hinter sich zu lassen, einzutauchen ins Nichts …
Da packte ihn eine starke Hand und zog ihn so energisch nach hinten, dass er rücklings auf den Planken zu liegen kam.
„Willkommen im Leben, mein Freund!“
Der junge Mann stützte sich auf seine Unterarme, richtete den Oberkörper auf und schaute den Fremden verdutzt an. Es war ein Mann um die vierzig, dessen großer runder Hut den dunklen Locken nur schwer Einhalt gebieten konnte. Seine Kleidung aus Samt und Satin war verschwenderisch gestaltet und wies ihn als Mitglied der Aristokratie aus. Sein Körper allerdings wirkte schwächlich, so als kämpfe er gegen eine schwere Krankheit, die ihn über kurz oder lang besiegen würde. In diesem Moment aber leuchtete sein Gesicht vor Freude. Die Mundwinkel waren entlang seiner Schnurrbartspitzen feixend nach oben gezogen und die Augen weit geöffnet, während sein durchdringendes Lachen das Rauschen des Windes übertönte. Der Fremde prustete auch noch, als er dem am Boden Liegenden das Wams zuwarf und die Stulpenstiefel mit einem gezielten Tritt zu ihm beförderte.
Der junge Mann rührte sich nicht. „Wer seid Ihr?“
„Wer ich bin?“ Der Fremde hielt die Frage offensichtlich für höchst amüsant. Er lupfte seinen Hut und verbeugte sich: „Gestatten. Antoon van Dyck. Hofmaler seiner Majestät Charles des Ersten, wenn du es genau wissen willst. Und du bist Maximilian. Schön, dass wir uns wieder sehen!“
Verwirrt zog der Angesprochene seine Kleidung wieder an. Nach längerem Schweigen sagte er: „Seid Ihr sicher, dass wir uns kennen?“
„Oh, ich vergesse nie ein Gesicht, das ich einmal gemalt habe. Außerdem habe ich deinen hübschen Kopf fast jeden Tag vor Augen. Dein Antlitz hängt an einer exponierten Stelle im Palast. Aber: Ist das nicht unglaublich? Du kommst aus meiner Zukunft und ich komme aus deiner Zukunft. Du weißt, was mit mir passieren wird, und ich weiß, was mit dir passieren wird. Vielleicht bin ich momentan ein wenig im Vorteil, weil ich die Vergangenheit mit mir bringe. Ich kenne dich schon lange, du lernst mich gerade erst kennen. Also, ich finde das komisch.“ Und wieder kam ein Lachanfall über ihn, der seinen ganzen Körper erschütterte.
Der junge Mann stammelte: „Ihr wisst von meiner …?“
„Na, eigentlich habe ich es bis vor einer Minute selbst nicht geglaubt. Ich dachte damals, ich hätte einen mit einer wundervollen Fantasie begabten, aber verrückten Wirrkopf in mein Atelier eingeladen. Trotzdem hat mich deine Geschichte so fasziniert, dass ich heute hierher gekommen bin, um zu sehen, ob sie wahr ist.“
Maximilian zog die Augenbrauen zusammen. Vorsichtig murmelte er: „Das verstehe ich nicht!“
Sein Gegenüber breitete strahlend die Arme aus: „Du hast mich vor fünf Jahren indirekt gebeten, heute mit dir auf diesem Schiff zu fahren und dir das Leben zu retten. Hier bin ich!“
Der Maler lachte so heftig, dass er sich verschluckte. Erst als er wieder Luft bekam, konnte er weitersprechen: „Es ist verrückt! Ich denke andauernd, dass du das alles doch eigentlich wissen müsstest, dabei hast du es noch vor dir. Du wirst unsere Londoner Begegnung ja erst in wenigen Tagen erleben. Und dann werde ich dich zum ersten Mal sehen, obwohl ich jetzt so viel über dich weiß. Damals, in meiner Zeitrechnung, war es umgekehrt: Du kanntest unsere gemeinsame Zukunft und hattest diese erste Begegnung schon hinter dir.“
Ängstlich blickte sich der blonde Reisende, der plötzlich zitterte, um und legte für einen kurzen Moment den Kopf in die hellen Hände. Dann flüsterte er: „Ich habe Euch wirklich alles erzählt?“
Van Dyck grinste: „Ich hatte noch niemals ein so geschwätziges Modell wie dich. Aber wen wundert es: Du hast dir ja bei deinem Besuch auch knapp 400 Jahre von der Seele geredet.“
„Woher weiß ich, dass Ihr nicht lügt?“
„Du bist ein komischer Vogel. Wenn ich damals so wenig Vertrauen zu dir gehabt hätte wie du jetzt zu mir, wäre ich heute nicht hier, und du würdest jetzt da unten mit den Fischen spielen. Aber warte …“
Van Dyck griff in sein Gewand und zog einen zusammengefalteten Bogen Papier hervor. Er entfaltete ihn genussvoll und hielt ihn dem immer noch am Boden Sitzenden vor die Nase. Staunend las Maximilian:
„Am 27. Dezember 1640 werde ich versuchen, mir auf der Fleute‚ Marian‘ auf dem Weg von Antwerpen nach London das Leben zu nehmen.
Gez. Maximilian Temper“
Van Dyck grinste: „Du wusstest damals schon, dass du mir nicht glauben würdest. Darum hast du mir im Jahr 1635 diesen Zettel gegeben.“
Maximilian starrte auf das Blatt, auf das die Botschaft ganz augenscheinlich mit seiner eigenen Handschrift geschrieben war. Und während die Buchstaben in der feuchten Luft zu zerlaufen begannen, streckte der Maler dem verdutzten jungen Mann die Hand hin.
„Komm hoch, es gibt einiges zu besprechen! Und wir haben nicht viel Zeit. In fünf Stunden verschwindest du wieder in meiner Vergangenheit. Los, wir wollen feiern wie zwei echte Ritter!“
Maximilian blickte den gut gelaunten Edelmann fragend an, dann zog er sich an der dargebotenen Hand hoch.
„Wieso habe ich Euch meine Geschichte erzählt?“
„Wahrscheinlich, weil du es nicht mehr ausgehalten hast. Weil du verzweifelt warst, so wie eben.“
Er griff sich theatralisch an die Stirn. „Nein, Unsinn, jetzt erst verstehe ich, was hinter all dem steckt: Du hast mir deine Geschichte damals erzählt, weil du ja durch unser heutiges Treffen schon darauf vorbereitet warst, weil du von nun an weißt, dass du sie mir im Jahr 1635 erzählen wirst. Ja, ich erinnere mich: Du hattest dir bislang immer fest vorgenommen, niemandem dein Geheimnis zu verraten, aber ein solches Schicksal kann keiner alleine bewältigen. Vielleicht hast du auch darum angefangen, alles aufzuschreiben …“
Maximilian unterbrach ihn: „Ich habe was?“
Van Dyck hob die Augenbrauen, weil ihm sein Gegenüber ins Wort gefallen war. Etwas gereizt sagte er: „Du hast deine Geschichte aufgeschrieben. Entschuldige meinen Ton, du kannst das ja noch nicht wissen. Es ist schwer, sich daran zu gewöhnen, dass wir beide in entgegengesetzter Richtung leben. Also, pass auf: Ich habe dir damals mehrere Seiten von meinem besten Zeichenpapier und eine wertvolle Feder gegeben. Das heißt für dich: Ich werde dir bald mehrere Seiten von meinem besten Zeichenpapier und eine wertvolle Feder geben. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu?“
Der junge Mann sprach leise vor sich hin: „Wenn ich meine Geschichte aufschreibe, dann verstehe ich vielleicht endlich, warum das alles passiert. Es muss doch irgendeinen Sinn hinter meiner absonderlichen Existenz geben, irgendeinen Plan oder ein verborgenes System. So etwas Seltsames passiert nicht ohne Grund.“
Maximilian ergriff die Hand des Malers: „Sir, Ihr habt mir mehr geholfen, als Ihr denkt.“
Der andere erwiderte den Händedruck. „Ich weiß. Das wirst du mir bald noch einmal sagen. Das heißt: Wenn ich es aus meiner Perspektive betrachte, dann hast du es mir schon gesagt. Aber darum bin ich ja auch hier. Ich dachte, du könntest dich revanchieren.“
Van Dyck legte den Arm um den Mann und führte ihn an die Treppe, die zu den Passagierkabinen hinunterführte.
„Du weißt vielleicht, dass ich mich auf meine alten Tage verheiratet habe. Aber es steht mit meiner Gesundheit nicht zum Besten. Sage mir, ob ich noch einen legitimen Erben zeugen werde.“
Maximilian schwieg. Van Dycks Frau Maria würde eine Tochter bekommen und sie „Justiniana“ nennen, eine Woche vor dem Tod des großen Malers. Alle werden davon sprechen. Nur du wirst nichts mehr davon haben, dachte er. Laut sagte er: „Ihre Frau wird bald schwanger werden.“
„Na, ich werde mein Bestes dafür tun!“
Van Dyck schlug ihm fröhlich auf die Schulter und zeigte nach vorne, wo die Lichter eines Fischerortes durch das Dunkel leuchteten.
1635 Ich reise. Ich reise durch die Zeit, genauer gesagt: in die Vergangenheit. Ich tauche ein in die Geschichte und versuche verzweifelt, nicht darin unterzugehen. Denn so sehr ich mich auch dagegen wehre: Meine Uhr springt zurück, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Unaufhaltsam falle ich durch die Jahre. Dafür muss es einen Grund geben, ich weiß nur noch nicht, welchen. Aber ich werde es herausfinden.
Der Künstler Antoon Van Dyck, den ich vor fünf Tagen an Bord des Fährschiffs „Marian“ kennen gelernt habe, hat Recht behalten. Er behauptete, er habe mir einige Jahre zuvor geholfen, meine Erfahrungen aufzuschreiben. Und tatsächlich: Ich sitze in einem kleinen, verwinkelten Raum neben seinem Atelier und schreibe auf seinem Zeichenpapier mit einer Feder, die er mir geschenkt hat. Das ist ein gutes Gefühl. Zum ersten Mal seit dem Beginn meiner widersinnigen Wanderung habe ich ein Ziel: Ich werde alles aufschreiben, was mir auf den Stationen meiner Wanderung widerfahren ist, denn vielleicht stoße ich dabei auf eine Spur, einen Hinweis, irgendetwas, das mir hilft, das Unglaubliche zu verstehen.
Wie warm es hier ist. Von allen Seiten starren mich Theatermasken an und lächeln über den einsamen Schreiberling, der sich an seiner Feder festhält wie an einem Rettungsring. Draußen schlägt eine Glocke, eins, zwei, drei, vier … zehnmal, und die Schläge hallen in dem dunklen Gewölbe nach.
Gerade ist mir bewusst geworden, welches Jahr wir heute haben: 1635. Ich wage kaum, diese Zahl noch einmal hinzuschreiben. Denn sie ist etwas Besonderes, ein kleiner Haltepunkt in meinem dahintreibenden Dasein. Heute bin ich genau 365 Tage in die Vergangenheit vorgedrungen, ein Jahr meines aus der Zeit gerissenen Lebens. Aber 365 Jahre der Geschichte, denn jeden Morgen, wenn ich aufwache, ist der Kalender genau um ein Jahr zurückgesprungen. Dann reibe ich mir jedes Mal die Zukunft aus den Augen und versuche, mich so gut wie möglich in der neuen Situation zurechtzufinden.
Zum Glück hat sich in meiner Umgebung meist wenig geändert. Manchmal tauschen die Möbel ihre Position, Pflanzen schrumpfen zusammen und Farben leuchten kräftiger. Geografisch wache ich aber immer an dem Platz auf, an dem ich am Abend zuvor eingeschlafen bin. Darum habe ich so große Angst, die Zeit um Mitternacht auf einem Schiff zu verbringen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Jahr vor meiner Abfahrt an der Stelle meines „Zurück“, wie ich diesen unerklärlichen Sprung für mich nenne, gerade wieder ein Fahrzeug befindet, ist doch eher gering, und ich konnte noch nie besonders gut schwimmen. Mein Sportlehrer hat mir damals sogar abgeraten, irgendein Abzeichen, ich glaube, es hieß „Seepferdchen“, zu machen, weil ich im Wasser immer wie ein Walross schnaubte. Das ist ewig her.
Nein! Das stimmt nicht … ich werde mich wohl nie daran gewöhnen, es richtig auszudrücken: Das ist nicht ewig her, das wird erst in einer Ewigkeit passieren. Da ich in der Zeit zurück reise, ist meine Vergangenheit die Zukunft der Welt und umgekehrt: Die Vergangenheit der Welt ist meine Zukunft. Ich weiß im Jahr 1635 ganz genau, was im Jahr 1640 passieren wird, denn von dort komme ich; die Menschen aber, die ich dann treffe, wissen sehr genau, was mich im Jahr 1630 erwartet, denn diese Zeit haben sie schon hinter sich. Wir nähern uns einander aus entgegengesetzten Richtungen – und ich bin der, der die Zusammenstöße vermeiden muss. Wenn ich erst einmal weiß, wer (oder was) hinter dieser Reise steckt, dann wird es mir auch leichter fallen, sie zu ertragen.
Ich werde mehr Tinte brauchen.
Ich kam nach London, weil ich dem Dreißigjährigen Krieg ausweichen wollte. Ich hatte keine Lust, mich mit diesem ganzen politischen Unsinn zu beschäftigen. In Europa wütet das Böse und trägt dabei wechselweise katholische oder protestantische Kleider, während sich England geschickt aus den Wirrungen heraushält.
Wenn man wie ich die Geschichte im Zeitraffer und zugleich im Rückwärtsgang erlebt, verliert vieles an Bedeutung. Ich verbringe in jedem Jahr nur einen Tag und werde dann schon wieder herausgerissen. So rast die Historie an mir vorbei und beraubt sich damit selbst ihrer Bedeutung. Warum sollte ich etwas ernst nehmen? Ein Menschenleben währet 70 Tage, und wenn‘s hoch kommt, so sind es 80 Tage, und am Ende bleibt nichts als Angst, Elend und Hoffnungslosigkeit. Es ist doch alles sinnlos. Jeder Lichtblick, den ich erhasche, verweist nur auf den nächsten Schatten.
Mitte diesen Jahres wird es beispielsweise so aussehen, als könnte der Friede von Prag zwischen dem Kaiser und den Sachsen den unseligen Konflikt der Konfessionen endlich zu einem guten Ende führen. Die Menschen schöpfen Hoffnung, Feste werden gefeiert und Freudentränen vergossen – aber ich weiß ja, dass das verheerende Chaos des Krieges noch 13 weitere Jahre durch die Länder ziehen und eine Spur des Elends hinterlassen wird. Der Friede ist nur von kurzer Dauer: Frankreich schlägt sich plötzlich auf die Seite der Schweden und erklärt Spanien den Krieg. Man kann nichts tun, als davonzulaufen.
Außerdem geht es all diesen heiligen Herrschern schon lange nicht mehr um den rechten Glauben. Sie benutzen die Religion, um ihren Einfluss zu vergrößern. Europa wird zu einem riesigen Sandkasten, in dem die verschiedenen Mächte gegen das Haus Habsburg im Burgenzerstören antreten und dabei beliebig viele „Ameisen“ zerstampfen.
Ich kam zum Glück rechtzeitig hier an. So früh, dass ich die vielen Schlachtfelder dieses barbarischen Krieges nicht mehr kreuzen musste, und so spät, dass ich mit der verheerenden Londoner Pestepidemie von 1665 nicht in Berührung kam. Das ist einer der Vorteile, wenn man in die Vergangenheit reist. Man weiß rechtzeitig, ob etwas Übles auf einen zukommt.
Heute Morgen bin ich früh in der zugigen Bauhütte aufgewacht, in der ich zur Zeit arbeite. Ein Bretterverschlag voller schnarchender Einzelgänger, in dem das Röcheln und Schnauben langer Arbeitstage weitergeht und mit dem knisternden Geräusch des Ofens konkurriert. Der Geruch alter, verschwitzter Kleider lehnt an der Wand und grinst einen an.
Natürlich gab es wieder verwirrte Blicke, wie jeden Morgen, wenn ich für alle überraschend in einer Gruppe auftauche: „Wo kommt denn der her? Was will der hier?“ Aber Handwerker sind zum Glück Zeitgenossen, die viel arbeiten und wenig fragen, wenn man sie in Ruhe lässt. Und ich sage ohnehin immer das Gleiche: „Ich bin heute Nacht eingetroffen, ich soll bei eurem Schaffner als Schreiber anfangen.“
Da ich in der Regel den Namen des Schaffners, der sich als Leiter der Bauhütte um die Abrechnungen kümmert, und einige seiner Bekannten schon aus der Zukunft kenne, fällt es mir nicht schwer, die verjüngten Arbeiter jeden Morgen neu von der Richtigkeit meines Daseins zu überzeugen. Manchmal erinnert sich dann jemand daran, dass ich schon vor einem Jahr für einen Tag mitgearbeitet habe, und runzelt die Stirn. Das verblüfft und verunsichert mich immer wieder. Die Tatsache, dass ich in die Vergangenheit reise, bedeutet natürlich auch, dass ich Menschen begegnen kann, die mit mir in vorhergehenden Jahren Erfahrungen gemacht haben, aber ich gewöhne mich nicht daran, mit den fragenden und wiedererkennenden Blicken richtig umzugehen. Es ist mir peinlich, nicht reagieren zu können. Bisweilen schließt mich sogar ein strahlender Fremder in die Arme, weil er sich freut, mich wieder zu sehen, und ich versuche dann, aus seinen Worten herauszuhören, was wir gemeinsam in seiner Vergangenheit erlebt haben. Gleichzeitig sehne ich mich nach diesen bescheidenen Augenblicken, weil sie mir vermitteln, dass ich nicht ganz ohne Beziehungen lebe.
Dass Van Dyck mir das Leben gerettet hat, war sicher die schönste Botschaft aus der Vergangenheit, die ich bisher erhalten habe. Meist vergessen die knurrigen und vor Dreck starrenden Bauarbeiter aber schnell, dass ich schon einmal einen Tag lang mit ihnen Arbeit und Nachtlager geteilt habe. Weggeschickt hat mich in all den Jahren jedenfalls noch keiner. Und wenn, dann wäre es auch nicht tragisch. Ein Kuriosum wie mich kann nichts mehr umwerfen. Schon gar nicht in London.
Hier fühle ich mich wohl. Erstens tut es mir gut, endlich wieder einmal in einer Großstadt zu sein – 420000 Einwohner findet man zu dieser Zeit nur selten –, und außerdem wird hier gebaut wie nie zuvor. Überall ragen die Gerippe halbfertiger Architektenträume aus dem Boden und schauen den Betrachter mit ihren hohlen Augen an. Nur die vielen herumwerkelnden Männer lassen hoffen, dass aus den Knochengerüsten bald mit Leben gefüllte Wesen werden. London erschafft sich neu. Da findet ein Tagelöhner leicht etwas zu essen und einen warmen Schlafplatz für die Nacht. Ganz gleich, wo man durch die Randgebiete dieser atmenden Stadt geht, man muss aufpassen, dass man nicht aus Versehen in eine Baugrube fällt. Erst nach dem September 1666, in dem 13000 Holzhäuser und 73 Kirchen von einer Feuersbrunst vernichtet werden, wird London wieder einer solchen Baustelle gleichen.
Mir bereitet es eine kleine Befriedigung, wenigstens für einen Tag im Jahr an etwas Bleibendem mitarbeiten zu können. Wenn mein Leben auf den Kopf gestellt ist, dann möchte ich zumindest in dem, was ich tue, Spuren hinterlassen. Darum höre ich sehr genau hin, was die Menschen erzählen, lausche, was sie beschäftigt und beeindruckt.
So wie ich es bei meiner Ankunft im Hafen getan habe. Und eines flüstert man dort in jeder Spelunke: Der Earl von Bedford baut den ehemaligen Garten der Westminster Abbey, Covent Garden, zu einer exklusiven Wohngegend um. Ein ehemaliger Klostergarten verwandelt sich in ein Nobelviertel. Davon hatte ich bereits in Antwerpen einige Fachleute schwärmen hören und mich deswegen nach der Bestätigung vor Ort direkt dorthin gewandt. Jetzt helfe ich mit, Covent Garden zu bauen, den Stadtteil, den ich früher bei keinem Londonbesuch ausgelassen habe. Das Einzige, was mich deprimiert, wenn ich längere Zeit auf einer Baustelle arbeite, ist die Tatsache, dass ich jeden Tag mit ansehen muss, wie die fast fertigen Gebäude sich wieder in ihre Einzelteile verwandeln. Auch wenn ich im Jahr 2000 zeigen könnte, welchen Stein ich zu einem Palast beigetragen habe, bin ich zur Zeit nur Zeuge des Abbaus. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, ist die Arbeit eines ganzen Jahres ungeschehen gemacht worden, und ich blicke traurig auf die bedauernswerten Gebilde, die ich ja schon fast vollendet betrachten durfte. Und dann frage ich mich natürlich um so mehr, warum etwas mit mir passiert, das scheinbar keinen Sinn ergibt.
Aber ich muss mehr über mich erzählen, sonst komme ich dem Geheimnis meiner Reise nicht auf die Spur. Leider weiß ich noch nicht, wie ich es anfangen soll. Am besten schreibe ich auf, was heute passiert ist, denn das ist ganz gewiss der erste Schritt gewesen.
Ich war heute Morgen sehr neugierig, wie und wann ich Van Dyck treffen würde, und zum ersten Mal seit langer Zeit lief ich wieder aufgeregt umher. Schon beim Frühstück, bei dem wir alle in der muffigen Bauhütte einen körnigen Brei hinunterschlangen, lehnte sich der Werkmeister, ein ungepflegter Kerl mit glasigen Augen, plötzlich mit einem triumphierenden Lächeln zurück und schlug mit einem Löffel gegen seine tönerne Schale: „Es wäre schön, wenn ihr faulen Säcke heute ausnahmsweise mal fleißig ausseht. Mister Jones kommt zu Besuch!“
Lautes Stöhnen ertönte. Ein Steinmetz, den ich aus den folgenden Jahren kannte, lachte künstlich und knurrte: „Es wird genauso ablaufen wie immer: Unserem Bau-Meister ist doch ohnehin alles zu verspielt, was wir machen. Es kotzt mich an. Erinnert ihr euch an das letzte Mal, als er die Ehre hatte, uns zu visitieren:, Ich wünsche schlichtere Formen, klar, streng und nobel. Nicht diese katholische Überfrachtung.‘ Und dann erzählt er wieder stundenlang von Palladio., Lasst es uns machen wie Palladio!‘ Palladio holladio! Ich kann es nicht mehr hören. Palladio, der große Wiederentdecker der alten Formen. Palladio hier, Palladio da. Warum ist Mister Jones nicht in Venedig oder Rom geblieben, wenn ihm der antike Kram der Vorgeschichte besser gefällt als die künstlerischen Formen unserer Zeit!“
Der Werkmeister rülpste genüsslich, und man sah ihm an, dass er die Meinung des aufgebrachten Handwerkers zwar teilte, aber schon kannte. In diesem Moment öffnete sich der mit groben Latten versperrte Eingang ein Stück und Van Dyck blickte in den Raum. Er rümpfte die Nase und blieb in der halboffenen Tür stehen, sodass der Wind ungehindert durch den Raum ziehen konnte. Herrisch fragte er: „Ist Inigo Jones schon hier gewesen?“
Der Werkmeister sprang auf, wischte sich die Hände an der Hose ab und machte einen Schritt auf den Maler zu, was diesen unwillkürlich zurückweichen ließ.
„Er wird jeden Augenblick hier sein, Sir!“
„Wenn er kommt, sag ihm, dass ich vor dem Kirchenportal auf ihn warte!“
„Gerne, Sir, äh, Sir …“ Der diensteifrige Vorarbeiter öffnete überraschend den Mund zu einem breiten Grinsen, bei dem eine Reihe abgebrochener Zähne sichtbar wurde. „Man sagt, Ihr macht nicht nur religiöse Bilder, sondern seid auch ein Meister der erotischen Malerei. Könntet Ihr nicht einmal eine unverhüllte Schönheit auf die Wand unserer kleinen Hütte hier malen? Eine mit großen … na, Ihr wisst schon. Warum guckt Ihr denn so? Eine keusche Jungfrau natürlich!“
Die Männer krümmten sich vor Lachen, während Van Dyck rot anlief und wortlos die Tür hinter sich zuschlug. Der Werkmeister prustete: „Na, das geschieht ihm recht, dem eingebildeten Laffen. Dem Ritter im feinen Zwirn. Habt ihr sein Gesicht gesehen? Wie ein Pferd mit Durchfall.“
Wieder grölten die Männer, und es gelang mir, mich durch die derbe Heiterkeit nach draußen zu schleichen. Van Dyck stand neben dem kleinen Verschlag mit den Werkzeugen, puderte sich erregt die Nase und blickte mit verspanntem Hals in die Ferne.
Da er mir an Bord der „Marian“ erzählt hatte, wie das Bild aussah, das er von mir malen würde, sprach ich ihn vorsichtig an: „Entschuldigt meine Unverfrorenheit, Sir, aber ich würde mich gerne als Modell zur Verfügung stellen.“
Er musterte mich von oben bis unten und verzog dann den Mund zu einem verächtlichen Grinsen: „Wofür? Für den Esel in einem Krippenbild?“
Idiot, dachte ich. „Nein, Sir, für irgendein Bild eben!“
Er hustete in ein spitzenbesetztes weißes Taschentuch und sagte dann mit drohendem Unterton: „Hör zu. Die eine Hälfte Londons möchte von mir gemalt werden und wartet darauf, dass ich für sie Zeit habe. Die andere Hälfte möchte das auch, kann es aber nicht bezahlen. Ich werde also für einen Habenichts wie dich keine Leinwand verschwenden. Und jetzt lass mich in Ruhe.“
Er drehte sich demonstrativ um und sah nach einer halben Minute erstaunt in meine Richtung, weil ich immer noch am gleichen Fleck stand.
„Ich habe gesagt, du sollst verschwinden!“
„Ich kann in die Zukunft sehen!“
„Ach! Und die Erde ist eine Kugel, die um die Sonne fliegt! Gibt es eigentlich überall nur noch Verrückte?“
Er blickte mich verächtlich an und ging Richtung Baustelle davon. Mir wurde mulmig. Eigentlich war ich immer bemüht gewesen, mich aus der Geschichte herauszuhalten. Was sollte ich jetzt machen? Ich hatte von Anfang an große Angst, dass ich Einfluss auf Dinge nehmen könnte, die den Lauf der Welt verändern. Ein scheinbar belangloses Wort zur falschen Zeit ist in der Lage, alles durcheinander zu bringen. Jemand ändert seine Meinung, geht einen neuen Weg oder bekommt Angst – und plötzlich schlägt die Geschichte einen neuen Kurs ein.
Wobei ich ehrlicherweise sagen sollte, dass ich nicht immer so vorsichtig gewesen bin. Zu Beginn meiner Reise in die Vergangenheit habe ich zum Beispiel eine Zeit lang mit dem Gedanken gespielt, Adolf Hitler zu töten. Es wäre ein Leichtes gewesen, dem Säugling oder dem Schulkind Adolf aufzulauern und das Jahrhundert etwas menschlicher zu machen. Aber dann wurde ich unsicher, denn ich wusste nicht, ob das überhaupt funktionieren würde. Ich hatte meine Reise ja zu einer Zeit begonnen, in der bereits bekannt war, wie das Dritte Reich verlaufen würde. Außerdem: Wer gab mir das Recht, mich zum Richter aufzuspielen? Ich hätte vielleicht nicht so viel grübeln sollen. Tatsache ist: Ich brachte es nicht fertig. Zumindest habe ich mir das damals eingebildet.
Wahrscheinlich ist der eigentliche Grund aber viel schlichter: Ich war zu feige. Ich wollte die Verantwortung nicht übernehmen. Das war noch nie meine Stärke gewesen. Ich konnte ja noch nicht einmal Entscheidungen für mich selbst fällen, wie sollte ich es dann für die Weltgeschichte tun? Im jetzigen Fall allerdings wusste ich auf Grund unseres Zusammentreffens auf der „Marian“, dass ich Van Dyck näher kennen lernen würde, also lief ich ihm nach.
„Sir, schaut mich doch einmal in Ruhe an. Vielleicht fällt Euch ja doch eine Möglichkeit ein, mich zu verwenden.“
Er drehte den Kopf angewidert über die Schulter, spielte mit der Kette, die über seinem Wams hing, und winkte zwei Maurer heran. „Haltet mir diesen Irren vom Leib.“
Ehe ich mich versah, packten mich die Männer und zogen mich zur Seite. Ich rief, so laut ich konnte: „Ihr werdet ein Bild malen, Sir. Darauf sieht man den König mit Reitknecht und Page. Ich kann es Euch beschreiben.“
Die Maurer waren einen Augenblick unachtsam, sodass ich mich losreißen und auf Van Dyck zulaufen konnte. Als ich ihn fast erreicht hatte, traf mich ein schwerer Schlag von hinten, und ich verlor das Bewusstsein.
Als ich wieder zu mir kam, lag ich auf einem Strohsack in einem großen Saal. An den Wänden standen und lagen unzählige halbfertige Bilder, die das gezackte Tapetenmuster verdeckten. In der Mitte des Raumes stand eine Staffelei, die von der anderen Seite durch unzählige Kerzen erhellt war.
Van Dyck musste eine meiner Bewegungen gehört haben, denn er kam hinter der Leinwand hervor und blendete mich mit einer Kerze, die unter einem Glassturz stand, sodass ich die Augen zusammenkneifen musste. Er betrachtete mich eine Zeit lang kritisch, dann murmelte er: „Beschreibe dieses Bild, von dem du gesprochen hast!“
Ich schluckte und versuchte, mich daran zu erinnern, was der Künstler mir über das Bild erzählt hatte. Ich richtete mich auf, sackte aber wieder zusammen, als ein stechender Schmerz durch meinen Kopf fuhr.
Leise sagte ich: „Das Bild zeigt auf der linken Seite den König mit seinem Degen und einem Spazierstock. Auf der rechten Seite steht ein Pferd, das so aussieht, als ob es lacht. Ein Reitknecht hat seinen Arm auf den Rücken des Tieres gelegt, während ein junger Mann hinter ihm gedankenverloren, nein, eher fragend, in die Ferne schaut.“
Die Augen des Malers verengten sich: „Welche Farbe hat das Pferd?“
„Es ist weiß!“
„Welche Farbe hat die Hose des Königs?
„Sie ist rot!“
Van Dyck packte mich brutal am Ärmel und zog mich hoch. Er stieß mich so schnell vorwärts, dass ich fast gestolpert wäre. Plötzlich griff seine Hand in meine Haare und drehte meinen Kopf zu dem Bild, an dem er eben gearbeitet hatte.
„Wie bist du hier hereingekommen?“
Ich schwieg. Auf der Staffelei stand das Gemälde von König Charles. Es sah eigentlich genau so aus, wie ich es beschrieben hatte, obwohl das Licht aus einem anderen Winkel zu kommen schien. Erst auf den zweiten Blick entdeckte ich den entscheidenden Unterschied: Auf der Leinwand waren nur der König und der Reitknecht zu sehen. Ich in Gestalt des jungen Mannes fehlte darauf.
Van Dyck schüttelte mich: „Niemand darf meine Bilder betrachten, bevor sie fertig sind. Ich hasse das, hörst du, ich ertrage es nicht. Das wissen sogar meine geringsten Diener. Also: Wie bist du hier hereingekommen?“
Ich packte seinen Arm und befreite mich aus dem schmerzhaften Griff.
„Sir, ich habe offensichtlich das falsche Bild beschrieben. Also kann ich nicht hier gewesen sein. Auf diesem Gemälde sind nur zwei Männer, ich habe aber von dreien gesprochen. Auf meinem Bild sieht man drei Männer. Hier fehlt der Dritte – Ihr seid also, mit Verlaub, im Irrtum. Ich weiß auch gar nicht, warum Ihr Euch so aufregt …“
Van Dyck starrte ins Leere. Er hatte meine Worte ignoriert, darum hörte ich auf zu reden und blickte in sein konzentriertes Gesicht. Unbewusst massierte er sich mit der linken Hand das Ohrläppchen. Er nahm ein Stück Kohle vom Tisch und begann, mit schnellen Strichen etwas zu skizzieren.
Nach einigen Minuten murmelte er leise vor sich hin: „Nicht zwei Figuren, nein, drei, das ist gut, das ist richtig gut. Drei Personen, drei Elemente und Ideen, die irgendwie zusammengehören: Geist, Seele und Körper. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Denken, Träumen und Handeln. Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart. Drei in einem. Drei Männer können zusammen die ganze Welt sehen, jeder 120 Grad. Jeder braucht die anderen und doch herrscht einer über sie. Er verkörpert die Macht des Augenblicks, die Herrschaft des Hier und Heute. Denn die Gegenwart ist die Königin des Seins. Darum muss einer dem Betrachter ins Gesicht sehen. Er, der König, der oberste Regent der Gegenwart, ragt heraus – er ist präsent, er bestimmt, er hat das Jetzt im Griff, während die anderen nach vorne und zurück schauen und darin versinken. Das gegenwärtige Sein steht im Vordergrund, der Blick zum Morgen ist der Blick des aktiven Arbeiters, während der gut gekleidete Page ins Gestern schaut. Die Vergangenheit steht im Hintergrund, die Zukunft bleibt der Gegenwart ebenbürtig, doch von ihr abhängig. Das Licht kommt von schräg hinten, es strahlt auf den Herrscher, der aber seinerseits den wärmenden Mantel des Pagen braucht, wenn er nicht erfrieren will. Es ist kalt ohne Vergangenheit. Und man kommt nicht vorwärts, wenn einem nicht die Träume mit schnellen Hufen voraneilen. Darum hat die Zukunft mit ihrem schattigen Gesicht ein schnelles Reittier an der Hand. Das ist der Lauf der Zeit. Stell dich da hin!“
Er deutete bestimmt auf einen Punkt hinter der Staffelei und wandte sich zu seiner Palette, die auf einem kleinen Schemel lag und im Licht der Kerzen glitzerte.
Ich verstand ihn nicht sofort: „Was ist los?“
Der Maler wiederholte seine Bewegung: „Du hast Recht. Ich weiß nicht warum, aber du hast Recht. Das Bild stimmt so, wie es jetzt ist, nicht. Seit Tagen überlege ich, was mir nicht gelungen ist, warum es mir nicht gefällt. Jetzt weiß ich es: Das Entscheidende fehlte. Zwei Figuren zeigen immer ein Gegeneinander, wenn es drei sind, beginnt das Ganze zu leben. Ich mache aus einem Königsporträt ein Meisterwerk über die Zeit. Zwischen Hell und Dunkel, zwischen die leuchtende Gegenwart und die fordernde Zukunft, zwischen König und Reitknecht drängt sich der fahle Schein dessen, der weiß, wo alles herkommt. Denn was ist die Gegenwart ohne die Vergangenheit? Ich werde dich in das Bild einbauen. Du bist die Vergangenheit. Ich muss dich allerdings kleiner malen als in der Realität, denn du bist ja fast einen ganzen Kopf größer als der König, aber das bekomme ich schon hin. Also, stell dich da hin!“
„Nein!“
Van Dyck blickte auf, als habe er ein Wort vernommen, das noch nie an sein Ohr gedrungen war.
„Bist du wahnsinnig geworden? Vorhin wolltest du unbedingt …“
„Ich bin gern bereit, Modell zu stehen, ich stelle nur eine Bedingung: Ich will euch dabei eine Geschichte erzählen dürfen.“
Der Maler hob die Augenbrauen: „Normalerweise bevorzuge ich zwar Musik beim Arbeiten, aber wenn du beim Erzählen einigermaßen ruhig stehen bleiben kannst, soll es mir recht sein.“
So verharrte ich, Stunde um Stunde, und blickte zurück in die Zeit, in meine Zeit, in die Jahrhunderte, die der Welt noch bevorstanden. Und ich ließ all das hervorströmen, was mir seit nunmehr 365 erlebten Jahren den Verstand rauben wollte, meine ganze Angst, meine Ruhelosigkeit und meine Verzweiflung.
Irgendwann hörte Van Dyck auf zu arbeiten und ließ uns etwas zu essen bringen. Er, der große Hofkünstler, das Wunderkind, das schon als junger Mann oberster Assistent von Peter Paul Rubens war, lauschte einem ratlosen Bauarbeiter, der durch widrige Umstände in sein Atelier gekommen war. Ich hatte ihm geholfen, er half mir. Und es tat unendlich gut, zu schimpfen, zu wüten, zu schreien, zu weinen und diesen Sack voller Fragen, der sich während meines selbst verordneten Schweigens in meiner Seele angefüllt hatte, zu öffnen.
Anfangs war der Drang, Worte zu finden, so groß, dass meine Erlebnisse wohl sehr wirr geklungen haben müssen. Ich holte Erinnerungen und Gefühle aus 365 Jahren hervor und warf sie meinem ersten Zuhörer hin.
Van Dyck ließ mich gewähren, zwei, vielleicht drei Stunden lang. Dann unterbrach mich der Künstler das erste Mal, sehr vorsichtig, ja fast zärtlich: „Wie fing alles an?“
1999 Ich kann mich noch an die Farbe des Kleides von Anna erinnern. Ein dunkles Blau mit eingesponnenen Silberfäden. Sie hatte es schon im vergangenen Jahr an Silvester getragen, weil ich es liebte, ihren nackten Rücken zu betrachten. Ich traf sie vor dem Haus, als sie gerade aus ihrem Polo stieg. (Van Dyck stutzte, also sagte ich: „Eine Kutsche ohne Pferde“.) Ich hatte nicht gewusst, dass sie auch zu dieser Party („Hofball“) kommen würde, und fühlte mich unbehaglich. Aber wenn man sich nach fünf Jahren trennt, hat man nun einmal noch einige Zeit den gleichen Freundeskreis.
Anna war unsere Beziehung nach einiger Zeit zu eng geworden, meine Lust am Heiraten, meine enge Welt der Altphilologie („Magister der alten Sprachen“), mein Eingebundensein in die „existenzverneinende“ Welt der Universität, wie sie es immer nannte, das Dahinvegetieren mit einer halben Assistentenstelle („Dasein als Adlatus“), mein zusätzliches Jobben auf dem Bau („Arbeit im Baugewerbe“), meine fruchtlose Forschungsarbeit über den „Humor als Mittel der Zeitkritik. Sprachmuster in den Satiren Lukians“, in der ich nachweisen wollte, dass der feixende Dichter des zweiten Jahrhunderts bewusst die erzählerischen Traditionen seiner Epoche aufgenommen hatte, um durch diese Verfremdungen die damaligen Stil- und Kunstformen als Farce zu entlarven.
Anna fand, dieses Thema sei reine Zeitverschwendung, Lebensverschwendung. Immer wieder fragte sie gehässig: „Was wird sich in der Welt ändern, wenn dein Buch erscheint? Gibt es nur einen Menschen, der dadurch ein bisschen glücklicher wird?“
„Ich!“, sagte ich dann beleidigt, aber das war zu einer Zeit, als wir schon anfingen, unsere Argumente zu wiederholen. Ich wusste, was ihr an mir missfiel, sie wusste, was mir an ihr missfiel, und keiner von uns dachte daran, etwas Grundlegendes zu ändern.
Nein, das stimmt nicht. Wir litten beide unter den andauernden Streitereien, die sich immer an Kleinigkeiten aufhingen und dann mit Tränen endeten, aber trotzdem machte keiner den ersten Schritt zu einer Verbesserung der Situation. Denn es gab immer wieder wundervolle Momente, in denen wir das Gleiche dachten und fühlten. Aber sie wurden seltener. Wäre es nach mir gegangen, hätte sich wahrscheinlich nie etwas geändert, doch dann fand Anna, es sei einfach Zeit, die Beziehung zu beenden, bevor ich sie mit in mein „selbstgeschaufeltes Akademikergrab“ zöge. Wäre unsere Trennung zu dieser Zeit nicht erst drei Monate her gewesen, drei Monate voller Selbstmitleid und Zerknirschung, dann hätte ich sicherlich anders reagiert.
„Was machst du denn hier?“, fuhr ich sie unfreundlicher an, als ich wollte. Anna wühlte noch einen Augenblick im Handschuhfach und schlug dann die Tür fester zu, als nötig gewesen wäre.
„Karsten gehört zu meinen Freunden, falls du das vergessen hast“, blaffte sie zurück. Damit hatte sie zweifelsohne Recht. „Außerdem kann ich den Jahrtausendwechsel feiern, mit wem ich will. Schließlich habe ich die letzten vier Jahre auch in diesem Kreis gefeiert.“
„Schon gut, entschuldige. War nicht so gemeint. Ich … äh … wusstest du, dass ich auch eingeladen bin?“
Sie hatte sich wieder gefangen und sah mich herausfordernd an: „Ja, ich dachte, wir wollten Freunde bleiben, da werden wir doch ohne Streit auf diese Party gehen können. Letztes Jahr ging es ja auch.“
Sehr lustig, dachte ich, da waren wir ja auch noch zusammen!
Mir fiel nichts mehr ein, obwohl ich seit unserer Trennung in meiner Fantasie sicherlich hundert Gespräche mit ihr geführt hatte, in denen ich ihr endlich all das sagen konnte, wofür mir in ihrer Gegenwart die Worte fehlten. Sie blickte ein bisschen mitleidig auf meinen alten Anzug, rückte den Träger ihres Kleides zurecht und ging vor mir ins Haus.
Ich war sehr melancholisch an diesem Abend. Vor allem, weil mein Blick immer Anna suchte. Für mich schien sie unübersehbar. Anna lachend mit einem Glas Sekt in der Hand. Anna mit einer Rose im Haar, die ihr ein angetrunkener Kollege dorthin gesteckt hatte. Dabei wusste ich genau, dass sie sich nichts aus Blumen machte. Sie war eines Tages damit herausgerückt, nachdem ich sie wochenlang mit Rosen überschüttet hatte, die immer wortlos in eine Ecke gestellt wurden. Anna mit attraktiven Männern, in ein angeregtes Gespräch vertieft. Anna mit diesem glücklichen Lachen, das wie eine sanfte Welle über ihr Gesicht floss und alle Ängste und Trübungen mit sich nahm, dieses Lachen, von dem ich immer geglaubt hatte, es sei nur für mich bestimmt. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass sie und ihr jeweiliges Gegenüber die Einzigen waren, die diesen Abend genossen.
Karsten zog mich nach dem Essen in die Küche, hielt mir einen Teller mit Käse hin und setzte eine aufmunternde Miene auf: „Sie macht das, weil sie traurig ist.“
„Na, so sieht sie aber nicht aus! Sie scheint sich prächtig zu amüsieren.“
Er musterte mich, als müsse er überlegen, was er jetzt am besten sagen könnte. Schließlich meinte er optimistisch: „Ich bin sicher, dass sie ihren Entschluss bereut.“
„Da habe ich aber was ganz anderes gehört!“
„Du meinst die Geschichte mit Frank? Das ist doch schon längst wieder vorbei. Sie war traurig, und er hat sie getröstet. Was glaubst du, wie viele Beziehungen auf diesem Wege entstehen? Aber so blöd ist Anna nicht. Die hat schnell genug gemerkt, dass man nicht so einfach eine neue Beziehung anfangen kann. Weißt du übrigens, was das Verrückte an neuen Beziehungen ist?“
Ich wollte in diesem Augenblick weder weise Ratschläge noch Unterhaltung, fand es aber unhöflich, nicht zu antworten. Also sagte ich mürrisch: „Nein!“
Karsten lachte: „50 Prozent davon sind auf jeden Fall alt, denn du bist wieder dabei! Klever, gell? Habe ich neulich irgendwo gehört. Aber mal ganz im Ernst. Wenn du Anna noch liebst, dann solltest du dir ein bisschen mehr Mühe geben!“
„Und was heißt das konkret, Dr.Sommer?“
Er senkte verschwörerisch die Stimme, konnte aber ein Lächeln nicht unterdrücken: „Was meinst du, warum sie dein Lieblingskleid anhat? Geh ran, sie wartet doch nur darauf.“
„Na, ich weiß nicht!“
Ich war an diesem Abend nicht zum Flirten aufgelegt. Alles wirkte trübe und undurchsichtig. Die Party, die Menschen, die Gespräche und das Gelächter, das wieselflink durch den Raum stob, um sich dann hinter einem der Bücherregale zu verstecken. Ich trieb in diesem zerfaserten Dasein wie eine Qualle, die vergeblich gegen die Meeresströmungen ankämpft. Irgendwie zerrann die Zeit in meinen Händen. An der Ursache gab es keinen Zweifel: Es war der Silvesterabend 1999.
Natürlich wusste ich, dass der Jahrtausendwechsel ein willkürliches Datum ist, bei dem sich die Historiker wahrscheinlich so oft verrechnet haben, dass wir eigentlich 2000 Jahre nach der Einschulung Jesu feiern. (Van Dyck hob die Augenbrauen.) Und trotzdem bekam ich plötzlich Angst, dass Anna Recht haben könnte.
Wozu brauchte die Welt eine Arbeit über den Humor Lukians? Und hatte nicht auch meine Mutter Recht, die bei allen Familientreffen spitz fragte, wann denn ihr 35jähriger Sohn gedenke, gediegen und anständig zu werden. Für sie hieß das vor allem eines: Enkelkinder zeugen. Plötzlich schien alles, wofür ich bisher gearbeitet hatte, so unwichtig zu sein. Als würde eine ausgehungerte Zecke mit einem Mal ahnen, dass die Welt doch aus mehr als aus Wärme und Buttersäure besteht. Ich fühlte mich verloren.
Karsten versuchte mehrfach, mich zu Anna zu schicken, aber ich saß den ganzen Abend lang stumm in einer Ecke und tat so, als würde mich seine CD-Sammlung („Verewigte Musik“) ungemein interessieren.
Um fünf vor zwölf knallten im ganzen Haus die Korken der Sektflaschen („Champagner“), und wir liefen mit unseren Gläsern in den kleinen Garten, um zu sehen, wie sich die Nacht über uns in ein Lichtermeer verwandelte. Frankfurt im Glanz der Verschwendung. Die Stadt hieß das neue Jahrtausend willkommen. Mir war schlecht. Eine Minute vor zwölf nahmen wir uns an den Händen, nein, man nahm sich an den Händen, denn auf einmal stand Anna neben mir, und wir zählten miteinander die Sekunden von 60 bis 0.
Es war ein langer Abschied. Ich sehnte mich ganz weit weg, hätte aber niemals sagen können, wohin. 35 Jahre zerrten wie eine einzige Frage an mir, und ich war nicht in der Lage, sie zu beantworten. Ich erinnere mich noch, dass mir in diesem Moment der Gedanke durch den Kopf schoss, ob ich wohl jemals trauriger gewesen war.
Vor allem, als mir auffiel, dass Anna und ich diesmal um null Uhr zusammen sein würden. Trotz unserer gescheiterten Beziehung. Im vergangenen Jahr, als wir noch ein Paar gewesen waren, hatten wir uns nämlich beide so intensiv mit verschiedenen Bekannten unterhalten, dass wir den eigentlichen Jahreswechsel getrennt verbrachten. Sie hatte im Garten gestanden, ich vor dem Haus, und jeder hatte dickköpfig darauf gewartet, dass der andere sich auf den Weg machte. Vor Wut war ich daraufhin erst einmal für zehn Minuten auf der Toilette verschwunden, um meiner Freundin aus dem Weg zu gehen. Und sie hatte später so getan, als sei nichts gewesen.
Aber das ist eben Anna, so war Anna, nein, so wird Anna sein: Sie ignoriert alles, was ihr nicht passt. Und irgendwann, schon drei Monate lang, genauer gesagt, gehörte eben auch ich zu den Dingen, die sie übersah.
Die Stimmen wurden lauter, denn jetzt blieben nur noch zehn Sekunden bis zum neuen Jahrtausend. Zehn, neun, acht … Es war, als würde mein Leben ausgezählt, der geschlagene Kämpfer liegt am Boden, ohne zu wissen, gegen wen er verloren hat, und der Schiedsrichter lässt die Zahlen über diese Niederlage triumphieren. Sieben, sechs, fünf … Die anderen Gäste strahlten sich an und mir wurde schwarz vor Augen. Vier, drei … Ich musste mich an Anna festhalten, deren vor Freude geöffneter Mund bei einem kurzen klaren Blick so aussah, als wollte er mich verschlingen. Ich war wie in einem Vollrausch, dabei hatte ich den ganzen Abend nur ein Glas Wein getrunken. Zwei, eins, null …
Ich spürte, wie etwas zerbrach. Irgendwo in mir. Ein störendes Knacken, lautlos und doch so, als ginge nun ein Riss durch mich hindurch oder als hätte ich einen Sprung bekommen. Einen Augenblick lang hatte ich das Gefühl, ich fiele ins Nichts, stürzte haltlos in den Abgrund. Ich habe keine Ahnung, wie lange dieser Zustand dauerte. Es passierte einfach – und es zog vorüber. Denn plötzlich war das, was den ganzen Abend von mir Besitz ergriffen hatte, wieder verschwunden. Als hätte jemand den auf das Opfer zurollenden Bagger einfrieren lassen oder einen Film angehalten.
Die Eindrücke, die eben noch wie eine Lawine über mich hereinzustürzen drohten, waren wie weggewischt. Ein angehaltenes Uhrenpendel, ein ausgeschalteter Presslufthammer, ein gefallener Bühnenvorhang. Ich war wieder ich. Ich atmete erleichtert die kalte Nachtluft ein und blickte in die Runde.
Anna fiel mir um den Hals und küsste mich auf den Mund, weich und einladend. Ich runzelte die Stirn.
„Hey, was ist?“, fragte sie und beugte sich ein wenig zurück. „Sei doch nicht immer so ernst. Ein frohes neues Jahr!“
„Ein frohes neues Jahr“, murmelte ich und wollte mich von ihr lösen, aber sie umschlang mich schon wieder, drückte ihre Brüste sinnlich gegen meinen Oberkörper und knabberte an meiner Unterlippe. Ich war so verblüfft, dass ich sie einfach gewähren ließ. Irgendetwas lief hier falsch. Sie streichelte meinen Rücken, schmiegte sich an mich und blitzte mich mit ihren grünen Augen verheißungsvoll an.
„Freust du dich auf das neue Jahr?“
„Na, ich weiß nicht so recht.“
Ein Hauch von Ärger zog über ihr Gesicht, aber ehe sie sich aufregen konnte, kamen Freunde und Bekannte von allen Seiten herbeigeströmt, um mit uns anzustoßen. Alle waren so gut gelaunt, dass ich mich anstecken ließ. Einige Freunde hatte ich den ganzen Abend über noch gar nicht wahrgenommen und ich fand es lustig, die ewig gleichen Sprüche zu hören. Alles schien wieder in Ordnung zu sein.
„Hallo, Max, ein gutes neues!“
Jemand klopfte mir auf die Schulter und hielt sich dann daran fest. Ich drehte mich um – und da stand Thomas. Jetzt wurde mir endgültig flau. Meine Gedanken zuckten wie Fische in einem Netz.
Thomas war ein Freund, mit dem ich schon als Schüler die örtliche Pfadfindergruppe unsicher gemacht hatte; der hoch aufgeschossene Verfahrenstechniker mit dem kleinen, unverkennbaren Muttermal am Kinn. Er stand da und grinste. Ich stand da und gefror innerlich. Wie eine Dunstglocke umhüllten mich die aufgeregten Stimmen der Freunde, wurden immer dumpfer und sperrten mich in mir ein.
Vor mir stand Thomas. Ich war im Juni bei seiner Beerdigung gewesen. Mit all den Leuten, die hier um uns feierten. Aber das schien niemandem außer mir aufzufallen. Ein widerlicher Unfall. Thomas war bei einer Nachtfahrt auf gerader Strecke mit dem Motorrad von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum gefahren. Keiner konnte sich erklären, wie es dazu gekommen war, denn er hatte jahrelang während des Studiums als Testfahrer für BMW gearbeitet und wusste, wie man mit schweren Maschinen umging.
Ich war bei der Trauerfeier nach vielen Jahren zum ersten Mal wieder in Tränen ausgebrochen, als ein ehemaliger Mitschüler einen melancholischen Gospel angestimmt hatte. Die Familie hatte später entschieden, dass ich einige altsprachliche Bücher und zwei Lexika von Thomas bekommen sollte. Sie standen seither direkt neben meinem Schreibtisch und erinnerten mich jeden Tag an ihn. Ich musste schlucken und brachte kein Wort heraus. Thomas dagegen war völlig entspannt.
„Na, ihr zwei Hübschen. Was machen denn die Heiratspläne? Ist es dieses Jahr endlich soweit? So etwas nimmt man sich doch an Silvester vor, oder nicht?“
Er zwickte Anna in die Seite, die sich kichernd nach vorne beugte. Sie druckste herum: „Na, alles zu seiner Zeit.“
„Max, was ist denn los? Du siehst aus, als ginge es dir nicht gut.“
Ich ertrug die Situation nicht mehr und rannte davon: „Entschuldigt mich einen Augenblick!“
Ich lief ins Haus, um mich zum Nachdenken auf die Toilette zu verziehen, wie ich es in solchen Momenten immer tue, gerade dann, wenn mich Panik überkommt. Es gibt Zeiten, in denen ich für mich sein muss. Und dieser Alptraum war Grund genug.
Aber ich kam nicht dazu. Denn als ich mich an den Resten des Büfetts vorbeigezwängt, einem halben Dutzend Freunden gequält ein gutes neues Jahr gewünscht und mich zum Flur durchgekämpft hatte, verlor ich völlig die Kontrolle über meinen Verstand. Normalerweise bin ich nicht leicht zu erschüttern, aber diesmal durchzog mich ein kalter Schauder, der nicht aufhören wollte. Mein Herz raste.
Es hatte auch allen Grund dazu: Im Gang stand ich! Ich selbst! Der, den ich sonst nur im Spiegel erblickte. Ich sah mich in angeregtem Gespräch vor der Tür zum Badezimmer stehen, etwa dreieinhalb Meter von mir entfernt. Da lehnte ich an der Wand und plauderte mit einer hübschen Brünetten, die schon im Jahr zuvor auf der Party gewesen war. Ich glaube, sie hieß Julia, aber das war mir in diesem Augenblick völlig gleichgültig.
Ich weiß nicht, ob irgendjemand verstehen kann, was da geschah: Ich sah mich als mein Gegenüber. Zum ersten Mal in meinem Leben begegnete ich mir selbst. Und als ich in den großen Spiegel neben der Eingangstür blickte, stand ich tatsächlich zweimal da. Ich wollte schreien – und konnte nicht. Ab da weiß ich kaum noch, was geschah.
Da sich mein anderes Ich in diesem Moment suchend umdrehte, ließ ich mich zwischen die Jacken und Mäntel an der Garderobe fallen und versuchte verzweifelt, meinen Herzschlag wieder unter Kontrolle zu bekommen. Was ist los? Was ist los? Was passiert hier? hämmerte es in mir, während ich flach und schnell atmete. Bevor ich auch nur eine irgendwie geartete Antwort zuließ, nahm ich völlig verstört meinen Mantel und rannte hinaus. Nach einigem Suchen fand ich an einem Taxistand einen einsam vom Widerschein der Raketen glitzernden Wagen und ließ mich völlig fassungslos auf die Rückbank gleiten.
„Ein gesegnetes Jahr 1999“, sagte der Taxifahrer.