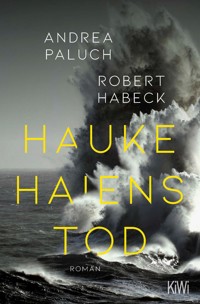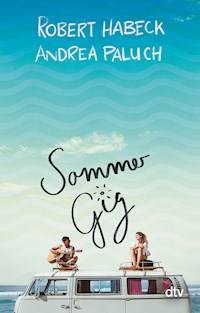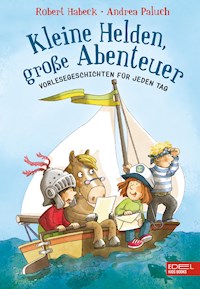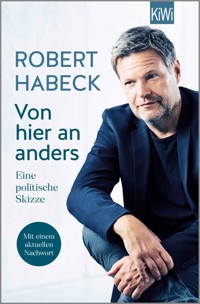8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Eine Reise zu sich selbst Der letzte Sommer vor dem Abitur soll etwas Besonderes werden. Max will per Segelschiff und ohne Geld nach Finnland. Svenja und Ole schließen sich auf einem zweiten Weg trampend auf Güterzügen an. In Tornio wollen die drei sich treffen, nicht ahnend, dass sie am Ende ihrer Reise nicht mehr dieselben sein werden. Svenja ist mit Ole zusammen, jedoch heimlich in Max verliebt. Ole weiß nichts von Svenjas Gefühlen für Max, will sich aber nach dem Urlaub von ihr trennen. Und Max hat nach dem Suizid seiner Zwillingsschwester vor, niemals in Finnland anzukommen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch
Der letzte Sommer vor dem Abitur soll etwas Besonderes werden. Max will per Segelschiff und ohne Geld nach Finnland. Svenja und Ole treten die Reise als blinde Passagiere in Güterzügen an. In Tornio wollen die drei sich treffen, doch der Weg dorthin wird sie für immer verändern. Svenja ist mit Ole zusammen, fühlt sich jedoch auch zu Max hingezogen. Ole weiß nichts von Svenjas Gefühlen für Max, will sich aber nach dem Urlaub von ihr trennen. Und Max weiß nicht, ob er jemals in Finnland ankommen will …
Aber es ist nicht gut,
sich bei einer einzigen Sehweise aufzuhalten,
und es ist schwer, sich mit ihr zu begnügen,
sich vielleicht des Widerspruchs der subtilsten
aller geistigen Kräfte zu berauben.
Bisher wurde nur eine Denkweise dargelegt.
Es gilt aber zu leben.
Albert Camus,
Der Mythos von Sisyphos
Ein Versuch über das Absurde
I.
Ich setzte den letzten Punkt hinter das letzte Wort, das ich in diesem Schuljahr schreiben würde. Aber ich legte die Blätter nicht zusammen, sondern starrte auf die drei viertel volle Seite. Das war’s. Das war die letzte Abi-Vorklausur und es hatte gar nicht wehgetan. Ich blickte auf die Schrift, die meine Hand auf dem Papier hinterlassen hatte, und wusste, ich würde es nicht noch einmal lesen. Egal, was uns die Lehrer sagten. Und dass vieles leider nicht stimmte, jedenfalls in dieser Bio-Klausur, darüber war ich mir im Klaren. Aber man muss glauben, es würde stimmen. Darauf kommt es an. Man muss an seine Möglichkeiten glauben. Man muss sie suchen, finden, erkennen, die Möglichkeiten, die Ordnung hinter der Ordnung. So versuchte ich in dem Muster aus Tinte und liniertem Raum einen höheren Sinn zu sehen. Einen höheren Sinn zu sehen, das bedeutete, nicht zu lesen, sondern sich den unscharfen Blick anzueignen. Der unscharfe Blick bedeutete in diesem Fall, dass man einen unsichtbaren Punkt irgendwo unter der Tischplatte, vielleicht sogar unter dem Fußboden mit seinem rostroten Kurzhaarteppich anpeilen musste. Und plötzlich, als wäre es ein dechiffrierter Code, sah ich den Weg, den ich gehen musste, ohne auf die Linien zu treten.
Neben mir schnaufte Michael. Irgendwie hatten seine Eltern immer auf homöopathische Kügelchen vertraut und ihm nie die Wucherungen aus der Nase ziehen lassen. Irgendwann würde sich das von selbst verwachsen, hatten sie geglaubt. Nun war irgendwann und er hatte uns schon drei Klassenfahrten und viele postalkoholische Fetennächte mit seinem Schnarchen wach gehalten. Vorne saß Franziska Schulte, unsere Bio-Lehrerin, und betrachtete ihre langen Fingernägel. Von allen Bio-Lehrerinnen hätte man mit Franziska Schulte sicherlich am meisten über den Körper des Menschen lernen können. Ich sage, mit ihr, nicht von ihr. Sie ist etwa halb so alt wie unsere Eltern, na ja, jedenfalls wirkt sie so, ist ziemlich groß und ziemlich blond und ziemlich sportlich. Michael und ich haben uns im letzten Sommer ein paar Nächte vor ihrem Haus auf die Lauer gelegt, um herauszufinden, ob sie einen Freund hat. Aber da kreuzte keiner auf. Stattdessen ging sie andauernd joggen und an den Abenden, an denen sie nicht joggen ging, saß sie ewig lange am Schreibtisch und schrieb. Keine Ahnung, was, vielleicht ein Buch. Ich schätze, alle Lehrer haben mindestens einen Roman in der Schublade. Muss einen doch sonst ganz irre machen, andauernd zu zerpflücken, was andere geschrieben haben, und immer zu denken, dass man es mindestens genauso gut kann.
Ich war kein schlechter Schüler, eigentlich sogar ein ganz guter, und das letzte halbe Jahr vor dem Abi-Jahr war vermutlich mein bestes halbes Jahr, seit ich in der ersten Klasse Mengenlehre hatte und grüne Dreiecke von roten Kreisen unterscheiden musste. Aber wer will schon leistungsmäßig sprechen? Es musste noch eine Menge Holz den großen Strom des Sommers hinuntergeschippert werden.
Dass ich gut in der Schule war, lag vielleicht daran, dass ich gesehen hatte, wie Franziska Schulte schrieb, so, als würde auch sie den Fluchtpunkt suchen. Ich hab das irgendwie im Kopf behalten und mich dabei erwischt, wie ich auch anfing zu joggen und abends lange am Schreibtisch saß, den Kopf nach unten, als würden einem die Gedanken mit Kaugummi an der Tischplatte festbacken. Ich wählte neben Biologie sogar mein viertes Prüfungsfach bei Franziska Schulte, nämlich Philosophie. Okay, das klingt jetzt ein wenig abgehoben, hat aber seinen Grund. Doch den erzähle ich jetzt noch nicht. Erst mal muss ich sagen, dass die Schnittmenge zwischen der Schule und mir, nach der Klausur, die Sonne auf dem Ohr, leer war. Da war nichts. Und die Frage war nur, wer hier das grüne Dreieck und wer der rote Kreis war. Und hinter mir schabte Gesas Füller noch immer wie wahnsinnig über das Papier. Sie kämpfte noch um ihren Zeugnis-Schnitt unter eins Komma null. Gesa war nach Franziska Schulte vielleicht die zweitschönste Frau, die ich kannte. Ach, verdammt, das war ungeschickt, ich meine, man könnte ja jetzt denken, dass ich nicht so viele Frauen kenne – was dummerweise auch noch stimmt. Aber eigentlich war es egal, wie schön Gesa war, weil sie eine komplette Nervensäge war. Sie war so superengagiert in allem, was sie tat. Sie war Schülersprecherin, nahm am Debattierklub teil, machte Leichtathletik und engagierte sich bei Fridays for Future. Wahrscheinlich war das alles auch superrichtig und es war gut, dass es jemand machte, aber ich konnte gerade niemanden leiden, der immer alles richtig machte, der immer recht hatte, der alles ernst und wichtig nahm. Gesa ging mir einfach auf den Senkel.
Ich sah auf meinem Blatt den Sommer und im Sommer das Leben. Der Weg in die Freiheit führte nicht mehr an irgendwelchen Aufgaben entlang, die sich Lehrer ausgedacht hatten, sondern an selbst gestellten. Wer sonst sollte mich herausfordern? Das Abi würde nur noch entscheiden, ob Gesa ihre Nullnummer ausbauen konnte. Und für Klaas ging es um ein Jahr mehr in der Schule oder siebzehn Jahre Bundeswehr. Das waren zwar auch Probleme, aber nicht meine. Wirtschaftswachstum, Brutto-Frissdich-voll-Produkt, Rentenkürzung die null Komma sechste. Für so etwas war Oles Vaters zuständig, der für die Grünen im Bundestag saß, Kompromisse rechtfertigte, uns abendelang mit alten Haschisch- und Auslandsjahr-Anekdoten langweilte und wollte, dass sein Sohnemann Volkswirtschaft studierte.
Ich riss die letzte Seite aus dem Papierblock, der uns ausgeteilt worden war, und schrieb darauf meinen höchsteigenen Arbeitsplan bis zum Big Bang, der uns in den Sommer katapultieren sollte: 1. Oles Vater erleuchten, 2. Franziska Schulte verführen, 3. Klaas die Bundeswehr ausreden, 4. Gesa küssen, 5. Geld verdienen. Geld kann man immer gebrauchen.
Die anderen Klippen, um die ich meinen Sommer führen wollte, hatten noch keine Namen. Aber eines war sicher. Rente würde ich nie bekommen. Am Ende des Sommers würde ich mir das Leben nehmen. Ich würde zu Miriam aufschließen. Ich hoffte nur, dass es kein Jenseits gab.
◆ ◆ ◆
Das ist der Grund, warum ich mich für Philosophie bei Franziska Schulte als zweites Prüfungsfach entschieden hatte. Ich sollte jetzt vielleicht von Miriam erzählen, aber das möchte ich noch nicht. Doch von Philosophie kann ich kurz was erzählen. Wie in jedem Fach muss man auch in Philosophie ein systematisches und ein geschichtliches Thema wählen. Als geschichtliches Thema habe ich Hegel genommen, als systematisches »Die Rechtfertigung des Selbstmordes«. Um mit dem Langweiligeren anzufangen: Wenn ihr einmal in einer Bibliothek seid, dann sucht das Regal mit der größten Werkausgabe. Das ist Hegel. Dann schlagt irgendein Buch an irgendeiner Stelle auf und lest mal drei Sätze. Wer danach nicht denkt, dass der Typ völlig einen an der Waffel hat, ist selbst nicht ganz dicht. Hegel hat Scheiße geschrieben und sah scheiße aus und niemand hat alles von ihm gelesen, weil es so viel ist. Genau das ist der Grund, warum ich ihn gewählt hab. Selbst ein Blitzmerker wie Franziska Schulte kann mich unmöglich Faktenwissen über Hegel abfragen, sie kann höchstens prüfen, ob ich die Logik seines Denkens verstanden habe. Und dafür muss man nicht sehr viel lesen, man muss nur lange genug über die drei Sätze nachdenken, die man zuerst gelesen hat. Bei Hegel funktioniert das nämlich so, dass das Gegenteil immer zu dem führt, von dem es eigentlich das Gegenteil war. Ein Beispiel: Wenn man ein geschichtliches mündliches Abiturthema wählen soll, es aber so wählt, dass es nicht geschichtlich, sondern systematisch ist, man also plötzlich zwei systematische Themen hat – das ist Hegel’sche Dialektik. Eine unglaublich gute Strategie, um recht zu bekommen. Man gibt einfach zu, dass man unrecht hat, und schon hat man wieder recht. Allerdings gibt es ein Problem und das führt zu meinem zweiten Thema. Wenn man nämlich alles in sein Gegenteil überführen kann, dann bedeutet auch nichts etwas nur für sich. Dann ist immer alles wichtig im Hinblick auf irgendetwas anderes. Und wem das jetzt bekannt vorkommt, der hat genau recht: Hegels Philosophie ist genauso wie die Politik, die sagt, ihr müsst euch jetzt die Zahnspangen selbst kaufen, damit ihr reicher werdet, ist genau wie die Leute, die sagen, wir können uns jetzt nicht in die Sonne setzen und eine rauchen, weil wir arbeiten müssen, um Geld zu verdienen, um dann später die Möglichkeit zu haben, in der Sonne zu sitzen und zu rauchen, ist genau wie Eltern, die sagen, erst mal muss man Abitur machen, damit man hinterher selbst entscheiden kann, dass man nicht studieren will. Nichts gilt für sich, alles wird zu Brei, keiner meint mehr, was er sagt. Bei Studium, Arbeit und Zahnspange ist mir das eigentlich egal. Nicht egal ist es, wenn es um das eigene Leben geht. Ich bin Teil eines höheren Sinnzusammenhangs, einer Gemeinschaft, einer Klasse, einer Familie, einer Krankenkasse. Was ich will oder nicht will, muss mit dem zusammenpassen, was andere wollen oder nicht wollen. Das heißt doch eigentlich, mein Leben ist nicht meins, sondern gehört uns allen. Das Dumme ist nur, dass mein Leben vielleicht allen anderen gehört, aber ich keinen Anspruch auf das Leben der anderen habe, sonst wäre ich längst schon mit Frau Franziska Schulte im Bett. Drauf geschissen. Mein Leben könnt ihr haben, aber nicht meinen Tod. Da hört der Spaß auf. Wäre ich Hegel, wäre auch mein Tod sinnvoll für irgendwas. Und wenn mir nichts einfiele, würde ich so lange das Gegenteil behaupten, bis es wieder passt. Der Tod von Jesus oder Che Guevara oder Martin Luther King, der bedeutet natürlich eine Menge. Aber vermutlich hätten alle gerne weitergelebt. Und erst recht vielleicht, wenn sie gesehen hätten, was aus ihrem Tod gemacht wurde. Ich weiß nicht, ob Che froh gewesen wäre, auf einem T-Shirt über Gesas Busen zu prangen, wobei an dem Busen nichts auszusetzen ist. Jesus jedenfalls müsste doch die Krise kriegen, wenn er sähe, was die Kirche aus ihm gemacht hat. Okay, lassen wir das. Ich bin ja nicht Gesa, zum Glück. Es ist natürlich klar, dass die Kirche den Selbstmord ablehnt, weil man ja ein Teil der Schöpfung ist. Aber das ist so ein typisches Hegel-Argument, denn schließlich ist ja alles, was es gibt, aus der Schöpfung hervorgegangen, also auch Atomkraftwerke, Hundescheiße oder Donald Trump. Eine ganze Reihe von Philosophen hat die Selbsttötung mit der Freiheit des Willens gerechtfertigt. Der Mensch wählt selbst, was er mit seinem Leben macht, zur Not beendet er es. Und? Richtig, reinster Hegel! Demnach geht es bei Selbstmord nicht um den Tod, sondern um das eigene Leben. Man beweist, dass man alles bis zum Schluss im Griff hat. So gesehen ist der Tod ein Ding wie ein Hammer oder wie ein Stück Klopapier. Benutzt man es richtig, erfüllt es seinen Zweck. Aber genau so verhält es sich mit dem Tod nicht und vermutlich auch nicht mit dem Leben. Der Tod ist das, wozu man keine Beziehung aufbauen kann, er ist das, was sich nicht in einen Sinnzusammenhang überführen lässt, das völlig Sinnfremde. So sehe ich es jedenfalls. Niemand hat mir bis jetzt erklärt, was der Sinn von Miriams Tod war. Und so will ich meinen Tod auch sehen. Als etwas, das nicht in irgendein Bild passt.
◆ ◆ ◆
»Bitte kommt jetzt zum Ende«, sagte Franziska Schulte und zog ihren Kaschmirpullover über ihre breite Armbanduhr. Michael meldete sich. Ich wusste, was er sagen würde.
»Bitte?«, sagte Franziska.
»Darf ich schon früher kommen?«, fragte er.
Alle bis auf Gesa grölten.
Ich stand auf, faltete mein Blatt zusammen und ging nach vorn. Neun Punkte, schätzte ich.
In Musik hatte uns unser Lehrer einmal gefragt, welche Note wir uns selbst geben würden. Der Reihe nach rief er uns auf und notierte sich die Antworten. Es war klar, dass er es ernst meinte, und vermutlich hätte er jedem eine Eins gegeben, wenn man es gesagt hätte. Aber das Verblüffende war, dass keiner schummelte. Alle schätzten sich aufrichtig ein und alle bekamen ihre Noten so, wie sie es gesagt hatten. Ziemlich ehrliche Aktion. Und ich glaube, sie zeigt auch irgendetwas über die Mentalität meiner Generation. Sie zeigt, dass selbst Arschlöcher wie ich nicht immer nur ihren eigenen Vorteil suchen, sondern dass wir alle im Grunde unseres Herzen danach hungern, dass es aufrichtig zugeht. Oles Vater würde von Solidarität reden. Das wäre mir zu fett. Ich würde aber sagen, dass wir gar nicht alles nehmen wollen, was man kriegen kann. Ich würde sagen, es geht um Ehrlichkeit – auch sich selbst gegenüber.
»Ging’s gut, Max?«, fragte Franziska Schulte und zwinkerte mir zu. Sie hatte den Kopf voll blonder Locken und sehr dunkle Augenbrauen. Der Kontrast machte ihr Gesicht aus.
»Ich glaub, die alten Fruchtfliegen hab ich erledigt«, sagte ich. Franziska lachte laut los. Viel zu laut für so einen blöden Spruch. Als ich zurückging, war ich mir sicher, dass sie mir zuliebe gelacht hatte. Das Augenzwinkern hatte nichts zu sagen, aber das Lachen schon.
Ole kam mir im Mittelgang entgegen. »Wart mal draußen«, sagte er.
Ich nickte, wischte Bleistifte, Kulis und die leere Wasserflasche in meine Tasche, warf den Leuten aus meinem Kurs noch einen Blick zu und ging.
Draußen auf dem Flur rannten zwei andere aus meinem Jahrgang an mir vorbei. Auf dem Pausenhof sang jemand »Ab in den Norden«. Aus einem anderen Kursraum sah ich Svenja kommen. Auch sie lachte mir zu. Es war irgendwie der Tag, an dem mir die Frauen zulachten. Dabei kannte ich Svenja eigentlich nur als Oles Freundin, obwohl sie auch Miriams beste Freundin gewesen war. Das war vermutlich der Grund, warum ich es nicht schaffte, mit ihr zu reden. Manchmal, wenn ich Oles Vater neue Links installierte, war sie auch da. Aber viel Zeit hatte ich dann eigentlich nicht und Ole und Svenja hatten vermutlich ebenfalls Besseres vor. Ab und an trafen wir uns in der Küche und tranken einen Saft oder Kaffee, während Oles Vater von uns wissen wollte, was wir von Eliteuniversitäten hielten.
»Was hältst du denn von Zoos?«, fragte Ole zurück. Svenja schwieg meistens. Schweigend verschwand sie auch jetzt auf dem Pausenhof. Hinter mir flog mit einem Krach die Tür auf.
Irgendwo habe ich gelesen, dass Tiere, die in Zoos geboren werden, ihre Gefangenschaft gar nicht bemerken. Im Gegenteil, würde man sie freilassen, würden sie Paranoia kriegen, und wenn sie wählen könnten, würden sie immer den Zoo mit seinen geregelten Fütterzeiten und seinem sicheren Käfigleben dem Leben voll Hunger und Gefahren in der Steppe vorziehen. Auch auf die Gefahr hin, euch zu beklugscheißern, kann ich das so aber nicht durchgehen lassen. Denn Tiere können nun mal nicht frei wählen. Deshalb geht es gar nicht um die Wahrheit über die Tiere, sondern um die Intention solcher Aussagen. Und das bedeutet, dass Begriffe wie Freiheit, Wildheit, Natur, Hunger und Gefahr nichts wert sind, wenn noch nicht mal der Tiger sie für sich reklamieren würde. Sie sind nicht ursprünglich, sondern einfach nur Projektionen unserer satten, sicheren, künstlichen, zahmen und unfreien Gesellschaft. Da aber die Gesellschaft vermutlich nicht weniger zahm, sicher und vollgefressen sein wird, wenn wir die Idee aufgeben, dass es auch anders sein könnte, ist die »Wahrheit über die Tiere« nur reaktionäre Propaganda. Sie rechtfertigt allein die Gefangenschaft. Die Wahrheit ist: Es gibt gar keine. Es gibt nur Entwürfe. Und der, dass alle gern hinter Gittern leben, ist vermutlich der erbärmlichste.
Michael kam heraus. Er hatte zwei Flaschen echten Champagner mitgebracht. Ich weiß nicht, was er trinken will, wenn wir in einem Jahr tatsächlich unser Abi haben – beziehungsweise: er. Ich ja nicht.
Dann kamen Ole, Klaas, Gesa und die anderen. Schließlich Franziska Schulte mit unseren Klausuren.
»Und jetzt, Jungs?«, fragte sie und musterte uns. Gesa schien sie nicht mitzumeinen.
»Morgen Abend ist Party bei Michael. Sie können auch kommen«, sagte Klaas. Er war fast zwei Meter groß und fast hundert Kilo schwer. Dabei setzte sein Körper beinahe kein Fett an. Er spielte in der Handball-Landesjugend und war von einer erschütternden Offenheit.
Franziska Schulte lächelte und ging, ohne die Einladung abgelehnt oder angenommen zu haben. Klaas starrte ihr nach und sprach aus, was wir alle über ihr Hinterteil dachten.
»Arschlöcher«, sagte Gesa. Sie trug eine runde Nickelbrille, ihr Gesicht war etwas zu schmal und ihre Hüften etwas zu breit. Und ihre Wimpern streiften die Gläser, wenn sie blinzelte.
Michael zog seine Flasche aus dem Rucksack und drehte den Draht auf. Der Korken knallte an die Decke. Michael setzte die Flasche an den Mund, damit der Schaum nicht auf den Boden kleckerte. Dafür kam er ihm nun zur Nase wieder raus. Aber er trank tapfer weiter.
»Auf die Arschlöcher!«, sagte er, als er absetzte und die Flasche Gesa anbot. Die trank und zeigte ihm dabei den ausgestreckten Mittelfinger. Wir ließen die Flasche kreisen. Nur Ole lehnte ab. »Davon kriegt man es nicht«, sagte Michael.
Von allen aus unserem Jahrgang würde es Michael im Leben am leichtesten haben, schätzte ich. Er hatte mit allen Idealen abgeschlossen. Für ihn zählte, was kaufbar und berechenbar war. Und weil er sich keinen Kopf um Freiheit oder Liebe machte und wie beides zusammenpasst, lebte er auf eine gewisse Art den ursprünglichsten Anarchismus. Er war schon mit 16 ohne Führerschein in die Disko gefahren. Vor zwei Jahren hatte er einen Sommer lang bei einer Gärtnerei Unkraut gejätet und sich danach für hundert Euro hundert Aktien von irgendeiner Minifirma gekauft, die kurz danach mit einem Patent für genveränderten Mais rauskam, mit dem man ein Bier brauen konnte, von dem man abnimmt. Michael hatte seine hundert Aktien für 5 000 Euro verkauft und uns danach alle zu einem Billigflieger-Trip auf die Balearen eingeladen. Keiner war mitgeflogen, weil ihm niemand geglaubt hatte. Aber Michael hatte einfach einen Tag blaugemacht und war am nächsten Tag pünktlich zur Sportstunde wieder zurück gewesen.
Er fragte sich nie, ob etwas gut oder schlecht war, sondern nur, ob es gut oder schlecht für ihn war. Dem Philosophiefreund drängt sich damit sogleich die Frage auf, ob Egoismus die Bedingung für Anarchie ist, ob also Kapitalismus nur der bessere Sozialismus ist und was wohl Hegel dazu sagen würde.
Ich ging zu dem Rest meines Jahrgangs auf den Hof. Als ich gerade die Tür erreichte, hielt mich eine Hand zurück. Es war Ole. Er zog mich nach hinten in das Treppenhaus zum Fahrradkeller.
»Ich hab was«, sagte er.
Ich fand, es war zu früh zum Kiffen. Aber Ole schüttelte den Kopf und zog eine lange Metallröhre aus seiner Tasche. Sie sah aus wie eine Panzergranate.
»Von meinem Vater. Und der hat sie von der Tabaklobby«, sagte er und schraubte die Granate am Ende auf.
Eine fette Zigarre flutschte ihm in die Hand.
Ole und ich saßen in der Frühlingssonne auf einem Fahrradständer und probierten aus, wer den Rauch der Zigarre am längsten in der Lunge halten konnte. Mir war schlecht und ich hatte das Gefühl, dass meine Haut gelb angelaufen war.
»Also, nach Kuba muss ich nicht«, sagte ich.
Ole nickte. »Was echte Scheiße ist«, sagte er. »Wir reißen uns hier den Arsch auf und sind doch nur Mittelmaß.«
»Was meinst du?«
»Ich meine, selbst wenn Gesa nächstes Jahr einen 1,0-Schnitt macht, ist sie nur bei uns der Star. Und dann bewirbt sie sich und irgendeiner sagt ihr: ›Gut, gut, aber euer System ist so schlecht.‹ PISA und so.«
Ich glaube, in dem Moment hatte ich zum ersten Mal den Gedanken, nach Finnland zu segeln, wo alle glücklich sind.
»Aber ich meine gar nicht PISA. Ich meine, dass nichts, was man tut, für sich selbst steht, sondern immer irgendwie eingebunden ist. Als würde man in Watte leben.«
Ich zog noch mal an der Zigarre. Ole wollte mir irgendwas sagen, aber ich kam nicht drauf, was er meinte. Natürlich hatte er recht mit der Watte, aber das war nun auch nicht so neu, dass es ihn so fertigmachen musste.
»Redest du von Sex?«, fragte ich. Er blickte mich misstrauisch an.
»Mit wie viel Mädchen hast du schon geschlafen?«, fragte er.
»Ist nicht so ’ne wilde Sache«, sagte ich.
Ich reichte ihm die Zigarre. Er schüttelte den Kopf.
»Für uns schon«, sagte Ole.
Ich hatte das Gefühl, er würde gleich anfangen zu heulen.
»Frag deinen Daddy«, sagte ich, »Sex ist wie Politik. Man glaubt, man könnte die Welt auf den Kopf stellen, tatsächlich befriedigt man nur sich selbst.«
Zum zweiten Mal innerhalb einer Stunde sagte jemand »Arschloch« zu mir. Aber Ole meinte es wirklich ernst.
»Ihr habt noch nicht miteinander geschlafen?«, fragte ich. Die qualmende Cohiba steckte ich in eine Mülltonne. Zirka 100 Euro verdampften zwischen Apfelgehäusen und vollgeschnodderten Taschentüchern. Ein Anblick, der mich irgendwie glücklich machte.
»Wir wollen ja, irgendwie. Aber ich weiß nicht …«
Er stockte. »Du sagst doch immer, wenn’s am schönsten ist, muss man aufhören …«
»Das hab ich gesagt?«, fragte ich zurück. Tatsächlich hatte ich irgendwie eine Ahnung, so was schon mal gesagt zu haben, aber eher in Richtung »keine lauen Kompromisse machen« und »sich absetzen, bevor aufgeräumt wird«, also aufhören, solange die Party noch läuft, nicht, wenn sie schon zu Ende ist. Dass man bei Sex aufhören soll, wenn es am schönsten ist, klang entweder nach einer fernöstlichen Liebeskunst oder nach Quark mit Soße. »Ich weiß nicht, was unsere Perspektive ist«, sagte Ole.
»Alter, du hast wohl zu viel Zeit mit deinem Daddy verbracht. Du schläfst doch nicht mit einem Mädchen und denkst an die Perspektive.« Ich war echt sauer auf Ole. Ich meine, er war kein so guter Freund, dass es mich wirklich was anging. Aber ich wollte nicht, dass Svenja sich so eine verkopfte Scheiße anhören musste.
»Dann red du doch mal mit Svenja«, sagte Ole. Er stand auf und ging in die Schule zurück.
Keine Ahnung, ob Ole das ernst gemeint hatte, dass ich mich in seine Beziehung einmischen sollte. Aber als ich ihm nachsah, wurde mir klar, wovon er überhaupt gesprochen hatte. Er wollte mit Svenja Schluss machen. Aber vorher wollte er noch mit ihr schlafen. Als ich so weit war, schien es mir schon etwas logischer, warum er mir das erzählt hatte.
◆ ◆ ◆
Nachdem wir Michaels zweite Flasche ausgetrunken hatten, fuhr ich mit Klaas nach Hause. Wir eierten herrlich. Einmal hätte mich fast ein ausparkendes Auto mit seinem Kühler geküsst. Eine Frau rief hinter uns her, als wir vor einem Laster über die rote Ampel rasten. Dann tauchte unter einer Steilklippe die Ostsee auf, auch sie schwankte.
Klaas’ Eltern waren Landwirte, aber nicht so blöde Schweinebauern, sondern total coole Unternehmer. Sie hatten schon vor Jahren Windräder auf ihren Koppeln aufgestellt und seitdem waren sie mehr auf Kongressen als im Kuhstall, was Klaas die Möglichkeit eröffnete, in einer Ecke des ehemaligen Bullenpferchs Pilze zu züchten.
Windräder, das war klar, würden niemals all den Strom liefern, die unsere AKWs so ausbrüten, aber darum geht es gar nicht. Ich finde, Windräder sehen einfach schön aus. Sie haben etwas von Statuen. Wären wir die alten Griechen, lebten aber in der Gegenwart, würden wir vermutlich Windräder statt irgendwelcher Marmorgötter bauen. Sie sind das stahlgewordene Symbol der Hilflosigkeit des Lebens, rudern wie wild und kommen doch nicht voran. Wie Ertrinkende.
Ich hatte erst ein Mal von Klaas’ Pilzen gekostet, im letzten Herbst, zusammen mit Ole, nach einer Halloween-Party. Ich müsste genauer sagen, der Halloween-Party, die Svenja gegeben hatte, nachdem sie aus Frankreich zurückgekommen war, an dem Abend, an dem sie mit Ole zusammengekommen war. Die ersten Minuten war überhaupt nichts passiert, aber dann veränderte sich plötzlich die Wahrnehmung. Eine Glühlampe wurde zur Supernova, die Musik schnitt mein Gehirn in Scheiben, und während ich Michael sah, redete ich mit Ole, und als ich Gesa suchte, fand ich immer nur Svenja. Ich musste mich übergeben, schaffte es aber nicht mehr bis zur Verandatür und entschied mich, um Svenjas Eltern nicht mitten auf den Wohnzimmerteppich zu kotzen, für einen Mülleimer. Als ich fertig war, wollte ich ihn des Gestanks wegen rausstellen, hob ihn hoch und trug ihn zur Verandatür. Aber während ich ging, wurde sein Gewicht immer leichter. Der Mülleimer war ein Papierkorb und weder wasser- noch luftdicht, sodass meine angedaute Nahrung doch auf dem Wohnzimmerteppich landete.
Aber jetzt war es lange genug her, um nachzuschauen, wie die Pilze den Winter überstanden hatten.
Klaas und ich, wir hatten beide einen hängen. Die Welt drehte sich unter uns. Die Tulpen salutierten in den Beeten und die Luft fühlte sich an wie Haut.
»Mensch Klaas, du bist aber groß geworden«, sagte ich, als wir den Bauernhof seiner Eltern erreichten und er wieder neben seinem Fahrrad stand.
»Nur keinen Neid«, sagte er und warf seine Tasche durch das offene Küchenfenster ins Haus.
»Tor«, sagte ich.
»War Stürmerfaul.«
Klaas war cool.
»Gehst du deshalb zum Bund, wegen des Sports?«, fragte ich.
Er blickte mich an, als hätte ich nicht alle Tassen im Schrank.
»Du würdest sogar den Zivildienst verweigern, wenn es den noch gäbe, oder?«, meinte er.
»Ich würde verweigern, weil ich keinen Menschen töten kann«, entgegnete ich.
»Klar kannst du. Ehrlich gesagt, du bist der Einzige aus unserem Jahrgang, dem ich so etwas zutrauen würde. Jedenfalls seit der Sache mit Miriam. Du verweigerst alles aus Prinzip. Du machst total dicht. Du lässt nichts mehr durch.«
»Hör auf, in Handballvokabeln mit mir zu quatschen«, gab ich zurück. »Ich mach die Biege, denke ich, ich hau ab und komm nicht wieder zurück.«
Klaas kratzte sich am Scheitel. Während ich normal kurze Haare habe, hat er eine Mähne, die ihm über die Schultern fällt. Beim Handball hält ihm ein Haarband die Pracht aus der Stirn.
»Das mit Miriam ist echt scheiße. Aber das ist nun fast zwei Jahre her. Du musst dir mal wieder den Ball holen«, sagte Klaas und dabei stand er so dicht vor mir, dass es sich anfühlte, als würde er meine Hand halten.
Dabei war ich es doch, der Klaas davon abbringen wollte, zum Bund zu gehen. Jetzt nahm er mich in die Psychoklemme.
»Hinten dicht und vorne volle Pulle, was?«, sagte ich. Ich wollte dieses Gespräch nicht führen.
»Mach schon auf, Klaas.« Ich zeigte auf das Tor zum ehemaligen Bullenstall. Aber Klaas lehnte sich dagegen.
»Erst will ich, dass du mir sagst, dass es richtig ist, zum Bund zu gehen«, sagte er.
»Was soll daran richtig sein?«, fragte ich.
»Es gibt Menschen, denen man helfen kann. Menschen, die echt dreckig dran sind, die vergewaltigt wurden und deren Kinder man ermordet hat – Afghanistan und Sudan. Aber an die denkst du nicht. Du denkst nämlich nur an dich.«
Ich hatte Klaas noch nie so viel reden gehört und auch nicht gewusst, dass er sich über mich so viele Gedanken machte.
»Jawoll, mein General«, sagte ich.
»Und deswegen will ich, dass du jetzt sagst, dass es richtig ist, sich zu verpflichten, und du das nur nicht verstehst, weil du ein asoziales Arsch bist.«
»Ich bin ein asoziales Arsch. Machst du jetzt auf?«
»Das kam nicht von Herzen.«
»Willst du wissen, wie es sich anfühlt, wenn es von Herzen kommt?«, fragte ich.
Ich musste hochspringen um Klaas im Gesicht zu treffen. Eigentlich wollte ich ihn am Kinn treffen, aber er drehte seinen Kopf im Reflex zur Seite und ich schlug ihm voll auf die Lippe, die sofort platzte. Aber noch während ich in der Luft war, traf mich Klaas’ Faust auf den Rippen. Ich hörte, wie eine brach. Es fühlte sich an wie Seitenstiche. Der Schmerz machte mich schlagartig nüchtern. Ich rumste auf den Boden und versuchte Klaas mit einer Beinschere zu Fall zu bringen, traf ihn aber nicht, weil ich mich gleichzeitig vor Schmerzen krümmte. Klaas sprang schnell zur Seite. Dabei stolperte er jedoch über sein Fahrrad und stürzte hin. Ich bekam kaum Luft, der Schmerz in meinem Brustkorb griff auf den ganzen Körper über. Klaas warf sich auf mich. Sein Gewicht presste mich gegen die Lenkerstange des Fahrrads, das Blut aus seiner Lippe lief mir in den Nacken. Ich schlug mit dem Kopf nach hinten und traf ihn nun endlich am Kinn. Für einen Moment ließ seine Umklammerung nach. Ich drehte mich um und schlug ihm auf den Rücken. Sofort griff er wieder zu und nahm mich in den Schwitzkasten, stand auf, ohne mich loszulassen, hob mich hoch und quetschte mich so zusammen, dass ich keine Luft mehr bekam. Ich trat ihm vors Schienbein. Klaas drückte weiter. Meine Lunge krampfte sich zusammen. Ich schmeckte Blut in meinem Mund. Dann bekam ich eine Hand frei und griff ihm in die Haare. Ich riss daran. Und da ließ er mich los. Ich sackte benommen auf den Boden, Klaas kniete vornübergebeugt. Ich wischte mir das Blut aus dem Gesicht und blieb liegen. Erstaunlicherweise fühlten die Schmerzen sich gut an. Es tat gut, zu merken, wie sie nachließen, es war okay, dass meine Knöchel vom Zuschlagen abgeschürft waren. Diese Cowboyfilme, in denen die Männer, nur weil einer geniest hat, den Saloon ramponieren, hab ich immer gern geguckt. Vielleicht haben Schlägereien irgendeine ganzheitliche Bedeutung. Jedenfalls fühlte es sich so an. Aber das würde auch bedeuten, dass Kriege eine Bedeutung haben.
»Okay, es ist richtig, dass du zum Bund gehst«, sagte ich.
»Dann mach ich jetzt auf«, sagte Klaas und half mir hoch.
◆ ◆ ◆
Die Pilze waren total mickrig und sahen außerdem ziemlich verstaubt aus. Was immer sie für wirklichkeitserweiternde Substanzen ausbrüten würden, die Schlägerei mit Klaas hatte mir das Interesse an biologischen Drogen genommen. Und als diesmal das Meer auftauchte, bog ich ab und fuhr zwischen zwei Feldern unreifen Weizens an den steinigen Strand, der sich vor der Steilküste breitmachte. Ich musste freihändig fahren, denn sobald ich mich vornüberbeugte, konnte ich vor Schmerzen kaum atmen. Gleichzeitig machte mich die Intensität des Gefühls glücklich.
Als ich am Wasser war und eine marode Holztreppe hinunter zum lehmigen Sockel der Steilklippen gekraxelt war, streckte ich mich auf dem Rücken aus, um weiter zu überlegen, warum ich zufrieden war, dass Klaas mir die Rippe gebrochen hatte. Der Himmel ließ weiße, kleine, vom Wind zerrupfte Wolken vorbeiziehen und schien bester Laune zu sein. Wahrscheinlich sieht der Himmel immer so aus, wie man sich fühlt. Vermutlich ist er ein Spiegel, dachte ich, der einem anzeigt, wie es einem geht. Aber da er ein Spiegel aus Nichts ist, schaut man, wenn man sich selbst in ihm zu finden meint, eigentlich durch ihn hindurch.
Ich schloss die Augen. Vor meinen Lidern tanzten Stäbchen im roten Licht. Ich dachte an Miriam.
Miriam ist meine Schwester. Ich sage »ist« und ich schreibe im Präsens, weil ich nicht akzeptiere, dass sie tot ist. Miriam ist nämlich nicht nur meine Schwester, sie ist meine Zwillingsschwester. Sie ist ein Teil von mir, den ich irgendwie behüten muss.
Ich kam zwanzig Minuten vor ihr auf die Welt. Miriam wurde mit dem Gesicht nach oben geboren. Man nennt solche Kinder Sternengucker. Und ein Sternengucker ist sie. Vielleicht hat Klaas recht, dass ich seit ihrem Tod zynisch geworden bin. Ich war immer derjenige von uns beiden, der wissen wollte, was es mit den Dingen auf sich hat, während sie wissen wollte, was hinter den Dingen wartet. Sie hat das Unsichtbare gesehen, ich sehe nur die Wände davor. Vielleicht hat sie sich deshalb mit Svenja so gut verstanden. Ich weiß es nicht, ich hatte mit Svenja wenig zu tun. Und ihretwegen auch zunehmend weniger mit Miriam.
Am Abend von Miriams Tod waren wir am Strand. Ein kleines Feuer knisterte, nachts wurde es immer noch kalt. Ich lag auf dem Rücken und schaute ins All über mir. Manchmal sauste eine Sternschnuppe genau auf mich zu, aber mir fiel nichts ein, was ich mir hätte wünschen können. Stattdessen dachte ich an Miriam. Wie sie versuchte ich durch die Sterne hindurchzuschauen, zu erkennen, was das Schwarz verbarg.
Die Mädchen saßen etwas abseits. Ich weiß, dass sie gekichert haben, aber ich weiß nicht mehr, wann ich sie zum letzten Mal hörte.
Plötzlich stand Svenja vor mir und schüttelte mich. Sie schrie und gab mir eine Ohrfeige. Aber ich war noch tief in einem Raum hinter dem Raum und schaffte den Quantensprung ins Sonnensystem nicht.
Svenja lief zum Wasser und fuchtelte mit den Armen. Ich stand auf und torkelte ihr nach. Jetzt hörte ich, dass sie Miriams Namen rief. Und dann begriff ich. Miriam war ins Wasser gegangen. Weit draußen im Licht, das der Mond über das Meer trieb, sah ich etwas, das Miriams Kopf sein konnte. Ich rannte ins Wasser. Idiotischerweise zog ich mir noch die Hose aus. Es war eine weiße Jeans und sie war neu.
Der Sternennebel in meinem Kopf war wie weggeblasen. Ich kraulte, bis mir die Lunge platzte, dann schwamm ich Brust, immer in Richtung Mond, immer im Licht. Als ich dachte, an der Stelle zu sein, wo ich Miriam gesehen hatte, war sie nicht mehr da. Ich drehte mich zu Svenja um, die jetzt meinen Namen rief und winkte. Ich tauchte. Aber unter Wasser scheint kein Mond. Ich schwamm hin und her, bis die Kälte anfing meine Glieder zu betäuben. Dann kehrte ich um.
Miriam war eine gute Schwimmerin. Ich begriff nicht, was passiert war.
Als eine Welle mich auf den Strand spülte, blieb ich einfach liegen. Svenja kam angelaufen und setzte sich neben mich in die Widersee.