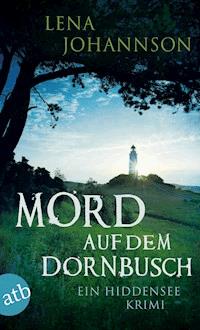10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nord-Ostsee-Saga
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Vier Frauen, vier Schicksale – verbunden durch ein blaues Band.
Kiel 1886: Seit Stine denken kann, ist das alte Puppentheater ihres Großvaters das Herzstück des Kolonialwarenladens ihrer Familie. Hier hat sie ihre Leidenschaft für das Geschichtenerzählen entdeckt. Doch statt, wie von ihr erträumt, gemeinsam mit ihrer großen Liebe Thorin auf der Bühne zu stehen, muss sie im Geschäft aushelfen, obwohl immer weniger Kunden kommen. Währenddessen wünscht Sanne sich nichts sehnlicher, als zu studieren und Gebäude zu konstruieren, wie schon ihre Großväter. Regina sieht sich nach dem Tod ihrer Brüder gezwungen, eine Vernunftehe einzugehen. Doch dann wird der Bau einer gigantischen Wasserstraße beschlossen, die die Meere miteinander verbinden soll. Ein Jahrhundertprojekt, das nicht nur die Schicksale der drei Frauen verändert, sondern auch das Leben von Mimi, der Tochter des Kanalplaners ...
Der Auftakt der großen Saga von Bestsellerautorin Lena Johannson über das Leben vierer Frauen und ein einzigartiges Bauwerk: den Nord-Ostsee-Kanal.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 507
Ähnliche
Über das Buch
Stine hilft in dem Kolonialwarenladen ihres Vaters aus, das Geschäft ist in die Jahre gekommen, die meisten Kunden kommen wegen des alten Puppentheaters, das Justines Großvater ab und an noch bespielt. Das Puppenspiel hat Justine von Anfang an geprägt, und am liebsten würde sie selbst einmal auf der Bühne stehen. In Rendsburg wird Regina, Tochter eines Großgrundbesitzers, gegen ihren Willen verheiratet, nur so kann der Familienbesitz gerettet werden. Sanne ist in Brunsbüttel in einer Handwerkerdynastie aufgewachsen, schon ihre Vorfahren waren im Schleusenbau tätig – ihr größter Wunsch ist es, in die Fußstapfen ihrer Ahnen zu treten und selbst einmal ein Bauwerk zu konstruieren. Mimis Kindheit ist von einem tragischen Verlust überschattet, von einem Tag auf den anderen muss sie große Verantwortung übernehmen. Dann beschließt der Kaiser den Bau des Nord-Ostsee-Kanals, ein Projekt für das Mimis Vater, Heinrich Hermann Dahlström, Jahrzehnte lang gekämpft hat, und ein Bauwerk, das nicht nur das Schicksal der vier Frauen für immer bestimmen wird, sondern auch das Leben von Generationen verändert.
Über Lena Johannson
Lena Johannson, 1967 in Reinbek bei Hamburg geboren, war Buchhändlerin, bevor sie als Reisejournalistin ihre beiden Leidenschaften Schreiben und Reisen verbinden konnte. Sie lebt als freie Autorin an der Ostsee.Im Aufbau Taschenbuch sind ihre Bestseller „Die Villa an der Elbchaussee“, "Jahre an der Elbchaussee", „Töchter der Elbchaussee“, „Die Frauen vom Jungfernstieg – Gerdas Entscheidung“, „Die Frauen vom Jungfernstieg – Antonias Hoffnung“, „Die Frauen vom Jungfernstieg – Irmas Geheimnis“ und "Die Malerin des Nordlichts" lieferbar, ihre Romane „Dünenmond“, „Rügensommer“, „Himmel über der Hallig“, „Der Sommer auf Usedom“, „Die Inselbahn“, „Liebesquartett auf Usedom“, „Strandzauber“, „Die Bernsteinhexe“, „Sommernächte und Lavendelküsse“ sowie die Kriminalromane „Große Fische“ und „Mord auf dem Dornbusch“.Mehr zur Autorin unter www.lena-johannson.de
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Lena Johannson
Zwischen den Meeren
Vier Frauen und ein Jahrhundertbauwerk, das die Welt verändert
Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Motto
Personenregister
Prolog — Mimi
Kapitel 1: Mimi — Hamburg, Hochallee Nr. 8, Ende Februar 1886
Kapitel 2: Justine — Kiel, Mai 1886
Kapitel 3: Regina — Schülldorf, Juni 1886
Kapitel 4: Mimi — Heilwigstraße in Hamburg, Frühjahr 1886
Kapitel 5: Susanne — Brunsbüttel, Mai 1886
Kapitel 6: Susanne — Brunsbüttel, Mai 1886
Kapitel 7: Justine — Kiel, Juli 1886
Kapitel 8 : Susanne — Brunsbüttel, Juli 1886
Kapitel 9: Justine — Kiel, Juli/August 1886
Kapitel 10: Susanne — Brunsbüttel, August 1886
Kapitel 11: Susanne — Brunsbüttel, August 1886
Kapitel 12: Regina — Westerrönfeld, August 1886
Kapitel 13: Justine — Kiel, Sommer 1886
Kapitel 14: Regina — Westerrönfeld, November 1886
Kapitel 15: Justine — Kiel, Jahreswechsel 1886/87
Kapitel 16: Regina — Westerrönfeld, Januar 1887
Kapitel 17: Justine — Kiel, Februar 1887
Kapitel 18: Regina — Westerrönfeld, März 1887
Kapitel 19: Susanne — Brunsbüttel, April 1887
Kapitel 20: Regina — Kiel, Mai 1887
Kapitel 21: Mimi Dahlström — Kiel, 3. Juni 1887
Kapitel 22: Justine — Kiel, Sommer 1887
Kapitel 23: Susanne — Brunsbüttel, Oktober 1887
Kapitel 24: Justine — Kiel, 10. Februar 1888
Kapitel 25: Regina — Westerrönfeld und Brunsbüttel, Februar 1888
Kapitel 26: Justine — Kiel, Mitte Februar 1888
Kapitel 27: Justine — Kiel, einen Tag später
Epilog — Brunsbüttelkoog, Freitag, 10. Februar 1888
Wahrheit oder Phantasie?
Quellen
Dank
Impressum
Wer von dieser großen historischen Saga begeistert ist, liest auch ...
Für Heinrich Hermann Dahlström, ohne den es den Nord-Ostsee-Kanal womöglich nie gegeben hätte.
Und für Mimi und Else, für Ilse und Merve, die das Andenken an ihren Vater, Großvater und Urgroßvater stets liebevoll lebendig gehalten haben.
»Er ist so fleißig und arbeitet seit langer Zeit an einem großen Unternehmen. Der liebe Gott möge die Sache zum Guten leiten, denn wenn ich denke, mein Hermann könnte eine Enttäuschung erfahren, … Ich darf nicht daran denken, – es wäre entsetzlich.«
Aus dem Tagebuch von Dorothea Dahlström, 20. August 1879
Personenregister
Kiel
Justine Thams, genannt Stine: Tochter des Kolonialwarenhändlers Wilfried Thams
Jobst Wilfried Thams: Sohn des Kolonialwarenhändlers Wilfried Thams
Wilfried Hermann Thams: Kolonial- und Eisenwarenhändler
Ruthild Thams: Seine Ehefrau
Helene Thams, geb. Nissen, genannt Hella: Ehefrau von Jobst Thams
Thorin Tüxen: Schauspieler und Justines Freund
Rendsburg
Regina Rademacher, geb. Barz: Tochter des Gutsbesitzers Friedrich Hubert Barz
Broder Neunes: Lübecker Kaufmann
Christoph Rademacher: Gutsbesitzer aus Hademarschen, Ehemann von Regina
Friedrich Hubert Barz: Gutsbesitzer bei Rendsburg und Reginas Vater
Brunsbüttel
Susanne Agathe Schmidt, genannt Sanne: Tochter eines Zimmermanns und Nachfahrin eines Schleusenbauers; Geschwister: Inge, Michel, Frerk und Elke
Herwart und Maria Schmidt: Zimmermann und seine Frau, Susannes Eltern
Rosario Antonio Francesco Limone: Steinmetz aus dem Trentino
Familie Dahlström, Hamburg
Heinrich Hermann Dahlström: »Vater« des Nord-Ostsee-Kanals
Johanna Dorothea Adolphine Dahlström, geb. Meyer: Erste Ehefrau von Heinrich Hermann Dahlström
Bertha Dahlström, geb. Lachmund: Zweite Ehefrau von Heinrich Hermann Dahlström
Johanna Maria Wilhelmine Dahlström, genannt Mimi: Tochter von Heinrich Hermann Dahlström; Geschwister: Else, Hermann, Oskar und Paul
Prolog
Mimi
Dunkelblau und glitzernd windet sich der Kanal zwischen sattgrünen Wiesen hindurch. Schlanke Birken neigen sich in der sanften Brise elegant mal hierhin, mal dorthin. Nur an wenigen Stellen ist das Ufer durch Beton befestigt. Mimi setzt behutsam einen Fuß vor den anderen. Kleine Schritte. In ihrem Alter macht man keine großen Sprünge mehr. Sie hat noch ein ausgesprochen feines Gehör, nimmt das Summen einer Hummel wahr, die von einer Butterblume zur nächsten fliegt. Sie lauscht dem Plätschern des Wassers, das über die unzähligen nass glänzenden Steine schwappt, jeder einzelne von ihnen meist schon vor langer Zeit mit Bedacht platziert. Ein Segelschiff zieht geschmeidig vorbei. Ein Mann an Bord hat Mimi entdeckt und winkt. Sie hebt lächelnd die Hand. Am Horizont taucht ein mächtiger Frachter auf. Er kommt aus Richtung Kiel. Auf einer Strecke von knapp hundert Kilometern wird er Felder und Weiden passieren, Städte und Dörfer, Brücken und Schleusen, ehe er sich bei Brunsbüttel in die Elbe schieben und dem Land zwischen den Meeren Lebewohl sagen wird. Mit dumpfem Wummern kommt er näher, immer schneller klatschen kleine Wellen an Land. Es ist, als hätte jemand das blaue Band, das eben noch ruhig unter dem weiß betupften Frühsommerhimmel lag, an beiden Enden gepackt und zum Schwingen gebracht. Mimi lässt ihren Blick schweifen. Für einige ist dieser Kanal wohl einfach nur die Verbindung von Nord- und Ostsee. Das Wattenmeer mit seinen Gezeiten, Inseln, der Halligwelt, mit seinen Salzwiesen, auf denen Schafe grasen auf der einen Seite, die sanften Buchten, weit ins Land vordringenden Förden, die Städte und feinen Seebäder auf der anderen Seite. Für so manche ist es ein Brückenschlag von Ost nach West, von den baltischen Ländern zum Vereinigten Königreich und weit darüber hinaus. Für Mimi würde der Kanal immer das Band zwischen den Seelen ihrer Eltern sein. Ein Band, das ihre Mutter mehr als einmal zu ersticken gedroht und das sie dennoch immer stolz durch ihr Leben getragen hat, als sei es ein Schmuckstück. Mimis Vater war besessen davon gewesen, eine Wasserstraße von einem deutschen Meer zum anderen zu bauen. So schien es. In Wahrheit wollte er für seine Dorothea West und Ost näher zusammenbringen, um ihr die gesamte Welt zu Füßen legen zu können. Tag und Nacht hat er gearbeitet, um mit dem Verdienst für seine Familie ein Fleckchen im Grünen zu kaufen. Doch es war alles anders gekommen. Mimi schließt kurz die Augen und saugt den Geruch ein, der ihr so vertraut ist. Ein Hauch von Algen und Fisch, doch wesentlich zarter als an der See. Der Frachter ist schon wieder aus ihrem Blickfeld verschwunden. Sie geht ein paar Schritte, um die Levensauer Hochbrücke mit etwas Abstand in voller Pracht betrachten zu können. Die Wappenschilde mit dem Kaiseradler gibt es nicht mehr. Auch die vier über das schmiedeeiserne Gerüst ragenden Türme mit ihren Torbögen sind verschwunden. Trotzdem ist sie noch immer eine der eindrucksvollsten Kanalbrücken, vielleicht die schönste von ihnen. Weil sie mächtige massive Pfeiler aus rotem Backstein mit einem geradezu filigran wirkenden Metallüberbau verbindet. Weil sie über dem Kanal schwebt, als würde sie schützend ihre Arme darüber ausbreiten. Es ist Mimis Lieblingsplatz. Sie war bei der feierlichen Eröffnung am dritten Dezember 1894 und ist so manches Mal mit dem Zug darübergefahren. Dann mussten die Fuhrwerke und Kutschen anhalten und der Eisenbahn die Vorfahrt lassen. Sogar eine kleine Station gab es dort oben auf der Brücke. Mimi legt eine Hand über die Augen und den Kopf in den Nacken. Seit Kurzem halten da keine Züge mehr, der Betrieb ist eingestellt. Dafür rauschen die Automobile jetzt in großer Zahl von einer Seite zur anderen. Als Mimi noch ein Kind war, war ein Auto noch eine Sensation.
»Mit dem Fortschritt verhält es sich wie mit einem an die Wand gelehnten Holzbalken, der ins Rutschen gerät«, hat sie plötzlich die Stimme ihres Vaters im Kopf. »Er setzt sich langsam in Bewegung, gewinnt dann jedoch rasant an Tempo. Die Menschen müssen irgendwie mithalten. Dazu sind schnelle Verbindungen nötig.« Und noch etwas hat er immer gesagt: »Veränderungen erfordern die Erschaffung passender Bauwerke, die wiederum für Veränderungen sorgen. Und sie erfordern Mut.« Mimi muss unwillkürlich lächeln. Ihr Vater, Heinrich Hermann Dahlström, hatte diesen Mut, er hat diese schnelle Verbindung geschaffen. Gegen alle Widerstände. Und davon gab es viele. Mimi spürt, dass es Zeit wird, zurückzugehen, ihre Beine werden ihr schwer, immer häufiger muss sie stehen bleiben und Atem schöpfen. Sie ist eben kein junges Ding mehr mit langen dunklen Zöpfen und Augen, die voller Neugier in die Zukunft blicken. Jetzt schaut sie eher zurück, denn vor ihr ist der Horizont erschreckend nah.
Ihr Vater erholte sich gerade von einer ernsten Erkrankung, als er zu ihr sagte: »Mimi, ich werde dir irgendwann die Geschichte meines Lebens diktieren.«
Er hat nie die Zeit dafür gefunden. Und auch ihre Zeit geht allmählich zu Ende. Doch auch ohne Diktat hat Mimi sein Leben in ihrem Kopf und ihrem Herzen. In unzähligen Stunden hat sie es mit ihm geteilt und er hat ihr alles erzählt. Fast immer ging es um den Kanal. Er ist untrennbar mit ihm verbunden, mit der gesamten Familie. Er gehört zu ihrem Vater wie ein Sohn, der ihm etliche graue Haare beschert und ihn am Ende doch unendlich stolz gemacht hat. Er gehört zu Mimi wie ein Bruder, der es stets verstanden hat, sich die gesamte Aufmerksamkeit der Eltern zu sichern, und die kleine Schwester immer gerade rechtzeitig in Staunen versetzt hat, um ihre Eifersucht in grenzenlose Liebe zu verwandeln. Wahrscheinlich kann sie deshalb noch immer nicht lange ohne ihn sein, so wie es einen automatisch zum Verwandtenbesuch drängt, wenn der letzte bereits zu weit zurückliegt.
Keine Bank weit und breit, keine Möglichkeit, sich auszuruhen, nur das glitzernde, sanft wogende Band, eingebettet in sattes Grün, behütet von einem blauen Himmel mit Schäfchenwolken. Die Erinnerung nimmt Mimi fast die Luft. Schäfchen hat ihr Vater ihre Mutter genannt. Wer ihn nicht kannte, hätte den Kosenamen falsch verstehen können. Doch Mimi weiß genau, wie er es meinte.
Ihre Mutter hatte es ihr erzählt: »Er hat mich schon auf dem Mühlenberg so genannt, wo ich aufgewachsen bin. Den Tag vergesse ich nie. Ich war auf den von Mehl bedeckten Stufen nach oben geklettert, in den Raum unter der Kuppel, über die sich ein grünes Kupferdach spannte. Mein blaues Kleid war über und über weiß betupft. Mehl. Ich war unachtsam gewesen, als ich der Katze Milch hingestellt und mich nah ans Holz gepresst hatte, um besser aus der Luke schauen zu können.
›Es sieht beinahe aus wie Löckchen aus Schafwolle‹, hatte er gesagt.« Und dann hatte sie Mimi davon erzählt, dass auch die Dahlströms auf dem Mühlenberg gelebt hatten. Während ihre Mutter ihr Versteck unter dem Helm der über hundert Jahre alten Mühle für seine Geborgenheit liebte, die sogar Katzen nutzten, um dort ihre Jungen großzuziehen, war ihr Vater fasziniert vom Rattern und Vibrieren der Mühlsteine gewesen, vom zuverlässigen Ineinandergreifen der Räder. Die Begeisterung für die Aussicht über die Anhöhe des Stintfangs auf die Masten der Schiffe teilten sie. Auch ein Stückchen Elbe konnten sie von dort sehen. Hamburgs Lebensader. Ein blaues Band, das die Hansestadt mit der Welt verband. Mimi bekommt eine Gänsehaut. Als hätten Dorothea und Hermann damals bereits auf ihr Schicksal geschaut. Sie heirateten bald darauf in der Michaeliskirche, nur einen Steinwurf entfernt von ihrem mehlbestäubten Ausguck.
Obwohl sie erschöpft ist, zögert Mimi den Abschied raus. Nicht anzunehmen, dass sie noch einmal die Reise von ihrem Haus in Wohldorf durch halb Schleswig-Holstein schaffen wird, hierher an ihren Lieblingsplatz unter der Levensauer Hochbrücke. Ein Abschied für immer also. Ein Raddampfer zieht vorbei. Seine Schaufeln bringen das Wasser zum Schäumen und Rauschen. Heutzutage ein seltener Anblick. Erschrocken bringt eine Entenmutter ihre Jungen, noch grau und flauschig, über die Böschung hinauf in Sicherheit. Sie ahnt nichts von der Bedeutung des Kanals. Ob Mimis Vater in seinem Begeisterungsrausch für die gewaltige künstliche Wasserstraße geahnt hat, wie sie den Norden des Kaiserreichs verändern wird? Nicht nur den Norden, sondern das gesamte Reich, wenn nicht gar die ganze Welt! Die Entstehung dieses Jahrhundertbauwerks hat sein Leben bestimmt und das derer, die es erschaffen haben. Seine und ihre Geschichte soll hier erzählt werden.
Kapitel 1
Mimi
Hamburg, Hochallee Nr. 8, Ende Februar 1886
Der März stand vor der Tür, an manchen Stellen ließen sich schon grüne Blätter mit feinen weißen Streifen im Rasen ausmachen. Krokusse, die ihre Köpfchen der Sonne entgegenschoben. An diesem Tag stürmte Mimi achtlos an ihnen vorüber. Sie hatte keinen Blick dafür, weil eine Freude sie ausfüllte, wie sie sie nicht mehr empfunden hatte, seit ihre Mutter im Juli des vergangenen Jahres gestorben war. Seit diesem schrecklichen Tag fühlte es sich an, als hinge ein bedrohlicher Nebel in allen Winkeln des Hauses, der darauf lauerte, die Familie mit Haut und Haaren zu verschlingen, sollte einer es wagen, zu lachen, herumzutoben oder auch nur in gewöhnlicher Lautstärke zu sprechen. Sie war nachts gestorben. Mimi hatte nicht weinen können, am Morgen, als ihr Vater sie stumm in den Arm nahm, und auch nicht, als sie das Leinentuch vom Gesicht der Mutter zogen, damit die Kinder sie noch einmal sehen konnten. Friedlich hatte sie auf Mimi gewirkt, als würde sie etwas Schönes träumen. Die Tränen, die sie am von Kerzen und Blumen üppig eingerahmten Sarg vergossen hatte, waren wohl in erster Linie den vielen schluchzenden Menschen geschuldet, die gekommen waren. Vor allem aber dem Kummer, der aus den Augen ihres Vaters gesprochen hatte. Es war, als sei er durch Mutters Tod versteinert, unfähig, eine Gefühlsregung zu zeigen. Das würde sich jetzt ändern, da war Mimi sicher. Welch ein glücklicher Zufall, dass sie ausgerechnet heute schon so früh auf den Beinen gewesen war. Sie hatte ein Hausstandsbuch besorgt, denn sie hatte die neue Hausdame in Verdacht, sich regelmäßig Lebensmittel abzuzweigen, die auf Dahlströmsche Rechnung geliefert wurden. Zwar litten sie nicht gerade Hunger, lebten aber auch nicht im Überfluss. Vater hatte schließlich sämtliche Ersparnisse in sein Kanalprojekt gesteckt. Auf dem Heimweg hatte sie dann einen Zeitungsjungen gehört, der die Schlagzeile herausbrüllte:
»Kanal beschlossene Sache, der Nord-Ostsee-Kanal kommt!«
Für einen Moment war ihr geradezu die Luft weggeblieben. Das war eine gute Nachricht, ach was, das war die beste Nachricht, die sie sich vorstellen konnte. Sie würde ihren Vater ganz bestimmt aus seiner Trauer reißen und ihm mehr als nur ein Lächeln entlocken. Sofort hatte sie eine Ausgabe gekauft und war nach Hause gerannt. Trotz der Kälte lief ihr der Schweiß den Rücken herunter, als sie jetzt das Haus betrat. Sie hielt die Aufregung nicht mehr länger aus.
»Vati?«, rief sie, kaum dass sie die Tür hinter sich geschlossen hatte. Er antwortete nicht. Wo steckte er nur? »Vati!« Noch in Stiefeln und Mantel stürmte sie ins Speisezimmer. Da saß er und stocherte in seinem Rührei herum. Ohne eine erkennbare Regung sah er sie an. Er schimpfte nicht einmal, dass ihre dreckigen Sohlen Flecken auf dem Teppich hinterlassen könnten.
»Der Nord-Ostsee-Kanal ist genehmigt, Vati.« Sie wedelte mit der Zeitung vor seiner Nase herum. »Es steht alles hier drin«, brachte sie atemlos hervor und strahlte ihn an. Er lächelte nicht, seine Lippen waren fest aufeinandergepresst, seine Kieferknochen traten hervor. »Das ist die Nachricht, auf die du so sehnsüchtig gewartet hast«, sagte sie. Als ob er das nicht selbst am besten wüsste. Nur brachte seine Reaktion, seine fehlende Freude sie eben komplett aus dem Konzept. Glaubte er ihr nicht? Eilig schlug sie die Seite auf und tippte mit dem Finger auf den Artikel. Er schluckte hart, beugte sich über die Rubrik Aktuelles und las. Gespannt betrachtete sie seine Augen, die von einer Zeile zur nächsten eilten. Höchstens noch eine Sekunde, dann würden sich seine Lippen verziehen und sein Gesicht würde leuchten. Sie konnte es nicht erwarten. Endlich blickte er zu ihr auf, die Wangen fahl, die Augen leer.
»Der Reichstag hat dem Gesetzentwurf zugestimmt. Der Kanal wird gebaut werden«, sagte er heiser.
»So ist es, Vati. Ist das nicht wunderbar?« Mimi lachte.
»Sie hat es nicht mehr erleben dürfen«, antwortete er so leise, dass sie glaubte, sich verhört zu haben. »Zu spät, Mimi, begreifst du das denn nicht?«, schrie er plötzlich auf. »Deine Mutter hat es nicht mehr erlebt, es hat keinen Sinn mehr.« Er schlug die Hände vor das Gesicht und begann zu weinen. Wie lange hatte sie sich gewünscht, er würde seine Gefühle zeigen, seine Trauer mit ihr teilen. Wenigstens wenn er allein mit ihr war, mit seiner Erstgeborenen. Jetzt erschreckte es sie. Noch nie zuvor hatte sie ihn so verletzlich gesehen, so hilflos. Was sollte sie nur tun? Mimi legte die Arme um seine bebenden Schultern. Kurz meinte sie, er würde sie wegstoßen. Sie presste sich fest an ihn und merkte, dass auch ihr die Tränen über die Wangen liefen. So lange hatte sie sich zusammengerissen, war sie stark geblieben für ihre jüngeren Geschwister. Vor allem für Brüderchen Paul. Nicht einmal seinen ersten Geburtstag hatte Mutter erlebt. An ihrem Sarg hatte Mimi ihr still versprochen, ihm die Mutter zu ersetzen. Sie riss sich zusammen, wenn die Trauer sie auch manches Mal zu überwältigen drohte. Jetzt stürzte die Mauer auf einen Schlag ein, die sie um ihren Kummer gebaut hatte. Mimi und ihr Vater kämpften nicht mehr. Für ein paar Sekunden kümmerte es sie nicht, dass sie ein Vorbild sein müssten, die Kleinen sie womöglich hören könnten. Der Schmerz rollte über sie hinweg wie eine riesige Welle, und sie überließen sich einfach der Strömung.
»Sie hat so viel mit mir durchgemacht«, murmelte er schließlich, rieb sich die Augen und sah Mimi an. »Manchmal denke ich, der Kanal hat schon einen Menschen auf dem Gewissen, ehe er überhaupt gebaut ist.«
»Sie war krank«, wandte sie ein, »dafür kann doch der Kanal nichts.« Vor ziemlich genau einem Jahr hatte das Unglück seinen Anfang genommen. Großmutter Dreyer war gestorben. Mit 93 Jahren, ein unvorstellbares, ein wunderbares Alter. Natürlich waren Vater und Mutter zum Begräbnis gegangen, trotz des starken Schneetreibens und des biestigen Oststurms. Danach hatte ihre Mutter schrecklich zu husten begonnen. Zuerst war von einer schweren Erkältung die Rede gewesen, später sprach der Arzt von Rippenfellentzündung. Fünf lange Monate hatte sie im Bett gelegen und gegen die Fieberflammen gekämpft, die ihren Körper zu verschlingen drohten. Sie hatte den Kampf verloren.
»Hast recht, Kind«, sagte er und räusperte sich. »Ich darf nicht ihm in die Schuhe schieben, was mir anzukreiden ist. Ich bin der Schuldige, mit dem sie zu viel hat durchmachen müssen.« Ihm brach die Stimme.
»Aber das stimmt doch nicht, Vati«, erwiderte sie zitternd und streichelte ihm über den Arm. »Du warst immer gut zu ihr. Sie hat dich sehr lieb gehabt, das weiß ich genau.«
»Vielleicht hat sie mich mehr geliebt, als ich es verdient habe.« Er putzte sich die Nase und sah Mimi an. »Hat sie dir je von meinen Reisen für Alfred Nobel und sein Sprengöl erzählt?« Mimi schüttelte den Kopf. »Ich habe es für ihn in deutschen Grubenbezirken vorgeführt, bin damit sogar nach London und Russland gereist.« Er lächelte schwach. »Wie oft habe ich meine Geschichten zum Besten gegeben! Hinterher hatte ich gut lachen, doch ihr blieb die Heiterkeit manches Mal im Halse stecken. Sie hatte vollkommen recht, mir war damals nicht einmal klar, dass der falsche Umgang mit dem explosiven Stoff lebensgefährlich war. Ich habe ihn einfach in der Reisetasche herumgetragen und zu gern zu Demonstrationszwecken an die Wand geschleudert.«
»Wie bitte?«
»Ja, du hast richtig gehört. Der arme Kerl, der nach mir für Nobel in der Welt unterwegs war, hatte weniger Glück als ich. Er ist mitsamt seinem Wagen in die Luft geflogen. Nichts ist von ihm geblieben, außer einem Stiefel, der hoch über der Unfallstelle in einem Baum gefunden wurde.« Für ein paar kostbare Sekunden nahm er sie mit in die Vergangenheit, in der ihre Mutter noch lebte und alles in schönster Ordnung war. »Deine Mutter muss Todesängste ausgestanden haben«, sagte er matt. »In ihren Augen war Dynamit ein wahres Teufelszeug.« Er griff Mimis Hände so plötzlich, dass sie beinahe aufgeschrien hätte. »Dabei ist es ein Geschenk. Was hat es nicht alles möglich gemacht?« Dann schwärmte er von dem Genfer Bauunternehmer Louis Favre, der mit Hilfe des Sprengstoffs in Rekordzeit einen Tunnel durch das Schweizer Gotthardmassiv getrieben hatte. »Der längste Tunnel der Welt, Mimi. Siebzehn Kilometer. Und sie haben nicht einmal siebeneinhalb Jahre gebraucht. Eine wahre Meisterleistung der Ingenieurskunst! Die Zeitungen waren voll davon.« Seine Augen glänzten beinahe fiebrig, Mimi wusste nicht, was sie von diesem plötzlichen Stimmungsumschwung halten sollte. »Nur über die Arbeiter, die, vom Ehrgeiz Favres angespornt, bis zur kompletten Erschöpfung geschuftet haben, war keine Silbe zu lesen. Der Anstand hätte es verlangt, ihre Leistung anzuerkennen.«
Kurz kehrte Stille ein. Mimi wollte auf sein eigenes Sensationsbauwerk zu sprechen kommen. Der Nord-Ostsee-Kanal war genehmigt. Zu spät für Mutter, gewiss, aber Vater war noch am Leben. Er musste weitermachen, in die Zukunft schauen.
»Du wirst es besser machen, Vati, du wirst dafür sorgen, dass die Kanalarbeiter angemessen gewürdigt werden«, sagte sie und lächelte.
»Wie soll ich das tun ohne sie?« Er verbarg sein Gesicht wieder hinter seinen Händen.
Ihre Mutter hatte die gleiche Sorge gehabt. Sie hatte Angst gehabt, ihn im Stich zu lassen, wenn sie ans Bett gefesselt war. Wie sollte Hermann denn alles allein schaffen, die fünf Kinder, den Kanal? Dieser Gedanke hatte sie umgetrieben, das wusste Mimi, obwohl ihre Mutter alles darangesetzt hatte, es vor ihr zu verbergen.
Noch etwas fiel Mimi ein: »Sie war schrecklich stolz auf dich. Immer hat sie davon gesprochen. ›Wer hätte gedacht, dass der Sohn eines Klavierbauers einmal das größte Unternehmen des Kaiserreichs planen würde?‹«, ahmte sie ihre Mutter nach. »Sie hat mir erzählt, dass du den Betrieb deines Vaters übernehmen solltest, aber nicht konntest, weil du zu schmächtig warst und allergisch auf Holzstaub«, sagte sie jetzt mit leiser Stimme.
»Ich habe meine Ausbildung sehr wohl gemacht«, verteidigte er sich, wischte sich über die feuchten Wangen und setzte zerknirscht hinzu: »Allerdings ist es wahr, der feine Staub hat meinen Atemwegen so sehr zugesetzt, dass ich in der Werkstatt einen Blutsturz bekam.«
»Gut so«, meinte Mimi munter. Als er fragend die Augenbrauen hob, sagte sie: »Mutti behauptete immer, du bist ein Tüftler, kein Tischler. Sie hat mir erzählt, du hättest dir ein wahres Wunderding ausgedacht, als du gerade mal sechzehn warst.«
»Ein mit Wasserstoffgas betriebenes Perpetuum mobile«, erklärte er stolz. Wie es aussah, gelang ihr Ablenkungsmanöver. »Das sollte es zumindest werden. Na ja, meine Maschine war noch nicht ausgereift, war aber immerhin so interessant, dass sie die Aufmerksamkeit von Werner von Siemens erregt hat. Er ist extra zu uns nach Hause gekommen, um sich meine Konstruktion anzusehen. Siemens wollte mich sogar nach Berlin holen. Tja, daraus wurde nichts.«
Mimi und ihr Vater hatten sich immer nahegestanden. In gewisser Weise war sie aus dem selben Holz wie er. So wie an diesem Morgen hatten sie jedoch noch nie miteinander gesprochen. Er vertraute sich ihr an, wie er sich sonst wohl nur seiner Frau anvertraut hatte. Ein Gefühl tiefster Zufriedenheit breitete sich in ihr aus. Sie sah ihn an und bekam Angst, denn er starrte plötzlich wieder vor sich hin. Alles Lebendige, über das sie sich eben noch so gefreut hatte, war dahin.
»Vati?«
»Es ist und bleibt meine Schuld.« Ehe sie Einspruch erheben konnte, fuhr er fort: »Vier Geburten allzu rasch nacheinander haben ihr die Kraft geraubt. Es war zu viel für sie. Und selbst während sie in Kiel im Krankenhaus lag, hatte ich nur mein Projekt im Sinn.«
»Ich denke, du warst in Kiel, um in ihrer Nähe zu sein«, warf sie zaghaft ein. Er seufzte so tief, dass es ihr das Herz zerriss.
»Und doch habe ich sie zu oft allein gelassen und mich in Unterlagen vergraben. Ich konnte doch nicht zulassen, dass Henry Strousberg Elbe und Oder durch eine Wasserstraße verbindet und damit Berlin zum ersten Handelsplatz des Reiches macht«, stieß er verzweifelt hervor.
»Strousberg?«
Er nickte. »Ihm gehörte ein Hüttenwerk in Dortmund, ich hatte ihn durch das Dynamit kennengelernt. Eisenbahnkönig wurde er genannt«, sagte er abfällig. »Die Art und Weise, wie Strousberg Konzessionen für so manche Strecke erworben hat, soll ebenso wenig seriös gewesen sein wie seine Finanzierungskonzepte. Trotzdem ist er kein übler Kerl. Bloß dass er sich mit einem Kanal beschäftigt hat, der quer durch Schleswig-Holstein führen sollte, habe ich ihm angekreidet. Er vertrat den Standpunkt, Berlin sei das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Reiches, das müsse seine Lage widerspiegeln. Strousberg wollte allen Ernstes und ganz bewusst dem Hamburger Hafen das Wasser abgraben.« Vater schüttelte den Kopf. »Ihm war die privilegierte wirtschaftliche Stellung der Hansestadt schon länger ein Dorn im Auge. Sein Plan war nicht realisierbar, das war mir klar, doch allein seine Idee war schon eine Provokation. Was wäre geschehen, wenn er Irre gefunden hätte, die ihn unterstützt hätten? Ich konnte nicht zulassen, dass die Bedeutung des Hamburger Hafens an Berlin abgetreten würde.«
»Das hätte sie auch nicht gewollt«, sagte sie.
»Ach, Mimi, du hast ja recht. Du bist schon so erwachsen mit deinen zwölf Jahren. Deine Mutter hat den Kanal beinahe so sehr gewollt wie ich. Sie hat mich ausgehalten, wenn ich mich wie besessen durch Berge von Papier gewühlt, statistisches Material gesammelt, zuverlässige Ertragsberechnungen angestellt und Schriften herausgegeben habe, wenn ich mich mit bedeutenden Männern traf, um sie zu überzeugen. Ich wollte unbedingt derjenige sein, der aus der ewigen Vision endlich ein reales Bauwerk macht, zum Wohle des Reiches und zum Wohle Hamburgs!« Hatte er eben noch kämpferisch geklungen, drang jetzt wieder ein Laut aus seiner Kehle, der ihr durch Mark und Bein ging. »Es hat mich mein Vermögen gekostet. Unser Vermögen. Ich wollte ihr die Welt zu Füßen legen, mit ihr von Finnland durch meinen Kanal reisen und weiter bis nach London oder nach Irland. Wenigstens ein Häuschen im Grünen wollte ich ihr kaufen. Nicht mehr ständig getrennt sein, mit euch durch die Wälder streifen, Tannenzapfen sammeln oder Kastanien. Das hätte ihr gefallen. Ich werde ihr nie etwas dafür zurückgeben können!« Seine Stimme brach erneut, Tränen rannen ihm über die Wangen.
»Ja, das hat sie sich sehr gewünscht«, sagte Mimi sanft. »Weißt du auch, warum?« Er antwortete nicht. »Weil sie wusste, wie sehr du es genossen hättest.« Er blickte auf. »Das hat sie mir verraten. ›All die Planer und Ingenieure, mit denen er zu tun hat‹, hat sie mal zu mir gesagt, ›erleben ihn nur energisch und konzentriert. Sie können ihn sich nicht ausgelassen tobend vorstellen.‹ Und dann hat sie noch etwas gesagt, nämlich dass du der sensibelste und romantischste Mensch bist, der ihr je begegnet ist. Du hast ihr die schönsten Liebesbriefe geschrieben, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, hat sie gesagt.« Mimi schluckte. »Vielleicht hast du ihr viel mehr gegeben, als du ahnst.«
Ihr Vater schnäuzte sich und lächelte, seine Augen glänzten.
»Du hast recht, Mimi, es ist gut, dass der Kanal kommt, es ist sogar ganz wunderbar.«
Gut zwei Wochen später, am 16. März 1886 gab es kein Zittern und Bangen mehr, Kaiser Wilhelm hatte aus dem Entschluss ein Gesetz gemacht:
Wir, Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen, verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und des Reichstags, was folgt: Es wird ein für die Benutzung durch die deutsche Kriegsflotte geeigneter Schifffahrtskanal von der Elbmündung über Rendsburg nach der Kieler Bucht … hergestellt.
Kapitel 2
Justine
Kiel, Mai 1886
Justine wusste nicht, wo ihr der Kopf stand. Sie eilte den Lorentzendamm herunter, nahm die Schlote der Dampfmaschinenfabrik von Schweffel & Howaldt kaum wahr, die sämtliche Gebäude der Straße überragten. Sie musste pünktlich bei Gericht sein, um die Papiere ihres Vaters abzuliefern. Das Gespräch in der Möbeltischlerei Jessen hatte länger gedauert als erwartet. Sie hatte Rudolf Jessen höchstpersönlich die erneuten Änderungswünsche mitgeteilt.
»Sie wollen die Regale zehn Zentimeter tiefer haben?« Er hatte ungläubig die Augenbrauen hochgezogen, wie schon die beiden Male zuvor. »Sämtliche Bretter?« Dann hatte er sich nachdenklich das Kinn gerieben, ehe er aussprach, worauf sie bereits gewartet hatte: »Das wird dann aber kräftig teurer!« Wenigstens hatte er sich inzwischen daran gewöhnt, Anweisungen und Aufträge von ihr für voll zu nehmen. Jeder in Kiel wusste, dass Justine Thams nicht nur den Haushalt unter ihren Fittichen hatte, sondern auch sämtliche Schreibarbeiten für ihren Vater Wilfried Thams und dessen Vater Gregor. Ihre Mutter Ruthild verfüge über eine schwache Konstitution, hieß es. Man konnte ihr unmöglich zumuten, sich selbst um die Einkäufe, das Kochen, Backen und Putzen zu kümmern. Also fielen diese Aufgaben selbstverständlich der ältesten Tochter zu. Kein Kieler konnte daran etwas Ungewöhnliches finden. Aber eine junge Frau, die Rechnungen ausstellte und Geschäftsbriefe verfasste? Ein Unding! Um derlei Angelegenheiten hätte sich ihr Bruder Jobst kümmern sollen, immerhin der älteste Thams-Sohn.
»Kein Wunder, dass der die Flucht ergriffen hat«, tuschelten einige hinter vorgehaltener Hand. »Wer will schon sein Leben lang Plunder und Trödel verkaufen?«
Oder: »Ein schöner Kolonialwarenladen ist das, in dem man stundenlang warten muss, bis der alte Thams eine Rolle Garn gefunden hat. Zum Trost spielt er einem etwas auf der Mundharmonika vor, wenn man Pech hat.«
Die Leute redeten viel, wenn der Tag lang war. Dummerweise hatten sie nicht unrecht. Justine wusste, wie sehr ihr Vater unter dem schrecklichen Durcheinander litt, das in Schubladen und Regalen, in Ecken und Abseiten, einfach in jedem Winkel der Geschäftsräume herrschte. Nicht mehr lange. Der Kanal änderte alles, mit dem Bau würde sein Geschäft prosperieren. Vater sprach von nichts anderem, seit Bismarck vor zwei Monaten den Bau endlich per Gesetz amtlich gemacht hatte. Justine war sich da nicht so sicher. Kiel besaß schon eine Universität, als das längst nicht selbstverständlich war. Auch davon hatten sich die Menschen viel versprochen.
»Hat ihre Gründung etwa zum Erblühen der Kunst und der Forschung geführt?«, hatte Thorin sie einmal gefragt, ohne jedoch eine Antwort von ihr zu erwarten. »Pustekuchen, die Einwohner taten sich sogar schwer mit den Studenten.« Dann hatte er frech gezwinkert. »Mag sein, dass einige der Hochschüler nicht gerade hochanständig waren, weil sie nicht der städtischen Gerichtsbarkeit unterlagen. Wie dem auch sei, jedenfalls ist Kiel erst zu einer Stadt von Format geworden, als die Marine das verschlafene Nest für sich entdeckt hat.«
»Ein verschlafenes Nest war Kiel sicher nicht«, hatte Justine einwenden wollen, war aber nicht weit gekommen.
»Dann eben Dornröschen. Nur dass es kein Prinz war, der es wachgeküsst hat, sondern das Militär. Erst als seine Werften aus dem Boden schossen und Arbeiter anlockten, mauserte sich das Nest, Pardon, Dornröschen zur strahlenden Königin.«
Würde nun der Kanal Arbeiter in Scharen anlocken und das Wachstum der Stadt vorantreiben? Dann konnten Vaters Träume womöglich doch in Erfüllung gehen. Und ihre gleich mit. Sie musste lächeln. Es würde endgültig Schluss sein mit dem vollgestopften Laden, der überall nur Trödel-Thams genannt wurde.
Wie unterschiedlich Vater und Großvater waren, ging ihr durch den Kopf, als sie das Gerichtsgebäude verlassen hatte. Äußerlich glichen sie sich sehr, die gleichen wässrigen blauen Augen, der gleiche rötlich braune Schopf, sorgsam gescheitelt, und auch einen vollen Bart trugen beide, nur dass Vater noch nicht so viele graue Strähnen hatte. Und Vaters Bart war stets adrett gestutzt und gekämmt. Der von Großvater erinnerte Justine an dichtes Gestrüpp. Ihr Wesen unterschied sich dagegen so sehr, dass Justine manchmal am Familienstammbaum zweifelte. Vater war wie ein Zirkusdirektor, der Menschen kommandieren und Angelegenheiten regeln konnte. Großvater erinnerte sie eher an einen Clown in der Manege, der sein Publikum zum Lachen und zum Träumen brachte. Ihre erste bewusste Erinnerung an ihren Großvater führte sie zurück an einen schwülen Augusttag, an dem es am Nachmittag zu gewittern begonnen hatte. Justine hatte schreckliche Angst gehabt. Großvater Gregor dagegen war regelrecht aus dem Häuschen gewesen.
»Das ist kein Gewitter, Stine, das ist die Untermalung für einen Überfall.« Ehe sie begriffen hatte, war auch schon das schöne alte Kaspertheater hervorgeholt gewesen. Justine spielte Kasper, Gretel und die Großmutter, er übernahm den bösen Räuber und den Polizisten, der zu Hilfe gerufen wurde. Im Nu hatte Justine ihre Angst vergessen, denn sie steckte im wildesten Spiel. Je lauter es donnerte und grollte, desto lieber war es ihr, denn plötzlich gehörte das Tosen draußen zur Geschichte, die Großvater Gregor und sie sich ausdachten.
Vor zwei Jahren, als die Gerüchte um eine künstliche Wasserstraße auch bis in den letzten Winkel der Stadt gedrungen waren, hatte Vater darauf bestanden, endlich als Geschäftsführer eingetragen zu werden. Das war geschehen, geändert hatte sich trotzdem kaum etwas. Großvater würde noch lange nicht loslassen, und so resolut Vater sonst auch war, diese eine Angelegenheit, so schien es, bekam er einfach nicht in den Griff.
Endlich, die Papiere waren rechtzeitig abgeliefert, jetzt hatte sie Fleethörn erreicht. Die Sonne schien, am Himmel kündigte sich jedoch der nächste Regen an. Man konnte ihn schon riechen.
»Du führst jetzt das Geschäft«, sagte ihr Großvater eins um das andere Mal, »ich bin nur noch zu Gast.« Aber jeder wusste, das war geflunkert. Obwohl Vater sich längst um den Wareneinkauf kümmerte, fand sich stets plötzlich ein Kleinod in irgendeiner Ecke, nachdem Großvater seinen täglichen Besuch absolviert hatte. Jeder hätte geschworen, es noch nie zuvor gesehen zu haben, doch Großvater behauptete stur, dieser bunte Brummkreisel oder jener glitzernde Lampenschirm warte doch nun wirklich schon seit Ewigkeiten auf seinen Käufer. Möglich, dass er kürzlich ein wenig umgeräumt habe. Zu weitergehenden Geständnissen war er nie zu bewegen. Von dem Geschäft als einem Kolonialwarenladen zu sprechen, war so falsch wie die Behauptung, Vater treffe die Entscheidungen. Zwar gab es auch Kaffee, Zucker und Tee zu kaufen, von Letzterem vor allem Großvaters Lieblingssorte, die die drei großzügigen ineinander übergehenden Räume mit Bergamotte-Duft erfüllte. Hauptsächlich jedoch handelte es sich um eine undurchdringbare Ansammlung der herrlichsten Gegenstände. Da war ein riesiger Küchenschrank, noch gar nicht mal so alt. Seine Besonderheit: Die Behälter für Mehl, Grieß, Erbsen, Salz oder Sago, selbst der Bottich für die Zwiebeln und die Fliesen der Arbeitsfläche waren statt mit der immer gleichen Mühle, die man sonst überall sehen konnte, mit verschiedenen Hamburger Motiven verziert. Und fein gezeichnet waren sie, federleichte himmelblaue Kunstwerke, wie Großvater sagte. Dann war da noch das Puppengeschirr, komplett für zwölf Püppchen und Stofftiere, ein Paravent, mit golddurchwirktem altrosafarbenem Stoff bezogen, der angeblich aus Versailles stammte. Es gab einen bunt bemalten Schrank. Keinen gewöhnlichen Schrank natürlich. Öffnete man die Türen, betrat man eine winzige Welt. Großvater hatte einen Alkoven mit verschnörkelten, ebenfalls bunt bemalten Lehnen geschaffen und mit großen Kissen, Polstern und Decken vollgestopft, so dass Justine gerade noch dazwischenpasste. Das war ihr Rückzugsort. Und dann war da noch das gute alte Kaspertheater, das Großvater trotz des hohen Preises schon mehrmals hätte verkaufen können. Nur redete er es jedem seiner Kunden geschickt aus. Er hatte wohl zu viel Freude daran, wenn Justine an der Kordel zog, der Vorhang sich langsam öffnete und sie die Bühne, die eigentlich hübschen Handpuppen gehören sollte, zu einem Ladentisch umfunktionierte.
»Guten Tag, die Herrschaften, was darf es sein?«, fragte sie jedes Mal, und Großvater dachte sich die absonderlichsten Dinge aus, die er verlangte.
»Ein Viertelpfund frisch gepflückten Erdbeerreis«, sagte er zum Beispiel. Oder: »Ich hätte gern einen Liter Mehl mit einer Prise Curry-Kaffee.«
Justine pflegte in der gleichen Art zu antworten: »Tut mir sehr leid, der Erdbeerreis ist aus, aber frisch gepflücktes Erdbeereis hätten wir anzubieten.« Oder: »Wünschen Sie den Curry-Kaffee über das Mehl gestreut oder auf einem Extra-Teller?«
Läutete mal das Glöckchen an der Ladentür, während sie im Spiel waren, betätigte Justine rasch die zweite Kordel, während sich Großvater formvollendet entschuldigte: »Verzeihung, gnädige Frau, ich bin in einer Minute zurück.«
Sie konnte noch sehen, wie seine Augen blitzten, ehe sich der Vorhang zwischen ihnen schloss und er zu einem Kunden eilte. Justine liebte diese seltenen Gelegenheiten. Sie waren nicht etwa rar, weil Großvater viele Kunden gehabt hätte, schon gar nicht, seit er sich aufs Altenteil zurückgezogen hatte, wie er immer wieder betonte, und Vater sich um die Kundschaft kümmerte. Es lag daran, dass Justine wenig Zeit für Vergnügungen blieb. Neben dem Haushalt und den Arbeiten für Vater – neuerdings rechnete sie sogar Bilanz und Jahresabschluss durch – war sie für die Erziehung ihrer jüngeren Schwester Jette zuständig und natürlich für Nesthäkchen Jens. Jeden Abend dachte sie sich für die beiden Geschichten zum Einschlafen aus. Es freute sie, wenn Jette zwar stets betonte, dass sie mit ihren 14 Jahren zu alt dafür sei, dann aber doch gespannt die Ohren spitzte. So viel Freude sie auch an Zahlen und an ihren Geschwistern hatte, so sehr hoffte sie, Vaters Pläne mögen aufgehen. Dann wäre sie frei und konnte tun, was sie wollte. Was genau das sein sollte, wusste sie noch nicht, aber eins wusste sie sicher: Sie wollte etwas haben, das nur ihr gehörte. Etwas, wo ihre Phantasie den Ton angeben und niemand ihr hereinreden durfte.
Sie hatte sich ordentlich beeilt und war nun ein wenig außer Atem, als sie auf das Stadttheater zulief. Mit Glück würde sie Thorin abfangen können, der nach der Vormittagsprobe etwa um diese Zeit in die Pause gehen musste. Wenn er sich nur nicht wieder mit Direktor Hoffmann anlegte. Sie konnte den Gedanken nicht verfolgen, denn in dem Moment sah sie ihn. Lässig und gleichzeitig elegant wie ein Tänzer sprang er die Treppe hinab. Sein schwarzes Haar glänzte in der Sonne. Seine Eltern waren beide in Kiel geboren, seine Großeltern kamen ebenfalls aus Schleswig-Holstein, soweit sie wusste, trotzdem behauptete er, von Spaniern abzustammen. Sein dunkler Schopf und seine braunen Augen sprachen dafür. Und sagte man Spaniern nicht auch einen ausgeprägten Stolz nach?
»Stine«, rief er, als er sie bemerkte. Sein Gesicht verzog sich zu einem strahlenden Lächeln, und ihr Herz stolperte über seine eigenen Füße. So fühlte es sich an.
»Ich war gerade in der Gegend«, flunkerte sie und spürte, wie ihre Wangen brannten. Wie lange kannten sie sich jetzt? Vier Jahre! Würde es denn nie aufhören, dass sie rot wurde wie Klatschmohn, sobald er in ihrer Nähe war?
»Wie schade, ich dachte schon, du bist meinetwegen hier.« Er nahm ihre Hände und betrachtete sie von oben bis unten. »Hübsch. Neues Kleid?«
»Aber nein.« Als ob sie sich ein neues Kleid leisten könnte, ehe die alten nicht zerschlissen waren.
»Sieh mal an, ich dachte. Du bist einfach so hübsch, dass alles an dir neu und kostbar aussieht.« Ein warmes Gefühl durchflutete sie, denn sie fand sich nicht sonderlich hübsch. Sie war klein und drahtig. Zwar fehlte es ihr nicht an weiblichen Rundungen, trotzdem hatte ihr Bruder sie früher manchmal Justus genannt, weil sie so burschikos gewirkt hatte. Um ihre Weiblichkeit zu unterstreichen, hatte sie sich die dunkelbraunen Haare bis zur Hüfte wachsen lassen. Thorin mochte es, wenn sie sie offen trug, aber meistens trug sie einen Zopf, weil es viel praktischer war.
Er ließ sie los und schlenderte über den Rasen. Justine sah sich verstohlen um. Es war nicht erwünscht, mitten durch die Grünanlagen zu stiefeln, man hatte auf dem Sandweg zu bleiben. Nur was sollte sie tun? Er sollte schließlich denken, sie gäbe so wenig auf das Gerede der Leute wie er.
»Wann darf ich dich endlich Direktor Hoffmann vorstellen? Du gehörst auf die Bühne!« Thorin bückte sich, pflückte ein Gänseblümchen und schob den Stängel in den Mundwinkel.
»So ein dummes Zeug aber auch.« Sie konnte ein nervöses Kichern nicht unterdrücken. Allein die Vorstellung, im Theater aufzutreten, raubte ihr den Atem. Womöglich sogar hier in diesem prachtvollen Bauwerk. Sie ließ ihren Blick über die Gesimse wandern und den Turm hinauf, der zwischen zwei Gebäudehälften den spitzen Helm in den Mai-Himmel reckte. Den Saal und das Foyer stellte sie sich noch viel beeindruckender vor, purer Prunk gewiss. Das jedenfalls erzählte Thorin manchmal. Sie selbst kannte es nicht von innen, bisher war sie nicht einmal als Zuschauerin drinnen gewesen. Überhaupt hatte sie erst zweimal im Leben ein Theater besucht.
»Dumm ist nur, wenn du dich weiter hinter einem Ladentisch oder womöglich im Kontor deines Vaters versteckst«, hörte sie ihn sagen.
»Ich verstecke mich nicht, das weißt du.«
»Du könntest meine Geliebte spielen. Das dürfte dir nicht schwerfallen.« Er blieb stehen und wandte sich ihr zu. Justine wurde richtig ein bisschen blümerant, wenn er sie so ansah.
»Wenn überhaupt, dann würde ich eine anständige Frau spielen. Deine Ehefrau vielleicht.«
Er trat einen Schritt auf sie zu.
»Könntest du dir das vorstellen? Meine Ehefrau zu sein, meine ich?«
Sie schnappte nach Luft.
»Du meinst …«
»Auf der Bühne natürlich.«
So ein Glück, dass er sich wieder in Bewegung setzte, sonst hätte er ihre Enttäuschung gesehen. Sie hatte doch allen Ernstes geglaubt, er würde ihr einen Antrag machen. Unfug. Selbst wenn er wollte, war das nicht möglich. Noch nicht. Erst musste er einen Vertrag für die nächsten Jahre in der Tasche haben und mehr verdienen. Das hatte er ihr oft genug erklärt. Sie holte ihn am Ende der Rasenfläche ein, wo er sich auf einem großen Findling niederließ und seine Stulle auswickelte. Thorin beäugte das Klappbrot lustlos. Ein schönes Stück Braten mit Kartoffeln wäre ihm sicher lieber. Konnte sie verstehen. Allerdings konnte jeder in diesen Zeiten froh sein, der genug zu essen hatte. Justine seufzte. Thorin hatte schon recht, erst musste er eine Familie ernähren können, ehe sie heirateten. Das hatte Zeit, sie waren schließlich noch jung.
»Hier, magst du?« Er hielt ihr sein karges Mittagessen hin, sie schüttelte ablehnend den Kopf. »Ich habe auch keinen Appetit.« Seine Augen funkelten zornig.
»Wieso, ist dir etwas auf den Magen geschlagen?« Sie ahnte Böses.
»Das kann man wohl sagen!« Wütend spuckte er das Gänseblümchen aus und biss nun doch in die Stulle. Der Hunger war offenbar größer als der Ärger. »Es ist immer das Gleiche, ich trete in diesem Schuppen auf der Stelle. Mein Talent wird hier einfach nicht ausreichend gewürdigt.«
»Der Schuppen ist das Stadttheater«, erinnerte sie ihn leise und sah ängstlich zu zwei Herren hinüber, die gerade auf das Portal zugingen. Sie konnten Thorin unmöglich gehört haben, aber man konnte nie wissen. »Hast du mir nicht erzählt, du hättest in dem neuen Stück die größte Nebenrolle? Würden sie dein Talent nicht erkennen und schätzen, hätten sie sie dir nicht gegeben.«
»Darum geht es nicht. Der Regisseur ist ein Dilettant.« Sie sah ihn fragend an. »Ein Stümper. Er versteht nichts von echter Kunst. Trotzdem hält er sich für einen Puppenspieler, dessen Leistung darin besteht, Marionetten mit Holzköpfen zu dirigieren. Aber hier drin«, er tippte sich an die Stirn, »ist kein Stroh. Ich bin der Künstler. Ich kann das Publikum zum Lachen oder zum Weinen bringen. Er hat mir nichts zu sagen.«
»Du verstehst natürlich viel mehr davon als ich. Aber ist nicht gerade das die Aufgabe des Regisseurs, den Schauspielern zu sagen, was sie zu tun haben?«
»Er begreift nicht einmal, worum es in dem Stück geht. Außerdem, was heißt schon größte Nebenrolle?« Er schnaufte herablassend. »Ich spiele einen Vize-Kirchen-Vorsteher und Gewürzkrämer. Eine traurige Figur.«
»Worum geht es überhaupt?«
»Das Stück heißt Die deutschen Kleinstädter. Sehr passend.« Er lachte auf. »Es geht um Geltungssucht, darum, dass jemand sich mit einem komplizierten Titel aufwerten will. Es hätte geradezu für Kiel geschrieben worden sein können. Haben wir nicht viel zu viele Beamtenseelen, kleingeistige Bürokraten, die sich in ihren Vorschriften verzetteln und vor Stolz platzen, wenn man ihnen einen Titel verleiht? Es ist die reine Kritik, von Kotzebue hält dem Publikum einen Spiegel vor.«
»Ist das der Regisseur?«
»Nein, Stine, das ist der Schriftsteller. Unser feiner Herr Regisseur inszeniert das Ganze als großen Klamauk. Niemand wird sich angesprochen fühlen, sondern alle werden über die dümmlichen Figuren lachen. Von denen ich eine bin«, stieß er zwischen den Zähnen hervor. »Er versteht das Stück einfach nicht«, wiederholte er und ließ die Schultern sinken.
»Das hast du ihm hoffentlich nicht gesagt.«
Sofort war die Spannung zurück in seinem Körper.
»Selbstverständlich habe ich das.« Der letzte Happen Brot verschwand zwischen seinen Lippen, er erhob sich von dem Stein und baute sich mit übertrieben durchgedrücktem Rücken vor ihr auf, den rechten Zeigefinger nach oben gestreckt. »Beim nächften Mal melde ich Fie dem Herrn Direktor«, machte er den Regisseur mit vollem Mund und prallen Wangen nach. Justine musste lachen, obwohl ihr nicht danach zumute war. Er war schon mal mit Direktor Hoffmann aneinandergeraten.
»Er findet keinen besseren Darsteller, die Leute lieben mich«, hatte Thorin damals behauptet. »Das weiß er genau. Er wird mich niemals fortjagen.«
Sie fragte sich nur, warum der Direktor ihm dann noch keinen Vertrag für mehrere Jahre gegeben hatte, den Thorin sich so sehr wünschte.
Außerdem hatte sie noch allzu deutlich Hoffmanns Drohung im Kopf: »Treiben Sie es nicht zu weit, mein Freund. Glauben Sie mir, talentierte junge Burschen stehen Schlange, sie warten nur darauf, ihre Chance am Stadttheater zu ergreifen.« Thorin hatte es als Bluff abgetan, doch Justine fürchtete, es könnte etwas dran sein. Sicher war Thorin besser als andere. Bloß leider auch aufmüpfiger. Wie lange würden sich die Herren das noch gefallen lassen?
»Ach Stine, du hast es nicht leicht mit mir. Ein anderer könnte dir etwas bieten.« Offensichtlich wartete er darauf, dass sie ihm widersprach, aber was sollte sie denn sagen? Während sie sich noch einen Satz zurechtlegen wollte, fuhr er fort: »Natürlich weißt du, dass ich das irgendwann auch kann. Es steht außer Frage, dass man mich bald in den Hauptrollen besetzen wird. Wer weiß, vielleicht führe ich sogar selbst Regie.« Wie oft hatte er das schon versprochen? Ob alle Männer ständig alles wiederholten? Genau wie bei Tischlermeister Jessen wusste sie auch, was Thorin als Nächstes sagen würde. »Am liebsten hätte ich mein eigenes Schauspielhaus. Ein kleiner Saal würde mir schon reichen. Es gäbe nur moderne Stücke oder Klassiker auf neue Art interpretiert.«
Justine lächelte. Wie sehr sie es liebte, wenn die Leidenschaft für seinen Beruf derartig Besitz von ihm ergriff. Sie verstand nicht jedes Wort, aber sie war in solchen Augenblicken überzeugt davon, dass alles wahr werden könnte, was er sich erträumte. Sie sah es vor sich: Thorin Tüxen verbeugt sich unter tosendem Applaus, und sie, Justine Tüxen wartet schon mit dem Abendessen, das ein Dienstmädchen zubereitet hat.
»Die Vorstellung morgen ist ausverkauft. Wie immer«, würde sie ihn wissen lassen, denn die Zahlen der verkauften Billetts hätte sie selbstverständlich im Kopf. Schließlich würde sie sich um Schreibarbeiten und die Bücher kümmern wie jetzt auch. Plötzlich hatte sie die Kinder vor Augen, die zu gern in Großvaters phantastisches Warenhaus kamen. Bald würde es das nicht mehr geben. Wenn aber Thorin und Justine ein Theater betreiben würden, könnten sie dort ein solches Wunderland einrichten. Das Herz lief ihr über bei dem Gedanken. Der bunte Schrank hätte eine Heimat, genau wie das Kaspertheater.
»Stine?« Sie sah ihn an. »Hast du mir überhaupt zugehört?«
»Natürlich.« Sie senkte den Blick. »Jedenfalls die meiste Zeit.«
»Und habe ich nicht recht? Wenn dein Vater demnächst reich ist, muss er dir etwas abgeben. Das hast du dir verdient. Dann können wir uns vielleicht wirklich ein eigenes Schauspielhaus leisten.«
Eigentlich hatte sie immer gedacht, Thorin würde mit seinen Hauptrollen und einem Fünf- oder Zehnjahresvertrag das nötige Geld verdienen. Sicher gäbe Vater ihr eine Mitgift dazu, aber …
Thorin machte einen Diener.
»Danke für den Besuch, gnädige Frau.« Ein schneller Blick nach rechts und nach links, und ehe sie wusste, wie ihr geschah, küsste er sie auf den Mund. Flüchtig nur, aber in aller Öffentlichkeit. »Ich muss wieder hinein. Es wäre nicht klug, heute auch noch zu spät zur Nachmittagsprobe zu kommen.«
Noch etwas benommen von dem Kuss lief sie die Dänische und Brunswieker hinauf und dann auf der Holtenauer Straße weiter in Richtung Norden. Der Himmel zog immer mehr zu. Hoffentlich erwischte sie nicht ein kräftiger Regenschauer, bis Wik war es noch ein gutes Stück. Ach was, und wenn schon, sie war schließlich nicht aus Zucker. Justine lächelte. Doch etwas störte ihre gute Laune. Wie ein fetter Klecks mitten in einem sonst perfekten Gemälde. Wenn Thorin nur immer so vernünftig wäre, auf Pünktlichkeit und dergleichen Rücksicht zu nehmen. War es das, was ihr die Petersilie verhagelte? Nein. Thorin war ein Hitzkopf, darum liebte sie ihn ja so sehr. Das war es gewiss nicht, was ihr die Stimmung vermieste. Wahrscheinlich war es die allgemeine Aufregung, die allen in den Knochen steckte, seit die Zeitungsjungen lauthals die Neuigkeiten verkündet hatten: »Reichstag hat den Bau des Nord-Ostsee-Kanals beschlossen! Der Kanal kommt. Reichstag hat den Nord-Ostsee-Kanal beschlossen.«
Viele hängten ihre Hoffnungen an das gigantische Bauwerk, von dem bisher nur hier und da etwas zu ahnen war. Auch ihr Vater. Einfacher würde es für ihn sicher werden, wenn sich erst alles eingespielt hatte. Ob er aber gleich im Geld schwimmen würde, wie Thorin meinte, stand in den Sternen. Schön wär’s ja. Ein eigenes Theater, welch eine Vorstellung! Womöglich hatte er recht, wenn sie Gutenachtgeschichten fesselnd erzählen konnte, hatte sie vielleicht auch Talent für die Bühne. Und machte es ihr nicht deshalb solche Freude, mit Großvater zu spielen, weil sie dabei in eine andere Rolle schlüpfen konnte?
Sie atmete einmal tief durch. Die letzten Häuser der Stadt hatte sie hinter sich gelassen. Nun führte sie ihr Weg zwischen Feldern hindurch. Die Schwarzbunten sahen mager aus. Wie sollten die überhaupt noch Milch geben? Auf der anderen Straßenseite setzten Kornblumen blaue Tupfer zwischen die Halme des Hafers. Die ersten Tropfen fielen, als Justine das Dorf Wik eben erreichte. Sie beschleunigte ihren Schritt, nur eine Kurve noch, dann hatte sie die Katenstelle von Heiner Nissen erreicht. Sie riss die hölzerne Pforte auf, die fast völlig von rötlichen Flechten bedeckt war. Ein leises Quietschen, Jobsts Frau Hella, die mit einer Weidenrute in der Hand dabei war, Hühner und Gänse in den Stall zu scheuchen, drehte sich um, erkannte Justine und winkte kurz, ehe sie sich wieder ihrer Aufgabe zuwandte. Bestimmt erwartete sie Gewitter und wollte die Tiere lieber im Stall wissen als auf der Wiese neben dem Haus.
»Da hast du dir aber feines Wetter ausgesucht, um uns besuchen zu kommen«, begrüßte Hella sie fröhlich, nachdem Justine das Tor hinter sich geschlossen hatte und rasch den Sandweg zum strohgedeckten Haus hinaufgekommen war.
»Fast hätte ich es noch geschafft, trocken zu bleiben«, gab sie schnaufend zurück.
»Fast«, wiederholte Hella und sah mitleidig an ihr herunter. Dann lachte sie. »Selbst das Federvieh hat nicht so viel abbekommen wie du. Komm schon rein!«
Justine setzte sich in der Küche neben das Feuer und breitete ihren Rock mit beiden Händen aus. Hella goss dampfenden Tee in einen Becher und stellte ihn vor Justine auf den Tisch.
»Wie geht es deinen Eltern, Opa Gregor und den Kleinen?«, wollte Hella wissen, während sie in eine große Schüssel mit Teig griff und kräftig zu kneten begann.
»Alles bestens.« Justine rollte die Tasse zwischen ihren Handflächen und pustete vorsichtig hinein. Trotz des Herdfeuers, das stets brannte, war es kühl in dem Bauernhaus mit seinen kleinen Fenstern, die nur wenig Sonne und Wärme hereinließen. »Mutter repariert immerhin mal einen Rock oder eine Hose und ruht sich davon mindestens zwei Tage gründlich aus. Vater denkt nur noch an sein Eisenwarengeschäft, wie es in Schleswig-Holstein kein zweites gibt«, sagte sie und bemühte sich, den Tonfall ihres Vaters zu treffen: »Die Veränderung wird zu Wohlstand führen, nicht nur für einige, sondern für alle«, fuhr sie fort. »Gut so.« Sie hörte das Klappen der Haustür. »Es heißt, Kiel werde Flensburg in den Schatten stellen, wenn der Kanal erst da ist. Wirtschaftlich, meine ich. Was auch immer das bedeuten soll.«
Hella zuckte mit den Achseln. Dann öffnete sich die Küchentür, und Jobst trat ein.
»Stines Märchenstunde«, sagte er, küsste Hella und goss sich einen Becher Tee ein.
Wie immer, wenn sie ihren Bruder und ihre Schwägerin beobachtete, versetzte es ihr einen Stich und Sehnsucht machte sich in ihr breit. Sie kannte kein zweites Paar, das sich so sehr liebte. Die Ehe ihrer Eltern war von Höflichkeit und Respekt bestimmt, in der Nachbarschaft gab es nicht wenige, die stritten wie die Kesselflicker. Wenn sie nur an den Bäcker und seine Frau dachte, verging ihr die Lust, selbst einmal zu heiraten. Betrachtete sie dagegen Jobst und Hella, konnte sie es nicht mehr abwarten.
»Ich dachte, du erzählst nur Jens und Jette Gutenachtgeschichten. Jetzt auch Hella? Hoffentlich schläft sie nicht ein, sonst bekommen wir morgen kein frisches Brot.«
»Eine sehr nette Begrüßung, ich muss schon sagen«, beschwerte Justine sich.
Er lachte und kniff ihr in die Wange, was sie auf den Tod nicht ausstehen konnte.
»So besser?«
»Au, verflixt. Lass das!«
Jobst ließ sich auf einem Schemel neben ihr nieder.
»Man kann es dir aber auch nicht rechtmachen.« Seine Augen funkelten. »Ich muss endlich deinen Schauspieler kennenlernen, damit ich ihm sagen kann, wie gut dir das gefällt.« Schon kamen die Knöchel seines Zeige- und Mittelfingers ihr wieder bedrohlich nah. Justine packte sein Handgelenk.
»Untersteh dich!«
Kurz schwieg sie. »Du wolltest uns längst mal wieder besuchen«, sagte sie dann. Sofort schnitt er eine Grimasse. Sie wusste, dass er das nicht hören mochte. »Du hast es versprochen«, erinnerte sie ihn dennoch. »Meinst du nicht, es wäre höchste Zeit?«
»Du hast keine Ahnung, was im Mai auf einem Hof los ist. Der Hühnerstall hat im letzten Winter einiges abgekriegt, ich muss das Dach erneuern. Wir haben zwei Dutzend Küken, das Obstgehölz muss zurückgeschnitten werden, nicht zu vergessen die …«
»Was der Frühling nicht sät, kann der Sommer nicht reifen, der Herbst nicht ernten, der Winter nicht genießen«, platzte Justine dazwischen. »Das bedeutet, der Bauer hat das ganze Jahr über jede Menge zu tun, wenn er über den Winter kommen will. Zumindest kenne ich jemanden, der mir das predigt, so oft er nur kann. Wer war das noch?« Sie legte demonstrativ den Zeigefinger auf ihre Nase, als könne sie so besser nachdenken. Hella wandte sich ihr kurz zu und zwinkerte verschwörerisch, ehe sie den Teig auf zwei kleine ovale Körbe aufteilte und Brotlaibe daraus formte.
»Das war ja klar, ihr Weibsbilder haltet natürlich zusammen.«
»Habe ich etwas gesagt?«, fragte Hella mit Unschuldsmiene.
»Ich sehe doch ein, dass du dir nicht viel Zeit für uns nehmen kannst«, lenkte Justine ein. »Trotzdem. Jetzt, wo es wirklich bald losgeht mit dem Kanal und damit auch mit Vaters neuer Geschäftsidee, wissen wir kaum noch, wo uns der Kopf steht.«
Hella wischte sich die Hände an der Schürze ab und wandte sich zu ihnen um.
»Wo werden all die sonderbaren Dinge bleiben, die euer Großvater angesammelt hat, wenn euer Vater alles neu und anders haben will?«
Sofort wurde Justine das Herz schwer. Diese Frage hatte sie sich selbst oft genug gestellt. Ein eigenes Schauspielhaus mit Platz dafür war pure Illusion. Aber jetzt war einfach nicht der Moment, einem bunten Schrank oder einem Puppentheater hinterherzutrauern. Ihr Vater hatte einen beträchtlichen Bankkredit aufgenommen, um die Ladenfläche zu vergrößern. Schaufeln, Spitzhacken, Stemmeisen in allen Größen und Ausführungen waren bereits bestellt und würden bald eintreffen. Darum musste sie sich kümmern.
»Ich hätte da eine Idee für Opas Dinge, nur …« Justine holte Luft. »Die Ware ist geordert, Jessen baut mit Volldampf an der neuen Ladeneinrichtung. Alles wird modern und schick. Aber allein schaffen wir es nicht. Wir brauchen Hilfe, jemanden, der anpacken kann und der sich mit Werkzeug auskennt. Wir brauchen dich, Jobst.« Leise fügte sie hinzu: »Und dich am besten auch, Hella. Großvater kann dich besonders gut leiden. Die Veränderung wird ihm das Herz brechen«, flüsterte sie, »wär schön, wenn du ihm beistehen könntest.« Justine durfte noch gar nicht an den Moment denken, wenn es so weit war. Sie war nur froh, dass sie selbst würde schleppen, putzen und räumen müssen. Sonst wäre sie womöglich diejenige, die nach Großvater Gregor sehen müsste. Das würde sie nicht überstehen.
»Hat unser Herr Vater dich also hergeschickt, damit du mich bittest.« Jobsts Miene verdüsterte sich. »Sieht ihm ähnlich.«
»So schlecht kennst du ihn? Er weiß nicht einmal, dass ich hier bin. Er würde dich nie um Hilfe bitten. Er würde mich nicht einmal schicken. Dafür müsste er ja über seinen Schatten springen.«
Als ob es nur um die große Eröffnung ginge. Sie seufzte, der Druck in ihrer Brust, der ihr vorhin schon die gute Laune getrübt hatte, kehrte mit Wucht zurück. Wenn Jobst schon nicht bereit war, einmal anzupacken, bräuchte sie ihm mit dem, was sie noch auf dem Herzen hatte, erst gar nicht kommen. Dummerweise gab es keinen anderen Weg.
»Also schön, Vater ist größenwahnsinnig oder kommt endlich zur Vernunft, wie man es sehen will. Jedenfalls krempelt er Großvaters Kuriositätenkabinett anscheinend um. Hätte er längst tun sollen. Was geht’s mich an?«
Jobst hatte es ihrem Vater nicht verziehen, dass er vor Jahren seine Ideen und Vorschläge für das Geschäft abgewiesen hatte. Nicht einmal richtig angehört hatte er ihn. Sie konnte verstehen, dass Jobst daraufhin einen anderen Weg eingeschlagen hatte. Dass er aber noch immer so feindselig war nach all der Zeit, das begriff sie beim besten Willen nicht.
»Na hör mal, du bist sein ältester Sohn! Es geht dich sehr wohl etwas an.«
»Ich bin in erster Linie Schwiegersohn, Stine. Heiner ist ein mächtig feiner Kerl. Er hat mir alles beigebracht, was ich über die Feldarbeit und die Viehwirtschaft wissen muss. Er hat mir seinen Hof und sein Land anvertraut. Aber was noch mehr bedeutet, Stine, er hat mir seine Tochter anvertraut. Ich kann ihm nicht genug danken.«
Hella hatte ihnen Tee nachgeschenkt, jetzt legte sie kurz eine Hand auf seine Schulter, ehe sie sich dem Korb voller Kräuter zuwandte, die sie wohl am Vormittag geerntet hatte.
»Ich stehe Heiner gegenüber in der Pflicht. Vater hätte es sich früher überlegen müssen, ehe er mich weggejagt hat.«
»O bitte!« Stine hob beide Hände und ließ sie dann in ihren Schoß fallen. Sie konnte die alte Leier nicht mehr hören. »Vater hatte dich auf Nissens Hof in die Lehre gehen lassen, weil das Geschäft nicht genug abwarf. Er wollte Sicherheit für dich, ein zweites Standbein. So sagt man doch, oder?«
Er lachte auf. »Außerdem war es dein Vorschlag.«
»Ach ja, richtig, das vergesse ich aber auch immer wieder. Ich wollte etwas anderes lernen. Landwirtschaft stirbt nie aus, sie hat immer eine Zukunft. Nee, Stine, darum ging es nicht, das hatte Großvater mir nur eingeredet, um mich zu trösten. Klang ja auch allzu gut. In Wahrheit ging es darum, dass ein anderer mein stets hungriges Maul stopfen sollte. Dass Vater meine Ideen damit auch gleich los war, passte wie der Arsch auf den Eimer.«
Justine musste grinsen, wurde aber sofort wieder ernst.
»Du weißt genau, dass Vater nicht anders konnte.«
»Man kann immer anders, Stine, wenn man nur will. Vaters neues Geschäft!« Er schüttelte wütend den Kopf.
»Niemand von euch kann sich gegen Gregor durchsetzen«, erklärte Hella und sah lächelnd von einem zum anderen. »Dafür liebt ihr ihn alle zu sehr. Für dich gilt das genauso wie für deinen Vater, mein Lieber.« Sie berührte sanft seinen Arm, dann setzte sie sich, breitete Petersilie und Schnittlauch vor sich aus und begann, sie zu kleinen Sträußen zu binden. »Deine Vorschläge für den Kolonialwarenladen mögen damals klug gewesen sein, aber auch du hättest es nicht übers Herz gebracht, sie gegen den Willen deines Großvaters umzusetzen.« Sie zuckte mit den Schultern. »Man kann eben doch nicht immer so, wie man gern wollte.«