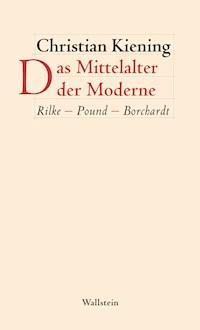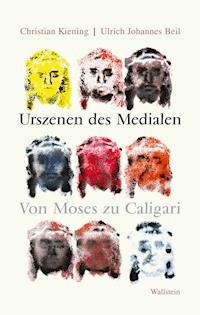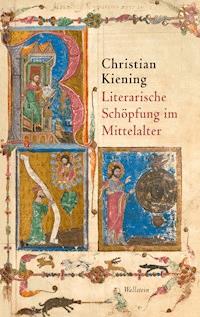19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Eine Einführung in die Eigenart älterer Texte und das Methodenspektrum einer Wisenschaft, die geschichtlich fremd gewordenen Sinngefügen ihre Faszinationskraft zurückgibt. Systematisch orientierte Fallstudien vermessen das Spannungsfeld von Körper und Schrift, das eine semi-orale Kultur wie die mittelalterliche prägt. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 685
Ähnliche
Christian Kiening
Zwischen Körper und Schrift
Texte vor dem Zeitalter der Literatur
FISCHER E-Books
Inhalt
Vorspiel: Zwischen Körper und Schrift
I
Die »schätzbaren Reste des [deutschen] Altertums hätten viel früher auf mancherlei Weise einen günstigen Einfluß auf mich ausgeübt, hätten sie mich nicht durch ihre rauhe Schale abgeschreckt, welche zu durchbrechen weder mein Naturell noch meine Lebensweise geeignet war […], das Rohe und Ungeschlachte, was sich an ihnen findet, [ist] zwar dem Charakter jener Zeit angemessen, auch bei der historischen Würdigung wohl notwendig zu beachten, keineswegs aber zur wahren Schätzung nötig und dem Genuß durchaus hinderlich.«
So schreibt Johann Wolfgang von Goethe 1811 an Friedrich Heinrich von der Hagen, den Erneuerer des Nibelungenlieds und begeisterten Förderer der ›altdeutschen Poesie‹.[1] Zwiespältig ist Goethes Urteil und zwiespältig generell seine Haltung gegenüber den alten Texten. Er findet das, was die ›Mittelältler‹, also die Romantiker, zutage fördern, meist ungenießbar oder mittelmäßig. Auch das Nibelungenlied, das er den Damen der Mittwochsgesellschaft vorliest, bleibt in manchem fremd: »die Nibelungen so furchtbar, weil es eine Dichtung ohne Reflex ist; und die Helden wie eherne Wesen nur durch und für sich existieren.«[2] Und doch arbeitet er sich sukzessive in den Text ein. Er legt Verzeichnisse der Figuren an und skizziert »flüchtige Aufsätze über Lokalität und Geschichtliches, Sitten und Leidenschaften, Harmonie und Inkongruitäten«. Nach dem Vorbild der Voßischen Karten zu altgriechischen Dichtern entwirft er eine Karte zur Geographie des Textes, »die auf sehr hübsche Reflexionen führt«.[3] Das Nibelungenlied fasziniert Goethe, weil es ihm der antiken Dichtung näher zu stehen scheint als der mittelalterlichen, weil es die Einbildungskraft anregt – was noch besser zu Wirkung käme, wenn der Text, in Prosa übertragen, von unnötigem Reimgeklingel und »vielen Flick- und Füllversen« befreit wäre.[4] Anders als August Wilhelm Schlegel, der im Nibelungenlied ein Stück deutschen ›Nationalcharakters‹ wiederfindet, wird Goethe das alte Epos zu einem archäologischen Objekt, dessen Fremdheit unverkennbar, dessen Imaginationspotential aber wiedergewinnbar ist. Die Zeit, aus der es kommt, sieht er, anders als die Romantiker, nicht als die glorreiche Ära des starken Kaisertums und der ungeteilten Christenheit. Das Mittelalter ist für ihn eine Epoche des Unreifen und Unvollendeten, die alte Dichtung ›Bildungsstufe einer Nation‹, Durchgangsstadium zu ästhetisch wertvolleren, harmonischeren und komplexeren Formen. Der Blick auf die deutsche Vergangenheit führt nicht zu einer Aufhebung historischer Distanz. Er sucht nicht nach einem politischen oder religiösen Vorbild für die eigene Zeit. Er sucht nach dem, was die Bedingtheiten der Zeit übersteigt.[5]
Zwei Haltungen gegenüber den älteren Texten treffen im frühen 19. Jahrhundert, zur Zeit der Entstehung einer akademischen Germanistik, aufeinander. Einerseits das Bewußtsein historischer und ästhetischer Differenz, begleitet nicht selten von einer teleologischen Vorstellung vom Gang der Geschichte und der Entwicklung der Künste. Andererseits die Nivellierung des Zeitenabstands im Brückenschlag zwischen Einst und Jetzt, begleitet vom Ideal einer vergangenen goldenen Zeit und einer ursprünglichen, naturhaften Poesie. Die Haltungen sind nicht immer streng zu trennen. Die Sehnsucht nach Wieder-Holung des Vergangenen kann in dem Maße, in dem sich das Vergangene als nicht wiederholbar erweist, in ein Bewußtsein von Distanz umschlagen: Diese Tendenz ist schon der romantischen Mittelalterbegeisterung inhärent.[6] Umgekehrt kann die Betonung der Differenz zwischen Vergangenheit und Gegenwart in den Dienst einer Geschichtskonzeption treten, der ihrerseits daran gelegen ist, Vergangenheit und Gegenwart zu synthetisieren: Goethe setzt das Mittelalter ab von der allein vorbildhaften klassischen Antike. Einem Werk wie dem Nibelungenlied, das ihn durch seinen Reichtum in Bann zieht, nähert er sich mit den Methoden der Klassischen Philologie – wie Generationen von Germanisten nach ihm.[7]
Die Eigenheit des Vergangenen wird auf diese Weise gemildert oder instrumentalisiert. Das Vergangene wird entweder dem Gegenwärtigen anverwandelt oder bietet eine Negativfolie für die Erneuerung klassischer Bildungs- und überzeitlicher Literaturideale. Dieses Verfahren ist durchaus charakteristisch – nicht nur für die Gründungszeit des Faches. Zugespitzt ließe sich behaupten, die Geschichte der Altgermanistik sei über weite Strecken eine Geschichte der Aufhebung der Eigenheit ihres Gegenstandes. Aufhebung zum Beispiel durch Patriotismus, der in der Vergangenheit eine Identifikations- und Projektionsfläche für die Gegenwart suchte, oder durch Positivismus, der sich auf Fragen von Textkritik und Sprachanalyse, Quellenforschung und Motivgeschichte beschränkte. Ausnahmen bestätigen die Regel. Als Clemens Lugowski 1932 seine Abhandlung über Die Form der Individualität im Roman vorlegte, stand er fast allein. Kaum zufällig hielt er sich, um die Eigenheit mittelalterlichen Erzählens zu charakterisieren, an einen Philosophen, den Neukantianer Ernst Cassirer. Dessen Mythoskonzept sollte es ermöglichen, epische Welten nicht im Blick auf aktuelle Lebensverhältnisse zu beschreiben, sondern in ihrer Künstlichkeit, das heißt in der historischen Eigentümlichkeit nichtkausaler Motivationen, nicht-psychologischer Begründungen und nicht-individueller Verhaltensweisen.[8]
Lugowskis Buch brachte keinen Durchbruch. Es wurde zurückhaltend aufgenommen und geriet in Vergessenheit. Ein Paradigmawechsel war nötig, damit die in ihm enthaltene Frage dem Fach zum Anliegen werden konnte. Er ereignete sich in den sechziger und siebziger Jahren. Nicht nur traten neue Gebiete (vor allem das Spätmittelalter) ins Licht der Forschung. Im Gefolge von Rezeptionsästhetik, Strukturalismus und Textlinguistik machten auch neue Theoriekonstellationen und Methodenreflexionen die prekäre Beziehung sichtbar zwischen den Modellbildungen der Forschung und der Eigenart ihrer historischen Objekte.[9] Man begann darüber nachzudenken, welche Grenzen dem Verstehen mittelalterlicher Dichtung gesetzt sind.[10] Äußere Grenzen durch fragmentarische Überlieferung, isolierte Position, singuläre Sprachlichkeit eines Textes. Innere Grenzen aufgrund von Eigenarten der Komposition, der Logik und des Stils, die dem modernen Leser oder Interpreten unvertraut sind. Eine Möglichkeit, mit diesen Grenzen umzugehen, konnte heißen, sie zurückzudrängen: durch umfassende Rekonstruktion von Kontexten und Einfühlung in die mittelalterlichen Denkkategorien. Eine andere konnte darin bestehen, diese Grenzen als Herausforderung zu sehen für einen unabschließbaren, immer von Gegenwärtigkeit und Intuition gezeichneten Deutungsprozeß.[11]
Den prägnantesten Nenner für die methodologische Situation fand der Romanist Hans Robert Jauß. Unter dem programmatischen Titel Alterität und Modernität der mittelalterlichen Literatur formulierte er 1977 das Anliegen einer Generation, die nicht mehr auf die Selbstverständlichkeit setzte, mit der die Nationalphilologien lange ihren Gegenstand behandelt hatten: als Zeichen einer Kontinuität nämlich, deren sich die Philologie in der identitätsstiftenden Beschäftigung mit der Vergangenheit je neu versichert. Wo solche Identitätsstiftungen brüchig wurden, wo neue Gegenwartserfahrungen Diskontinuitäten und Inhomogenitäten hervortreten ließen, schärfte sich auch der Sinn für Differenzen zwischen älteren und neueren Texten wie für notwendige Differenzierungen des Beschreibungsinventars. Jauß skizziert ein je neues Wechselspiel von ästhetischem Vergnügen und befremdender Andersheit.[12] Ästhetisches Vergnügen im naiven Sinne kann sich an mittelalterlichen Texten entwickeln, die der modernen Imagination verwandt sind: Texte also, die abenteuerliche, wunderbare und geheimnisvolle Welten entwerfen, wie sie uns im Bereich der fantasy noch allenthalben begegnen. Ästhetisches Vergnügen im reflektierten Sinne kann sich an Texten entwickeln, die durch den Kontrast zu modernen ästhetischen Erfahrungen reizen: Texte also, die weniger durch Innovation als durch Variation glänzen, die mit allegorischen Sinnebenen arbeiten, die Innerlichkeit nur im Spiel äußerer Mächte zu erkennen geben. Eben solche Texte sind aber auch bereits Ausdruck dessen, was die Alterität der mittelalterlichen Literatur ausmacht.[13] Auf der Ebene der Handlung: Brüchigkeit der Logik, Typenhaftigkeit der Figuren, Schematik von Handlungsmustern; auf der Ebene des Textes: Unfestigkeit der Überlieferung, Fehlen eines klaren Werkbegriffs, Mangel an auktorialer Kontrolle.
Alterität und Modernität greifen ineinander. Das Befremdende kann zum Vertrauten, das Spannungslose zum Reizvollen, das Alte zum Modernen werden – wenn es zu einem Prozeß ästhetischer Erfahrungsbildung kommt. Aufbauend auf der Hermeneutik Hans-Georg Gadamers sieht Jauß den Bezug zwischen den Texten verschiedener Epochen und generell zwischen Vergangenheit und Gegenwart im Modell von Frage und Antwort. Es gilt, die Frage zu rekonstruieren, auf die ein Text antwortet, und mit ihr die ästhetische Erfahrung, die er ermöglicht. Den Sinn eines Textes zu erschließen heißt die Erwartungshorizonte des Textes, der Gattung und späterer Rezeptionssituationen zu erschließen, um so in einer sukzessiven Überbrückung des Zeitenabstands, einer ›Verschmelzung von Horizonten‹, Dimensionen eines zugleich historischen wie gegenwärtigen Verstehens zu eröffnen.
Dieser Weg, schrittweise Annäherung an die Eigenart älterer Literatur, war vielversprechend und erwies sich doch nicht ohne weiteres als gangbar. Mehrere Begriffe werfen Fragen auf. Ästhetische Erfahrung – ist damit nicht die ästhetische Subjektivität einer literarischen Moderne ins Spiel gebracht und ein einseitiger Bezugspunkt für den Umgang mit älteren Texten gesetzt? Horizontverschmelzung – ist damit nicht suggeriert, eine Rekonstruktion von Rezeptionssituationen könnte ursprüngliche Bedeutung und gegenwärtiges Verständnis eines Textes zur Deckung bringen, und ignoriert, daß Rezeptionsprozesse aus kontingenten Sinnstiftungen bestehen, die eine frühere Bedeutung manchmal offenlegen, nicht selten aber verdunkeln oder verschieben? Auch das Modell von Frage und Antwort, aus der Hermeneutik des Gesprächs stammend, ist nicht problemlos auf die Hermeneutik von Texten übertragbar. Texte sind nicht einfach dialogische Konstellationen, in denen um Problem und Lösung gerungen würde. Sie sind komplexe Zeichengefüge, in denen Codes abgewandelt und verändert werden, in denen bekannte Elemente durch neue Kontexte neue Bedeutung erhalten, in denen das Dialogische sich am ehesten in der Überlagerung der Stimmen, Traditionen und Materialien manifestiert.[14]
Viele Beobachtungen von Jauß bleiben richtig, die Kategorien Alterität und Modernität nützlich. Doch empfiehlt es sich, sie zu entlasten von der Emphase einer Hermeneutik, die sich an der Idealität des Gesprächs und der Vorbildhaftigkeit klassischer oder moderner Ästhetik orientiert. Klarer wird dann, daß die Begriffe relationalen Charakter haben. Sie überlagern sich und treten fallweise zu je neuen Kombinationen zusammen. Sie bezeichnen einerseits kulturspezifisch, andererseits historisch variable Momente von Differenz. Sie beschreiben geschichtliche Sachverhalte und beruhen zugleich auf Zuschreibungen moderner Betrachter. Alterität in diesem Sinne meint keine Exotisierung des Mittelalters, das plötzlich der Welt balinesischer Hahnenkämpfer näherstünde als der Welt unserer Vorfahren.[15] Sie zielt vielmehr auf das Moment des Nicht-Verfügbaren, die grundsätzliche Fremdheit und Künstlichkeit des sprachlich-literarischen Weltentwurfs, die vielfältig abgeschattete und abgestufte Distanz zwischen Vergangenheit und Gegenwart, der im einzelnen Werk ein komplexes Bündel von Gleichzeitigem und Ungleichzeitigem korrespondiert. Nicht also Unterstellung, historische Kontinuität sei nur Illusion des am Verläßlichkeitsmangel der Wirklichkeit leidenden Europäers, wohl aber Erinnerung daran, daß Verstehensprozesse immer auch zur Auslöschung des Unverständlichen, zur Marginalisierung von Diskontinuitäten neigen. Modernität wiederum meint keine spezifische Nähe zwischen mittelalterlichen und modernen ästhetischen Erfahrungen und keine definitive Errungenschaft einer Epoche. Sie verweist auf variable Differenzen, denen nicht mit einsinnigen Geschichtskonstruktionen beizukommen ist.[16]
Analytische Vorsicht angesichts der Gefahr, Differenzen einzuebnen, methodisch reflektierte Bemühung um die Angemessenheit der Modellbildung – das Zusammenspiel der beiden Aspekte macht deutlich, daß es hier zugleich um ein Zusammenspiel von Theorie und Praxis geht. So verbindet sich denn auch das feinere Sensorium, das die Literatur- und Kulturwissenschaften entwickelt haben für die vielfältigen Weisen, in denen Altes und Neues, Fremdes und Vertrautes interagieren, mit einem neuen Interesse für den Zusammenhang von textueller Eigenart und kultureller Vielheit. Immer deutlicher zeigen sich die älteren Texte als Produkte einer Kultur, in der Schriftlichkeit noch keine Selbstverständlichkeit war. Immer deutlicher zeigen sie sich aber auch als Produkte hoher Komplexität, vielfältig in den entworfenen Welten, tiefsinnig in der Variation von Strukturen, subtil im Spiel der Zeichen.[17]
Kaum besser läßt sich das Spannungsfeld, das sich hier abzeichnet, benennen als mit den Begriffen Körper und Schrift. Körper, das heißt für die Existenzweise der Texte: Bindung an Situationen der Kommunikation unter Anwesenden, das heißt für die Rhetorik der Texte: Bedeutung performativer Sprechakte, das heißt für die in den Texten entworfenen Welten: Zurschaustellung von Gesten, Haltungen und körpergeprägten Aktionen. Schrift auf der anderen Seite heißt: Entstehung einer zunehmend auch die Volkssprachen umfassenden Manuskriptkultur, Entwicklung von Formen des leisen und einzelnen Lesens, Verbreitung schriftliterarischer Prinzipien bei Produktion, Distribution und Rezeption von Texten.[18] Die beiden Begriffe stellen keinen Gegensatz dar. Das ist ihr Vorteil gegenüber einem Begriffspaar wie Mündlichkeit und Schriftlichkeit, das immer wieder Dichotomien ins Spiel bringt, wo es tatsächlich um Verflechtungen und Übergänge geht.[19] Körper und Schrift kennzeichnen Aspekte semi-oraler Kulturen, in denen das Wort, auch wenn es schriftlich ist, an ein gemeinschaftliches Tun, eine soziale Praxis, einen habitualisierten Vollzug gekoppelt bleibt. Sie kennzeichnen das Ineinandergreifen von Repräsentation und Präsenz. Repräsentation, sichtbar an geistlichen und weltlichen Ritualen, an demonstrativen Akten und Inszenierungen, an Formen der Visualisierung, vollzieht sich in mittelalterlichen Gesellschaften gemäß einer Ästhetik des Erscheinens, der es zugleich auf Gegenwärtigkeit ankommt. Das Zeichen verweist nicht nur auf das Bezeichnete, es versucht auch, diesem eine Aura von Präsenz – Klanglichkeit, Körperlichkeit, Sinnlichkeit – zu verleihen.[20] Nicht nur für die Eucharistie gilt: Im materiellen Objekt ist dessen Bedeutung selbst schon da, dem sichtbaren oder fühlbaren Lautkörper wohnt eine ontologische Nennkraft inne, dem fürstlichen Siegel eignet der Charakter einer Spur, die das Abgebildete, obwohl abwesend, anwesend machen kann. Die mittelalterlichen Kulturen sind deshalb aber nicht Kulturen reiner Präsenz: Die reale Gegenwart des Körpers Christi in der Eucharistie war unter Theologen seit dem 9. Jahrhundert Gegenstand der Diskussion, die Identität von Wort und Sache geriet seit dem Universalienstreit des 11. Jahrhunderts ins Wanken, die adligen Siegel wurden schon im 12. Jahrhundert mehr als soziale Identitätskennzeichen denn als essentielle imagines begriffen.[21]
Körper und Schrift sind also doppelt aufeinander bezogen. Sie markieren ein kulturspezifisches Spannungsfeld. Gleichzeitig stellen sie Marksteine eines historischen Prozesses dar, der zwar keine klaren Anfänge und Enden kennt, aber eine (obschon uneinheitliche) Richtung – auf jene uns vertrautere Situation hin, in der Literatur Teil ist einer institutionell differenzierten Wissens- und Informationsgesellschaft und in ihr in erster Linie gedacht wird als schriftliche, die von einzelnen anonymen Lesern rezipiert wird.[22] Von dieser Situation aus gesehen existieren die mittelalterlichen Texte, zumal die volkssprachigen, in einem Zwischenraum: Sie entstehen als schriftliche, doch ihre Schriftlichkeit besitzt weder die Selbstverständlichkeit noch die Systemhaftigkeit der Neuzeit. Dies als Hybridität zu bezeichnen kann nicht die mit Hegemonien und Hierarchien brechende Unentschiedenheit zwischen (im wesentlichen schon ausdifferenzierten) Sinnsystemen meinen.[23] Vielmehr zeugen die mittelalterlichen Texte von der (zumindest teilweisen) Ungeschiedenheit sich erst ausdifferenzierender Praktiken. Auch Text und Bild, im Mittelalter vielfältig aufeinander bezogen, sind nicht neuzeitlichem Verständnis gemäß unter dem Aspekt der Konkurrenz oder der ›wechselseitigen Erhellung‹ der Künste zu sehen. Sie können beide einer Vergegenwärtigung und Verkörperlichung des Sinns dienen. Mediale Pluralität und Experimentalität charakterisiert die Situation mittelalterlichen Text- und Bildgebrauchs nicht nur an ihren Rändern, sondern in ihrem Zentrum.
Drei Textbeispiele mögen dies anschaulich machen.
II
Das erste Beispiel ist die Geschichte des Heiligen Brandan. Verbreitet über ganz Europa, reicht sie in ihren Druckausgaben bis ins Entdeckungszeitalter hinein. Noch als sich das Bild der Welt entscheidend zu verändern begann, war man fasziniert vom Bericht über eine Reise an die Grenzen der Welt. Eine deutsche Version (die sog. ›Reisefassung‹), die wohl noch im 12. Jahrhundert entstand und seit dem 14. überliefert ist, situiert die Fahrt in einer Rahmenhandlung: Der irische Abt Brandan stößt im Kloster auf ein Buch. Es berichtet von Gottes Wundern in der Welt, von drei Himmeln, zwei Paradiesen und vier Fegefeuern, von fremden Ländern und wilden Menschen, von Riesenfischen, auf denen Wälder wachsen, und vom Riesensünder Judas, dessen Höllenqualen dank göttlichem Erbarmen in der Nacht zum Sonntag gemildert sind. Brandan kann nicht glauben, was er liest, und verbrennt das Buch, noch bevor er zum Ende gekommen ist. Ein Engel teilt ihm mit, er habe die Wahrheit verbrannt und müsse zur Strafe die Wunder auf einer neunjährigen Weltreise selbst erfahren und in einem neuen Buch festhalten. Die jüngere Prosaredaktion des Textes (15. Jh.) hat den letzten Punkt abgewandelt: Hier gibt es keinen expliziten göttlichen Schreibauftrag und damit auch keine Parallelität zwischen Reisen und Schreiben, die Abfassung vollzieht sich am Ende der Fahrt, und das Buch wird schließlich der Gottesmutter auf dem Altar dargeboten. Eine göttliche Stimme ruft Brandan zum himmlischen Reich: wenn du wilt, so kum.[24]
Sieht man von den Unterschieden der Redaktionen zunächst ab, so geht es in jedem Fall um die Gegenüberstellung von Buchwissen und Erfahrungswissen. Das im Buch niedergelegte Wissen um die mirabilia, obschon durch die Tradition beglaubigt, erweist im gegebenen Fall seine Gültigkeit erst in dem Maße, in dem es sich mit dem Erfahrungswissen zur Deckung bringt. Doch der Begriff der Erfahrung besitzt noch nicht den Status, den er in der frühen Neuzeit haben wird. Erfahrung ist nicht generell notwendig, um die Welt zu kennen. Sie ist notwendig nur für den, der der Schrift nicht glauben will. Klüger als die, die wie der Apostel Thomas eine sinnliche Bestätigung des Wunderbaren brauchen, seien die, »die da glauben, was sie nicht gesehen haben« – dieses Christuswort aus dem Johannes-Evangelium (20,29) muß Brandan auf seiner Reise erfahren, und zwar gerade von einem Volk, das der Welt des Vertrauten nicht ferner stehen könnte: Wesen, die nur an Händen und Bauch wie Menschen aussehen, ansonsten Köpfe wie Schweine, Hälse wie Kraniche und Unterleiber wie Fische haben. Von ihnen, die nach der Tradition der Wunder des Ostens mehr animalisch als menschlich scheinen, hier aber Verkörperungen der neutralen Engel darstellen, muß Brandan sich über Gott belehren lassen. Seine Welterfahrung ist denn auch weniger beglückend als schmerzlich: Er hat Situationen der Angst und Gefährdung durchzustehen, den Bruch mit vertrauten Ordnungen hinzunehmen.
Der Weg, auf dem dies geschieht, ist ein Weg in Form einer Spirale. Er führt mit dem Ende zugleich zum Anfang zurück, er führt vom Buch zum Buch, vom fremden Buch zum eigenen. Die jüngere Prosaredaktion hat diesen Bezug über das Moment des Sakralen verstärkt. Beide Bücher sind mehr als nur Sammlungen von Wissen. Sie sind materielle Objekte, an denen Handlungen, genauer: Opferhandlungen vollzogen werden. Das erste, das die Reise auslöst, legt Brandan nicht einfach beiseite, als er es allzu unglaublich findet. Er verbrennt es und verletzt damit die göttliche Schöpfung. Das zweite, das die auf der Reise erfahrenen Wunder festhält, wird nicht einfach in die Klosterbibliothek eingereiht. Es wird auf dem Altar präsentiert, und seine Annahme bezeugt: Brandans Frevel an der Schöpfung ist gesühnt. Der anfängliche Akt der Aggression wird also ausgelöscht durch einen Akt der Demut, die zunächst unfreiwillige Kommunikation mit dem Göttlichen abgelöst durch eine rituelle etablierte, das scheinbar ungeschriebene, beinahe himmlische Buch reproduziert durch ein in einem Schreibakt hergestelltes. Das neue Buch ist keine Abschrift, sondern eine Neuschrift. Ihre Übereinstimmung mit der Urschrift wird durch die Erfahrung der Reise garantiert. Das heißt aber auch: Das neue Buch hat einen Urheber, einen Entstehungsmoment und diverse Funktionen: Es ist ein Zeichen der individuellen Einsicht, ein sakrales Objekt in der Beziehung zum Göttlichen, ein Originalkodex, der – wie es in einer Handschrift der jüngeren Redaktion heißt – ›noch heute‹ in Brandans Kloster aufbewahrt würde.[25]
›Noch heute‹ – damit ist eine Ebene der Textproduktion anvisiert, die den Raum der Geschichte aufs Gegenwärtige hin öffnet. Der jeweilige Text, den der Hörer zu hören, der Leser zu lesen bekommt, dieser Text, der von Brandans Reise und den Wundern der Welt berichtet, erhält seine Nobilität durch das Wissen um den durch ein göttliches Zeichen bestätigten Urtext. Das Verhältnis zwischen dem ersten verbrannten und dem zweiten erneuerten Buch wiederholt sich also im Verhältnis zwischen dem erneuerten Buch und dem von ihm erzählenden Text. Es ist dies eine Form, die Authentizität eines Textes zu sichern in einer Kultur, in der Schriftlichkeit noch nicht automatisch Stabilität der Textgestalt bedeutete. Die Wahrheit liegt im Körper des Urtextes, der wiederum einen anderen verlorenen Urtext wiederholt. Ein doppelter Ursprung also. Er sichert die Geschichte des Unglaublichen und Wunderbaren ab, doch dies auf der Basis einer Leerstelle. Brandans Neuschrift ist im Verhältnis zur verbrannten Urschrift Restitution und Substitution zugleich. Sie ist mit jener identisch und doch nicht identisch, verbunden und gleichzeitig getrennt durch eine Erfahrung, die nicht ohne weiteres verallgemeinert werden soll. In den Spiegelverhältnissen zwischen den Texten manifestiert sich ein Vertrauen in die Schrift, aber auch ein Festhalten an Ursprüngen, die zwischen göttlicher Stimme und materiellem Codex oszillieren. Zugleich zeigen die unterschiedlichen Redaktionen des Textes, daß die Sakralisierung eines sowohl alten wie neuen Textes kein altertümliches Moment ist, das im Laufe der Überlieferung zurückgedrängt würde. Sie manifestiert sich pointierterweise eben zu jener Zeit, da die kommerzielle und schließlich auch mechanische Reproduktion von Texten an Bedeutung gewann.
Das zweite Beispiel ist ebenfalls die Geschichte eines ungewöhnlichen Heiligen. Gregorius, dessen Vita Hartmann von Aue um 1200 nach einer altfranzösischen Vorlage gestaltete, repräsentiert den Typus des sogenannten Sünderheiligen.[26] Er stammt aus einer inzestuösen Verbindung und begibt sich selbst in eine weitere. Er ist Sohn von Zwillingsgeschwistern, die in Aquitanien, jung an Jahren noch, nach dem Tod des Herrschers verwaist zurückgeblieben sind. Er wird unmittelbar nach der Geburt in einem Kahn auf dem Meer ausgesetzt und auf einer Insel an Land geschwemmt. Aufgezogen zunächst bei einer Fischerfamilie, nimmt ihn schließlich der Abt des Inselklosters als spiritueller Vater unter seine Fittiche. Herangewachsen, erwachen ritterliche Neigungen in ihm. Er verläßt das Kloster und kommt jenseits des Meeres genau dorthin, wo seine Mutter mühsam versucht, das Land gegen einen abgewiesenen Freier zu verteidigen. Er besiegt den Gegner und heiratet, ohne es zu wissen, die eigene Mutter. Als die Katastrophe entdeckt wird, zieht er weiter: Auf einer abgelegenen Felseninsel verbringt er, angekettet, halbnackt und nur von einigen Tropfen Wasser lebend, 17 Jahre der Buße. Nach dem Tod des Papstes in Rom wird er durch ein himmlisches Zeichen zum neuen Papst bestimmt.
Die Geschichte erzählt von der Spannung epischer und hagiographischer Logiken, weltlicher und geistlicher Lebensformen, feudaler und klerikaler Sinnmuster. Im Zentrum dieser Spannung steht – eine Schrifttafel, ein kostbares, aus Elfenbein gefertigtes, mit Gold und Edelsteinen verziertes Stück.[27] Die Mutter gibt sie zusammen mit einigem Geld dem Neugeborenen mit auf den Weg, versehen mit einem längeren Text, der erklärt, was es mit dem merkwürdigen Paket auf sich habe: Von hoher Geburt sei das Kind, doch ausgesetzt, um den Frevel seiner Genese zu verbergen; christlich solle es erzogen und klerikal ausgebildet werden; die Geschichte auf der Tafel solle es später einmal als beständige Aufforderung zu Demut und Bußfertigkeit begreifen. Genau dies geschieht: Gregorius nimmt die Tafel mit auf seinen Weg und benutzt sie noch, als er schon verheiratet ist, für rituelle Bußbezeugungen. Das führt schließlich zur Aufdeckung seiner Identität und zu seinem Bußweg, auf den ihn auch die Tafel begleitet. Auf die Felseninsel indes gelangt sie nicht. Gregorius läßt sie im Haus eines Fischers zurück, trennt sich also in jeder Hinsicht von seiner früheren Existenz. Erst als er, von Sünden rein, fast schon auf dem Weg nach Rom ist, fällt ihm die Tafel wieder ein. Sie wird in dem verfallenen Haus unter Unkraut und Mist gefunden und ist – ein göttliches Wunder – makellos wie am ersten Tag.
Auch in diesem Text ist die Schrift also mehr als Schrift. Sie ist Träger von Sinn und Verkörperung von Sinn in einem. Sie bietet Informationen, die autoreflexiven Charakter haben (nämlich die eigenen Leistungen und Ziele ansprechen). Doch sie bietet diese Informationen gekoppelt an einen spezifischen Beschreibstoff. Die Tafel in ihrer Materialität demonstriert zunächst einen sozialen Status und dient sodann als Memorialobjekt im Sinne eines tragbaren Reliquiars, vor dem und mit dem Gregorius in gottesdienstähnlichen Akten immer wieder den eigenen Makel vergegenwärtigt. Darüber hinaus markiert sie eine paradoxe Leerstelle, die Identität verhüllt und doch (dezidierter als Kleidung und Gebaren) Identifikation ermöglicht, und fungiert sie als mirakulöses Zeichen für die durch Gott bewirkte Reinigung von Sünde. Und vor allem: Sie begleitet die Handlung nicht nur, sie leitet sie auch. Sie enthält ein Programm für den Weg des Helden und bewirkt zugleich, daß dieses Programm sich realisiert – im Positiven wie im Negativen: Der Junge erhält eine Ausbildung, wiederholt aber auch eben, indem er sich nach der Lektüre der Tafel auf die Suche nach der eigenen Geschichte begibt, den Inzest, der wiederum jenes Unmaß an Sünde verkörpert, dessen Aufhebung die Geschichte vorführt.
Diese Aufhebung vollzieht sich in einem Prozeß der Ausgrenzung und Wiedergliederung des Protagonisten, der seinerseits an der Tafel sichtbar wird. Die Tafel trennt zwischen illiterati und litterati. Die Dienerin am Hof sieht in ihr ein rätselhaftes dinc, die Fischer lassen sie trotz ihres Wertes im Haus verbrennen. Gregorius hingegen benutzt sie als Gegenstand ritueller Memoria, die Mutter und der Abt als Informationsträger. Die Tafel trennt aber auch zwischen dem potentiellen Heiligen und seinen Vertrauten. Die Mutter und der Abt, sie repräsentieren die Lebensordnungen, zwischen denen der Protagonist sich bewegt und die ihm doch nicht zubestimmt sind – wie der Umgang mit der Tafel zeigt. Die Mutter will mit ihrer Hilfe zwar die Zukunft des Kindes sichern, nicht aber dessen Herkunft offenlegen. Der Abt gibt Gregorius die Tafel erst, als alle anderen Mittel, ihn auf der Insel zu halten, fehlschlagen. Tafel und Schrift werden zu Instrumenten einer menschlichen Steuerung, die nach der Logik des Textes der göttlichen Steuerung unterworfen bleiben muß.
Auch dies manifestiert sich in der Tafel, nämlich ihrer Auffindung. Makellos ist sie, das heißt, die 17 Jahre, die den Körper des Gregorius zu einem mageren, schmutzigen, verfilzten Etwas gemacht haben, sind an ihr spurlos vorübergegangen. Die Tafel zeigt, was der Körper nicht zeigt. Gregorius wird, von den Eisenfesseln befreit, mit Priestergewändern bekleidet. Von einer Wiederherstellung seines Körpers erfährt man nichts. Die Tafel substituiert den Körper und mutiert vom Sinnobjekt des Helden zum Wahrzeichen seiner Heiligkeit. Jüngere Prosafassungen des Gregorius haben diese Mutation übergangen: Ihnen genügt das Mirakel der Wiederauffindung, die Unversehrtheit der Tafel bleibt unerwähnt.[28] Bei Hartmann kennzeichnet die Engführung von Körper und Schrift genau die Einfallstelle der göttlichen Gnade im weltlichen System des Sichtbaren. Die Tafel verkörperte den sündhaften Ursprung und verkörpert nun dessen Aufhebung. Sie interessiert nicht mehr als Schriftzeugnis, sondern nur mehr als materielle Manifestation des Göttlichen. Zugleich verschwindet sie aus der Geschichte, denn sie repräsentiert diese nicht wie in der Brandan-Legende in ihrer Gesamtheit, sondern nur in ihrem schließlich aufzuhebenden Ausgangspunkt. Beständig und kostbar ist das Material, aus dem die Tafel gemacht ist, vorläufig und ergänzungsbedürftig aber der Text, der sich auf ihr befindet. Statt auf ihn richtet sich der Blick am Ende auf das Werk, das die Geschichte vollständig enthält: das vorliegende Buch, das Hartmann seinen Hörern und Lesern anempfiehlt mit der Bitte, auch für das Seelenheil des Autors zu beten.
Das dritte Beispiel stammt aus dem Parzival Wolframs von Eschenbach (um 1200/1210). Gawan, der zweite Hauptheld des Romans, hat das große Abenteuer auf der verzauberten Burg (Schastelmarveille) siegreich hinter sich gebracht. Es steht ihm aber noch ein großer Kampf gegen Gramoflanz bevor, für den er die Unterstützung des Artushofes braucht. Er läßt sich Tinte und Pergament bringen und schreibt einen Brief, in dem er die Situation darlegt und den ganzen Hof bittet, nach Joflanze zu kommen, wo der Kampf stattfinden soll (625,12–626,8). Der Brief trägt kein Siegel, ist aber durch wârzeichen eindeutig als von Gawans Hand geschrieben kenntlich. Warum dies wichtig ist, begreift man erst eine Weile später: Der Brief soll unverwechselbar sein und doch mehrere Adressaten haben können. Das Ganze ist Teil einer komplizierten Geheimdiplomatie (644,12–652,14). Gawan bedient sich eines sorgsam ausgesuchten Boten, der zur Geheimhaltung verpflichtet wird. Er übergibt ihm den Brief zusammen mit Instruktionen, wie damit umzugehen: Er solle sich erst an die Königin wenden, nicht aber mündlich mehr verraten, als im Brief gesagt wird. Der Bote trifft die Königin morgens in der Kapelle. Sie erkennt die Schrift und ist bereit zur Unterstützung, gibt aber ihrerseits dem Boten vor, wie er sich weiter zu verhalten habe. Er solle am späten Vormittag bei Hof erscheinen, sich durch die nach Neuigkeiten dürstende Versammlung bis zu Artus vordrängen und diesem den Brief in die Hand legen. Auch dies vollzieht sich wie geplant. Das Ergebnis: Der König schickt den Boten wiederum zur Königin, diese liest den Brief erneut, nunmehr aber offiziell und laut und mit unverkennbarem Effekt: Angesichts der dramatischen Mitteilung treten manchem die Tränen in die Augen.[29]
Schrift erscheint hier gebunden an Situationen, in denen die Kommunikation unter Anwesenden dominiert. Der Brief, den Wolfram nur referiert, nicht aber zitiert, wendet sich von vornherein an mehrere Ansprechpartner: zuvorderst Artus und Ginover, dann aber auch alle anderen am Hof, deren Hilfe gebraucht wird. Er ist für die Öffentlichkeit gedacht und soll doch bestimmte Kanäle nehmen, um zur Wirkung zu kommen. Da dafür eine Lenkung nötig ist, bedarf es des Boten, der nicht einfach nur Überbringer ist, sondern auch Teil der Inszenierung. Bote und Brief funktionieren gemeinsam.[30] Der Brief ist notwendig, um eine festgelegte Menge an Information zu übermitteln, der Bote, um die richtige Kenntnisnahme der Information zu bewerkstelligen. Das geschieht in mehreren Schritten. Erste Empfängerin ist die Königin. Sie kennt die Situation am Hof und damit auch den richtigen Moment, in dem Gawans Mitteilung publik werden soll. Sie muß aber selbst erst auf das Unternehmen eingeschworen werden – durch eine mündliche Mitteilung, die über die Schrift hinausgeht: Der Bote behauptet, Gawan habe gesagt, all seine Hoffnung läge bei der Königin. Diese mündliche Verstärkung unterstützt die affektive Verbindung zwischen Absender und Empfänger und damit die wirksame Inszenierung der Schrift. Auch der dramatische offizielle Auftritt des Boten am Hof nutzt die sozialen Gegebenheiten: Die Ritter sind begierig nach Neuigkeiten, denn am Artushof herrscht die Sitte, solange nicht zum Mahl schreiten zu können, als keine bedeutende aventiure mitgeteilt wurde. Die Aufnahme von Nahrung und die Aufnahme von Geschichten sind aneinander gekoppelt, und eben dies sichert dem Anliegen des Boten höchste Aufmerksamkeit.
Das zeigt, wie wenig es mit der Schrift allein getan ist. Zwar können die adligen Protagonisten der Szene alle lesen – für den zeitgenössischen Adel keine Selbstverständlichkeit. Doch wichtig bleibt die Ebene des Mündlichen und Körperlichen, des Gemeinschaftlichen und Demonstrativen. Die Schrift muß zum Leben gebracht werden, zumindest in einer Gesellschaft, in der Sichtbarkeit und Hörbarkeit zentral sind, dem Erzählen von Geschichten eine geradezu nährende Bedeutung zukommt. Die Schrift stiftet eine besondere Form von Geltung und ermöglicht ein Agieren aus der Distanz, doch dies nur dann, wenn es Helfer im Raum der Nähe gibt, die sie dem sozialen Handeln und interaktiven Vollzug anverwandeln. Aber auch der umgekehrte Schluß dürfte zutreffen: Indem die Anverwandlung sich in einer umständlichen Inszenierung vollzieht, deutet sich an, daß die kommunikativen Regeln der dargestellten Gesellschaft für Verhältnisse der Nähe wie der Distanz zu gelten haben. Mit der Schrift allein ist es zwar nicht getan, mit ihr ist aber doch zu rechnen: nicht nur auf der Ebene der Handlung, sondern auch auf der des Textes. An einer Stelle heißt es, der Parzival-Roman sei nicht als buoch zu begreifen (115,29f.). An einer anderen aber wird eine komplizierte Quellenkette skizziert, die zwar letztlich die Gestirne zum göttlichen Ursprung des Erzählens macht, daneben aber eine sukzessive Weitergabe im Medium der Schrift impliziert (453,11–454,30). Die Kette reicht von der Entzifferung über die Aufzeichnung und Übersetzung hin zur Interpretation und Kompilation. Erst diese schriftliterarischen Prinzipien machen wie in der Brandan-Geschichte eine kosmische Wahrheit verfügbar, von der sie sich andererseits unwiderruflich entfernen. Auch hier vollzieht sich also ein Balanceakt zwischen dem, was die Schrift leistet, und dem, in dem sie gründet.
Drei Beispiele, drei Überlieferungstypen. Codex, Schrifttafel, Pergamentblatt – sie repräsentieren Erscheinungsformen zeitgenössischer Schriftlichkeit von unterschiedlicher Funktionalität und Stabilität. Doch sie bezeugen – wie schon der Blick auf Variationen der Überlieferung erweist – nicht schlichtweg die Ausbreitung der Selbstverständlichkeit von Schriftlichkeit. Die Texte greifen soziale Praktiken auf, stellen sie aber in den Kontext imaginärer Welten und damit komplexer Sinnstiftungen. Sie arbeiten zum einen mit Doppelungen, Spiegelungen und Wiederholungen, die erst in der Schrift in dieser Weise möglich sind. Und sie benutzen zum andern die Schrift als Element der epischen Welt, um eben diese Doppelungen, Spiegelungen und Wiederholungen in prägnanten Inszenierungen vorzuführen. Die Inszenierungen kreisen um die Beziehung von Körper und Schrift, um ihr wechselseitiges Implikationsverhältnis.[31] So wie Körper nicht einfach krude Materialität sind, sondern auch Einschreibefläche für Zeichenordnungen, ist Schrift auf der anderen Seite nicht einfach Informationsmedium, sondern auch magisches Objekt. Sie besitzt eine Aura, und die in ihr aufbewahrte Botschaft erscheint gekoppelt an Situationen des Heimlichen und Mysteriösen, Situationen oszillierend zwischen Nähe und Ferne, Sichtbarem und Unsichtbarem, körperlichem und medialem Kontakt. Eben in dieser Oszillation erweist sich das Auratische aber auch als Moment einer textuellen Konstruktion, welche die archaische Ungeschiedenheit von Sinn und Sinnträger nicht schlichtweg beschwört, vielmehr raffiniert in Dienst nimmt. Unübertreffliches Beispiel dafür: der Prolog des Wolfdietrich-Epos (Version D) aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Die Herkunft der zu erzählenden Geschichte wird hier geknüpft an ein Buch. Es sei nach langer Zeit in einem Kloster entdeckt, zunächst innerhalb der klerikalen Schriftkultur (Bischof, Kaplan, Frauenkloster) verbreitet und verändert, sodann von zwei Spielleuten – in einem Akt sekundärer Mündlichkeit – auswendig gelernt und durch ›Singen und Sagen‹ einem größeren Publikum bekanntgemacht worden. Der gattungstypisch anonyme Autor konstruiert ein Spannungsverhältnis zwischen verschiedenen medialen Situationen. Er mythisiert den Text in seinen Ursprüngen und nobilitiert ihn durch seine Verankerung im Klerus und in der Schrift. An der Notwendigkeit einer Überschreitung des nur Schriftlichen hält er fest.[32]
Als inszenierte besitzt die Schrift hier und anderswo eine doppelte Funktion. Im sozialen Vollzug gezeigt und im Kontext kommunikativer Handlungen ›ausgestellt‹, macht sie auf die performative Dimension der entworfenen Sinnstiftungen aufmerksam. Zugleich stiftet sie selbst Beziehungen, die verschiedene Handlungsmomente verbinden und im Spiel mit dem erzählten Text den Text der Erzählung profilieren. Die Schrift in ihrer Reflexivität zu thematisieren ermöglicht es, an epischen Welten die Spannung von Gegenwärtigkeit und Dauer des Sinns zu verhandeln. Schrift kommt in den Blick als Medium der Fixierung und Speicherung, als Grundlage von Archiven und Diskursen, als Voraussetzung von Situationsabstraktheit und Verstetigung, aber auch als eine Technologie, die, indem sie soziales Handeln von der je neu im Moment herzustellenden Geltung entlastet, einen neuen Typus von Komplexität hervorbringt. Sie vervielfacht die Welt, der sie angehört und auf die sie sich bezieht, indem sie selbst imaginäre Welten erzeugt. Sie etabliert aber damit auch jene schillernde, für Mißverständnisse und Interpretationen offene Beziehung zwischen Zeichen und Bedeutung, mit der es alle historischen Text- und Kulturwissenschaften zu tun haben.
III
Von hier aus läßt sich das Problemfeld schärfer umreißen, das den Umgang mit mittelalterlichen Texten bestimmt. Mittelalterliche Texte sind, um eine Wendung des Kunsthistorikers Hans Belting abzuwandeln, Texte vor dem Zeitalter der Literatur.[33] Belting richtete den Blick auf sakrale Bildtypen des Mittelalters und der frühen Neuzeit, für die Präsenz wichtiger war als Repräsentation, Authentizität wichtiger als Artifizialität, Evidenz und Materialität wichtiger als Ingenium und Perspektive. Im ganzen ist die Trennung zwischen Bild und Kunst wohl zu teleologisch und zu rigide gedacht. Vieles fällt aus dem Schema heraus oder ist ihm nur gewaltsam einzufügen.[34] Doch wichtig ist das Grundsätzliche: die Erinnerung daran, daß ein in der Moderne ausgebildeter Begriff von Kunst bestimmte Dimensionen älterer Bilder nicht erfassen kann. Genau dies ist auch für die schriftliche Überlieferung zu bedenken. Mittelalterliche Texte lassen sich als ›Literatur‹ bezeichnen, wenn man damit sagen will, daß sie an der etablierten Schriftlichkeit des lateinschreibenden Klerus partizipieren oder daß sie Formen des Imaginären entwickeln, die in pragmatischer Schriftlichkeit (Urkunden, Formelsammlungen, Annalen) fehlen. Sie dringen mit ihren Formen des Schriftbezugs nicht nur ins kulturelle, sondern auch ins kommunikative Gedächtnis ein,[35] sind aber noch nicht Teil eines skriptographischen, dann typographischen Netzes, wie es der Wissensgesellschaft der Neuzeit zugrunde liegen wird, und sind insofern nicht ›Literatur‹ im Sinne jenes Systems Literatur, das wir seit der Goethezeit kennen.
Auch der Begriff des Textes ist indes nicht ohne weiteres deskriptiv neutral. Er besitzt seine eigene Bedeutungsgeschichte. Sie zeigt, daß Aspekte wie Abgeschlossenheit, Strukturiertheit und Zeichenhaftigkeit (die wir mit dem Begriff verbinden) ihrerseits erst in Neuzeit und Moderne dominant geworden sind. Eben dies kann aber auch zum Vorteil gereichen: Die im Mittelalter lange vorherrschende Bindung des Begriffs an einerseits kultische und rituelle Zusammenhänge, andererseits materielle Träger der Überlieferung (textus bibliae oder textus evangelii) kann an eben jene Eigenheit älterer Textverhältnisse erinnern, die sich in den Bewegungen zwischen Körper und Schrift immer wieder manifestiert.[36]
Sachlich läßt sich der Unterschied zu einem neueren Typus von ›Literatur‹ vor allem an drei Momenten ablesen: Wiederholung, Performativität und Unfestigkeit. Wiederholung meint: Die Texte konstituieren sich nicht als Ausdruck dichterischer Originalität, sondern als Teilhabe an einem ›Überlieferungsgeschehen‹, als Aufnahme, Abwandlung und Anverwandlung anderer Texte. Performativität meint: Sie existieren nicht in einer von Raum und Zeit abgelösten Gestalt, sondern bleiben – zumindest grundsätzlich – gebunden an Situationen gemeinschaftlichen Vollzugs (Kult, Ritual, pararituelle Formen), an Formen repräsentativer Öffentlichkeit, an Dimensionen synästhetischer Wahrnehmung, an die Präsenz von Körpern. Unfestigkeit meint: Sie behalten im Prozeß der Überlieferung keine unveränderliche Gestalt, erfahren vielmehr Variationen auf der Ebene der Morphologie, der Syntax, der Textfolge und des Textbestands – Variationen indes, die nicht wie in der Literatur der Neuzeit einem einzigen auktorialen Subjekt zuzuschreiben sind.[37]
All dies gilt gewiß nicht absolut. Mittelalterliche Texte kennen auch die Artikulation von dichterischem Selbstbewußtsein, auch die Abstraktion vom Gegenwärtigen, auch die Sicherung von Kohärenz und Konstanz. Moderne Kriterien eines Textes lassen sich in Vorformen auch schon im 12. Jahrhundert beobachten.[38] Doch weiterhin und noch für längere Zeit bleibt der Text zugleich Gegenstand und Geschehen, zugleich abstrakt und konkret.[39] Zwar kommt es zu Standardisierungen und Institutionalisierungen von Schriftlichkeit, aber dies in einem keineswegs einheitlichen und geradlinigen Prozeß – einem Prozeß, in dem der Buchdruck eine wichtige, doch nicht allein verantwortliche Rolle spielt.[40] Die ersten Phasen der Buchdruckzeit blieben, wie man heute weiß, noch stark den Bedingungen der Manuskriptkultur verpflichtet. Das gilt nicht nur für die Gestaltungen des Layouts, sondern auch für den Status des Produkts: Wie die Handschrift war auch die Inkunabel offen für verschiedene Optionen des Benutzers – Ausschmückung der Initialen, Hinzufügung von Rubrizierung und Interpunktion, Wahl des Einbands. Erst im Gefolge der Reformation wurde das Gedruckte, schmale Heftchen, in hoher Auflage und ohne besondere buchkünstlerische Ambition hergestellt, zu einer Massenware, die der Tagespolemik und generell der (sich von der Materialität der Überlieferung lösenden) Übermittlung von Information diente.
Ebendiese Verschiebung des abendländischen Kommunikationshaushalts (der in jüngerer Zeit eine weitere Verschiebung gefolgt ist) läßt aber erst genauer erkennen, daß in früherer Zeit Handschriften und Drucke nicht als verzerrende Filter zu begreifen sind, die den Blick auf die Originale verstellen. Sie sind nicht Schutt, den der Archäologe wegzuräumen hätte. Sie sind die historisch-materialen Gegebenheiten der Texte, und an ihnen ist zu verfolgen, wie sich jene Aussageformen und Praktiken herausbilden, die uns als charakteristisch für ›Literatur‹ erscheinen.[41] Die Beschäftigung mit älteren Texten hat also ihre sowohl performative wie skripturale Dimension zu berücksichtigen und das Verhältnis von pragmatischem Rahmen und poetischer Textur zu analysieren. Versteht man Texte als kommunikative Handlungen, die sich in Zeichengefügen materialisieren, welche ihrerseits in Wechselwirkung stehen mit anderen Zeichengefügen, so gilt es, die Bedingungen zu rekonstruieren, die eine solche Handlung zu einem bestimmten Zeitpunkt möglich machten.
In dem Begriff Bedingungen steckt die Frage nach dem Verhältnis von Texten und Kontexten. Stellt man fest, mittelalterlichen Texten fehle die Einmaligkeit, Situationsabstraktheit und Stabilität neuerer Texte, so liegt es nahe, sie auch in stärkerem Maße determiniert zu sehen durch Gruppen, Institutionen und Lebenszusammenhänge. Die Sozialgeschichte hat herausgearbeitet, wie Höfe und Klöster, Mäzene und Führungsschichten die Entstehung und Überlieferung von Texten ermöglicht haben.[42] Sie hat aber auch erkennen lassen, daß sich die spezifische Gestalt eines Textes nicht einfach aus seinen Bedingungskontexten ableiten läßt. Der New historicism verschiebt deshalb den Blick von den Kontexten zu den Interferenzen: Texte erscheinen nun als Produkt von Austauschprozessen – zwischen anderen Texten, aber auch zwischen verschiedenen Wissensformationen und Diskursen. Das gibt den Texten ihre Komplexität zurück, reduziert aber historische Konstellationen ihrerseits auf Beziehungen zwischen Texten.[43]
Beide Ansätze reagieren auf ein bekanntes Problem: Texte spiegeln nicht einfach Wirklichkeit, sie bilden eigene Formen symbolischer Ordnungen, sind selbst schon soziale Tatsachen und erheben als solche einen nicht nur literarischen Geltungsanspruch. Aber sie können dies nur, weil sie zugleich in Kontexte eingebettet sind und diese überschreiten. Daraus ergibt sich ein ebenso bekanntes Dilemma: Die wissenschaftliche Erschließung muß immer eine von Texten wie Kontexten sein. Sie kann aber nie Gewißheit erlangen, welcher Art die Beziehung der beiden zueinander ist: komplementär oder kontrastiv, affirmativ oder subversiv, inhaltlich oder formal. Nur modellhaft lassen sich die Beziehungen zwischen Texten und Kontexten fassen, Modelle aber sind durch eine Dialektik von Entwurf und Revision geprägt. Eine hermeneutische Konstellation also, die indes ihre Pointe darin hat, daß der Gegenstand, der hier im Mittelpunkt steht, sich nicht ohne weiteres in eine gegenwärtige Erfahrung überführen läßt. Die Diskussion der jüngeren Zeit hat deutlich gemacht, wo die klassisch geisteswissenschaftliche Hermeneutik an Grenzen stößt: dort, wo sie Universalität beansprucht und auch Fremdes oder Unverständliches, zeitlich oder räumlich Entferntes den im Gegenwartsbewußtsein verankerten abendländischen Modellen der Repräsentation unterwirft.[44]
So ergibt sich auch für mittelalterliche Texte, daß zwei einstmals zentrale Begriffe der Hermeneutik nicht mehr fraglose Gültigkeit besitzen: Verstehen und Interpretation. Verstehen als Ziel der Erfassung von Textstrukturen und Kontextbedingungen tendiert dazu, unter dem Mantel des Dialogischen Unverständliches und Diskontinuierliches zu marginalisieren. Interpretation als privilegiertes Verfahren, um in der Dynamik von Vorverständnis und Einholung Verstehen zu ermöglichen, setzt eine Sinneinheit des Gegenstands voraus, die als solche gerade in Frage steht. Beide suggerieren, ›wahre‹ Bedeutung läge in einer Tiefenschicht, zu welcher der Interpret vordringen muß, um den Text – und mit ihm das Autorsubjekt – zu verstehen. Nicht zuletzt Erfahrungen mit neuerer Literatur und Kunst haben den Zweifel genährt, ob die Opposition von Oberfläche und Tiefe und die Privilegierung von Autorintentionen zu historisch angemessenen Ergebnissen führen. Deshalb sind Begriffe wie Interpretation und Verstehen noch nicht unbrauchbar geworden. Nur sollte man sich ihrer Implikationen ebenso bewußt sein wie der Alternativen, die in den letzten Jahrzehnten entwickelt wurden.[45] Sie lassen sich mit den Begriffen Analyse, Lektüre und Beschreibung bezeichnen. Und sie lassen sich, will man sie programmatisch gebrauchen, drei Theorieformationen zuordnen.[46]Analyse kann ein auf Objektivierbarkeit setzendes Verfahren meinen, das den Text als von Regularitäten bestimmtes Zeichengefüge begreift: Das wäre die Position des Strukturalismus.[47]Lektüre kann sich auf eine Durchquerung des Textes beziehen, die, bestimmte Momente herausgreifend, seine rhetorische Komplexität und semantische Unerschöpflichkeit hervorhebt: Das wäre die Position des Poststrukturalismus.[48]Beschreibung kann sich manifestieren in einer möglichst genauen Nachzeichnung von Bedeutungsstrukturen, Logiken und Regeln, Kohärenzen und Inkohärenzen eines kulturellen Textes: Das wäre die Position einer neueren ethnologisch inspirierten Kulturwissenschaft.[49]
Die drei Positionen sind nicht strikt voneinander zu trennen. Sie repräsentieren »Einstellungen auf den Text«, die sich je neu am Gegenstand zu bewähren haben.[50] Analyse, strenge Erfassung der Textdaten auf phonetischer, lexikalischer und semantischer Ebene, in syntagmatischer und paradigmatischer Hinsicht, ist für jeden wissenschaftlich verantwortbaren und verallgemeinerbaren Umgang mit Texten nötig. Sie bedarf aber der Ergänzung durch die spezifische Perspektivierung einer Lektüre, die aus den Daten auswählen, sie in argumentativen wie narrativen Zusammenhang bringen muß. Beschreibung wiederum kann, wenn nicht im Sinne einer bloßen Bestandsaufnahme (Handschriftenbeschreibung) aufgefaßt, Aspekte von Analyse wie Lektüre in sich aufnehmen. Festhaltend an Genauigkeit, Stimmigkeit und Adäquatheit als Kriterien von Wissenschaftlichkeit, kann sie ein starres Schema von Oppositionen und Substitutionen vermeiden und gleichzeitig bewußt machen, daß auch der wissenschaftliche Zugriff auf Texte eine Form der Neukonfiguration darstellt, unvermeidlich standpunktgebunden, nie anders als vorläufig und jeweilig, offen für die ihrerseits offenen Prozesse der Bedeutungskonstitution. Eine Historische Semantik, die nach den sich wandelnden Bedingungen von Sinnsystemen fragt, wird sich immer in einem Spannungsfeld bewegen: auf der einen Seite die Hoffnung, die Eigenart vergangener Kulturen und Texte lasse sich dank genauer Rekonstruktion in Grenzen wiedergewinnen, auf der anderen Seite die Gewißheit, der Sinn von Kulturen wie Texten werde im Umgang mit ihnen immer zugleich aufgedeckt und verhüllt.[51]
IV
Die folgenden Kapitel haben so eine doppelte Blickrichtung. Sie versuchen, Texte aus den Jahrhunderten vor dem Buchdruck in jener Eigenart zu beleuchten, die sich durch die Spannung zwischen Körper und Schrift ergibt. Und sie verbinden diesen Versuch mit der Frage nach den Beschreibungskategorien, die dieser Eigenart gerecht werden können. Daraus resultiert ein multiperspektivisches Vorgehen. Da die Beziehung von Körper und Schrift sich nicht entlang einer dominanten historischen Linie entwickeln läßt, ist an verschiedenen Stellen anzusetzen und das Terrain in je neuen Anläufen zu durchqueren, um seine Dimensionen erkennbar zu machen. Herausgegriffen sind besonders prägnante und faszinierende Beispiele: Auf den ersten Blick befremdlich oder merkwürdig wirkend, erweisen sie sich bei aufmerksamer Lektüre und geduldiger Entzifferung als funkelnde Brillanten, in denen momenthaft ein vergangenes Sinngefüge lebendig wird. Die Kapitel setzen also auf das signifikante Einzelne, an dem zugleich ein Allgemeines zu erfahren, Grundsätzliches im Umgang mit vormodernen Texten zu lernen ist. Sie gliedern sich in vier Sektionen.
Erste Sektion: Anthropologische Perspektiven. Vorgestellt, zunächst systematisch, sodann analytisch, werden Blickwinkel, die alte Texte in neues Licht rücken. Die Legende des inzestuösen Heiligen (Albanus), situiert im Feld von Gewalt und Heiligkeit, zeigt sich als Text, an dem das feudale System der Genealogie von seinen Exzessen her zur Diskussion gestellt ist (Kapitel 1). Die Geschichte des den Orient durchquerenden, Frauen akkumulierenden und Monster besiegenden Apollonius enthüllt sich als pointierte Konfiguration des Spannungsverhältnisses von Kultur und Natur, das, anthropologisch zentral, im mittelalterlichen höfischen Roman in einer Fülle von Gegenordnungen entfaltet wird (Kapitel 2). Das hochdifferenzierte Epos vom Heidenkrieg (Wolfram von Eschenbach, Willehalm) erweist sich als literarischer Verhandlungsort für eine Form von politischer Anthropologie, die die Spannung von Person und Institution, Affekt und Rationalität, Symbol und Zeichen durchspielt (Kapitel 3).
Zweite Sektion: Experimente der Reflexivität. Im Zentrum stehen frühe Ansätze, die Literarizität eines Textes aufscheinen zu lassen, und zwar dort, wo man sie nicht unbedingt erwartet: in geistlicher Dichtung, im Brautwerbungsepos und im höfischen Liebeslied. An frühmittelhochdeutschen Texten zur Heilsgeschichte ist abzulesen, wie das Problem der Sicherung des Sinns (nicht nur des Stoffes, sondern auch der Erzählung) und damit auch der literarische Status eines Textes in den Blick gerät (Kapitel 4). An einem raffinierten Brautwerbungsepos (König Rother) läßt sich verfolgen, wie ein Autor das Spiel mit Erzählmustern entdeckt und zugleich das Prinzip literarischer Sinnkonstitution in den Blick rückt (Kapitel 5). Am hochmittelalterlichen Tagelied, hier in der Zuspitzung Wolframs von Eschenbach, ist zu beobachten, wie die Etablierung einer triadischen Konstellation (Dame/Ritter/Wächter) mit der literarisch reflektierten Engführung von Sprache und Sprachlosigkeit einhergeht (Kapitel 6).
Dritte Sektion: Subjekte des Körpers. Es geht um Versuche, die Diskurse des Körpers in bezug auf das handelnde oder schreibende, seinem Körper unterworfene Ich zu subjektivieren. Einer der eigenwilligsten autobiographischen Texte des hohen Mittelalters, Guiberts de Nogent Monodiae, wird betrachtet im Blick auf das Ich, das seinen fragilen Körper ins Zentrum zentrifugaler und zentripetaler Kräfte stellt und den Schreibakt zu einem ebenso chancenwie gefahrenreichen Tun macht (Kapitel 7). Ein ambitionierter Minneroman, der Frauendienst Ulrichs von Liechtenstein, wird befragt auf die Eigentümlichkeit, mit der sich die Erzählung drastischer Körpereinsätze und die Aufbewahrung lyrischer und prosaischer Minnedichtung verbinden (Kapitel 8). Das schillernde Kartenwerk des Opicinus de Canistris wird analysiert hinsichtlich der Weise, in der ein Ich, sich geographisch, historisch und biographisch im System der Entsprechungen von Mikrokosmos und Makrokosmos verortend, eben dieses System aus den Angeln zu heben droht (Kapitel 9).
Vierte Sektion: Figuren der Präsenz. Der Fokus gilt den vielgesichtigen Beziehungen zwischen Körper, Sprache und Schrift. Wolframs rätselhafte Titurel-Stücke erscheinen als fragmentierter Text, der, die Leerstelle von Liebe und Tod umkreisend, Metapher und Erzählwelt paradox verknüpft und in der Gestalt eines geheimisvollen Hundes die unbewegte Schrift in Bewegung versetzt (Kapitel 10). Literarische und philosophische Werke zwischen Boethius und Chaucer erweisen sich in ihren Ansätzen, menschliche und nicht-menschliche Figuren einander spiegelbildlich begegnen zu lassen, als poetologische Paradigmen des im Mittelalter zentralen Phänomenkomplexes der Personifikation (Kapitel 11). Rhetorisch aufgeladene Totenklagen zeigen sich als Texte, die in der Überblendung von dokumentarischem Bericht und autoreferentieller Poesie die Absenz des toten Körpers beschwören und sich zugleich selbst als Rituale der Bewältigung anbieten (Kapitel 12).
Die einzelnen Kapitel stehen untereinander in inneren Zusammenhängen. Doch sind sie argumentativ eigenständig und unabhängig von ihrer Reihenfolge lesbar. Alle bleiben sie auf das skizzierte Spannungsfeld bezogen. Sie entfalten das Verhältnis von Körper und Schrift im Blick auf verschiedene Texte, Gattungen und historische Situationen und bieten ein repräsentatives Spektrum dessen, was auch heute noch, jenseits bloß antiquarischen Interesses, an dem Fremden und doch nicht ganz Fremden einer vergangenen und doch nicht verschwundenen Kultur zu faszinieren vermag.
Anthropologische Perspektiven
1 Gewalt und Heiligkeit
I
Zu den wichtigsten Impulsen, die in den letzten Jahren die Literaturwissenschaft auf neue Wege geführt haben, gehören die, die aus dem Kontakt mit einer ethnologisch orientierten Kultur- oder Sozialanthropologie herrühren.[52] Was in ihr an Bedeutung gewonnen hat, das Interesse am Zusammenhang von Text und Kultur sowie die Reflexion über die Bedingungen kultureller Sinnkonstitution, wird zunehmend wichtig auch für eine Literaturwissenschaft, die sich bemüht, über die Dichotomie von Text und Geschichte hinauszukommen. Die Technik dichter Beschreibung, die Rekonstruktion symbolischer Sinnsysteme, die Sensibilität für die Alterität des Untersuchungsgegenstands, die Einsicht in die semiotische Komplexität von Repräsentationsformen – all dies trifft ebenso dort auf Interesse, wo (fremde) Kulturen im Medium von Texten, wie dort, wo (fremde) Texte im Kontext kultureller Formationen erschlossen werden sollen.[53]
In keinem Fall handelt es sich schlicht um die Etablierung eines neuen Paradigmas, sofern man mit diesem ein verbindliches Inventar von Methoden und Kategorien verbindet. Die ›anthropologische Wende‹ der Literaturwissenschaft bedingt sowenig wie andere in den letzten Jahrzehnten beschworene Paradigmawechsel (›turns‹) eine Ablösung vorhandener Methoden. Als Form wissenschaftlicher Ausdifferenzierung erweitert sie das Spektrum von Zugangsweisen zu Kulturen und Texten und steht zugleich in Wechselwirkung mit wissenschaftspolitischen Entwicklungen und sozialen Veränderungen. Sie verbindet die Sehnsucht, die Vergangenheit in ihrer sinnstiftenden Kraft aus dem Staub der Archive zum Leben zu erwecken, mit der Notwendigkeit, das wissenschaftliche Tun aus dem Elfenbeinturm zu befreien. Und sie nährt die Illusion, eine nur in Überresten oder Denkmälern, in entweder kruder Materie oder opaken Zeichen erhaltene Vergangenheit lasse sich in Kategorien menschlichen Handelns ›rückübersetzen‹.[54] Ob diese Illusion nur Effekt einer wissenschaftlichen Selbstbehauptungsstrategie ist, mag dahingestellt bleiben, sie ist jedenfalls eine fruchtbare. Der Umgang mit literarischen Texten behält so auch nach dem Verblassen der Nationalphilologien gesellschaftliche Relevanz, erweist er sich doch nicht zuletzt als Auseinandersetzung mit Fragen der Lebenswelt, zum Beispiel mit der wachsenden Bedeutung, die Fremdheit im Rahmen postmoderner Gesellschaften spielt. In Texten findet man Experimentierfelder für soziale Konstellationen und anthropologische Dispositionen, Felder, auf denen Heterogenes im Spannungsfeld ästhetischer und außerästhetischer Bedingungen zusammentreffen und zur Verhandlung gestellt werden kann. Dementsprechend ist anders als bei den älteren anthropologischen Ansätzen bei den neueren nicht so sehr die entdifferenzierende Suche nach menschlichen Universalien dominant als vielmehr die differenzierende Suche nach Kategorien, die zwischen Einzelnem und Allgemeinem vermitteln können. Die Untersuchungen gehen deshalb häufig einher mit einer Infragestellung scheinbarer interpretatorischer Sicherheiten, einer Problematisierung der dem Gegenstand traditionell unterstellten Sinneinheit und einem Insistieren auf Brüchen, Gegenläufigkeiten und Widerstimmigkeiten. Eine zentrale Rolle spielt die Frage nach dem Zusammenwirken von Kontinuitäten und Diskontinuitäten, das die historische und situative Spezifik von Kulturen wie Texten charakterisiert.
Damit ist keine Verabschiedung des in Generationen ausgebildeten Instrumentariums hermeneutischer Wissenschaften verbunden. Weder werden in der Kultur- und Sozialanthropologie funktions- oder strukturanalytische Verfahren noch in der Literaturwissenschaft sozial- oder geistesgeschichtliche Methoden obsolet. Doch richtet sich der Blick in stärkerem Maße auf die Prämissen, die jene Ansätze oft stillschweigend voraussetzen, auf die Punkte, die sie ausblenden, und auf die Grenzen, die sie dem Verständnis des Gegenstandes auferlegen. Resultat ist im Falle des literarischen Textes eine doppelte Verschiebung: eine Einschränkung ästhetischer Autonomie und gleichzeitige Erhöhung kultureller Signifikanz. Der literarische Text erscheint als ein heterogenes Gebilde, zusammengesetzt aus Stücken der Tradition, die in ihm zugleich eine neue Dynamik gewinnen kann, teilhabend an Diskursen, die durch ihn zugleich eine neue Richtung erhalten können, bezogen auf ›Wirklichkeiten‹, die er nicht einfach abbildet oder spiegelt, in die er aber auf spezifische Weise eingelassen ist – als Produkt situativ unterschiedlicher Praktiken, in denen gesellschaftliche Gruppen Bedeutung herstellen im Medium geformter Rede.
Wie in der neueren anthropologisch geprägten Kulturwissenschaft Kulturen, so zeigen sich in der jüngeren Literaturwissenschaft Texte, und nicht zuletzt kanonische, vielschichtiger in ihren Profilen, ihren inter- und kontextuellen Beziehungen, als bislang wahrgenommen. Die Analyse versucht, diese Komplexität nicht zu verringern, sondern zu entfalten. Sie begreift sie als eine auf der multiplen Verknüpfung und Überlagerung von Zeichensystemen beruhende und unternimmt es mit Hilfe einer kontrollierten Distanznahme zum Untersuchungsgegenstand, die diesen nicht von vornherein an das Eigene, Vertraute und Gegenwärtige anschließt, das in jeder analytischen Erschließung virulente Problem der Übersetzung (von einer Kultur in eine andere, einem Text in einen anderen) im Sinne einer produktiven Verunsicherung zu nutzen – einer Verunsicherung, die nicht in postmoderne Beliebigkeit münden, vielmehr einen Gewinn an Tiefenschärfe, Differenzqualität und Historizität ermöglichen soll.[55]
Auch die literaturwissenschaftliche Mediävistik ist von diesen Tendenzen nicht unbeeinflußt geblieben.[56] Sie hat die Alterität ihres Gegenstandes entdeckt, nämlich die Eigenart mittelalterlicher symbolischer Ordnungen, die sich in modernen Repräsentationssystemen nicht angemessen erfassen lassen. Und sie ist in diesem Zusammenhang aufmerksam geworden auf Entwicklungen in der Ethnologie, die ebendieses Repräsentationsproblem anhand von räumlich entfernten Kulturen zum Thema machten. Eine Reihe von Arbeiten hat sich in den letzten Jahren auf ethnologische Untersuchungen bezogen. Claude Lévi-Strauss wurde aufgerufen, wenn Verwandtschaftssysteme und Genealogiemuster zu beschreiben waren, Marcel Mauss, wenn die Logiken der Gabe, Mary Douglas, wenn die Symboliken des Körpers zur Diskussion standen, Arnold van Gennep, wenn Übergangsriten, Victor Turner, wenn rituelle Prozesse aufgeschlüsselt werden sollten. Clifford Geertz wird überall genannt, wo die Bedeutungshaftigkeit fremder kultureller Formationen und der Rekonstruktionsanspruch der Wissenschaft auf dem Spiel steht.[57] In den meisten Fällen geht es um die faszinierende (obschon häufig punktuelle) Erschließungskraft scheinbar universaler Beschreibungskategorien, in den wenigsten um eine methodologische Klärung des Bezugs zwischen zwei Disziplinen, die sich zwar in ihrem Selbstverständnis aneinander angenähert haben mögen, in ihren Untersuchungsverfahren aber doch unterschiedlichen Traditionen verpflichtet sind. Entscheidende Fragen sind dementsprechend noch offen. Welchen Status haben literarische Texte hinsichtlich anthropologischer Konstellationen? Sind sie Material, aus dem überindividuelle Muster und Logiken herauspräpariert werden können? Oder sind sie reflexive Gefüge, die solche Muster und Logiken im Modus des Spiels neu konfigurieren? Und umgekehrt: Welchen Status haben ethnologische Beschreibungsmuster hinsichtlich literarischer Texte? Dienen sie der Erklärung von Textphänomenen? Oder dienen sie einer Modellbildung, die eine systematischere Erfassung von Texten ermöglicht?
Antworten auf diese Fragen hängen vom jeweiligen Erkenntnisinteresse ab. Wer Belege sucht für menschliche Elementarerfahrungen, für Körpertechniken und Ernährungsweisen, für Geburts-, Heirats- und Sterberiten wird auch in mittelalterlichen Texten fündig werden. Deren Strukturen und Subtilitäten können dabei unbeachtet bleiben.[58] Wer den Blick auf anthropologische Dispositionen richtet, soweit diese in spezifischen historischen Kontexten, medialen Ausprägungen und symbolischen Ordnungen zur Verhandlung stehen, wird die historische Eigenart und Logik des Materials genauer zu beachten haben. Er wird die Verallgemeinerung, um ihr Gültigkeit zu verschaffen, an das Einzelne zurückbinden müssen. Schon ein Begriff wie jener der Literarischen Anthropologie kann dann zum Problem werden.[59] Zum einen ist das Literarische mittelalterlicher Texte in kritischer Reflexion dessen zu bestimmen, was seit dem 18. Jahrhundert als Literatur verstanden wird (s. Einleitung). Zum anderen suggeriert der Begriff Anthropologie das Vorhandensein eines Diskurses, der für mittelalterliche Kulturen nicht ohne weiteres als gegeben und für die sie beschreibenden Wissenschaftsformationen kaum als einheitlich angenommen werden kann.[60] Das mag erklären, warum ich umständlich von ›anthropologischen Perspektiven‹ spreche, und rechtfertigen, warum ich versuche, das, was diese Perspektiven ausmacht, überhaupt erst zu definieren. Diese Definition erfolgt weniger in Form eines Resümees denn eines Prospekts. In starker Verkürzung skizziere ich, wie anthropologische Perspektiven auf mittelalterliche Texte in systematischer Hinsicht umrissen (II), an einem bestimmten Untersuchungsfeld präzisiert (III) und an einem konkreten Text erprobt werden können (IV).
II
Ausgangspunkt seien sechs Sätze, verbunden mit kurzen Erläuterungen, Sätze, die zunächst wissenschaftssystematische, sodann methodische und hermeneutische, schließlich gegenstandsbezogene Aspekte herausgreifen. Es handelt sich nicht um apodiktische Setzungen, sondern um pragmatische Vorschläge. Sie mögen dazu dienen, das Feld klarer abzustecken, auf dem sich vorhandene und künftige Ansätze begegnen können.
1. Anthropologische Perspektiven beziehen sich wissenschaftssystematisch auf Ansätze einer interpretativen Kultur- und Sozialanthropologie (oder berühren sich mit solchen). Der Begriff des Anthropologischen hat vielfältige Bedeutungen gemäß den verschiedenen Bereichen der Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaften, die sich mit dem Menschen beschäftigen.[61] Auch die Biologische, die Philosophische oder die Soziologische Anthropologie können für die Beschreibung von Texten eine Rolle spielen. Dennoch liegt die Orientierung an einer interpretativen Kultur- und Sozialanthropologie zumindest in zweifacher Hinsicht nahe. Diese hat Methoden ausgebildet, die Vernetzung von Einzelelementen in der Totalität einer kultureller Formation zu erfassen. Und sie hat sich in jüngerer Zeit mit der Frage beschäftigt, wie das Sinnsystem einer fremden Kultur im Spannungsfeld von Beobachter und Beobachtetem zu ›lesen‹ und zu repräsentieren ist.[62] Das eine ist mediävistisch relevant, wenn Überlagerungen zwischen sozialen Feldern beschrieben werden sollen, die nur ansatzweise funktionale Ausdifferenzierungen kennen. Das andere ist mediävistisch relevant, wenn neben Kontinuitäten auch Diskontinuitäten zwischen mittelalterlichen und neuzeitlichen Sinnsystemen in den Blick treten sollen.
2. Anthropologische Perspektiven verwenden Verfahrensweisen einer Historischen Semantik. Das Instrumentarium für die Untersuchung mittelalterlicher Texte läßt sich nicht einfach an Verfahren der Kultur- und Sozialanthropologie – Feldforschung, teilnehmende Beobachtung, Kombination von Aufzeichnungstechniken – ausrichten. Insofern diese aber interpretativen Charakter haben, sind sie mit den gleichen Problemen konfrontiert wie die Textwissenschaften.[63] Sie versuchen, möglichst exakt die Eigenlogik einer Kultur oder eines Textes zu erfassen – ohne dabei von ahistorischen oder anachronistischen, implikationsreichen oder teleologischen Vorannahmen auszugehen. Nichts anderes meint, zumindest idealiter, der Begriff ›dichte Beschreibung‹: Gegebenes in einem möglichst dichten Netz textueller und historisch relevanter Bezüge zu verorten. Das berührt sich mit dem weiter angelegten Projekt einer Historischen Semantik. Vorannahmen über zum Beispiel Originalität, Individualität oder psychologische Stimmigkeit mittelalterlicher Texte auszuschalten heißt nicht, erneut der Illusion des Historismus zu verfallen, man könne vergangene Zeiten aus ihrem eigenen System heraus verstehen. Doch es heißt, Bedeutungsstrukturen zu rekonstruieren und mit ihnen nicht nur die innere Logik und den geschichtlichen Wandel von symbolischen Ordnungen, sondern auch die Bedingungen der Möglichkeit, bestimmte Sachverhalte in bestimmten Kontexten zu bestimmten Zeitpunkten zu artikulieren.
3. Anthropologische Perspektiven operieren nach den Modalitäten einer Fremd-Hermeneutik. Vorausgesetzt, es gehe darum, Texte nicht als bloßen Ausdruck, sondern als semiotischen Entwurf anthropologischer Konstellationen zu verstehen, sind anthropologische Perspektiven mit den üblichen Dimensionen interpretativer Vorgehensweisen konfrontiert. Sie müssen Modelle bilden, die Revisionen zulassen. Und sie müssen reflexiv angelegt sein, um das prekäre Verhältnis zwischen Gegenstand und Beschreibung nicht aus dem Blick zu verlieren. Prekär ist dieses Verhältnis, weil die Eigenart des Gegenstands eben jenes Traditionskontinuum in Frage stellt, auf dem der Verstehensprozeß im Sinne der klassischen Hermeneutik aufbaut. Statt im Zuge von Horizontverschmelzungen die Distanz zwischen Gegenwart und Vergangenheit zu verringern, gilt es, die Fremdheit des Objekts einerseits zu entfalten, andererseits für eine Präzisierung des Beschreibungsinventars zu nutzen. Diese Art von Hermeneutik hat prozessualen und infiniten Charakter nicht nur aufgrund der Unendlichkeit von Auslegungsmöglichkeiten, sondern aufgrund der prinzipiellen Nicht-Verfügbarkeit des Gegenstands.
4. Anthropologische Perspektiven richten sich auf Texte als menschliche Hervorbringungen und Teil von Handlungsvollzügen und Kommunikationssituationen. Gegenstand oder zumindest Ausgangspunkt der Beschreibung sind konkrete Objekte: Texte, vorliegend in Handschriften und Drucken. Als solche sind sie Produkt von Herstellungsvorgängen und tragen sie die Spuren von Handlungsweisen an sich. Zugleich sind sie Basis von Sinnsystemen und dies in doppelter Weise: Sie transportieren Sinn, sind aber in einer Kultur wie der mittelalterlichen auch selbst sinnhaft. Das Buch ist sowohl Träger von Wissen wie Gegenstand von Handlungen. Es vereint in sich, was später in den Informationsträger einerseits, das bibliophile Kunstwerk andererseits auseinandertreten wird. Eine materielle Philologie kann die spezifischen Praktiken herausarbeiten, die in einer noch nicht selbstverständlich auf Schriftlichkeit gegründeten Kultur den Umgang mit der Materialität der Überlieferung prägten: Praktiken, die einerseits der Öffnung, andererseits der Stabilisierung von Sinn dienen sollten. Sie kann aber auch einzelne Überlieferungsträger mikrohistorisch im Schnittpunkt verschiedener Herstellungs- und Verwendungszusammenhänge situieren und aus der Detailanalyse Modelle für die kommunikative Funktion der Texte gewinnen: Modelle, die nicht einfach ästhetischen Genuß und kritische Reflexion berücksichtigen, sondern auch Momente memorialen Gemeinschaftshandelns, didaktischer Wissensvermittlung und geistlicher Lebensorientierung.
5. Anthropologische Perspektiven richten sich auf Texte als Repräsentationen imaginärer Welten.