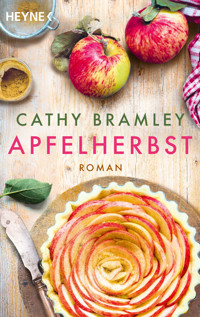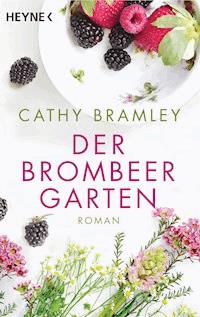9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Rosie beschließt, ihren gut bezahlten Job in einer Werbeagentur aufzugeben, um ihrer Großmutter für eine Weile in ihrem Café auszuhelfen. Sie liebt die Zitronenbäume, die den kleinen Laden schmücken und den Duft von Sommer versprühen. Schnell wird das Café zu Rosies Lebensmittelpunkt. Die freundlichen Gäste, die köstlichen Biscotti ihrer Großmutter und vor allem Gabriel möchte sie nicht mehr missen. Doch Rosies Glück wird überschattet von einem Geheimnis aus ihrer Vergangenheit ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 682
Ähnliche
Das Buch
Rosie beschließt, ihren gut bezahlten Job in einer Werbeagentur aufzugeben, um ihrer Großmutter für eine Weile in ihrem Café auszuhelfen. Sie liebt die Zitronenbäume, die den kleinen Laden schmücken, und die den Duft von Sommer versprühen. Schnell wird das Café zu Rosies Lebensmittelpunkt. Die freundlichen Gäste, die köstlichen Biscotti ihrer Großmutter und vor allem Gabriel möchte sie nicht mehr missen. Doch Rosies Glück wird überschattet von einem Geheimnis aus ihrer Vergangenheit …
Die Autorin
Cathy Bramley lebt mit ihrem Mann, ihren beiden Töchtern und ihrem Hund in einem kleinen Dorf in Nottinghamshire. Sie war schon immer eine Leseratte und las früher oft mit der Taschenlampe unter der Bettdecke. Damit war erst Schluss, als ihr Mann ihr einen E-Reader mit Beleuchtung schenkte. Nachdem sie achtzehn Jahre lang eine Marketingagentur geleitet hatte, startete sie als Autorin noch einmal neu durch. Von ihrem Erfolg war sie dabei wohl als Einzige selbst überrascht.
Lieferbare Titel
Wie Himbeeren im Sommer
Fliedersommer
Der Brombeergarten
CATHY BRAMLEY
ZITRONEN
SOMMER
ROMAN
Aus dem Englischen von
Aimée de Bruyn Ouboter
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel The Lemon Tree Café.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 07/2019
Copyright © 2017 by Cathy Bramley
Copyright © 2019 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Rabea Güttler
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik Design, München
unter Verwendung von © Apinan/Shutterstock (Weiße Wand);
© Thasneem/Shutterstock (Blaubeeren und Blätter);
© Rimma Bondarenko/Shutterstock (Erfrischungsgetränke);
© 9dream studio/Shutterstock (Zitronen);
© New Africa/Shutterstock (Blätter)
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-23905-3V002
www.heyne.de
ERSTER TEIL
Kapitel 1
Das Büro der Geschäftsleitung von Digital Horizons bot einen reizvollen Ausblick über das Stadtzentrum Derbys, aber gerade sah ich nicht aus dem Fenster. Ich starrte meinen Chef an, der meinen Blick erwiderte, ohne zu blinzeln, während er auf meine Antwort wartete. Die niedrig stehende Märzsonne war meiner Sache nicht zuträglich: So schön die ersten Sonnenstrahlen waren, sie schienen mir direkt in die Augen und brachten sie zum Tränen. Hoffentlich sah es nicht so aus, als würde ich weinen, denn davon war ich weit entfernt.
Ich versuchte, meinen Stuhl zu verrücken, aber in diesem Glaskasten gab es kein Entkommen. Sogar die Innenwände waren durchsichtig.
»Ich habe bereits Nein gesagt.« Ich schlug die Beine übereinander und musterte Robert herausfordernd.
Robert Crisp, der nicht nur mein Vorgesetzter, sondern auch der Geschäftsführer von Digital Horizons war, seufzte und lockerte den Kragen seines Hemdes. Vielleicht ahnte er schon, dass ich nicht nachgeben würde. Damit lag er ganz richtig: Für manche Dinge lohnte es sich zu kämpfen.
»Es sind doch nur ein paar Handgriffe, Rosie.« Robert verlegte sich aufs Bitten. »In zwei Minuten ist alles vorbei. Es wird auch keiner davon erfahren, wenn Ihnen die Sache so unangenehm ist. Sie sind nun mal die Beste auf dem Gebiet!« Er machte effektheischend eine Pause. »Deshalb habe ich Sie eingestellt.«
Eine kaum verhohlene Drohung. Enttäuscht von ihm, wandte ich den Blick ab.
Außer uns war nur Duncan Wiggins noch mit im Raum, der Verkaufsleiter. Jetzt schnalzte er missbilligend mit der Zunge.
»Verfluchte Feministinnen«, murmelte er so leise, dass nur ich es hören konnte.
Duncan, um die dreißig, wurde bereits kahl und hatte eine Vorliebe für knallbunte Socken. Ich hatte schnell verstanden, dass es das Beste war, über sein sexistisches Geschwätz hinwegzugehen. Wenn ich mich auf eine Diskussion mit ihm einließ, fachte ich bloß das Feuer an.
Und ja, ich war Feministin. Wer hätte das gedacht? Sicherlich nicht ich mit Anfang zwanzig. Damals hätte ich mich wahrscheinlich als eine typische junge Frau beschrieben, mit der man jede Menge Spaß haben konnte und die gern flirtete. Gleichberechtigung, hatte ich damals gedacht, herrschte längst überall, Frauen hatten genauso viel Macht wie Männer, und Feministinnen machten Wind wegen gar nichts.
Außerdem war ich überzeugt davon gewesen, dass ich immer recht hatte. Auch das war ein Irrtum gewesen.
Ich ignorierte Duncan und versuchte, an das Gute in Robert zu appellieren. Im Großen und Ganzen war er ein netter Kerl und überdies Vater von zwei Mädchen im Teenageralter.
»Tut mir leid, Chef«, sagte ich, »aber das ist die falsche Entscheidung – aus verschiedenen Gründen. Das muss Ihnen doch klar sein!«
Der Bildschirm auf dem Konferenztisch war so ausgerichtet, dass wir alle drei einen freien Blick darauf hatten. Ich deutete auf das abgebildete Foto. Ich konnte nicht fassen, dass von mir verlangt wurde, es zu bearbeiten, um Lucinda Miller schlanker erscheinen zu lassen. Lucinda war eine hübsche junge Schauspielerin und das Gesicht einer Online-Kampagne für die Vermeidung häuslicher Gewalt gegen Teenager, die wir heute Mittag starten wollten. Kupferrote Locken standen ihr um den Kopf, ihr Lächeln war natürlich und freundlich, und ihre Augen glitzerten. Außerdem hatte sie Brüste, ein kleines Bäuchlein und – o Schreck! – keine Oberschenkellücke.
Lucinda hatte eine schwierige Kindheit überstanden und war eine erfolgreiche Schauspielerin geworden. Meiner Meinung nach war sie genau die Richtige für die Kampagne, das perfekte Vorbild – genau so, wie sie war.
Der Kunde jedoch hatte darum gebeten, dass wir ihren Bauch und ihre Beine dünner machten. Nicht etwa, weil sie fett wäre, hatte es geheißen, es ginge nur darum, dem Gesamtbild eine anmutigere Linie zu verleihen. Die Brüste könnten so bleiben.
War ja klar.
Duncan hatte Lucinda bereits als »das Pummelchen aus Raw Recruits« bezeichnet – Raw Recruits war das düstere Polizeidrama, in dem sie mitspielte. Ich fand das lächerlich: Lucinda trug Größe 38, lag deutlich unter dem Durchschnittsgewicht und hatte digitale Verbesserungen durch mich und meine Bildbearbeitungssoftware einfach nicht nötig.
»Wie wär’s mit etwas Süßem?« Robert schob den Teller mit Zimtschnecken über den Konferenztisch zu mir herüber.
Als ich danach griff, schwangen mir meine kurz geschnittenen schwarzen Haare in die Augen. Ich strich sie mir hinter die Ohren und lächelte Robert verhalten an. »Sie werden meine Meinung nicht ändern können, indem Sie mich bestechen.«
Er massierte seine Stirn und sagte: »Wir haben keine Wahl, Liebes.«
Mir froren die Gesichtszüge ein. Sofort hob er beschwichtigend die Hände.
»Verzeihung: Rosie. Verzeihung!«
»Robert.« Ich sah ihn entschlossen an. »Wir haben immer eine Wahl. Wir können ablehnen. Was vermitteln wir sonst den jungen Frauen, die sich Hilfe suchend an diese Organisation wenden? Wenn wir das unterstützen, sind wir genauso schlimm wie die Medien, die überhaupt erst dafür gesorgt haben, dass junge Mädchen so ein schlechtes Selbstwertgefühl haben! Also nein, ich mache sie nicht dünner. Sie ist schön, so wie sie ist. Und im Ernst – dass sie eben nicht perfekt ist, ist viel aussagekräftiger!«
Neben mir fluchte Duncan tonlos. Ich gab mir große Mühe, nicht darauf zu reagieren.
»Natürlich wird Rosie es machen.« Er streckte die Hand nach der Kaffeekanne aus, sah Robert an und zog eine Augenbraue hoch. Selten hatte er so schmierig ausgesehen. »Frauen sagen doch immer Nein und meinen es nicht so. Zumindest meiner Erfahrung nach.«
»Helfen Sie mir auf die Sprünge«, wandte ich mich an Duncan und tupfte mir Krümel von den Lippen, »wann waren Sie das letzte Mal mit einer Frau verabredet? Ihre Mutter ausgenommen.«
Er öffnete den Mund, konnte sich offenbar nicht erinnern und begnügte sich damit, mir einen vernichtenden Blick zuzuwerfen.
»Und fürs Protokoll: Ich meine es vollkommen ernst«, fuhr ich fort und sah zufrieden, dass Robert zu schwitzen begonnen hatte. »Lucinda gefällt das Bild, ich habe eine Mail von ihrem Agenten, die das belegt. Es ist ein Mythos, dass Frauenkörper perfektioniert werden müssen, und ich werde sicher nicht dabei helfen, den am Leben zu erhalten! Das verstößt gegen meine Prinzipien.« Ich schob mir den Rest der Zimtschnecke in den Mund und murmelte: »Sorry.«
»Die Geschäfte laufen im Moment nicht besonders, Rosie«, argumentierte Robert. »Sie wissen, wie wichtig dieser Kunde ist.«
»Ja, das weiß ich.« Ich verschränkte die Arme. »Wichtig für junge Mädchen, die in Missbrauchsbeziehungen stecken und von ihren Freunden schikaniert werden, weil sie angeblich Nutten sind oder dumm oder weil sie keine Oberschenkellücke haben!«
»Um Himmels willen, Featherstone, können Sie mal von Ihrem hohen Ross runterkommen?« Duncan gab ein Ächzen von sich, das seine Erschöpfung illustrieren sollte, und warf dann einen bedeutungsschweren Blick auf meinen engen Rock und meine High Heels. Ich kämpfte gegen den Drang, am Saum herumzuzupfen – der Rock war nicht einmal besonders kurz. Ich machte mich für mich selbst schick, nicht um der männlichen Hälfte der Bevölkerung zu gefallen. Duncan konnte sich zum Teufel scheren.
Er fragte: »Hat man mit Ihnen immer so viel Spaß?«
»Oh, es tut mir leid, dass ich bei häuslicher Gewalt nicht lachen kann«, sagte ich, die Augen weit aufgerissen.
»Das hat er nicht gemeint, Rosie«, sagte Robert mit einem warnenden Blick in Duncans Richtung.
»Es ist kein Verbrechen, Lucindas Vorzüge herauszustellen. Und selbst wenn … Wir sind nicht verantwortlich«, sagte Duncan aalglatt. »Wir machen bloß, was der Kunde will: Wir retuschieren ein bisschen an der dicken Kleinen herum und starten die Kampagne wie geplant. Schluss, aus, Ende! Jetzt lassen Sie uns über etwas von Belang sprechen – über den Golfausflug für unsere wichtigsten Kunden. Ich habe mir verschiedene Golfplätze angesehen …«
Und er fing an zu schwadronieren: über achtzehn Löcher, über Teams, Trophäen und eine Hand, die stets die andere wäscht. Ich starrte Robert an, erwartungsvoll. Er wand sich in seinem Stuhl und schlug die Augen nieder.
Mittags ging die Social-Media-Kampagne online. Ein bearbeitetes Foto von Lucinda Miller war der Aufmacher: Darauf hatte sie eine Wespentaille, einen flachen Bauch und Beine so dünn wie Streichhölzer. Keine Ahnung, wer das Retuschieren übernommen hatte – wahrscheinlich Billy, der Nachwuchs-Grafikdesigner. Er hoffte auf eine Einladung zu Duncans Golfausflug.
Ich hatte ihn nicht an Lucindas Foto arbeiten sehen, weil ich zu sehr damit beschäftigt war, auf meine Computertastatur einzuhacken. Zehn Minuten später überreichte ich meinem sprachlosen Chef mein Kündigungsschreiben und trat als Kreativchefin der größten Social-Media-Agentur in den Midlands zurück.
Als Robert mir vorwarf, überempfindlich zu sein, erklärte ich ihm geduldig, dass es nicht bloß um Lucinda Millers Oberschenkel ging: Bei Digital Horizons war alltäglicher Sexismus so untrennbar mit dem Firmenethos verbunden, dass die wenigen Frauen, die hier arbeiteten, ihn einfach hinnahmen, während die Männer ihn nicht einmal bemerkten.
Ich für meinen Teil würde mich nicht weiter damit abfinden. Also hinterlegte ich den Schlüssel meines Dienstwagens an der Rezeption, verließ die Agentur durch die gläserne Drehtür und stieg in den Bus. Dabei war ich ausgesprochen stolz auf mich: Zwar mochte ich den Kampf heute verloren haben, doch von meinen Grundsätzen war ich nicht abgerückt.
Der Bus brachte mich bis Chesterfield. Von dort nahm ich mir für den Rest des Weges ein Taxi, um ungestört ein wichtiges Telefonat zu führen.
»Ich kann sofort anfangen«, sagte ich zu Michael, dem Headhunter, der mir die Stelle bei Digital Horizons vermittelt hatte. »Je eher, desto besser.«
Herumsitzen war nichts für mich. Es kam selten vor, dass ich meinen Urlaubsanspruch wahrnahm; die Vorstellung, »einmal richtig zu entspannen«, fand ich gruselig.
»Meine Güte, Darling! Das kommt aber plötzlich. Was ist denn bloß passiert?«
Ich hatte Vertrauen zu Michael. Er wusste, wie ehrgeizig ich war, wie hart ich arbeitete. Ich war sicher, dass er sich auf meine Seite stellen würde.
»Eine Meinungsverschiedenheit … Und die bei Digital Horizons waren im Unrecht. Also …« Ich räusperte mich. Was brachte es, über vergossene Milch zu jammern? »Auf zu neuen Ufern! Was hast du für mich?«
»Hm, für jemanden von deinem Format fällt mir auf Anhieb nichts ein. Einen kleinen Moment Geduld, ich schaue mal, was sich in den Tiefen meines Computers finden lässt.«
Ich hörte zu, wie seine Finger über die Tastatur klickten, und klammerte mich mit der freien Hand am Türgriff fest, während das Taxi über die Hügel der Grafschaft Derbyshire holperte, Barnaby entgegen. Als wir an der alten Eiche vor der Kirche vorbeifuhren, warf ich einen Blick aus dem Fenster und konnte die Inschrift auf der Tafel lesen, die dort angebracht war: »Gepflegtestes Dorf 2012«.
Barnaby war ein hübsches Dorf am Rand des Hochlandgebiets Peak District. Eingebettet in ein Tal und umgeben von Schafweiden, versprühte es den Charme der Vergangenheit. Die Cottages waren aus klobigen, sandfarbenen Steinen erbaut und hatten weiß umrahmte Fensterchen. Eine Zeile malerischer kleiner Läden begrenzte den Dorfanger, und ein Flüsschen schlängelte sich fröhlich plätschernd neben der kopfsteingepflasterten Hauptstraße her.
Wir kamen an der steil ansteigenden Gasse vorbei, in der ich wohnte. Im letzten Sommer hatte ich ein winziges Cottage ganz am oberen Ende gekauft. Mein Plan war gewesen, es zu renovieren und dann weiterzuverkaufen. Es hatte viel daran getan werden müssen: Das Cottage hatte nun ein neues Dach, einen niedlichen Ofen, der mit Holzscheiten beheizt wurde, ein Badezimmer im Hotel-Stil sowie eine Küche mit jedem erdenklichen modernen Komfort. Tatsächlich hatte ich meine Sache so gut gemacht, dass ich mich von dem Häuschen nicht mehr trennen konnte und es nun mein Zuhause nannte.
Kinder tummelten sich auf dem Spielplatz vor dem kleinen viktorianischen Schulgebäude: Sie spielten Himmel und Hölle und Fußball. Ein paar pressten die Gesichter gegen den Zaun, winkten und riefen, um die Aufmerksamkeit der Vorübergehenden auf sich zu ziehen. Lächelnd winkte ich zurück. Meine kleine Schwester Lia und ich hatten es früher genauso gemacht.
Michael murmelte noch immer kaum hörbar vor sich hin, während er seine Notizen durchsah.
»Oh, hey, ich habe hier eine märchenhafte freie Stelle: eine leitende Position bei einer Fullservice-Werbeagentur in London. Aufregende Kundenliste, tolles Leistungspaket. Wäre das was für dich?«
Eigentlich ja. Wenn die Agentur nur nicht in London gewesen wäre … Nach meinem Universitätsabschluss hatte ich ein paar Monate in der Stadt gelebt, aber meine Zeit dort hatte kein gutes Ende genommen. Andererseits war es vielleicht wirklich an der Zeit, meinen Aktionsradius zu vergrößern, wenn ich auf der Erfolgsleiter weiter nach oben steigen wollte.
»Könnte schon sein«, sagte ich vage. »Eine Stelle weiter nördlich wäre mir allerdings lieber.«
Michael seufzte. »Im Augenblick ist es ziemlich still in der Social-Media-Branche.«
»Halte bitte weiter Ausschau für mich. Wenn ich nichts zu tun habe, drehe ich durch!«
Er versprach, sein Bestes zu geben, und legte auf. Ich ließ mein Handy in meine offene Handtasche fallen. Als wir uns dem Dorfanger näherten, senkte ich die Glasscheibe zwischen mir und dem Taxifahrer ab.
»Da ist es«, sagte ich und deutete auf das Gebäude mit der sonnengelben Markise und den zwei kleinen Zitronenbäumen, die in Terrakottatöpfen links und rechts der Tür standen. »Das Lemon Tree Café.«
Das altmodische Glöckchen über der Tür verkündete bimmelnd meine Ankunft. Ich trat über die Schwelle in eine andere Welt: Das Café meiner Großmutter war das genaue Gegenteil von Digital Horizons.
Für den Mittagstisch war es schon zu spät, die meisten Tische waren leer. Doreen, die im Café gearbeitet hatte, solange ich zurückdenken konnte, stand hinter dem Tresen und füllte die Sandwich-Zutaten auf. Meine fünfundsiebzigjährige italienische Nonna, Maria Carloni, saß in der Spielzeugecke und räumte Holzbausteine in eine Kiste. Als sie das Glöckchen hörte, blickte sie auf, rückte ihre schwarz umrandete Brille zurecht, durch deren Gläser ihre Augen so groß wie Kastanien wirkten, und steckte eine Strähne ihres weißen Haars zurück in ihren Haarknoten. Dann erst erkannte sie mich.
»Santo cielo!«, rief sie aus. »Rosanna!«
»Überraschung!« Ich lachte, als sie zu mir herübergeeilt kam, die Arme weit ausgebreitet.
Sie küsste mich laut schmatzend auf beide Wangen, und ich drückte meine mollige Nonna fest an mich. Sie roch, wie sie immer schon gerochen hatte: nach Zitronenseife und Mandelhandcreme.
Das Café war bis zum Bersten gefüllt mit glücklichen Erinnerungen. Als Lia und ich noch klein gewesen waren, hatte Nonna nach der Schule immer auf uns aufgepasst. Wir hatten Süßigkeiten aus dem Glas hinter dem Tresen stibitzt, die Gäste mit Liedern und selbst ausgedachten Tanzeinlagen unterhalten und – natürlich – gut gegessen. So viel leckeres Essen! Nach diesem Morgen war das Café der perfekte Ort, um meine Batterien wieder aufzuladen.
Doreen winkte mir zu. Ihre Wangen bekamen Grübchen, wenn sie lächelte. Sie hielt eine Kaffeetasse in die Höhe, und ich nickte heftig, während Nonna mich zu einem der Barhocker am Tresen führte. Ich atmete den caféeigenen Duft ein: eine einladende Mischung aus gerösteten Kaffeebohnen, den Kräutern, die in Blumentöpfen auf den Tischen standen, der Süße frisch gebackener Cookies und der aromatischen Schärfe der Zitronenbäume aus dem angrenzenden Wintergarten. Für mich war das der Inbegriff von Wärme, Liebe und Zusammensein. Zum ersten Mal an diesem Tag entspannten sich meine Schultern.
»Warum biste du nicht auf die Arbeit?« Nonnas Blick wanderte prüfend über mein Gesicht. Sie wirkte besorgt. »Biste eine Arbeitstier, nicht einmale Wochenende fur dich. Genau wie deine Nonna«, fügte sie mit einem Anflug von Stolz hinzu.
»Nein, ich …« Ich brach ab, als Doreen einen Cappuccino und ein gegrilltes Schinken-Käse-Sandwich vor mich hinstellte, und lächelte sie dankbar an. »Ich hab gekündigt. Bin aus Protest gegangen.«
Dann erzählte ich ihnen, was passiert war. Sie hörten mir gebannt zu.
»Arschegeigen.« Nonna zog eine finstere Miene. Doreen wandte sich zwei Spaziergängern zu, die Tee und getoastete Teacakes bestellen wollten, um sich nach ihrer Wanderung aufzuwärmen. »Biste ihre beste Frau. Was stimmte nicht mitte ihne?«
»Ganz offensichtlich sind sie Arschegeigen«, sagte ich und grinste Doreen an.
Nonnas Loyalität wärmte mir das Herz. Sie hatte nicht die geringste Ahnung, was soziale Medien waren, hatte noch nie im Leben von viralem Marketing gehört und konnte sich nicht vorstellen, was ich den ganzen Tag über machte – und trotzdem, in ihren Augen war ich die Größte.
»Eh.« Sie schlug mit ihrem allgegenwärtigen Lappen nach mir. Ein Regen aus Krümeln ging nieder. »So wir rede nichte!«
Ich lachte und duckte mich unter dem Lappen weg. Sie wanderte davon, um weiter Tische abzuräumen und ein paar Worte mit ihren Gästen zu wechseln.
»Gib mir das.« Doreen schnalzte tadelnd mit der Zunge und streckte ihre Hand nach meinem Cappuccino aus. »Das kannst du nicht mehr trinken.«
Ich spähte in die Tasse. »Oh.« Der Cappuccino-Schaum war mit Krümeln und Fusseln übersät.
Doreen machte mir einen neuen und lehnte sich dann verschwörerisch über den Tresen.
»Deine Großmutter und dieser verflixte Lappen. Ich verbringe den halben Tag damit, hinter ihr herzuwischen. Ich will mir nicht zu viel herausnehmen …«, ihre Wangen röteten sich vor Verlegenheit, »aber ich mache mir ein bisschen Sorgen um Maria.«
»Warum denn das?« Ich sah zu Nonna hinüber, die sich schwer auf eine Tischplatte stützte und sich mit einem Arm die Stirn abwischte. »Ist sie krank?«
Doreen schüttelte den Kopf. »Nicht krank …« Sie sah sich nervös um. »Ich sollte das alles gar nicht sagen. Vergiss es bitte!«
»Du machst mir Angst. Komm schon, spuck’s aus!«
»Es ist nur so … Ich hab das Gefühl, dass …« Sie stieß den Atem aus und knetete den Saum ihrer Schürze in den Händen. »In Ordnung. Die Sache ist die: Ich glaube nicht, dass sie ihren Aufgaben noch gewachsen ist.«
»Was meinst du? Dass sie das Café nicht mehr führen kann?« Meine Augen wurden groß.
»Einen Moment.« Sie ging ein paar Schritte zur Seite, um eine kleine, im Aufbruch begriffene Gruppe Gäste abzukassieren.
Ich trank meinen frischen Cappuccino und runzelte die Stirn.
Doreen war fleißig und Nonna sehr ergeben. Grundlos würde sie sich nie beklagen.
Sie schloss die altmodische Kasse mit einem Knall und kam wieder zu mir herüber. Nachdem sie sich mit einem Blick über die Schulter vergewissert hatte, dass Nonna nicht in Hörweite war, sagte sie: »Heute Morgen zum Beispiel. Sie hat jemandem statt drei dreizehn Pfund Wechselgeld herausgegeben.«
»Das kann schnell mal passieren«, sagte ich diplomatisch.
»Ich hab sie außerdem letzte Woche dabei erwischt, wie sie die Salzstreuer mit Zucker auffüllen wollte.«
Jetzt war Nonna offenbar gerade dabei, einen sauberen Tisch mit ihrem schmutzigen Lappen abzuwischen. Das Ergebnis war mehr als fragwürdig.
»Vielleicht braucht sie eine neue Brille?«, fragte ich.
»Nein«, sagte Doreen traurig. »Gestern hab ich gedacht, sie wäre verschwunden. Nach einer halben Stunde hab ich sie im Hof gefunden, sie saß auf einem umgedrehten Eimer und hat fest geschlafen. Es geht nicht um eine neue Brille. Sie ist fünfundsiebzig. Was deine Großmutter braucht, ist eine Pause. Eine dauerhafte!«
Mein Magen fühlte sich an, als säße ich in einer Achterbahn, die einen Looping fuhr. Von Freizeit war Nonna in etwa so begeistert wie ich, und von guten Ratschlägen hielt sie gar nichts.
»Hast du versucht, ihr das zu sagen?«, fragte ich schwach.
Doreen schnaubte. »Auf uns hört sie nicht. Ich kann sie nicht mal dazu kriegen, eine richtige Mittagspause zu machen. Sie lässt nicht zu, dass Juliet und ich nach Ladenschluss sauber machen – pünktlich um vier schickt sie uns nach Hause und macht alles selbst. Wenn wir können, putzen wir vorher ein bisschen, ohne dass sie was merkt. Aber der Grill muss dringend mal richtig geschrubbt werden und die Toiletten … Wenn die Hygiene-Heinis hier auftauchen, ist der Teufel los. Ich kann es mir nicht leisten, meinen Job zu verlieren! Juliet auch nicht.«
Juliet war die zweite Teilzeitkraft, die im Café arbeitete, wenn Doreen freihatte. Nonna hatte nie viele Leute beschäftigt; sie hatte immer gesagt, dass sie selbst für zwei arbeitete. Diese Zeiten mochten der Vergangenheit angehören, aber ich wollte nicht diejenige sein, die Nonna das beibringen musste.
»Ich bin sicher, dass es dazu nicht kommt.« Ich lächelte Doreen beruhigend zu. »Hm … Soll ich mit Mum darüber reden?«
»Lieber nicht«, sagte Doreen eilig. »Erinnerst du dich noch ans letzte Mal, als deine Mutter helfen wollte?«
Ich zog eine Grimasse. Wie hätte ich das vergessen können? Mum war aus der kommunalen Planungsabteilung geflogen. Anstatt sich nach einer neuen Stelle umzusehen, hatte sie vorgeschlagen, dass sie das Café weiterführen könnte – immerhin sei Nonna im Rentenalter. Nonna ging einen Kompromiss ein und schlug Mum vor, sie erst einmal gründlich einzuarbeiten. Aber gleich in der ersten Woche zerstritten sie sich, und Nonna feuerte Mum. Die nächsten sechs Monate war die Stimmung bei familiären Anlässen entschieden frostig gewesen.
»Das Problem liegt darin«, versuchte ich mich möglichst taktvoll auszudrücken, »dass sie alle beide gern bestimmen, wo es langgeht.«
»Was du nicht sagst.« Doreen verdrehte die Augen. »Dabei fällt mir ein: Heute findet das Treffen des Frauenvereins deiner Mutter hier statt. In einer halben Stunde geht’s los. Ich werd mal besser die Tische im Wintergarten eindecken.«
Ich aß mein Sandwich auf, dachte über Doreens Sorgen nach und sah mich dabei mit neuen Augen im Lemon Tree Café um.
Kein Familienmitglied war je in Nonnas Heimatstadt Neapel gewesen, aber sie sagte, dass das Café sie an das Haus erinnerte, in dem sie aufgewachsen war. Sie hatte keine Angehörigen mehr in Italien, und nachdem ihr Ehemann in den 1960er-Jahren jung gestorben war, war sie mit Mum nach England gekommen. Ursprünglich hatte sie als Bedienung im Lemon Tree Café angefangen, war dann zur Geschäftsführerin aufgestiegen und hatte das Café schließlich übernommen. Sie sagte gern, dass es ihr kleines Stück Italien sei. Für nichts auf der Welt wolle sie es hergeben.
An den Wänden hingen alte italienische Werbeplakate für Olivenöl, Mehl und Zitronen, die Tische waren aus schwerem, dunklem Holz, die zusammengewürfelten Stühle ein wenig abgenutzt, dafür aber bequem. Auf einer Anrichte war ein Sammelsurium von italienischem Geschirr ausgestellt, auf dem Zitronen abgebildet waren. Überall zwischen den Töpfen mit Kräutern standen Vasen und Gläser in verschiedenen Formen und Größen. Das Café sah aus wie eine Kreuzung zwischen einem südländischen Garten und der Küche einer alten Dame. Schäbig-schick – obwohl inzwischen mehr schäbig als schick.
Das war es, was Doreen mir hatte zeigen wollen: Das Café wirkte ein bisschen vernachlässigt. Dabei hatte es so viel Potenzial! Von den Fenstern aus konnte man den Dorfanger überblicken, und auf dem Bürgersteig gab es genug Platz, um im Sommer ein paar zusätzliche Tische aufzustellen. Es war ein Jammer, dass ich so eine schlechte Köchin war. Ansonsten hätte ich anbieten können auszuhelfen.
»Also, was machste du jetzte, eh?« Nonnas durchdringende Stimme sprach direkt in mein Ohr und riss mich aus meinen Gedanken.
Sie stützte sich auf den Tresen, um mich besser begutachten zu können, und stieß prompt mit dem Ellbogen meine Kaffeetasse um. Die Tasse landete in meinem Schoß, und ich hielt sie fest.
Doreen seufzte und gab mir eine Serviette.
»Na ja«, sagte ich betont fröhlich und ignorierte die leise innere Stimme, die mich erneut an meine Unfähigkeit in der Küche erinnerte, »ehrlich gesagt habe ich gehofft, dass du mich einen Monat lang für dich arbeiten lässt.«
Nonnas Stirn legte sich in Falten. »Brauche ich nichte …«
»Natürlich musst du mich nicht bezahlen«, fügte ich rasch hinzu. »Du würdest mir einen großen Gefallen tun. Du weißt doch, wie schrecklich ich es finde, den ganzen Tag bloß Däumchen zu drehen! Und auf meinem Lebenslauf sähe es auch besser aus.«
Doreen legte die Hände zusammen, als würde sie beten. Nonna dachte unangenehm lange über meinen Vorschlag nach.
»Gebongte«, brummte sie schließlich. Sie wedelte mit dem Zeigefinger. »Aber nichte vergesse, wer iste Chefin! Hängste du dich nichte rein!«
Ich warf die Arme um ihren Hals und küsste ihre weiche Wange.
»Danke schön, Nonna!« Ich zwinkerte Doreen zu, die ihre Erleichterung kaum verbergen konnte. »Mach dir keine Sorgen, ich werd mich nicht reinhängen … Ich weiß doch nicht mal, wie man ein Ei kocht!«
Es mochte Einbildung sein, aber Doreens Lächeln wirkte nach diesem Eingeständnis ein wenig gezwungen.
Kapitel 2
Als ich am nächsten Morgen den Kragen meines Mantels hochschlug, um mich gegen den beißenden Wind zu schützen, freute ich mich richtig auf meinen ersten Arbeitstag im Café. Ich wandte meinem kleinen Cottage den Rücken zu und wanderte bergab. Die Zeit im Café würde eine willkommene Abwechslung für mich sein: etwas ganz anderes als das Einhalten von Deadlines oder das Beschwichtigen von Kunden, die unrealistischerweise erwarteten, dass eine Handvoll gesponsorter Tweets ihren Bekanntheitsgrad im Internet über Nacht enorm steigern würde. Körperliche Arbeit würde mir guttun. Außerdem bot sich hier eine wunderbare Gelegenheit, meine Kochkünste ein wenig zu verfeinern … Und hoffentlich würde es mir gelingen, unauffällig ein wenig herumzuschnüffeln.
Als ich auf den Dorfanger zuging, sah ich eine Frau mit einer pink gefärbten Haarsträhne in Ken’s Mini Mart, dem Einkaufsladen, verschwinden. Das musste meine alte Schulfreundin Gina sein: Schon früher war sie eine schillernde Persönlichkeit gewesen. Vielleicht würde es uns jetzt, da ich mehr Zeit im Dorf verbrachte, endlich gelingen, uns zu treffen. Wie ich war Gina im letzten Jahr zurück nach Barnaby gezogen; sie hatte sich von ihrem Mann getrennt und sich als Tagesmutter selbstständig gemacht. Bisher waren wir immer zu beschäftigt gewesen, um uns zu verabreden.
Ich winkte Adrian zu. Der Gastwirt des Pubs Cross Keys auf der anderen Seite des Angers lehnte im Türrahmen, rauchte eine Morgenzigarette und unterhielt sich mit ein paar Frühaufstehern, deren Hunde sich im Kreis über das raureifbedeckte Gras jagten.
Mein neuer Arbeitsweg war bezaubernd friedvoll im Vergleich zu der üblichen hektischen Pendelei nach Derby: Nur die im Weißdorn zwitschernden Vögel und das sanfte Plätschern des Flüsschens waren zu hören. Die drei Läden, die mit dem Café zusammen eine Zeile bildeten, waren alle noch geschlossen: Es gab ein Haustierfachgeschäft, einen Geschenkeladen und ein Blumengeschäft. Das handgeschriebene Schild im Schaufenster von Biddy’s Pets brachte mich zum Lächeln: »Trächtiges Kaninchen zu verkaufen – Schnäppchen! Acht (wahrscheinlich) für den Preis von einem!«
Mein Handy gab einen Piepton von sich. Mein Lächeln wurde zu einem breiten Grinsen, als ich sah, dass ich eine SMS von meiner Freundin Verity bekommen hatte:
Viel Glück heute! Und wenn alles andere anbrennt, servierst du ihnen einfach Fischstäbchen-Sandwiches. Küsschen!
Als Verity und ich noch zusammengewohnt hatten, hatten wir unsere Küche kaum betreten. Stattdessen gab es Toast. Toast in rauen Mengen – oder, wenn wir uns mal richtig was gönnen wollten, Veritys Spezialität: Fischstäbchen-Sandwiches. Umso lustiger war es, dass wir nun beide beruflich mit Essen zu tun hatten. Verity, die mit einem Koch zusammenlebte, leitete eine Kochschule – und ich hatte jetzt den Job im Café. Natürlich nur vorübergehend. Veritys Herz dagegen hatte im Grunde schon immer fürs Kochen geschlagen. Sie hatte es bloß eine Weile lang aufgegeben, nachdem ihre beste Freundin Mimi plötzlich und unerwartet gestorben war und ihren Mann Gabe und ihren kleinen Sohn zurückgelassen hatte. Erst als sich die Gelegenheit ergeben hatte, die Leitung der Plumberry School of Comfort Food zu übernehmen, war Veritys Leidenschaft wieder entflammt.
Das Schild an der Tür des Cafés war noch auf »geschlossen« gedreht, aber die Lichter brannten schon. Doreen war so nett, früher zu kommen, um mich einzuarbeiten. Und das ist auch besser so, dachte ich, als ich die Glastür aufschob und das Glöckchen bimmeln hörte: Ich war auf Hilfe angewiesen.
Während Nonna die gefüllten Folienkartoffeln vorbereitete, machten Doreen und ich einen schnellen, verstohlenen Rundgang. Sie zeigte mir alles, was gereinigt und in manchen Fällen sogar ausgetauscht werden musste. Dann stellte sie mich einer wankelmütigen italienischen Kaffeemaschine vor und wies mich an, den Grill zu bedienen und Toast zu machen. Zu meiner eigenen Überraschung hatte ich plötzlich Lampenfieber. Deshalb war ich sehr erleichtert, dass die ersten Gäste, die hereinkamen, meine Schwester Lia und ihr sechs Monate alter Sohn Arlo waren.
»Oh.« Lia blinzelte mich verdutzt an. »Du arbeitest hier?«
»Ehrenamtlich sozusagen«, erklärte ich und tadelte mich stumm dafür, dass ich ihr gestern Abend keine SMS mehr geschickt hatte. Ich war bis nach Mitternacht wach gewesen und hatte an meinem Lebenslauf gefeilt (und mir außerdem YouTube-Videos darüber angesehen, wie man Muster in Cappuccino-Schaum zauberte). Ich nahm ihr Arlo ab und kuschelte mit ihm, während sie in einer Babyflasche Milchpulver mit Wasser mischte.
»Bloß bis ich einen neuen Job gefunden habe.« Ich erzählte ihr, warum ich bei Digital Horizons gekündigt hatte.
»Dich schnappt sicherlich bald jemand weg«, sagte sie und fügte errötend hinzu: »Vom Arbeitsmarkt, meine ich.« Dann begriff sie, dass sie es nicht besser, sondern schlimmer gemacht hatte, und die Röte kroch ihr über den Hals bis zum Dekolleté hinunter. Eilig nahm sie Arlo wieder auf den Arm, um ihn zu füttern. »Und auch sonst …«
»Danke für das Kompliment«, sagte ich trocken. »Falls das eins sein sollte.«
Dass ich offenbar nicht in der Lage war, einen festen Freund zu finden, bot meiner Familie regelmäßig Gesprächsstoff. Sie glaubten alle, ich wäre zu wählerisch. Aber ich gab einfach kurzen, vergnüglichen Flirts den Vorzug, die endeten, ehe das L-Wort ins Gespräch gebracht werden konnte. Meiner Erfahrung nach machte Liebe die Leute verrückt. Ohne, so schien es, war zumindest ich besser dran.
»Wird es nicht schön sein, Tante Rosie öfter zu sehen?«, fragte Lia ihren Sohn und bedeckte sein Gesicht mit Küssen. »Wir schauen fast jeden Tag vorbei. Ich hab ein ganz schlechtes Gewissen, Nonna. Wenn ich gewusst hätte, dass du Hilfe brauchst, wäre ich eingesprungen.«
»Brauche ich keine Hilfe«, murmelte Nonna düster. Sie ließ sich auf einen Stuhl an Lias Tisch sacken.
»Nonna tut mir einen Gefallen«, sagte ich schnell, »damit mir nicht langweilig wird. Und du hast mit Arlo schon genug zu tun.«
Lia sah so aus, als wollte sie protestieren, daher zog ich rasch meinen brandneuen Bestellblock aus meiner Schürzentasche und grinste sie an.
»Darf ich Ihnen Tee und Toast servieren, verehrte Dame?«
»Gerne. Aber nur eine Scheibe Toast«, sagte sie und setzte sich, Arlo auf dem Schoß.
»Fur mich eine Espresso«, sagte Nonna. »Doppelte.«
Ich eilte mit meiner ersten Bestellung davon und hoffte, dass die Kaffeemaschine mir gnädig sein würde.
»Ich habe das Toilettenpapier besorgt, das du haben wolltest, Maria«, sagte Doreen. Sie beugte sich über Arlo und gab ihm einen Kuss auf den Kopf.
Nonna erwiderte unbestimmt: »Bene, grazie!«
Doreen trat neben dem Tisch von einem Fuß auf den anderen. Schließlich räusperte sie sich. »Neun Rollen kosten vier Pfund.«
»Gut, gut.«
Doreen blieb noch einen Moment lang stehen, dann wandte sie sich ab und verschwand leise vor sich hinmurmelnd in der Küche.
Ich trug das Tablett zu Lias Tisch und stellte den Teller mit dem Toast und ein paar Locken Butter vor ihr ab. Lia hob abwehrend die Hände.
»Führ mich bloß nicht mit echter Butter in Versuchung. Ich versuche, ein bisschen Ballast abzuwerfen.« Sie zog den Bauch ein. »Ich esse besser nur eine halbe Scheibe.«
Ihr Schwangerschaftsgewicht hatte sich hartnäckig gehalten, aber Arlo war ja auch immer noch klein. Und es mochte vielleicht stimmen, dass sie an manchen Stellen ein wenig runder geworden war, aber ich fand sie hübscher denn je.
»Dumme Zeug!« Nonna wedelte mit ihrem Lappen in Lias Richtung. »Isste du fur swei.«
»Das tue ich«, bestätigte Lia. »Immer noch. Das ist ja das Problem! Arlo isst jetzt schon seit einer ganzen Weile allein.«
Meine Schwester war schön. Sie hatte feine goldene Locken, weiche rosige Wangen und ein sonniges Wesen – sie zog Menschen an wie eine Sonnenblume die Hummeln. In vielerlei Hinsicht war ich ihr Gegenteil. Ich hatte schwarzes Haar, das ich zu einem praktischen, kantigen Bob geschnitten trug, ein hitziges Temperament und eine scharfe Zunge. Lia ließ sich gern treiben, sie mochte es, wenn das Leben einfach war. Ich dagegen glich einem Lachs in der Laichsaison: Ich war entschlossen, flussaufwärts zu schwimmen, und wenn es mich umbrachte. Mums braune Augen hatten wir beide geerbt, wir teilten eine tief verwurzelte Leidenschaft für Tom Hiddleston und für Eiscreme in jeder Geschmacksrichtung, und abgesehen von Verity, die ich nur noch selten sah, war meine Schwester ohne Frage meine beste Freundin.
Arlo machte ein schmatzendes Geräusch, das ungeheuer zufrieden klang. Bei seinem Anblick schmolz ich dahin: Er hatte die winzigen Finger der einen Hand in den eigenen Locken vergraben, mit der anderen Hand hielt er sein Fläschchen in Position. Ich war vielleicht voreingenommen, aber in meinen Augen war mein Neffe der bezauberndste kleine Kerl auf der ganzen Welt.
»Erinnere ich mich an eure Mamma, wenn sie iste noch so klein.« Nonnas runzeliges Gesicht wurde weich. »Bevor alle die Widerworte. Gluckliche Zeiten.«
»Es muss schwer für dich gewesen sein, Nonno so früh zu verlieren und ganz allein ein Kind großziehen zu müssen«, sagte ich und streichelte Arlos seidige Wange mit einem Finger.
Nonna griff nach einem Teelöffel und rührte ihren Espresso so heftig damit um, dass dieser auf die Untertasse schwappte. »Lange her«, sagte sie knapp.
»Ich hätte allen Ernstes den Verstand verloren, wenn ich in den ersten Wochen Ed nicht gehabt hätte. Hätte er mir nicht Tee gebracht, während ich Arlo nachts dauernd füttern musste …« Lia biss in ihren Toast und schloss die Augen. »Oh, himmlisch.«
Arlo schob die Flasche von sich und versuchte, sich aufzusetzen. Lia stopfte sich hastig den Rest ihres Toastes in den Mund.
»Hetz dich nicht, ich nehme ihn!« Ich legte mir den kleinen Jungen über die Schulter, schmiegte mein Gesicht in seine Halsbeuge und atmete seinen süßen Geruch nach Milch und Baby tief ein.
»Sieh mal einer an.« Lia klopfte Krümel von ihrem Pullover. »Du bist ja ein Naturtalent!«
»In Sachen Tante vielleicht.« Ich setzte ein gezwungenes Lächeln auf. Früher war ich fest davon ausgegangen, dass ich eines Tages Kinder haben würde, aber mittlerweile war ich mir da gar nicht mehr so sicher. Die letzten zehn Jahre hatte ich mich ganz meinem Beruf gewidmet, und jetzt war ich wohl mit meiner Karriere verheiratet. Und eine Scheidung war nicht in Sicht.
Ich klopfte Arlo sanft auf den Rücken. Er rülpste ein paarmal leise, und wir jubelten alle, was er als Aufforderung sah, noch einen draufzusetzen und mir prompt über den Rücken zu speien.
»Danke, Kumpel.« Ich gab Arlo an Lia weiter, damit sie ihn abputzen konnte. Nonna hielt mir ihr Tuch hin.
Lia lachte über meine gerümpfte Nase. »Willkommen in meinem Leben, Rosie«, sagte sie, während ich mich aus meinem Cardigan schälte und den größten Teil der milchig-schleimigen Masse mit dem Lappen abrieb. »Das ist genau das, was ich meine, Nonna. Wie bist du bloß ohne Unterstützung zurechtgekommen?«
»Habbe ich geliebt eure Mamma mit die ganze Herz. Habbe ich gesorgt fur uns beide, dass wir ware sicher unde warm unde satt. Das iste alles.« Sie zuckte mit den Schultern. »Und sobald habbe ich genug Geld, fange ich an neue Lebe in Engeland.«
Ich rollte den Cardigan und das dreckige Tuch zusammen und umarmte Nonna. »Ich bewundere dich. Du warst so tapfer.«
Das Glöckchen über der Tür bimmelte. Ein stämmiger junger Mann mit einem Gesicht, so weich wie das eines Kindes, und riesigen Füßen kam herein.
»Morgen, Tyson!«, rief Nonna. »Eine Ei heute oder lieber swei?«
»Lieber zwei, Mrs. Carloni.« Er rieb sich die Hände und suchte sich dann einen Tisch in einer der Ecken aus. »Wird ein anstrengender Tag in der Gärtnerei … Ich schleppe die ganzen großen Terrakottatöpfe zum Eingang. Der Frühling kündigt sich an!«
»Swei Eier, komme sofort. Okeh, Rosanna, jetzt biste du an die Reihe, tapfer zu sein, no?« Nonnas Augen funkelten mich an. Ich strich meine neue schwarze Schürze glatt.
»Kannste du mache Spiegeleier Over Easy?«
»Ich?« Ich lachte und eilte zum Grill hinüber. »Nichts leichter als das.«
Das waren doch die, die man wenden musste, oder? Oder hießen die Sunnyside Up?
»Haste du Spaß?«, fragte Nonna später, als ich eine kurze Pause machte und einen Kaffee an einem der leeren Tische trank. »Iste besser hier als in schicke Büro, eh?«
»Der Job ist schwieriger, als ich dachte«, gab ich zu. »Gleichzeitig die Bestellungen abzuarbeiten und alles am Laufen zu halten ist gar nicht ohne.«
»Als ich die Café habbe ubernomme, in die Anfang ich bin alleine. Keine Bedienung, nix.« Sie schüttelte den Kopf, versunken in der Erinnerung. »Das iste schwierig.«
Das Glöckchen läutete. Nonna schnappte nach Luft und wandte sich rasch von der Tür ab.
»Oh no, der schonne wieder«, zischelte sie und fuhr sich mit den Händen übers Haar.
Ich warf einen Blick zur Tür hinüber. Dort hielt ein rundlicher älterer Gentleman gerade einem anderen Gast die Tür auf. Er hatte einen weißen Bart und eine Halbglatze, war etwa so alt wie Nonna und trug eine Zeitung unter dem Arm und eine Nelke im Knopfloch seines Blazers.
»Wer ist das?«, fragte ich.
»Stanley Pigeon.« Nonna kniff sich in die Wangen, um Farbe hineinzubringen. Dann holte sie einen uralten Lippenstift aus ihrer Schürzentasche und machte sich daran, ihn auf ihre gespitzten Lippen aufzutragen. »Iste eine Quälegeist.«
Ich blinzelte. Ich hatte sie noch nie im Leben Make-up tragen sehen.
Aber der Name Stanley Pigeon sagte mir etwas.
»Der Postbote?«
»Er inne Ruhestand«, erwiderte sie. »Obwohl manchmal er helfe aus, wenn neue Junge findete nichte alle Häuser.«
Ich schüttelte den Kopf und versuchte, mein Lächeln zu verbergen. Der »neue Junge« war in Dads Alter. Er war heute schon hier gewesen und hatte sich einen Tee zum Mitnehmen und ein Pflaster für seinen Finger geholt, den er sich beim Kampf mit einem besonders gemeinen Briefkasten verletzt hatte.
»Und warum ist Mr. Pigeon ein Quälgeist?«
Früher hatte ich Stanley Pigeon jeden Tag auf dem Schulweg getroffen. In einer Jackentasche hatte er immer Karamellbonbons gehabt, in der anderen Hundekuchen. Er hatte mir erklärt, dass man sich mittels Bestechung aus beinahe jeder brenzligen Lage befreien könne.
»Fragte immerzu, wann ich gehe mit ihm aus. Verruckte, alte Narr.« Sie stieß einen dramatischen Seufzer aus und warf dann einen verstohlenen Blick über die Schulter. »Guckte er?«
Über Nonnas Ehemann, meinen Großvater Lorenzo, wussten wir fast nichts – bloß, dass er bei einem Arbeitsunfall in Neapel umgekommen und dass er Nonnas große Liebe gewesen war. Sie hatte nicht wieder geheiratet. Soweit ich wusste, hatte sie nicht einmal flüchtige Affären gehabt. Obwohl Großvaters Tod nun schon über fünfzig Jahre zurücklag, hatte sie nie auch nur den Anflug von Interesse für einen anderen Mann gezeigt.
»Ich glaube schon. Soll ich hingehen und ihn fragen, was er haben möchte?« Ich beobachtete, wie Stanley sich in einen der durchgesessenen Sessel am Fenster setzte. »Dann musst du nicht mit ihm reden.«
»No, no, haste du genug zu tun.« Sie bleckte die Zähne. »Habbe ich Lippestift auf die Zähne?«
Ich schüttelte den Kopf und sah ihr nach. Sie stolzierte zu ihm hinüber, eine Hand in die Hüfte gestützt, ihr breites Hinterteil schwang von links nach rechts. Stanley erhob sich steif, küsste Nonna die Hand und überreichte ihr seine Nelke. Ich konnte nicht verstehen, was er zu ihr sagte, aber sie gluckste, steckte sich die Blume hinters Ohr und nahm ihm gegenüber Platz. Als sie die Beine übereinanderschlug, zog sie ihren Rocksaum ein kleines Stück weiter nach oben. Ich konnte es nicht fassen.
Doreen kam mit einem Blech frischer Scones aus der Küche und folgte meinem Blick.
»Da ist noch mal Frühling geworden.« Sie schmunzelte. »Wie man sieht, ist es nie zu spät, sich zu verlieben.«
»Ganz offensichtlich. Bleibt er eine Weile?«, fragte ich. Ich war schon dabei, einen Plan auszuhecken.
Doreen lachte. »Stanley gehört morgens zum Inventar. Normalerweise frühstückt er und trinkt dann eine Kanne Tee.«
»Wunderbar«, sagte ich triumphierend. Ich stülpte mir ein Paar Gummihandschuhe über und griff nach dem Allzweckreiniger. »Solange Nonna beschäftigt ist, werde ich mich rasch der Toiletten annehmen.«
Ich fing in der Damentoilette an und schrubbte alles einmal kräftig durch. Allerdings gab es hier mehr zu tun. Mir schwebte eine Runderneuerung vor: Die Kacheln mussten neu verfugt werden, einer der Wasserhähne tropfte, und das Linoleum auf dem Boden war eingerissen. Doreen hatte recht, das alles konnte Nonna nicht alleine stemmen. Wenn sie bloß zugeben würde, dass sie Hilfe brauchte! Das würde alles einfacher machen.
In der Herrentoilette achtete ich darauf, nicht zu tief einzuatmen, und ging mit dem Allzweckreiniger bewehrt vor der Kloschüssel in die Hocke. Noch immer wälzte ich mein Dilemma im Kopf: Wie konnte ich Nonna nahebringen, dass das Café einer gründlichen Renovierung bedurfte, ohne sie zu beleidigen?
»Dir ist wahrhaftig eine große Ehre zuteilgeworden: im Café deiner Großmutter arbeiten zu dürfen!«
Ich zog meinen Arm aus dem Klo und wandte mich um. Meine Mutter lehnte im Türrahmen, ein amüsiertes Lächeln auf den Lippen. Der Duft ihres Parfüms war eine Wohltat für meine Nase. Ich lächelte zurück.
»Richtig. Ehre. Das war das Wort, nach dem ich gesucht habe.« Ich verlagerte mein Gewicht auf die Fersen und versuchte, mir mit der Armbeuge – dem einzigen sauberen Abschnitt meines Arms – über die Stirn zu fahren. »Es beschreibt meine Position hier perfekt. Klofrau. Für lau!«
»Du bist weiter vorgedrungen, als ich es je geschafft habe.« Sie lachte. Ihre braunen Augen funkelten. »Ich hab lediglich vorgeschlagen, Panini in die Karte aufzunehmen, und schon war ich draußen.«
»Ist gemerkt«, sagte ich grinsend. »Keine Kritik an der Karte.«
»Doreen hat mich hergeschickt, um dir zu sagen, dass Stanley bald aufbrechen wird.« Sie schnipste unsichtbare Flusen von ihrer eleganten Bluse, rückte ihren Rock zurecht und strich sich glättend über die Haare, die noch immer so dicht und dunkel wie meine waren, wenn auch durchsetzt mit Silberfäden. Ich fand es toll, dass sie sich die Haare nicht färbte. Sie hatte es nicht nötig: Sie sah fantastisch aus.
Im Gegensatz zu mir, vermutete ich. Zumindest im Augenblick.
»Oh, Mist.« Ich rappelte mich auf. »Ich seh besser zu, dass ich wieder in die Küche komme, ehe Nonna noch merkt, was ich hier mache!«
»Das mag dir wie eine blöde Frage vorkommen – aber was genau ist das denn?« Mum zog die Nase kraus. Ich war nicht sicher, ob sie ihrer Verwirrung Ausdruck verleihen wollte oder endlich doch auf den Geruch in der Herrentoilette reagierte.
»Psst! Triff mich am Tresen«, sagte ich und konnte mich gerade noch bremsen, einen gummihandschuhverhüllten, allzweckreinigerbeschmierten Finger vor meine Lippen zu legen, »dann erzähle ich dir alles.«
»Sie ist fünfundsiebzig«, raunte ich, sobald ich meine Hände und Unterarme geschrubbt, Mum richtig umarmt und uns beiden ein Glas Mineralwasser geholt hatte. »Sie erlaubt Juliet und Doreen nicht, auch nur einen Handschlag mehr zu tun, aber die Arbeit wird ihr zu viel. Ich versuche, ihr zu helfen, ohne dass sie es merkt, bloß wird das nicht reichen. Wann wird sie endlich zugeben, dass es an der Zeit für sie ist, ihre Schürze an den Nagel zu hängen?«
»Süße, diese Frage stelle ich mir schon seit Jahren«, erwiderte Mum müde, »und ich habe immer noch keine Antwort darauf gefunden. Ich liebe deine Nonna, aber sie ist ein Buch mit sieben Siegeln für mich. Sie öffnet sich niemandem. Aber ich weiß, dass das Café ihr alles bedeutet. Ich glaube, sie kann sich gar nicht vorstellen, anders zu leben.«
Ich nickte nachdenklich. »Vielleicht wäre das die Lösung? Ihr zu zeigen, was das Leben sonst noch bereithält?«
»Es ist lieb von dir, dass du aushelfen willst«, sagte Mum und schnitt ihr Das-wird-alles-noch-in-Tränen-enden-Gesicht, das ich noch von früher kannte. So hatte sie Lia und mich immer angesehen, wenn wir uns zusammen etwas gekauft und geschworen hatten, dass wir es gerecht teilen würden. »Aber deine Großmutter wird es dir nicht danken. Ich muss es wissen«, fügte sie mit einem leisen Schniefen hinzu.
Ich warf ihr einen Seitenblick zu. Unsere Vorgehensweise unterschied sich darin, dass ich nicht vorhatte, Nonna zu sagen, wie sie ihr eigenes Café zu führen hatte. Ich würde ihr lediglich unauffällig zur Hand gehen, ohne dass sie es merkte. Das sollte kein Vorwurf an Mum sein – es war einfach so, dass Nonna und sie beide starke Frauen waren, die es nicht leiden konnten zurückzustecken.
»Mal was anderes, Mum«, sagte ich, weil ich den Eindruck hatte, dass es höchste Zeit war, das Thema zu wechseln. »Fühlst du dich wohl im Gemeindevorstand?«
»Bis jetzt habe ich ja erst an einem Treffen teilgenommen«, erzählte sie fröhlich. Die wichtige Rolle, die sie in ihren vielen Ausschüssen spielte, war ihr liebster Gesprächsgegenstand. »Unter uns gesagt – es ist eine gute Sache, dass ich beigetreten bin. Die wissen da nicht mal, wie man einen ordentlichen Bericht schreibt!«
Ich ließ sie weiterreden, während ich ein gegrilltes Sandwich mit Käse und Tomate, zwei Kannen Tee und einen Latte macchiato zubereitete.
»… aber ich habe gesagt: ›Da können wir das Treffen nicht abhalten, an dem Tag findet die Hauptversammlung des Heimatpflegevereins statt.‹ Du hättest mal hören sollen …«
Just in diesem Moment brachen Nonna und Stanley in Gelächter aus, und Nonna klapste ihm spielerisch auf den Arm, während sie ihn zur Tür geleitete.
Mum blieb der Mund offen stehen. »Flirtet sie etwa mit ihm?«
»Und wie!« Ich kicherte. »Aber ist das nicht großartig? Mir scheint, eine Romanze bahnt sich an!«
»Ich bezweifle es.« Mum nahm einen Schluck von ihrem Wasser. »Sie macht das manchmal: Ein Mann zeigt Interesse an ihr, und sie spielt das Spielchen eine Weile mit, bevor sie ihm eine Abfuhr erteilt.«
»Ein Jammer.« Ich beobachtete die beiden dabei, wie sie sich durch die Glastür hindurch zuwinkten. »Ein Freund könnte genau das sein, was sie bräuchte, um mal auf andere Gedanken zu kommen. Vielleicht merkt sie dann, dass Arbeit nicht alles ist.«
Mum zog die Augenbrauen hoch und räusperte sich vielsagend. Im Stillen verbot ich mir streng, rot zu werden.
»Da fällt mir ein …« Ich holte mein Handy aus der Schürzentasche, rief meine Mails auf und sah die Betreffzeilen durch. »Ich muss unbedingt meinen Personalberater anrufen und ihn fragen, ob er eine Stelle für mich gefunden hat. Nicht dass ich noch wie Nonna fünfzig Jahre hier verbringe!«
Kapitel 3
»Wir brauchen noch zwei Gabeln und einen Löffel, Alec!«, sagte Mum. Dabei wedelte sie mit einer Hand vor ihrem Gesicht herum.
»Hast du noch Gabeln, Rosie?«, fragte Dad, während er die Geschirrschublade durchsuchte. Seine Stimme drang gedämpft durch das Geschirrtuch, das er sich vor die Nase presste. »Hier sind bloß fünf drin.«
»Guck mal in der Abwaschschale«, sagte ich, »ganz unten.« Ich stand im Eingangsbereich des Cottages und schwang immer wieder die Tür auf und zu, in der Hoffnung, dass diese Maßnahme den Feuermelder beruhigen und den dicksten Qualm vertreiben würde.
Ich hatte meine Familie zum Mittagessen eingeladen. Das war ein Novum, denn normalerweise verbrachte ich die Wochenenden damit, Projektberichte zu lesen, für die ich unter der Woche keine Zeit gehabt hatte, oder ich saß wie festgeschweißt vor meinem Tablet und beantwortete Tweets im Namen von Kunden. Wenn ich hungrig wurde, aß ich schnell eine Kleinigkeit, dann arbeitete ich weiter. Aber da ich nun keinen richtigen Job mehr hatte, hatte ich beschlossen, ausnahmsweise einmal richtig zu kochen.
Ehrlich gesagt verfolgte ich damit gleich zwei Hintergedanken. Zum einen war ich nach ein paar Tagen im Café erschrocken, wie ungeschickt ich mich in der Küche anstellte – ich musste dringend üben –, und zum anderen konnte ich das Gespräch beim Essen vielleicht unauffällig auf Nonnas Pläne für das Café lenken.
Ehrgeizig gedacht, das musste ich zugeben.
Dad schob seinen Hemdsärmel hoch und tauchte seine Hand in meine Abwaschschale, die mit einer trüben Brühe gefüllt war. »Bäh!«, sagte er und zuckte sogar ein bisschen zusammen.
»Tut mir leid!«, sagte ich, aber lachen musste ich trotzdem.
Mein Vater war Dozent der Philosophie an der Universität in Derby. Seine Uniform, die aus einem Tweedjackett, Kordhosen und karierten Hemden bestand, legte er nicht einmal am Wochenende ab. Sogar im Haus behielt er sein Jackett an. Er war blond, hatte sehr helle Haut und Sommersprossen. Zwischen uns anderen war er im Urlaub immer aufgefallen, weil wir schon braun wurden, wenn wir bloß einen Sonnenstrahl abbekamen.
»Hab sie!« Er schwenkte stolz das tropfende Besteck durch die Luft und sah mich fragend und durch den Rauch hindurch blinzelnd an. Ich zeigte auf sein Geschirrtuch.
Während er das Besteck abtrocknete, fragte er: »Was macht der Schweinebraten?«
Ich warf einen Blick auf den schwarzen Klumpen, der im Bräter lag und noch immer vor sich hin schwelte. »Ist gut durch.«
Ich hatte gedacht, dass mein Schweinebraten schön knusprig werden würde, wenn ich ihm ein paar Minuten richtig einheizte. Leider war ich vom Kartoffelbrei abgelenkt worden, den ich unbedingt so cremig hinbekommen wollte wie Nonna, und hatte den Braten vergessen. Daher glich er nun einem Kohlestück und über dem Esstisch hing eine dichte graue Rauchwolke.
Lia und mein Schwager Ed waren mit Arlo in den Garten geflohen, Nonna attackierte die Klumpen im Kartoffelbrei mit dem Ende eines Holzlöffels, und Mum gab ihr Bestes, Platz für sechs Erwachsene und einen Kinderstuhl an meinem kleinen Esstisch zu finden. Und Dad befolgte wie üblich Mums Anweisungen.
Das Erdgeschoss meines Cottages bestand aus einem einzigen Zimmer: Die eine Hälfte nahm die Küche ein, die andere das Wohnzimmer. Mein Esstisch stand in der Mitte. In die dicke Steinmauer des Wohnzimmers war der kleine Holzofen eingelassen. Eine Treppe führte nach oben, wo sich mein Schlafzimmer und ein kleines Bad befanden. Ich fühlte mich in meinem winzigen, aber wunderschönen Cottage nie eingeengt, dafür sorgte schon allein die Aussicht. Durch das Fenster an meinem Bett konnte ich weit über das Dorf und die Hügel dahinter blicken.
»Bitte schau mal, ob du irgendwo Servietten findest, Alec, ja?« Mum quetschte die Sauciere zwischen das Apfelmus und die gebutterten Karotten.
»Na klar.« Dad kramte noch ein bisschen in den Schubladen. Er fand einen kleinen Stapel Papierservietten mit Adventssternen, die noch von Weihnachten übrig waren, machte eine Runde um den Esstisch und legte auf jeden Teller eine Serviette.
Lia kam aus dem Garten herein. »Ich zerlege das Fleisch!« Auch sie versuchte, den Rauch mit einer Hand zu verscheuchen. »Ich hab in letzter Zeit viele Kochshows gesehen. Wusstet ihr, dass man mehr als fünftausend Pfund für ein japanisches Messer aus weißem Papierstahl ausgeben kann?«
Nonna schnalzte missbilligend mit der Zunge. »Schwacheköpfe«, murmelte sie. »Habbe sie mehr Geld als Hirn, manche Leute.«
Ich hielt Lia mein Tranchiermesser hin, als wäre es ein kostbares Schwert. »Guck mal, wie du mit diesem Kleinod zurechtkommst.«
»Ist es japanisch?« Lia betrachtete mein Supermarktmesser mit dem Plastikgriff, das nicht besonders stabil aussah, und rümpfte die Nase. Es war noch ganz neu; ich hatte es zu diesem Anlass gekauft.
»Nah dran«, sagte ich. »Made in China.«
»Wird ein ziemliches Gedränge«, sagte Mum und trat einen Schritt zurück, um den gedeckten Tisch besser begutachten zu können. »Aber so geht’s.«
»Ich hab nichts dagegen, dicht neben dir zu sitzen, Luisa«, sagte Dad und versuchte, Mum auf die Wange zu küssen.
Sie wehrte ihn ab. »Nicht jetzt, Alec! Geh lieber und hol die beiden Stühle aus dem Auto.«
Dad drückte ihre Hände gegen seine Brust, holte tief Atem und schmetterte die ersten Zeilen des alten Bryan-Adams-Songs aus dem Film Robin Hood, der vor Jahren im Kino gelaufen war: »Everything I do, I do it for you!«
Ich beeilte mich, die gebackenen Kartoffeln aus dem Ofen zu holen, um ihnen das Schicksal des Schweinebratens zu ersparen. Außerdem war das eine gute Gelegenheit, mein Grinsen zu verbergen. Dad sang leidenschaftlich gern, aber nicht besonders gut. Normalerweise erlaubte Mum ihm bloß loszulegen, wenn er im hintersten Winkel des Gartens arbeitete.
Auch jetzt hielt sie ihm den Mund zu. »Du bist ein Mann mit vielen Talenten, Alec, aber fürs Singen hast du keins. Was ist jetzt mit den Stühlen?«
Mir wurde das Herz schwer, als ich sah, wie er sich davonschlich. Mein Vater freute sich an kleinen Dingen: Er war Fan des Derby-Country-Fußballvereins, von Schweinefleischpasteten und von Dolly Parton. Aber keine dieser Leidenschaften ließ sich mit der bedingungslosen Hingabe vergleichen, die er seiner Frau entgegenbrachte. Nur schien Mum immer zu beschäftigt zu sein, um Zeit mit ihm zu verbringen – sie liebte ihn, ja, aber mir kam es so vor, als hätte sie ihn dauerhaft in die untere Hälfte ihrer To-do-Liste verbannt.
»Kann man bedenkenlos wieder reinkommen?«, fragte Ed von der Tür aus.
»Das Mittagessen ist fertig, man kann schon wieder ganz gut durch den Rauch gucken, und Dad hat aufgehört zu singen«, sagte ich. »Also ja – du hast genau den richtigen Moment abgepasst!«
Ed schwang Arlo durch die Luft, sehr zu dessen Begeisterung. Mum streckte die Arme aus, um ihm ihren Enkel abzunehmen, und Ed rieb sich mit einem breiten Grinsen die Hände. »Dann schenke ich mal aus.« Er füllte die Weingläser und reichte mir eins. »Für dich, liebste Schwägerin.«
Ich lächelte und nahm einen Schluck. Ich mochte Ed. Er war ein sanfter Mann mit großen Muskeln, kurz geschorenem, dunklem Haar und Grübchen in den Wangen. Er arbeitete hart für das Fuhrunternehmen seines Vaters und half Lia ganz selbstverständlich mit Arlo. Lia kann sich wirklich glücklich schätzen, dachte ich.
»Familie, zu Tisch!«, rief ich und zog für Nonna einen Stuhl zurück. »Lasst uns essen.«
Das Mittagessen war nicht direkt ein Riesenerfolg, aber alles war essbar, und es war genug da. Auch ohne Lias Hilfe verputzten wir die Zabaione ganz, und der letzte Gang bestand aus Kaffee und Trüffeln aus dunkler Schokolade.
»Wie macht Rosie sich im Café, Nonna?« Lia gab Arlo ein Stück weich gekochter Karotte, die er sich prompt ins Gesicht schmierte. Dann zeigte er hoffnungsvoll (und vergeblich) auf die Schokolade. »Bist du zufrieden mit ihr?«
»Machte sie noch nichte viel«, sagte Nonna. Sie sprach über mich, als säße ich nicht mit am Tisch. »Bringe ich sie um ganze vorsichtig.«
»Ich glaube, du meinst, du bringst ihr etwas bei, Mamma«, korrigierte Mum sie.
»Sì, sì.« Nonna schnaufte. »Iste sie okeh.«
Lia und ich grinsten uns an: Aus dem Mund unserer Großmutter war das ein hohes Lob.
Tatsächlich hatte Nonna den Nagel auf den Kopf getroffen: Die Arbeit im Café brachte mich tatsächlich um. Alles tat mir weh, und meine Fingernägel waren völlig ruiniert. Denn sobald Nonna mir den Rücken kehrte, scheuerte, schrubbte und putzte ich wie eine Verrückte. Am Freitag hatte sie einen Termin beim Arzt gehabt und es mir überlassen, das Café zu schließen. Juliet und ich hatten die Gelegenheit genutzt und den großen Ofen auseinandergenommen, um jedes Einzelteil sauber machen zu können. Zwei Stunden lang hatten wir gegen den Ruß und die Ablagerungen vieler Jahre gekämpft. So hart hatte ich mein ganzes Leben noch nicht gearbeitet.
»Ich glaube, ich stelle mich ganz gut an«, sagte ich nun. »Wenn man bedenkt, dass ich noch nie etwas Ähnliches gemacht habe.«
»Was du anpackst, gelingt, mein Mädchen«, sagte Dad warmherzig und löffelte Zucker in seinen Kaffee. »Das war schon immer so.«
»Das stimmt.« Mum hob ihre Kaffeetasse. »Auf Rosie, die ihren Prinzipien treu geblieben ist! Ich bin stolz auf dich, Süße.«
Nonna trank ihren Wein aus. »Du bist eine brave Kinde, Rosie. Machste deine Sache gut. Sagste mir nicht, wie ich habbe su fuhre die Café, und wir bleibe Freunde, eh?«
»Ach, Mamma.« Mum runzelte die Stirn. »Wann siehst du endlich ein, dass du in deinem Alter …«
»Dio mio!« Nonna schlug ärgerlich mit der Hand auf den Tisch. »Wann siehste du ein, dass meine Geschäft iste meine Geschäft? Steckste du deine Nase nichte rein.«
Mum und Nonna starrten einander finster an. Alle waren still bis auf Dad, der auf einem übrig gebliebenen Stück Kruste herumkaute. Schließlich schluckte er es herunter und trank etwas Wein hinterher. »Was für ein zähes Schwein«, sagte er und schüttelte den Kopf.
Ed machte ein Geräusch, das ein Husten oder ein unterdrücktes Auflachen hätte sein können. Ich wagte keinen Blick in seine Richtung.
»Es wäre schön, wenn ich auch im Café mithelfen könnte«, sagte Lia sehnsuchtsvoll. »Wo ich doch so gern koche.«
Ed schlang einen Arm um sie und gab ihr einen Kuss auf den Kopf. »Aber du genießt deinen Mutterschaftsurlaub doch, oder? Bloß Arlo und du! Du bist schneller wieder im Freizeitzentrum, als dir lieb ist. Warum solltest du eher als nötig wieder mit dem Arbeiten anfangen?«
Lia war Schwimmlehrerin in dem viel besuchten Freizeitzentrum direkt vor den Toren Derbys. In der Schwangerschaft hatte sie ihre Arbeitswoche auf drei Tage reduziert. Dann war Arlo auf die Welt gekommen, und Lia hatte nie darüber gesprochen, dass sie das Unterrichten vermisste. Ich hatte es für möglich gehalten, dass sie einfach zu Hause bleiben würde.
Sie seufzte. »Natürlich ist es toll, dass ich Arlo noch ein Weilchen ganz für mich habe. Aber ich fühle mich … Ach, ich weiß nicht. Ist ja auch egal!«
Sie stieß ihren Stuhl zurück und lief so schnell die Treppe hinauf, dass ich fast nicht gesehen hätte, wie heftig ihre Unterlippe zitterte.
Für einen Moment sagte niemand etwas.
Dann sprang ich auf. »Ich sehe nach ihr!«
Lia saß vor dem Fenster auf dem Bett und fummelte an einer Zeitschrift herum, die auf meinem Nachttisch lag. In ihren Augen standen Tränen.
»Was ist denn los?«, fragte ich.
»Nichts ist. Oder alles. Das hier«, sagte sie, packte eine Handvoll Bauchspeck und brachte ihn in ihrer Hand zum Wabbeln.
»Sei nicht blöd!« Ich gab ihr einen leichten Schubs. »Du hast gerade erst ein Baby gekriegt!«
»Ich meine es ernst«, sagte sie. »Ich finde es schrecklich, so auszusehen. Wenn ich den Fernseher anmache oder eine Zeitschrift aufschlage, sehe ich jedes Mal irgendeine Schauspielerin, die ein sechs Wochen altes Baby im Arm hält und Größe 36 trägt. Und die erzählt dann lang und breit, wie doll sie auf ihre Figur achten musste. Ich hasse das! Mir passt gar nichts mehr. Ich kann mir schöne Kleider bloß noch angucken – für mich bleiben Leggins und weite Pullis. Ich würde alles dafür geben, wenn ich so schlank wäre wie du!«
»Bist du verrückt?«, fragte ich erschüttert. »Du bist wunderschön. Deine Kurven hast du dir verdient: Dein Körper sieht so aus, weil er ein Wunder hervorgebracht hat! Du hast ziemliches Glück, weißt du?«
Lia sah mich mit großen Augen an. »Das ist eine schöne Sichtweise der Dinge. Danke, Rosie.«
»Gern geschehen.« Ich war vielleicht die Schwester mit der Karriere, aber Lia hatte eine Familie. Sie liebte Ed, und er liebte sie. In meinen Augen war das unbezahlbar.
»Es ist bloß so, dass …« Sie sah mich nicht an. »Lach mich bitte nicht aus.«
Ich streichelte ihren Rücken. »Werde ich nicht.«
Sie senkte die Stimme. »Ich fühle mich wie eine Versagerin, weil ich so außer Form bin. Eine fette Versagerin mit einem abstoßenden Körper.«
»Das darfst du nicht mal denken, Lia!«, sagte ich scharf. »Sonst haben die gewonnen. Lass dir nicht von den Medien vorschreiben, wie du auszusehen, was du zu wiegen oder wie du dich zu benehmen hast. Das ist genau der Grund, warum ich bei Digital Horizons aufgehört habe! Himmel, wir leben im einundzwanzigsten Jahrhundert, und immer noch werden Frauen manipuliert und zu Objekten degradiert und dazu gedrängt, gegen ihren Willen ihren eigenen Körper zu verändern!«
»Schon gut.« Lia war ein Stück vor mir zurückgewichen, als hätte ich sie geschlagen. »Ich hab’s verstanden.«
»Entschuldige.« Ich holte tief Atem, um mich zu beruhigen. »Aber das macht mich so wütend … Egal, was noch? Ich hab dich gefragt, was los ist, und du hast gesagt: ›Alles.‹«
Sie stand auf, stützte sich mit den Händen aufs Fensterbrett und blickte in die Ferne.