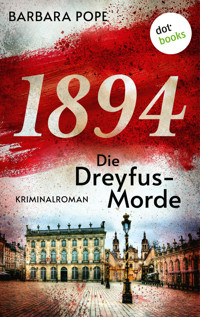Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Bernhard Martin ermittelt
- Sprache: Deutsch
Eine tödliche Sünde ... Der historische Kriminalroman »1885 – Die Cézanne-Affäre« von Barbara Pope jetzt als eBook bei dotbooks. Aix-en-Provence, 1885: Die Sonne brennt heiß auf die französische Provinzstadt herab, doch dem Untersuchungsrichter Bernard Martin läuft es kalt den Rücken hinunter: Im abgelegenen Steinbruch wird die Leiche einer jungen Frau aufgefunden, das lange Haar so rot wie das Blut, in dem sie liegt. Wieso musste Solange Vernet sterben? Fasziniert taucht Bernard in das Leben der exzentrischen Fremden ein. Schon bald geraten zwei Männer in sein Visier: der undurchsichtige Professor Westerbury, Solanges Liebhaber, dessen Charme jede Frau zu verfallen scheint – und der Künstler Paul Cézanne, der ebenfalls eine Affäre mit der Toten gehabt haben soll. Als im Steinbruch eines seiner Gemälde gefunden wird, das eine Frau zeigt, die große Ähnlichkeit mit Solange hat, verhärtet sich Bernards Verdacht … aber ist wirklich alles so, wie es scheint? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der fesselnde Provence-Krimi »1885 – Die Cézanne-Affäre« von Barbara Pope wird alle Fans von Niclas Natt och Dag und Pierre Lagrange begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 576
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Aix-en-Provence, 1885: Die Sonne brennt heiß auf die französische Provinzstadt herab, doch dem Untersuchungsrichter Bernard Martin läuft es kalt den Rücken hinunter: Im abgelegenen Steinbruch wird die Leiche einer jungen Frau aufgefunden, das lange Haar so rot wie das Blut, in dem sie liegt. Wieso musste Solange Vernet sterben? Fasziniert taucht Bernard in das Leben der exzentrischen Fremden ein. Schon bald geraten zwei Männer in sein Visier: der undurchsichtige Professor Westerbury, Solanges Liebhaber, dessen Charme jede Frau zu verfallen scheint – und der Künstler Paul Cézanne, der ebenfalls eine Affäre mit der Toten gehabt haben soll. Als im Steinbruch eines seiner Gemälde gefunden wird, das eine Frau zeigt, die große Ähnlichkeit mit Solange hat, verhärtet sich Bernards Verdacht … aber ist wirklich alles so, wie es scheint?
Über die Autorin:
Barbara Pope wurde 1941 in Cleeveland/Ohio geboren. An der Columbia University promovierte sie in Europäischer Geschichte und unterrichtete viele Jahre an Universitäten in Amerika und Europa, wobei sie sich immer mit Frauen in der Geschichte beschäftigte und für den Feminismus einsetzte. Seit ihrem Ruhestand schreibt Barbara Pope Romane, für die sie in zahlreichen Kritiken gelobt wurde.
Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin ihre historischen Kriminalromane »1885 – Die Cézanne-Affäre« und »1894 – Die Dreyfus-Morde«.
***
eBook-Neuausgabe August 2023
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2008 unter dem Originaltitel »Cézanne’s Quarry« bei Pegasus, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2008 unter dem Titel »Im hellen Licht des Todes « bei List Taschenbuch.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2008 by Barbara Corrado Pope.
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2008, List Taschenbuch, List ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin.
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Bildagentur Zoonar GmbH, artjazz, travelview, Oleg Golovnev, jessicahyde
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ys)
ISBN 978-3-98690-718-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »1885 – Die Cézanne-Affäre« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Barbara Pope
1885 – Die Cézanne-Affäre
Kriminalroman
Aus dem Amerikanischen von Lisa Kuppler
dotbooks.
Zu Beginn des Jahres 1885 unterbrach Cézanne seine einsamen Kontemplationen der Natur wegen der stürmischen Liebesaffäre mit einer Frau, von der nur bekannt ist, dass der Künstler sie in Aix kennenlernte.
JOHN REWALD, Paul Cézanne: A Biography
Dienstag, 18. August
Aix-en-Provence, 1885. Zwanzigtausend Seelen lebten noch in der Provinzstadt. Die ruhmreichen Tage, als der gute König René über einen prächtigen, ritterlichen Hof residierte, lagen schon lange zurück. Aix opferte noch den großen Mirabeau der Revolution von 1789, dann fiel es in einen tiefen Dornröschenschlaf. Als das neunzehnte Jahrhundert seinen Fortgang nahm, wurde es mehr und mehr von dem nur dreißig Kilometer südlich gelegenen Marseille überflügelt. Dort legte man nicht nur eine größere Gelehrsamkeit an den Tag, sondern es siedelten sich bald auch eine größere Anzahl von Einwohnern und wichtigere Industriezweige an. Im Jahr 1885 verblieben Aix einige wenige Fakultäten der Universität, der Gerichtshof (der immer noch den hochtrabenden Namen Palais de Justice trug) und – natürlich – seine hohen Ansprüche.
Kapitel 1
Albert Franc kam wegen der toten Frau im Steinbruch zu ihm, denn sonst gab es niemanden im Palais de Justice, dem der Inspektor den Leichenfund hätte melden können. Der Gerichtshof war während der Sommerpause geschlossen. Für gewöhnlich ereignete sich in den letzten beiden Augustwochen nie etwas Wichtiges, und die Richter waren alle aufs Land gefahren. Die Verwaltung von Recht und Ordnung hatten sie Bernard Martin überlassen, einem jungen Kollegen mit wenig Erfahrung, der keine Familie oder sonstige Beziehungen im Süden Frankreichs besaß.
Martin las gerade in einem Buch, als jemand laut an die Tür seines Dachzimmers hämmerte. Erschrocken markierte er die Seite in Zolas neuem Roman und legte das Buch auf das Regal über seinem Bett. Germinal und Darwins Die Entstehung der Arten schob er nach hinten an die Wand und vergewisserte sich, dass die schwarze, in Leder gebundene Bibel – ein Geschenk seiner Mutter – sie verdeckte. Er wusste nicht genau, wer an der Tür war. Doch in diesen Zeiten, in dieser Stadt, war es ratsam, seine radikalen politischen Ansichten geheim zu halten. Er schob die Briefe von zu Hause auf die eine Seite des Tisches, das trockene Brot und den harten Käse, die Überreste seines einsamen Abendbrots, zur anderen.
»Monsieur Martin. Monsieur le juge!«, rief eine ungeduldige Stimme draußen im Gang.
Mit drei Schritten war Martin bei der Tür und öffnete sie. »Bitte entschuldigen Sie, ich war in ein Buch vertieft –«
»Dem Himmel sei Dank! Sie sind hier.«
Martin war nicht gerade erfreut über den Anblick des schwer atmenden Albert Franc. Der Veteran unter den Inspektoren von Aix war nicht sehr groß, doch er war breit und kräftig gebaut; der Mann war bekannt für seine Härte und für seine manchmal recht freie Auslegung der Strafprozessordnung. Sein massiger Körper füllte den niedrigen Torbogen aus. Martin trat beiseite und deutete auf den hölzernen Stuhl am Tisch.
»Ich danke Ihnen.« Franc ließ sich stöhnend nieder und wedelte sich mit der Mütze Luft zu. »Ein Glas Wasser?«
Der Tonkrug stand auf dem Waschstand neben Martins Kleiderschrank, er füllte ein Glas und reichte es Franc, der das Wasser hinunterstürzte und sich dann sofort wieder Luft zufächelte. Bevor Martin eine Frage stellen konnte, begann der Inspektor noch ganz außer Atem den Grund für sein Kommen zu erklären. »Verzeihen Sie, mein Herr, dass ich Sie störe. Aber ich muss es Ihnen doch melden. Im Steinbruch. Da ist eine tote Frau. Ermordet, würde ich meinen. Der Proc ist nicht in der Stadt«, sagte Franc, wobei er den am Palais de Justice gebräuchlichen Ausdruck für den Staatsanwalt verwendete, »und deshalb brauche ich Sie. Sie müssen mich zum Steinbruch begleiten.«
»Eine tote Frau, hier in Aix?« Martin ließ sich auf dem Bett nieder. »Sind Sie sicher?«
»Gerade war ein Junge mit seinem Vater auf der Wache und hat berichtet, was er gesehen hat. Sie liegt im alten Steinbruch. Er meint, es handelt sich um eine Bürgerliche.«
»Und Sie sind sich sicher, dass uns hier kein Dummejungenstreich gespielt wird? Oder ein Missverständnis vorliegt?«
»Nein, nein. Sie kennen mich doch, Herr, es ist meine Stärke. Das Verhör, meine ich.«
Martin kannte Francs Verhöre wirklich zur Genüge. Häufig erschienen Gefangene des Inspektors vollkommen verängstigt und mit Blutergüssen in seinen Räumen. »Weichklopfen« nannte Franc seine Methoden.
»Ich habe mich etwa eine Stunde mit ihm unterhalten«, fuhr Franc fort. »Er sagt die Wahrheit, davon bin ich überzeugt. Er meint, er hat Blut gesehen. Und er konnte sogar das Kleid beschreiben, das die Frau trug. Weiß, mit grünen Streifen. Von bessrer Qualität als die Kleider seiner Mutter.«
Eine vage Erinnerung ging Martin durch den Kopf, doch er konnte sie nicht einordnen. »Ist es weit bis zum Steinbruch?«
»Nein, Monsieur, er liegt in der Nähe der Bibémusstraße, knapp eine Wegstunde entfernt. Deshalb bin ich ja hier. Ich dachte, wir beide sollten uns aufmachen und so schnell wie möglich einen Blick auf die Leiche werfen. Besonders, wenn man die Hitze und die Cholera und alles bedenkt ...«
Martins Magen zog sich jäh zusammen. Die Untersuchung von Mordopfern war der abscheulichste Teil seiner juristischen Ausbildung gewesen. In der Pariser Leichenhalle hatten die grauen und namenlosen Körper auf kalten Marmortischen gelegen. Den Zustand einer Leiche, die einige Zeit dieser höllischen Hitze ausgesetzt war, mochte sich Martin kaum vorstellen. »Es hat doch noch keine Cholerafälle in Aix gegeben, oder?«
»Nein, Monsieur, aber in Marseille –«
»Ja, ja.« Martin bemühte sich um einen gelassenen Tonfall, als er sich erhob und zum Schrank trat. Was ihn auch in diesem Steinbruch erwartete, er würde sich hüten, Anzeichen von Schwäche zu zeigen, schon gar nicht vor diesem Mann, der dafür bekannt war, dass er nur allzu gerne Gerüchte im Palais verbreitete. »Wie viele von Ihren Männern haben Sie mitgebracht?«
»Die meisten feiern immer noch das Fest der Heiligen Jungfrau, Monsieur.«
Martin wandte sich rasch um. »Aber Mariä Himmelfahrt war doch schon vor drei Tagen.«
Franc zuckte mit den Schultern. »Es sind brave Burschen, und es ist mitten im August.«
Wahrlich brave Burschen! Franc hielt sich gerne im Gefängnis auf bei den Uniformierten, die dort Dienst taten. Gott allein wusste, was er dort trieb. Wahrscheinlich machte er sich lustig über den Standesdünkel von Richtern, so wie Martin einer war. Als er den Gehrock und den Hut hervorholte – die angemessene Bekleidung für derlei offizielle Anlässe –, hob Franc die Hand, offenbar, um ihn davon abzuhalten, den Gehrock überzustreifen.
»Nein, Monsieur, das sollten Sie heute nicht tragen. Zu heiß. Und wer weiß, wie lange wir dort draußen herumklettern müssen.«
»Richtig«, murmelte Martin, »Sie haben recht.« Ein Zylinder bei dieser Hitze – da zeigte sich der richterliche Dünkel. Er griff nach der Jacke und seiner Mütze aus Studententagen und wandte sich zu Franc, der seine Unterkunft kritisch beäugte.
»Verzeihen Sie mir die Frage, Monsieur Martin, aber haben Sie jemanden, der hier nach dem Rechten sieht?«
»Ich beschäftige eine Zugehfrau, sie wohnt draußen auf dem Lande. Doch weil die Familie Picard nicht da ist, kommt sie derzeit nur an einem Tag in der Woche.« Durch Francs Gerüchteküche würden wahrscheinlich bald alle im Palais von Martins bescheidenen Wohnverhältnissen und der Tatsache, dass er eine Dachkammer anmieten musste, erfahren. Der alte Inspektor wusste bestimmt, dass die Amtsrichter am Anfang ihrer Laufbahn nur einen Hungerlohn verdienten. Wahrscheinlich hatte er auch gehört, dass Martin kein nennenswertes Familienvermögen besaß, was für einen Richter eher ungewöhnlich war. »Gehen wir«, sagte Martin und zog die Fensterläden zu, wobei er sich bemühte, die gesamte Autorität seines Amtes in die Stimme zu legen.
»Selbstverständlich.« Franc setzte die Mütze auf, ging zur Tür und hielt sie auf. Als sie die Treppen hinuntereilten, berichtete er Martin, dass er ein Maultier und einen Karren für sie bestellt habe. Sie traten in das blendend helle Tageslicht, und Franc wies zum Ende der Straße. Das Wohnhaus des Notars René Picard war eines der neueren Gebäude ganz in der Nähe der ehemaligen Nordmauer der Stadt, einen knappen Steinwurf entfernt von der Saint-Sauveur-Kathedrale. Das Gefährt, das am Eingang des Platzes der Kathedrale auf Franc und Martin wartete, war von simpler Bauart und in die Jahre gekommen, das Holz grau und splittrig. Der Inspektor deutete auf ein Taschentuch, das er sich um die linke Hand gebunden hatte, und warnte Martin vor aus dem Holz ragenden Nägeln.
Als sie auf dem Kutschbock Platz genommen hatten, knallte Franc mit der Peitsche, worauf sich das Tier in Richtung der großen Kirche in Bewegung setzte. Dort hatte die Prozession zu Ehren der Himmelfahrt der Heiligen Jungfrau begonnen und war dann weiter durch die Straßen von Aix gezogen. Nun, drei Tage später, waren von den kirchlichen Festlichkeiten nur einige blaue und weiße Blumen übriggeblieben, die verloren auf dem Kopfsteinpflaster lagen. Schmale, kurvenreiche Sträßchen, die trostlos wirkten wie die verblühten Blumen, führten sie hinaus aus der Stadt. Die Fenster der Konvente und Wohnhäuser waren fest geschlossen, damit das grelle Licht der späten Nachmittagssonne nicht ins Innere dringen konnte. Die bedächtigen Hufschläge des Maultiers hallten in den menschenleeren Gassen.
Martin wollte Franc genauer zu den Umständen des Leichenfunds befragen, doch er wartete, bis sie die Hauptstraße nach Vauvenargues erreichten. Wie viele Jungen hatten die Leiche gesehen? Wann genau hatten sie sie entdeckt? Hatten sie sonst noch etwas gefunden?
Es gab nicht viel zu berichten. Drei Bauernjungen waren beim Schwimmen gewesen. Auf dem Heimweg hatten sie am Steinbruch eine Pause eingelegt und zwischen den Felsen Verstecken gespielt, wobei sie die Tote entdeckt und sich furchtbar erschreckt hatten. Franc lachte, und sein kräftiges Gebiss mit den tabakfleckigen Zähnen wurde sichtbar. Anscheinend hatte die Leiche mit dem Gesicht zum Boden gelegen, doch keiner der Jungen hatte den Mut aufgebracht, die Tote umzudrehen. Sie waren überzeugt, dass sie eine so feine Dame sowieso nicht kennen würden. Pierre Tolbec, der Vater des ältesten Jungen, hatte der Polizei Meldung von dem Fund gemacht. Tolbec und sein Sohn Patric waren um zwei Uhr mittags zur Wache geritten, mit einem Sonnenschirm und einem kleinen Geldbeutel, in dem einige wenige Münzen klimperten.
Martin konnte diesem Bericht nichts Lustiges abgewinnen. Seine Kollegen bei Gericht mochten Franc, denn er nahm seine polizeilichen Pflichten ernst und machte ihnen so das Leben etwas leichter. Den meisten Amtsrichtern war es egal, wie der Inspektor die Taschendiebe, Wilderer und Prostituierten behandelte, über die sie Recht sprachen. Martin war es nicht egal, doch er bemühte sich, dies für sich zu behalten. Falls sie im Steinbruch wirklich eine Tote vorfanden, dann war er auf Franc angewiesen, genau wie Franc auf ihn, was sich angesichts von Martins Unerfahrenheit und der möglichen großen Bedeutung eines solchen Falls wahrscheinlich für Franc unangenehmer als für Martin auswirken konnte.
Martin studierte das Profil seines Gefährten. Das glänzende, schwarzgefärbte Haar und der mächtige, glatte Schnauzbart passten offensichtlich nicht zu Francs Alter, das die grauen und weißen Stoppeln in seinem unrasierten Gesicht verrieten. Im Waschraum der Richter und Advokaten hatte Martin Witze gehört über die erstaunliche Eitelkeit des Inspektors und die übermäßige Menge an Pomade, mit der er seine beeindruckende tiefschwarze Mähne zähmte. Dennoch respektierten sie ihn. Nicht nur Francs Leibesfülle, sondern seine gesamte Haltung verliehen ihm eine raubeinige und ungezwungene Autorität. Martin war genauso groß wie Franc, von mittlerem Wuchs, allerdings um einiges dünner. Nach der strikten Hierarchie, die im Palais de Justice herrschte, war Martin Francs Vorgesetzter. Aber als er nun neben dem kräftigen, selbstbewussten Mann saß, kam sich Martin wie ein Kind vor. Er schüttelte das Gefühl ab und widmete sich stattdessen der Umgebung.
Sie fuhren langsam, fast lautlos auf der steinernen weißen Straße einen Hügel hoch, vorbei an Bauernhöfen mit roten Ziegeldächern, an Olivenhainen mit krummen, silbrigblättrigen Bäumen und an Weinbergen, in denen gelbliches Laub an den Stöcken hing. In weiter Ferne ragten die leuchtenden Kalksteinberge in den wolkenlosen blauen Himmel. Alles erschien Martin zu grell, von einer fast unnatürlichen Helligkeit. Nichts war hier so wie im Norden, wo er aufgewachsen war.
Anfänglich war er noch erleichtert, als sie in die Bibémusstraße einbogen, die durch einen schattenspendenden Kiefern- und Eichenwald führte. Aber die schmale, steinige Straße war steil, und als das Maultier seinen Schritt verlangsamte, steigerten sich Martins sorgenvolle Bedenken. Er konnte nur noch daran denken, was wohl in dem Steinbruch auf sie wartete. Er lockerte den Kragen. Seine Kehle war wie ausgetrocknet, und bald fiel ihm das Schlucken immer schwerer. Endlich erreichte der Karren eine mit Felsen und Gestrüpp überwucherte Fläche, auf der das Maultier zum Stehen kam. Auf dieser öden Ebene hatten nur ein paar missgestaltete Föhren Fuß fassen können. Ihre Stämme und fedrig-grünen Äste neigten sich scharf in eine Richtung, als wollten sie sich mit stummem Klagen für alle Ewigkeit dem Mistral, dem furchtgebietenden Winterwind der Provence, unterwerfen. Überall um sie herum zirpten, summten und brummten Insekten, sonst waren keinerlei Geräusche zu hören.
»Wir sind fast da«, sagte Franc und kletterte vom Karren. Er schaute sich einen Moment um, dann deutete er auf eine Linie aus rot-orangen Felsbrocken und Geröll. »Hier geht’s lang, meine ich, Monsieur. Wir werden die Leiche hochtragen müssen, aber halten Sie trotzdem Ausschau nach etwas, was der Mörder vielleicht zurückgelassen hat.«
Martin folgte dem älteren Mann. Mit einer Hand stützte er sich an dem rauen Sandstein ab, als sie auf dem Pfad im Zickzack den Hang hinunterschritten. Sein Herz schlug ihm bis zum Hals, doch der Grund dafür war nicht die ungewohnte Anstrengung. Erst als er ausrutschte, wurde ihm klar, vor was er sich eigentlich fürchtete. Er schaute zu Boden und rechnete schon fast damit, dort Blut zu sehen. Stattdessen blickte er auf die Steine unter seinen Füßen, die glatt und ausgetreten waren von den Schritten der Wanderer, die seit Jahrhunderten diesen Pfad entlanggingen. Glücklicherweise schien Franc zu sehr mit möglichen Spuren beschäftigt und nahm keine Notiz von Martins Ungeschicklichkeit. Der Inspektor bewegte sich wie ein geschmeidiges Raubtier, das der Fährte seines Opfers folgte, er hielt die Nase in die Luft und schaute sich aufmerksam im Gelände um. Schließlich entdeckte er etwas. In den Ästen, die zwischen den Felsen hervorragten, hing die aufgerollte Leinwand eines Malers, das heißt, eigentlich war es nur ein kleines Stück einer Leinwand. Franc entrollte das Bild, und sie sahen, dass jemand ein mit groben Strichen gemaltes Gemälde von gebeugten Kiefern und mächtigen orangefarbenen Felsbrocken zerrissen hatte. Der Inspektor musterte das Stück Leinwand so lange, dass Martin ihn schließlich fragte, ob er denn wisse, wer es gemalt haben könnte.
»Ich bin mir nicht ganz sicher, Monsieur, aber ich habe einen Verdacht.« Franc faltete die Leinwand zusammen und steckte sie in die Tasche. Dann deutete er auf einen zweiten Felsenpfad, der zu ihrem Ziel führte. Der Steinbruch tat sich trostlos und unheimlich vor ihnen auf.
Hier zeigte nicht die Natur selbst ihre zerstörerische Kraft, sondern der Mensch. Unterhalb von ihnen, fast wie aus der Ebene herausgemeißelt, befanden sich gigantische, geometrisch geformte Türme und Höhlen, freistehende Treppen und Mauern, gekrümmte Bögen und Röhren: die Überreste der begierigen Jagd nach dem Material, aus dem die mächtigen honigfarbenen Häuser von Aix gebaut waren. Die ordnungslose Architektur des Steinbruchs kam Martin so phantastisch vor, dass es ihm schien, als blickte er auf Bauklötze, die riesenhafte, uralte Götter vor langer Zeit hier zurückgelassen hatten. Selbst die Farben schienen nicht in dieses Land zu gehören. Im Licht der untergehenden Sonne glühten die Felsen orange und rot und violett. Überall krümmten und wanden sich Äste, als wollten sie sich aus dem leblosen Stein befreien, und wuchsen in schwarzen und gelbgrünen Reihen empor zum Licht.
Franc schlitterte über treppenartige Einkerbungen, die ein Steinhauer mit seinem Pickel in den Fels geschlagen hatte. Sie entdeckten sie schon nach kurzer Zeit. Als Erstes sahen sie ihr Kleid. Es war weiß, mit grünen Streifen, wie der Junge gesagt hatte. Schlagartig fiel Martin ein, wo er das Kleid schon einmal gesehen hatte: auf der anderen Seite des Platzes der Kathedrale während der Prozession der Jungfrau, unter einem Sonnenschirm. Zweifellos würde Franc später ebenjenen Sonnenschirm von der Wache zu ihm in den Gerichtshof bringen.
Sie lag zwischen Schatten und Licht, halb versteckt hinter den Überresten der Felsen, die die Steinhauer hatten stehenlassen. Als Martin sich näherte, sah er den eindeutigen Beweis, dass sie es wirklich war. Ihr offenes Haar wirkte im unbarmherzigen Schein der untergehenden Sonne, als stünde es in Flammen. Dieses wundervolle rotgoldene Haar, das sie in seiner Gegenwart immer nur elegant hochgesteckt getragen hatte, so dass die Locken ihren langen weißen Nacken freiließen. Unter ihrem Körper breitete sich von den Schultern bis zur Taille eine dunkle Blutlache aus, die schon längst in der Sonne eingetrocknet war.
Martin wollte die summenden Fliegen von ihrem Körper verscheuchen, doch er war zu keiner Bewegung fähig. Franc dagegen zeigte wenig Respekt im Umgang mit der Toten. Der Veteran schob seine Stiefelspitze unter ihre Hüfte und drehte sie so um. Und dann blickte Martin in ihr Gesicht, das einst so schön gewesen war, doch nun für alle Zeiten erstarrt war in der grotesken Maske des Todes. Mein Gott, dachte Martin, das ist Unrecht. Die Eindrücke des Tages, die grellen Sonnenstrahlen überwältigten ihn mit erbarmungsloser Intensität. Wo ihm einmal der Hauch eines Parfums in die Nase gestiegen war, schlug ihm nun der Gestank menschlicher Überreste entgegen. Ihm wurde schwindlig von der Hitze, den Ausdünstungen des Todes und dem unablässigen Zirpen der Grillen. Aus Sorge, dass er sich übergeben könnte, ließ er sich auf einem Felsbrocken nieder.
»Kannten Sie sie?«
»Wie bitte?«
»Ich fragte, ob Sie sie kannten?«
»Ja ... Nein, nicht wirklich.« Beide Antworten entsprachen der Wahrheit. Doch das wenige, das er über sie wusste, würde er keinesfalls Franc anvertrauen.
»Dann wissen Sie, wer sie ist?«
Martin nickte und ließ den Kopf in die Hände sinken, wobei er nur mit größter Willenskraft die Übelkeit zurückdrängen konnte. Seine Stimme ging in dem schrillen Konzert der Grillen fast unter.
»Es ist Solange Vernet.«
Martin hatte Solange Vernet im Frühling des Jahres in einer Buchhandlung in der Nähe des Hôtel de Ville kennengelernt. Er war auf der Suche nach einer neuen Ausgabe von Die Entstehung der Arten gewesen, und da er die politische Einstellung des Buchhändlers damals noch nicht kannte, hatte er selbst in den Regalen mit den wissenschaftlichen Büchern nach der Ausgabe gesucht. In einer hinteren Ecke stieß er auf Solange Vernet, die in dem einzigen Exemplar des Buches las, das im Laden zu finden war. Ihr weißer Hut hing an einem grünen Satinband von ihrem Nacken, ihr Schirm lehnte an der Wand. Sie war so sehr in die Lektüre vertieft, dass sich ihre Stirn in Falten gelegt hatte und sie ihn erst bemerkte, als er schon fast vor ihr stand. Aber sie zuckte nicht zusammen und trat auch nicht zurück. Sie lächelte. Ein wunderschönes Lächeln, warm und spitzbübisch zugleich.
»Halten Sie vielleicht danach Ausschau?«, fragte sie und blickte von dem Buch hoch in sein Gesicht.
Martin hob abwehrend die Hand und beteuerte, dass –
»Nein, bitte«, unterbrach sie ihn. »Wir haben eine englische Ausgabe zu Hause stehen. In dieser wollte ich nur nachschauen, weil ... Sehen Sie, hier«, sie deutete mit dem weißen Finger ihres Handschuhs auf das Titelblatt. »Es wurde von einer Frau übersetzt, Clémence Royer. Ich habe in Paris eine Reihe von Vorträgen von ihr besucht. Sie sprach über Philosophie und Naturwissenschaft.«
»Ja«, antwortete Martin, »eine außergewöhnlich kluge Frau. Aber hat sie nicht auch so etwas wie einen Skandal verursacht?« Wenn er durchscheinen ließ, dass er über den Skandal Bescheid wusste, würde er hoffentlich nicht gestehen müssen, dass er einer Meinung war mit denen, die allein schon bei der Vorstellung, eine Frau könnte öffentlich über solche Dinge sprechen, buhten und aufschrien.
»Sie haben sie auch gehört? Sie haben in Paris gelebt?«
»Nur drei Jahre. Ich war an der juristischen Fakultät eingeschrieben und die meiste Zeit mit furchtbar langweiligen Dingen beschäftigt, fürchte ich. Ich musste auf mein Examen lernen.«
Später fragte er sich oft, warum er ihr das alles erzählt hatte. Und er musste sich eingestehen, dass er sich gewünscht hatte, die Frau, diese schöne Fremde, würde der bescheidenen Einschätzung seiner Jahre in Paris widersprechen. Er erinnerte sich, dass ihre Augen, die ihn fröhlich und offen anblickten, grün waren und dass sie denselben Farbton hatten wie die Smaragde in ihren Ohrringen. Noch nie zuvor war Martin so etwas an einer Frau aufgefallen.
»Also gut, Sie müssen es haben«, sagte sie und drückte ihm dabei das Buch in die Hand. Dann stellte sie sich vor und lud ihn zu einem ihrer Donnerstagabend-Salons ein. »Cours Mirabeau 57, zweiter Stock, um acht«, sagte sie. »Gebildete und gelehrte Menschen jeder politischen Couleur.« Professor Westerbury, erklärte sie, sei der führende Kopf der Gruppe. In der ganzen Stadt stand der Name des Engländers auf Plakaten, die separate Vorträge für Männer und Frauen über Geologie ankündigten. Solange wartete Martins Antwort nicht ab – er hätte sicherlich irgendeine Entschuldigung vorgebracht –, sondern setzte ihren Hut auf und sagte, sie müsse gehen. Dann legte sie ihre behandschuhten Finger auf seinen Arm. »Wirklich, Sie müssen kommen. Sie wären zur Abwechslung einmal ein interessanter Gast.«
Weder ihr Lächeln noch ihre Augen verrieten Martin, ob sie das ernst meinte oder sich über ihn lustig machte. Nun würde er es nie erfahren.
Er war zu keinem ihrer Salons gegangen. Seit dem Treffen in der Buchhandlung hatte er sie nur aus der Ferne gesehen, doch immer hatte er sie an ihrer stolzen Haltung erkannt und an den weithin leuchtenden Locken ihres glänzenden rotgoldenen Haars. Normalerweise begegnete er ihr auf dem Cours Mirabeau. Aber gelegentlich sah er sie auch die Madeleine-Kirche betreten oder verlassen, wenn er auf dem Weg zum Palais de Justice war oder einen Sonntagsspaziergang machte. Das letzte Mal war erst vor ein paar Tagen gewesen, an der Himmelfahrts-Prozession. Er hatte von der anderen Seite des Platzes der Kathedrale her beobachtet, wie sie sich bekreuzigte und das Knie beugte, als die Statue der Jungfrau an ihr vorbeigetragen wurde. Was war das nur für eine Frau, die Darwin las und dennoch vor der Jungfrau in die Knie ging?
»Monsieur le juge?« Franc sprach ihn an, wobei er ein christliches Medaillon an einem breiten weißen Band in die Höhe hielt. »Sieht mir nach einem Verbrechen aus Leidenschaft aus. Jemand wollte sie mit dem hier erwürgen. Ich hab’s gefunden, es war um ihren Hals gewickelt. Und dann hat er sie mit einem Messer erstochen.«
»Aber warum?« Warum? Was für eine naive, geradezu kindische Frage für einen Richter. Er hätte das nicht fragen, nicht einmal denken dürfen. Doch glücklicherweise schien Franc die Frage nicht seltsam zu finden.
»Wer weiß? So hatte es ja kommen müssen, Monsieur, das habe ich immer schon gesagt. Seit die beiden in der Stadt sind, habe ich sie und ihren Liebhaber, diesen Engländer Westerbury, im Auge. Ihm habe ich nie vertraut. Kam mir wie ein Scharlatan vor. Und sie ...« Er schüttelte verächtlich den Kopf. »Eine sittenlose Frau mit Affären, die sich als eine Art Dame einrichten will. Und da wagt sie es noch, das Medaillon der Heiligen Jungfrau zu tragen.« Er warf einen letzten Blick darauf, bevor er es in seiner Tasche verschwinden ließ. »Diese Pariser Sitten brauchen wir hier im Süden nicht.«
»Woher wissen Sie, dass sie Affären hatte?« Martin hoffte, dass er nicht allzu neugierig klang.
»Das gehört zu meiner Arbeit, Monsieur. Damit die Stadt sauber und ruhig bleibt. Wenn solche Leute kommen, dann halte ich ein Auge auf sie. Ich kann Ihnen eine vollständige Namensliste der Professoren und großen Tiere beschaffen, die sich in ihrer Wohnung zusammengefunden haben. Aber ich stelle auch meine eigenen Vermutungen an.« Franc klopfte auf seine Jackentasche, in der sich das gefaltete Stück Leinwand befand. »Ich habe gesehen, wie sie sich mit dem Sohn des Bankiers getroffen hat, Cézanne. Der sich als Künstler ausgibt.«
»Madame Vernet und dieser Cézanne haben sich alleine getroffen?« Martin schaute kurz zu der Leiche von Solange Vernet, einer frommen Frau, die offenbar Liebschaften unterhielt.
»Ja, zumindest einmal außerhalb ihrer Wohnung. Und wer weiß, was hinter geschlossenen Türen vor sich ging. Ich frage mich, was der Engländer davon gehalten hat.«
»Wenn er überhaupt davon wusste«, meinte Martin leise.
»Richtig, Monsieur. Aber wie mag er wohl reagiert haben, als er es herausgefunden hat?« Franc warf ihm einen aufmunternden Blick zu, als wollte er sage, ja, jetzt bist du auf der richtigen Spur.
Das Summen in Martins Kopf hatte nicht nachgelassen, auch war ihm nach wie vor übel. Doch es half nichts, er musste die Initiative ergreifen. »Das Messer haben Sie offenbar noch nicht gefunden«, brachte er mit Mühe hervor. »Wir sollten danach suchen, solange es noch hell ist.«
Franc nickte, und sie begannen mit der Suche.
Martin war froh, von Solange Vernets Leichnam wegzukommen. Fast eine Stunde lang durchforsteten sie den Steinbruch, doch schließlich mussten sie aufgeben. An dem Wagen war keine Lampe, und wenn sie die Straße in der hereinbrechenden Dämmerung noch erkennen wollten, mussten sie die Rückfahrt in die Stadt antreten. Martin trug Franc auf, dafür zu sorgen, dass seine Truppe am nächsten Tag vollzählig zur Arbeit erschien. Ein paar der Männer sollten die Suche hier draußen fortsetzen.
Dann widmeten sie sich dem grauenvollsten Teil ihrer Aufgabe. Franc packte Solange Vernet an den Schultern, während Martin ihr das Kleid um die Beine wickelte und ihre Knöchel fest gegeneinanderdrückte. Francs Griff war weniger behutsam. Ihr Kopf hing so weit nach unten, dass Martin ihn fast nicht sehen konnte. Er war dankbar, dass ihm der Anblick des aufgedunsenen Gesichts erspart blieb.
Fast schaffte er es, die Gerüche und Geräusche um ihn herum auszublenden, indem er sich darauf konzentrierte, die Falten ihres Kleids zusammenzuhalten und auf dem steilen Weg nicht zu stolpern. Dennoch war er erleichtert, als er endlich Solange Vernets Leiche auf den Karren heben und eine alte Decke über sie werfen konnte. Nach diesem stummen Ritual klopfte Franc den rot-orangenen Staub des Steinbruchs von seinen Kleidern. Martin wollte es ihm nachtun, doch seine Handflächen waren so verschwitzt, dass er den Staub nur noch mehr auf seiner Jacke verschmierte. Schließlich setzten sie sich auf den Kutschbock.
Martin schaute starr geradeaus, als Franc den Esel zurück auf die Bibémusstraße lenkte. Er versuchte, ruhig zu atmen und nicht daran zu denken, was hinter ihnen auf dem Karren lag. Glücklicherweise war Franc zum Plaudern aufgelegt. Martin war nicht sicher, ob der Inspektor ihm zuliebe so viel erzählte, um ihn auf andere Gedanken zu bringen, oder ob der alte Veteran ihn einfach nur beeindrucken wollte. Aber eigentlich war es ihm egal. Er war dankbar für alles, was ihn von dem geschändeten Leichnam Solange Vernets ablenkte.
Franc hatte 1870 gegen die Preußen gekämpft, weshalb ihm, wie er Martin erklärte, die Leiche einer Ermordeten nicht besonders an die Nieren ging. Franc hatte schon ganz andere Dinge gesehen. Furchtbare Dinge. Gefallene Kameraden. Vergewaltigte Frauen. Mit dem Bajonett aufgespießte Kinder. Weggeschossene Gesichter. Dicke Äste, die mitten in der Schlacht über den Soldaten zersplitterten. Und eins könne er ihm glauben, versicherte er seinem Zuhörer, nämlich, dass er jede Menge Hunnen für ihre Sünden hatte bezahlen lassen. Er schilderte seine Heldentaten in allen Einzelheiten.
Martin konnte spüren, wie ihre grauenhafte Fracht bei jedem Stoß des Karrens von der einen auf die andere Seite rollte, dennoch versuchte er Franc zu vermitteln, dass ihn seine Kriegsgeschichten nicht langweilten. Er selbst erzählte, wie er als elfjähriger Junge ganz Lille in einem Zustand von Panik erlebt hatte, als die Preußen über die Grenze marschiert waren, und wie sehr seine Mutter geweint hatte, als sein Vater fortging, um ihr Zuhause zu verteidigen. Am Ende waren die deutschen Armeen an der gewappneten Stadt vorbeigezogen, und Martins Vater, ein bescheidener Uhrmacher, der ohne Brille kaum etwas erkennen konnte, hatte nie kämpfen müssen. Er war zwei Jahre später in seinem Bett gestorben.
Verglichen mit Francs heldenmutigen Geschichten schienen seine Reminiszenzen unbedeutend. Doch das waren sie nicht. Sie erinnerten Martin an den Tod, der seinem Leben eine unwiderrufliche Wendung gegeben hatte. Immer noch konnte er seinen Vater auf dem Bett liegen sehen, umgeben von den flackernden Kerzen der Totenwache. Nie würde er die weinenden Verwandten und den Geruch der Weihrauchschwaden vergessen, der immer den Tod eines Gläubigen begleitete. Er selbst vergoss keine Träne, das wäre unmännlich gewesen. Dem Vater hatte er versprochen, seine Mutter zu trösten, und deshalb ließ er seiner Trauer nur auf den Spaziergängen im Wald ihren Lauf, wo ihn niemand sehen oder hören konnte. Wie er die kleinen Scherze vermisste, die sein Vater nur ihm erzählt hatte, und sein Lob und die Umarmungen, selbst die sanften Ermahnungen, auch weiterhin sein Bestes zu geben und immer das Richtige zu tun.
Martins Vater war ein gutmütiger Mensch gewesen. Vielleicht zu gutmütig. Sein Einkommen hatte er nicht besonders gut verwaltet. Erst nach seinem Tod entdeckten sie, dass er zu große Summen auf die Wünsche seiner Frau verwendet oder an arme Angestellte verliehen hatte, die ihm nie etwas zurückzahlen konnten. Aufgrund der Schulden hatten Martin und seine Mutter in Abhängigkeit von reichen Verwandten leben müssen. Martin schaute zu Franc. In einer Welt, wo harte Fakten regierten und gute Taten nichts zählten, konnte man womöglich von einem Mann mit Francs Erfahrung etwas lernen. Einem Mann, der im Gegensatz zu Martin dem Tod ins Gesicht blicken konnte, ohne dass es ihm etwas ausmachte.
Die Nacht hatte sich schon über die Stadt gelegt, als sie Aix erreichten. Der unerschrockene Inspektor erklärte Martin ausführlich, warum es insbesondere für sie beide wichtig sei, dass sie den Fall lösten, bevor die anderen Richter und der Staatsanwalt aus der Sommerfrische auftauchten. Martin und er, erklärte Franc in vertrautem Tonfall, seien beide Außenseiter, die nach Aix gekommen waren, um hier ihr Glück zu machen. Ohne den Krieg und die neue Welt, die sich ihm dadurch eröffnet hatte, so Franc, würde er immer noch in dem armen Dorf leben, in dem er geboren wurde. Doch wenn sie diesen Mordfall lösten, dann würde er vielleicht zum commissaire ernannt, einem Mann, zu dem alle aufblickten. Viel höher konnte er nicht aufsteigen. Martin dagegen, Martin war jung und gebildet. Auch wenn er vom anderen Ende Frankreichs kam, konnte niemand voraussagen, wie weit ihn dieser Fall bringen würde. Womöglich gelangte sein Name dadurch sogar auf eine Beförderungsliste für eine Stelle im Norden, in der Nähe seiner Familie, oder sogar in Paris, falls es ihn dorthin zog.
Martin wusste nicht, wohin es ihn zog, nur dass er endlich auf eigenen Beinen stehen wollte. Es war kein Zufall, dass es ihn vom anderen Ende des Landes hierher verschlagen hatte. Er hatte gesellschaftlichen Zwängen entkommen wollen, die ihn in Richtungen drängten, die er nicht beschreiten wollte. Sein Herz gehörte den demokratischen Idealen, an die früher auch sein ältester Freund Merckx geglaubt hatte. Doch Merckx hatte sich dem Anarchismus verschrieben, und seine ständig gewalttätiger werdenden Hetztiraden gegen die Reichen und Mächtigen hatten Martin immer größere Sorge bereitet, ja, sie waren sogar gefährlich für Martin geworden, der geschworen hatte, das Recht zu wahren. Und dann waren da die Reichen und Mächtigen selbst, die Familie DuPont, die seine Ausbildung finanziert hatte und nun erwartete, dass er um die Hand der ältesten Tochter anhielt. Die Heirat würde Martin Ansehen und Wohlstand verschaffen, zumindest solange er bereit war, die reaktionären Meinungen zu vertreten, die eine solche Position mit sich brachte.
Martin glaubte fest daran, dass er einen Mittelweg finden konnte, einen Weg der Vernunft zwischen reaktionärer Politik und Anarchie. Obwohl Merckx ihn dafür verspottete, hatte Martin sich für eine Laufbahn als Richter entschieden, anstatt ein Anwalt zu werden, der die Armen verteidigte. Die Amtsrichterschaft war der sicherere Weg für jemanden, dessen Familie kein Vermögen besaß. Und anders als Merckx glaubte Martin an die Republik. Er glaubte daran, dass, wenn die Menschen die Ideale von liberté, fraternité und egalité aufrechthielten, Gerechtigkeit für alle gleichermaßen möglich war.
Doch diese Ansichten hielt er vor Franc und überhaupt vor allen in der hochnäsigen, eingeschworenen Welt des Palais geheim. Der Staatsanwalt und die anderen Richter behandelten Martin fast wie einen Fremden, dem man die unwichtigsten und unangenehmsten Fälle zuschieben konnte. Mit einer Sache hatte der Inspektor recht, dachte Martin, als der Karren mit einem letzten Ruckeln vor dem imposanten Gerichtsgebäude zum Stehen kam: Einen Mordfall zu lösen würde ihm Respekt verschaffen. Aber zu welchem Preis? Es widerte ihn an, wie er an seinen persönlichen Vorteil dachte, während die Leiche von Solange Vernet hinter ihm verrottete.
»Wenn es Ihnen recht ist, Monsieur Martin«, meinte Franc, als er die Zügel lockerte, »dann lasse ich Sie hier aussteigen und bringe die Leiche alleine zum Gefängnis.«
»Gut, Franc. Ich danke Ihnen.« Martin war froh, dass der Inspektor ihn aus dem giftigen Dunstkreis von Tod und Verwesung entließ, der den stehenden Karren umgab. Wenigstens hatte er noch die Geistesgegenwart, Franc zu fragen, ob dieser wisse, wo sich Riguel, der Professor für Biologie, aufhielt, der bei der Polizei die Obduktionen durchführte.
»Wenn er in der Stadt ist, dann finde ich ihn noch heute Abend«, versprach Franc. »Sobald ich die Leiche aufgebahrt habe.«
Die Leiche. Schon war sie nur noch eine Leiche.
»Und gleich morgen früh schicke ich die Burschen los, damit sie diesen Liebhaber ausfindig machen«, fuhr Franc fort. Er hatte sich alles schon überlegt und schien unbedingt sofort mit der Untersuchung beginnen zu wollen. »Und ich schicke den alten Joseph zu Ihnen.« Franc dachte wirklich an alles, sogar an Martins Schreiber. Im Gericht hatte man Martin wie selbstverständlich den ältesten und gebrechlichsten greffier zugewiesen. Wegen seines Alters war es unwahrscheinlich, dass Joseph Gilbert in die Sommerfrische verreist war.
Martin reichte Franc die Hand, und dieser drückte sie eifrig.
Der Händedruck besiegelte ihre Partnerschaft.
Martin schwankte wie ein Betrunkener, als er in Richtung der Kathedrale schritt. Eine Flut von Bildern, die bis jetzt durch die Unterhaltung mit dem Inspektor zurückgehalten worden war, brach über ihn herein. Kaum war er um die Ecke gebogen und aus dem Blickfeld von Franc, presste er die Hand auf seinen Magen. Er konnte die Übelkeit nicht länger unterdrücken, beugte sich vor und erbrach sich in der Gosse. Dann wischte er sich den Mund am Ärmel ab, lehnte sich gegen die Mauer und holte mehrmals tief Luft. Die Gaslichter warfen seltsame Schatten in den engen, menschenleeren Gassen, doch wenigstens war nirgends mehr das Summen der Insekten zu hören. Stattdessen lauschte er dem tröstenden, sittsamen Plätschern der vielen Springbrunnen von Aix, die das sprudelnde Wasser aus der Erde pumpten, für das die Stadt berühmt war. An einem Brunnen seitlich der Kathedrale genoss Martin seine wohltätige Wirkung. Er schöpfte das Wasser in seine Hände und trank von der kühlen, klaren Flüssigkeit. Wieder und immer wieder benetzte er Hände und Gesicht, bis Wasser von seinem Bart tropfte und ihm unter den Kragen rann. Er schaute zu, wie der Staub des Steinbruchs rote Schlieren im Wasser formte, die langsam von ihm wegtrieben.
Asche zu Asche, Staub zu Staub. So verkündeten es die Priester, und auch seine Mutter sprach diese Worte im Gebet. Doch selbst ihr war klar, dass der Tod keine so einfache Angelegenheit war.
Martin trat einige Schritte zurück, schaute an der großen Kirche empor und erblickte eine lächelnde Statue. Als Junge hatte er mit seiner Mutter viele Kirchen besucht, in einer endlosen Suche nach dem richtigen Altar, dem richtigen Heiligen und dem einen Gebet, das ihr ein zweites Kind schenken würde. Bei jedem Besuch hatte sie ihn Lektionen des Glaubens und der Moral gelehrt.
»Schau, mein Junge«, hatte sie ihm einmal erläutert, wobei sie auf eine wunderschöne Gestalt an der Fassade irgendeiner Kirche deutete. »Sie verkörpert die ungläubige weltliche Frau. Ihr Lächeln scheint so reizend, so gütig, aber sieh hier ...« Sie zog ihn näher, damit er die schlangenartigen Figuren an der Hinterseite der Statue erkennen konnte. »Schau dir die Würmer an, die sich in sie hineinfressen. Natürlich wird es uns allen so ergehen, wenn wir sterben. Der Körper verfault. Aber das hier, das geschieht mit ihrer Seele – und mit der Seele jedes Einzelnen, der sie berührt hat, der von ihr verführt wurde, als sie noch am Leben war!«
Mit einem Lächeln erinnerte sich Martin an die Albträume, die ihn nach dieser Lektion geplagt hatten. Er war zu jung gewesen, um die Reize der weltlichen Verlockungen zu verstehen. Und so hatten ihm, auch wenn seine Mutter das Gegenteil beabsichtigte, die Folgen des irdischen Todes viel mehr Angst eingejagt als der spirituelle Verfall. Heute war er Zeuge dieses natürlichen Verwesungsprozesses geworden, als sie die geschundene Leiche von Solange Vernet gefunden hatten. Aber hatte er auch Zeichen ihrer seelischen Verderbtheit gesehen? Als er die Stufen zu seiner Dachkammer erklomm, fragte sich Martin, was für Träume ihn wohl heute Nacht heimsuchen würden.
Mittwoch, 19. August
»Untersuchungsrichter schlagen auch mal gerne zu.«
NICOLAS FREELING, Der Himmel über Flandern
Kapitel 2
»Aufwachen, Monsieur Martin, wachen Sie auf.« Louïsos raue Hand schüttelte Martin, bis er wach war. »Sie müssen ja eine schlimme Nacht verbracht haben«, murmelte die alte Frau in ihrem breiten provenzalischen Dialekt. »Ihre Decken liegen überall herum.« Martin konnte den gekrümmten, vorwurfsvollen Finger nicht einordnen, der auf ihn zeigte. Als er die Augen öffnete, sah er, dass Louïso eine leere Weinflasche und einen Kanten trockenes Brot fest an ihren ausladenden Busen drückte. Er stöhnte auf, als er die Überreste von seinem Tisch erkannte. Kein Wunder, dass die Zugehfrau der Picards so schlechte Laune hatte.
»Ich dachte, Sie wollen sicher nicht den ganzen Tag verschlafen, deshalb habe ich Ihnen frisches Brot vom Bäcker geholt und eine Schale café au lait gemacht«, fuhr sie fort. »Und nun gehe ich, damit Sie sich ankleiden können.« Ehe Martin noch etwas erwidern konnte, drehte sie sich um und trat zur Tür hinaus, wobei sie heftig schwankte.
Er sprang aus dem Bett und öffnete die Läden. Das helle Sonnenlicht bestätigte seine Befürchtungen. Er hatte verschlafen. Er ließ sich in den Stuhl vor seinem Tisch fallen. Sein erster Mordfall, und er fühlte sich entsetzlich. Es war der Wein gewesen, den er getrunken hatte, damit er nicht die ganze Nacht nur an das groteske Wesen denken musste, das aus Solange Vernet geworden war. Martin hob die Decken auf, die über den Boden verstreut lagen, und warf sie auf das Bett. Trotz des Weins hatte Solange Vernet ihn bis in seine Träume verfolgt und sich an ihn gewandt mit stumm flehenden Bitten, die er weder verstehen noch erfüllen konnte.
Mit zitternden Fingern griff er nach der Schale mit Milchkaffee, und kaum berührte das Getränk seine Lippen, trank er gierig. Mit einem einzigen Schluck leerte er die halbe Schale, setzte sie ab und brach ein Stück Brot ab, das er sich in den Mund schob, um seinen Magen zu beruhigen. Er musste versuchen, so schnell es ging eine Antwort auf Solange Vernets Flehen zu finden. Vielleicht würde er heute schon auf ihren Mörder treffen. Er brauchte seine volle Geistesgegenwart und einen klaren Kopf.
Martin kleidete sich rasch an. Er wusch sich nicht einmal, sondern stürzte sofort nach draußen. Mit Absicht mied er die Straßen um die Kathedrale mit den Erinnerungen, die dort vielleicht wieder über ihn hereinbrachen. Er ging schnell und zwang sich, an nichts anderes zu denken als an die Hauptpunkte zur Kunst des Verhörs, wie man sie ihn in den Vorlesungen gelehrt hatte. Tragen Sie Sorge, dass der Verdächtige sich wohl fühlt. Lassen Sie ihn spüren, dass Sie auf seiner Seite stehen. Hören Sie ihm zu. Machen Sie sich ein Bild von seinem Charakter. Wenn Sie seinen Charakter verstehen, dann kennen Sie das Motiv. Wenn Sie das Motiv kennen, dann haben Sie das Verbrechen gelöst. Und wenn er dann auch nur einen falschen Schritt tut, schlagen Sie zu! Ja, und am wichtigsten, vertrauen Sie auf Ihre Instinkte. Martin war nicht sicher, wie er diesem letzten Lehrsatz nachkommen sollte. Vernunft und Geduld hatten ihn bis in den Palais de Justice gebracht. Er fragte sich oft, ob er überhaupt so etwas wie Instinkte besaß. Oder Phantasie.
Sein Weg führte ihn vorbei an dem offenen Markt vor dem Hôtel de Ville, wo Bauern und ihre Weiber die hohe Qualität ihrer Früchte und des Gemüses anpriesen. Frauen mit großen Körben rempelten Martin an, als sie zu ihren Lieblingsständen hasteten, um die Ware zu inspizieren und einen guten Preis auszuhandeln. Die Tage nach Mariä Himmelfahrt waren seltsam still gewesen, es war gut, dass wieder Leben in die Stadt kam.
Leider musste er das endlich wieder lebhafte Treiben hinter sich lassen. Er trat auf den ruhigeren Platz, der sich von der großen Madeleine-Kirche bis zum Palais de Justice erstreckte. Beim Anblick des mächtigen Gerichtsgebäudes sank Martin immer ein wenig das Herz. Sein Freund Merckx hätte zweifellos bemerkt, wie sehr die breite, anmaßende Fassade mit den acht riesigen Säulen dem Eingang der Bourse ähnelte, der Pariser Börse, wo die neuen Reichen ein Vermögen machten, indem sie die Arbeit der Armen ausbeuteten. Natürlich hatten die Erbauer des Palais de Justice von Aix einen weitaus nobleren Eindruck vermitteln wollen: Die Architektur des Gerichtshofs sollte zeigen, dass hier nach dem besten juristischen System der Welt Recht gesprochen wurde. Doch schon beim Betreten des Palais wurden dem Besucher bei jedem Schritt die sozialen Unterschiede offenbart. Die Vermögenden in ihren Kutschen fuhren direkt vor dem Haupteingang vor, den sie über eine schmale, kopfsteingepflasterte Auffahrt erreichten, die in einem Bogen hinter einer flachen Treppe vorbeiführte und den Privilegierteren vorbehalten war. Über ebenjene Treppe betraten die weniger betuchten Bürger von Aix das Gebäude. Die Mittelständigen und Armen mussten an den großen, sitzenden Statuen zweier berühmter Juristen vorbeigehen, die für alle Zeiten über sie und ihre Beschwerden ein steinernes Urteil fällten.
Heute jedoch waren weder Reiche noch Arme in den Palais berufen worden. Der öffentliche Eingang war in der Ferienzeit geschlossen, deshalb ging Martin zur Hintertür, wo ihn ein Gendarm ins Erdgeschoss einließ. Eine Treppe führte hoch zur grandiosen Eingangshalle, deren Pracht ebenfalls von einem Geltungsbewusstsein der Mächtigen zeugte, das wenig mit den egalitären Idealen der Dritten Republik zu tun hatte.
Der majestätische, offene Raum des zentralen Atriums war von einer zweistöckigen Säulenhalle umgeben. Die Gerichtssäle gingen zwischen den Säulen von der Hauptebene ab. Im zweiten Stock waren die Garderoben und Besprechungszimmer der Richter und Verteidiger untergebracht, ebenso die Büros der Amtsrichter. Martins Schritte klangen hohl, als er über den Marmorboden des Atriums auf die mächtige Treppe zuging. Wenn Verhandlungen stattfanden, musste er sich für gewöhnlich durch eine Masse von arroganten Juristen in schwarzen Roben kämpfen, die die Stufen hinauf- und hinunterrannten und durch das Atrium hetzten wie ein Schwarm krächzender, räuberischer Krähen. Martin hasste, wie sie offenkundig nur ihresgleichen zur Kenntnis nahmen und grüßten, während ihre Opfer – die ärmeren Mitbürger – ängstlich auf den Bänken vor den Gerichtssälen hockten und darauf warteten, dass sie verteidigt, angeklagt oder abgeurteilt wurden.
Martin hatte sich kaum von diesen düsteren Gedanken freigemacht, als ihm die Pflicht in der gebeugten, dünnen Gestalt seines Gerichtsschreibers entgegentrat. Der alte Joseph fing ihn auf der obersten Treppenstufe ab, um ihn vorzuwarnen, dass ihn Besuch erwarte. »Ein Mr Charles Westerbury, Monsieur«, flüsterte Joseph ihm ins Ohr. »Monsieur Franc hat ihn heute früh hergebracht.« Als Martin sich aufrichtete, sah er Franc im Gang stehen. Neben ihm auf der Bank saß ein Mann mit gebeugtem Kopf. Martins erster Verdächtiger.
Der Inspektor verließ den ihm Anvertrauten, eilte auf Martin zu und redete gleich oben an der Treppe auf ihn ein. »Ich habe ihn heute Morgen um acht gefunden, Herr. Hat da ganz ruhig beim Kaffee gesessen, mit der Dienstmagd der Toten. Er hat die Leiche gesehen. Er hat Anzeichen eines Schocks gezeigt, doch ich kann nicht sagen, ob das nur vorgetäuscht war oder nicht. Ich wollte ihn verhören, aber ich kriege nichts aus ihm heraus. Aber Sie sind ja auch ein gebildeter Mann, Monsieur Martin. Ich bin sicher, dass Sie besser mit so einem Herrn zurechtkommen.«
Während Franc noch auf ihn einredete, schaute Martin den Gang hinunter zu dem trauernden Verdächtigen, der seinen Blick erwiderte. Er versuchte sich zu erinnern, ob er Westerbury je mit Solange Vernet gesehen hatte.
»Soll ich bei der Befragung dabei sein, falls Widersprüche auftreten?«
»Nein«, antwortete Martin rasch. »Das wird nicht nötig sein.« Er war nicht auf die Unterstützung des Inspektors angewiesen, um seine Arbeit zu tun. Und falls doch, dann wollte er ihn das auf keinen Fall wissen lassen. »Haben Sie die Männer zum Steinbruch geschickt? Ist der medizinische Befund schon da?«
»Die Männer sind heute Morgen rausgefahren, und der Bericht liegt auf Ihrem Tisch. Riquel meint, dass sie höchstens seit einem Tag tot war.«
Martin nickte. Das deckte sich mit seinen Beobachtungen. Die Maden waren noch nicht überall in den aufgeblähten Leichnam von Solange Vernet eingedrungen. »Und die Beweisstücke?«, fragte Martin, ohne die Augen von dem Mann zu lassen, der vielleicht ihr Mörder war.
»Die bringe ich Ihnen später hoch. Ich wollte sie nicht bei mir tragen, während ich mit ihm ...« Der Inspektor deutete mit dem Kopf zu Westerbury.
»Ja, richtig. Gute Idee.« Franc war voll von guten Ideen. Martin musste sich anstrengen, wenn er ihm einen Schritt vorausbleiben wollte. Er holte tief Luft. Jetzt war er an der Reihe. »Also gut«, sagte er, »wir unterhalten uns später.«
Sogar der starrsinnige Franc hätte begreifen müssen, dass er damit entlassen war, doch er gab Martin noch einen letzten guten Rat. Mit gesenkter Stimme sagte er: »Monsieur, vergessen Sie nicht, ihn nach dem Geld zu fragen. Die beiden haben wie die Könige gelebt.« Dann legte er mit einer kurzen militärischen Geste die Hand an seine Kappe und ging die Treppen hinunter.
Während sie sich unterhalten hatten, war der alte Joseph zu Westerbury getreten. Der Kopf des Schreibers mit dem spärlichen, zerzausten weißen Haar bewegte sich auf und ab, als er dem Verdächtigen etwas erklärte. Als Martin die Tür zu seinem Räumen öffnete, stand der Engländer auf und begrüßte ihn. Sie starrten einander einen kurzen Moment lang an. Konnte es sein, dass dieser Mann die schöne Solange Vernet erwürgt und erstochen hatte? Martin senkte den Blick, um die Aufregung und den Abscheu zu verbergen, der ihn plötzlich ergriff.
Er forderte Westerbury auf, ihm in seine Räume zu folgen, und bat ihn, auf einem der beiden Holzstühle Platz zu nehmen, die vor dem großen Mahagoni-Schreibtisch standen. Auf dem Weg zu seinem Stuhl hinter dem Tisch ging Martin an der Regalwand mit den Gesetzesbänden vorbei, während der alte Joseph an einem kleinen Tischchen in einer Wandnische Platz nahm. Der Schreiber saß mit dem Rücken zu dem Verdächtigen und war nach wenigen Augenblicken zur Mitschrift bereit. Martin dagegen ließ sich Zeit; er nahm seinen Federhalter heraus, dann die Tinte, dann Papier, und er blätterte durch die Dokumente auf seinem Schreibtisch. Natürlich war das alles Schauspielerei. Selbst, wenn er hätte lesen wollen, was Dr. Riquel geschrieben hatte, war er dazu nicht in der Lage. Die Worte des medizinischen Berichts verschwammen vor seinen Augen. Mit seiner vorgetäuschten Ruhe wollte er Westerbury zeigen, wer das Ruder in der Hand hielt, außerdem brauchte er Zeit, um sich zu überlegen, wie er die Befragung beginnen sollte.
Als er hochschaute, starrte Westerbury ausdruckslos an ihm vorbei durch das große Fenster auf den Platz vor dem Palais. Von der Stelle, wo der Engländer saß, konnte er draußen kaum etwas erkennen. Er hatte die Beine übergeschlagen, die Hände lagen auf dem Knie. Womöglich wollte er mit dieser Pose einen gleichgültigen Eindruck vermitteln, doch seine leicht zitternden Finger verrieten, wie nervös er war.
Westerburys Kleidung – ein grauer Gehrock und ein dazu passender Zylinder, den er neben sich auf den zweiten Stuhl platziert hatte – ließ vermuten, dass der Professor einmal so etwas wie ein Dandy gewesen sein mochte, vielleicht sogar ein Frauenheld. Doch nun sah er gewöhnlich aus, fast schäbig. Er war überdurchschnittlich groß, seine Haut war hell wie bei den meisten Engländern, er hatte schütteres grau-blondes Haar und wässrige blaue Augen. Bei der morgendlichen Festnahme hatte sich der Knoten seines zerknitterten, gestreiften Seidenhalstuchs gelöst, was den vernachlässigten Eindruck noch unterstrich. Keine Spur von Elan, kein leidenschaftliches Funkeln in den Augen. Martin würde den Liebhaber von Solange Vernet aufrütteln müssen, wenn er irgendetwas von ihm erfahren wollte. Also sorgte er dafür, dem Rat seiner Juraprofessoren folgend und trotz den nervösen Beklemmungen in seiner Brust, dass der Verdächtige sich wohl fühlte.
»Mr Westerbury«, begann er und ließ eine kultivierte Besorgnis in seiner Stimme anklingen, »sind Sie vertraut mit dem französischen Rechtssystem?«
»Ich bin nicht sicher, was Sie meinen.« Der Engländer sprach sehr leise, er öffnete kaum die Lippen.
»Dann möchte ich es Ihnen gerne erklären. Meine Position wird in unserer Sprache als Untersuchungsrichter bezeichnet. In Ihrer Heimat«, fuhr Martin langsam in Englisch fort, »entspricht das einem ›examining magistrate‹. Monsieur Gilbert«, er deutete auf den gebeugten Rücken des alten Joseph, »ist mein Schreiber. Er wird unser Gespräch protokollieren, und ich selbst werde mir auch Notizen machen. Das Protokoll wird Ihnen später vorgelegt.« Westerburys Blick war immer noch auf etwas Unsichtbares hinter Martins linkem Ohr gerichtet. Ihm blieb nichts anderes übrig, als weiterzumachen. Er räusperte sich. »Bei der Untersuchung eines gewaltsamen Todesfalls sprechen Sie immer zuerst mit jemandem wie Inspektor Franc, den Sie ja heute Morgen kennengelernt haben. Normalerweise werden Sie dann vom Staatsanwalt befragt. Doch da wir uns mitten in der Sommerpause befinden«, sagte er mit einem Achselzucken, das hoffentlich den Eindruck vermittelte, dass sie beide über solchen Formalien standen, »überspringen wir diesen Zwischenschritt. Sie würden am Ende auf jeden Fall mit mir oder einem meiner Kollegen sprechen müssen. Zu unseren Aufgaben gehört es, Zeugenaussagen zu Protokoll zu nehmen, die Beweise zu überprüfen und zu entscheiden, ob der Fall zur Verhandlung kommt – was hier mit Sicherheit geschehen wird. Wir stellen aus allen Beweisen eine offizielle Akte zusammen und entscheiden, wer des Verbrechens beschuldigt wird. Sollte das Gericht zu dem Schluss kommen, dass der Mord geplant war, dann wird der Mörder mit dem Tod durch die Guillotine bestraft. Sollten wir allerdings feststellen, dass es sich lediglich um ein Verbrechen aus Leidenschaft –«
»Good God!«, stieß Westerbury auf Englisch hervor. Martin war sich nicht sicher, ob der Ausbruch vorgetäuscht war oder ob der Mann wirklich so naiv war und erst in diesem Moment erkannte, dass er ein Hauptverdächtiger war. Doch zumindest hatte er jetzt die Aufmerksamkeit des Engländers.
»Ja, natürlich, entschuldigen Sie«, sagte Martin. »Sie haben heute Morgen einen furchtbaren Schock erlitten. Geht es Ihnen besser?«
»Die Frau, die ich liebe, ist ermordet und verstümmelt worden. Natürlich stehe ich noch unter Schock.« Der Engländer sprach ein präzises, stockendes Französisch. Eine Ader, die von seinem Nacken bis zur Stirn verlief, war vor Empörung angeschwollen. »Machen Sie weiter. Bringen wir das so schnell wie möglich hinter uns.«
»Selbstverständlich.« Martin entkorkte sein Tintenfläschchen, überlegte kurz, dann blickte er zu Westerbury auf. »Beginnen wir mit Ihnen. Dürfte ich Ihre Papiere sehen?«
Der Engländer zog eine dünne, lederne Brieftasche aus der Hosentasche und nahm ein zerschlissenes Dokument heraus. Er erhob sich und reichte alles Martin. Der Ausweis bestätigte, dass Charles William Westerbury im Jahre 1845 in Liverpool geboren war. Beruf: Geologe. Ausreisedatum: März 1875. Als einziger weiterer Wohnsitz in Frankreich war eine Adresse in Paris angegeben. Martin nahm die Ausweiskarte des Engländers an sich und gab Westerbury die Brieftasche zurück. »Den Ausweis muss ich einziehen«, erklärte Martin, »bis die Untersuchung beendet ist.«
»Dafür gibt es keinen Grund. Ich werde nirgendwo hingehen, bis Sie den –«
Martin ignorierte den Einwurf und forderte den Engländer mit einer Handbewegung auf, sich wieder zu setzen. Sogleich merkte er, dass dies sein erster Fehler gewesen war. Westerbury gehorchte, aber die überkreuzten Arme und der wütende Zug um seinen Mund verrieten deutlich, dass er Martins gedankenlose Abweisung als Beleidigung auffasste. Wohl fühlte sich dieser Verdächtige bestimmt nicht mehr. Martin ermahnte sich, dass die meisten Zeugen in diesem außergewöhnlichen Fall nicht so bescheiden und gefügig sein würden wie die Menschen, die sich normalerweise in seinen Räumen einfanden. Er musste mit Bedacht vorgehen.
»Mr Westerbury«, begann er erneut, »haben Sie Geologie in Oxford oder Cambridge studiert?«
»Nein, nicht direkt.«
»Dann an einer anderen englischen Universität.«
»Nein. Ich habe mir mein Wissen zum größten Teil selbst angeeignet.«
Martin bemühte sich, keinerlei Reaktion zu zeigen, doch diese Information schien Francs Anschuldigung zu bestätigen: Der Engländer war ein Scharlatan.
»Aber«, fügte Westerbury rasch hinzu, »ich habe die Vorträge des berühmten Lyell gehört. Ich habe Darwin studiert. Ich versichere Ihnen, dass ich weiß, worüber ich rede.«
»Dennoch steht ›Professor‹ auf Ihren Ankündigungen.«
»Ich dachte, wir untersuchen hier den Mord an Solange.« Ein selbstgerechter Ton schlich sich in seine Stimme.
»Das ist richtig. Aber Sie haben in der Stadt einen ziemlichen Wirbel verursacht. Und ich nehme an, Sie haben auch in Paris Vorträge gehalten.«
»Ich stamme vielleicht nicht aus der Oberschicht, Monsieur le juge, dennoch bin ich der festen Überzeugung, dass ich etwas Wichtiges zu den großen Debatten unserer Zeit beitragen kann.« Während er sprach, beugte Westerbury sich nach vorn und betonte Martins Titel mit unnötigem Sarkasmus. Dann lehnte er sich wieder zurück und fuhr fort: »Und Solange wollte mir dabei helfen.«
»Lassen Sie uns darüber später sprechen«, sagte Martin ruhig und bemühte sich, seine Irritation nicht zu zeigen. Falls der Engländer noch öfter eine solche Arroganz an den Tag legte, dann konnte Martin seine wachsende Abneigung gegen den Verdächtigen bald nicht mehr verbergen. »Wenn Sie mir im Moment nur genau erklären möchten, was genau Sie zu diesen Debatten beitragen wollen?«
»Ich werde beweisen, dass sich die Erkenntnisse von Wissenschaft und Religion nicht widersprechen, sondern im Gegenteil im Einklang miteinander stehen.«
Wenn es weiter nichts ist, dachte Martin, äußerte sich jedoch nicht dazu. Er wartete einen Augenblick, ob Westerbury noch etwas hinzufügen wollte. Doch offenbar war der Engländer der Ansicht, dass die Verkündung seines hehren Ziels keiner Erklärung bedurfte.
»Mr Westerbury, darf ich fragen, warum Frankreich? Warum lehren Sie nicht in Ihrem eigenen Land?« Martin versuchte, keinen ironischen oder vorwurfsvollen Ton in die Frage zu legen. Er wollte nicht, dass sein Verdächtiger sich ihm verschloss.
Doch es war wohl nicht zu vermeiden. Bedeutende Wissenschaftler mussten für gewöhnlich nicht ihr Heimatland verlassen und ihre Erkenntnisse in fremden Städten anpreisen. Westerburys Haltung veränderte sich, er blickte Martin direkt ins Gesicht, als wolle er ihm deutlich machen, dass er willens sei, voll und ganz zu kooperieren. »Wie Sie schon bemerkten, habe ich nicht die besten Schulen besucht. Ich bin Autodidakt, kein Gentleman-Forscher aus guter Familie. Mir stand nie Familienvermögen zur Verfügung, mit dem ich meine Studien hätte finanzieren können. In England ist ein Mann, der die großen Werke der britischen Geologie kennt, keine Besonderheit. Hier in Frankreich dagegen schon. Hier kann ich von meinen Vorträgen leben und dabei das tun, was ich liebe.
»Und um offen zu sprechen«, fuhr er fort, »meine Arbeit ist hier vielleicht noch notwendiger als in meinem Land. Ihre Frauen scheinen mir fast Angst vor den Wissenschaften zu haben. Vor der Natur. Es liegt daran, wie sie erzogen werden, nichts außer Näharbeiten und der Katechismus. Und die Angst vor Sünde und Tod, sogar vor dem Leben, geben sie an ihre Kinder weiter. So wird der Fortschritt zurückgehalten, wissenschaftliches Denken verhindert. Darum biete ich meine Kurse für Frauen an, genau wie für Männer. Auch das schöne Geschlecht soll verstehen, dass die Natur eine Wohltäterin ist.«
Das Bild der in Stein gehauenen, zur Sünde verführenden, weltlichen Frau ging Martin durch den Kopf, ebenso das so viel lebendigere Bild von Solange Vernet, als die Fliegen im Steinbruch ihren leblosen Körper umschwirrten. Eine Wohltäterin? Wie konnte Westerbury das noch glauben, nachdem er die Leiche seiner Geliebten gesehen hatte?
»Und Aix? Was hat Sie hierher geführt?« Martin bemühte sich, ruhig und leise zu sprechen und seine Gefühle nicht zu verraten.
»Eigentlich zwei Dinge. Der große Geologe Monsieur Charles Lyell arbeitete als junger Mann in der Umgebung von Aix. Ich wollte diese Arbeiten fortführen und weiterentwickeln. Und dann suchten wir – Solange und ich – einen Ort, an dem wir neu anfangen konnten.«
Martin notierte dies und unterstrich die Worte neu anfangen. Seine Handfläche war heiß und feucht, so dass sie fast am Papier kleben blieb. Er hätte gerne das Fenster geöffnet, ließ es dann aber doch geschlossen. Sicher vertrug Westerbury die Hitze noch weniger als er selbst. Martin legte den Federhalter aus der Hand und lehnte sich zurück, eine Haltung, die, wie er hoffte, intellektuelle Neugier ausdrückte und den Verdächtigen dazu brachte, dass er ihm noch mehr über sich erzählte.
»Dieser Lyell – verzeihen Sie, aber ich versuche, das alles zu verstehen –, ist er ein Anhänger von Darwin?«
»Nein, nein, ganz im Gegenteil. Es wäre angemessener, Darwin als einen Anhänger von Lyell zu bezeichnen. Die Lektüre von Lyells Prinzipien hat Darwin dazu inspiriert, sein Ursprung der Arten zu verfassen. Obwohl ich sagen muss, dass Darwin in seinen letzten Jahren Lyell nicht mehr ganz so würdigte, wie er es verdiente.« Diese Tatsache schien Westerbury wütend zu machen.
»Und was hat nun Darwin von Lyell gelernt?«
»Hören Sie, ist das wirklich notwendig – oder relevant für diese Untersuchung?« Westerbury legte die Hände übereinander und schaute Martin ungeduldig an.
»Um ganz ehrlich zu sein, im jetzigen Stadium der Untersuchung ist es schwierig vorherzusagen, was später relevant sein könnte. Vielleicht hat sich jemand über Ihre Vorträge geärgert.« Martin glaubte das nicht wirklich, doch hier ging es nicht um seine Glaubwürdigkeit, sondern darum, inwieweit sie Westerburys Aussagen Glauben schenken konnten. Und ob der Engländer sich mit einiger Berechtigung als Wissenschaftler bezeichnen konnte oder nicht.