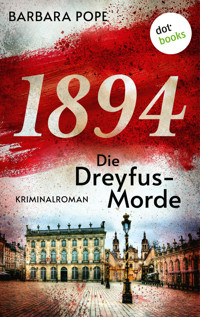
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Bernhard Martin ermittelt
- Sprache: Deutsch
Eine Stadt zwischen Furcht und Hass: Der historische Kriminalroman »1894 – Die Dreyfus-Morde« von Barbara Pope jetzt als eBook bei dotbooks. Nancy, 1894: Um die schrecklichen Ereignisse seiner letzten Ermittlungen hinter sich zu lassen, zieht der Untersuchungsrichter Bernard Martin mit seiner schwangeren Frau in das lothringische Nancy. Doch schon kurz nach ihrer Ankunft erschüttert ein schrecklicher Mord die Stadt: Ein Säugling wird tot aufgefunden, der kleine Körper ausgeweidet. Die Mutter des Kindes ist überzeugt, dass »ein Jude« die Gräueltat begangen hat, und hetzt ihre Mitbürger zunehmend gegen die Minderheit auf. Während Martin versucht, gegen die Welle aus Hass und Gewalt anzukämpfen, die über Nancy hereinzubrechen droht, wird ein jüdischer Fabrikant auf brutale Weise ermordet. Ein gewaltsamer Racheakt – oder Teil eines eiskalten Plans? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Frankreich-Krimi »1894 – Die Dreyfus-Morde« von Barbara Pope wird alle Fans von Niclas Natt och Dag und Alex Beer begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 589
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Nancy, 1894: Um die schrecklichen Ereignisse seiner letzten Ermittlungen hinter sich zu lassen, zieht der Untersuchungsrichter Bernard Martin mit seiner schwangeren Frau in das lothringische Nancy. Doch schon kurz nach ihrer Ankunft erschüttert ein schrecklicher Mord die Stadt: Ein Säugling wird tot aufgefunden, der kleine Körper ausgeweidet. Die Mutter des Kindes ist überzeugt, dass »ein Jude« die Gräueltat begangen hat, und hetzt ihre Mitbürger zunehmend gegen die Minderheit auf. Während Martin versucht, gegen die Welle aus Hass und Gewalt anzukämpfen, die über Nancy hereinzubrechen droht, wird ein jüdischer Fabrikant auf brutale Weise ermordet. Ein gewaltsamer Racheakt – oder Teil eines eiskalten Plans?
Über die Autorin:
Barbara Pope wurde 1941 in Cleeveland/Ohio geboren. An der Columbia University promovierte sie in Europäischer Geschichte und unterrichtete viele Jahre an Universitäten in Amerika und Europa, wobei sie sich immer mit Frauen in der Geschichte beschäftigte und für den Feminismus einsetzte. Seit ihrem Ruhestand schreibt Barbara Pope Romane, für die sie in zahlreichen Kritiken gelobt wurde.
Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin ihre historischen Kriminalromane »1885 – Die Cézanne-Affäre« und »1894 – Die Dreyfus-Morde«.
***
eBook-Neuausgabe September 2023
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2010 unter dem Originaltitel »Blood of Lorraine« bei Pegasus Books, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2010 unter dem Titel »Jakobsblut« bei Ullstein, Berlin.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2010 by Barbara Corrado Pope
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2010 Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Leonid Andropov, inxti, artjazz
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98690-806-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Dreyfus-Morde« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Barbara Pope
1894 – Die Dreyfus-Morde
Kriminalroman
Aus dem Amerikanischen von Uta Rupprecht
dotbooks.
Für Daniel und für Stephanie, die ein wahrer avocat ist
Die Juden in Elsass-Lothringen haben sich Schritt für Schritt nach oben gearbeitet, aus dem Dorf in die Kleinstadt, aus der Kleinstadt in die große Stadt; vom Kleinhandel über Ladengeschäfte zur großen Geschäftswelt ... Das brauchte Zeit und Geduld. Schließlich zettelten sie das entscheidende Ereignis an – den Krieg von 1870–71 –, und zwanzig Jahre später war Nancy ein Klein-Jerusalem geworden, mit Tausenden und Abertausenden von Juden aus Lothringen, dem Elsass, Polen und Russland.
Abbé François Hémonet, Nancy-Juif(Das jüdische Nancy), 1892–93
HISTORISCHE VORBEMERKUNG
Am 22. Dezember 1894 sprach ein nicht-öffentliches Militärtribunal den Hauptmann Alfred Dreyfus des Landesverrats schuldig und verurteilte damit den ersten jüdischen Offizier im französischen Generalstab zu einem Leben in Verbannung auf der Teufelsinsel. 1898 brach der immer heftiger werdende Streit um seine Schuld oder Unschuld offen aus, die berühmte Dreyfus-Affäre entzweite das Land. Nachdem sich die Beweise häuften, dass Dreyfus nicht der Offizier war, der militärische Geheimnisse an die Deutschen weitergegeben hatte, waren seine Unterstützer der Meinung, nichts weniger als der Fortbestand Frankreichs als einer Nation der Rechtsstaatlichkeit, Gerechtigkeit und Gleichheit stehe auf dem Spiel.
Dreyfus war ebenso sehr ein Opfer von Vorurteilen wie das eines Femegerichts. In den letzten zwei Jahrzehnten des 19. Jahrhundert erfasste, angefeuert von Hetzjournalisten und Édouard Drumonts enormem Bestseller La France Juive (Das jüdische Frankreich), ein neuer unterschwelliger Antisemitismus bestimmte Teile der Bevölkerung. Dabei richtete sich dieser Hass gegen weniger als ein Prozent der Bewohner des Landes.
Die französischen Juden (oder Israeliten, eine Bezeichnung, die viele von ihnen damals bevorzugten) waren stets auf einige wenige, über das Land verteilte Gegenden konzentriert. Die bevölkerungsreichste jüdische Gemeinde lebte traditionell in Elsass-Lothringen, dessen überwiegender Teil 1871 den Deutschen überlassen werden musste. Nancy, die größte noch bei Frankreich verbliebene Stadt, wurde zur Hauptstadt der Region, Sitz der Verwaltung und künstlerisches und wirtschaftliches Zentrum. Zu Beginn des Romans im November 1894 war es auch der Mittelpunkt des jüdischen Lebens in diesem Landesteil, obwohl von den etwa 90 000 Bürgern der schnell wachsenden Stadt nur 2000 Israeliten waren.
KAPITEL 1
Freitag, 16. November
Die Stadt Nancy im Jahr 1894. Vierundzwanzig Jahre nachdem sich Frankreich mitten in einem Krieg zur Republik erklärt hatte. Dreiundzwanzig Jahre nach der demütigenden Niederlage, der Besatzung und dem Verlust der alten Gebiete Elsass und eines Teils von Lothringen an das neue, mächtige Deutschland. Und nur zwei Jahre nachdem der Untersuchungsrichter Bernard Martin aus Aix-en-Provence in diese elegante Stadt in der gestutzten Nordostecke seines geliebten Vaterlandes versetzt worden war.
Martin ordnete seine Unterlagen zu Stapeln, ehe er ins Wochenende aufbrach. In seinem Richterzimmer mit den weißgetünchten Wänden wurde es bereits kalt. Die halbverborgenen Flammen im schwarzen Kanonenofen in der Ecke flackerten nicht mehr, aus der Öffnung drang nur noch ein sanfter bernsteinfarbener Schein. Während die gedämpften Schritte der Beamten und Angestellten durch Martins Erdgeschossfenster zu hören waren, genoss er eine für ihn noch immer unerwartete und erfreuliche Zufriedenheit. Er würde jetzt nach Hause gehen.
Plötzlich flog die Tür seines Zimmers auf, und sein Kollege David Singer stürmte herein, atemlos und außer Fassung. »Sie müssen mir diesen Fall abnehmen«, rief er laut.
»Singer, können Sie nicht anklopfen?«, entschlüpfte es Martin unwillkürlich. Es war nicht als Zurechtweisung gemeint, er war vor allem erschrocken. Singer war vermutlich der höflichste Mensch im ganzen Gerichtsgebäude, von ihm hätte man einen solchen Bruch der Etikette am wenigsten erwartet. Und dennoch stand er jetzt unangemeldet vor Martin, keuchend, mit aufgeknöpftem Gehrock und verrutschter Krawatte, und sein kurzgeschnittenes schwarzes Haar stand in Büscheln in die Höhe, als hätte er versucht, es sich auszureißen. Martin wies auf den Holzstuhl neben seinem verstörten Kollegen. »Bitte setzen Sie sich doch.«
Singer beachtete die Geste nicht. »Den ganzen Nachmittag habe ich darüber nachgedacht. Ich bin mir sicher, sie haben ihn mir gegeben, um sich über mich lustig zu machen. Jetzt haben sie endlich die Chance, mich zu erwischen.«
Martin trat auf seinen Freund zu und betrachtete ihn genauer. Eine von Singers sorgsam manikürten Händen war zur Faust geballt, die andere umklammerte eine gerollte Zeitung. »Bitte setzen Sie sich«, wiederholte Martin und bemühte sich, ruhig zu bleiben. Singers Verhalten machte ihn allmählich nervös.
Als sein Kollege nicht antwortete, ging Martin an ihm vorbei und schloss vorsichtshalber die Tür. Auch wenn er fast sicher war, dass die Richter und Gerichtsangestellten bereits nach Hause gegangen waren, wollte er doch dafür Sorge tragen, dass niemand Singer in diesem Zustand sah.
»Was ist denn passiert?«, fragte Martin eindringlich.
Mit erstickter Stimme flüsterte Singer: »Angeblich ein Fall von Ritualmord.«
»Was?« Martins Verwirrung wandelte sich in Abscheu. Er ging zu seinem Schreibtisch zurück und sah seinen Freund an.
»Ein Ritualmord.« Diesmal sprach Singer lauter. »Eine Bezichtigung, ein Jude habe einen christlichen Säugling getötet und verstümmelt.«
»Aber das ist lächerlich! So etwas passiert doch nicht –«
»Wollten Sie ›nicht mehr‹ sagen?«
»Wie meinen Sie das?« Martin war es ein Rätsel, warum Singer ausgerechnet bei ihm so empfindlich reagierte.
»So etwas passiert nicht mehr. Nicht im Jahr 1894. Nicht im dritten Jahrzehnt unserer glorreichen französischen Republik.«
»Nein, nein, überhaupt nicht.« Martin fürchtete, dass auch er im nächsten Moment laut werden würde.
»Ich sage Ihnen, diesen Fall haben sie mir gegeben, um mir eine Falle zu stellen. Sie wollen mich austricksen.«
»Das verstehe ich nicht.«
»Das verstehen Sie nicht«, gab Singer in sarkastischem Tonfall zurück. »Ich heiße Singer. David Singer.«
»Nun, ich dachte nie, dass das eine Rolle spielt –«
»Bestimmt haben Sie das nie gedacht«, unterbrach ihn Singer und trat einen Schritt von Martins Schreibtisch zurück. »Übernehmen Sie den Fall? Das ist alles, was ich wissen will.« Er legte die Zeitung ab und begann, seinen Kragen und die Manschetten zurechtzuziehen, um seine Kleidung wieder zu ordnen.
Martin starrte seinen Kollegen an. In einem Winkel seines Hirns war ihm durchaus bewusst gewesen, dass Singer Israelit war. Aber ihm war nie der Gedanke gekommen, dies könnte von Bedeutung sein. Seit Singer Martin kurz nach seiner Ankunft so zuvorkommend das Gerichtsgebäude gezeigt hatte, waren sie Freunde. Beide waren Mitte dreißig, sie ähnelten sich in Größe und Gewicht – jeweils durchschnittlich – und auch in ihren politischen Sympathien und Idealen. Sie waren beide leidenschaftliche Republikaner.
Martin war Singer besonders dankbar, dass dieser auf sein frühes Eingeständnis, er sei nicht wohlhabend und mit einer Lehrerin verheiratet, nicht abwehrend reagiert hatte – genauer gesagt, eigentlich gar nicht. Statt verächtlich auf ihn herabzublicken, hatte Singer den Martins Hilfe bei der Suche nach einer preiswerten Wohnung angeboten und tatsächlich eine gefunden, mitten in Nancy und in der Nähe des Justizpalastes und der Schule von Clarie. Die Wohnung habe sogar fließendes Wasser, hatte Singer mit einem stolzen Lächeln verkündet, eine notwendige Erleichterung, wenn eine Frau arbeiten gehe. Würde sein Kollege nicht solchen Wert auf Formalitäten legen, dann wäre Martin längst dazu übergegangen, ihn mit seinem Taufnamen anzusprechen.
Aber natürlich war David, dachte Martin erschrocken, nicht Singers Taufname.
Singer zwirbelte die Enden seines kohlschwarzen Schnurrbarts, der auf jeder Seite des Mundes leicht erhöht und spitz auslief. »Es ist keine schwierige Sache«, fuhr er fort. »Ein Arbeiter und seine Frau bringen die Beschuldigung vor. Eine einzige Zeugin, die Amme. Sie lügen alle.«
Singers Bart war äußerst akkurat geschnitten, vermutlich ließ er ihn jeden Morgen trimmen. Ein Mann, der stets so gut gekleidet war und von jedem im Gerichtsgebäude respektiert und mit ausgesuchter Höflichkeit behandelt wurde, hatte eigentlich keinen Grund, so empfindsam zu sein. Dennoch ertappte sich Martin dabei, dass er unbewusst Singers Nase betrachtete, die allerdings in keiner Weise auffällig war.
Ihre Blicke trafen sich, und Singer wurde förmlich: »Ich kann Ihnen die Akte gleich am Montagmorgen vorbeibringen. Es wird Sie nicht viel Zeit kosten.«
»Darum geht es nicht«, murmelte Martin.
»Worum dann?« Singer, der seine Enttäuschung kaum verbergen konnte, griff wieder nach seiner Zeitung.
Wie hätte Martin ihm gestehen können, dass er in diesem Augenblick einen Anflug von Angst verspürte? Singers Ausbruch hatte in ihm die Erinnerung an einen Fall geweckt, zu dem er zu Beginn seiner Laufbahn ähnlich eilig gerufen worden war und der ihn bei der Polizei und unter den Richtern in Aix-en-Provence zum Geächteten gemacht hatte. Die Vernet-Morde. Er schüttelte leicht den Kopf, um die Vision dieser Leichen zu vertreiben.
»Sie lehnen ab? Nachdem wir so oft über Gerechtigkeit gesprochen haben? Vielleicht können Sie hier die Ungerechtigkeit nicht erkennen.« Singer ging zur Tür.
Martin seufzte. »Warten Sie. Ich sollte wohl erst mit dem Proc darüber sprechen.« So bezeichnete jedermann den Procureur, den Oberstaatsanwalt, der den Untersuchungsrichtern die Fälle zur Ermittlung zuteilte.
»Natürlich«, pflichtete ihm Singer bei. »Und möglichst schnell.«
»Vielleicht sehe ich ihn heute Abend –«
Singer fuhr dazwischen: »Ich bin nicht eingeladen. War ich noch nie.«
»Nun, das ist auch für uns das erste Mal. Ich kann nicht sagen, dass ich mich besonders darauf freue.« Der Gerichtspräsident hatte zwei Jahre gebraucht, bis er Clarie und ihn zu einem offiziellen Diner lud. Martin versuchte, sich zu erinnern, wie lange Singer schon am Gericht von Nancy arbeitete.
»Ich bin aber schon zwei Jahre länger hier als Sie«, sagte Singer, als könnte er Martins Gedanken lesen.
Aufgebracht zuckte Martin mit den Schultern. »Ich habe in Ihnen immer nur den Franzosen gesehen, einen überzeugten Republikaner –«
»Auch ein französischer Jude ist Franzose und Republikaner.« Wenigstens hatte Singer kehrtgemacht und trat nun wieder vor Martins Schreibtisch.
»Ja, ich weiß.«
»Das wissen Sie? Lesen Sie die Zeitung, die Édouard Drumont herausgibt, La Libre Parole?«
Martin hob die Hand, um jeden Verdacht von sich zu weisen, er würde Drumonts antisemitisches Schmutzblatt auch nur anfassen. La Libre Parole – »das freie Wort« im wahrsten Sinne.
»Vielleicht würden Sie es anregend finden.« Singer entrollte die Zeitung, die er in der rechten Hand gehalten hatte. »Das ist die wöchentliche Ausgabe, durchgehend illustriert.«
Martin blieb nichts anderes übrig, als die Titelseite von La Libre Parole Illustrée vom vergangenen Samstag, dem 10. November, zu studieren. Den größten Teil der Seite nahm die Zeichnung eines bärtigen Mannes ein, der neben einem Stapel Bücher stand. Martin kniff die Augen zusammen. Den ersten Titel konnte er lesen: Drumonts skurriler und unglaublich erfolgreicher Bestseller La France Juive, das »jüdische Frankreich«. Martin holte tief Luft. »Also das ist Drumont.«
»Ja, und das.« Singer deutete auf den kleinen Mann, der unten an der Seite entlangkroch, die Karikatur eines Juden mit einer riesenhaften Hakennase und dem Helm der preußischen Armee. Mit einer langen Zinke hatte Drumont diesen Miniatursoldaten am Hosenboden aufgespießt. »Sie wissen natürlich, wer das ist«, bemerkte Singer eindringlich.
»Singer, ich kann lesen«, gab Martin ungeduldig zurück. Die Bildunterschrift ließ keinen Zweifel, worauf die Zeichnung anspielte: »Was den Judas Dreyfus angeht: Franzosen, das sage ich euch seit acht Jahren jeden Tag.«
»Erst La France Juive und jetzt dieses Blatt«, schrie Singer zornig. »Sie wissen, dass es Drumont war, der die Geschichte von Dreyfus’ Verrat aufgebracht hat. Er genießt es jede Sekunde.«
Martin, der noch immer die Karikatur anstarrte, nickte nur. Alfred Dreyfus, beschuldigt, militärische Geheimnisse an die Deutschen verkauft zu haben, fand sich in allen Zeitungen. Martin fragte sich, wie Dreyfus eigentlich wirklich aussah. Da er es geschafft hatte, in den elitären Generalstab der Armee aufzusteigen, glich er sicherlich in keiner Weise dieser hässlichen Karikatur.
»Sehen Sie denn nicht«, beschwor ihn Singer, »sie wollen durch Dreyfus beweisen, dass wir alle Verräter und Betrüger sind.«
Martin machte einen letzten Versuch, seinen Freund zu beruhigen. »Selbst wenn es wahr wäre und Dreyfus mit den Deutschen zu tun hatte, dann ist er doch nur ein Einzelner und nicht gleich das ganze Volk. Gewiss ...« Er beendete den Satz nicht. Gewiss was? Wenn Drumont und seinesgleichen gegen Dreyfus die Trommel rührten, bestand dann nicht die Gefahr, dass sie den Mob gegen die Israeliten aufhetzten? Martin ließ sich in seinen Stuhl sinken.
»Ich finde, Sie sollten La France Juive lesen«, drängte ihn Singer. »Sie ahnen gar nicht, was für widerliche Dinge Drumont darin über uns verbreitet. Und jetzt verleumdet er uns in seiner Zeitung, zieht uns durch den Schmutz, jeden Tag. Jeden einzelnen Tag. Sie können sich wirklich glücklich schätzen, dass Sie sich über so etwas keine Sorgen zu machen brauchen.«
Martin spürte, wie ihm die Hitze in den Kopf stieg. Warum stand eigentlich er im Sperrfeuer? Er hatte sich doch immer als wahrer Republikaner gezeigt. Kaum aus der Schule, hatte er den Kontakt zur Kirche abgebrochen, teilweise wegen der antisemitischen Kanzelreden seines Gemeindepfarrers. Martin verdiente diese Strafpredigt nun wirklich nicht. Er machte sich wieder daran, die Unterlagen auf seinem Schreibtisch zu ordnen.
»Bitte entschuldigen Sie«, sagte Singer und trat näher. Offenbar hatte er endlich begriffen, dass Martin nicht zu den bigotten Hetzern und Aufrührern gehörte. »Ich bin durcheinander. Gerade war ich bei der Leichenschau dieses armen Kindes. Sie können sich nicht vorstellen, was manche Menschen anstellen, um zu beweisen, dass wir wilde Tiere sind.« Er hielt inne. »Bernard, Sie sind der Einzige, an den ich mich wenden kann, der Einzige, dem ich vertraue.«
Dieser Appell an ihre Freundschaft gab schließlich den Ausschlag, die Tatsache, dass er Martin mit seinem Vornamen ansprach und die Förmlichkeiten ihres Berufs und seinen ausgeprägten Sinn für gutes Benehmen beiseiteschob.
Martin presste die Lippen aufeinander und nickte. »Ich werde es versuchen.« Was hatte er denn schon zu verlieren? Wenn Singer recht hatte und es sich um den leicht zu klärenden Fall einer falschen Bezichtigung handelte, dann war das in keiner Weise mit dem Fall Vernet zu vergleichen.
Oder vielleicht doch? Martin lehnte sich in seinem Stuhl zurück und erinnerte sich. Unter all den Toten in Aix gab es einen, den Martin niemals vergessen konnte, und das war die wachsbleiche Gestalt seines ältesten Freundes Jean-Jacques Merckx, aufgebahrt auf dem grauen Steintisch wie ein anarchistischer Christus mit vier Löchern im Körper. Nicht von Nägeln gebohrt, sondern von Kugeln. Ein Freund, den er im Stich gelassen hatte, weil er seine radikalen Ideen ablehnte, ein Freund, der zum Teil auch deshalb getötet worden war, weil Martin unentschieden und halbherzig gehandelt hatte. Er hatte ihm weder nachdrücklich dabei geholfen, aus der Armee zu desertieren, noch darauf bestanden, dass sie beide dem Gesetz gehorchten und Merckx zurückkehrte, um sich seiner grausamen Bestrafung zu stellen. Ein Freund, der ihm – genau wie Singer soeben – Selbstgefälligkeit und mangelndes Verständnis für das, was er durchmachte, vorgeworfen hatte. Martin schüttelte heftig den Kopf, um sich in die Gegenwart zurückzuholen. Die jetzige Situation war völlig anders. Singers Ansichten waren in keiner Weise gefährlich oder unpatriotisch. Er träumte nicht wie Martins Kindheitsfreund davon, den Staat zu zerstören. Nein, Singer war genau wie Martin jemand, der sich am Aufbau beteiligte. Sie glaubten beide fest an die französische Republik und waren bemüht, sie stärker und besser, weniger korrupt und gerechter zu machen. Sie ähnelten sich in so vieler Hinsicht. In jedem Punkt, der wirklich zählte.
Singer stand vor ihm und wartete auf seine Zusage. Martin nickte. »Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um Didier heute Abend zu fassen zu kriegen. Aber erst«, fügte er hinzu, um die Atmosphäre aufzulockern, »muss ich nach Hause.«
»Ja, natürlich.« Singer holte Luft. »Aber ich rate Ihnen dringend, sofort in die Faculté zu gehen, um den Leichnam anzusehen. Sie müssen wissen, worauf Sie sich einlassen. Ich habe Dr. Fauvet gebeten, auf Sie zu warten.«
Ehe Martin Einspruch erheben konnte, redete sein Gegenüber weiter und ging erneut auf die Tür zu: »Ich werde die Vorladungen ausstellen, damit die drei sogenannten Zeugen am Montagmorgen im Palais erscheinen und Sie dort erwarten.« Auf der Schwelle machte Singer eine leichte Verbeugung. »Bitte grüßen Sie Mme. Martin von mir.« Seine Rückkehr zum Formellen verhehlte nicht, sondern betonte sogar noch, wie ungewöhnlich der selbstmitleidige Gefühlsausbruch vorhin für Singer gewesen war. Und, so hoffte Martin inständig, auch vollkommen ungerechtfertigt.
Als die Tür zuschlug, warf Martin einen Bleistift über seinen Schreibtisch und sah zu, wie er über den Boden kullerte. Warum musste er sich heute Abend noch den Leichnam eines verstümmelten Säuglings ansehen? Warum war er immerzu der Fremde, der Neue, derjenige, dem die anderen ihre unangenehmen Fälle aufdrückten? Na, wer schwelgte jetzt im Selbstmitleid? Singer hatte wenigstens Grund dazu!
Martin stieß einen Seufzer aus, erhob sich und lief dem rollenden Bleistift nach, der am Fuß des Pults seines greffier, des Gerichtssekretärs, liegen blieb. Das Pult stand nahe der Wand, und zwar so, dass der Schreiber sowohl den Richter als auch die Zeugen sehen konnte, während er das Gespräch protokollierte. Martin zögerte einen Moment, dann legte er den Bleistift neben Guy Charpentiers Tintenfass, eine fast bösartige Geste. Sein Sekretär war trotz seiner Jugend ziemlich diensteifrig, und sein kleiner aufgeräumter Arbeitsplatz war eine ständige Mahnung für Martin, auf dessen viel größerem luxuriöseren Mahagonischreibtisch stets Unordnung herrschte.
Lächelnd griff Martin nach seinem Hut und nahm den langen Wollmantel vom Garderobenständer in der Ecke.
Clarie würde Verständnis dafür haben, wenn er wieder einmal zu spät nach Hause kam. Am besten, er brachte das Schlimmste gleich hinter sich.
Martin verließ den Palais de Justice durch den Haupteingang, der sich auf der Südseite der ruhigen und eleganten Place de la Carrière befand. Er liebte die »Carrière«, weil sie in Stein, Büschen und Bäumen all das ausdrückte, woran er von ganzem Herzen glaubte, dass nämlich Fortschritt, Gleichheit und Gerechtigkeit möglich waren. Der stattliche längliche Platz gehörte zum ältesten Teil der Stadt und war einst feudaler Spielplatz für Militärparaden und Turniere gewesen, umgeben von Palästen, die nur von privilegierten Adeligen bewohnt wurden. Im aufgeklärten letzten Jahrhundert hatte der gute Herzog Stanislas das geändert, er hatte die Fassaden der Gebäude um den Platz harmonisiert, einige der Häuser für Regierungszwecke bestimmt und den Streifen in der Mitte zu einem Park für alle Bürger umgestaltet, mit geraden Reihen gestutzter Lindenbäume, Steinbänken und eleganten Statuen. An den meisten Abenden blieb Martin, ehe er durch den Triumphbogen nach Hause ging, stehen und betrachtete dies alles voller Dankbarkeit. Froh, dass er die beruflichen Sorgen im Gerichtsgebäude zurücklassen konnte, froh, dass er seinem einsamen Leben im verschlafenen, dünkelhaften Aix entkommen war.
Aber heute war kein gewöhnlicher Abend. Er hielt sich den Hut vors Gesicht, um sich vor dem kalten Wind zu schützen, und eilte an der Place de la Carrière und dem Arc de Triomphe vorbei zur geschäftigen Rue Saint-Dizier. Dort bestieg er die Pferdetrambahn zur Faculté de Médecine.
Während er sich in dem vollbesetzten Wagen an einem über Kopf angebrachten Gurt festhielt, beobachtete Martin bedauernd, wie die Bahn am Ende der Straße hielt, die zu seiner Wohnung und zu Clarie führte. Er war nicht daran gewöhnt, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen; mit jedem klappernden Halt, der einen neuen Schwung Menschen brachte, die spät noch einkaufen gingen, wurde er ungeduldiger. Vielleicht hatte Dr. Fauvet es längst aufgegeben, auf ihn zu warten, und war nach Hause gegangen? Das Gedränge erreichte seinen Höhepunkt, als sie zum Marktplatz gelangten, wo die Händler gerade zusammenpackten. Lebhaft plaudernde Frauen stießen ihn mit ihren Taschen an, die voll waren mit in Papier gewickelten Fischen, Brot und sperrigem Gemüse. Erst nachdem die Trambahn durch einen Bogen der alten Porte Saint-Nicolas, ein massives Steintor am Rand der Altstadt, gefahren war, konnte Martin aufatmen. Nun waren nicht mehr so viele Fahrgäste im Wagen, und von seiner Last erleichtert, klapperte das breite Zugpferd in schnellerem Schritt an den parallel verlaufenden Eisenschienen entlang. Als Martin den Kirchturm von Saint-Pierre erblickte, war er es, der das Klingelzeichen zum Anhalten gab. Die Faculté de Médecine lag eine Querstraße von der Kirche entfernt in einem von Nancys neueren, nicht so dicht bevölkerten Vierteln.
Sobald Martin sich aus der Trambahn gezwängt hatte, fiel er in einen Laufschritt. Als er an der Faculté ankam, war der Sektionssaal im Keller dunkel und verschlossen. In der Haupthalle entdeckte Martin auf dem Boden einen Lichtschein, der ihm den Weg zu Lucien Fauvets Büro wies. Er klopfte an das Milchglasfenster im oberen Teil der Eichenholztür und wurde hineingebeten.
Graublauer Dunst und das angenehme Aroma von Tabak empfing Martin.
»Ach, Monsieur le juge, schön, dass Sie kommen. Ich habe auf Sie gewartet.« Lucien Fauvet blickte von einem Stapel Bücher auf und legte seine Pfeife zur Seite. Er hatte das strohblonde Haar und die blauen Augen eines Menschen aus dem Norden und den Enthusiasmus eines Schuljungen. Was er auch beinahe noch war. Backen- und Schnurrbart, mit denen er versuchte, seinem dicklichen Gesicht die Anmutung von Alter und Würde zu geben, wuchsen noch immer rührend spärlich.
»Es tut mir leid ...«
»Nicht nötig, nicht nötig«, sagte Fauvet und erhob sich von seinem überhäuften Schreibtisch. »Ich habe gerade nachgelesen, um sicherzugehen, dass meine Schlussfolgerungen zutreffen. Kommen Sie mit, bringen wir es hinter uns, damit Sie zum Abendessen zu Hause sind.« Er ließ seine Pfeife im Aschenbecher und das Jackett über dem Stuhl. Offenbar war die Arbeit des jungen Physiologieprofessors für heute Abend noch nicht beendet.
»Ein ziemlich interessanter Fall, sehr interessant«, murmelte Fauvet, während er Martin über die Hintertreppe nach unten führte.
Martin ging hinter dem jungen Arzt her, und ein erwartungsvoller Schauder stieg in seiner Brust auf. Fauvet war dafür bekannt, dass er das Groteske genoss.
Nachdem Fauvet mit einem der Schlüssel, die er in der Tasche seiner grauen Hose an einem Messingring bei sich trug, den Sektionssaal aufgeschlossen hatte, zog er an einer Schnur, und über einem eisernen Tisch leuchtete eine elektrische Glühbirne auf. Ihr Licht fiel auf ein kleines, mit einem weißen Tuch bedecktes Bündel. Fauvet rollte die Ärmel hoch und zog das Leintuch gerade weit genug nach unten, dass der Kopf zu sehen war. Martin musste sich bemühen, keine Reaktion zu zeigen. Das grünliche Gesicht war abstoßender, als er erwartet hatte. Das tote Kind glich einem zahnlosen, faltigen alten Mann. Unter der nackten Glühbirne glänzten die feinen blonden Haarsträhnen auf dem Schädel des Säuglings weiß vor der fleckigen, nachgedunkelten Haut.
Fauvet hob ein Augenlid des Kindes an.
»Sehen Sie diese kleinen roten Punkte?«
Martin beugte sich vor und spähte in die blaugrauen Augen des toten Säuglings. Er nickte und kämpfte gegen eine aufsteigende Übelkeit an.
»Das ist ein Zeichen für Ersticken. Aber«, Fauvet hob triumphierend einen Finger, »nicht durch Strangulieren. Keine Quetschung am Hals. Könnte durch ein Kopfkissen oder eine Windel passiert sein. Allerdings ist die Nase unverletzt, und man muss sich doch fragen«, sagte er mit deutlicher Betonung und zog mit einer schwungvollen Geste das Tuch weg, »warum das hier?«
Der Anblick des unnatürlich ausgemergelten Leibes war noch schockierender als der des Kopfes. Der kleine Rumpf war nach innen gedrückt, hin zu einem ausgefransten Schnitt in der Mitte, der vom Hals des Kindes bis zu der Stelle reichte, wo die Genitalien hätten sein sollen, wären sie nicht abgeschnitten worden. Diesmal wich Martin zurück, stützte sich an der kalten Steinmauer ab und hielt die Hand vor den Mund, um sein Erschrecken zu verbergen.
»Wurde ausgeweidet. Das behindert meine Arbeit ein wenig. Aber vielleicht haben Sie bemerkt, dass uns die fehlenden Innereien vor dem Gestank bewahren.«
Das war Martin nicht aufgefallen, aber nun, nach Fauvets Bemerkung, wusste er, dass er tief einatmen konnte, ohne dass ihm noch übler wurde. Er brauchte einen Augenblick, bis er eine Frage herausbrachte.
»Warum, glauben Sie, hat jemand so etwas getan?«, sagte er mit rauer Stimme und wiederholte damit ungläubig und voller Abscheu Fauvets rhetorische Frage.
»Ein Erstickungstod ist durchaus möglich, doch ich vermute stark, dass er etwas verschluckt hat, einen Stein, ein Stück Fleisch, und dass man versucht hat, dies zu vertuschen.«
»Aber so?« Trotz des unangenehmen säuerlichen Geschmacks im Mund konnte Martin seinen Blick nicht von dem winzigen Leichnam abwenden.
Fauvet zuckte die Achseln. »Vielleicht hatte die Amme Angst, dass man ihr Vernachlässigung vorwirft. Er war erst etwa sieben Monate alt. Er hätte noch nichts Festes essen dürfen. Nach dem, was ich so in meinem Labor zu sehen bekomme, sollten wir verbieten, dass Kinder aufs Land geschickt werden. Es ist unmöglich, sämtliche Frauen zu überprüfen, die sich als Amme verdingen.«
»Aber ich dachte, Kinder aufs Land zu schicken, das wird fast nicht mehr gemacht.«
»Außer in der Arbeiterschicht. Wenn die Frauen wieder in die Fabrik müssen ...«
»Ja, natürlich.« Martin schwieg, während er sich vorzustellen versuchte, wie die Ereignisse wohl abgelaufen waren. »Warum sollten die Eltern diese bizarre Geschichte glauben?«
»Unwissenheit. Ammenmärchen über Juden. Meine Mutter hat sie mir auch erzählt.«
»Ich habe so etwas nie gehört.«
»Sie sind nicht in dieser Gegend aufgewachsen. Ihre Eltern stammten wohl auch nicht aus einem der Dörfer, in denen Israeliten und Christen Tür an Tür lebten. Die meisten dieser Dörfer sind jetzt natürlich weg, an Deutschland gefallen.«
Fauvet sprach von den Gebieten, die im letzten Krieg verlorengegangen waren, und von den Dörfern, in denen die meisten der französischen Juden gelebt hatten. Oder zumindest die ärmeren Juden, die Pferdehändler, Kesselflicker und Hausierer. Soweit Martin wusste, verschwand diese Welt aus Wäldern, Kobolden und Legenden nach und nach. Ganz bestimmt fand man sie nicht in Nancy, der einzigen großen Stadt Elsass-Lothringens, die es auf der französischen Seite der Grenze noch gab. Oder wenigstens nicht in dem Nancy, das er kannte.
»Haben Sie Kinder?«, wollte Fauvet wissen.
Martin schüttelte den Kopf.
»Ich frage nur, weil Sie mir ein wenig ...«
Wirkte er so empfindlich? »Meine Frau ist schwanger«, sagte Martin und nutzte Claries Zustand, um Fauvets Unterstellung abzuwehren.
»Aha. Nun, wenn ich Sie wäre, würde ich ihr von dieser Sache nichts erzählen. Sie wissen, dass schwangere Frauen seelisch manchmal etwas instabil sind.«
»Ich habe nicht vor, ihr etwas darüber zu sagen.« Selbst wenn Frauen, wie manche medizinische Fachleute behaupteten, von ihrer Physiologie her zur Hysterie neigten, wusste Martin doch, dass dies für Clarie nicht galt. Dennoch war es eine nicht ganz einfache Zeit, und er wollte sie mehr denn je schützen.
»Dann haben Sie Singer gesagt, dass Sie annehmen, der Säugling könnte etwas verschluckt haben?«, fragte Martin, um das Thema zu wechseln.
»Ich habe ihm gesagt, dass ich mir nicht völlig sicher sein kann. Weil sie ihn ausgeweidet haben, habe ich keine Ahnung, woran er erstickt sein könnte.«
»Sie sprechen immer von ›sie‹?«
»Sie, er, sie – jeder normal starke Erwachsene könnte den Säugling in der Mitte aufgeschnitten haben. Der Knorpel ist in diesem Alter noch recht weich.«
Sie, er, sie? Keine Ahnung, woran das Kind erstickt ist? Falls das tatsächlich die Todesursache war. Oder hatte ihn jemand mit seiner eigenen Windel erstickt? Der grausige Abstecher zum Sektionssaal hatte Martin nicht viel weitergebracht – außer dass er nun wusste, warum Singer so erschüttert war. Martin starrte den kleinen verstümmelten Leichnam an, während er sich selbst fragen hörte, ob Fauvet Singer seine Hypothesen erklärt habe.
»Ich habe es versucht. Er bestand darauf, den Leichnam zu sehen. Um herauszufinden, ob seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt würden, wie er erklärte. Und als ich ihm das Kind zeigte, sagte er immer wieder: ›Wie können sie es wagen. Sie behaupten, das hat ein Jude getan, ein blutdürstiger jüdischer Hausierer. Wie können sie es wagen.‹ Und immer so weiter in diesem Ton. Dass jeder es getan haben könnte, damit bin ich gar nicht zu ihm durchgedrungen. Es muss noch nicht einmal unbedingt ein Mann gewesen sein, was das angeht. Als er dann sagte, er sollte damit nichts zu tun haben, musste ich ihm recht geben, weil er überhaupt nicht mehr rational dachte. Eigentlich war er geradezu hysterisch. Und dann hat er mich gebeten, auf Sie zu warten.«
Martin fand, dass »hysterisch« ein zu harter und respektloser Begriff war, auch wenn er selbst Zeuge von Singers Erregung geworden war. Aber er wollte mit dem selbstgefälligen jungen Professor keinen Streit anfangen. Er wollte nur noch gehen.
»Haben Sie überhaupt irgendetwas gefunden, was uns helfen könnte, die Person, die den Säugling verstümmelt hat, zu finden?« Das war eine entscheidende Frage. Wenn das Kind durch einen Unfall gestorben war, dann lag vielleicht gar kein Verbrechen vor. Dennoch konnte eine falsche Anschuldigung in Anbetracht der Stimmung, die seit der Nachricht von Dreyfus’ angeblichem Verrat bei der Bevölkerung herrschte, wie eine Bombe wirken. Deshalb musste Martin so etwas im Keim ersticken.
»Wenn wir ein Messer finden würden, dann könnten wir prüfen, ob es diese Wunden verursacht hat«, sagte Fauvet und fuhr mit dem Finger an der langen, ausgefransten Linie entlang. Dann zog er zum Glück das Leintuch über die Leiche. »Wenn sie klug sind, haben sie das Messer in den Fluss geworfen oder es sehr sorgfältig gereinigt.«
Natürlich. Es wäre ein glücklicher Zufall, wenn die Polizei das Messer fände. Dennoch würde Martin gleich am Montagmorgen die Anweisung geben, dass man es zumindest versuchen sollte. Mit unsicheren Fingern begann er, seinen Mantel zuzuknöpfen. »Es ist wichtig, dass nichts davon an die Öffentlichkeit dringt, bis wir wissen, was wirklich geschehen ist. Wir möchten so etwas nicht in der Zeitung lesen.«
Fauvet nickte zustimmend, während er seine Ärmel nach unten rollte. »Es besteht kein Grund, manche Leute noch mehr aufzuregen.«
Bezog sich Fauvet, der eine perverse Zuneigung zu toten Körpern hatte, auf die Öffentlichkeit oder auf die schwachen Mägen von Martin und Singer? Dessen ungeachtet schüttelte Martin Fauvet die Hand und dankte ihm. Dann eilte er hinaus und machte sich auf den kurzen Fußweg nach Hause. Er hoffte, dass er genug Zeit hatte, sich zu fassen, ehe er seiner hochschwangeren Frau begegnete.
KAPITEL 2
Der Lärm des Freitagabendverkehrs auf der belebten Rue des Dominicains drang sogar durch die Fenster im dritten Stock, die wegen der Kälte fest geschlossen waren. Clarie Martin störte das nicht. Sie war mitten in der südfranzösischen Stadt Arles aufgewachsen und liebte das Klappern der Pferdehufe und der Kutschen und die Rufe und das Lachen der einkaufenden Passanten. Das waren die Geräusche des Lebens, heimatliche Geräusche. Könnte sie sich nur in ihrem Sessel zurücklehnen, die Augen schließen und den Schatten nachträumen, die durch ihr Wohnzimmer zogen. Wie gern hätte sie ein bisschen geschlafen, ehe sie sich den Anstrengungen eines formellen Abendessens stellen musste. Aber sie hatte einen Gast. Und Madeleine Froment dazu zu bringen, sich zu verabschieden, ohne ihre Gefühle zu verletzen, war eine mühsame und knifflige Aufgabe.
Madeleine war vor vier Wochen in Nancy eingetroffen, um während der letzten beiden Monate von Claries Schwangerschaft ihre Stelle am Lycée Jeanne d’Arc zu übernehmen. Heute war Madeleine wieder einmal pünktlich zum Nachmittagstee erschienen, angeblich, um über neue Lehrpläne für Geschichte, Geographie und Literatur zu sprechen. Clarie vermutete allerdings, dass ihre Kollegin lediglich plaudern wollte.
Clarie versuchte, sich in ihrem Sessel bequemer hinzusetzen. Die Winter im Norden waren so dunkel. Wenn die Sonne schien, war das Wohnzimmer der freundlichste Ort in der ganzen Wohnung. Nun konnte Clarie kaum noch die zarten rosafarbenen und gelben Rosenzweiglein auf der Tapete erkennen. Sie wollte Madeleine gerade bitten, die Gaslampe neben ihrem Sessel aufzudrehen, als ihr Kind sie trat. Sie legte ihre Hände auf ihren umfangreichen Rumpf und wartete auf einen weiteren Tritt. Wie sehr sie die neue Straffheit ihres Bauchs genoss und die Energie des Wesens, das in ihr wuchs! Das war das Leben, das Zuhause, das sie und Bernard sich gemeinsam einrichteten.
»Du hörst mir nicht zu.«
»Es tut mir leid, das Kind hat sich bewegt.«
»Vermutlich sollte ich dafür Verständnis haben, man sagt, alle schwangeren Frauen werden verträumt.«
Madeleine hatte mit der Bitternis einer alten Jungfer gesprochen, was sie mit vierundvierzig Jahren sicherlich war. Sie hatte ihr Geplapper über ihr neuestes Lieblingsthema – irgendein Artikel in der katholischen Zeitung La Croix über die »wundersame« Bekehrung eines bekannten französischen Juden – unterbrochen und sich aufgerichtet, um Clarie anzusehen. Mit ihren dunklen stechenden Augen, der spitzen kleinen Nase und dem flachen schwarzen Hut, den sie bei Besuchen aufsetzte, ähnelte Madeleine auffallend einem mageren kleinen Vogel.
Clarie biss sich auf die Unterlippe. Armes Ding, dachte sie und versuchte, diesen wenig freundlichen Vergleich hinter einem Lächeln zu verbergen. »Sprich doch bitte weiter.«
»Alles, was ich sage, meine Liebe, ist, wenn sie alle Katholiken würden, wäre das Problem gelöst.«
»Mmmh.« Clarie gelang es zu nicken, um zu zeigen, dass sie zugehört hatte.
»Obwohl – vielleicht doch nicht, wenn man bedenkt, wie sie so sind.« Madeleine schürzte die Lippen und schob das Kinn vor, als müsste sie sich zurückhalten, noch mehr zu sagen.
Clarie seufzte. Sie wusste, wie sehr Madeleine auf ihre Zustimmung, ihr Einverständnis Wert legte, aber Clarie konnte nichts zeigen außer Mitleid. Sie war es müde, sich von Madeleine ständig anzuhören, dass die Juden, die Protestanten und die Freimaurer für jegliches Leid in Frankreich verantwortlich seien. Schwer zu glauben, dass sie beide dafür ausgebildet worden waren, an der neuen öffentlichen höheren Schule für Mädchen aufklärerische Prinzipien zu lehren. Aber Clarie musste freundlich bleiben. Das war sie Madeleine schuldig, nicht zuletzt deshalb, weil diese eigens nach Nancy gekommen war, um Claries Klassen zu übernehmen.
Behutsam strich sich Clarie über den harten, runden Hügel ihres Bauchs und dachte darüber nach, was für unterschiedliche Wege ihrer beider Leben genommen hatten. Als Clarie vor acht Jahren in das neugegründete Lehrerinnen-Ausbildungsinstitut in Sèvres eintrat, hatte sie solche Angst gehabt. Sie war völlig ahnungslos und fühlte ihre Schwächen nur zu deutlich: Unerfahrenheit, Einsamkeit, Mangel an Stil und Vermögen. Am schlimmsten war, dass sie in einem Zustand emotionaler Auflösung ankam, weil sie an ihren Träumen festgehalten und Bernard Martin, ihren Richter, ihren süßen jungen Richter, in Aix-en-Provence zurückgelassen hatte.
Damals war Madeleine eine fortgeschrittene Studentin gewesen, die bereits an Privatschulen unterrichtete. Sie hatte Clarie unter ihre Fittiche genommen, sie angeleitet und getröstet. Daher war es nun an Clarie, Verständnis zu zeigen. Die vergangenen Jahre waren zu Madeleine nicht freundlich gewesen. Sie hatte nie eine feste Anstellung gefunden, teilweise deshalb, weil sie nach Bordeaux zurückgegangen war, um sich um ihren Vater zu kümmern. Er starb dann plötzlich 1889, nachdem er entdeckt hatte, dass er gerade den Rest seines kleinen Vermögens im katastrophalen Bankrott der Panamakanal-Gesellschaft verloren hatte. Clarie runzelte die Stirn, denn sie wusste nur zu gut, dass die Geschichte damit noch lange nicht zu Ende war: Einige Jahre später enthüllte die Presse die betrügerischen Machenschaften, durch welche die schwierige finanzielle Lage der Gesellschaft vor ihren Investoren geheim gehalten worden war. Obwohl der darauffolgende Skandal die Politik insgesamt betraf, betonten die antisemitischen Zeitungen voller Schadenfreude die Rolle, die einige prominente Israeliten gespielt hatten. Damals hatte Madeleine angefangen, den Juden die Schuld an ihrem persönlichen Unglück zuzuschreiben.
Madeleine räusperte sich.
»Bitte entschuldige«, sagte Clarie, »ich habe wohl wieder geträumt.« Als wollte sie diese harmlose Lüge wiedergutmachen, schob sie sich aus ihrem Sessel. »Ist dir kalt? Vielleicht sollte ich nachschüren.« Sie hatte Madeleine den Lehnstuhl am marmornen Kamin überlassen, weil sich die Ältere immer über die Kälte beklagte.
»Meine Liebe, mach dir bitte keine Mühe. Ich gehe gleich.«
Clarie ließ sich zurücksinken und zog ihren braunen Wollschal fester um Schultern und Oberkörper. Sie war gespannt, was Madeleine einfallen würde, um das Gespräch noch in die Länge zu ziehen. Wo bleibt bloß Bernard?
»Bevor ich aufbreche, meine Liebe, muss ich dich doch noch einmal fragen«, sagte Madeleine, während sie sich ihre Handschuhe überstreifte. »Meinst du nicht, dass der Richter und du allmählich an einen Umzug denken solltet?«
Das alte Thema. Clarie wusste nicht genau, ob Madeleine ihre Wohnung vor allem deshalb kritisierte, weil sie fand, dass ein juge d’instruction, ein Untersuchungsrichter, eine elegantere Adresse haben sollte, oder weil die Martins über einem jüdischen Ladengeschäft wohnten. Sie biss die Zähne zusammen und erklärte zum wiederholten Mal geduldig, wie sehr sie es schätzten, mittendrin zu wohnen – nahe am Justizpalast und der Schule, an einer Straße, die bei den Bürgern der Stadt so beliebt war, dass sie sie einfach die Rue des Dom nannten.
»Aber die Wohnung ist so klein«, gab Madeleine zu bedenken.
»Für die Möbel und für den Lohn von Rose, unserer Zugehfrau, haben wir alles ausgegeben, was wir hatten. Ich vermute, dass wir in einem Jahr oder so auf die andere Seite der Gleise ziehen werden, in eine der neuen Siedlungen. Aber derzeit sind wir recht glücklich hier.« Clarie hoffte, das Thema damit endgültig abzuschließen.
»Hier? Über einer deiner Schülerinnen? Mit ihrem Vater als Vermieter?«
»Rebecca Stein ist sehr respektvoll. Sie fragt jedes Mal vorher an, ehe sie zu Besuch kommt. Und sie ist ein sehr nettes Mädchen.« Clarie streckte die Hand nach dem Teller aus, der auf dem Beistelltisch neben ihrem Stuhl stand, und nahm einen kleinen Ingwerkeks. »Die hat sie mir heute Morgen vorbeigebracht. Sie hat behauptet, ihre Familie könne gar nicht alle aufessen. Ich denke, sie wollte mir nur zeigen, dass sie an mich denkt.« Clarie biss in den süßen Keks, um ihren Ärger zu verbergen.
»Das ist, weil sie dich verehrt. Das tun sie alle. Bestimmt halten sie mich für einen sehr mageren Ersatz.«
»O Madeleine, das ist doch nicht wahr«, sagte Clarie müde, obwohl sie gelegentlich auch vermutete, dass ihre Kollegin keine sehr beliebte Lehrerin war. »Was hast du mir alles beigebracht! Ich war ein solches Landei ...«
»Das ist schon lange her.« Madeleine knöpfte sich sorgfältig die Handschuhe zu, während sie sprach.
Diesmal gelang es Clarie, sich aus dem Lehnstuhl zu erheben. Wenn sie doch nur etwas für ihre Freundin tun könnte. Sie wollte schon die Arme nach ihr ausstrecken, da hörte sie das Rasseln eines Schlüssels an der Tür. Beide drehten sich um und sahen, wie Bernard den Vorraum betrat. Sobald er ihrer ansichtig wurde, zog er seinen Hut. »Madame Froment«, begrüßte er Madeleine, indem er leicht seinen Kopf beugte.
»Monsieur Martin.« Madeleine nickte. Sie schien genau zu spüren, dass Bernard sie nicht mochte.
Clarie ging auf ihn zu, auch wenn sie wusste, dass er sie nicht küssen oder umarmen würde. Nicht vor einem Gast. Nicht einmal vor dem Dienstmädchen. Ihr Richter war so zurückhaltend. Aber wenigstens lächelte er ihr zu, ehe er die Stirn runzelte.
»Es tut mir leid, ich bin spät dran. Ich weiß, wir müssen uns fertigmachen. Ich hatte noch zu tun.«
»Das stimmt«, sagte Madeleine, »ich halte dich auf. Du musst dich fein anziehen.«
»Ach nein, ich habe es nicht eilig.« Clarie lächelte. »In meinem Zustand muss man sich um modische Kleidung nicht allzu viele Gedanken machen, Gott sei Dank.« Sie wandte sich an ihren Ehemann: »Bernard, holst du bitte Madeleines Mantel? Und du«, damit fasste sie beide Hände von Madeleine, »mach dir nicht so viele Sorgen. Nächstes Jahr um diese Zeit wirst du sicherlich eine gute Stelle finden.« Clarie drückte zu, bis sie spürte, dass ihr Griff erwidert wurde.
»Meine Liebe«, sagte Madeleine und entzog sich, »ich wünsche dir viel Vergnügen heute Abend.«
Clarie schüttelte den Kopf. »Wir freuen uns beide nicht sonderlich darauf, das kann ich dir versichern.« Das sagte sie für Madeleine, damit sie wegen der Einladung nicht neidisch wurde, aber auch, weil es der Wahrheit entsprach.
Die leere Wiege – und die Erinnerungen an den Säugling im Sektionssaal, die diese wachrief – steigerte Martins Anspannung, während er und Clarie sich durch ihr enges Schlafzimmer bewegten, um sich für das erste offizielle Diner in Nancy zurechtzumachen. Er wusste, dass Clarie dieses Abendessen seit dem Tag ihrer Ankunft vor mehr als zwei Jahren fürchtete. Als schüchterner Mann, der aus eher einfachen Verhältnissen stammte, fühlte auch Martin sich bei derlei gesellschaftlichen Anlässen nicht wohl. Ganz besonders heute Abend nicht. Hätte er doch Singer nur nicht versprochen, dass er versuchen würde, mit dem Oberstaatsanwalt zu sprechen. Aber das Gericht war seine Welt, nicht die von Clarie, und daher musste er zuallererst seine nervöse schwangere Gattin beruhigen.
»Du weißt doch, dass sie mich für unnatürlich halten werden, zu ehrgeizig für eine richtige Frau, nur weil ich beschlossen habe, meinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen«, sagte Clarie, schloss den Schrank und warf ihr wollenes Cape neben ihm aufs Bett.
»Ich bin sicher, sie werden wissen, dass du eine richtige Frau bist. Du bist schön. Und du wirst ganz offensichtlich Mutter.«
»Und auch noch schwerfällig wie eine Gans«, murrte sie auf dem Weg zum Frisiertisch. »Eine große blaue Gans«, fügte sie hinzu mit Verweis auf das Satinkleid, das sie mit Rose, ihrer Zugehfrau, für den Anlass in aller Eile genäht hatte.
»Schöner denn je«, murmelte Martin. Er zog sich die Seidenstrümpfe an und schlüpfte in die Schuhe.
Clarie schwieg, während sie glitzernde blaue Ohrringe anlegte und eine dazu passende Nadel in den Knoten auf ihrem Hinterkopf steckte. Dann griff sie nach der schweren Silberkette mit den Saphiren, die sie von ihrer Mutter geerbt hatte. »Kannst du mir damit helfen?«, fragte sie.
»Mit Vergnügen.« Martin bemühte sich um Heiterkeit, als er aufstand und ihr die Kette aus der Hand nahm. Nachdem er den Verschluss befestigt hatte, gab er ihr einen Kuss auf die duftende Stelle an ihrem Hals, wo sie gerade Parfüm aufgetragen hatte. Er blickte auf und sah sie im Spiegel lächeln. Musste er seine leidenschaftliche Arlésienne nicht lieben? Verglichen mit ihr war er eine unauffällige Erscheinung – graublaue Augen, braunes Haar und ein Bart, der bereits mit Grau durchsetzt war. Alles an ihm war einfach und gewöhnlich. Clarie hingegen sorgte mit ihrer Masse schwarzen Haares und den mandelförmigen braunen Augen für Aufsehen, wo immer sie auch hinging. Er beobachtete sie, als sie die Halskette mit den Fingern abtastete. Das schelmische Glitzern in ihren Augen verschwand.
»Ich weiß, es wäre dir lieber, deine Mutter wäre am Leben«, sagte er leise.
»Und dein Vater.« Da sprach das tapfere Mädchen.
Aber für sie war es anders. Auch wenn sie beide bereits ein Elternteil verloren hatten, war Martin doch sicher, dass eine Frau gerade in so einer Zeit ihre Mutter benötigte. Außerdem war Giuseppe Falchetti, der Vater von Clarie, für ihn wie ein zweiter Vater geworden. Seine Mutter hingegen hatte ihm nie verziehen, dass er die Tochter eines Schmieds einer reichen Kusine aus einer einflussreichen Familie vorgezogen hatte. Sie mochte Clarie noch immer nicht. Martin küsste seine schöne Frau noch einmal. »Wenigstens haben wir einander.«
»Du hast mir noch gar nicht erzählt, warum du heute so spät nach Hause gekommen bist«, sagte sie und gab ihm einen liebevollen Schubs, der die Stimmung auflockern sollte.
Martin ging hinüber zum Schrank, um sein Seidentuch zu holen. »Singer wollte mit mir noch über einen Fall sprechen«, antwortete er und hielt den Blick auf das Möbel gerichtet, damit er sie nicht ansehen musste. Das war natürlich albern. Das Bild des grässlich verstümmelten Säuglings war ja nicht auf seiner Stirn eingraviert.
»Und?« Clarie hatte sich immer für seine Arbeit interessiert.
»Und nichts. Langweilige Kleinigkeiten.« Er schloss die Augen, weil er sich schuldig fühlte. Noch nie hatte er etwas vor ihr verschwiegen. Wäre es noch schlimmer für ihn, wenn er ihr die Wahrheit erzählen würde über das, was er im Sektionssaal gesehen hatte? Nein, er konnte es nicht. Jetzt nicht. Er holte tief Luft und drehte sich zu ihr um. »Ich vermute, dein Gespräch mit Madeleine war sehr viel spannender.«
»Nicht unbedingt.« Clarie zuckte die Achseln. »Das Übliche eben: der arme König im Exil, die Angriffe auf die Kirche, die gottlose Republik, die von machtgierigen Protestanten und Juden korrumpiert wird. Vor allem natürlich den Juden.« Sie verdrehte die Augen und schenkte ihm ein schiefes ironisches Lächeln.
Martin zerrte an seiner Krawatte, während er sich bemühte, sie zu binden. Er war sich über Madeleines reaktionäre Ansichten völlig im Klaren, aber an ihre besondere Abneigung gegenüber Israeliten hatte er gar nicht gedacht. Brauchte er noch eine weitere Erinnerung daran, dass er bei diesem Diner mehr zu tun hatte, als Clarie sicher hindurchzugeleiten?
»Ich kann sehen, dass du verärgert bist.«
»Nein, das bin ich nicht«, sagte er, obwohl es zutraf. »Es ist nur so schade, dass du so viel Zeit mit ihr verbringen musst. Du solltest dich ausruhen und dich vergnügen.«
»Ihr Männer seid so dumm. Ich habe jede Menge Zeit. Und es kostet nichts, der Armen zuzuhören.«
Der unerträglichen Armen, dachte Martin, während er in den Spiegel blickte und vor Wut den Knoten erneut verpfuschte.
»Erzähl mir nichts, du bist genauso nervös wie ich.« Clarie lachte. »Lass mich das machen, sonst kommen wir hier nie weg.«
Er überließ sich gern ihren kundigen Händen. Obwohl Martin immerhin von mittlerer Größe war, war Clarie doch fast so groß wie er. Ihre Haare kitzelten ihn an der Nase, während sie sich auf seine Krawatte konzentrierte. Ihre Nähe, ihr Duft, ihre Wärme gaben ihm seine gute Laune wieder.
»So.« Sie trat zurück. »Jetzt siehst du richtig gut aus.«
»Wohl kaum.« Aber was machte das schon? Clarie hatte es ihm gesagt, und sie lachte.
»Wir sollten uns beeilen«, warnte sie. »Ich kann nicht so schnell gehen wie sonst.«
»Du hast recht.« Martin griff nach Claries Umhang und legte ihn ihr um die Schultern. Nachdem er sie gründlich gegen die Kälte gewappnet hatte, küsste er die leicht nach oben gebogene Spitze ihrer schmalen Nase. »Nur Mut!«, flüsterte er. Sie würden ihn beide brauchen.
Clarie betete, dass sich niemand neugierig nach ihr und ihrer Schwangerschaft erkundigte, bevor sich die Männer von den Frauen getrennt und zum Rauchen und zu »Geschäftsgesprächen« zurückgezogen hatten. Die Vorstellungsrunde mit sieben von Bernards Kollegen und deren Ehefrauen in dem von Gaslampen erleuchteten Wohnzimmer verlief ohne Zwischenfälle. Es genügten ein höfliches Lächeln und einige Schlückchen Champagner, der von livrierten Dienern gereicht wurde. Aber sobald sie das rechteckige Esszimmer betrat, dessen dunkle Wände mit karminroter Prägetapete behängt waren, begann Clarie, sich eingesperrt zu fühlen. Der Raum wurde lediglich von riesigen verzierten Kandelabern beleuchtet, und seine opulente Ausstattung glänzte von allen Seiten: von den Büffets, auf denen dampfende Schüsseln standen, den mit schweren Rahmen versehenen Porträts an den Wänden und dem langen Esstisch, wo sich an jedem Platz eine einschüchternde Überfülle von glitzerndem Silberbesteck und goldgerahmten Tellern befand. Schlimmer noch: Weil Bernard und sie zum ersten Mal eingeladen waren, erhielten sie Ehrenplätze, er neben der Gastgeberin am Fuß der Tafel, sie neben Charles du Manoir am Kopfende.
Glücklicherweise genoss es du Manoir, der Präsident des Gerichts von Nancy, ausführliche Reden zu schwingen; er beachtete sie die meiste Zeit gar nicht. Und wenn er sich ihr zuwandte, erwies er sich als bemühter Gastgeber, der harmlos und freundlich plauderte und ihr taktvoll die richtige Reihenfolge zeigte, indem er als Erster nach dem passenden Utensil für jeden Gang griff. Claries Atem wurde ruhiger, während die Paté, die Suppe, der Steinbutt und das Roastbeef aufeinanderfolgten.
Ihr persönliches Fegefeuer begann erst dann, als die in schwarzweiße Uniformen gekleideten Dienstmädchen bereits die Käsetabletts herumreichten. Da konnte die Hausherrin, Albertine du Manoir, ihre Neugier nicht länger zügeln.
»So, Madame Martin«, setzte sie an, wobei sie vom anderen Tischende her beinahe schreien musste, »Sie unterrichten?«
»Ja«, sagte Clarie und warf ihrem Ehemann durch die Arme der Kerzenleuchter einen Blick zu.
»Die höheren Klassen?« Mme. du Manoir sprach jetzt noch lauter, eine Ermutigung an ihr Opfer, es ihr gleichzutun. Sie streckte den Hals über ihrem stattlichen Rumpf nach oben. Clarie sah jedes einzelne der weißen Löckchen, die ihre ältliche, hochwohlgeborene Gastgeberin so sorgfältig um ihr strenges gepudertes Gesicht gelegt hatte.
»Ja, an einer der neuen öffentlichen höheren Schulen für Mädchen.« Das hatte Clarie schnell herausgestoßen. Ihr Herz begann zu pochen. Sie hatte es gesagt. Sie arbeitete an einem Ort, der »neu« und »öffentlich« war, und das war bestimmt nicht die Art von Zeitvertreib, der sich für die Ehefrau eines Richters schickte. Vielleicht würde diese Fülle an Fakten ihre Zuhörer wenigstens für einen Moment zum Schweigen bringen.
Und so geschah es dann auch. Es war ein unnatürliches Schweigen. Das Klicken der Bestecke auf den Tellern hatte aufgehört, genau wie das Murmeln der Gespräche. Clarie trank einen Schluck Wein, ihr Mund wurde trocken.
»Und wie, meine Liebe, haben Sie so etwas gelernt?« Mme. du Manoir hatte nicht vor, sie schon vom Haken zu lassen.
»Ich wurde in einem Internat ausgebildet, in Sèvres, nicht weit außerhalb von Paris.« Clarie legte Messer und Gabel ab. Sie wollte nichts mehr essen. Und bestimmt würde sie nicht essen, solange alle Augen auf sie gerichtet waren. Wenn sie nur neben Bernard säße, er würde ihr sicher zu Hilfe kommen.
»Sie sind ganz allein nach Paris gegangen?«, wollte die Frau des Oberstaatsanwalts wissen, die ihr direkt gegenübersaß. Sie war jünger als die meisten anderen Gäste, vielleicht Mitte dreißig. Eine hübsche Brünette mit einem ovalen Gesicht, das Überraschung, aber, so hoffte Clarie wenigstens, keine Missbilligung ausdrückte.
Clarie nickte und senkte den Blick auf den Teller.
»Wie außerordentlich.«
Clarie wusste nicht, von wem dieser Kommentar stammte, aber er war nicht als Kompliment gedacht.
»Ja, es war außerordentlich. Sehr anspruchsvoll«, schaltete sich Bernard ein. Er lehnte sich über den Tisch, um die Aufmerksamkeit der Speisenden auf sich zu ziehen.
»Aber dennoch, eine junge Frau, allein, die gemeinsam mit anderen jungen Frauen durch die Stadt spaziert. Wenn ich es recht verstehe, gab es keine Beschränkung der Bewegungsfreiheit.« Clarie hätte schwören können, dass sogar Mme. du Manoirs Hängebäckchen missbilligend zitterten. Ihre großen Diamantohrringe schaukelten und glitzerten im Kerzenschein.
»Nur die Beschränkung einer sehr strikten Moral. Einer kantianischen Moral, um genau zu sein.« Bernard fuhr fort: »Ich sage Ihnen, als ich die Schulleiterin um Claries Hand bat, war ich nervöser als bei ihrem Vater. Mme. Favre hatte sehr genaue Vorstellungen, wer ihren Schülerinnen den Hof machen durfte.«
»Sie haben tatsächlich die Schulleiterin um Erlaubnis gebeten?« Die Gattin des Oberstaatsanwalts lächelte verblüfft. Wenigstens eine von ihnen hatte Claries ritterlicher Verteidiger auf seine Seite gezogen.
»Ich bin nicht vor ihr auf die Knie gesunken.« Bernard legte eine Pause ein, ehe er hinzufügte: »Aber ich schwöre Ihnen, ich hatte das Gefühl, ich hätte es tun sollen.«
Diese Bemerkung rief sogar beifälliges Kichern hervor.
»Dennoch fragt man sich«, Mme. du Manoir legte ihre Hand auf die von Bernard, um weiteren Frivolitäten Einhalt zu gebieten, »was für Frauen einen so schwierigen Beruf ergreifen.« Sie starrte hinüber zu Clarie und erwartete eine Antwort.
Clarie spürte, wie ihr die Röte ins Gesicht stieg. Wie konnte einer von diesen Leuten wissen, wie schwierig dieser Beruf tatsächlich war? Da war zunächst die Unsicherheit, ob man eine Stelle fand. Und hatte man eine, dann stand man all diesen Mädchen gegenüber, die von einem erwarteten, dass man ihnen alles beibrachte, was die Welt zu bieten hatte. Man saß bis zum Morgengrauen, um sich vorzubereiten, fast weinend vor Müdigkeit. »Nun ja«, sagte sie und versuchte, ihre Stimme so ruhig wie möglich zu halten, »die Schülerinnen in Sèvres kommen aus allen Bevölkerungsschichten.«
Mme. du Manoir hob die Augenbrauen. »Das ist doch nicht möglich!«
Sollte Clarie nun zugeben, dass ihr eigener Vater ein Einwanderer war, der als Schmied arbeitete, und dass Bernards Vater lediglich Uhrmacher war? Sie verschränkte die Hände unter dem Tisch, um sie am Zittern zu hindern. Damit würde sie sich lächerlich machen.
Monsieur du Manoir rettete Clarie: »Albertine, wenn unsere republikanische Regierung bestimmt, dass junge Frauen eine höhere Bildung erhalten sollen, ist es dann besser, dass sie von einer Nonne unterrichtet werden oder von jemandem, der Ehefrau und Mutter werden wird?«
»Jawohl! Darauf trinken wir!«, rief Alphonse Rocher, der älteste der Richter, dessen Gesicht schon vom Alkohol gerötet war. Ein Dutzend Gäste, alle auf unterschiedliche Weise zögernd oder verwirrt, hob die Gläser. Erleichtert über die Ablenkung lehnte Clarie noch einmal den Käse ab. Nach dem mageren Toast setzten das Klackern des Bestecks und das leise Murmeln einzelner Gespräche wieder ein. Clarie, noch immer nervös, betrachtete die Gesellschaft mit gesenkten Blicken. Als sie sah, dass die Bediensteten Eis und Kuchen auf den Büffets anordneten, löste sie ihre Hände und stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. Es war beinahe geschafft.
Martin strich mit seinen Fingern über Claries Fingerspitzen, als er auf dem Weg in die Bibliothek mit den anderen männlichen Gästen an ihr vorüberkam. Das war seine unausgesprochene Entschuldigung. Er überließ sie nur ungern der Gnade der »Damen«, aber es war nun einmal nicht zu verhindern. Martin war fest entschlossen, Clarie loszueisen, sobald er mit Théophile Didier, dem Oberstaatsanwalt, gesprochen hatte.
Am Eingang zur Bibliothek blieb er stehen und holte tief Luft. Außer wenn Singers Vermutung zutraf, sollte das eigentlich nicht schwer werden. Falls der Proc sich weigerte, ihm die Leitung der Untersuchung zu überlassen, dann würde Martin Singer erklären, er habe getan, was er konnte. Sollte Didier zustimmen, den Fall an Martin zu übergeben, dann konnte er sich darauf konzentrieren, wie er vorgehen wollte. In jedem Fall, sagte Martin zu sich selbst, zog sein Abendjackett zurecht und zwang sich weiterzugehen, würde eine definitive Entscheidung in der Sache verhindern, dass er das ganze Wochenende lang den kleinen Leichnam vor sich sah.
Die übrigen Männer hatten sich bereits um du Manoirs monströsen Mahagonischreibtisch versammelt, wo die Diener Zigarren und Cognac bereitgestellt hatten. So groß er auch war, wirkte der Tisch doch winzig in einem Raum, dessen Wände vom Boden bis unter die hohe Decke mit Bücherregalen versehen waren. Der Gerichtspräsident hatte sogar eine Schiebeleiter einbauen lassen, damit er oder sein Diener die oberen Regalbretter erreichen konnten. Martin bezweifelte, dass die Leiter häufig zum Einsatz kam. Du Manoir war ihm nie wie ein tiefer Denker vorgekommen.
Martin lehnte eine Zigarre ab, nahm sich aber ein Glas Cognac. Dann hielt er sich am Rand der Gespräche und wartete auf seine Chance. Als Didier sich aus der Gruppe der Raucher löste, um ein paar Bücher im Regal zu betrachten, trat Martin sofort auf ihn zu.
»Singer war heute Nachmittag bei mir«, begann er.
»Tatsächlich?« Didier zog die Augenbrauen hoch und nahm einen Schluck aus seinem winzigen runden Cognacglas. Er war ein großer, dünner Mann mit kurzgeschnittenen sandfarbenen Locken. Gewöhnlich trug er einen strengen Ausdruck im Gesicht, der seiner Stellung angemessen war. Selbst bei diesem gesellschaftlichen Anlass setzte er einen seiner vielen wohlbekannten taktischen Kniffe ein, indem er den Zeugen zwang, alle Einzelheiten aufzuführen und womöglich einen Fehler zu machen.
»Er war aufgeregt wegen eines Falls, den Sie ihm gerade übergeben hatten, der verstümmelte Säugling und die Bezichtigung eines Ritualmordes.« Martin hob sein Glas an die Lippen, obwohl ihn das kaum vor dem unbewegten Blick Didiers schützte.
»Und?«, fragte der Oberstaatsanwalt.
»Und er hätte gern, dass ich ihn übernehme.« So, nun war Didier an der Reihe. Martin nahm einen Schluck von dem angewärmten bernsteinfarbenen Branntwein.
Aber statt zu antworten, flüsterte Didier warnend: »Ich glaube, Rocher kommt auf uns zu.«
Gegenüber dem korpulenten Alphonse Rocher herrschte im Gericht eine allgemeine unausgesprochene Abneigung. Der älteste Untersuchungsrichter von Nancy hatte es auf seine lautstarke Weise irgendwie nach oben geschafft. Zögernd wich Martin zur Seite aus, um den Mann, der den ungeschickten Toast auf Clarie ausgesprochen hatte, näher treten zu lassen.
»Was ist das denn? Redet ihr über die Arbeit?«, fragte Rocher und saugte zufrieden an seiner Zigarre.
»Das könnte man sagen.« Didier lächelte halb und sah Martin erwartungsvoll an.
»Na, dann lasst mal hören!«, tönte Rocher. Die Getränke beim Abendessen hatten ihn noch redseliger gemacht als sonst.
Martin murmelte: »Ach, es ist gar nichts.« Er trank noch einen Schluck und versuchte, sich von den beiden zu entfernen.
»Na, da bin ich mir nicht so sicher. Ich wette, da ist etwas.« Mit seinen rosigen Wangen, dem Walross-Schnurrbart und der üppigen Mähne weißer Haare sah Rocher aus wie ein freundlicher Großvater. Aber in seinem Amt sollte er eigentlich nicht nachgiebig sein und Scherze machen. Ein Richter musste seine Pflichten und seine Verantwortung ernst nehmen. Martin verspürte nicht im Geringsten den Wunsch, mit ihm über Singers Bitte zu sprechen.
»Es geht um den Fall, den ich eigentlich Ihnen gegeben habe und von dem Sie unbedingt wollten, dass Singer ihn bearbeitet«, sagte Didier und warf Martin einen bedeutungsvollen Blick zu. Die wenigen Worte des mageren Oberstaatsanwalts hatten auf knappe Weise zwei Botschaften enthalten: dass er den Fall für nicht sonderlich schwer zu lösen hielt, denn sonst hätte er ihn nicht Rocher übergeben, und dass Rocher derjenige gewesen war, der vorgeschlagen hatte, ihn ihrem jüdischen Kollegen zuzuweisen.
»Ja, ja, dieser Fall«, sagte Rocher und paffte genussvoll seine Zigarre.
»Warum Singer?«, wollte Martin wissen. Er hätte nur zu gern diesen dümmlich fröhlichen Gesichtsausdruck von Rochers Antlitz gewischt.
»Na, na, jetzt regen Sie sich nicht gleich auf«, sagte Rocher und legte dem unwilligen Martin eine Hand auf die Schulter. »Wir wollten nur mal sehen, wie er reagiert. Und außerdem geht es um seine Leute. Wir dachten, es wäre das Beste, wenn er sich darum kümmert.« Rocher zwinkerte Didier zu, doch dessen Gesicht blieb unbewegt.
»Die Republik ist für alle Menschen da. Ich glaube, dieses Prinzip herrscht seit 1789.«
Rocher lachte und sah zu Didier hinüber. »Oje, jetzt gibt’s Geschichtsunterricht.«
»Sie haben recht. Tut mir leid«, sagte Martin. Irgendwie hörte er sich immer wie ein Pedant an, sobald er über die Dinge sprach, die ihm am meisten am Herzen lagen. Aber er mochte es nicht, wenn man sich über ihn lustig machte. Er trank einen Schluck von seinem Cognac und ließ sich von der Wärme stärken, ehe er, an Didier gewandt, fortfuhr: »Nun, wenn dieser Fall ohnehin von einem Richter zum anderen geschoben wird, macht es vermutlich nichts aus, wenn ich ihn übernehme.«
Didier schürzte die Lippen und nickte.
»Ja, nehmen Sie ihn, wenn Sie ihn unbedingt wollen«, mischte sich Rocher ein, auch wenn es eigentlich nicht mehr seine Sache war. Er blies einen Rauchring aus, dann beugte er sich zu Martin und sagte: »Das heißt, wenn Sie sich als einen Freund der Israeliten betrachten –«
»Ich weiß nicht, wovon Sie reden.« Martin konnte seinen Ärger kaum noch verbergen.
»Haben Sie gewusst«, fragte Rocher, »dass die Familie Singer für Nancy ›optiert‹ hat, als die Deutschen sich die andere Hälfte von Lothringen genommen haben?«
Obwohl Singer ihm das nie erzählt hatte, war Martin nicht überrascht. Nachdem Frankreich 1871 das Elsass und die Hälfte von Lothringen an die Preußen verloren hatte, waren viele Franzosen lieber Flüchtlinge geworden, als unter deutschem Gesetz zu leben.
»Ich glaube nicht, dass er versteht«, bemerkte Rocher zu Didier gewandt, als wäre Martin ein Schuljunge, der eine Lektion nicht begreift. »Sie übernehmen uns«, betonte der alte Mann und hob seine Stimme. »Und es genügt noch nicht, dass sie in den siebziger Jahren alle in die Stadt geströmt sind. Jetzt kommen sie sogar aus Russland. Alles Bettler.«





























