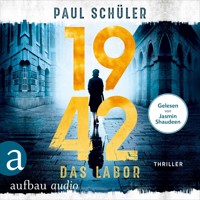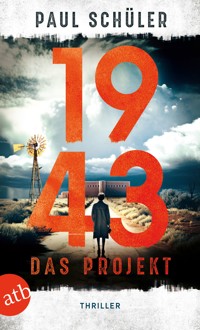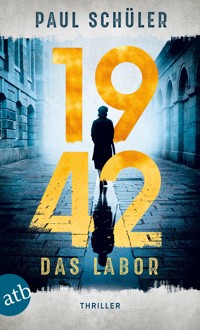
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Margarete von Brühl
- Sprache: Deutsch
Eine Frau und ihr Kampf gegen die gefährlichste Waffe der Welt.
Leipzig im Juni 1942: Die Physikerin Margarete von Brühl arbeitet an der Entwicklung einer Uranmaschine. Sie ahnt nicht, wie sehr sich die Gestapo für ihre Experimente interessiert. Als es in ihrem Labor zu einer Explosion kommt, bei der ihr Assistent und heimlicher Geliebter stirbt, wird sie verhaftet – und danach von einem alten Freund befreit. Er behauptet, Mitglied einer Widerstandsgruppe zu sein und dass Margaretes Forschung dem Bau einer Atombombe dient. Gemeinsam versuchen sie mit all ihren Kräften zu verhindern, dass die Nazis an die apokalyptische Waffe gelangen ...
Ein packender Thriller über eine Verschwörung im Dritten Reich – nach historischen Begebenheiten erzählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Die junge Physikerin Dr. Margarete von Brühl arbeitet an der Entwicklung der Uranmaschine, einem Vorläufer moderner Kernreaktoren. Ihre männlichen Kollegen nehmen sie nicht ernst, doch sie will sich beweisen – unbedingt. Kurz nachdem ihr Institutsleiter plötzlich verschwindet, kommt es zur Katastrophe: Die Uranmaschine explodiert. Ihr Assistent und heimlicher Geliebter Karl Leitner verliert in dem Inferno sein Leben, und sie selbst wird von der Gestapo gejagt. Und noch jemand hat es auf sie abgesehen: Für Karls Vater steht fest, dass Margarete die Schuld am Tod seines Sohnes trägt. Er macht sich auf, ihn zu rächen.
Über Paul Schüler
Paul Schüler, Jahrgang 1986, studierte in Hannover erst Architektur, später Physik und Mathematik. Nach einigen Jahren als Songschreiber, Sänger und Gitarrist der Band „Ich Kann Fliegen“ und diversen journalistischen Tätigkeiten begann er, als Lehrer zu arbeiten. In seinem Debütroman verbindet er die Liebe zu Thrillern mit sprachlicher Präzision und physikalischem Fachwissen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Paul Schüler
1942 – Das Labor
Thriller
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Erstes Kapitel
Leipzig, 21. Juni 1942
Leipzig, 22. Juni 1942
Leipzig, 23. Juni 1942
Zweites Kapitel
Leipzig, 11. Juni 1942
Leipzig, 23. Juni 1942
Truppenübungsplatz Ohrdruf, 24. Juni 1942
Drittes Kapitel
Zürich, 26. Juni 1942
Mülhausen, 26. Juni 1942
Taucha bei Leipzig, 14. Mai 1943
Hinter der Geschichte
Danksagung
Impressum
Wer von diesem spannenden Roman begeistert ist, liest auch ...
Prolog
Langsam, ganz langsam bildeten sich Formen in der Schwärze, die ihn umschloss. Da, an der Kellerwand, stand das Fahrrad seines Vaters. Daneben lehnten in einer unordentlichen Reihe Schaufeln und Harken, die seine Mutter im Garten benutzte. Und dort stand der gewaltige Heizofen. Etwas abseits davon, in einem hüfthoch ummauerten Bereich, lag dunkel der Kohlenhaufen. Darüber gab es ein vergittertes Fenster, dessen Riegel sein Vater öffnete, wenn der Kohlenmann kam.
Gerald Schander, Kriminalrat bei der Leipziger Gestapo, wusste, dass er träumte. Er sah sich im Dunkeln sitzen, wieder einmal. Erneut war er der kleine Junge, gerade acht geworden, und verbüßte seine Strafe im Keller. Jedes Detail der Szenerie hatte sich in sein Gehirn eingebrannt. Doch wieso ihn sein Vater an diesem Abend in den Keller gesperrt hatte, das wusste er nicht mehr. Vielleicht hatte er es nie gewusst.
Im Haus war es bereits still geworden. Seine Eltern waren zu Bett gegangen, vielleicht vor einer Stunde, vielleicht auch schon früher. Gerald hatte keine Uhr, und wenn er eine gehabt hätte, dann hätte er das Zifferblatt im Dunkeln nicht erkennen können. Zuerst war er ängstlich gewesen, geradezu panisch. Die Finsternis hatte ihn Dinge sehen lassen, Monstrositäten, die auf ihn zugekrochen kamen und nach ihm griffen. Geflügelte Wesen, die ihn mit toten Augen anstarrten und sich die Lippen leckten nach seinem Fleisch. Natürlich hätte er das vergitterte Fenster über dem Kohlenhaufen öffnen und hinausklettern können, so wie er es schon manches Mal getan hatte. Doch draußen, wo die Eulen heulten und es vielleicht sogar Wölfe gab, war es noch unheimlicher als im Keller. Und nachdem die Monster ihn während seiner letzten Aufenthalte in dem Verlies stets verschont hatten, hatte Gerald sich schließlich an sie gewöhnt.
Manchmal redeten sie sogar mit ihm.
»Nimm die Zündhölzer!« Das kleine Wesen mit den krummen Hörnern, das ihn stets am lautesten piesackte, funkelte ihn an. »Nun nimm sie schon, Feigling! Ich friere!«
Gerald schloss die Augen und hielt sich die Ohren zu.
»Denkst du, dass du mich so loswirst?« Die Stimme, die nun direkt in Geralds Kopf zu sein schien, lachte meckernd. »Nimm die Zündhölzer, du Ochse, sonst mach ich dir Beine!«
Gerald öffnete vorsichtig ein Auge und sah gerade noch, wie das Wesen hinter dem Kohlenhaufen verschwand. Davor lag, von einem Streifen Mondlicht erhellt, die Schachtel mit den Zündhölzern. Zögernd kroch er darauf zu, öffnete die Packung und nahm eins der Hölzer heraus.
»Zünd es an!«, zischte das Wesen.
Gerald blickte auf, doch er konnte das Wesen im Dunkeln nicht entdecken. Dann senkte er den Blick wieder und betrachtete das Zündholz in seiner Hand. Er hatte seinem Vater immer schon gern dabei zugesehen, wie er den Ofen anmachte. Man musste es an der rauen Seitenfläche der Schachtel reiben, dann gab es eine kleine Flamme. Und aus der kleinen Flamme wurde ein großes Feuer.
»Nun mach schon«, drängelte das Wesen. »Es ist so schrecklich kalt hier!«
Gerald rieb das Zündholz über die Schachtel. Nichts geschah.
»Fester!«, befahl die Stimme aus der Dunkelheit.
Gerald wiederholte die Bewegung, diesmal mit mehr Schwung.
Der Kopf des Zündholzes spie Funken und knisterte, dann züngelte eine Flamme hervor. Gerald betrachtete sie ganz genau. Sie sah aus wie ein Tropfen, wie die Träne eines Drachen vielleicht, und schimmerte in allen Farben des Regenbogens, unten blau, weiter oben eher rötlich. Sie war wunderschön.
Ein sengender Schmerz stach in seinem Finger. Gerald bemerkte, dass das Zündholz beinahe abgebrannt war, und ehe er sich versah, hatte er es in hohem Bogen von sich geworfen. Es landete irgendwo in dem Kohlenhaufen und verschwand. Er steckte den Finger in den Mund, um die Schmerzen zu lindern.
Einige Augenblicke lang passierte gar nichts. Doch dann sah er ein Flämmchen, das zwischen den Kohlen hervorlugte. Es war nur ein zartes Flackern, ein rotes Drachenauge, das in der Dunkelheit blinzelte.
Dann gab es ein Geräusch, als habe ihm jemand aufs Ohr gehauen, und mit einem Mal stand der Kohlenhaufen in Flammen. Für einige Sekunden war Gerald wie versteinert. Wie konnte das passieren? So etwas hatte er noch nie gesehen. Das Feuer wuchs vor ihm immer weiter in die Höhe. Fast erreichte es schon die Decke. Gerald starrte mit großen Augen in die tosenden Flammen. Immer wieder knallte es, Funken wurden daraus hervorgeschleudert und er schloss jedes Mal schnell die Augen, um sie gleich danach wieder aufzureißen. Schatten zuckten über die Kellerwände, wie tanzende Teufel.
Mit einem Mal spürte er die Hitze auf seinem Gesicht. Er realisierte in diesem Moment noch nicht, was er getan hatte, doch er spürte instinktiv, dass er in Gefahr war. Rauch sammelte sich unter der Decke. Er musste sich jetzt von diesem Anblick lösen, auch wenn es ihn unendlich viel Überwindung kostete. Sonst würde er in diesem Verlies sterben.
Gerald wollte nicht sterben. Er wollte auch nicht, dass seine Eltern starben, aber dieser Gedanke kam ihm erst, als es schon zu spät war.
Die Kellertür war verschlossen, das wusste er. Dennoch lief Gerald die paar Meter zur Tür hin, drückte die Klinke hinunter und rüttelte an ihr, ohne Erfolg. Es gab nur einen Ausweg. Er sah zu dem vergitterten Fenster hinauf, durch das müde der Mond hereinschien. Dann stand er auf und ging um den brennenden Kohlenhaufen herum. Seine Hose fing Feuer, doch das bemerkte er nicht. Es hätte auch keine Rolle gespielt, er hatte ja keine Wahl, es gab nur diesen einen Weg. Mit ausgestreckten Händen näherte er sich den Gitterstäben, um den Riegel zu öffnen und das Fenster aufzudrücken.
Die Flammen hatten zu diesem Zeitpunkt schon mehrere Minuten lang direkt unter dem metallenen Gitter gelodert. Es glühte, doch das konnte Gerald, geblendet von dem tosenden Feuer, nicht sehen. Entschlossen legte er den Riegel um, dann umgriff er mit beiden Händen die Metallstäbe und versuchte, das Gitter aufzustoßen. Es klemmte.
Gerald schrie nicht.
Er sah zu, wie das Fleisch an seinen Händen verbrannte. Erst wurde es rot, dann platzte es auf und zischte. Graue Ascheränder bildeten sich und weiße Rauschwaden stiegen daraus hervor. Es roch nach dem Brathähnchen, das seine Mutter manchmal sonntags zubereitete.
Doch Gerald schrie nicht.
Er löste seine Finger von dem glühenden Gitter und registrierte kaum, dass Teile seiner Haut daran kleben blieben. Dann nahm er Anlauf und warf sich mit der Schulter gegen die Metallstreben. Wieder zischte es, Schmerzen durchzuckten seinen Arm. Doch das Fenster bewegte sich nicht. Gerald nahm erneut Anlauf und rannte gegen das Gitter an.
Und noch mal.
Und noch mal.
Schließlich gab es nach und er kletterte ins Freie. Er sackte auf die Knie und sog mit gierigen Atemzügen die kalte Novemberluft ein. Dann kroch er, auf seine Ellbogen gestützt, den Hügel hinter dem Haus hinauf und beobachtete das brennende Gebäude, in dessen ersten Stock seine Eltern schliefen.
Er sah niemanden hinauslaufen.
Kriminalrat Gerald Schander öffnete die Augen. Seine Hände juckten. Mechanisch knetete er das Gewebe der Brandnarben, bis das Gefühl nachließ.
Hatte er Angst?
Vielleicht.
War es seine Angst, die ihm diese Träume schickte?
Vermutlich.
Doch es gab keinen Grund, jetzt noch Angst zu haben. Er konnte ohnehin nicht mehr umkehren. Die Ereignisse, die er in Gang gesetzt hatte, nahmen ihren Lauf, und es gab keinen Grund, an seinem Plan zu zweifeln. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis er in die höchsten Führungszirkel des Reichs vorstoßen würde.
Und wenn nicht, nun … dann würde er untergehen, aber mit einem Knall.
Eine kühle Brise wehte durch das geöffnete Schlafzimmerfenster herein. Die Gaslampe auf dem Nachttisch flackerte. Mit einer hektischen Bewegung drehte Schander das Ventil zu und die Flamme erlosch.
Erstes Kapitel
Leipzig, 21. Juni 1942
Die Uranmaschine lag stumm in ihrem Wasserbecken. Manchmal kam es Dr. Margarete von Brühl vor, als flimmere die Luft über der Wasseroberfläche. Vermutlich verursachte der gelbe Schein der Lampen, der sich auf der gekräuselten Trennlinie zwischen Luft- und Wassermolekülen spiegelte, diesen Eindruck. Doch Margarete ertappte sich schon seit Beginn der Versuchsreihe dabei, immer wieder zu dem quadratischen Bassin hinüberzuschauen und auf irgendetwas zu warten.
In dem Becken, das in einer eilig errichteten Laborbaracke auf dem Innenhof des Physikalischen Instituts in Leipzig lag, befand sich die siebzig Zentimeter durchmessende Aluminiumkugel, in deren Innern sich Schichten aus Uran und schwerem Wasser abwechselten. Die Uranmaschine. Von außen betrachtet lag sie ruhig da, doch Margarete wusste, dass in ihrem Innern die Hölle los war. An der Werkbank, an der sie stand, spürte sie lediglich die drückende Hitze, die die Maschine ausstrahlte. Margarete warf einen Blick auf die Nadel des Geigerzählers. Sie trudelte ruhig am unteren Ende der Skala. Kein Grund zur Besorgnis.
Karl Leitner, ihr Assistent, stand auf einer klapprigen Holzkonstruktion, die über der Maschine errichtet worden war, und hantierte an verschiedenen Öffnungen an der Oberseite der Aluminiumkugel herum. Dann blickte er Margarete an, grinste und strich sich mit einer unbewussten Handbewegung die kupferroten Locken aus dem Gesicht. Eine Strähne seines wirren Seitenscheitels ragte in die Luft, was ihn aussehen ließ, als würde er jeden Moment vorschlagen wollen, beim Nachbarn Äpfel zu klauen. Seine Zähne strahlten, als wäre irgendwo im Labor eine ultraviolette Lampe angebracht worden. »Also, haben wir eine Verabredung, meine Teuerste?« Er machte eine Art Knicks, gefolgt von einer tiefen Verbeugung. Schelmisch blickte er sie an, während er in der tief vornüber geneigten Pose verharrte.
Margarete setzte einen säuerlichen Blick auf, um Karl daran zu erinnern, dass ihre Arbeit von höchster Wichtigkeit war und allergrößte Präzision erforderte. Seine Albernheiten hatten im Physikalischen Institut der Universität Leipzig nichts verloren. Doch sie konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. »Karl, ich werde heute Abend sehr beschäftigt sein. Wenn wir hier fertig sind, beginnt für mich erst die eigentliche Arbeit. Ich muss aus den Messwerten den Wirkungsgrad errechnen und mit den theoretisch vorhergesagten Werten vergleichen, und das Ganze auch noch schnell.« Das stimmte zwar, war aber nicht die ganze Wahrheit.
Offenbar wusste das auch Karl. Das Grinsen verschwand aus seinem Gesicht. Er zog die Stirn in Falten und sah sie an. »Hör zu, was vor vier Wochen passiert ist, tut mir leid. Du sollst nicht denken, dass ich …«
»Ach, Unsinn«, unterbrach sie ihn. »Was passiert ist, ist passiert. Ich bereue es nicht.« Wieder war es nicht die ganze Wahrheit. Wenn sie an diesen Abend dachte, begannen ihre Wangen immer noch zu glühen. Sie war über den armen Karl hergefallen, der gerade neu ans Institut gekommen war und wohl kaum gewusst hatte, wie ihm geschah. Sie hatte ihm keine Chance gegeben zu widersprechen. Nach einem Film im Kino am Bahnhof, mehreren sündhaft teuren Gläsern Wein und einem Blick in sein schüchternes Gesicht mit den graugrün blitzenden Augen hatte sie ihn geradeheraus gefragt, ob er noch mit zu ihr kommen wolle. Als er sie mit großen Augen angesehen hatte, hatte sie gezahlt und ihn hinter sich hergeschleift. Nein, sie hatte keinen Grund, Karl wegen dieses Abends böse zu sein. Sie war vielmehr wütend auf sich selbst.
Margarete schüttelte den Kopf. Sie hatte keine Lust, sich jetzt darüber Gedanken zu machen. Und keine Zeit. »Was machen die Indikatoren?«
»Wenn du eines Tages darüber reden willst …«, begann er, brach seinen Satz dann aber ab.
Margarete zog die Augenbrauen zusammen und blickte zu ihm hinauf, sagte jedoch kein Wort.
Einige Sekunden lang hielt Karl ihrem Blick stand, doch schließlich seufzte er und zuckte mit den Schultern. Dann wandte er sich wieder den Öffnungen an der Oberseite der Uranmaschine zu. »Sieht alles gut aus hier oben.«
»Keine Blasen?«, fragte Margarete. Eine Blasenbildung im Wasserbecken hätte bedeutet, dass die Kugel undicht geworden war. Es durfte unter keinen Umständen Wasser in den Brenner eindringen. Die darin vorherrschende Hitze würde es schlagartig verdampfen lassen, was eine massive Explosion zur Folge haben würde. Dann hätten sie die Versuchsreihe vergessen können und vermutlich auch das halbe Institutsgebäude.
»Nein, keine Blasen«, antwortete Karl. »Was machen die Werte?«
Margarete blickte auf die Spannungsmessgeräte, die neben ihr auf der Tischplatte standen. Die Zeiger krochen träge die Skalen hinauf. »In Ordnung. Zwei Werte sind gleich beim Soll angelangt.« Sie sah auf die Uhr, die die Minuten seit Beginn des Experiments maß. Sechs Minuten, 34 Sekunden. Das war schnell. Sie spürte, wie ihr Puls anzog, hielt die Luft an und kniff die Augen zusammen. Ihr Blick schwenkte wieder auf das Messgerät. Einer der Zeiger hatte den Zielwert von 10 Volt fast erreicht. Das war das Zeichen dafür, dass einer der Indikatoren ein bestimmtes Maß an Strahlung aufgefangen hatte. Je schneller dieser Wert erreicht wurde, desto höher war der Wirkungsgrad der Maschine. »Noch ein paar Sekunden«, rief sie zu Karl hinauf, ohne sich zu ihm umzudrehen.
Hektisch suchte sie mit der Hand nach einem Bleistift, wobei ihr Blick fest auf die Skala des Spannungsmessgeräts geheftet blieb. Ihre Hand stieß gegen etwas Hartes, das scheppernd umfiel. Die Kaffeetasse, dachte sie, zum Glück war sie schon leer gewesen. Weiter hing ihr Blick an dem Zeiger, der langsam vorankroch. 9,5 Volt, 9,6 … Gleich würde er sein Ziel erreichen.
Endlich hatte Margarete den Bleistift gefunden, doch das Quietschen der Labortür ließ sie zusammenfahren. Konnten die Leute nicht lesen? Der Zutritt zum Labor war streng verboten, das stand in großen Lettern außen an der Tür. Die Messungen, die sie hier durchführten, waren sensibel. Außerdem lagen im ganzen Labor Kabel herum. Unbefugte Eindringlinge konnten großen Schaden anrichten, ohne es überhaupt zu bemerken. Zudem wusste niemand genau, wie lang und wie zuverlässig die Aluminiumhülle der Uranmaschine vor der darin freigesetzten Strahlung schützen würde. Der Versuchsaufbau, den sie hier verwendeten, war noch nirgendwo auf der Welt getestet worden. Sie befanden sich auf unbekanntem Terrain.
Margarete widerstand dem Impuls, sich umzudrehen und nachzusehen, wer sie bei der Arbeit störte. Stattdessen hielt sie den Blick auf die Anzeige des Messgeräts gerichtet. Nur noch ein paar Sekunden, dann würden die 10 Volt erreicht sein. Sie durfte den Augenblick nicht verpassen.
»Das Fräulein Brühl, emsig wie eh und je«, sagte eine bekannte Stimme hinter ihr. Sie gehörte zu Dr. Grambow, einem ihrer ausschließlich männlichen Kollegen am Institut.
Margarete presste die Lippen aufeinander und spürte, dass ihre Hand drohte, den Bleistift zu zerbrechen. »Dr. Grambow, ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie mich mit meinem vollen Namen ansprächen. Ich habe mich nicht umsonst jahrelang mit Männern wie Ihnen an der Universität herumgeschlagen.«
»Ei, ei, ei«, sagte Grambow hinter ihr, und Margarete konnte sich vorstellen, wie er dabei zu Karl hinübergrinste und eine Geste machte, als habe er sich verbrannt. »Bitte um Verzeihung, Gnädigste. Ich meinte natürlich: Fräulein von Brühl.«
»Fräulein Doktor von Brühl«, presste Margarete hervor, ohne sich umzudrehen. Der Zeiger des Messgeräts hatte die 10‑Volt-Marke erreicht. Margarete wirbelte herum, ihr Blick fand die Uhr. Sieben Minuten, zwölf Sekunden. Das war gut, sehr gut sogar. Ihr Gesicht entspannte sich und ließ ein Lächeln zu.
»Immer noch mit Ihren Dysprosium-Oxid-Indikatoren zugange, wie ich sehe?«, fragte Grambow hinter ihr. »Und die Schwerwasserschichten haben Sie noch weiter eingeschrumpft, wie ich hörte. Ob das mal gut geht … Sie wissen ja, diese Kernreaktionen können ganz schön … heikel werden.«
Margarete hörte nicht mehr hin. Nach und nach erreichten die anderen Messwerte den Sollwert von 10 Volt. Sie notierte die dazugehörenden Zeiten in einer Tabelle, die sie vor dem Experiment angelegt hatte. Wenn sie sich nicht irrte, dann waren die Werte dieses Mal besser als je zuvor. Möglicherweise hatte der veränderte Aufbau mit den dünneren Absorberschichten innerhalb der Maschine den Absorptionskoeffizienten entscheidend verringert. Das würde bedeuten, dass die von ihr entwickelte Maschine endlich die Wirkung erzielte, die die Theoretiker mit ihren Berechnungen vorausgesagt hatten. Doch das würde sie erst noch überprüfen müssen, bevor sie Professor Braun über ihre Ergebnisse informieren konnte. Es würde noch eine lange Nacht werden.
Plötzlich trat Grambow dicht hinter sie. Sie konnte seinen Atem hören und sein strenges Rasierwasser riechen. »Ist es nicht schrecklich ernüchternd festzustellen, dass Sie so hart arbeiten können, wie Sie wollen, und trotzdem für die meisten hier immer nur das Fräulein Brühl bleiben werden?«
Hitze schoss in Margaretes Gesicht. Sie wollte sich gerade umdrehen, um Grambow zurechtzuweisen, doch dann ertönte erneut das Quietschen der Labortür. Professor Braun, erkennbar an seinem Schnauzbart, dem verbeulten braunen Cordanzug und dem bunten Seidenschal, den er ständig trug, trat ein und hielt die Tür hinter sich auf. Ihm folgte ein schmächtiger, aber kerzengerader Mann in einer grauen Uniform mit blitzenden Rangabzeichen auf den Schultern. Er hielt einen schwarzen Aktenkoffer in der Hand und blickte sich prüfend um, als er das Labor betrat. Margarete wunderte sich, dass der Mann schwarze Lederhandschuhe trug, obwohl es draußen sicherlich 30 Grad im Schatten waren.
Grambow neben ihr schlug die Hacken zusammen und zeigte einen zackigen Hitlergruß. Margarete hob ebenfalls den Arm, jedoch weit weniger energisch. Braun winkte ihnen zu, der Uniformierte machte keine Anstalten, sie zu grüßen.
»Fräulein Brühl, wie schön, dass ich Sie hier treffe«, sagte Braun, wobei die letzten Worte in einem Hustenanfall mündeten, der ihn veranlasste, ein Stofftaschentuch aus einer Tasche seines Sakkos zu fummeln. Der Uniformierte machte einen Schritt zur Seite. »Verzeihen Sie bitte, ich habe mir wohl eine leichte Sommergrippe eingefangen.« Unschlüssig blickte der Professor hin und her, bevor er seinen Begleiter vorstellte. »Gestatten, das ist Kriminalrat Schander von der Gestapo. Ich führe ihn ein wenig herum.«
»Heil Hitler, Fräulein Brühl.« Schander ließ seinen Blick auf Margarete ruhen, einen Moment nur, dann sah er sich weiter im Raum um. Stahlblaue wache Augen. Grambow und Karl würdigte er keines Blicks.
Margarete war zu überrascht, um etwas zu erwidern. Sie hatten wenig Besuch im Institut und schon gar keinen in Uniform. Ihre Forschung wurde der Öffentlichkeit gegenüber streng geheim gehalten, und die Reichsführung schien sich nicht mehr sonderlich für sie zu interessieren, seit sie den Plan zur militärischen Nutzung der Kernphysik verworfen hatte. Sie wandte sich Professor Braun zu. »Wir haben gerade unseren Testlauf beendet. Wenn Sie noch einen Moment Ihrer Zeit entbehren wollen, können Sie gleich die aktuellen Werte erfahren.«
Brauns Gesicht hellte sich auf, dann schüttelte ihn ein erneuter Hustenanfall. »Das ist ja ein grandioser Zufall. Ich kann es kaum erwarten. Sehen Sie, Herr Schander, hier stehen Sie vor dem Zentrum unserer Arbeit, der Uranmaschine. Eines Tages wird sie alle Kraftwerke im Reich ersetzen. Was für ein Glück, dass wir gerade eine Messung mitbekommen. Haben Sie noch einen Moment?« Er blickte zu dem Gestapomann hinüber, der seinen Blick weiter durch den Raum schweifen ließ.
»Das wird nicht nötig sein.« Schander fixierte Margarete. »Haben Sie Dank für Ihre Zeit, Fräulein Brühl«, sagte er und verließ das Labor. Der Professor sah Margarete an, zuckte entschuldigend mit den Schultern und folgte ihm.
»Was war das denn?«, fragte Karl, nachdem die beiden Männer das Labor verlassen hatten.
Margarete blickte die Tür an, durch die sie gegangen waren, und schüttelte den Kopf. »Ich habe keine Ahnung.«
»Ist Ihnen etwas aufgefallen?« Grambow blickte sie an und grinste. »Auch diese beiden haben Sie nur Fräulein Brühl genannt.«
»Wohingegen Sie gar nicht erst bemerkt wurden.« Margarete verdrehte die Augen und wandte sich wieder ihrer Arbeit zu. Aus dem Augenwinkel konnte sie sehen, wie Grambow das Labor verließ. Sie wandte sich Karl zu und stemmte die Hände in die Hüften. »Weißt du was, ich habe mich anders entschieden. Lass uns heute Abend ausgehen.«
Schnaufend schleppte sich Oberwachtmeister Wilhelm Leitner die Stufen hoch, die in den ersten Stock der Leitstelle führten. Die johlende Stimme seines Kameraden Max Türauf begrüßte ihn. »Da brat mir doch einer ’nen Storch! Willi, du hier und nicht am Tresen bei der dicken Bertha?«
Die Männer des zweiten Löschzugs der Leipziger Feuerschutzpolizei saßen im Aufenthaltsraum der Wache um einen Tisch herum und grölten vor Lachen. Doch Wilhelm ging nicht auf den Spruch ein, den Türauf, ein großer, drahtiger Endzwanziger mit einer markanten Zahnlücke, gemacht hatte. Seit Wilhelm seinen Männern mitgeteilt hatte, dass er dem Alkohol endgültig entsagt hatte, zogen sie ihn umso mehr mit seiner früheren Trinkfreudigkeit auf. Es war eine milde Form des Spotts, mit der er als Zugführer leben konnte. Sein kameradschaftlicher Führungsstil stieß jedoch nicht überall auf Begeisterung. Mehr als einmal hatte Hauptmann Fink ihn schon zum Gespräch gebeten und ihm eingebläut, dass es seine Pflicht war, unbedingten Gehorsam einzufordern. Doch Türauf, der Sprücheklopfer, war ein guter Feuerwehrmann. Wilhelm konnte sich auf ihn verlassen, deswegen vergab er ihm den einen oder anderen unangemessenen Spruch. Wer gut arbeitete, der erwarb sich mit den Jahren Sonderrechte, so hatte Wilhelm es immer gehandhabt. Es war wichtig, die Moral hochzuhalten. Meistens gelang ihm das, doch er wusste, dass es in der Feuerschutzpolizei Leipzig auch Männer gab, die mit seinen Einstellungen absolut nicht einverstanden waren.
Kopfschüttelnd setzte Wilhelm sich zwischen seine Kameraden in den grünen Uniformen und goss sich einen Kaffee ein. Schwarz. Zumindest so schwarz, wie der verdammte Getreidekaffee eben sein konnte. »Hat einer was zu rauchen?«, fragte er in die Runde, woraufhin ihm eine Packung Zigaretten gereicht wurde. Wilhelm hatte wieder einmal aufgehört. Aufgehört, sich selbst Zigaretten zu kaufen. Die waren eh nicht mehr so leicht zu bekommen und dementsprechend teuer. Außerdem hasste Ida es, wenn er rauchte. Aber welche Wahl hatte er schon? Seit er nicht mehr trank, kamen ihm die Abende endlos lang vor, und irgendein Laster musste ein Mann nun einmal haben.
»Liegt was an?« Wilhelm blickte in die Runde. »Hat die Tagschicht uns was dagelassen?«
Türauf schüttelte den Kopf. »Alles ruhig.« Dann entblößte er grinsend seine Zahnlücke. »So wie bei dir im Bett, hab ich recht?« Wieder brüllten die Männer vor Lachen.
Wilhelm schluckte. »Übertreib es nicht, Max.« Einige der Kameraden wechselten besorgte Blicke, als fürchteten sie, dass Wilhelm nun doch noch an die Decke gehen würde. Sprüche über sein Eheleben unterließ man besser, das hatte Wilhelm anhand einiger Tobsuchtsanfälle, teils mit körperlicher Komponente, klargemacht.
»Nichts für ungut, Willi.« Türauf klopfte ihm auf die Schulter. »Lass uns die Daumen drücken, dass es so ruhig bleibt, dann schicken wir Henning los, damit er uns ein paar Bier besorgt!« Erschrocken blickte er Wilhelm an. »Und eine Flasche Apfelsaft.«
Wilhelm wollte gerade etwas entgegnen, als plötzlich die Alarmglocke losschepperte. »Das Bier müsst ihr euch wohl erst noch verdienen.« Er kippte den Kaffee hinunter. Zum Glück war er schon fast kalt gewesen, sonst hätte er sich den Schlund verbrannt. Stolz beobachtete er, wie die Männer seines Löschzugs in eine professionelle Geschäftigkeit verfielen. Zigaretten wurden ausgedrückt. Dann ließen sie sich, einer nach dem anderen, die Rutschstange hinabgleiten, die hinter einer Schwingtür verborgen war und direkt in die Fahrzeughalle im Erdgeschoss führte.
Unten angekommen, führte ihr Weg sie im Laufschritt an einer Reihe Haken vorbei, an denen ihre Helme hingen. Wilhelm lief als Letzter, nachdem der Funker ihm den Einsatzort genannt hatte. Connewitz. Spitze, dachte Wilhelm. Die Häuser dort waren alt und morsch und brannten wie Zunder. Er nahm seinen Helm und hängte dafür seine Mütze an den Haken. Dann griff er nach dem Ledergürtel, an dem eine kleine Axt, eine Gasmaske und ein Seil hingen. Die Männer setzten sich seitlich auf den Löschwagen. Ihre Bewegungen zeugten von jahrelanger Routine. Zufrieden ging Wilhelm um das Fahrzeug herum, stieg in die Fahrerkabine und hievte sich auf den Beifahrersitz. »Fahr los!«, sagte er zu Türauf, der neben ihm auf dem Fahrersitz Platz genommen hatte.
Das Tor der Fahrzeughalle war schon geöffnet worden. Türauf schaltete die Alarmglocke des Löschfahrzeugs ein und drückte auf das Gaspedal. Auf der Straße erwartete sie eine Gruppe zerlumpter Kinder, die schreiend mit dem Wagen mitlief, bis sie nicht mehr Schritt halten konnte. Wilhelm tippte sich an den Helm und lächelte. An einer Kreuzung hielt ein Schutzpolizist den Verkehr für sie auf, sie kamen gut voran. Das Straßenbild verlor zusehends an Glanz, je weiter sie sich vom Stadtzentrum in Richtung Süden entfernten. Die Fassaden bestanden hier nicht mehr aus Sandstein, sondern aus den groben roten Ziegeln, aus denen auch das Haus gebaut war, in dem Wilhelm geboren war. Gar nicht so weit von hier, dachte er. Müll lag auf den Straßen. Wilhelm konnte Rauch riechen. »Wir sind gleich da, Männer, macht euch bereit!«
Sie bogen um eine weitere Ecke, dann konnte Wilhelm es sehen: eine Mietskaserne. Flammen schlugen aus dem zweiten Stock, schwarzbrauner Qualm hing zwischen den Häuserzeilen. Die Straße lag im Dunkeln, obwohl die Junisonne noch am Himmel stand. Schaulustige hatten sich versammelt und stoben auseinander, als sie den Löschzug kommen hörten. Türauf trat auf die Bremse. Die Männer sprangen ab, formierten sich in einer Reihe und zeigten den Hitlergruß. Wilhelm erwiderte den Gruß nicht, auch wenn er dafür schon einmal offiziell von seinem Vorgesetzten gerügt worden war.
Er musterte seine Mannschaft. Ihre Gesichter wirkten ruhig. »Männer, ich weiß, wie ihr euch fühlt! Ihr habt Durst! Mann, ich wünsche mir selbst gerade nichts mehr als ein kühles Helles! Aber hier gibt es vielleicht Leben zu retten, also lasst uns die Sache durchziehen!« Die Männer brüllten ein lautes »Jawoll!«, dann ergriff Wilhelm wieder das Wort: »Schulze, Hellers: Schläuche ausrollen! Kranach, Meier: Wasserversorgung aufbauen! Lebert, Müller: Drehleiter ausfahren! Schaut, ob ihr von außen an die Wohnungen rankommt. Die anderen: Masken auf und mir folgen!«
Wilhelm nahm den Helm ab und zog die Gasmaske über. Er hasste die Dinger. Er bekam unter normalen Umständen schon schlecht Luft. Unter der Maske hatte er das Gefühl zu ersticken. Und die drückende Hitze, die seit Wochen über der Stadt lag, machte es nicht besser. Sein Atem rasselte. Im Laufschritt bewegte er sich zur Eingangstür und ließ den rechten Arm seitlich neben sich kreisen. Wegen der Masken musste die Kommunikation ab jetzt über Handzeichen erfolgen. Türauf, Menge und Walloschke sammelten sich hinter ihm und warteten auf weitere Befehle. Wilhelm nickte ihnen zu und hob den Arm. Dann stieß er ihn mehrmals hintereinander nach oben, der Marschbefehl. Die Männer liefen an ihm vorbei ins Treppenhaus der Mietskaserne.
Wilhelm wollte ihnen folgen, doch dann sah er Müller auf sich zu laufen, einen blutjungen Kerl, dem ein spärlicher Flaum unter dem Kinn wuchs. Verdammt, der sollte sich doch um die Leiter kümmern! Müller bewegte den Mund, er schien Wilhelm etwas zuzurufen, doch der konnte ihn nicht verstehen. »Scheiße!«, entfuhr es ihm. Er zog sich die Maske vom Gesicht. »Was ist los, warum bist du nicht auf dem Wagen und fährst die Leiter aus?«
»Wir haben neue Befehle erhalten.« Der junge Mann mit den blonden Bartstoppeln zuckte mit den Schultern und zeigte auf einen vielleicht vierzehnjährigen Bengel, der auf einem Fahrrad lümmelte. »Wir sollen den Einsatz abbrechen. Die Einsatzbereitschaft der Feuerschutzpolizei soll in Zeiten drohender Bombenangriffe nicht durch nachrangige Einsätze beeinträchtigt werden.«
Wilhelm traute seinen Ohren nicht. »Nachrangige Einsätze? Was redest du für einen Scheiß, Müller?«
»Ich sage nur, was er mir gesagt hat.« Müller zeigte wieder auf den Jungen auf dem Fahrrad. »Der kommt gerade aus der Wache und überbringt den Befehl direkt von Hauptmann Fink. Die Freiwillige aus Connewitz soll sich um das hier kümmern.« Er machte eine Geste zu dem brennenden Haus hin.
»Nachrangige Einsätze«, wiederholte Wilhelm. »Was zur Hölle soll das sein, wieso sollen wir hier nicht löschen?«
Müller sah sich um und zuckte wieder mit den Schultern. »Willi, schau dich mal um.«
Wilhelm tat, wie ihm geheißen, und schüttelte mit dem Kopf. Er konnte sich keinen Reim darauf machen. »Was? Nun sprich schon! Klär mich auf!«
Müller sah zu Boden. Dann blickte er Wilhelm direkt an. »Wir sind hier mitten in Connewitz. Kommunisten! Du verstehst?«
»Einen Scheiß verstehe ich!« Wilhelm schrie beinahe. »Die wollen mir verbieten, die Wohnungen von ehrlichen Arbeitern zu löschen? Denen werde ich was erzählen. Ich habe gerade drei Männer in dieses Haus geschickt, und denen werde ich folgen!« Er stampfte mit dem Fuß auf. »Und du, Müller, wirst die Drehleiter ausfahren und das verdammte Ding hochklettern. Wir werden die Menschen, die in diesem Haus eingeschlossen sind, nicht im Stich lassen. Hast du mich verstanden?«
Müller nickte.
»Dann sieh zu, dass du auf die Leiter kommst!«
Müller drehte sich hastig um und lief zurück zum Wagen.
»Und du!« Wilhelm brüllte zu dem Jungen auf dem Fahrrad hinüber. »Fahr zurück zur Wache und bestell Hauptmann Fink einen schönen Gruß von Oberwachtmeister Leitner! Die Einsatzbereitschaft der Feuerschutzpolizei muss warten, bis ich hier fertig bin!« Der Junge trat in die Pedale und sah zu, dass er Land gewann.
Wilhelm schüttelte den Kopf, griff in die Tasche seines Mantels und fingerte seine Taschenuhr hervor. Er klappte sie auf, und sein Blick fiel auf die verblichene Fotografie, die in den Deckel eingelassen war. Ida und er, Arm in Arm. Er war damals noch dünner gewesen, seine blonden Haare, mit Pomade nach hinten gekämmt, hatten noch weniger graue Strähnen gezeigt. Doch Ida hatte sich kaum verändert, zumindest äußerlich. Ihre grauen Haare, die hellbraunen Augen. Ein Lächeln stahl sich auf sein Gesicht. Er küsste das Bild, wie er es vor jedem Einsatz machte. Dann verstaute er die Taschenuhr wieder, streifte sich die Maske über und betrat das Gebäude. Im Treppenhaus bröckelte der Putz von den Wänden.
Von oben konnte er Schreie hören.
»Ich brauche mehr Zeit.« Professor Braun hob abwehrend beide Hände, wobei sich sein alberner Seidenschal lockerte und ihm wie ein indisches Kleid über die Brust rutschte. »Wenn wir es jetzt überstürzen, dann riskieren wir die ganze Operation.«
Kriminalrat Gerald Schander saß in einem unbequemen Sessel in Brauns Büro und massierte seine Hände, die höllisch juckten und wie immer in schwarzen Lederhandschuhen steckten. Er ergötzte sich am Anblick des Professors, der sich vor Angst wand. Schander selbst verzog keine Miene, er blinzelte nicht einmal. »Zeit ist die einzige Ressource, von der wir nicht genügend haben«, erwiderte er. »Ich will es präziser formulieren: Zeit ist die Ressource, von der Sie nicht genügend haben. Nicht mehr.« Er starrte Braun an, immer noch, ohne zu blinzeln.
Der Professor stöhnte und fuhr sich mit der Hand durch die Haare, wobei sich der grellbunte Schal vollends löste und ihm auf den Schoß rutschte.
Schander verdrehte innerlich die Augen. Er hatte Braun im Laufe des vergangenen Jahres exakt 19 Mal getroffen. An 17 Tagen hatte der Professor diesen hässlichen Schal getragen. Schander vergaß nie etwas. Auch wenn er sich manchmal wünschte, es zu können. Diesen Schal zum Beispiel hätte er mit Freuden aus seinem Gedächtnis getilgt. »Unsere Operation muss jetzt in die nächste Phase übergehen. Mit jedem Tag, den wir vergeuden, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Wind von der Sache bekommt.« Schander faltete die Hände vor der Brust. »Unsere Neuentwicklung muss getestet werden. Meine Kontaktleute bei der Wehrmacht scharren mit den Hufen. Wir haben bereits einen Testtermin vereinbart.«
Braun riss die Augen auf. »Was? Ohne mich einzubeziehen?«
Schander schwieg. Sollte Braun doch allein darauf kommen, was das bedeutete.
Der Professor legte den Seidenschal auf seinen Schreibtisch, dann erhob er sich und massierte mit der Hand sein Gesicht. »Wir sind am Institut gerade in einer sehr arbeitsreichen Phase. Sie haben es ja selbst gesehen. Mit der Uranmaschine stehen wir kurz vor dem Durchbruch.«
»Ihre Uranmaschine interessiert mich nicht.«
Braun sah ihn an und legte die Stirn in Falten. »Wenn ich jetzt aufbreche, wird das Fragen aufwerfen.«
»Sie werden eine gute Erklärung brauchen.« Schander nickte. »Ich bin sicher, dass Ihnen da etwas einfällt.«
Braun trat an seinen Schreibtisch und stützte sich mit den Armen darauf ab. Eine Zeit lang schien er nachzudenken, dann schüttelte er den Kopf und sah Schander an. »Es ist zu riskant. Das Produkt ist noch nicht ausgereift. Was, wenn der Test fehlschlägt?«
»Wird er das?« Schander zog eine Augenbraue hoch.
Braun schüttelte energisch den Kopf. »Natürlich nicht. Das heißt, ich hoffe es!« Er zögerte und fügte dann hinzu: »Deswegen nennt man es ja einen Test, nehme ich an.«
Diesmal musste sich Schander ein Grinsen verkneifen. Braun hatte tatsächlich einen gewissen Unterhaltungswert, wenn auch unfreiwillig. »Ich rate Ihnen, in dieser Sache nicht zu versagen, Braun!« Er griff mit der rechten Hand nach seinem linken Handschuh und begann, ihn von seiner Hand zu ziehen. Dann zog er auch den rechten Handschuh aus. Dabei beobachtete er, wie Brauns Gesichtszüge entgleisten. Offenbar hatte der Mann noch nie Brandnarben dritten Grades aus dieser Entfernung gesehen.
Schander rückte näher an Brauns Schreibtisch heran und faltete die Hände auf der Tischplatte. »Es darf keinen Fehlschlag geben. Die Operation ist zu weit fortgeschritten. Ich erwarte, dass der Test wie geplant in drei Tagen stattfinden kann. Sie fahren noch heute nach Ohrdruf und treffen die nötigen Vorbereitungen. Haben wir uns verstanden?«
Braun nickte. Er konnte den Blick nicht von Schanders Händen lösen. Zugegeben, sie waren kein schöner Anblick. Zwar waren alle zehn Finger vorhanden, doch waren sie teilweise kaum noch als solche zu erkennen. Die Brandnarben, die ihn schon fast sein ganzes Leben lang begleiteten, hatten seine Hände zu Klauen verformt. Klauen aus weißem Gewebe, das zu wuchern schien, wie es ihm beliebte. Früher war Schander oft dafür verspottet worden, weswegen er dazu übergegangen war, Handschuhe zu tragen. Doch bei bestimmten Menschen, solchen, die von ihren Gefühlen geleitet wurden, wirkte ihr Anblick Wunder. Er konnte Brauns Angst förmlich riechen. »Haben wir uns verstanden?«
Braun hob den Blick und sah ihn an. Dann nickte er. »Ja. Ich habe verstanden. Ich reise noch heute ab.«
»Gut.« Schander bückte sich und stellte den schwarzen Aktenkoffer, den er mitgebracht hatte, auf den Schreibtisch. »Für Ihre Auslagen.«
Braun nickte und reichte ihm zum Abschied die Hand hin.
Schander betrachtete sie. Bei dem Gedanken, sie zu ergreifen und zu schütteln, wurde ihm schlecht. Brauns Hand glitzerte im Licht, das durch das Fenster hereinfiel, sie wirkte nass und klebrig. Nie im Leben würde er sie berühren. Langsam begann Schander, seine Handschuhe wieder anzuziehen. Dabei ließ er Braun nicht aus den Augen. Auch auf der Stirn des Professors sammelte sich Schweiß.
Schließlich hatte Schander die Handschuhe wieder angelegt. Doch anstatt Brauns Hand zu schütteln, hob er seine Rechte und sagte: »Heil Hitler!«
Braun wirkte verdutzt und beeilte sich, es ihm gleichzutun.
Dann wandte Schander sich zum Gehen. Kurz bevor er die Tür erreicht hatte, drehte er sich noch einmal um. »Sie erinnern sich, dass ich Ihnen das Leben gerettet habe?«
Braun sah ihn ausdruckslos an.
Schander wandte sich ab. Erst jetzt, als Braun sein Gesicht nicht mehr sehen konnte, gestattete er sich ein Lächeln. Es war ein leichter Sieg gewesen.
Die Uhr über der Labortür zeigte kurz nach sechs an. Karl war schon gegangen, doch Margarete war noch mit den Nachbereitungen des Testlaufs beschäftigt. Nachdenklich betrachtete sie die Uranmaschine, die sie an mehreren groben Stahlketten mithilfe eines modernen Elektromotors aus ihrem Wasserbecken gehoben hatten. So würde sie vor dem nächsten Testlauf einfacher zu warten sein.
Sie trat an das Wasserbecken heran und blickte hinab. Die Oberfläche lag jetzt ganz still da. Margarete konnte ihr Gesicht in der Spiegelung betrachten. Die dunklen Augen, die blasse Haut, den Leberfleck auf der Wange. Mit der Hand richtete sie behutsam ihre Frisur. Als sie endlich an die Universität gehen konnte, hatte sie begonnen, sich die rötlich-braunen Haare mit einem Marcel-Eisen in streng geformte Wellen zu legen – wie Marlene Dietrich. Damals hatte sie auch angefangen, Hosen zu tragen, und sich ihre geliebte schwarze Baskenmütze gekauft. Ihre männlichen Kommilitonen hatten Augen gemacht.
Margarete neigte den Kopf zur Seite und starrte ihrem Spiegelbild entschlossen entgegen. Diesmal würde sie allen beweisen, dass sie ihren Doktortitel zurecht trug.
Sie betrachtete die Zahlen, die sie auf dem Zettel in ihrer Hand notiert hatte. Die Zeiten, die die Spannungsmessgeräte benötigt hatten, um auf die vorher festgelegte Marke von 10 Volt zu klettern, sahen vielversprechend aus. Jetzt fehlte lediglich noch ein wenig Mathematik, um aus diesen Zeiten den Wirkungsgrad der Maschine zu berechnen. Ihrer Maschine. War es ihr diesmal gelungen, den Aufbau so zu optimieren, dass sich die Neutronen, die freigesetzt wurden, in den Uranschichten selbst vermehrten? Dann wäre es ihr zum ersten Mal in der Geschichte gelungen, eine Kettenreaktion in Gang zu bringen, die allein auf den Prinzipien der Kernspaltung beruhte! Margarete spürte das Kribbeln im Bauch, das immer dann auftrat, wenn sie vor einem Durchbruch stand. Diesmal würde es nicht ausreichen, dem Fräulein Brühl lobend auf die Schulter zu klopfen. Nein, diesmal wäre eine Beförderung fällig. Ehrliche Anerkennung. Ihr Gesicht, das sich auf der Wasseroberfläche spiegelte, lächelte.
Die Absätze ihrer hohen Schuhe erzeugten auf dem Betonboden des Labors ein Stakkato scharfer Geräusche, die von den rohen Wänden zurückgeworfen wurden. Als sie in der Tür stand, drehte sie sich noch einmal um und blickte zur Uranmaschine zurück. Schlaf gut, dachte sie, ich bin bald wieder da. Dann zog sie die Tür hinter sich zu und verriegelte sie mit mehreren Schlössern, zu denen verschiedene Schlüssel gehörten. Ihr Blick fiel auf die Aufschrift »Virushaus«, die Professor Braun darauf hatte anbringen lassen, um Schaulustige abzuhalten. Margarete schüttelte den Kopf. Der Professor hatte schon immer verrückte Ideen gehabt. Vermutlich war das eine hilfreiche Eigenschaft für einen theoretischen Physiker.
»Herein!«, hörte sie Braun wenig später rufen, nachdem sie an seine Bürotür geklopft hatte. Sie betrat das Büro. Es war viel zu klein und dunkel für einen so wichtigen Mann. Der Professor stand gebeugt hinter seinem klobigen Schreibtisch und hustete in ein Taschentuch. Vor ihm auf der Tischplatte verstreut lag ein Haufen Papiere, daneben stand seine helle Ledertasche. Seinen Schal hatte er abgelegt und zusammen mit einem schwarzen Aktenkoffer auf einen Stuhl in einer Ecke des Raums gelegt. Sein Haar stand ihm wirr vom Kopf ab, als er von seinen Aufzeichnungen aufblickte und Margarete anlächelte. »Fräulein Brühl, wie schön, sie so schnell wiederzusehen. Es ist so ein wundervoller Tag.« Er blickte aus dem Fenster zu seiner Rechten. Dabei verzog er die Nase, als würde sie ihn jucken.
Margarete beschlich für einen Moment ein seltsames Gefühl. Hatte Braun geweint? Da war ein Blitzen in seinen Augen, das sie so noch nie gesehen hatte. Sie verdrängte den Gedanken, straffte sich und schritt auf seinen Schreibtisch zu. Mit auffordernd hochgezogenen Augenbrauen legte sie die aufgezeichneten Messwerte auf das Durcheinander, das auf der Tischplatte herrschte. Braun zog seine Brille aus der Brusttasche seiner Weste und hielt den Zettel dicht vor seine Augen. »Ah, Ihre Ergebnisse.« Er legte die Notizen vor sich ab. Dann sah er Margarete an und rieb sich die Nase. »Stimmen die Messwerte mit den theoretischen Vorhersagen überein? Haben Sie sie schon überprüft?«
Margarete legte den Kopf schief. »Noch nicht. Ich komme gerade erst aus dem Labor, wie Sie wissen.«
»Ja, richtig.« Braun nickte. Sein Blick ging an Margarete vorbei.
»Ich werde mich gleich morgen früh an die Arbeit machen.«
Wieder nickte Braun. Dann sah er Margarete direkt in die Augen. »Das ist gut. Wir müssen absolut sicher sein, dass uns kein Fehler unterläuft. Es darf keine Fragezeichen mehr geben. Wenn auch nur der Hauch einer Unsicherheit besteht, möchte ich, dass Sie das Experiment morgen noch einmal wiederholen. Alles muss wasserdicht sein.«
Margarete schluckte. So bestimmt trat Braun selten auf. Er leitete das Institut eher wie ein gütiger Vater, der zufrieden mit seinen Kindern war, solange sie nicht das Porzellan zerschlugen und ihn ansonsten in Ruhe ließen. »Gibt es etwas, das ich wissen sollte?«
Der Professor zog einen Mundwinkel hoch. »Das Fräulein Brühl, blitzgescheit wie immer.« Er blickte kurz hinab zu ihren Aufzeichnungen, dann sah er Margarete direkt an. »Heisenberg kommt aus Berlin hierher. Schon Ende der Woche, am Freitag.«
Margarete japste. »Der Heisenberg?«
»Genau der.«
»Ende der Woche schon«, wiederholte Margarete. In ihrem Kopf ratterten die Gedanken. Professor Heisenberg war Nobelpreisträger, eine Koryphäe. Sie hatte ihn während ihres Studiums in Berlin bei einer Vorlesung erleben dürfen und war seit diesem Tag fest entschlossen, ihr Glück in der Kernphysik zu suchen. Mittlerweile leitete Heisenberg das gesamte Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik in Berlin. Und nun würde er ihre Maschine sehen und ihren Bericht lesen. Margarete schluckte und wischte sich eine Strähne aus dem Gesicht. »Ich werde mich heute Abend noch an die Berechnungen machen, das ist gar kein Problem. Dann können wir morgen früh die Ergebnisse besprechen und beraten, wie wir weiter vorgehen wollen.« Ihre Gedanken überschlugen sich. Sie würde Karl absagen müssen. Doch dies war ihre Chance! Sie musste bis Freitag vernünftige Werte produzieren, um sie Heisenberg präsentieren zu können. Wenn sie ihn überzeugen konnte, dann würden die Zweifler endlich verstummen. Wer konnte es schon wissen, vielleicht würde er sie mit nach Berlin nehmen, ans Kaiser-Wilhelm-Institut?
Braun trat ans Fenster und blickte hinaus in den auf der anderen Seite der Linnéstraße gelegenen Neuen Johannisfriedhof. Es schien, als würde er auf seiner Unterlippe herumkauen. »Ich muss einige Tage verreisen und bin schon so gut wie weg. Ich werde Sie mit Ihrer Arbeit leider allein lassen müssen.«
»Verreisen?« Margarete runzelte die Stirn. »Aber … Professor, ich könnte hier Ihre Hilfe gebrauchen!«
Braun lächelte Margarete an. »Meine Hilfe? Ich denke, Sie kommen schon ganz gut ohne mich zurecht.« Er nahm einige Papiere von seinem Schreibtisch, warf einen prüfenden Blick darauf und stopfte sie in die Ledertasche, die vor ihm stand. Dann schritt er an ihr vorbei und nahm ein Ölgemälde einer süddeutschen Landschaft von der Wand. Dahinter verbarg sich ein kleiner Tresor.
»Ist das alles?« Braun drehte sich um und musterte sie. »Ich habe noch zu tun.«
Margarete konnte seinen Blick nicht deuten. Warum verhielt er sich plötzlich so abweisend? Sie schüttelte den Kopf. »Ich … ich weiß nicht, ich bin wohl nur überrascht, das ist alles.«
Der Professor seufzte. »Glauben Sie mir, Sie schaffen das auch ohne mich. Und vielleicht bin ich bis Ende der Woche schon wieder in Leipzig, wer weiß.« Er blickte wieder aus dem Fenster und legte die Stirn in Falten. »Wer weiß …« Sein Blick richtete sich wieder auf Margarete. Er zwang ein Lächeln auf sein Gesicht. »Glauben Sie mir, alles wird gut werden.«
Wilhelm holte über die rechte Schulter aus und hieb die Axt in die Holztür, hinter der der Brand wütete. Helle Splitter klafften aus dem Holz, als er das Blatt der Axt löste und erneut ausholte. Er konnte den Rauch, der durch das Treppenhaus waberte, durch die Gasmaske hindurch riechen. Es war ein vertrauter Geruch. Wilhelm spürte keine Angst, dafür war er schon in zu viele brennende Wohnungen gestürmt. Doch eine vertraute Spannung pulsierte durch seine Adern. Pures Adrenalin, das seinen Blick schärfte und ihn die Schmerzen, die das Alter in seine Schultern und seinen Rücken entsandt hatte, ignorieren ließ. Diese Spannung durfte er niemals verlieren. Wer die Spannung verlor, der starb.
Wieder schlug er mit der Axt gegen die Wohnungstür. Dann löste er das Blatt und warf sich mit der Schulter gegen das, was von der Tür übrig geblieben war. Splitter flogen ihm entgegen, dann gab das Holz nach und machte den Weg in die Wohnung frei. Wilhelm achtete jetzt nicht mehr auf die Befehlskette, das Adrenalin übernahm die Kontrolle. Er stürmte voran, seine drei Kameraden folgten ihm. Linkerhand lag die Küche. Sie stand in Flammen. Vielleicht ein Fettbrand, dachte Wilhelm. Man sollte meinen, dass die hohen Butterpreise die Leute dazu brachten, gut auf ihr Bratfett aufzupassen.
Er drang weiter in die Wohnung vor. Offenbar war sie auch vor dem Brand schon in einem erbärmlichen Zustand gewesen. Wilhelm kannte solche Buden gut, er hatte den größten Teil seines Lebens in so einer gewohnt. Ein düsterer Flur, die Zimmer eher Löcher, doppelt und dreifach belegt, Klo und Wasser auf dem Hof.
Er gab seinen Kameraden ein Zeichen, die übrigen Räume zu durchsuchen, und lief weiter den Flur entlang, in einen Bereich, der zur Straße hinaus lag. Hier herrschte Chaos. Auf einem Bett lag ein geöffneter Koffer, im ganzen Zimmer stapelten sich Berge von Klamotten. Wilhelm stürzte zum Fenster, öffnete es und ließ das Seil hinab, das er am Gürtel getragen hatte. Unten wartete Schulze mit dem Schlauch. Schnell befestigte er das Seil an der Düse, und Wilhelm zog es wieder nach oben. Als er die Düse in den Händen hielt, sah er wieder aus dem Fenster, ließ den Arm über dem Kopf kreisen und stieß ihn dann nach oben. Wasser marsch! Schulze drehte den Hahn auf. Ein gewaltiger Druck baute sich im Schlauch auf, dann spritzte ein dicker Wasserstrahl aus der Düse. Wilhelm setzte sich in Bewegung, doch bevor er das Zimmer verlassen konnte, begann der Schlauch in seinen Händen zu beben. »O nein, verdammt!«, brüllte er. Luft in der Leitung. Der Wasserstrahl brach ab, wurde zu einem stotternden Spritzen. Dann stieg der Druck wieder, nur um gleich wieder abzubrechen. Wilhelm schüttelte den Kopf. Aber er hatte keine Wahl, er musste weiter.
In diesem Moment griff das Feuer auf den Holzboden im Flur über. »Scheiße!«, brüllte Wilhelm unter der Gasmaske. Menge und Walloschke kamen mit zwei verschreckten Kindern auf dem Arm auf ihn zugerannt. Sie schafften es gerade noch über den Flur, bevor die Tapeten Feuer fingen. Hinter ihnen brach ein Inferno los, die Flammen leckten an ihren Stiefeln. Wo war Türauf? Wilhelm schwenkte den stockenden Wasserstrahl im Flur von links nach rechts. Wo das Wasser auf die Flammen traf, zischte es gewaltig und milchige Dunstschwaden stiegen auf. Doch kaum führte Wilhelm den Strahl weiter, loderten die Flammen wieder auf. Etwas in der Lackierung der Bodendielen musste brennen wie Zunder. Und durch die Luft im Schlauch kam zu wenig Wasser am Brandherd an. Es war aussichtslos. So würden sie dieses Feuer nicht löschen können. Schlimmer noch: Durch diesen Flur und das dahinter liegende Treppenhaus konnten sie die Wohnung nicht wieder verlassen!
»Wo ist Türauf?« Wilhelm riss sich die Gasmaske vom Kopf und brüllte den Namen seines Kameraden. Keine Antwort. Rauch flutete seine Lungen. Mühsam unterdrückte er einen Hustenanfall. Vor ihm toste das Feuer, wurde mit jeder Sekunde wilder. Durch das geöffnete Fenster hatte sich in Verbindung mit der geöffneten Wohnungstür ein Kamineffekt eingestellt. Wilhelm fluchte. Am liebsten hätte er das Fenster geschlossen, damit die Zugluft die Flammen nicht noch weiter anheizen konnte. Doch es war der einzige Weg in die Freiheit.
Wilhelm blickte sich um. Hinter ihm machten sich Menge und Walloschke daran, die beiden Kinder, die bewusstlos zu sein schienen, durch das Fenster hinaus abzuseilen. Wo blieb die Drehleiter? Wilhelm machte ein paar Schritte auf seine Kameraden zu. »Wo ist die verdammte Leiter?«
Walloschke rief ihm etwas zu, das Wilhelm wegen der Gasmaske nicht verstand. Dann zuckte er mit den Schultern und hob den Jungen auf das Fensterbrett. Wilhelm hatte sein Seil um den Brustkorb des Jungen gelegt und dann um einen Haken an seinem Gürtel geschlungen. Er stemmte sich mit dem Fuß gegen die Wand, dann gab er dem Kind einen leichten Schubs. Für einen Moment fiel der Junge, der einen spitzen Schrei ausstieß, dann spannte sich das Seil und Walloschke ließ ihn zügig hinab. Währenddessen verschnürte Menge das Mädchen.
Wo blieb Türauf nur? Wilhelm dachte darüber nach, in den brennenden Flur zu rennen und die anderen Zimmer zu durchsuchen. Aber das wäre Selbstmord gewesen. »Wo ist Türauf?«, brüllte er Walloschke an. Erneut zuckte sein Kamerad nur mit den Schultern und schüttelte den Kopf. Wilhelm brach in lautes Husten aus. Er musste die Gasmaske wieder aufsetzen, sonst würde er nicht mehr lang durchhalten. »Wenn das Mädchen raus ist, lasse ich euch runter«, rief er noch, bevor er sich die Maske über das Gesicht zog.
Wilhelm lehnte sich aus dem Fenster und ließ die Hand über dem Kopf kreisen. Schulze verstand, und der Wasserstrahl verebbte. Es hatte keinen Sinn mehr. Diesen Brand würden sie mit ihren Mitteln nicht löschen können. Zumindest nicht, wenn sie überleben wollten. Die Flammen hatten mittlerweile schon auf das Wohnzimmer übergegriffen. Wilhelm spürte die Hitze durch den dicken Stoff der Uniform. Sie würden das Feuer später von außen bekämpfen müssen. Hoffentlich hatten seine Kameraden mittlerweile einen weiteren Leiterwagen angefordert.
Walloschke saß schon auf der Fensterbank, die Beine baumelten nach draußen. Menge band ihm das Seil um die Brust, dann ließen Wilhelm und er den Kameraden Stück für Stück hinabsinken. Wilhelm keuchte. Er stemmte sich gegen den Zug des Seils. Plötzlich ließ die Spannung nach. Menge und Wilhelm stolperten zurück. Wilhelm deutete auf das Fenster, während Menge das Seil wieder hochzog. Er sollte der Nächste sein. Die Hitze war mittlerweile kaum noch auszuhalten. Menge machte Anstalten, Wilhelm das Seil umzulegen, doch der wehrte ihn mit den Händen ab. Er würde dieses Haus als Letzter verlassen. Er riss seinem Kameraden das Seil aus der Hand und warf ihm eine Schlaufe über den Kopf. Schnell war Menge verschnürt. Er nickte Wilhelm zu, bevor er sich über den Fenstersims gleiten ließ.
Das Seil straffte sich. Wilhelm lehnte sich gegen das Gewicht und spürte einen heftigen Schmerz im Rücken. So schwer hatte Menge gar nicht ausgesehen. Wilhelm wusste, dass er diese Belastung nicht lang aushalten würde. Er ließ das Seil ein wenig schneller durch die Hände laufen. Ohne Handschuhe hätte es ihm das Fleisch von den Knochen gerissen, so viel war sicher. Hinter sich konnte Wilhelm das Feuer toben hören. Er nahm sich nicht die Zeit, sich umzublicken. Als Menge endlich unten ankam, sackte Wilhelm für einen Moment auf die Knie.
Einatmen. Ausatmen. Diese verfluchte Gasmaske.
Er rappelte sich wieder auf und öffnete die kleine Ledertasche, die an seinem Gürtel hing. Die Hitze versengte seinen Nacken, er musste sich beeilen, wenn er diesen Einsatz überleben wollte. Wilhelm riss sich einen Handschuh von der Hand und fingerte den Notnagel aus der Tasche. Er blickte sich um, suchte einen Holzbalken. Irgendetwas, das Halt versprach. Er konnte nichts entdecken. Wilhelm setzte den Nagel unterhalb der Fensterbank an und schlug ihn mit der stumpfen Seite seiner Axt in die Wand. Putz rieselte ihm entgegen, ein faustgroßes Loch tat sich auf. Keine Chance, hier würde der Nagel nicht halten. Wilhelm warf einen Blick zurück. Die Flammenwand war jetzt nur noch zwei Meter entfernt. Höchstens.
Wilhelm versuchte es erneut, diesmal einen halben Meter weiter rechts. Drei Schläge, dann saß der Nagel. Er wackelte noch einmal daran. Das würde genügen müssen. Wilhelm führte das Seil durch die Öse an seinem Gürtel und band einen Knoten um den Notnagel. Er atmete noch einmal durch, dann stieg er auf das Fensterbrett. Wenn der Notnagel seinen Halt verlor, würde Wilhelm gute zwölf Meter in die Tiefe stürzen. Als er sich aus dem Fenster gleiten ließ, schloss er die Augen.
Der Nagel hielt. Wilhelm konnte über sich Flammen aus dem Fenster schlagen sehen. Lang würde das Seil nicht halten. Er ließ es zwischen seinen Händen hindurchgleiten. Er hätte sich den zweiten Handschuh wieder anziehen sollen, dachte er noch, doch dafür war es nun zu spät. Das Seil schnitt schmerzhaft ein, aber gleich hatte er es geschafft. Noch drei Meter, noch zwei …
Als Wilhelm auf dem Bürgersteig ankam, sank er auf die Knie. Sein Puls raste, und er hatte Schwierigkeiten, Luft zu bekommen. So knapp war es lange nicht mehr gewesen. Was war das für ein verflucht beschissener Einsatz? Erst die Ansage, dass sie sich zurückziehen sollten, dann die Luft im Schlauch, die Drehleiter, die nicht ausgefahren worden war … und Türauf, was war mit Türauf?
Wilhelm blickte auf. Menge und Walloschke standen einige Meter abseits und rangen ebenfalls um Fassung. Wilhelm riss sich die Gasmaske vom Gesicht und blickte sich um. Die beiden Kinder lagen schon auf Tragen, seine Kameraden hatten ihnen Decken unter die Köpfe gelegt. Es schien ihnen einigermaßen gut zu gehen. Aus der Ferne konnte er mehrere Alarmklingeln hören. Offenbar war ein weiterer Löschzug im Anmarsch. Immerhin würde das Feuer wohl nicht den ganzen Straßenzug niederbrennen.
Dann erblickte er Türauf. Er schien wohlauf zu sein, seine Uniform sah tadellos aus. Da dämmerte es Wilhelm: Türauf war gar nicht in der Wohnung gewesen! Er richtete sich auf, taumelte für einen Moment und stolperte dann auf seinen Kameraden zu. »Wo warst du? Wir hätten dich gebraucht da oben!«
Türauf kam seinerseits auf Wilhelm zu. »Hätte ich mich etwa auch grillen lassen sollen?« Sein Gesicht war verzerrt vor Wut. »Es ist immer dasselbe mit dir, Willi! Stürmst einfach drauflos, ohne Plan! Und dann erwartest du, dass alle dir folgen und ihr Leben aufs Spiel setzen.« Wütend funkelte er Wilhelm an. Dann schüttelte er den Kopf. »Und wofür? Um so ein paar Kommunistenschweine zu retten?«
Wilhelm stockte der Atem. Er machte eine Geste zu den beiden Tragen, auf denen die Geretteten lagen. »Kommunistenschweine? Das sind Kinder!«
Türauf spuckte aus. »Die Kinder von Kommunistenschweinen.« Ein dicker weißlicher Speichelfleck breitete sich auf dem Bürgersteig aus und rann auf Wilhelms Stiefel zu.
Wilhelm stürzte auf seinen Kameraden zu und hämmerte ihm eine Faust ins Gesicht. Aus dem Augenwinkel konnte er sehen, dass Hellers und Müller von Kameraden zurückgehalten werden mussten, doch das war ihm gleichgültig. Diesem Arschloch würde er es zeigen!
Türauf spuckte erneut aus. Diesmal färbte der Fleck den Bürgersteig rot.
»Was für ein furchtbarer Film.« Margarete setzte ihre Baskenmütze auf und trat mit Karl in den immer noch heißen Juniabend vor dem Kino am Hauptbahnhof hinaus. Sie hatte noch einige Stunden lang am Schreibtisch in ihrem Büro gesessen und versucht, die Messwerte vom Nachmittag zu überprüfen. Doch in Wahrheit hatte sie sich den Kopf wegen des Verhaltens des Professors zerbrochen. Was war nur in ihn gefahren? Er schien ihr irgendetwas zu verschweigen. An effektives Arbeiten war jedenfalls nicht zu denken gewesen, dazu war sie zu verwirrt. Also hatte sie sich letztlich doch dazu entschlossen, Karl zu treffen. Wenn sie ihm diesen Abend schenkte, hätte sie für den Rest der Woche vielleicht Ruhe, um ihre Arbeit zu erledigen. Sie mochte ihn zwar, er war nett und lustig, aber sie wollte sich auf keinen Fall von ihm ablenken lassen. Nicht jetzt, wo sie mit der Uranmaschine so kurz vor dem Durchbruch stand.
Sie schüttelte den Kopf und sah Karl ins Gesicht. »Wie diese Hanna sich ihrem Paul an den Hals geworfen hat … widerlich! Und wie sie beide in der letzten Szene zum Horizont blicken und die Kampfflugzeuge über ihre Köpfe donnern …« Ihr Blick schweifte in die Ferne. »Und was ist das überhaupt für ein Titel, ›Die Große Liebe‹? Das soll Liebe sein? Die Unterwerfung der Frau durch den Mann und die Unterwerfung beider durch das Regime?« Margarete baute sich vor Karl auf und war kurz davor, ihn an den Schultern zu packen und zu schütteln. »Wie kann man nur so einen Dreck drehen?«
»Es freut mich, dass du so denkst«, flüsterte Karl ihr zu und lächelte, »aber vielleicht solltest du deinen Zorn noch für einen Moment zügeln.«
Margarete sah sich um. Karl hatte recht. Sie standen direkt vor dem Eingang des Kinos, an ihnen vorbei drängten die anderen Besucher der Vorstellung. Nicht wenige von ihnen trugen Uniformen. Und alle strahlten bis über beide Ohren und unterhielten sich vergnügt.
»Dieser Goebbels weiß schon, was er tut«, raunte Margarete Karl zu. »Tut mir leid, dass ich so ausfallend geworden bin, das ist eigentlich nicht meine Art.«
Er lächelte. »Mir tut’s leid, dass dir der Film nicht gefallen hat. Du hast mir zwei Stunden deiner kostbaren Zeit geopfert, und ich schleppe dich in so einen Schmachtfetzen.«
Margarete zuckte mit den Schultern und zwinkerte ihm zu. »Mach dir keine Gedanken.« Sie hielt ihm ihren Arm hin. »Geleitest du mich noch zurück ins Institut? Ich denke, jetzt ist mein Kopf frei genug, um noch ein paar Stunden über den Zahlen von heute Nachmittag zu brüten.«
Karl machte große Augen. »Du willst jetzt noch arbeiten?«
»Was spricht dagegen? Ich habe einen Generalschlüsselfür das Institut. Oder hattest du gehofft, ich würde dich wieder zu mir nach Hause entführen?« Sie grinste ihn an.
Karl hob die Hände. »Ich habe mich nicht entführt gefühlt, ich war höchstens überrascht!«
Margarete lachte auf. »Sagen wir, keiner von uns wollte das, was an diesem Abend passiert ist.«
Karl legte die Stirn in Falten. »So würde ich es nun auch nicht sagen.«
»Ich auch nicht.« Margarete küsste ihn auf die Wange.
Karl schüttelte den Kopf und grinste. Eine lockige Strähne strich über sein rechtes Auge. In diesem Moment fiel Margarete zum ersten Mal auf, wie sehr sie die Sommersprossen mochte, die links und rechts seiner schlanken Nase die helle Haut bedeckten.
Sie schlenderten Arm in Arm die Straße entlang, Richtung Süden. Bis zum Institut brauchte man zu Fuß etwa eine halbe Stunde. Karl pfiff eine Melodie, die Margarete bekannt vorkam. »Ist das aus dem Film?«
Er nickte und begann laut zu singen: »Ich weiß, es wird einmal ein Wunder gescheh’n, und dann werden tausend Märchen wahr.« Dabei tänzelte er mit weiten, federnden Schritten neben Margarete her und machte Gesten, die denen einer Operndiva glichen.
Margarete prustete vor Lachen.
»Wusstest du, dass der Komponist ein Homosexueller ist?«, fragte Karl.
»Er liebt Männer?«, fragte Margarete zurück und schüttelte den Kopf. »Der Arme! Wieso tut er sich das an?« Sie grinste Karl an. »Und woher weißt du so etwas?«
Karl zuckte mit den Schultern. »Ich habe es wohl irgendwo gelesen.«
Wenig später bogen sie in die Linnéstraße ein, in der das Physikalische Institut lag. Der Verkehr ruhte um diese Uhrzeit weitestgehend, also liefen sie in der Mitte der Straße auf dem Kopfsteinpflaster. Linkerhand lag dunkel der Friedhof. Vereinzelt stehende Straßenlaternen zeichneten gelbe Kreise auf den Bürgersteig.
Ein Schatten kam ihnen entgegen. Margarete löste ihren Arm, den sie bei Karl untergehakt hatte, und richtete ihre Frisur. Als der Schatten in einen der gelben Lichtkegel trat, erstarrte sie. Sie kannte diesen Mann! Aber was machte er hier in Leipzig?
»Fritze!«, rief sie, »Fritze Kowalski!«
Der Mann blieb stehen, blickte zu ihnen herüber und beugte sich leicht nach vorn. »Grete? Dit ist ja mal ein Zufall.« Er schlenderte auf sie zu. Kein Zweifel, es war tatsächlich Fritze. Margarete erkannte die speckige Lederjacke, die er schon vor einem Jahr in Berlin getragen hatte, als sie ihn zum letzten Mal gesehen hatte. Und den Berliner Akzent, der sie so oft zum Lachen gebracht hatte. Einige Schritte vor ihnen blieb er stehen und sah Karl an. »Anjenehm, Kowalski.«
Karl nickte ihm zu, dann blickte er zu Margarete.
»Was machst du denn hier?«, fragte sie an Fritze gewandt. Durch ihren Kopf schossen Bilder aus einer anderen Zeit. Sie hatte ihn in Berlin kennengelernt, als sie in den letzten Zügen ihrer Doktorarbeit gelegen hatte. Einige Kommilitonen hatten sie dazu überredet, nach einer späten Vorlesung tanzen zu gehen. Auf der Tanzfläche war sie Fritze im wahrsten Sinne in die Arme gestolpert. Sie hatte seine Art gleich gemocht. Er sagte, was er dachte. Aber er sagte auch nicht zu viel. Erst später war ihr klar geworden, dass beide Eigenschaften miteinander zusammenhingen. Jedenfalls waren sie eine Zeit lang miteinander ausgegangen. Nach zwei Wochen jedoch fing er an, ihr auf die Nerven zu fallen. Sie befand sich mitten im Stress der bevorstehenden Abgabe und konnte keinen Mann gebrauchen, der sie jeden Tag ausführen wollte. »Ick wollt nur mal nach dir gesehen haben«, hatte er dann stets gesagt. Irgendwann war es ihr zu viel geworden.
»Ick bin nur auf der Durchreise«, sagte Fritze und trat von einem Fuß auf den anderen. »Was Geschäftliches.« Unschlüssig blickte er zwischen ihr und Karl hin und her.