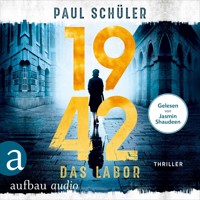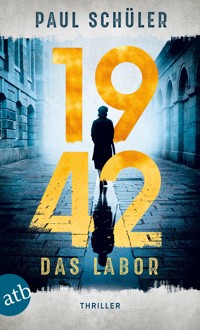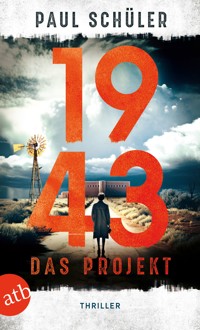
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Margarete von Brühl
- Sprache: Deutsch
Eine Forscherin – und der Kampf um die Atombombe.
Juni 1943: In der Hitze New Mexicos setzen Wissenschaftler wie Robert Oppenheimer alles daran, eine Atombombe zu entwickeln, um die Deutschen und Japaner zu besiegen. Margarete von Brühl, eine junge deutsche Forscherin, wird, ohne dass sie es durchschaut, in das Projekt in Los Alamos eingeschleust. Sie soll Informationen über den Bau der Bombe sammeln – und dann an die Nazis weitergeben. Als sie sich weigert, geraten sie und ihr Kind in größte Gefahr ...
Packend erzählt und auf wahren Begebenheiten beruhend.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Juni 1943: In der Hitze New Mexicos setzt eine Gruppe internationaler Wissenschaftler alles daran, im Rahmen des Manhattan Project eine Atombombe zu entwickeln. Sie sind getrieben von der Angst, dass das Deutsche Reich ihnen zuvorkommen könnte. Währenddessen lebt die deutsche Physikerin Dr. Margarete von Brühl mit ihrer drei Monate alten Tochter unter falschem Namen bei Leipzig auf dem Land, nachdem sie zuvor eine Verschwörung ranghoher Militärs vereitelt hat. Die Schatten der Vergangenheit holen Margarete ein, als sich ein Gestapo-Mann nach ihr erkundigt. Wenig später wird sie von einem US-Agenten angesprochen, der ihr anbietet, in den USA am Manhattan Project zu arbeiten. Margarete ahnt, dass eine Flucht in die USA ihre einzige Chance ist, zu überleben und dafür zu sorgen, dass die Bombe nie gebaut wird – von niemandem.
Über Paul Schüler
Paul Schüler, Jahrgang 1986, studierte in Hannover erst Architektur, später Physik und Mathematik. Nach einigen Jahren als Songschreiber, Sänger und Gitarrist der Band »Ich Kann Fliegen« und diversen journalistischen Tätigkeiten begann er als Lehrer zu arbeiten. Zurzeit lebt er in Mexiko.
Im Aufbau Taschenbuch ist bisher sein Thriller »1942 – Das Labor« erschienen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Paul Schüler
1943 – Das Projekt
Thriller
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Prolog — Mondhain, nahe Los Alamos, New Mexico, USA. 28. Mai 1943
Erster Teil
Taucha bei Leipzig, 4. Juni 1943
Los Alamos, New Mexico, USA. 4. Juni 1943
Zweiter Teil
Dritter Teil
Hinter der Geschichte
Impressum
Wer von diesem Thriller begeistert ist, liest auch ...
Für Chrissi. Was für ein Abenteuer!
Prolog
Mondhain, nahe Los Alamos, New Mexico, USA. 28. Mai 1943
Die Unendlichkeit des Universums spiegelte sich in der Oberfläche des heiligen Sees. Adrian vom Stamm der Tewa liebte es, wenn er die Milchstraße mit jeder Bahn, die er durch den See zog, in Schwingung versetzen konnte.
Der Mondhain war sein geheimer Rückzugsort. Auch wenn die Alten ihn als heiligste aller heiligen Stätten bezeichneten und ein großes Gewese darum machten, verirrte sich kaum jemand hierher. Adrian hatte seine Ruhe. Nahezu geräuschlos glitt er durch das Wasser und beobachtete, wie die Spiegelung des Vollmondes auf den Wellen des Sees erst zu einem Fladen zerknautscht wurde, um danach in die Länge gezogen zu werden wie ein Kaugummi. Sein Kopf war herrlich leer. Das Geschimpfe seiner Mutter war weit weg, ebenso die Alten mit ihren Traditionen und die weißen Lehrer, die ihm genau diese Traditionen wieder austreiben wollten. Am Montag würde er sich in den Bus setzen müssen, um die dreistündige Fahrt ins Internat anzutreten.
All das war vergessen, wenn er im heiligen See schwamm.
Das eiskalte Wasser sprudelte nicht weit von hier aus einer natürlichen Quelle, war kristallklar und schmeckte vorzüglich. Adrian glitt mit offenem Mund durch das Nass, verschluckte sich, hustete eine Fontäne aus und gluckste vor Freude. Später trocknete er sich ab und setzte sich am Rand des Sees auf einen Baumstamm, der halb im Wasser lag. Noch konnte er die Gedanken an die nahende Schulwoche zurückdrängen. Es herrschte Frieden im Mondhain.
Am nächsten Morgen kam alles ganz anders. Adrian hatte sich unwohl gefühlt, als er aufgewacht war, und nachdem seine Mutter ihn zum dritten Mal ermahnt hatte, dass er aufstehen müsse, rannte er an ihr vorbei aus dem Haus und übergab sich auf der Straße. Seine Mutter erwartete ihn mit verschränkten Armen auf der Türschwelle und sah ihn forschend an. Doch als Adrian erneut hinauslaufen musste, glaubte sie ihm seine Krankheit. Wortlos verließ sie das Haus und ging zur Arbeit.
Adrian blieb schwitzend auf seiner Bastmatte liegen und fiel in einen unruhigen Schlaf, aus dem er immer wieder hochschreckte. Das Bild des verzerrten Mondes im See verfolgte ihn, doch jetzt hatte er ein Gesicht. Und es sah nicht freundlich aus.
Am nächsten Tag hatte sich sein Zustand nicht verbessert, so dass die Mutter nach dem Doktor rief. Da es im Pueblo kein Telefon gab, musste sie die Nachricht einem Nachbarn mitgeben, der in Santa Fe arbeitete. Der Arzt brauchte von dort aus beinahe zwei Stunden, um in die Berge zu fahren. Adrian hatte ein schlechtes Gewissen, da er wusste, welch horrende Rechnungen der Doktor stellte. Nachdem der bärtige Mann Adrian untersucht hatte, murmelte er etwas von einer Sommergrippe, verordnete Bettruhe und nahm das Geld von Adrians Mutter entgegen. Immerhin wurde sie nun etwas versöhnlicher und umsorgte ihn mit Tee und Zwieback. Essen konnte er jedoch nichts.
Am dritten Tag bemerkte Adrian, dass ihm die Haare ausfielen. Er hatte sich am Kopf gekratzt und danach ein dickes Büschel seiner glatten, schwarzen Mähne in der Hand gehabt. Bevor die Mutter am Abend zurückkehrte, setzte er sich eine Mütze auf, um die kahlen Stellen zu verbergen. In der Nacht tauchte erneut der böse grinsende Mond in seinen Träumen auf. Er schien zu Adrian zu sprechen, doch die Worte blieben unverständlich.
Im Laufe der Woche wurde Adrian immer schwächer. Alles, was er zu sich nahm, gab er wieder von sich – auf die eine oder andere Weise. Seine Mutter weinte still, rief erneut den Doktor, zahlte brav die Rechnung und machte ihrem Sohn fortan zweimal am Tag Wadenwickel.
Am achten Morgen rief sie vergeblich nach Adrian. Sie trat an sein Bett und legte ihm die Hand auf die Stirn, um zu sehen, ob er fieberte. Verschreckt zog sie sie zurück. Adrian war kalt wie ein Fisch.
Erster Teil
Taucha bei Leipzig, 4. Juni 1943
Turmhoch ragte die weiße Felswand vor ihr in den Nachthimmel.
Nein, es war kein Fels, es war Muschelkalk. Noch strahlte er weiß wie Schnee, doch schon bald würde rotes Blut den Stein besudeln.
Margarete kannte diesen Ort, auch wenn sie ihn in diesem Moment nicht benennen konnte. Sie war dort gewesen, in jener Nacht. Wie auf Schienen glitt sie auf die fahle Wand zu, ihre Hände tasteten in der Dunkelheit, ohne etwas greifen zu können. Vor ihr erschien ein Rechteck im Fels, schwarz und alles verschlingend. Margarete stemmte sich gegen den Sog, der wie ein starker Magnet an ihr zerrte. Vergebens. Obwohl sie mit den Armen ruderte, zog der Berg sie weiter in Richtung der gähnenden Öffnung.
Dahinter lag Leid, das wusste sie. Eine Erinnerung, die sie verdrängen wollte. Doch sie musste sich ihr stellen. Schon wieder.
Nur noch wenige Meter trennten sie von der Finsternis. Margarete öffnete den Mund, ein Schrei hätte ihr entfahren müssen. Doch sie war keines Lautes fähig. Stumm glitt sie über die Schwelle, und die Dunkelheit umfing sie. Das Mondlicht war hinter ihr zurückgeblieben und mit ihm die Hoffnung, dem Schlimmsten entgehen zu können. Margarete keuchte vor Angst. Kälte biss ihr in die nackten Arme und Beine. Um sie herum war nichts als Schwärze. Oder lauerte dort etwas? Jemand? Margarete biss sich auf die Unterlippe, hielt den Atem an und lauschte.
Nichts.
Sie war allein.
Zitternd öffnete sie den Mund und sog die feuchtkalte Luft ein. Ihr Atem schallte seltsam laut in der Dunkelheit.
Plötzlich packte sie jemand von hinten. Raue Hände griffen nach ihren Hüften, zogen sie zurück. Schweißgeruch drang an ihre Nase. Heißer, feuchter Atem streifte ihren Nacken. Margarete erstarrte. Dann fuhr eine der Hände an ihrem Körper hinauf und legte sich über ihren Mund.
In diesem Moment erinnerte sie sich an alles. Er war es! Er war wieder da. Und er wollte ihr wehtun.
Mit einem Schrei schreckte Margarete hoch und öffnete die Augen. Mildes Licht fiel in ihr Zimmer. Ihr Herz pochte wie wild, ihre Arme waren verkrampft und schmerzten. Am Fuße ihres Bettes stand Wilhelm und sah sie mit gerunzelter Stirn an.
»Wieder dieser Traum?«, fragte er.
Margarete blinzelte. »Wie spät ist es?«
»Noch nicht mal halb sieben.«
»Ich komme zu spät«, rief sie und sprang auf.
»Es sind nur zehn Minuten bis zur Schule, du wirst rechtzeitig da sein.« Wilhelm setzte ein schiefes Lächeln auf. »Ida macht dir Frühstück, und ich habe schon Wasser aufgesetzt, damit du dich waschen kannst.« Er legte seine Hand auf Margaretes Schulter und zwinkerte ihr zu. »Wir schaffen das.«
Margarete schreckte vor der Berührung zurück und registrierte Wilhelms überraschten Blick. »Ich muss los.« Sie hastete quer durch das Zimmer. Die Dielen knarrten unter ihren eiskalten Füßen. Sie erreichte die Wiege und erblickte ihre Tochter. Sofort zuckten ihre Mundwinkel nach oben. Marie war bereits wach, sah sie aus neugierigen Augen an und steckte sich eine kleine Faust in den Mund. Als sie im Februar zur Welt gekommen war, hatte draußen Schnee gelegen. Margarete hob ihre Tochter aus der Wiege und drückte sie an sich. »Mein liebes Kind«, sagte sie und küsste sie auf die Stirn. »Weißt du, wer dich jetzt wickeln wird, obwohl er mir immer weismachen will, er könne das nicht?« Sie nickte ihrer Tochter zu. »Ganz genau, dein Onkel Willi!« Margarete drehte sich um und drückte Wilhelm das Baby in die Arme.
Wilhelm stupste Marie auf die Nase. »Ob du das wohl bald selbst kannst, kleine Maus?«
Margarete verließ kopfschüttelnd das Zimmer. »Sie ist drei Monate alt.«
Wenig später ließ sie sich am Frühstückstisch nieder. Wilhelm blickte von seiner Zeitung auf und pfiff anerkennend durch die Zähne. »Ich hatte gedacht, du wolltest den Rektor von deinen Qualitäten als Lehrerin überzeugen. Aber offenbar möchtest du ihn verführen.«
Margarete verzog das Gesicht, blickte an sich hinab und strich mit den Händen ihren modern geschnittenen Hosenanzug glatt. »Ich sehe doch ganz normal aus.«
»Normal für Leipzig vielleicht«, meinte Ida. Wilhelms Frau goss Margarete eine Tasse Kamillentee ein. »Hier auf dem Land wirst du mit deinem Aufzug einige Aufmerksamkeit erregen.«
Aufmerksamkeit, das war es, was Margarete unter allen Umständen vermeiden wollte. Nach den Ereignissen des letzten Jahres musste sie für eine Weile vom Radar verschwinden. Vermutlich würde sie sich hier mit Wilhelm und Ida verstecken müssen, bis der Krieg vorbei war. Aber deswegen würde sie sich noch lange nicht gehen lassen. »Der Herr Direktor wird schon mit meinem Anblick zurechtkommen.«
»Gewiss, Kind.« Ida trat auf sie zu und legte ihr eine Hand an die Wange. »Ich bin sehr stolz auf dich. Wir werden gut auf Marie achtgeben, bis du zurück bist.«
»Danke.« Margarete blickte in Idas faltiges Gesicht und musste schlucken, als Emotionen in ihr aufwallten. Sie wandte sich ab und griff nach der Teetasse. »Jetzt muss ich aber los.«
Wilhelm riss einen Arm in die Luft und begann zu schnipsen. »Fräulein von Brühl, hier bin ich, nehmen Sie mich dran«, rief er mit einer schrillen Kinderstimme.
»Leitner, Leitner, Leitner …« Margarete schüttelte den Kopf. »Was habe ich Ihnen über das Reinrufen gesagt?«
Wilhelm grinste. »Dass es ganz ungehörig ist, Fräulein von Brühl. Aber, sehen Sie, ich wollte doch nur wissen, was die Quadratwurzel von zwei ist. Können Sie mir das wohl sagen?«
Margarete verzog keine Miene. »1,4142. Oder brauchen Sie noch mehr Stellen?« Sie strich sich eine Strähne aus dem Gesicht. »Außerdem heiße ich jetzt Fräulein Müller, schon vergessen?«
»Schon gut.« Wilhelm hob abwehrend die Hände, dann erhob er sich ächzend. »Komm, ich begleite dich nach draußen.«
Margarete beobachtete, wie der massige Mann seine Jacke anzog, die speckig glänzte. Alt war er geworden, die Stirn faltig und die Haare noch schütterer als zuvor. Sie kannte ihn erst seit einem Jahr, und doch fiel ihr die Veränderung auf. Wahrscheinlich fehlte ihm seine Arbeit. Die Verantwortung und die körperliche Anstrengung bei der Feuerschutzpolizei in Leipzig hatten ihn jung gehalten. Nun führte er gezwungenermaßen das Leben eines Pensionisten, und das bekam ihm nicht gut.
Margarete nahm Ida zum Abschied in die Arme, dann trat sie durch die Haustür in den Vorgarten. Sie musste die Augen zusammenkneifen, so hell schien die Sonne bereits. Es war ein warmer Frühsommermorgen. Im hohen Gras, das rund um das Fachwerkhaus stand, in dem sie mit Wilhelm und Ida untergekommen war, dampfte der Tau, der von der Nacht übrig geblieben war. Es war ein Paradies.
Wilhelm trat neben sie. »Hast du deinen Pass?«
Margarete griff in die Innentasche ihrer Jacke, zog das Dokument hervor und klappte es auf. Wie schon so oft musste sie schlucken, als sie ihr Gesicht auf dem Passbild erblickte. Das war zweifellos sie, mit der schmalen Nase und dem Leberfleck auf der Wange. Doch die blondierten Haare, die sie nun trug, machten einen anderen Menschen aus ihr. Wie sie ihr natürliches Braun vermisste! Und dieser Name. Klara Müller! Wie einfallslos!
»Karl wäre sehr stolz auf dich«, sagte Wilhelm.
Margarete schluckte. »Danke.«
Wilhelm nahm ihr den Pass ab, klappte ihn zu und steckte ihn zurück in ihre Tasche. »Das ist gute Arbeit. Trotzdem solltest du ihn so wenigen Menschen zeigen wie möglich. Ein Polizist könnte die Fälschung erkennen.«
Margarete nickte. »Ich passe auf mich auf. Und ihr passt bitte gut auf Marie auf.«
»Keine Sorge.«
»Heute Mittag bin ich zurück, mit einer Festanstellung in der Tasche.«
Wilhelm lächelte. »Da bin ich mir sicher. Und dann trinken wir Champagner auf deinen Erfolg.«
»Ha!«, machte Ida, die ihnen nach draußen gefolgt war und noch ihr Küchentuch in den Händen hielt. »Wo willst du denn Champagner herbekommen?«
»Lass das mal meine Sorge sein.« Wilhelm kniff seiner Frau in die Wange und wandte sich wieder an Margarete. »Vertraue niemandem, hörst du?«
Margarete verdrehte die Augen. »Natürlich, Willi. Mach dir keine Sorgen.«
Er trat an sie heran, sein Blick bekam mit einem Mal etwas Stechendes. »Ich meine es ernst. Du darfst niemandem vertrauen.« Dann setzte er wieder sein Lächeln auf und ließ sie los. »Und jetzt sieh zu, dass du wegkommst. Es ist schon Viertel vor acht.«
Margarete zuckte zusammen, fiel Wilhelm zum Abschied um den Hals und griff nach ihrem Fahrrad, das an dem rot gestrichenen Holzzaun lehnte. »Ich bin bald zurück«, rief sie, setzte sich auf das Rad und fuhr los. Als sie zurückblickte, war Ida neben Wilhelm getreten. Auf dem Arm trug sie die kleine Marie.
Margarete winkte ihnen zu. Was für ein Glück sie doch hatte! Ida, Wilhelm, Marie und sie bildeten eine liebevolle kleine Familie, auch wenn sie nicht verwandt waren. Die Schatten der Vergangenheit schienen endgültig hinter ihnen zu liegen. Niemand hatte sich im Dorf um sie gekümmert, als sie eingezogen waren. Niemand hatte Fragen gestellt. Wenn Margarete jetzt noch diese Anstellung bekäme, dann würden sie den Krieg hier überdauern können. Und Marie würde ein unbeschwertes Leben beginnen.
Nach langer Zeit keimte wieder Hoffnung in Margaretes Brust.
Wilhelm sah Margarete noch einige Sekunden lang hinterher, bis sie am Ende der Dorfstraße um die Ecke bog und aus seinem Blickfeld verschwand. Genussvoll sog er den Duft der Juniluft ein. Er bildete sich ein, die Blüten des Kastanienbaums riechen zu können, der hinter dem Haus stand. Die Luft war hier um Längen besser als in der Stadt. Wie viele Jahre lang hatten seine Klamotten stets nach kaltem Rauch gestunken! Von den Bränden, die er gelöscht hatte. Und von den Zigaretten, die er gequalmt hatte. Beides war nun vorbei, und er hatte seinen Frieden damit gemacht.
Nach allem, was vorgefallen war, wäre es ohnehin nicht möglich gewesen, nach Leipzig zurückzukehren. Es war ein Glücksfall gewesen, dass er seine Eltern bereits zuvor aus der Stadt ausquartiert hatte. Zunächst waren Ida, Margarete, die kleine Marie und er eine Zeit lang bei ihnen untergekommen, später war ein Haus frei geworden, das nur ein Stück weit die Straße hinab am Ortsausgang lag. Dort waren sie eingezogen. In Leipzig hatte er das Familienleben vermisst, das war ihm hier auf dem Land klar geworden. Als sein Sohn Karl die elterliche Wohnung verlassen hatte, war das ein Tiefschlag für Wilhelm gewesen. Wenig später hatte seine Frau Ida ihren Mutismus entwickelt, hatte nicht mehr gesprochen und kaum noch etwas gegessen. Und dann war Karl gestorben, in dem verfluchten Labor an der Leipziger Universität. Nach dem plötzlichen Tod seines Sohnes war Wilhelm endgültig auf sich allein gestellt gewesen. Und mit sich selbst war er noch nie gut zurechtgekommen.
Doch hier in Taucha hatte sich sein Leben ins Gegenteil verkehrt. Margarete war zu einem Familienmitglied geworden und Marie zu so etwas wie Wilhelms Enkelin. Es freute ihn, zu sehen, wie sehr auch Ida ihre neue Rolle als Großmutter genoss. Wie sie Margarete und Marie liebevoll umsorgte und vor sich hin summte, während sie Windeln auskochte. Nur selten noch drangen die düsteren Bilder in Wilhelms Bewusstsein, die so lange sein Denken bestimmt hatten. Die Bilder von Karl, und wie er ihn tot aufgefunden hatte in den Trümmern der Uranmaschine. Die Uniformen der Gestapomänner, die ihnen auf den Fersen gewesen waren. Und die Schrecken jener Nacht in Haigerloch, als Ida und er beinahe in dem brennenden Gasthaus gestorben waren. All das war nun schon beinahe ein Jahr her.
Wilhelm rieb sich mit dem Handrücken das Gesicht und räusperte sich, dann drehte er sich um und ging zurück ins Haus. Aus der Küche drang Idas Stimme. Sie sang Marie etwas vor, die mit wildem Gequieke reagierte. Das Klappern von Geschirr verriet ihm, dass sie nebenbei den Abwasch erledigte. Er ging den dunklen Flur entlang zum Hinterausgang des Hauses und schlüpfte in seine alten Arbeitsstiefel, die draußen vor der Tür standen. Ida achtete sehr darauf, dass er keinen Dreck ins Haus trug.
Mit Genugtuung ließ er den Blick über sein Werk schweifen. In wochenlanger Schwerstarbeit hatte er die Wiese hinter dem Haus in ein riesiges Gemüsebeet verwandelt, aus dem einzelne Obstbäume aufragten. Mittlerweile gediehen die Pflanzen, die er im Frühjahr ausgesät hatte. Mangold, Radieschen, Möhren, Zwiebeln, aber vor allem Kartoffeln sollten seine neue Familie, so gut es ging, ernähren. Jetzt, da Wilhelm nicht mehr arbeitete, waren sie darauf angewiesen, sich selbst zu versorgen. Das wenige Geld, das Margarete mit Nachhilfestunden verdiente, ermöglichte ihnen ab und an den Luxus eines Schinkens oder eines Stücks Käse, doch über den Winter würden sie die Kartoffeln bringen. Wenn es Margarete zudem gelingen sollte, eine Festanstellung an der Schule zu ergattern, dann würden sie bis zum Ende des Krieges hier über die Runden kommen.
Wilhelm streckte die Glieder und begab sich auf einen Kontrollgang durch sein Beet. Vom Salat zupfte er einige Schnecken und warf sie mit Schwung über die Hecke, wo ein Bächlein floss, mit dessen Wasser er sein Gemüse goss. Die Bohnen, die er an der Rückwand des Hauses ausgesät hatte, machten ihm Sorgen. Sie kümmerten vor sich hin, und er war sich nicht sicher, wieso. Brauchten sie mehr oder weniger Licht? Insgeheim musste er zugeben, dass er nicht allzu traurig um die Pflanzen war. Er konnte Bohnen nicht ausstehen. Aber Ida hatte ihm ständig mit dem Wunsch in den Ohren gelegen, er solle sie ihr zuliebe anbauen. Also hatte er ihr den Gefallen getan.
Ein Motorengeräusch riss ihn aus seinen Gedanken. Wilhelm machte einige Schritte, um am Haus vorbei auf die Straße blicken zu können. Zunächst konnte er nichts erkennen, doch dann sah er, dass sich zwei größere Fahrzeuge näherten. Sie waren dunkelgrau lackiert.
Wilhelms Puls stieg. Es war nichts Ungewöhnliches, in diesen Zeiten Polizei- oder Militärfahrzeuge zu sehen, doch nach allem, was passiert war, versetzte ihn der Anblick in Aufruhr. Instinktiv drückte er sich an die warme Hauswand, wo man ihn von der Straße aus nicht entdecken würde, und schlich dann ins Haus, um dort abzuwarten, bis die Fahrzeuge vorbeigefahren waren.
Los Alamos, New Mexico, USA. 4. Juni 1943
»Guten Morgen, Gabriel.« Lieutenant Jenkins lehnte seinen drahtigen Körper an einen Pfosten des mannshohen Stacheldrahtzaunes, der Area T einschloss, und grinste ihn aus seiner beigefarbenen Uniform an. An seinem Arm prangte die schwarze Binde mit dem Aufdruck »MP«, die ihn als Mitglied der Military Police auswies.
Gabriel nickte dem Mann zu und zeigte seinen Ausweis, der ihn berechtigte, die streng bewachte Forschungseinrichtung zu betreten. Den Ausweis, der nur seinen spanischen Namen zeigte, Gabriel Gutierrez, nicht jedoch seinen Geburtsnamen, Avanyu, der aus der Sprache der Tewa stammte.
»Ich muss dich durchsuchen, Gabriel. Du kennst das Spiel.« Jenkins streckte ihm seine Hände entgegen und machte eine Geste, als wolle er etwas aus der Luft greifen.
Gabriel hob die Arme über den Kopf und ließ die allmorgendliche Prozedur über sich ergehen. Mit halb geschlossenen Augen beobachtete er, wie Jenkins auf ihn zukam. Als der Soldat begann, seine Arme und Beine abzutasten, spannten sich unwillkürlich seine Muskeln an. Jenkins, der kein Zwerg war, musste sich auf die Zehenspitzen stellen, um Gabriels Handgelenke zu erreichen. Gabriel reckte sich noch ein wenig mehr in die Länge.
Jenkins bemerkte die Bewegung und lachte. »Jeden Morgen derselbe Unfug.« Schließlich befand er die Überprüfung für abgeschlossen. »Hab einen schönen Tag, Gabriel! Und keinen Ärger heute, hörst du?«
Gabriel tippte sich an die Stirn, dann ging er den sandigen Weg hinauf, der zwischen eingeschossigen Holzbaracken entlangführte, und drehte sich eine Zigarette aus einem getrockneten Maisblatt. Vereinzelt standen alte Pinien und Zedern zwischen den Gebäuden, die uralt wirkten. Gabriel hatte beim Bau der Einrichtung mitgeholfen und wusste es besser. Die meisten Häuser waren kaum älter als ein Jahr. Vorher hatten an diesem Ort die Mexikaner ihre Schafe geweidet. Und vor noch längerer Zeit hatten Gabriels Vorfahren hier Vater Sonne beim Auf- und Untergehen zugesehen. Seit einem Jahr hatten die Weißen das Sagen auf dem Hügel, wie sie diesen Ort nannten. Seitdem hatte Gabriel die Baracken bereits zweimal neu gestrichen. Doch der ständige Wind, der über die Hochebene pfiff, schliff mit dem Sand, den er mit sich trug, jede neue Farbschicht ab. Die sengende Berührung von Vater Sonne tat ihr Übriges. Hier oben sollten einfach keine Häuser stehen, dachte Gabriel, und schon gar keine aus Holz.
Seine Gedanken mäanderten zu Maria, seiner Frau, und zu dem Versprechen, das er ihr gegeben hatte. Wenn er heute Abend ohne das Huhn in den Pueblo kam, das sie sich gewünscht hatte, würde sie eine Woche lang nicht mit ihm reden. Am Ende seiner Schicht würde er in den kleinen Gemischtwarenladen gehen, den es auf dem Hügel gab. Er durfte es unter keinen Umständen vergessen. Und wenn er schon da wäre, würde er für sich ein paar Dosen Bier mitnehmen und für die Jungs eine Flasche Cola. Er konnte schon hören, wie sie vor Freude jubeln würden, wenn sie die Kohlensäure auf ihren Zungen spürten.
Gabriel öffnete die Tür eines Holzschuppens, der sich seitlich an eine der Baracken anschmiegte, und bückte sich nach seinem Werkzeugkoffer. Schweiß lief ihm in die Augen. Bereits jetzt, am frühen Morgen, lag eine brütende Hitze über der Stadt, die die Weißen aus dem kargen Boden eines Hochplateaus gestampft hatten. Er wischte sich mit dem Ärmel seines karierten Hemdes über das Gesicht. Dann packte er mit einer Hand die Leiter aus glattem Holz, die an einer Wand des Schuppens lehnte.
Als Gabriel seine Anstellung als Technikwart angetreten hatte, hatte es in ganz Los Alamos keine Leiter gegeben. Er hatte sich darüber bei Professor Muller beklagt, und der hatte nachdenklich genickt. Vier Wochen lang war nichts passiert, dann war eines Morgens ein Army-Truck vorgefahren, und zwei Soldaten hatten zwanzig nagelneue Leitern vor Gabriels Schuppen abgeladen. So lief das auf dem Hügel. Er hatte nicht gewusst, was er damit anfangen sollte, geschweige denn, wo er so viele Leitern lagern konnte. Also hatte er sie an die neu zugezogenen Bewohner verteilt, was ihm einige Einladungen zum Dinner beschert hatte. Er hatte sie alle abgelehnt.
Technikwart, mit diesem Titel hatte Gabriel nie etwas anfangen können. Er selbst bezeichnete sich als Hausmeister des Hügels, und so hielten es auch die meisten anderen Angestellten. Mit dem Werkzeugkoffer in der einen und der Leiter in der anderen Hand verließ er den Schuppen und strebte auf eine Baracke zu, in der eine der Forschungsgruppen arbeitete. Gabriel wusste nicht genug über Physik, um zu verstehen, was die Wissenschaftler dort genau taten. Doch er wusste, was ihr Ziel war. Sie wollten den Krieg beenden, der am anderen Ende der Welt tobte.
Er betrat das Gebäude und fand sich in einem langen Flur wieder, von dem zu beiden Seiten Türen abgingen, in die auf Augenhöhe Fenster eingelassen waren. In der Mitte verstaubte ein Wasserspender. Unter den Sohlen von Gabriels Stiefeln quietschte das Linoleum. Er lehnte die Leiter an eine Wand und betätigte den Lichtschalter. Nichts geschah. Seufzend stellte er den Werkzeugkoffer ab, öffnete ihn und fischte eine Glühbirne heraus. Dann griff er nach der Leiter und platzierte sie unter der Lampe, die von der Decke des Flures baumelte. Er war gerade auf die erste Sprosse gestiegen, als sich eine Tür öffnete. Zwei Männer, die noch nicht einmal fünfundzwanzig Jahre alt sein mochten, traten auf den Flur. Sie trugen Zivilkleidung, was sie als Wissenschaftler auswies. Keine Uniform wie die Soldaten und keinen Blaumann so wie Gabriel. Zielstrebig gingen sie auf den Wasserspender zu und füllten ihre Pappbecher.
»Muller ist übergeschnappt! Drei Tage für einen vollständigen Bericht, dabei brauchen wir allein für die Experimente schon mehr als eine Woche.« Der kleinere der beiden Männer fuhr sich mit der Hand durch die schulterlangen Haare.
»Recht hat er«, erwiderte der andere. »Wir müssen mehr Tempo machen. Wenn es stimmt, was der Geheimdienst sagt, dann sind die Krauts uns zwei Jahre voraus bei der Entwicklung der Bombe.«
Gabriel hatte unterdessen die Leiter erklommen, wischte die Spinnweben beiseite, die die Deckenlampe umgarnten, und machte sich daran, den Lampenschirm zu entfernen.
»Die Deutschen sind an allen Fronten auf dem Rückzug«, sagte der Kleine. »Wenn es so weitergeht, ist Hitler an Weihnachten geschlagen.«
Der andere stemmte die Hände in die Hüften. »Genau das macht ihn ja so gefährlich! Er wird beißen wie ein Tier, das in die Ecke gedrängt wird. Hitler hat gar keine andere Wahl mehr, als seine Superwaffe zu entwickeln.« Sein Blick fiel auf Gabriel. »Ich finde es nicht richtig, dass sie Leute wie ihn hier reinlassen.«
Der Kleine lächelte. »Du meinst Gabriel? Keine Sorge, der versteht kein Wort von dem, was du sagst.«
»Denkst du?« Der andere trat an die Leiter heran und sah zu Gabriel hinauf. »Hey, du! Verstehst du, was ich sage?«
Gabriel lächelte den Mann freundlich an, schwieg jedoch.
»Wie viel ist zwei plus zwei, hm?«
Gabriel nickte und lächelte einfach weiter.
»Wie ist dein Name, Rothaut? Bist du ein Spitzel?«
Gabriel zwinkerte dem Mann zu, dann wandte er sich ab und machte sich wieder an der Lampe zu schaffen.
»Lass ihn in Ruhe«, sagte der Kleine. »Gabriel ist schon in Ordnung. Nicht der Hellste, aber echt in Ordnung.«
Der andere schnaubte. »In Ordnung? Ich habe gehört, dass er Dave die Nase gebrochen hat.« Er starrte Gabriel mit zusammengekniffenen Augen an.
»Das ist doch schon ewig her«, sagte der Kleine. »Außerdem ist Dave ein Arschloch. Er hat’s bestimmt verdient.«
Gabriel stieg von der Leiter, ging zum Lichtschalter und testete die neue Glühbirne, die brav aufflammte. Zufrieden mit dem Ergebnis, griff er sich die Leiter und den Werkzeugkasten und machte sich daran, das Gebäude zu verlassen. Auf der Türschwelle drehte er sich um und schaute die beiden Männer an. »Vielleicht solltet ihr euch wieder an die Arbeit machen, wenn ihr schneller sein wollt als dieser Herr Hitler.« Einen Moment lang genoss er den Anblick der offenen Münder der beiden Forscher, dann ging er seines Weges.
*
Margarete sprang vom Fahrrad, ehe es zum Stehen gekommen war. Sie reckte den Kopf, um die Uhr über dem Eingangsportal des marode wirkenden Gebäudes der Jungenschule erkennen zu können. Fünf vor acht. Sie hatte es gerade so geschafft. Jetzt musste sie nur noch den richtigen Raum finden. Mit energischen Schritten eilte sie über den Schulhof, auf dem einige Pimpfe Fangen spielten. Als sie Margarete sahen, blieben sie stehen und starrten sie an, als käme sie vom Mond.
Margarete ignorierte die Blicke. Sie musste sich jetzt konzentrieren, sie hatte nur diese eine Chance. Der stellvertretende Direktor Herr Lüder hatte ihr vorgeschlagen, ihr pädagogisches Können im Physikkurs der Primaner zu beweisen. Danach wolle er mit Herrn Direktor Thalheim entscheiden, ob sie auf Probe in den Schuldienst übernommen werden könne. Bisher war Margarete lediglich stundenweise im Nachhilfeunterricht eingesetzt worden.
Fünf Stufen führten zur zweiflügeligen Eingangstür des Schulgebäudes. Margarete nahm immer zwei auf einmal, als ein Pfiff sie zusammenfahren ließ. Sie drehte sich um und sah, wie die Jungen auf dem Schulhof sich vor Lachen krümmten und einem hageren Burschen mit strähnigen Haaren auf die Schulter klopften. Ärger stieg in Margarete auf, doch sie ermahnte sich zur Ruhe. Warum sollte es hier anders sein als in Berlin oder Leipzig? Ihr ganzes Leben lang hatte sie sich mit einer Männerwelt auseinandersetzen müssen, die sich nicht vorstellen konnte, dass eine Frau dieselbe Arbeit machen konnte wie einer der ihren. Viel zu oft hatte man sie nur als das hübsche Fräulein von Brühl angesehen, das nicht durch ihre Fähigkeiten, sondern durch ihr Äußeres überzeugte. Heute würde sie ihnen erneut das Gegenteil beweisen.
Entschlossen machte sie kehrt und ging auf den Jungen zu, der mit jedem ihrer Schritte kleiner zu werden schien. Als sie schließlich vor ihm stand, hatte er den Kopf gesenkt und tat so, als habe er gerade erst fasziniert festgestellt, dass sein Körper über Füße verfügte. Margarete hob eine Hand, und der Junge zuckte zusammen. Die Hand fuhr hinab und verstrubbelte dem Kleinen die Haare. »Wie heißt denn mein kleiner Verehrer, hm?«
Der Junge riss den Kopf hoch und die Augen auf. Stotternd suchte er nach Worten. »M… M‑m… Max Laufer, hocherfreut.«
»Du weißt doch, dass jede Tat Konsequenzen hat, oder?«
Der Junge nickte schweigend.
»Und dass man mit den Konsequenzen leben muss, das weißt du auch, nicht wahr?«
Erneutes Nicken.
»Wenn du einer Dame den Hof machen willst, dann solltest du dir vielleicht ein wenig mehr einfallen lassen, als sie anzupfeifen, meinst du nicht?«
Der Junge sah sie mit großen Augen an, bekam aber immer noch kein Wort heraus. Margarete tätschelte seine Wange und zwinkerte ihm zu. »Das wird schon noch, mein Kleiner.« Dann wandte sie sich von ihm ab, eilte die Stufen hinauf und durchschritt das Portal, ohne sich noch einmal umzusehen.
Kühle, abgestandene Luft quoll ihr entgegen und brachte den Geruch von Schweiß und Tafelkreide mit sich. Erinnerungen an ihre eigene Schulzeit kamen in Margarete auf, vermengt mit Bildern ihrer Studienzeit in Berlin und ihrer ersten Festanstellung am Physikalischen Institut in Leipzig. Was wohl aus Professor Braun geworden war? Es gab so vieles, das sie nicht wusste, so viele lose Enden.
Das Läuten der Schulglocke riss Margarete aus ihren Gedanken. Was war nur in sie gefahren? Sie musste sich zusammenreißen, wenn sie diese Anstellung bekommen wollte. Suchend schweifte ihr Blick durch die Eingangshalle. Lüder hatte ihr den Weg in den Physiksaal beschrieben: die Treppe hoch in den zweiten Stock, dann rechts halten. Die zweite Tür auf der linken Seite. Margarete hatte seine leicht lispelnde Stimme noch deutlich in den Ohren. Ohne sich noch einmal umzuschauen, ging sie die Treppe hinauf. Ihre hohen Absätze klapperten auf den steinernen Stufen.
Wenig später hatte sie den zweiten Stock erreicht, wandte sich nach rechts und stand schließlich vor der Tür, die Lüder ihr beschrieben hatte. Sie straffte sich und ordnete mit der Hand ihre Frisur, dann drückte sie die Klinke hinunter und öffnete die Tür mit Schwung.
Das Stimmengewirr, das in dem Klassenzimmer geherrscht hatte, erstarb in dem Moment, in dem Margarete eintrat. Etwa fünfzehn Augenpaare waren auf sie gerichtet. Einen Moment lang herrschte ungläubiges Schweigen, dann rannten die Schüler zu ihren Plätzen und nahmen Haltung an. Margarete atmete tief ein und aus, dann trat sie an das Pult heran, das auf einem Podest an der Stirnseite des Klassenzimmers vor der großen Kreidetafel und einer Hakenkreuzfahne stand.
Mit klopfendem Herzen ließ sie den Blick durch die Reihen schweifen. Wie zerlumpt die Jungen aussahen! Außerdem waren sie unterschiedlich alt, so als habe man den verbliebenen männlichen Nachwuchs, der noch nicht an der Front war, in eine Klasse gesteckt. Margarete schluckte. »Guten Morgen. Mein Name ist von Brühl, ich meine …« Sie versteinerte. Alle Augen waren auf sie gerichtet. »Müller«, stieß sie endlich hervor. »Ich heiße Müller.«
Keine Reaktion. Die Jungen standen stramm neben ihren Bänken und starrten sie an. Lediglich ein älterer Schüler in der letzten Reihe verkniff sich mühsam ein Grinsen. Margarete runzelte die Stirn. Irgendetwas stimmte nicht. Wieso setzten sich die Jungen nicht? Und wo war Lüder? Sollte sie nun mit dem Unterricht beginnen? Da fiel ihr ein, was der stellvertretende Direktor über das Begrüßungszeremoniell gesagt hatte. Mit klopfendem Herzen hob sie die rechte Hand über ihren Kopf und räusperte sich. »Heil Hitler.«
Ein Ruck ging durch die Jungen. Mit einer synchronen Bewegung schnellten ihre rechten Arme in die Höhe. »Heil Hitler!«, brüllten sie im Chor und nahmen dann auf den knarzenden Bänken Platz.
Ein Lächeln huschte über Margaretes Gesicht. Nun konnte sie mit dem Unterricht beginnen. Tagelang hatte sie sich auf diesen Moment vorbereitet. Lüder hatte ihr gesagt, dass in dieser Woche der Einstieg in die Kernphysik auf dem Lehrplan stand, und war begeistert gewesen, als er hörte, dass Margarete Expertin auf diesem Gebiet war. »Meine Herren«, begann sie, »was können Sie mir über den Aufbau der Atome sagen?«
Die Schüler warfen sich verunsicherte Blicke zu.
Margarete legte die Stirn in Falten. »Kommen Sie, das müssten Sie doch wissen. Welches sind die Bestandteile eines Atoms?« Sie ließ den Blick durch die Reihen schweifen und machte einen Jungen mit strubbeligen blonden Haaren aus, der aus dem Fenster schaute. »Sie da, in der zweiten Reihe.«
Der Kopf des Jungen wirbelte herum, seine Augen waren vor Schreck geweitet. Mit einem Finger zeigte er auf seine Brust. »Meinen Sie mich?«
»Ja, genau Sie. Stehen Sie auf!«
Der Junge gehorchte.
»Name?«
»Heinrichs, Fräulein …« Er stockte.
»Müller«, erinnerte Margarete ihn. »Dann beginnen Sie mal, Heinrichs. Was können Sie mir über den Aufbau des Atoms sagen?«
Heinrichs blickte sich Hilfe suchend im Klassenzimmer um, doch niemand wagte es, Blickkontakt zu ihm aufzunehmen. »Haben … Haben wir jetzt nicht Geschichte?«
Gemurmel machte sich breit. Einige der Jungen feixten und brachen in Gelächter aus. Margarete sank das Herz in die Kniekehlen. Irgendetwas ging hier gründlich schief. Dabei hatte sie sich so sorgfältig auf diesen Tag vorbereitet! Sie schlug mit der flachen Hand auf das Pult. »Ruhe!« Tatsächlich verstummten die Schüler und sahen sie neugierig an.
In diesem Moment flog die Tür des Klassenzimmers auf, und ein fülliger Mann mit Gehstock betrat den Raum. Entgeistert blickte er Margarete an. »Wer sind Sie, und was machen Sie in meinem Klassenraum?«
*
Die weiche Federung seines Pick-ups schüttelte Gabriel durch, während sein Blick über den Horizont wanderte. In der Ferne blitzten die kahlen Gipfel des Sangre‑de-Cristo-Gebirges, die im Winter schneebedeckt waren. Davor, tief unten im Tal, glitzerte der Rio Grande. Ein Stück weiter lag sein Ziel, der Pueblo San Ildefonso, seine Heimat. In diesem überschaubaren Gebiet hatte sich Gabriels ganzes Leben abgespielt, abgesehen von den Jahren, die er im Internat verbracht hatte. Das Antlitz von Vater Sonne, rot und mächtig, knapp über den Bergen, blendete ihn im Rückspiegel. Gabriel schüttelte den Kopf. Vater Sonne. Gabriels Vater war ein Trinker gewesen, nichts weiter.
Die Sangre de Cristo Mountains bildeten die östliche Begrenzung des alten Tewa-Landes. Die Berge glühten leuchtend rot, wie ein Feuer, in das der Wind bläst. Früher waren sie das Ende der Welt gewesen, doch Gabriel wusste, dass die Welt streng genommen dahinter erst anfing. Er hatte sie kennengelernt, als die Weißen ihn auf ihr Internat mitgenommen hatten. Damals war er sieben Jahre alt gewesen.
Die Soldaten hatten die Straße, die, von Los Alamos kommend, hinabführte, gerade erst angelegt. Feine Schwaden von rötlichem Sand tanzten über den dunklen Asphalt und bildeten die Silhouetten von fremden Geistern, die kamen und wieder vergingen, ehe das Auge sich an ihren Anblick gewöhnen konnte.
Nach einigen Minuten Fahrt, während der sich die Straße in engen Serpentinen den Berg hinabschlängelte, erreichte Gabriel die Otowi-Brücke, ein schmales Gebilde aus groben Holzbalken, das an Stahlseilen hing und über den Rio Grande führte. Zu dieser Jahreszeit war der Fluss nur etwa knietief, das Wasser klar, so dass man bis zum Grund blicken konnte. Unweit der Brücke stand das geräumige Holzhaus, in dem Ms. Warner lebte. Sie war so etwas wie der Mutterersatz für die jungen Forscher, die auf den Hügel gezogen waren, und kochte jeden Abend für einige Gäste. Auch Gabriel gegenüber verhielt sie sich stets freundlich, und er revanchierte sich für ihre Gastfreundschaft, indem er ihr hin und wieder eine Forelle mitbrachte. Vielleicht sollte er am Wochenende mal wieder fischen gehen.
Hinter der Brücke wurde der Zustand der Straße schlechter. Niedrige, verkrüppelte Büsche waren über die Landschaft verteilt, die aus Sand und Geröll bestand. Die größeren Felsen warfen lange, dunkle Schatten. Schließlich tauchten die rötlichen Mauern von San Ildefonso vor Gabriel auf. Sie waren aus Lehmziegeln errichtet, die die Spanier Adobe nannten. Die Straße führte zu einem breiten Holztor in der Mauer. Es stand offen, und Gabriel lenkte den Wagen darauf zu.
Eine plötzliche Bewegung erregte seine Aufmerksamkeit. Etwas war von der Mauer gehuscht. Eine Katze. Oder ein Späher. Hatte man ihn erwartet? Er steuerte den Wagen durch das Tor und auf den großen Platz, der das Zentrum des Pueblos bildete. Auf der gegenüberliegenden Seite thronte die Kirche, die die spanischen Missionare errichtet hatten. Der Priester wohnte jedoch in Santa Fe und ließ sich nur zu hohen Feiertagen blicken. Wollte man ihn dazu bringen, eine Hochzeit durchzuführen, musste man ihn im Voraus bezahlen.
Links und rechts des Platzes reihten sich quaderförmige, eingeschossige Wohnhäuser mit flachen Dächern, vor denen in Decken gehüllte Gestalten auf niedrigen Holzbänken saßen. Einige Männer sprachen miteinander und rauchten. Als sie Gabriels Pick‑up bemerkten, blickten sie einen Moment lang zu ihm hinüber, dann wandten sie sich wieder ihrem Gespräch zu. Eine Schar von Hühnern pickte im Sand nach Ameisen.
Gabriel war sofort aufgefallen, dass etwas nicht stimmte. Er war sich nur nicht sicher, was es war.
Ein Geräusch ließ ihn reflexhaft auf die Bremse treten. Abrupt kam der Wagen zum Stehen. Gabriel sah sich um und entdeckte Jesus, der sich an der Beifahrertür des Pick-ups zu schaffen machte. »Sie klemmt«, murmelte Gabriel zu sich selbst und stieß die Tür mit Kraft von innen auf.
Sein Sohn kam auf den Beifahrersitz geklettert. Seine schwarzen Haare standen ihm wirr vom Kopf ab. Eines Tages würde auch er die traditionellen geflochtenen Zöpfe tragen, wie Gabriel es tat. Jesus grinste ihn aus einem ungewaschenen Gesicht an. »Die Alten erwarten dich, Vater. Adrian ist krank aus dem Mondhain zurückgekehrt. Er liegt bei seinen Eltern und kämpft um sein Leben.« Das Grinsen in seinem Gesicht wollte nicht zu der Tragweite des Gesagten passen.
»Das sind schlimme Nachrichten.« Gabriel steuerte den Wagen in Richtung des Hauses des Dorfältesten. Dort würden die Alten auf ihn warten. Dort würden sie ihn empfangen. Er spürte, wie sich sein Magen zuschnürte.
Jesus griff nach seiner Hand, als Gabriel auf den dunklen Eingang zuging, der in das Innere des Adobe-Hauses führte. Warme, stickige Luft quoll daraus hervor. Sie roch nach Zedernholz und Tabakrauch. »Geh zu deiner Mutter.« Gabriel gab Jesus eine Klaps auf den Hinterkopf. Lächelnd sah er seinem Sohn hinterher, der wie der Teufel um eine Ecke wetzte und verschwand. Dann trat er in das Gebäude.
Seine Augen brauchten einige Sekunden, um sich an die Dunkelheit im Inneren zu gewöhnen. Das Feuer in der Mitte des einzigen Raumes erhellte die Umgebung kaum, im Gegenteil. Die züngelnden Flammen warfen tanzende Schatten an die Wände, die das Auge täuschten. Erst nach und nach schälten sich Umrisse von Männern aus der Dunkelheit. Männer, die, eingehüllt in ihre Decken, an den Wänden des Hauses vor sich hin brüteten und rauchten. Niemand sah auf, als Gabriel eintrat. Niemand sprach ein Wort.
»Ihr habt nach mir verlangt.« Gabriel richtete seine Zöpfe, indem er sie nach vorn über seine Schultern legte. »Hier bin ich.«
Eine Zeit lang geschah nichts. Keiner der Männer reagierte auf seine Worte. Gabriel lauschte dem Knistern des Feuers und dem Rascheln der Decken, wenn einer der Ältesten sein Gewicht verlagerte oder die Zigarette an den Mund führte. Mehrere Minuten verharrten sie so, blickten hin und wieder zu ihm herüber und vertieften sich dann gleich wieder in ihre eigenen Gedanken.
Schließlich drang eine Stimme aus der Tiefe des Raumes, gerade in dem Moment, als Gabriel das Haus wutentbrannt wieder verlassen wollte. »Du kommst spät.« Ein Mann erhob sich und richtete seine Decke. Es war Luis, die Rote Feder, der Dorfälteste. Das Feuer spielte in seinem Gesicht und ließ die Falten darin noch tiefer erscheinen. »Wir sind sehr verstimmt.«
»Hätte ich gewusst, dass ihr nach mir sucht, wäre ich früher gekommen«, entgegnete Gabriel.
»Adrian, unser Sohn, ist krank.« Der Älteste trat einen Schritt näher an das Feuer heran.
Gabriel wusste nicht, worauf das Ganze hinauslaufen sollte. »Ich werde seine Mutter besuchen und ihr zu essen …«
»Er trank aus der Quelle, die im Mondhain entspringt, oben auf dem Berg«, unterbrach ihn Luis. Seine Stimme war nun lauter. »Das Wasser ist schlecht. Unsere Quelle ist entweiht. Die Weißen schänden sie. Sie dürfen unseren Hain nicht betreten.« Seine Stimme bebte. »Es ist unser Hain!«
Die anderen Männer unter ihren Decken stießen ein unverständliches Gemurmel aus.
Luis zeigte mit dem Finger auf Gabriel. »Du bist der Vorsteher unseres Pueblos. Du bist unsere Stimme bei den Weißen. Geh und schicke die Weißen fort!«
»Die Weißen haben das Recht erworben, die Berge im Westen zu betreten.« Gabriel stemmte die Hände in die Hüften. »In den Osten gehen sie nicht. Der Hain ist für sie nicht wichtig. Sie besuchen ihn nicht.«
»Dein Vater hat ihnen die Berge im Westen geschenkt. Dein Vater, der zu viel trank.« Rote Feder rümpfte die Nase. »Und nun stehlen sie immer mehr Land von uns.«
Gabriel schluckte. »Die Army hat sich den Hügel genommen und ihr Labor darauf gebaut, das ist richtig. Aber die Army ist eben die Army.«
Der Dorfälteste war an Gabriel herangetreten und musterte ihn von Kopf bis Fuß. »Deine Schuhe«, sagte er schließlich. »Deine Schuhe sind falsch.«
Gabriel sah an sich hinab und betrachtete die staubigen Arbeitsstiefel, die Professor Muller ihm an seinem ersten Arbeitstag überreicht hatte.
»Ihre Sohlen sind zu dick.« Der Dorfälteste musterte ihn ausdruckslos. »Dies sage ich.«
Gabriel sah sich um. Die anderen Männer trugen die traditionellen Mokassins aus dünnem Leder. Alle Augen waren auf ihn gerichtet.
»Nun geh«, sagte der Älteste. »Geh und hole unseren Hain zurück!«
»Er ist schon selbst ein Weißer«, hörte Gabriel einen der Alten murmeln, als er das Haus verließ und auf den Platz trat. Er bemerkte nicht das Zirpen der Grillen, nicht das Geheul von Großvater Kojote. Er ging stumm in Richtung seines Hauses und drehte sich eine Zigarette. Der verfluchte Hain!, dachte er. Die verfluchten Alten!
Nachdem er sein Heim erreicht und die Tür hinter sich geschlossen hatte, kniete er nieder und löste die Schnürbänder seiner Stiefel. Als er aufblickte, sah er in das Gesicht seiner Frau. Maria legte die Stirn in Falten. »Hast du nicht etwas vergessen, Mann?«
*
»Meine Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.« Margarete klappte das Heft mit ihren Aufzeichnungen zu und lächelte, während sie die Primaner dabei beobachtete, wie sie ihre Bücher in die Ranzen stopften und tuschelten. Sie hatte es geschafft! Sie hatte den ganzen Unterrichtsstoff vermittelt, den Lüder von ihr verlangt hatte. Überdies hatten die jungen Männer, die hoffentlich bald ihre Schüler sein würden, sie als Lehrerin akzeptiert.
Einfach war es jedoch nicht gewesen, zumal sie sich zunächst im falschen Raum befunden hatte. Als sie ihr Missgeschick bemerkt hatte, war sie aus der Tür gestürzt und Lüder geradewegs in die Arme gelaufen. Er hatte im Nachbarraum auf sie gewartet und entschuldigte sich wortreich, dass er sie offenbar in das falsche Klassenzimmer gelotst hatte.
Im richtigen Raum angekommen, stellte Margarete sich selbstbewusst als Fräulein Müller vor und ging sogleich zum Unterricht über. Es machte ihr großen Spaß, dieser jungen Generation von dem Forschungsbereich zu berichten, der sie seit so vielen Jahren faszinierte. Ihre Wangen begannen zu glühen, als sie die Phänomene des spontanen und induzierten Zerfalls beschrieb und Schritt für Schritt die mathematischen Grundlagen erläuterte.
Die Primaner hingen Margarete an den Lippen und stellten unzählige Fragen, die sie bildhaft und mit einfachen Worten beantwortete. Ihre Faszination für die Physik der Atomkerne schien in vollem Umfang auf ihre Schüler überzugehen. Selbst das Läuten der Pausenglocke konnte die Jungen nicht davon abhalten, sie mit Fragen zu löchern. »Jetzt ist es aber wirklich genug für heute«, versuchte Margarete sie zu vertrösten. »Wenn mich nicht alles täuscht, dann werden wir schon bald die Gelegenheit haben, das heute Gelernte zu vertiefen.« Sie lächelte Lüder zu, der während der Unterrichtsstunde in der letzten Reihe gesessen hatte und ihr nun freundlich zunickte.
»Eine Frage habe ich noch.« Ein ernst wirkender rothaariger Junge war in seiner Bank in der zweiten Reihe aufgestanden und sah sie mit gerunzelter Stirn an. »Wenn Sie gestatten.«
Margarete nickte ihm auffordernd zu. »Na gut, eine Frage noch und dann ab in die Pause mit Ihnen!«
Der Junge setzte an, seine Frage zu stellen, er zögerte und legte einen Finger an die Unterlippe.
»Nun los, Thörner!«, drängte ihn sein Sitznachbar.
Thörner ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. »Sie haben uns erklärt, dass bei der Spaltung eines Atomkerns große Mengen an Energie frei werden …«
»Unfassbare Mengen, richtig. Zumindest wenn man sehr viele Atomkerne spaltet.«
»Halten Sie es für möglich, dass man diese Energie als Waffe einsetzen könnte? Vielleicht als eine Art Bombe? Damit könnte man doch sicherlich London oder Moskau dem Erdboden gleichmachen.«
Das Gemurmel in den Reihen verstummte mit einem Schlag. Einen Moment lang blickten sich die Jungen entgeistert an, dann brach Gejohle los. »Thörner, du bist genial!«, rief einer, und ein anderer fing sogar an zu singen: »Mit Thörners Bombe siegen wir, Thörner, unser Musketier!«
Margarete war zusammengezuckt, als sie die Frage nach der Bombe gehört hatte. Sie war ihr schon oft gestellt worden. In ihrer Doktorarbeit hatte sie sich intensiv mit der Nutzbarmachung der Kernenergie auseinandergesetzt, jedoch lediglich theoretisch. Die praktischen Pläne für den Bau einer Kernbombe im Deutschen Reich waren im Kein erstickt worden, nachdem klar geworden war, dass der benötigte Rohstoff, angereichertes Uran, nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stand. Und alle Bestrebungen, diesen Mangel durch technische Neuerungen zu umgehen, waren gescheitert oder hatten sich als Finte herausgestellt. Nein, es war nicht möglich, diese Bombe zu bauen. Nicht hier, nicht jetzt. Trotzdem drangen wieder diese Bilder aus Ohrdruf in ihre Gedanken, die sie vergessen wollte. Die turmhohe Rauchsäule, die versengte Erde, die verkohlten Körper …
»Fräulein Müller?« Die Stimme des stellvertretenden Direktors riss Margarete aus ihren Gedanken.
Sie blinzelte, und ihr Blick klärte sich. Die Schüler hatten den Raum bereits verlassen. Lüder stand ihr gegenüber und lächelte verlegen.
»Wie bitte? Oh, entschuldigen Sie.« Margarete schüttelte den Kopf und deutete einen Knicks an. »Ich war ganz in Gedanken.«
»Toll, wie Sie mit den Jungen umgegangen sind. Menschen wie Sie brauchen wir an dieser Schule. Leute aus der Forschung, die am Puls der Zeit sind.«
»Herr Lüder, das ist zu viel der Ehre.« Sie rieb sich die Hände, um den Kreidestaub vom Anschreiben an der Tafel loszuwerden.
»Nein, nein, es ist, wie ich sage. Zu schade, dass der Herr Direktor nicht zugegen sein konnte.«
Erst jetzt fiel Margarete auf, dass Thalheim ihre Probestunde verpasst hatte. »Er wird sicherlich gute Gründe haben.«
Lüder nickte und sah dabei an Margarete vorbei aus dem Fenster. »Oh ja, überaus gute Gründe, ganz gewiss.« Sein Blick fiel wieder auf Margarete. »Ich denke, ich kann jedoch auch für den Herrn Direktor sprechen, wenn ich sage, dass wir uns freuen würden, Sie in unseren Reihen willkommen heißen zu dürfen.«
Margarete klatschte in die Hände. »Ich danke Ihnen.«
»Ihre Begeisterung für ihr Fach ist in natürlicher Art und Weise auf die Jungen übergesprungen. Das ist etwas, das nicht viele vermögen.« Er lächelte sie an. Seine Wangen waren gerötet. »Haben Sie an Ihren Pass gedacht?«
»Natürlich.« Hektisch durchsuchte Margarete die Innentasche ihrer Jacke und zog das Schriftstück hervor.
Lüder nahm es entgegen und klappte es auf. »Ausgezeichnet. Ich werde ihn gleich ins Sekretariat geben. Dort wird man alles weitere veranlassen.« Interessiert blätterte Lüder durch das Passbuch. »So, so, geboren in Chemnitz.« Er sah sie an. »Schön da, gell?«
Margarete wurde mulmig zumute. Warum interessierte Lüder sich derart für ihren Pass? Wilhelm hatte zwar gesagt, dass dieser gut gemacht sei, verlassen wollte sie sich jedoch nicht darauf. Während sie noch überlegte, wie sie Lüder von dem Dokument ablenken konnte, flog die Tür des Klassenzimmers auf, und Direktor Thalheim marschierte herein.
Lüder wandte sich seinem Vorgesetzten zu und grüßte. »Heil Hitler!«
Margarete folgte seinem Beispiel. Thalheim, ein großer, dürrer Endfünfziger, erwiderte den Gruß. »Heil.« Er musterte Margarete, ohne eine Regung in seinem Gesicht zu zeigen. Dann wandte er sich Lüder zu. »Die Gestapo war gerade da. Sie suchen eine junge Frau, die zuletzt hier in der Gegend gesehen wurde. Wir sind angewiesen, die Schüler zu befragen. Es handelt sich um jemanden mit Namen von Brühl.«
*
Wilhelm betrat die Küche und eilte zum Fenster, um die Vorhänge zuzuziehen. Ein unnatürliches Zwielicht senkte sich über den Raum.
»Was machst du denn?« Ida spielte die Entrüstete. »Willst du, dass ich mir beim Kartoffelschälen die Finger abschneide?«
Wilhelm warf ihr einen düsteren Blick zu und linste durch den Spalt im Vorhang auf die Straße, die vor dem Haus verlief. Aus dem Augenwinkel bekam er mit, wie Ida sich kopfschüttelnd die Hände an ihrer Schürze abtrocknete und ihn ansah. »Willst du mir nicht sagen, was los ist?«
»Polizei.« Wilhelm spähte weiter auf die Straße hinaus, konnte jedoch nichts erkennen. Auch die Motorengeräusche waren verklungen. Waren die Wagen vorbeigefahren?
»Nun stell dich nicht so an.« Ida trat hinter ihn und versuchte über seine Schulter hinweg ebenfalls einen Blick auf die Straße zu werfen. »Wir können nicht bei jedem Polizeiauto, das vorbeifährt, die Wohnung verdunkeln.« Sie lächelte matt. »Ich dachte, wir wären aufs Land gezogen, um der Verdunklung zu entgehen.«
»Ich werde später darüber lachen.« Wilhelm rieb sich das Kinn. »Ich mache dir keinen Vorwurf. Bei den meisten Dingen, die Grete und ich erlebt haben, warst du nicht dabei. Zumindest nicht richtig.«
Ida gab ihm einen Klaps auf den Hinterkopf. »Mein lieber Herr Oberwachtmeister a. D., jetzt werden Sie mal nicht frech. Mir ist schon klar, dass wir uns vor der Polizei hüten sollten.« Sie trat zurück und wandte sich wieder den Kartoffeln zu. Plötzlich rief sie: »Wilhelm, ich fasse es nicht!«
Er drehte sich zu ihr um. Ida starrte ihn wütend an und zeigte mit dem Schälmesser auf seine Füße. Wilhelms Blick wanderte nach unten. Er hatte seine Gartenstiefel nicht ausgezogen. Eine Spur aus Erde zeigte auf dem Küchenboden deutlich seinen Weg vom Garten bis zum Fenster. Unwillkürlich zog er die Schultern hoch und stellte sich auf Ärger ein.
»Wie oft habe ich dir gesagt, dass du nicht den ganzen Dreck aus dem Garten ins Haus tragen sollst! Jetzt nimm dir den Wischer und beseitige deine Spuren!«
Wilhelm wollte etwas entgegnen, doch während er nach Worten suchte, drang von draußen ein Geräusch an seine Ohren. Motorenlärm! Er erstarrte, den Blick auf Ida gerichtet. Seine Frau sah an ihm vorbei zum Fenster hinaus und schien ebenfalls die Luft anzuhalten. Das Motorengeräusch kam näher, wurde immer lauter und verstummte dann. Einen Moment lang hoffte Wilhelm, die Wagen seien vorbeigefahren. Doch dann überzeugte ihn das Geräusch von zuschlagenden Autotüren vom Gegenteil. Die Wagen hatten vor dem Haus gehalten! Er starrte in Idas schreckgeweitete Augen. Mit zwei Schritten war er bei ihr und schloss sie in seine Arme. »Hab keine Angst.«
Ein energisches Klopfen erscholl an der Tür.
»Du weißt, was zu tun ist.« Er sah Ida an, und sie nickte. Ihre Oberlippe zitterte. Noch einmal drückte Wilhelm seine Frau, dann flüsterte er: »Geh!«
Ida hob die schlafende Marie aus ihrer Wiege und schlich mit ihr auf Zehenspitzen aus der Küche und die Treppe hinauf, wie sie es so oft besprochen hatten. Sie würde sich auf dem ehemaligen Heuboden verkriechen, wo Wilhelm eine Pistole versteckt hatte. Außerdem lag dort eine Leiter, mit der sie im Notfall aus der zum Garten führenden Öffnung entkommen konnte, durch die früher das Heu auf den Boden gelangt war.
Wieder ertönte das Klopfen an der Tür, diesmal heftiger, ungeduldiger.
Wilhelm bekreuzigte sich. Es war eine Geste, die er seit seiner Jugend nicht mehr ausgeführt hatte. Dann ging er zur Tür und öffnete sie.
Vor ihm stand ein kleiner, hagerer Mann in einer zu groß wirkenden grauen Uniform eines Kriminalinspektors der Gestapo. Seine Mütze saß schief auf dem Kopf, sein Gesichtsausdruck wirkte traurig, seine Mundwinkel hingen herab. Außerdem verfügte er über auffällig große Ohren und eine gleichfalls große Nase. Zwischen seinen Augenbrauen verlief eine markante vertikale Falte. Neben ihm standen zwei weitere Polizisten. Weiter hinten, bei den beiden Wagen, konnte Wilhelm noch mehr Uniformierte ausmachen.
»Mein Name ist Labes, Kriminalinspektor.« Der Anführer rümpfte die Nase, als müsse er niesen. »Sie sind?«
»Pensionär«, gab Wilhelm zurück.
Labes verzog keine Miene. »Ihr Name.«
»Ich denke, den kennen Sie.«
»Da dürften Sie recht haben.« Labes gab mit der Hand ein Signal an seine Männer. »Abführen.«
*
Wie in Trance taumelte Margarete die Treppe des Schulgebäudes hinab, durchquerte das Foyer, stieß die zweiflüglige Holztür auf und stürzte ins Freie. Der Lärm von spielenden Kindern umgab sie. Die Pause war noch nicht vorbei.
Sie suchen mich! Sie wissen, dass ich hier bin!
Margarete hatte dem Gespräch mit Lüder und Thalheim kaum noch folgen können, nachdem die Rede von der Gestapo gewesen war. Lüder hatte ihren Unterricht in den höchsten Tönen gelobt, Thalheim hatte ergänzt, dass die Schule in diesen schwierigen Zeiten ohnehin nicht wählerisch sein könne. Die meisten Lehrer seien im Kriegsdienst. Man wolle sich beraten und ihr morgen das Ergebnis ihrer Einschätzung mitteilen. Margarete war sich sicher, dass sie die Anstellung bekommen würde.
Aber spielte das jetzt noch eine Rolle? Wenn die Gestapo ihr auf den Fersen war, dann konnte sie nicht riskieren, länger in dieser Gegend zu bleiben. Mehr noch, auch Wilhelm und Ida waren in Gefahr. Ganz zu schweigen von Marie, die noch nicht einmal geboren gewesen war, als die Ereignisse stattfanden, die Margarete in diese bedrohliche Lage gebracht hatten. Immerhin hatte sie nun Klarheit darüber, wie akut die Gefahr war. Bis jetzt hatte sie nicht gewusst, ob die Gestapo überhaupt noch nach ihr suchte. Das Versteckspiel, die neue Frisur und der neue Pass waren lediglich Vorsichtsmaßnahmen gewesen. Nun wusste sie, dass diese Maßnahmen ihr das Leben gerettet hatten. Bis jetzt.
»Fräulein von Brühl, haben Sie Ihre Klasse noch gefunden?« Die heiseren Worte eines Jungen im Stimmbruch rissen Margarete aus ihren Gedanken. Sie blickte auf und erkannte einen der Schüler aus der Klasse, in die sie zunächst fälschlicherweise gegangen war.
Margarete versuchte, ihrer Stimme eine gewisse Strenge zu verleihen. »Mein Name ist Müller.«
»Selbstverständlich.« Der Junge grinste. »Ich habe noch eine Frage, wenn es recht ist, Fräulein von Brühl.«
Margarete wühlte in der Tasche ihrer Jacke und zog den Pass hervor. »Hier, siehst du? Mein Name ist Müller!« Sie pochte mit dem Finger auf das Schriftstück.
Der Junge ging nicht darauf ein, sondern starrte sie unverwandt an. »Was ich fragen wollte … Also, eigentlich frage ich für Albert aus der Sekunda … Sind Sie noch auf dem Markt?«
Wut stieg in Margarete auf, die gerade den Pass wieder in ihre Jacke steckte. Sie blickte auf und wollte den Jungen zurechtweisen, doch der war schon davongelaufen und feixte mit seinen Kameraden.
Kopfschüttelnd atmete Margarete tief ein und aus. Die Lage war eindeutig: Sie befand sich in höchster Gefahr. Früher oder später würde jemand dahinterkommen, dass ihre Identität ein Lügenmärchen war. Oder sie würde sich erneut verplappern, so wie es ihr heute passiert war. Es war zu riskant. Aber was war die Alternative? Gab es einen Ort, wohin die Gestapo sie nicht verfolgen würde? Margarete überquerte den Schulhof und wich dabei den tobenden Jungen und ihren Bällen aus. Schließlich schritt sie durch das Tor, das den Hof von der Straße trennte, und wandte sich nach rechts, wo sie ihr Fahrrad abgestellt hatte.
Sie richtete es auf und wollte aufsteigen, doch etwas stimmte nicht. Beide Reifen waren platt. Jemand hatte die Ventile aufgedreht. Entnervt sah Margarete sich um. Sie war allein auf der Straße. Hatte etwa einer der Lausebengel aus der Schule es gewagt? Kurz rang sie mit sich, ob sie auf dem Schulhof nach dem Schuldigen suchen sollte, doch dann entschloss sie sich, den Vorfall auf sich beruhen zu lassen. Sie würde den Täter ohnehin nicht finden und zudem noch mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und Aufmerksamkeit konnte sie momentan am wenigsten gebrauchen.
Sie wendete das Fahrrad und schob es die Straße hinunter aus dem Dorf hinaus. Zu Fuß würde sie mindestens eine Stunde bis nach Hause brauchen. Eine Stunde, in der sie darüber nachdenken konnte, an welcher Stelle ihres Lebens die Dinge begonnen hatten, so furchtbar schiefzugehen.
Nach einigen Minuten war die Straße nicht mehr als ein Feldweg, der durch grüne Weizenfelder und Gruppen von Kiefern führte. Die Sonne stand hoch am wolkenlosen Himmel. Margarete zog ihre Jacke aus und warf sie über ihre Schulter. Gerade als ihre Gedanken sich wieder den Geschehnissen der Vergangenheit zuwenden wollten, brachte das Geräusch einer Autohupe sie unsanft zurück in die Realität.