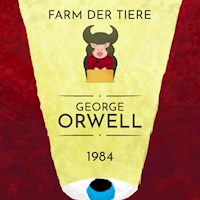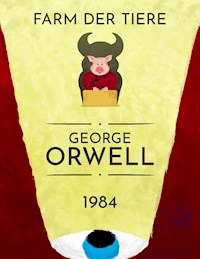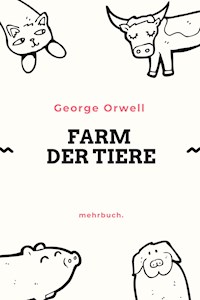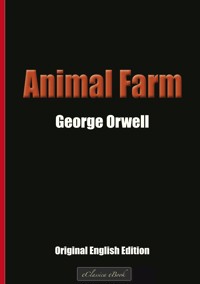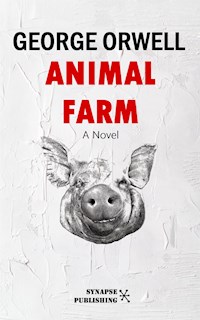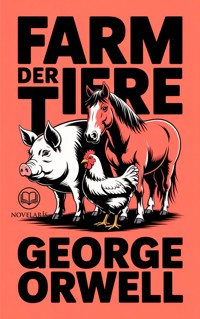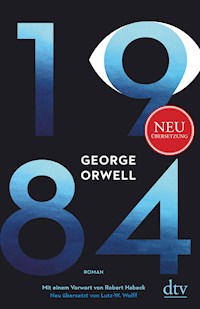
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Aktueller denn je: Orwells visionäres Meisterwerk – neu übersetzt Als Mitarbeiter des Ministeriums für Wahrheit verbringt Winston Smith seine Tage damit, die Geschichte zugunsten der regierenden Partei umzuschreiben. Aber in seinem Inneren wächst ein Widerstand gegen das totalitäre System, in dem das Leben aufs Strengste reguliert und überwacht wird. Als Winston sich verbotenerweise verliebt, erfährt er, was der Wunsch nach Freiheit kostet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 557
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Im Jahr 1984 ist London Teil des Staates Ozeania, eine von drei Weltmächten. Das Leben der Bürger wird von der regierenden Partei, an deren Spitze der symbolhafte Große Bruder steht, auf Schritt und Tritt überwacht. Der neununddreißigjährige Winston Smith verbringt als Mitarbeiter des Ministeriums der Wahrheit seinen Alltag damit, die Geschichte zugunsten der aktuellen Parteilinie umzuschreiben. Aber in seinem Inneren wächst ein Widerstand gegen das totalitäre System. Als Winston sich verbotenerweise verliebt und eine Affäre eingeht, muss er auf schmerzhafte Weise erfahren, was der Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmung kostet.
Big Brother, Fake News und alternative Fakten: George Orwell hat in seinem visionären dystopischen Meisterwerk eine Sprache geschaffen, die Einzug in unsere Realität gefunden hat und uns plakativ vor Augen führt, welche Gefahren in einem absoluten Überwachungsstaat liegen.
Ansichten über Wahrheit
Vorwort von Robert Habeck
George Orwell ist der Analytiker des Totalitarismus. Bis 1989 und dem Ende des real existierenden Sozialismus blieben seine Romane ›1984‹ und ›Farm der Tiere‹ die vielleicht jeweils aktuellsten Bücher ihrer Zeit. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetrepublik und dem beschworenen Sieg des globalen kapitalistischen Liberalismus schienen sie historisch geworden zu sein. Aber heute, nochmals dreißig Jahre später, sind sie wieder aktuell, vielleicht aktueller denn je. Denn nicht nur gewinnen autoritäre Regime global gesehen an Zuspruch, auch Staaten, die von sich glauben mögen, sie seien die ehemaligen Fackelträger der Freiheit und Demokratie, werden von einem autoritären Populismus gebeutelt. Insofern erleben wir derzeit nicht einfach nur eine neue Teilung der Welt in liberale und illiberale Demokratien, autoritäre Herrschaft gegen eine freiheitliche, liberale Ordnung. Wir erleben, wie das Gift des totalitären Denkens auch in das Fundament der Demokratie einsickert und sie von innen auszuhöhlen droht. Neue Allianzen entstehen zwischen weltanschaulich ganz unterschiedlich ausgerichteten Regierungen, die jedoch alle die Ablehnung gegen Freiheitsrechte, Pressefreiheit und Gewaltenteilung eint. Für alle, die die Instrumente des Autoritären, des Totalitären verstehen wollen, ist das Wiederlesen von George Orwell ein Muss.
Bedrohlich ist diese Entwicklung und Systemkonkurrenz zwischen autoritären und freiheitlichen Staaten, weil Erstere anders als früher möglicherweise auch einen ökonomischen Vorteil durch das massenweise Abgreifen von Daten haben. Galt es in der analogen Welt als ausgemacht, dass Wettbewerb, Freiheit und Kreativität und Marktwirtschaft gegenüber Planwirtschaft, gelenkten Prozessen, Oligopolen und Kartellen mindestens langfristig überlegen sind, weil sie effizienter und schneller Erkenntnisse und Innovationen hervorbringen, so ist das in der digitalen Wirtschaft bei Weitem nicht sicher. China beispielsweise mit seinen großen, zentral gesammelten Daten über Verhaltensweisen, Krankheitsbilder, persönliche Vorlieben weiß viel mehr über die Gesellschaft als die europäischen Staaten. Der Staat hat einen gigantischen Informationsvorteil gegenüber den dezentralen Wirtschaftssystemen. Erst recht, wenn Künstliche Intelligenz mit ins Spiel kommt und die Datenmengen auswertet. Für Demokratie und Bürgerrechte ist diese staatliche Kontrolle inakzeptabel. Der Machtvorteil gegenüber einer freien Gesellschaft, die das private Leben ihrer Bürgerinnen und Bürger nicht ausspäht und ausbeutet, ist jedoch immens. Ob die liberalen Demokratien diese neue Systemauseinandersetzung bestehen werden oder nicht, hängt ganz maßgeblich von der Frage ab, ob es ihnen gelingt, sich gegenüber den großen Herausforderungen unserer Zeit als handlungsfähig zu erweisen.
Für heutige Generationen, die freiwillig ihre privatesten Angelegenheiten im Internet teilen und die daran gewöhnt sind, dass Google immer weiß, wo wir uns gerade befinden, scheint die Überwachung durch die Technik, die Orwell in ›1984‹ aufzeigt, möglicherweise geradezu altmodisch. Dabei wird übersehen, wie aktuell die damit verbundene Warnung ist. Zynischerweise liefert gerade die Corona-Krise Beispiele en masse dafür, was technische Überwachung mittlerweile zu leisten in der Lage ist. Und die autoritären Herrscher weltweit nutzten die Lebensgefahr durch das Virus radikal aus. Parlamentarische Mitbestimmung, Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit wurden eingeschränkt. China vor allem spielte während der Corona-Zeit seinen technisch-totalitären Komplex voll aus und nutzte sein »Social Scoring«-System, um Menschen mit Corona-Infektion zu isolieren, indem ihnen beispielsweise verwehrt wurde, Züge, Busse oder Bahnen zu benutzen oder einzukaufen. Dritte konnten über ihre Smartphones identifizieren, wo sich Corona-Infizierte aufhielten. Über die Gesichtserkennung des Handys und die Temperaturmessung des Fingers auf dem Touchscreen konnte eine Vordiagnose getroffen werden. Der chinesische Staat übte totale Überwachung aus und kontrollierte das Verhalten seiner Bürgerinnen und Bürger bis ins letzte Detail. China schuf durch das »Social Scoring« den gläsernen Untertanen. War man schon daran gewöhnt, dass das Überqueren von Straßen ohne Erlaubnis gefilmt und gespeichert wurde, ist die Ausweitung der sozialen Kontrolle auf die Gesundheitsdaten der Menschen eine weitere Dimension auf dem Weg zur sozialen Manipulation. Der israelische Historiker Yuval Noah Harari wies in einem Gastbeitrag in der Financial Times am 20. März 2020 darauf hin, dass Emotionen messbare biologische Phänomene seien wie Krankheitssymptome. Wird auf Handys oder in Armbändern eine Technik eingesetzt, die Erkältungen und Infekte erkennen kann, ist sie auch in der Lage, Gelächter oder Ablehnung zu erkennen – und könnte dieses Wissen zur Beeinflussung von Meinungen nutzen. Das markiert die Grenze zwischen Überwachung und Manipulation. Und es ist genau diese Grenze, die Orwell schon in ›1984‹ sichtbar gemacht hat. So schlimm es ist, in einem Staat zu leben, in dem das Recht auf freie Rede genommen ist, schlimmer ist es, in einem Land zu leben, das die Menschen so manipuliert, dass sie überhaupt nicht mehr auf den Gedanken kommen zu widersprechen, beziehungsweise ihnen die Sprache genommen wird. Auch hier liefert die jüngste Geschichte eindringliche Beispiele dafür, dass genau solche Versuche immer wieder unternommen werden, auch in Deutschland. Nach der Landtagswahl in Thüringen 2019 konnte man AfD-Funktionären einen Abend lang zuschauen, wie sie behaupteten, dass ihr Wahlerfolg ein Sieg über Hass und Hetze sei. Diejenigen, die alle Grenzen des Sagbaren verschieben und überschreiten, beklagen sich, dass es in Deutschland Sprachverbote gebe. Diejenigen, die Anstand und Moral vermissen lassen, bezeichnen sich als bürgerlich. Diejenigen, die die Demokratie zu einer Volksherrschaft umbauen vollen, beschimpfen sie als Diktatur und Fassadendemokratie. Wir erleben in diesen Zeiten ein orwellsches NeuSprech par excellence. Aus Lüge wird Wahrheit und aus Wahrheit Lüge.
›1984‹ erneut zu lesen, hatte einen eigentümlichen Effekt auf mich. Als ich das Buch das erste Mal las, noch in der Schule, war es für mich eine Metapher für die totalitären Regime der dunkelsten Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts, des Stalinismus und des Nationalsozialismus. Es führte vor, wie Menschen gebrochen und manipuliert werden, wie Faschismus funktioniert, wie die Wirklichkeit zu einer einzigen Manipulation wird. Man weiß nicht, ob der Krieg, den Eurasien gegen Ozeania und Ostasien im Roman führt, tatsächlich stattfindet oder ob die Raketenangriffe nicht doch auf das Konto der eigenen Regierungen gehen, um ihre Gewalt zu rechtfertigen, so, wie beispielsweise der Reichstagsbrand 1933 in Berlin von den Nazis gelegt wurde, um Kommunisten und Sozialdemokraten zu inhaftieren. Und am Ende des Tages wird ein großer Sieg vermeldet, wie in der Wochenschau der Nazis.
Man weiß auch nicht, ob Emmanuel Goldstein, der Widersacher des Systems, und die Untergrundbewegung der »Bruderschaft« überhaupt existieren. Vermeintliche Freunde entpuppen sich als Spitzel, die Gedankenpolizei spürt nicht nur Verrat auf, sondern implementiert den Gedanken an Verrat in Köpfen, nur um diese dann abzuschlagen. Und am Ende verraten sich auch die einander liebenden Hauptfiguren, Winston Smith und Julia, gegenseitig. Es bleiben nur Scham und gebrochene Individualität. Es bleibt nichts Gutes. Es bleibt keine Hoffnung.
›1984‹ war für mich früher die literarische Intensivierung dessen, was ich aus Geschichtsbüchern und Nachrichtensendungen kannte. Es war die Veranschaulichung dessen, was die Generation meiner Großeltern im Nationalsozialismus und meiner Onkel und Tanten in der DDR erlebt haben müssen. Es war eine überzeugende Darstellung davon, wie es sich anfühlen muss, wenn die Intimsphäre ausgeleuchtet wird. »Ständig beobachteten dich seine Augen, ständig umgab dich seine Stimme. Beim Schlafen und beim Wachen, bei der Arbeit und beim Essen, zu Hause und auf der Straße, in der Badewanne und im Bett – es gab kein Entkommen. Nichts gehörte dir selbst, außer den paar Kubikzentimetern im Inneren deines Schädels.«
Aber es hatte damals nichts mit meiner Wirklichkeit zu tun. Und auch all die Kampagnen der letzten Jahre, die sich auf »orwellsche Überwachung« beriefen, gegen Vorratsdatenspeicherung, Datenleaks, Volkszählungen, Videoüberwachung, Warnung vor Amazons Alexa etc. fand ich letztlich an den Haaren herbeigezogen. Den orwellschen Überwachungsstaat auf den Bildschirm zu reduzieren, reduziert den Roman auf die Auflistung technischer Instrumente. Letztlich leben wir in einer freien Demokratie, das war immer meine feste Überzeugung gewesen. Und das Vertrauen darauf hat die Orwell-Lektüre für mich zu einem Spiegel der Vergangenheit gemacht. Eindringlich, ja. Grundsätzlich, unbedingt. Immerhin ist ›1984‹ einer der wenigen Romane der Weltliteratur, von dem es Elemente in unser sprachliches Allgemeingut geschafft haben – »Big Brother is watching you«. Aber diesen Roman darüber hinaus als gegenwärtig zu bezeichnen? Irgendwie schien mir diese Interpretation etwas überzogen, etwas zu dystopisch.
Beim erneuten Lesen ist es mir vollkommen anders gegangen. Ehrlich gesagt, habe ich dabei überhaupt nicht mehr an 1933–1945 oder die DDR oder Sowjetrussland gedacht. Ich dachte nur noch an unsere Zeit, unsere unmittelbare Gegenwart. Und das liegt an der von Orwell messerscharf vorgeführten Analyse, wie Sprache manipuliert werden kann. Wie Geschichte umgedeutet werden kann. Wie der Gesellschaft ein festes Wertefundament entzogen wird, sodass am Ende nur noch Angst und totale Unterwerfung übrig bleiben.
Da ist zunächst die Hauptperson Winston, die mit ihrer Arbeit im »Ministerium der Wahrheit« selbst dazu beiträgt, die Geschichte so umzuschreiben, dass sie zu der gegenwärtigen herrschenden Doktrin passt. In einem gewissen Sinn interpretiert Politik die Vergangenheit immer zu ihren Gunsten. Aber Orwell zeigt, dass die Vergangenheit nicht nur auf eine bestimmte Art und Weise interpretiert, sondern tatsächlich verändert wird. Das ist etwas ganz anderes. Es macht einen Unterschied, ob man darüber streitet, was die deutsche Geschichte ausmacht, oder ob man behauptet, die »Wehrmacht« der Nazis stehe in einer humanistischen Tradition, bzw. der Holocaust sei ein »Vogelschiss in 1.000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte« gewesen, wie es Politiker der AfD in den letzten Jahren taten. Orwell führt in seinem dystopischen Roman dieses Umdeuten der Wahrheit und infolgedessen ihren Verlust vor. Und dann ist da vor allen Dingen »NeuSprech«. Eine Sprache, die »gereinigt« ist, die »schädliche Begriffe ausgemerzt hat« und damit nicht mehr nur Propaganda ist, sondern eine eigene Wirklichkeit schafft, eine, in der es keine Wahrheit mehr gibt, sondern nur noch Ansichten über Wahrheit, wo dann »Unwissenheit« »Stärke«, »Krieg« »Frieden«, »Freiheit« »Sklaverei« ist. So entsteht »DoppelDenk«, eine Logik, nach der von zwei widersprüchlichen Überzeugungen beide richtig sind. Heute nennt man das »alternative Fakten« oder »Fake News«. Aber der Mechanismus ist der gleiche. Die Wahrheit als Basis einer gemeinsam geteilten und interpretierten Wirklichkeit wird zerstört. NeuSprech und DoppelDenk, beides feiert heute fröhliche Urständ – beides wird als politisches Mittel gebraucht. Die Manipulation durch Lügen und gefälschte Zitate, die Zergliederung des öffentlichen Raumes in lauter Gruppen und Grüppchen, oft unterstützt durch die sozialen Medien. »Die Partei sagte, man dürfe seinen Augen und Ohren nicht trauen. Das war ihr entscheidendes, ultimatives Gebot«, heißt es in ›1984‹. Und genau so agieren Populisten weltweit. Am radikalsten vielleicht der US-amerikanische Präsident, der beispielsweise behauptete, dass Bilder von seiner Amtseinführung, auf denen zu sehen ist, dass deutlich weniger Menschen anwesend waren als bei Barack Obama, von den Medien manipuliert worden seien. Was nicht seinem Weltbild entspricht, kann nicht wahr sein und ist »Fake News« oder im deutschen Pegida-Jargon »Lügenpresse«.
In ›1984‹ heißt es, nachdem die Beweisbilder manipuliert worden sind: »Du hast geglaubt, du hättest unwiderlegliche Beweise dafür gesehen, dass ihre Geständnisse falsch waren. Es gab da ein Foto, das Halluzinationen bei dir ausgelöst hat. Du hast sogar geglaubt, dass du es in der Hand gehabt hättest.«
Es geht bei diesen Formen der politischen Kommunikation nicht darum, dass Lüge zu einem Instrument der Politik wird. Denn Lüge setzt ein Bewusstsein von Wahrheit voraus. Das Dringliche und Eindringliche des Romans ist, dass er aufzeigt, wie nicht mehr zwischen Lüge und Wahrheit unterschieden werden kann. Und wenn das passiert, dann ist Demokratie am Ende. Weil es keinen gemeinsamen Grund mehr gibt, auf dem und von dem aus man streiten kann. Oder wie es im »Anhang: Die Grundlagen von NeuSprech« heißt: »Der Zweck von NeuSprech bestand nicht nur darin, ein Ausdrucksmittel für die Weltanschauung und die Geisteshaltung […] zu schaffen, sondern darin, jede andere Denkweise a priori unmöglich zu machen. Sobald NeuSprech ein für alle Mal angenommmen und AltSprech vergessen war, sollte jeder häretische […] Gedanke buchstäblich un-denkbar sein, jedenfalls, soweit er sich auf Worte stützte. Das Vokabular war so konstruiert, dass es den Parteimitgliedern erlaubte, alles Nötige korrekt und oft sehr subtil auszudrücken, während es den Ausdruck irgendwelcher anderer Ansichten (auch auf indirektem Weg) von vornherein unmöglich machte.«
Die Zerstörung der Erinnerung ist ein weiteres Ziel von NeuSprech und DoppelDenk. Und auch die begegnet uns heute. Wenn etwa die Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland als »Vogelschiss« und das Holocaust-Mahnmal als »Denkmal der Schande« bezeichnet wird, wie es AfD-Politiker tun, dann soll damit die gemeinsame Erinnerung, auf der unsere freiheitliche Rechtsordnung aufgebaut ist, zerstört werden. Unser Grundgesetz beruht in seinen Artikeln 1 und 3 maßgeblich auf der Erfahrung, dass die Würde des Menschen angegriffen werden kann, dass Menschen wegen ihres Glaubens, ihrer Religion, ihrer Herkunft oder ihres Namens ausgegrenzt, ausgemerzt werden können. Und dieses historische Bewusstsein soll nach Auffassung dieser Partei zerstört werden, damit die Gegenwart umgedeutet und uminterpretiert werden kann. »Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft, und wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit.« Durch Manipulation, Verdrehung von Tatsachen oder der Bedeutung von Geschehnissen, Auslöschen von Erinnerung.
Winston und Julia wehren sich dagegen mit ihren eigenen Mitteln. Sie führen »Gespräche auf Raten«. Sie versuchen, amoralisch zu sein. Sex zu haben, gegen die exerzierte Lustlosigkeit. »Sie hatte es viele Dutzend Mal getan, und er wünschte sich, es wäre hundert- oder tausendmal gewesen. Alles, was auf Verdorbenheit hinwies, erfüllte ihn immer mit wilder Hoffnung. Wer weiß? Vielleicht war die Partei ja unter der Oberfläche völlig verfault und der Kult der angestrengten Selbstverleugnung in Wirklichkeit nur eine Täuschung, hinter der sich ein Sündenbabel verbarg?« Täuschung ist hier das Schlüsselwort. Denn während Winston sich noch einer Hoffnung auf ein anderes Leben in anderen Umständen hingibt, ist er schon längst Gegenstand der Überwachung.
In ›1984‹ gibt es nicht mehr die eine geteilte Wirklichkeit, sondern verschiedene Universen der Täuschung. Auch das kann man heute beobachten. Der Journalismusforscher Gerret von Nordheim hat nach dem Amoklauf von München im Juli 2016, bei dem neun Menschen in einem Einkaufszentrum erschossen wurden, 80.000 Tweets ausgewertet. Es gab zwei Kern-Tweets, die die Kommunikation bestimmten und Cluster bildeten. Der eine Cluster wurde durch die Twitter-Kommunikation der Münchner bestimmt. Auf deren Kommunikation bezogen sich die großen Medien wie ›Tagesschau‹ oder ›Spiegel Online‹. Das andere Cluster war ein Netzwerk aus rechten Organisationen und AfD-Politikern. Der Tweet mit der größten Reichweite in diesem Cluster lautete: »Deutschland im Visier des islamistischen Terrors! Nun muss das deutsche Volk für die Fehler der Regierung Merkel bluten!« Beide Cluster wiesen so gut wie keine Verbindung miteinander auf. Es gab geschlossene, parallele Deutungswelten.
Dieses Phänomen ist nicht neu. Und es gab es schon lange vor dem Internet. Auch in unserem Alltag umgeben wir uns mit Menschen, die so ähnlich ticken wie wir. Die Freunde, die wir haben, haben meist ähnliche Meinungen und Einstellungen wie wir. Der Grund ist einfach und einfach nachzuvollziehen. Es ist schlicht anstrengend, sich permanent infrage stellen zu lassen oder sich dauernd entschuldigen zu müssen. So ist die ›taz‹ eine Zeitung des linksliberalen Milieus, und die meisten Grünen lesen sie. Die ›FAZ‹ ist eine bürgerliche Zeitung, und nur wenige Grüne lesen sie, geschweige denn die ›BILD‹. Aber welche Zeitung auch immer – einmal gedruckt, antwortet sie nicht. Auch wenn man eine Zeitung liest, die einem politisch nahesteht, sie wird immer Artikel und Aspekte haben, die einem neu sind, die einen herausfordern. Das Internet und die sozialen Medien sind nicht nur schneller, sondern auch individueller, ja individualisierbarer. Und das macht den entscheidenden Unterschied aus. Durch Antworten und Retweets bestätigen sich Nutzer permanent selbst, sowohl in ihren Urteilen als auch in ihren Vorurteilen. Die eigene Weltsicht wird zu einer Echokammer, »ein selbst tragendes Parallelnetzwerk, das sich selbst genügt«. Die digitale Welt zersplittert die Gesellschaft in User-Gruppen von hoher Homogenität. Innerhalb dieser Gruppen bestätigen sich die Leute permanent in ihren Urteilen wie Vorurteilen. So entstehen zunehmend homogene Milieus, unterschiedliche Wirklichkeitswahrnehmungen. Und eine Politik, die auf Widerspruch angelegt ist, die autoritär und illiberal ist, kann sich dies sehr geschickt zunutze machen. Von der Struktur her neigen die sozialen Medien – Twitter und Facebook – nicht zur analytischen Debatte, sondern zur populistischen Polemik, zum Freund-Feind-Schema. Und weil die modernen sozialen Medien eine solche emotionale Kraft haben, weil sie die Gefühle in uns ansprechen und uns vor allem bei unseren negativen Gefühlen packen, bei Neid, Hass, Eifersucht, sind sie Werkzeuge der Manipulation. Sie sind zwar »sozial« in dem Sinne, dass wir uns durch sie besser zusammenfinden, verabreden und verstehen können, aber auch sozial-selektierend. Und je fester und fest gefügter das Weltbild in der eigenen Filterblase und Twitter-Wolke ist, umso mehr wird die gesellschaftliche Spaltung durch soziale Selektierung verstärkt. Wie beim Aufkommen der Verschwörungstheorien während der Corona-Krise gut zu beobachten war, gab es für die Menschen, die ausschließlich in ihren Internetwelten lebten, nur noch ihre eigene Wahrheit. Und für eine so sozial selektierte Gesellschaft gibt es gar keinen Ort mehr, von dem aus Wahrheit festgestellt werden kann. Das ist der orwellsche Albtraum. Nicht der Streit um die richtige Wahrheit, noch nicht mal die Unterdrückung des Streites durch staatliche Kontrolle, sondern dass es einfach kein Bewusstsein für abweichende Meinungen mehr gibt. Dass man unbewusst »etwas in den Staub auf dem Tisch malt: 2 + 2 = 5«.
»NeuSprech war darauf angelegt, die Reichweite des Denkens zu verkleinern«, heißt es im »Anhang« von ›1984‹. »Alle Zweideutigkeiten und Bedeutungsnuancen waren beseitigt worden. […] Eine kritische Haltung […] war schon deshalb hilflos, weil sie sprachlos und unbestimmt bleiben musste.« Äußern tut sich das dann beispielsweise im Denken von Katharine, Winstons erster Frau. »Sie hatte keinen Gedanken im Kopf, der kein Slogan war, und es gab keine Idiotie, die sie nicht mitgemacht hätte, solange sie von der Partei kam. ›Die menschliche Schallplatte‹ hatte er sie in seinen Gedanken getauft.« Selbst der Sex wird zum sprachlich denunzierten Objekt. »Sie erinnerte ihn schon am Morgen daran. Es war eine Pflicht, die am Abend getan werden musste und auf keinen Fall vergessen werden durfte. Sie hatte zwei Namen dafür. Der eine war ›ein Baby machen‹ und der andere ›unsere Verpflichtung gegenüber der Partei‹.« Alle anderen Deutungen und Gefühle, Liebe, Romantik, Begierde, Zärtlichkeit sind abtrainiert.
Auch Übersetzungen sind immer relativ. Sie sind immer geprägt durch die Erfahrungen und den Horizont ihrer jeweiligen Zeit. Deshalb ist es gut, dass es eine Neuübersetzung von ›1984‹ gibt. Zu der neuen Aktualität von Orwell und ›1984‹ vor dem Hintergrund der politischen und medialen Verschiebungen unserer Zeit, dem Systemkampf eines neues Autoritarismus, ja digitalen Totalitarismus gegen die freiheitliche, liberale Demokratie, passt die Aktualisierung von ›1984‹ gut.
Sprache schafft dir Wirklichkeit. Und erst recht in der Politik. Freiheit – auch die der Sprache und der Rede – und Verantwortung gehören zusammen. Darauf gründet sich Demokratie. Das ist der Kern unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung. Und bei all den Ungerechtigkeiten und all den Aufgaben, die zu tun sind – wir leben in der besten Demokratie, die es in Deutschland je gab, wir leben in der freiesten Gesellschaft, die wir je hatten –, und die Feinde der Freiheit, der Demokratie, des Rechtsstaats, sie zielen darauf, die Freiheit der Rede und der Gesellschaft durch gezielte Verantwortungslosigkeit zu zerstören. Wie das geschehen kann, zeigt ›1984‹. Dass es Fiktion bleibt und nicht Wirklichkeit wird, ist unsere Aufgabe.
1984
TEIL I
1
Es war ein heller, kalter Apriltag. Die Uhren schlugen dreizehnmal. Winston Smith drückte sein Kinn auf die Brust, um dem scheußlichen Wind zu entgehen. Eilig schlüpfte er durch die Glastür der Victory-Mansions, aber nicht schnell genug, um zu verhindern, dass eine rußige Staubwolke mit ihm hereinwirbelte.
Im Hausflur roch es nach gekochtem Kohl und alten Fußabtretern. Am anderen Ende hing ein farbiges Plakat an der Wand, das eigentlich zu groß für einen Innenraum war. Es zeigte ein massiges, über einen Meter breites Gesicht: das Gesicht eines Mannes von ungefähr fünfundvierzig mit einem schwarzen Schnauzbart und angenehm kräftigen Zügen. Winston steuerte auf die Treppe zu. Es mit dem Lift zu versuchen, war sinnlos. Auch in den besten Zeiten funktionierte er selten, und gegenwärtig wurde in den Tageslichtstunden der Strom abgestellt. Das war Teil der Sparmaßnahmen im Vorfeld der HassWoche. Die Wohnung war oben im siebten Stock, und Winston, der mit neununddreißig schon Krampfadern am rechten Knöchel hatte, stieg langsam hinauf und ruhte sich unterwegs mehrmals aus. Auf jedem Treppenabsatz starrte gegenüber dem Aufzugschacht das Plakat mit dem überdimensionalen Gesicht von der Wand. Es war eins dieser Bilder, die so angelegt sind, dass einen die Augen überallhin zu verfolgen scheinen. Die Bildunterschrift lautete: BIG BROTHERIS WATCHING YOU.
In der Wohnung las eine sonore Stimme eine Kolonne von Zahlen vor, die irgendwas mit der Produktion von Roheisen zu tun hatten. Die Stimme kam aus einer rechteckigen Metallplatte, die wie ein stumpfer Spiegel aussah und einen Teil der rechten Wand bildete. Winston drehte an einem Knopf, und die Stimme wurde ein bisschen leiser, auch wenn die Worte nach wie vor gut zu hören waren. Das Gerät (man nannte es TeleSchirm) konnte leiser, aber niemals ganz abgestellt werden. Er trat ans Fenster: eine eher schmale, klapprige Gestalt, deren Magerkeit durch den blauen Overall (die Uniform der Partei) noch betont wurde. Sein Haar war sehr hell, sein Gesicht war von gesunder Farbe, und seine Haut war rau von der groben Seife, den stumpfen Rasierklingen und der Kälte des gerade vergangenen Winters.
Draußen, selbst durch das geschlossene Fenster, sah die Welt kalt aus. Der Wind wirbelte unten auf der Straße kleine Spiralen von Staub und Papierfetzen auf, und obwohl die Sonne schien und der Himmel ein strenges Blau zeigte, wirkte doch alles irgendwie farblos, außer den überall angeklebten Plakaten. Das Gesicht mit dem schwarzen Schnauzbart blickte von jeder beherrschenden Straßenecke herunter. Auch an der gegenüberliegenden Hauswand hing eins. BIG BROTHER IS WATCHING YOU, stand darunter, und der dunkle Blick bohrte sich Winston tief in die Augen. Weiter unten, auf der Höhe der Straße, flatterte ein anderes Plakat im Wind hin und her, wobei das Wort INGSOC abwechselnd aufgedeckt und verhüllt wurde. In der Ferne stieß ein Hubschrauber zwischen den Dächern herunter, verharrte einen Augenblick wie eine Schmeißfliege und schoss dann in einer Aufwärtskurve davon. Das war eine Polizeipatrouille, die den Leuten ins Fenster schaute. Diese Patrouillen waren allerdings harmlos. Nur die GedankenPolizei war gefährlich.
Hinter Winstons Rücken brabbelte die Stimme aus dem TeleSchirm immer noch über das Roheisen und die Übererfüllung des 9. Dreijahrplans. Der TeleSchirm war Empfänger und Sender zugleich. Jedes von Winston erzeugte Geräusch, das lauter als ein gedämpftes Flüstern war, konnte er auffangen. Und solange Winston im Sichtfeld seiner Metallplatte war, konnte er auch gesehen werden. Natürlich wusste man nie, ob man zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich beobachtet wurde. Nach welchem System und wie oft die GedankenPolizei sich in eine bestimmte Leitung einschaltete, war Spekulation. Es war sogar vorstellbar, dass jeder die ganze Zeit überwacht wurde. Auf jeden Fall konnten sie sich in deine Leitung schalten, wann immer sie wollten. Aus einer Gewohnheit, die zum Instinkt wurde, lebte man (und musste man) stets in der Annahme leben, dass jedes Geräusch, das man machte, von jemandem mitgehört und, wenn es nicht gerade dunkel war, jede Bewegung beobachtet wurde.
Winston drehte dem TeleSchirm weiter den Rücken zu. Das war sicherer, obwohl er wusste, dass auch ein Rücken verräterisch sein konnte. Einen Kilometer entfernt ragte das Ministerium der Wahrheit, sein Arbeitsplatz, riesig und weiß über der rußigen Stadt auf. Das, dachte er mit einem unbestimmten Widerwillen, war also London, die Hauptstadt von Airstrip One, der bevölkerungsmäßig drittgrößten Provinz von Ozeania. Er durchsuchte sein Gedächtnis nach einer Kindheitserinnerung, die ihm gesagt hätte, ob London eigentlich immer schon so gewesen war. Hatte es schon immer diesen Ausblick auf Schneisen von zerfallenden Häusern aus dem neunzehnten Jahrhundert gegeben, deren Mauern mit Balken abgestützt, deren Fenster mit Pappe und deren Dächer mit Wellblech geflickt werden mussten, während ihre kaputten Gartenmauern in sich zusammenfielen? Die ausgebombten Ruinen, wo der Mörtelstaub noch in der Luft hing und das Schmalblättrige Weidenröschen schon über die Schutthaufen kroch? Die trostlosen Barackensiedlungen, die sich wie Hühnerställe überall dort auszubreiten begannen, wo die Bomben größere Flächen freigelegt hatten? Aber es half nichts, er konnte sich nicht erinnern. Von seiner Kindheit war nur eine Reihe von hell erleuchteten lebenden Bildern geblieben, die keinen Hintergrund hatten und größtenteils nicht verständlich waren.
Das Ministerium der Wahrheit – in NeuSprech*MiniTrue – unterschied sich auf ganz erstaunliche Weise von allem anderen in der Umgebung. Es war ein enormer, pyramidenförmiger Bau aus glitzerndem weißen Beton, der, Terrasse über Terrasse, dreihundert Meter hoch in die Luft ragte. Von dort aus, wo Winston stand, konnte man gerade noch die wichtigsten drei Parteislogans lesen, die sich in eleganten Buchstaben von der weißen Fassade abhoben:
KRIEG IST FRIEDEN
FREIHEIT IST SKLAVEREI
UNWISSENHEIT IST STÄRKE
Es hieß, das Ministerium der Wahrheit habe überirdisch dreitausend Räume und entsprechende Erweiterungen auch unterirdisch. In ganz London verteilt gab es nur noch drei andere Gebäude von ähnlicher Erscheinung und Größe. Sie machten alle anderen Häuser so klein, dass man vom Dach der Victory-Mansions alle vier gleichzeitig sehen konnte. In diesen vier Hochhäusern waren die vier Ministerien untergebracht, die den Regierungsapparat ausmachten. Das Ministerium der Wahrheit beschäftigte sich mit den Nachrichten, der Unterhaltung, der Erziehung und den schönen Künsten. Das Ministerium des Friedens beschäftigte sich mit dem Krieg. Das Ministerium der Liebe hielt Recht und Ordnung aufrecht. Und das Ministerium der Fülle war für die Wirtschaft verantwortlich. Die Namen in NeuSprech lauteten: MiniTrue, MiniPax, MiniLove und MiniPlenty.
Wirklich angsteinflößend war das Ministerium der Liebe. Es hatte kein einziges Fenster. Winston war noch nie im Inneren des Ministeriums der Liebe gewesen oder hatte sich ihm auch nur auf fünfhundert Meter genähert. Ohne dienstlichen Anlass kam man auch gar nicht hinein, und selbst dann musste man erst ein Labyrinth von Stacheldrahthindernissen, Stahltüren und getarnten Maschinengewehrnestern passieren. Sogar die Zufahrtsstraßen, die zu den äußeren Absperrungen führten, wurden von gorillagesichtigen Männern in schwarzen Uniformen bewacht, die mit Schlagstöcken bewaffnet waren.
Winston drehte sich abrupt um. Sein Gesicht zeigte die ruhige Zuversicht, die angeraten war, wenn man sich im Blickfeld des TeleSchirms aufhielt. Er durchquerte den Raum und ging in die kleine Küche. Damit, dass er das Ministerium um diese Zeit verlassen hatte, verzichtete er auf das Mittagessen in der Kantine. Dabei wusste er, dass es in seiner Küche außer dem Klumpen Schwarzbrot, den er für das morgige Frühstück aufsparen musste, nichts Essbares gab. Er nahm eine Flasche mit einer farblosen Flüssigkeit vom Regal. Auf dem schmucklosen weißen Etikett stand VICTORY-GIN. Der Inhalt verbreitete einen ekelhaften, öligen Geruch wie chinesischer Reisschnaps. Winston goss fast eine Teetasse voll, bereitete sich auf den Schock vor und stürzte den Schnaps hinunter wie Medizin.
Sein Gesicht lief augenblicklich rot an, und seine Augen tränten. Das Zeug war wie Salpetersäure oder ein Schlag auf den Hinterkopf mit dem Gummiknüppel. Im nächsten Augenblick aber legte sich das Brennen in seinem Magen, und die Welt sah viel freundlicher aus. Er nahm sich eine Victory-Zigarette aus einer zerknitterten Packung. Unvorsichtigerweise hielt er sie aufrecht, und der Tabak fiel auf den Boden. Bei der nächsten hatte er mehr Glück. Er ging wieder ins Wohnzimmer und setzte sich an den kleinen Tisch links vom TeleSchirm. Aus der Schublade nahm er einen Federhalter, ein Tintenfass und ein dickes Quartheft mit leeren Seiten, marmoriertem Einband und rotem Rücken.
Aus irgendeinem Grund war der TeleSchirm in seinem Wohnzimmer an einer ungewöhnlichen Stelle. Anstatt wie üblich an der Schmalseite, die den ganzen Raum beherrschte, befand er sich an der Längsseite, gegenüber vom Fenster. Und links davon, wo Winston jetzt saß, war eine flache Nische, die vermutlich für ein Bücherregal gedacht war, als die Wohnung gebaut wurde. Wenn er in dieser Nische saß und sich nicht zu weit vorbeugte, befand er sich außerhalb der Reichweite des TeleSchirms, jedenfalls, was den Blickwinkel anging. Er konnte natürlich gehört werden, aber solange er in seiner gegenwärtigen Haltung verharrte, war er nicht zu sehen. Was er jetzt tun wollte, war nicht zuletzt auf diesen ungewöhnlichen Schnitt seines Zimmers zurückzuführen.
Aber es hatte auch mit dem Heft zu tun, das er gerade aus der Schublade genommen hatte. Es war ein besonders schönes Heft. Sein cremig glattes, vom Alter ein wenig vergilbtes Papier war von einer Qualität, wie sie seit mindestens vierzig Jahren nicht mehr hergestellt wurde. Er glaubte sogar, dass es noch wesentlich älter sein könnte. Er hatte es im Schaufenster eines Trödelladens in einem verkommenen Viertel gefunden (wo genau, wusste er gar nicht mehr) und war sofort von dem Verlangen erfasst worden, es zu besitzen. Parteimitglieder waren gehalten, gewöhnliche Läden zu meiden (Geschäfte auf dem »freien Markt« wurden nicht gern gesehen), aber streng an die Regeln konnte sich kaum jemand halten, denn es gab Dinge wie Schnürsenkel oder Rasierklingen, an die man gar nicht anders herankam. Winston hatte rasch die Straße hinauf- und hinuntergeschaut, hatte sich in den Laden gestohlen und das Heft für zwei Dollar fünfzig gekauft. Eine besondere Absicht hatte er damit nicht verbunden. Er hatte es in seine Aktentasche gesteckt und mit Schuldgefühlen nach Hause getragen. Obwohl gar nichts drinstand, war es ein kompromittierender Gegenstand.
Was er jetzt beginnen wollte, war ein Tagebuch. Das war nicht illegal (nichts war illegal, denn es gab gar keine Gesetze mehr), aber wenn es entdeckt wurde, würde er wahrscheinlich mit dem Tode oder zumindest fünfundzwanzig Jahren Zwangsarbeit in einem Lager bestraft werden. Winston steckte eine Feder in den Federhalter und saugte daran, um das Fett zu entfernen. Ein Federhalter war ein archaisches Schreibgerät, das selbst für Unterschriften nur noch selten benutzt wurde, und er hatte ihn sich nur besorgt, heimlich und nicht ohne Schwierigkeiten, weil er das Gefühl hatte, dass man das schöne cremige Papier mit einer echten Feder beschreiben musste statt mit einem Tintenstift. Eigentlich war er es gar nicht mehr gewohnt, mit der Hand zu schreiben. Abgesehen von kurzen Notizen war es üblich, alles dem SprechSchreib zu überlassen, was allerdings in diesem Fall nicht infrage kam. Er tauchte die Feder in die Tinte und zögerte einen Moment. Ein Schauder ergriff seine Eingeweide. Das Papier zu beschreiben, war der entscheidende Schritt. In kleinen, unbeholfenen Buchstaben schrieb er:
4. April 1984.
Dann lehnte er sich zurück. Ein Gefühl vollkommener Hilflosigkeit überkam ihn. Das fing schon damit an, dass er nicht einmal mit Sicherheit sagen konnte, ob es wirklich das Jahr 1984 war. Ungefähr stimmte es, denn er war sich ziemlich sicher, dass er neununddreißig war, und er glaubte, 1944 oder 1945 geboren zu sein; aber heutzutage war es nie möglich, ein Datum auf ein, zwei Jahre genau festzulegen.
Für wen, fragte er sich plötzlich, schrieb er dieses Tagebuch eigentlich? Für die Zukunft, für die Ungeborenen. Seine Gedanken kreisten eine Weile um das zweifelhafte Datum, das er auf die Seite gesetzt hatte, und prallten dann mit voller Wucht auf das NeuSprech-Wort: DoppelDenk. Zum ersten Mal wurde ihm die Ungeheuerlichkeit dessen bewusst, was er sich vorgenommen hatte. Wie konnte man mit der Zukunft kommunizieren? Das war doch ihrem Wesen nach unmöglich. Entweder würde die Zukunft der Gegenwart ähneln, dann würde sie ihm nicht zuhören, oder sie war ganz anders, dann hatten seine Probleme keine Bedeutung mehr.
Eine Zeit lang starrte er blind aufs Papier. Der TeleSchirm war zu strammer Marschmusik übergegangen. Es war eigenartig, dass Winston nicht nur die Fähigkeit, sich auszudrücken verloren zu haben schien, sondern offenbar auch vergessen hatte, was er ursprünglich hatte sagen wollen. Seit Wochen hatte er sich auf diesen Moment vorbereitet, und es war ihm nie in den Sinn gekommen, dass dafür noch etwas anderes notwendig sein könnte außer Mut. Das eigentliche Schreiben hätte einfach sein sollen. Er musste ja nur den endlosen, rastlosen Monolog, der seit Jahren in seinem Kopf lief, auf das Papier übertragen. In diesem Augenblick aber war auch der Monolog verstummt. Obendrein hatte das Geschwür an seinem Bein unerträglich zu jucken begonnen. Er wagte nicht, sich zu kratzen, denn sonst hätte es sich wahrscheinlich wieder entzündet. Die Sekunden verstrichen. Er war sich nur der leeren Seite vor ihm bewusst, des Juckens über dem Knöchel, der scheppernden Musik und einer leichten Benommenheit wegen des Gins.
Plötzlich begann er in einem Anflug von Panik zu schreiben, obwohl er sich kaum bewusst war, was er da zu Papier brachte. Seine kleine, aber kindliche Handschrift wucherte über die Seite. Zuerst verschwanden die Großbuchstaben, dann auch die Punkte und Kommas:
4. April 1984. Gestern Abend im Kino. Alles Kriegsfilme. Einer war sehr gut: ein Schiff voller Flüchtlinge, das irgendwo im Mittelmeer bombardiert wurde. Das Publikum war sehr amüsiert von der Szene, als ein riesiger fetter Mann wegschwimmen wollte und dabei von einem Hubschrauber verfolgt wurde. Erst sah man ihn im Wasser herumpaddeln wie einen Schweinswal, dann sah man ihn durch das Visier des MG-Schützen, dann war er voller Löcher und das Meer um ihn herum färbte sich rosa. Er ging unter, als ob die Löcher das Wasser reingelassen hätten, und das Publikum brüllte vor Lachen. Dann sah man ein Rettungsboot voller Kinder, darüber schwebte ein Hubschrauber. Eine Frau mittleren Alters, die eine Jüdin gewesen sein könnte, saß im Bug mit einem etwa drei Jahre alten Jungen im Arm. Der Kleine schrie vor angst und versteckte den Kopf an ihrer Brust, als ob er sich in sie hineingraben wollte, und die frau legte ihre arme um ihn, um ihn zu trösten, obwohl sie selbst blau vor angst war. Sie deckte ihn so weit wie möglich mit ihren armen zu, als ob sie damit die kugeln abhalten könnte. Dann setzte der Hubschrauber eine 20-Kilo-Bombe mittenrein, es gab einen mordsblitz und das boot war nur noch kleinholz. Dann kam diese herrliche szene als der kinderarm in die luft schoss immer höher und höher. Da muss ein hubschrauber mit einer kamera im bug direkt dahinter gewesen sein und es gab eine menge beifall von den parteirängen, aber eine frau auf den prollsitzen fing an zu kreischen und sagte so was soll man den kindern nicht zeigen es wäre nicht richtig so was vor kindern zu zeigen am ende hat die polizei sie rausgebracht rausgebracht aber ich glaube nicht dass ihr viel passiert ist kein mensch kümmert sich was die prolls sagen typische prollreaktion die verstehen doch nie –
Winston hörte auf zu schreiben, unter anderem, weil er an einem Krampf litt. Er wusste selbst nicht, was ihn dazu gebracht hatte, diesen Strom von Müll von sich zu geben. Das Eigenartige war nur, dass sich dabei eine ganz andere Erinnerung so weit in seinem Bewusstsein geklärt hatte, dass er sich fast in der Lage fühlte, sie niederzuschreiben. Dieser andere Zwischenfall war es gewesen, der ihn heute plötzlich veranlasst hatte, nach Hause zu gehen und das Tagebuch zu beginnen, das wurde ihm jetzt bewusst.
Passiert war es am Vormittag im Ministerium, wenn man bei so etwas Unbestimmtem überhaupt sagen konnte, dass es passiert war.
Es war kurz vor elf Uhr, und in der DokumentationsZentrale, wo Winston arbeitete, fingen sie an, die Stühle aus den Büros zu ziehen, und stellten sie für die ZweiMinutenHass in die Mitte der Halle gegenüber von einem der großen TeleSchirme. Winston wollte sich gerade auf seinen Platz in einer der mittleren Reihen setzen, als unerwartet zwei Personen den Raum betraten, die er vom Sehen her kannte, mit denen er aber noch nie ein Wort gewechselt hatte. Das eine war eine junge Frau, der er schon häufiger in den Korridoren begegnet war. Ihren Namen kannte er nicht, aber er wusste, dass sie in der BelletristikZentrale arbeitete. Er hatte sie manchmal mit ölverschmierten Händen und einem Schraubenschlüssel gesehen. Vielleicht war sie Mechanikerin bei den RomanSchreibMaschinen. Sie sah ziemlich frech aus, war ungefähr siebenundzwanzig und hatte dickes, schwarzes Haar, Sommersprossen und einen raschen, athletischen Gang. Ein schmaler roter Gürtel, das Kennzeichen der Junior-Anti-Sex-Liga, war mehrfach um die Taille ihres Overalls geschlungen, gerade eng genug, um den Schwung ihrer Hüften zur Geltung zu bringen. Winston hatte sie vom ersten Augenblick an nicht gemocht. Und er wusste auch, warum. Es war diese Aura von Hockeyplätzen, kalten Bädern, GemeinschaftsWanderungen und allgemeiner geistiger Sauberkeit, die sie vor sich hertrug. Er lehnte die meisten Frauen ab, besonders die jungen und hübschen, weil sie oft noch fanatischer als andere Parteimitglieder waren, willig alle Parolen schluckten, aus freien Stücken zu Spitzeln wurden und jede Gesinnungsschnüffelei mitmachten. Und speziell diese junge Frau hielt er für noch gefährlicher als die anderen. Als sie einmal im Korridor an ihm vorbeilief, hatte sie ihm einen Blick zugeworfen, der ihm durch und durch ging und ihn für einen Moment lang mit blankem Entsetzen erfüllt hatte. Er hat sich sogar gefragt, ob sie vielleicht eine Agentin der GedankenPolizei sein könnte. Das war zugegebenermaßen recht unwahrscheinlich. Trotzdem spürte er in ihrer Nähe jedes Mal ein undefinierbares Unbehagen, in dem sich Angst und Feindseligkeit mischten.
Die andere Person war ein Mann namens O’Brien, ein Mitglied der Inneren Partei, der eine so wichtige und abgehobene Position innehatte, dass Winston nur eine schwache Ahnung von seiner Funktion besaß. Ein plötzliches Schweigen senkte sich über die Anwesenden, als sie den schwarzen Overall des Inneren Parteimitglieds registrierten. O’Brien war ein breiter, kräftiger Mann mit einem stämmigen Hals und brutalen Gesichtszügen, die von einem Sinn für derben Humor zeugten. Trotz seines erschreckenden Äußeren besaß er einen gewissen Charme. Die Art und Weise, wie er sich die Brille auf der Nase zurechtrückte, war eigenartig entwaffnend und kultiviert. Es war eine Handbewegung, die – wenn jemand noch von solchen Umgangsformen gewusst hätte – vielleicht an die Geste eines Edelmanns aus dem achtzehnten Jahrhundert erinnert hätte, der jemandem seine Schnupftabaksdose anbietet. Winston hatte O’Brien in den letzten zwölf Jahren vielleicht ein Dutzend Mal gesehen. Er fühlte sich zutiefst zu ihm hingezogen, und nicht nur wegen des Kontrasts zwischen seinen urbanen Manieren und seiner Boxerfigur. Es war vielmehr, weil er glaubte (oder eigentlich nur insgeheim hoffte), dass O’Briens politische Strenggläubigkeit nicht ganz vollkommen war. Irgendetwas in seinem Gesicht schien das anzudeuten, und es war unwiderstehlich. Andererseits war es vielleicht gar kein Nonkonformismus, was in seinem Gesicht geschrieben stand, sondern einfach nur Intelligenz. Auf jeden Fall erweckte er den Eindruck eines Menschen, mit dem man reden konnte, wenn es einem gelang, den TeleSchirm auszutricksen und ihn allein zu erwischen. Winston hatte allerdings nie auch nur den kleinsten Versuch unternommen, um seine Vermutung zu überprüfen. Es gab auch gar keine Möglichkeit dazu. In diesem Augenblick warf O’Brien einen Blick auf die Armbanduhr, stellte fest, dass es kurz vor elf war, und beschloss offensichtlich, für die Dauer der ZweiMinutenHass hier in der DokumentationsZentrale zu bleiben. Er wählte einen Stuhl in derselben Reihe wie Winston, nur zwei Plätze weiter. Zwischen ihnen saß die kleine Frau mit sandfarbenem Haar, die ihren Arbeitsplatz neben Winston hatte. Das Mädchen mit den dunklen Haaren saß hinter ihnen.
Im nächsten Augenblick ertönte aus dem TeleSchirm am vorderen Ende des Saals ein scheußliches markerschütterndes Kreischen, das klang, als ob ein Maschinenmonster zu wenig Öl hätte. Es taten einem die Zähne weh, und die Nackenhaare stellten sich auf. Die HassMinuten hatten begonnen.
Wie immer erschien das Gesicht von Emmanuel Goldstein, dem Volksfeind, auf dem TeleSchirm. Sofort ertönte hier und da ein wütendes Zischen im Publikum. Die kleine Frau mit den Sandhaaren stieß ein angst- und abscheuerfülltes Quieken aus. Goldstein war der Verräter und Abtrünnige, der einst vor langer Zeit (wie lange es her war, wusste niemand mehr so genau) zu den Führern der Partei gehört hatte, fast auf einer Ebene mit dem Großen Bruder. Dann aber hatte er sich in konterrevolutionäre Aktivitäten verwickeln lassen und war zum Tode verurteilt worden. Auf rätselhafte Weise war er entkommen und seither verschwunden. Die ZweiMinutenHass-Programme wechselten täglich, aber es gab keins, in dem nicht Goldstein die Hauptrolle spielte. Er war der Erzschurke, der Erste, der die Reinheit der Partei besudelt hatte. Alle nachfolgenden Verbrechen an der Partei, aller Verrat, alle Sabotageakte und Häresien, alles Abweichlertum entsprangen seinen Lehren. Irgendwo lebte er noch und spann seine Intrigen: vielleicht in Übersee, unter dem Schutz seiner ausländischen Hintermänner, vielleicht aber auch – wurde manchmal gemunkelt – in einem Versteck in Ozeania selbst.
Winstons Zwerchfell zog sich zusammen. Er konnte Goldsteins Gesicht nie ohne eine Mischung schmerzlicher Gefühle betrachten. Es war ein schmales jüdisches Gesicht mit einem großen, wirren Strahlenkranz weißer Haare und einem Spitzbart – ein kluges und zugleich verächtliches Gesicht, dessen Brille am Ende seiner langen dünnen Nase eine senile Schwäche ausdrückte. Es war eine Art Schafsgesicht, und auch die Stimme klang irgendwie schafsmäßig. Goldstein trug seine üblichen giftigen Angriffe auf die Partei vor, die so pervers und übertrieben waren, dass selbst ein Kind sie durchschaute, und zugleich doch plausibel genug, dass man befürchten musste, andere, weniger vernünftige Menschen könnten womöglich darauf hereinfallen. Er beschimpfte den Großen Bruder, er klagte die Diktatur der Partei an, er verlangte einen sofortigen Friedensschluss mit Eurasien, er sprach sich für Redefreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit und die Freiheit der Gedanken aus, er heulte hysterisch, die Revolution sei verraten worden – und das alles in einer rasenden, vielsilbigen Sprache, die wie eine Parodie auf die echten Parteiführer schien und auch NeuSprech-Worte enthielt: ja, sogar mehr NeuSprech-Worte, als ein normales Parteimitglied im richtigen Leben benutzen würde. Und damit ja kein Zweifel blieb, was sich hinter Goldsteins tückischen Phrasen verbarg, sah man hinter seinem Kopf die endlosen Kolonnen der eurasischen Armee. Reihe auf Reihe bulliger Soldaten mit ausdruckslosen asiatischen Gesichtern marschierte auf dem Bildschirm vorbei, um gleich wieder anderen, völlig identischen Platz zu machen. Der dumpfe Marschtritt der Soldatenstiefel untermalte Goldsteins blökende Stimme.
Noch ehe eine halbe HassMinute vorbei war, brach die Hälfte der Zuhörer in unkontrollierte Wutschreie aus. Das selbstgefällige Schafsgesicht auf dem Bildschirm und die erschreckende Wucht der eurasischen Armee dahinter waren nicht zu ertragen: Abgesehen davon, erzeugten der Anblick von Goldstein, oder auch nur der Gedanke an ihn, ganz automatisch Angst und Wut. Er war ein dauerhafterer Gegenstand des Hasses als Eurasien oder Ostasia; denn wenn Ozeania mit einer der beiden Mächte im Krieg lag, herrschte mit der anderen meist Frieden. Das Befremdliche war nur, dass Goldstein zwar von jedermann gehasst und verachtet wurde, dass seine Theorien jeden Tag tausendfach auf dem Podium, auf dem TeleSchirm, in der Presse und Büchern widerlegt, zerschmettert, lächerlich gemacht und als jämmerlicher Unsinn entlarvt wurden, sein Einfluss aber nie geringer zu werden schien. Immer gab es neue Opfer, die ihm ins Netz gingen. Es verging kein Tag, an dem die GedankenPolizei keine Spione und Saboteure enttarnte, die unter seinem Befehl standen. Er war der Kommandeur einer riesigen Schattenarmee und verfügte über ein unterirdisches Netzwerk von Verschwörern, die sich dem Umsturz des Staates verschrieben hatten. Der Name dieser Vereinigung war angeblich: die Bruderschaft. Es kursierten auch Geschichten über ein schreckliches Buch, ein Kompendium sämtlicher von Goldstein verfassten Irrlehren, das im Untergrund heimlich von Hand zu Hand gereicht wurde. Es war ein Buch ohne Titel. Wenn man überhaupt davon sprach, nannte man es einfach: das Buch. Man wusste allerdings nur durch vage Gerüchte von diesen Dingen. Kein normales Parteimitglied würde die Bruderschaft oder das Buch auch nur erwähnen, wenn es sich irgend vermeiden ließ.
In der zweiten Minute steigerte der Hass sich zur Raserei. Die Leute sprangen auf und nieder und brüllten so laut sie nur konnten, um die blökende Stimme vom Bildschirm zu übertönen, die sie verrückt machte. Die kleine Frau mit den sandfarbenen Haaren war rosa angelaufen, und ihr Mund schloss und öffnete sich wie das Maul eines Fisches an Land. Sogar O’Briens schweres Gesicht war gerötet. Er saß kerzengerade auf seinem Stuhl, und seine mächtige Brust schwoll und zitterte, als ob er dem Anprall der Wogen standhalten müsse. Das dunkelhaarige Mädchen hinter Winston schrie immer nur: »Schwein! Schwein! Schwein!«, und plötzlich nahm sie ein schweres NeuSprech-Wörterbuch und schleuderte es auf den Bildschirm. Es traf Goldstein an der Nase und platschte herunter, aber die Stimme fuhr unerbittlich fort. In einem klaren Augenblick merkte Winston, dass er genauso brüllte wie die anderen und mit der Ferse heftig gegen sein Stuhlbein schlug. Das Schreckliche an den ZweiMinutenHass war nicht, dass man dabei eine Rolle spielen musste, sondern dass es unmöglich war, nicht mitgerissen zu werden. Spätestens nach dreißig Sekunden war jede gespielte Erregung unnötig. Eine entsetzliche Ekstase von Angst und Rache, ein Bedürfnis, zu töten, zu foltern und Gesichter mit dem Hammer einzuschlagen, erfasste die Gruppe wie ein elektrischer Strom und verwandelte jeden Einzelnen auch gegen seinen Willen in einen Fratzen schneidenden, kreischenden Irren. Und doch war die Wut, die man spürte, ein abstraktes, ungezieltes Gefühl, das wie die Flamme eines Schneidbrenners von einem Gegenstand auf einen anderen gelenkt werden konnte. Und so war Winstons Hass zeitweilig gar nicht gegen Goldstein gerichtet, sondern gegen den Großen Bruder, die Partei und die GedankenPolizei; und in solchen Momenten flog sein Herz dem einsamen, verspotteten Häretiker auf dem Bildschirm zu, der ihm als einziger Hüter der Wahrheit und der Vernunft in einer Welt voller Lügen erschien. Aber im nächsten Augenblick schloss Winston sich wieder seiner Umgebung an, und alles, was über Goldstein gesagt wurde, schien vollkommen wahr. In dieser Phase schlug sein geheimer Widerwille gegen den Großen Bruder in Anbetung um. Der Große Bruder schien immer größer zu werden, er war der Beschützer, furchtlos und unbesieglich, der sich den asiatischen Horden wie ein Fels in der Brandung entgegenstemmte, während Goldstein trotz seiner Isolation, seiner Hilflosigkeit und der Zweifel, ob er überhaupt existierte, wie ein finsterer Zauberer schien, der das Gebäude der zivilisierten Welt schon mit der Kraft seiner Stimme zerstören konnte.
Manchmal konnte man seinen Hass auch durch einen Willensakt in diese oder jene Richtung lenken. Jedenfalls gelang es Winston jetzt, seinen Hass mit einer heftigen Kraftanstrengung, wie man sie braucht, um seinen Kopf bei einem Albtraum vom Kissen zu reißen, von Goldsteins Gesicht auf das dunkelhaarige Mädchen zu richten, das hinter ihm saß. Lebhafte, herrliche Fantasien blitzten durch sein Gehirn. Er würde sie mit einem Gummiknüppel zu Tode prügeln. Er würde sie nackt an einen Pfahl binden und mit Pfeilen spicken wie Sankt Sebastian. Er würde sie schänden und ihr im Augenblick des Höhepunkts die Kehle durchschneiden. Und was das Beste war: Jetzt endlich wusste er, warum er sie hasste. Er hasste sie, weil sie jung und schön und frei von Sex war, weil er mit ihr ins Bett wollte und nie so weit kommen würde, weil ihre schlanke, biegsame Taille, die er so gern mit den Armen umschlungen hätte, umspannt war von diesem hässlichen roten Gürtel, diesem aggressiven Symbol der Keuschheit.
Der Hass erreichte den Höhepunkt. Die Stimme von Goldstein war zu einem wirklichen Blöken geworden, und für einen Augenblick wurde sein Gesicht auch zu einem Schafsgesicht. Es verschmolz zur Gestalt eines eurasischen Soldaten, der groß und schrecklich mit ratternder Maschinenpistole aus dem TeleSchirm stürmte, sodass die Zuschauer in der ersten Reihe auf ihren Stühlen vor ihm zurückwichen. Dann folgte ein tiefer, erleichterter Seufzer: Der Feind verschwand, und an seine Stelle trat das Gesicht des Großen Bruders mit schwarzem Haar und schwarzem Bart, voll Kraft und rätselhafter Ruhe, so groß, dass es den ganzen Bildschirm ausfüllte. Niemand hörte, was der Große Bruder sagte. Es waren ein paar Worte der Ermutigung, wie sie im Schlachtenlärm gesprochen werden, man konnte sie im Einzelnen nicht unterscheiden, aber schon, dass sie ausgesprochen wurden, genügte, um das Vertrauen wiederherzustellen. Dann verblasste das Gesicht des Großen Bruders, und stattdessen erschienen die drei Prinzipien der Partei:
KRIEG IST FRIEDEN
FREIHEIT IST SKLAVEREI
UNWISSENHEIT IST STÄRKE
Das Gesicht des Großen Bruders schien noch ein paar Sekunden auf dem Bildschirm stehen zu bleiben, als ob der Eindruck auf der Netzhaut der Zuschauer zu lebendig gewesen wäre, um gleich zu verschwinden. Die sandhaarige kleine Frau hatte sich auf die Lehne des Stuhls geworfen, der vor ihr stand. Mit zitterndem Tremolo in der Stimme murmelte sie: »Mein Erlöser!« oder etwas Ähnliches und streckte die Arme zum Bildschirm hinauf. Dann barg sie das Gesicht in den Händen, und es war deutlich, dass sie ein Gebet sprach.
In diesem Augenblick brach die ganze Gruppe in einen tiefen, rhythmischen Singsang aus: GeBe! GeBe! GeBe! Immer wieder und wieder, sehr langsam, mit einer langen Pause zwischen dem G und dem B. Es war ein schweres, tiefes Stöhnen wie der Gesang von Wilden, sodass man im Hintergrund das Stampfen von nackten Füßen und das Wummern von Tom-Toms zu hören glaubte. Sie hielten es ungefähr dreißig Sekunden lang durch. Es war ein Refrain, der oft ertönte, wenn die Gefühle sie überwältigten. Einerseits war es eine Huldigung, die der Majestät und Weisheit des Großen Bruders galt, aber vor allem war es eine Art Selbsthypnose. Mit dem rhythmischen Getöse unterdrückte man gezielt sein Bewusstsein. Winstons Eingeweide wurden eiskalt. Während der ZweiMinutenHass konnte er sich dem allgemeinen Delirium nicht entziehen, aber dieses unmenschliche Gebrüll von GeBe!, GeBe! erfüllte ihn stets mit Entsetzen. Natürlich brüllte er genauso wie alle anderen: Etwas anderes zu tun, war unmöglich. Die eigenen Empfindungen zu verbergen, den Gesichtsausdruck zu kontrollieren und sich so zu verhalten wie alle anderen, war ein instinktiver Reflex. Eine Sekunde lang hatten seine Augen ihn aber womöglich verraten. Und genau in dieser Sekunde war diese bemerkenswerte Sache geschehen – wenn sie denn tatsächlich geschehen war.
Für eine Sekunde war O’Briens Blick auf ihn gefallen. O’Brien war aufgestanden. Er hatte die Brille abgenommen und wollte sie gerade wieder mit seiner typischen Handbewegung auf die Nase zurücksetzen. Aber für den Bruchteil einer Sekunde hatten sich ihre Blicke getroffen, und in diesem Bruchteil einer Sekunde wusste Winston – ja, er wusste! –, dass O’Brien dasselbe dachte wie er. Eine unmissverständliche Botschaft war ausgetauscht worden. Es war, als hätten sich ihre Schädel geöffnet und die Gedanken seien durch die Augen vom einen zum anderen geflossen. »Ich bin bei dir«, schien O’Brien gesagt zu haben. »Ich weiß genau, was du denkst. Ich weiß alles über deine Verachtung, deinen Hass, deinen Abscheu. Aber mach dir keine Sorgen, ich bin auf deiner Seite!« Dann war der Blitz der Erkenntnis vorbei, und O’Briens Gesicht war wieder so undurchdringlich wie das aller anderen.
Das war alles gewesen, und Winston war sich schon gar nicht mehr sicher, ob es passiert war. Solche Zwischenfälle hatten nie eine Fortsetzung. Sie hielten aber den Glauben oder die Hoffnung aufrecht, dass es außer ihm selbst noch andere gab, die an der Partei zweifelten. Vielleicht stimmten die Gerüchte über eine große Verschwörung im Untergrund doch, und die Bruderschaft gab es tatsächlich! Trotz der endlosen Verhaftungen, Geständnisse und Hinrichtungen konnte man nämlich nicht sicher sein, ob die Bruderschaft nicht nur ein Mythos war. An manchen Tagen glaubte er daran, an anderen nicht. Es gab keine Beweise, nur flüchtige Spuren, die alles oder nichts heißen konnten: aufgeschnappte Gesprächsfetzen, verwischte Kritzeleien in den Toiletten – einmal sogar eine kleine Handbewegung zwischen zwei Fremden, die aussah, als ob sie ein Erkennungszeichen gewesen sein könnte. Aber das waren alles Spekulationen, und es war durchaus möglich, dass er sich die ganze Sache bloß einbildete. Er war an seinen Arbeitsplatz zurückgekehrt, ohne O’Brien noch einmal anzusehen. Es kam ihm gar nicht in den Sinn, den flüchtigen Kontakt irgendwie fortzusetzen. Es wäre unvorstellbar gefährlich gewesen, selbst wenn er gewusst hätte, wie er es anfangen sollte. Eine, vielleicht zwei Sekunden lang hatten sie einen Blick getauscht, und damit war es wieder vorbei. Aber in der absoluten Einsamkeit, in der man zu leben gezwungen war, war das schon ein bedeutungsvolles Ereignis.
Winston raffte sich auf und setzte sich wieder gerade hin. Das löste ein kräftiges Rülpsen aus. Der Gin rumorte in seinem Magen.
Sein Blick konzentrierte sich auf das vor ihm liegende Blatt. Er entdeckte, dass er mechanisch weitergeschrieben hatte, während er verloren dagesessen hatte und grübelte. Und zwar keineswegs in der kleinen verkrampften Handschrift wie vorher. Die Feder war lustvoll über das weiche Papier geglitten und hatte in sauberen, großen Versalien geschrieben –
NIEDER MIT DEM GROSSEN BRUDER
NIEDER MIT DEM GROSSEN BRUDER
NIEDER MIT DEM GROSSEN BRUDER
NIEDER MIT DEM GROSSEN BRUDER
NIEDER MIT DEM GROSSEN BRUDER
Immer wieder. Eine halbe Seite voll.
Leichte Panik erfasste ihn. Was allerdings ziemlich absurd war; denn das Schreiben dieser speziellen Worte war auch nicht gefährlicher als sein erster Schritt, nämlich das Tagebuch überhaupt zu beginnen. Trotzdem war er einen Augenblick lang versucht, die nunmehr verdorbenen Seiten herauszureißen und das ganze Vorhaben aufzugeben.
Das wiederum tat er schon deshalb nicht, weil er wusste, dass es nichts nützen würde. Ob er NIEDER MIT DEM GROSSEN BRUDER schrieb oder nicht, machte gar keinen Unterschied. Ob er sein Tagebuch fortsetzte oder nicht, machte auch keinen Unterschied. Die GedankenPolizei würde ihn in jedem Falle erwischen. Er hatte das entscheidende Verbrechen begangen, das alle anderen in sich einschloss – selbst wenn seine Feder das Papier nie berührt hätte. Es wurde GedankenVerbrechen genannt. GedankenVerbrechen ließen sich nicht verbergen. Eine Weile kam man vielleicht davon, vielleicht sogar jahrelang, aber früher oder später erwischten sie dich.
Es geschah immer nachts – die Verhaftungen fanden ausnahmslos in der Nacht statt. Ein plötzlicher Ruck an der Schulter, eine raue Hand, die dich aus dem Schlaf riss, grelles Licht, das dich blendete, ein Kreis von harten Gesichtern rund um dein Bett. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle gab es kein Gerichtsverfahren und keinen Bericht über die Verhaftung. Die Leute verschwanden einfach, immer irgendwann in der Nacht. Dein Name wurde gelöscht, alle Spuren deines tätigen Lebens wurden beseitigt, dass du einmal existiert hattest, wurde geleugnet und schließlich vergessen. Du wurdest abgeschafft und vernichtet – vaporisiert war das übliche Wort dafür.
Einen Augenblick lang wurde er von einer Art Hysterie geschüttelt und begann, hektisch auf das Papier zu kritzeln:
sie werden mich abknallen ist doch egal sie verpassen mir einen genickschuss ist doch egal nieder mit dem großen bruder sie schießen einem immer ins genick ist mir doch egal nieder mit dem großen bruder -----------
Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und legte den Federhalter beiseite. Er schämte sich etwas. Im nächsten Augenblick schrak er heftig zusammen. Es klopfte laut an der Tür.
So schnell! Er saß still da wie eine Maus, in der vergeblichen Hoffnung, der Betreffende würde es nach einem Versuch einfach aufgeben. Aber nein, das Klopfen wiederholte sich. Das Schlimmste war, wenn man versuchte, auf Zeit zu spielen. Sein Herz hämmerte wie eine Trommel, aber sein Gesicht war aufgrund der langen Übung vollkommen ausdruckslos. Er stand auf und ging mit schweren Schritten zur Tür.
2
Als er die Hand auf den Türknauf legte, sah Winston, dass er das Tagebuch offen auf dem Tisch hatte liegen lassen. Überall stand NIEDER MIT DEM GROSSEN BRUDER. Und die Buchstaben waren so groß, dass man sie wahrscheinlich quer durch den Raum lesen konnte. Das war unglaublich dumm. Aber auch jetzt, in seiner Panik, begriff er, dass er das cremige Papier nicht dadurch hatte beschmutzen wollen, dass er das Heft zuschlug, solange die Tinte noch nass war.
Er holte tief Luft und machte die Tür auf. Augenblicklich durchflutete ihn eine warme Welle der Erleichterung. Eine farblose, niedergedrückte Frau mit dünnen Haaren und faltigem Gesicht stand vor ihm.
»Ach, Genosse«, begann sie weinerlich. »Ich dachte schon, dass ich Sie hab reinkommen hören. Könnten Sie vielleicht mal rüberkommen und sich unsere Spüle ansehen? Der Abfluss ist verstopft und –«
Es war Mrs Parsons, die Frau des Nachbarn auf dem gleichen Stock. (Die Anrede »Mrs« wurde von der Partei nicht gern gesehen – man sollte eigentlich immer »Genossin« sagen –, aber bei manchen Frauen benutzte man die Bezeichnung ganz instinktiv.) Sie war ungefähr dreißig, sah aber viel älter aus. Man hatte den Eindruck, dass die Falten in ihrem Gesicht voller Staub waren. Winston folgte ihr den Korridor hinunter. Solche Amateur-Reparaturleistungen waren ein alltägliches Ärgernis. Die Victory-Mansions waren alte Wohnblocks aus den Dreißigerjahren, und langsam ging alles darin zu Bruch. Dauernd fiel Putz von der Decke und von den Wänden, bei strengem Frost platzten regelmäßig die Leitungen, wenn der Schnee schmolz, leckte das Dach, und die Heizungen wurden nur lauwarm, wenn sie nicht aus Gründen der Sparsamkeit ganz abgestellt waren. Reparaturen, die man nicht selbst ausführen konnte, mussten von weit entrückten Komitees bewilligt werden, die selbst das Einsetzen einer neuen Fensterscheibe zwei Jahre verzögern konnten.
»Es ist natürlich nur, weil Tom nicht zu Hause ist«, sagte Mrs Parsons unbestimmt.
Die Wohnung der Parsons war größer als die von Winston und auf andere Art schäbig. Alles sah so kaputt und zertrampelt aus, als wäre sie gerade von einem großen, gewalttätigen Tier heimgesucht worden. Auf dem Fußboden lag überall Sportausrüstung herum: Hockeyschläger, Boxhandschuhe, ein geplatzter Fußball, ein Paar verschwitzte, verwurschtelte Shorts; und auf dem Tisch stapelten sich schmutziges Geschirr und eselsohrige Schulhefte. An der Wand hingen neben einem überlebensgroßen Plakat mit dem Großen Bruder die scharlachroten Wimpel der Jugend-Liga und der Späher. Wie im ganzen Gebäude roch es auch hier nach gekochtem Kohl, aber diese Aura war mit einem scharfen Schweißgeruch durchsetzt, der – wie man beim ersten Atemzug spürte, ohne sagen zu können, woher man das wusste – von jemandem stammte, der gegenwärtig nicht da war. Im Nebenzimmer versuchte jemand, mit einem Kamm und einem Stück hartem Toilettenpapier mit der Marschmusik mitzuhalten, die immer noch aus dem TeleSchirm drang.
»Das sind die Kinder«, sagte Mrs Parsons und warf einen ängstlichen Blick auf die Tür. »Die waren heute noch nicht draußen. Und natürlich –«
Sie hatte die Gewohnheit, ihre Sätze mittendrin abzubrechen. Die Spüle war bis zum Rand mit schmutzigem, grünlich schimmerndem Wasser gefüllt, das noch heftiger nach Kohl stank als alles andere. Winston kniete sich hin und prüfte das U-Rohr unter dem Abfluss. Er hasste es, mit den Händen zu arbeiten, und er hasste es, wenn er sich bücken musste, weil das oft einen Hustenanfall bei ihm auslöste. Mrs Parsons sah hilflos zu.
»Wenn Tom zu Hause wäre, hätte er’s natürlich im Handumdrehen repariert«, sagte sie. »So etwas macht ihm richtig Spaß. Tom ist ja so geschickt mit den Händen.«
Parsons war einer von Winstons Kollegen im Ministerium der Wahrheit. Er war ein dicklicher, aber höchst aktiver Mann von lähmender Dummheit, ein dicker Haufen von dämlichem Enthusiasmus – einer von diesen bedingungslos ergebenen Trotteln, auf die sich die Partei fast noch mehr stützte als auf die GedankenPolizei. Mit seinen fünfunddreißig Jahren war er gerade erst höchst widerwillig aus der Jugend-Liga ausgeschieden, obwohl er es zuvor geschafft hatte, ein Jahr länger als vorgesehen bei den Spähern zu bleiben, ehe er zur Jugend-Liga wechseln musste. Im Ministerium war er an einer untergeordneten Stelle beschäftigt, wo Intelligenz nicht erforderlich war, aber er war eine führende Persönlichkeit im Sportkomitee und allen anderen Instanzen, die GemeinschaftsWanderungen, spontane Demonstrationen, Rationalisierungskampagnen und sonstige freiwillige Aktivitäten organisierten. Wenn er gerade mal nicht an seiner Pfeife nuckelte, teilte er dir voller Stolz mit, dass er in den vergangenen vier Jahren jeden Abend im GemeinschaftsZentrum gewesen sei. Ein überwältigender Schweißgeruch bezeugte, was er für ein anstrengendes Leben führte, folgte ihm überallhin und blieb auch noch in der Luft hängen, wenn er schon wieder weg war.
»Haben Sie eine Rohrzange?«, fragte Winston, während er an der Überwurfmutter herumfummelte, die das Verbindungsstück sicherte.
»Eine Rohrzange«, sagte Mrs Parsons und verwandelte sich augenblicklich in eine Qualle. »Ich weiß nicht, glaube ich. Vielleicht die Kinder –«
Man hörte das Trappeln von Füßen und einen letzten Versuch mit dem Kamm, dann rannten die Kinder ins Wohnzimmer. Mrs Parsons brachte die Rohrzange. Winston ließ das Wasser ablaufen und zog angewidert den Klumpen von langen Haaren heraus, der den Abfluss verstopft hatte. Er wusch sich so gut wie möglich die Finger unter dem kalten Wasser und ging dann ins andere Zimmer.
»Hände hoch!«, schrie eine schrille Stimme.
Ein hübscher, robust aussehender Neunjähriger war hinter dem Tisch hervorgesprungen und zielte mit einer Spielzeugpistole auf ihn, seine Schwester, ungefähr zwei Jahre jünger, machte dieselbe Geste mit einem Stück Holz. Beide trugen die Späher-Uniform: kurze blaue Hosen, graue Hemden und rote Halstücher. Winston hob die Hände über den Kopf und fühlte sich dabei sehr unbehaglich. Das Auftreten des Jungen war so aggressiv, dass es durchaus nicht bloß ein Spiel war.
»Du bist ein Verräter!«, kreischte er. »Du bist ein GedankenVerbrecher! Du bist ein Spion aus Eurasien! Ich erschieß dich, ich werd dich vaporisieren, ich schicke dich in die Salzbergwerke!«
Und plötzlich sprangen sie beide um ihn herum und schrien »Verräter!« oder »GedankenVerbrecher!«. Wobei das Mädchen ihren Bruder in jeder Bewegung nachahmte. Es war tatsächlich ein bisschen furchterregend – wie das Toben von Tigerjungen, die bald zu Menschenfressern heranwachsen werden. Im Blick des Jungen lag eine berechnende Bösartigkeit, der offensichtliche Wunsch, Winston zu schlagen oder zu treten, und das Bewusstsein, dass er bald groß genug sein würde, um das tatsächlich zu tun. Nur gut, dass es keine echte Pistole ist, was er da in der Hand hat, dachte Winston.
Mrs Parsons Augen huschten nervös zwischen Winston und den Kindern hin und her. Hier im Wohnzimmer war das Licht besser, und er stellte fasziniert fest, dass sich in den Falten ihres Gesichts tatsächlich Staub abgesetzt hatte.