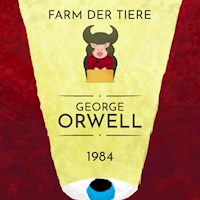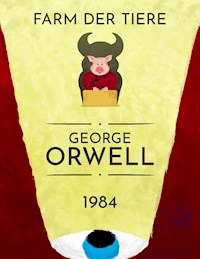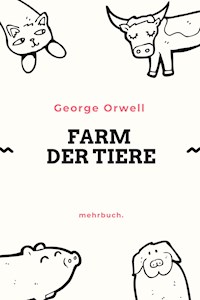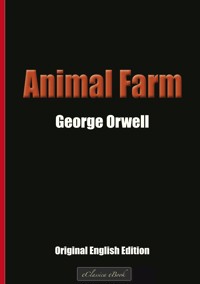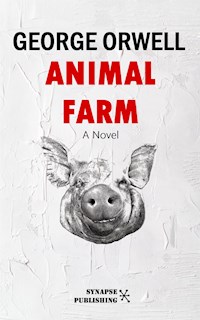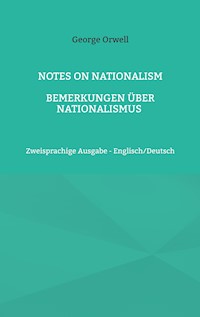Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hierax Medien
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Winston Smith, ein einfaches Mitglied der diktatorischen Staatspartei, arbeitet im Ministerium für Wahrheit, wo er die Vergangenheit im Sinne der Regierung umschreibt. «Der große Bruder» überwacht alle Bürger, jeder Widerstand gegen das System wird streng bestraft. Winston jedoch sehnt sich in seinem Innersten nach echter Wahrheit – und nach Liebe. Trotz aller Verbote beginnt er eine Beziehung mit seiner Kollegin Julia und träumt sogar davon, sich gegen die Partei aufzulehnen. Doch aus dem Überwachungsstaat gibt es kein Entkommen ... Die berühmte Dystopie von George Orwell, neu übersetzt von Karsten Singelmann.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
George Orwell
1984
Über dieses Buch
Winston Smith, ein einfaches Mitglied der diktatorischen Staatspartei, arbeitet im Ministerium für Wahrheit, wo er die Vergangenheit im Sinne der Regierung umschreibt. «Der große Bruder» überwacht alle Bürger, jeder Widerstand gegen das System wird streng bestraft. Winston jedoch sehnt sich in seinem Innersten nach echter Wahrheit – und nach Liebe. Trotz aller Verbote beginnt er eine Beziehung mit seiner Kollegin Julia und träumt sogar davon, sich gegen die Partei aufzulehnen. Doch aus dem Überwachungsstaat gibt es kein Entkommen ...
Die berühmte Dystopie von George Orwell, neu übersetzt von Karsten Singelmann.
Weitere Informationen finden Sie unter www.fischerverlage.de/kinderbuch-jugendbuch
Biografie
George Orwell, 1903 in Indien als Eric Arthur Blair geboren, zählt zu den bedeutendsten Autoren der englischen Literatur. Besonders seine Dystopien «Farm der Tiere» und «1984» verhalfen ihm zu internationalem Ruhm. Er starb 1950 in London
1. TEIL
I
Es war ein kalter, klarer Apriltag, die Uhren schlugen dreizehn. Das Kinn zum Schutz vor dem ekligen Wind an die Brust gedrückt, schlüpfte Winston Smith schnell durch die Glastüren des Wohngebäudes «Victory Mansions», doch nicht schnell genug, um zu verhindern, dass Schwaden von körnigem Staub mit ihm ins Innere fegten.
Im Flur roch es nach gekochtem Kohl und alten Teppichläufern. Ein farbiges Plakat, eigentlich viel zu groß für Innenräume, war mit Reißzwecken an der Wand befestigt. Es zeigte nichts weiter als ein riesiges Gesicht, über einen Meter breit: die kernigen, attraktiven Züge eines Mannes von etwa fünfundvierzig, mit einem mächtigen, schwarzen Schnurrbart. Winston steuerte auf die Treppe zu. Den Fahrstuhl zu nehmen war zwecklos. Selbst in besten Zeiten funktionierte er nur selten, und momentan war tagsüber sowieso der Strom abgestellt. Diese Maßnahme lief unter dem Motto Sparsamkeit, zur Vorbereitung auf die anstehende Hasswoche.
Seine Wohnung lag im siebten Stock, und Winston, der neununddreißig war und ein Krampfadergeschwür über dem rechten Knöchel hatte, nahm sich Zeit für den Aufstieg, gönnte sich zwischendurch mehrere Ruhepausen. Auf jedem Treppenabsatz, an der Wand gegenüber dem Fahrstuhlschacht, blickte ihm das Plakat mit dem riesigen Gesicht entgegen. Es war eine von diesen Abbildungen, deren Augen einem überallhin zu folgen scheinen. BIG BROTHER IS WATCHING YOU verkündete die Bildunterschrift.
Im Innern seiner Wohnung verlas eine tiefe, wohltönende Stimme eine Aufstellung von Zahlen, die mit der Produktion von Roheisen zu tun hatten. Die Stimme kam aus einer länglichen Metallplatte, ähnlich einem stumpfen Spiegel, die einen Teil der rechten Seitenwand einnahm. Winston drehte an einem Schalter, worauf die Stimme etwas leiser wurde, jedoch weiterhin zu verstehen war. Die Lautstärke ließ sich zwar regeln, aber man konnte das Gerät (das als «Teleschirm» bezeichnet wurde) nicht abschalten.
Winston trat ans Fenster: eine kleine, schmächtige Gestalt, deren Zartheit von dem blauen Overall – der Parteiuniform – noch betont wurde. Er hatte hellblonde Haare und ein von Natur aus rötliches Gesicht, seine Haut war aufgeraut von grober Seife, stumpfen Rasierklingen und der Kälte des eben erst zu Ende gegangenen Winters.
Die Welt draußen wirkte frostig, selbst durch die geschlossene Fensterscheibe. Staub und Papierfetzen, vom Wind aufgewirbelt, tanzten im Kreis, und obwohl die Sonne hoch am grellblauen Himmel stand, wirkten alle Dinge farblos, mit Ausnahme der überall angeklebten Plakate. Wohin man auch blickte, starrte einem das Gesicht mit dem schwarzen Schnurrbart an. Eins der Plakate hing an der Hauswand direkt gegenüber. BIG BROTHER IS WATCHING YOU erklärte die Aufschrift, während der Blick aus den dunklen Augen Winston zu durchbohren schien. Unten auf Straßenhöhe flatterte die eingerissene Ecke eines weiteren Plakats im Wind hin und her, dahinter blitzte immer wieder das Wort ENGSOZ hervor. In der Ferne tauchte ein Hubschrauber zwischen die Dächer hinab, schwebte wie eine Schmeißfliege für einen Moment auf der Stelle und schoss dann in einem weiten Bogen wieder davon. Das war die Polizeipatrouille, die den Leuten in die Fenster spähte. Diese Patrouillen spielten aber kaum eine Rolle, sie zählten nicht. Was zählte, war allein die Gedankenpolizei.
Hinter Winstons Rücken ließ die Stimme aus dem Bildschirm sich weiter über Roheisen und die Übererfüllung des Neunten Drei-Jahres-Plans aus. Der Bildschirm war Sender und Empfänger zugleich. Er fing jedes Geräusch auf, das über ein leises Flüstern hinausging, und solange Winston sich innerhalb des von der Metalltafel kontrollierten Sichtfelds aufhielt, konnte er nicht nur gehört, sondern auch gesehen werden. Natürlich wusste man nie, ob man zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich beobachtet wurde. Wie oft oder nach welchem System die Gedankenpolizei sich in einzelne Leitungen einklinkte, ließ sich nur vermuten. Aber es war durchaus vorstellbar, dass sie jede und jeden zu jeder Zeit überwachten. Auf jeden Fall konnten sie sich einklinken, wann immer sie wollten. Man musste damit rechnen – und tat es instinktiv, schon aus reiner Gewohnheit –, dass jeder Laut, den man von sich gab, abgehört und jede Bewegung beobachtet wurde, außer bei Dunkelheit.
Winston wandte dem Bildschirm weiter den Rücken zu. Das war sicherer, auch wenn ihm klar war, dass selbst ein Rücken allerhand preisgeben konnte. Einen Kilometer entfernt ragte das Ministerium für Wahrheit, sein Arbeitsplatz, weiß und wuchtig aus der verrußten Landschaft hervor. Das hier, dachte er leicht angewidert – das war London, Hauptstadt von Landefeld Eins, der Provinz mit der drittgrößten Bevölkerungszahl in Ozeanien. Er versuchte sich in seine Kindheit zurückzuversetzen, sich zu erinnern, ob London immer schon so ausgesehen hatte. Hatte man immer schon auf diese verfallenden Häuser aus dem neunzehnten Jahrhundert geblickt, deren Seitenwände notdürftig mit Holzbalken gestützt, deren Fenster mit Pappe und deren Dächer mit Wellblech geflickt waren, während die baufälligen Gartenmauern nach allen Seiten wegbröckelten? Und was war mit den Trümmergrundstücken, wo der Mörtelstaub in der Luft waberte und Weidenröschen auf dem Geröll wucherten, oder mit all den Stellen, wo die Bomben größere Flächen freigelegt hatten und wo sofort ganze Kolonien aus schäbigen, hühnerstallähnlichen Holzhütten aus dem Boden geschossen waren? Doch sosehr er sich auch bemühte, er konnte sich nicht erinnern: Von seiner Kindheit war ihm nichts geblieben als eine Reihe von zusammenhanglosen Bildern, die hin und wieder aufblitzten, ohne einen rechten Sinn zu ergeben.
Das Ministerium für Wahrheit – Miniwahr auf Neusprech[*] – unterschied sich verblüffend von allem anderen, was weit und breit zu sehen war. Es war ein gewaltiger, pyramidenförmiger Bau aus glitzerweißem Beton, der sich Absatz für Absatz bis in dreihundert Meter Höhe auftürmte. Von Winstons Standort aus konnte man eben noch die drei Parolen der Partei lesen, die in eleganten Schriftzügen auf der weißen Fassade prangten:
KRIEG IST FRIEDEN
FREIHEIT IST SKLAVEREI
UNWISSEN IST STÄRKE
Das Ministerium für Wahrheit umfasste, so hieß es, dreitausend oberirdische Räume sowie die entsprechenden, ähnlich verzweigten Untergeschosse. Übers Londoner Stadtgebiet verstreut gab es lediglich drei weitere Gebäude von ähnlicher Größe und Erscheinung. So sehr überragten sie alle umgebenden Bauten, dass man vom Dach der Victory Mansions alle vier gleichzeitig sehen konnte. Sie waren Sitz der vier Ministerien, auf die sich der gesamte Regierungsapparat aufteilte: Es gab das Ministerium für Wahrheit, das sich mit Nachrichten, Unterhaltung, Bildung und den schönen Künsten befasste; das Ministerium für Frieden, das sich um den Krieg kümmerte; das Ministerium für Liebe, das Recht und Ordnung aufrechterhielt. Und das Ministerium für Überfluss, das für die Wirtschaft zuständig war. Auf Neusprech lauteten die Namen: Miniwahr, Minipax, Minilieb und Miniflu.
Vielleicht am furchterregendsten war das Ministerium für Liebe. Dort gab es keinerlei Fenster. Winston hatte dieses Liebesministerium noch nie betreten, war ihm nie näher gekommen als einen halben Kilometer. Es war unmöglich, hineinzukommen, es sei denn, in amtlichen Angelegenheiten, und dann auch nur, indem man sich durch ein Labyrinth von Stacheldraht, Stahltüren und versteckten Maschinengewehrnestern kämpfte. Selbst in den Straßen, die zu den äußeren Sperranlagen führten, gingen gorillagesichtige Wachleute in schwarzer Uniform Streife, bewaffnet mit Gelenkschlagstöcken.
Mit einem Ruck drehte Winston sich um. Er hatte einen Ausdruck ruhiger Zuversicht aufgesetzt, der angeraten war, sobald man dem Teleschirm sein Gesicht zeigte. Er ging quer durchs Zimmer in die winzige Küche. Weil er das Ministerium zu dieser frühen Stunde verlassen hatte, musste er auf sein Mittagessen in der Kantine verzichten, und ihm war bewusst, dass in der Küche nichts Essbares aufzutreiben war außer einem Stück dunklem Brot, das aber fürs morgige Frühstück aufgespart werden musste. Vom Regalbrett hob er eine Flasche, auf der ein schlichtes weißes Etikett mit der Aufschrift VICTORY GIN klebte. Die farblose Flüssigkeit verströmte einen abgestandenen, öligen Geruch, wie chinesischer Reisschnaps. Winston goss sich fast eine Teetasse voll ein, bereitete sich seelisch auf den Schock vor und stürzte alles mit einem Schluck hinunter, als wäre es bittere Medizin.
Sofort wurde sein Gesicht puterrot, und das Wasser lief ihm aus den Augen. Das Zeug schmeckte nicht nur wie Salpetersäure, man hatte beim Schlucken auch das Gefühl, man bekäme mit dem Gummiknüppel eins über den Hinterkopf gezogen. Doch schon im nächsten Moment ließ das Brennen im Bauch nach, und gleich sah die Welt ein bisschen fröhlicher aus. Er zog eine Zigarette aus einer zerknüllten Packung mit der Aufschrift VICTORY ZIGARETTEN und hielt sie unvorsichtigerweise senkrecht, worauf der Tabak auf den Boden rieselte. Mit der nächsten hatte er mehr Erfolg. Er ging ins Wohnzimmer zurück und setzte sich an einen kleinen Tisch links vom Teleschirm. Aus der Tischschublade holte er einen Federhalter, ein Tintenfass und ein dickes Notizbuch im Quartformat mit rotem Rücken und marmoriertem Einband.
Aus irgendeinem Grund war der Teleschirm im Wohnzimmer an einer ungewöhnlichen Stelle installiert. Nicht, wie üblich, an der Stirnseite, wo er den ganzen Raum überblicken konnte, sondern an der Längsseite, gegenüber dem Fenster. Seitlich davon befand sich eine flache Nische, in der Winston jetzt saß und die wohl ursprünglich, beim Bau des Hauses, Platz für ein Bücherregal hatte bieten sollen. Wenn er sich ganz in die Nische schmiegte, konnte Winston sich dem Sichtfeld des Teleschirms entziehen. Gehört werden konnte er natürlich trotzdem, aber solange er in seiner Stellung verharrte, wurde er nicht gesehen. Zum Teil war es die ungewöhnliche Anlage des Zimmers gewesen, die ihn auf die Idee gebracht hatte, das zu tun, was er jetzt vorhatte.
Diese Idee hing aber auch mit dem Buch zusammen, das er soeben aus der Schublade gezogen hatte. Es war ein besonders schönes Buch. Das glatte, sämige Papier, altersbedingt ein wenig vergilbt, war von einer Qualität, wie sie seit mindestens vierzig Jahren nicht mehr hergestellt wurde. So wie er die Sache einschätzte, war dieses Buch aber noch viel älter. Er hatte es in der Auslage eines muffigen kleinen Trödelladens in einem der Elendsviertel der Stadt gesehen (welches Viertel genau das war, wusste er nicht mehr) und war sofort von dem überwältigenden Verlangen gepackt worden, es zu besitzen. Als Parteimitglied durfte man eigentlich kein gewöhnliches Geschäft betreten («auf dem freien Markt verkehren», sagte man dafür), aber diese Vorschrift wurde nicht mit letzter Konsequenz durchgesetzt, weil es verschiedene Dinge gab, Schnürsenkel oder Rasierklingen zum Beispiel, die auf anderem Wege nicht zu bekommen waren. Er hatte sich also kurz umgeblickt und war dann rasch in den Laden geschlüpft, um sich das Buch für zwei Dollar fünfzig zu kaufen. Welchen Zweck er damit verfolgte, hätte er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht sagen können. Mit schlechtem Gewissen hatte er das Buch in seiner Aktentasche nach Hause getragen. Auch wenn überhaupt nichts darin geschrieben stand, war es ein Besitz, der ihn in Schwierigkeiten bringen konnte.
Jetzt hatte er den Vorsatz gefasst, ein Tagebuch anzulegen. Das war zwar nicht illegal (da es keine Gesetze mehr gab, konnte auch nichts mehr illegal sein), aber wenn so etwas herauskam, wurde es ziemlich wahrscheinlich mit dem Tod oder zumindest mit fünfundzwanzig Jahren Arbeitslager bestraft. Winston steckte eine Feder in den Federhalter und saugte daran, um die Schmiere zu entfernen. Es war ein altertümliches Schreibgerät, kaum je benutzt, allenfalls für die eine oder andere Unterschrift, und er hatte es sich heimlich und nicht ohne Schwierigkeiten besorgt, einfach aus dem Gefühl heraus, dass dieses wunderbar sämige Papier es verdient hatte, mit einer echten Feder beschrieben zu werden anstatt mit einem kratzigen Tintenstift. Eigentlich hatte er überhaupt keine Übung darin, mit der Hand zu schreiben. Von ganz kurzen Notizen abgesehen, war es üblich, alles in den Sprechschreiber zu diktieren, aber das kam für sein jetziges Projekt natürlich nicht in Frage. Nachdem er die Feder in die Tinte getaucht hatte, zauderte er für einen Moment. Ein Grummeln war ihm durch die Eingeweide gefahren. War die Tinte erst einmal auf dem Papier, gab es kein Zurück mehr. Mit kleiner, ungelenker Schrift schrieb er:
4. April 1984
Er sank gegen die Rückenlehne des Stuhls. Ein lähmendes Gefühl der Hilflosigkeit hatte ihn gepackt. Die Probleme fingen schon damit an, dass er nicht mit Sicherheit sagen konnte, ob dies tatsächlich das Jahr 1984 war. So ungefähr musste es aber stimmen, denn er selbst, da war er sich einigermaßen sicher, war neununddreißig Jahre alt und seines Wissens 1944 oder 45 geboren worden; allerdings war es heutzutage schlicht unmöglich, egal welches Datum auf ein oder zwei Jahre genau zu bestimmen.
Für wen, diese Frage fiel ihm plötzlich ein, schrieb er dieses Tagebuch eigentlich? Für die Zukunft, für die Nachgeborenen. Er war noch dabei, dem zweifelhaften Datum oben auf der Seite nachzusinnen, da stolperten seine Gedanken plötzlich über das Neusprechwort Doppeldenk. Erst jetzt ging ihm auf, wie gewaltig das war, was er sich vorgenommen hatte. Wie konnte man denn mit der Zukunft kommunizieren? Das war doch schon logisch gar nicht denkbar. Entweder war die Zukunft der Gegenwart ähnlich, dann würde sie ihm nicht zuhören – oder sie unterschied sich völlig von dieser, dann hätte seine heutige missliche Lage keine Bedeutung für sie.
Eine Weile lang starrte er nur dumpf auf das Papier. Der Teleschirm sendete mittlerweile zackige Militärmusik. Schon merkwürdig, dass er nicht nur die Fähigkeit, sich auszudrücken, verloren zu haben schien, sondern offenbar sogar vergessen hatte, was er eigentlich sagen wollte. Seit Wochen hatte er sich auf diesen Moment vorbereitet, und nie war es ihm in den Sinn gekommen, dass dafür etwas anderes nötig wäre als Mut. Das Schreiben an sich, hatte er gedacht, würde ganz leicht gehen. Er müsste nichts weiter tun, als das zu Papier zu bringen, was ihm ohnehin, buchstäblich seit Jahren, wieder und immer wieder durch den Kopf ging. Doch jetzt, gerade wo es darauf ankam, war selbst dieser innere Redefluss versiegt. Obendrein hatte sein Geschwür am Unterschenkel unerträglich zu jucken begonnen. Er traute sich nicht zu kratzen, denn immer wenn er das tat, entzündete es sich. Die Sekunden vergingen. Er konnte nichts anderes wahrnehmen als die leere Seite vor seinen Augen, das Jucken über dem Knöchel, die plärrende Musik und die leichte, vom Gin verursachte Benommenheit.
Plötzlich aber, von nackter Panik gepackt, schrieb er einfach drauflos, ohne große Überlegung. Seine kleine, aber kindliche Schrift ergoss sich kreuz und quer über die Seite, und dabei mussten zuerst die Großbuchstaben dran glauben, dann die Kommas und schließlich sogar die Satzzeichen:
4. April, 1984. Gestern Abend im Kino. Nur Kriegsfilme. Ein sehr guter dabei, handelte von einem Schiff voller Flüchtlinge, das irgendwo im Mittelmeer bombardiert wurde. Publikum amüsierte sich prächtig, als ein großer, fetter Mann gezeigt wurde, der wegzuschwimmen versuchte, verfolgt von einem Hubschrauber. erst sah man, wie er sich im wasser wälzte wie eine schildkröte, dann sah man ihn durchs visier des hubschraubers, dann war sein ganzer körper durchlöchert und das meer um ihn herum färbte sich rosa und er versank so schnell als wäre das wasser in die löcher geströmt. publikum brüllte vor lachen, als er unterging. dann sah man ein rettungsboot voller kinder, über dem ein hubschrauber schwebte. eine frau mittleren alters vielleicht jüdin saß im bug, in ihren armen ein kleiner junge von ungefähr drei jahren. der kleine junge schrie vor Angst und verbarg seinen kopf zwischen ihren brüsten als wollte er in sie hineinkriechen und die frau schlang die arme um ihn und tröstete ihn obwohl sie selbst vor Angst schlotterte und die ganze zeit schirmte sie ihn ab so gut es ging und als würde sie glauben dass ihre arme ihn vor den kugeln schützen könnten. dann warf der hubschrauber eine 20-kilo-bombe genau auf sie drauf mit riesenexplosion und das boot wurde zu kleinholz. dann gab es eine wunderbare einstellung von einem kinderarm der steil in die luft flog da muss ein hubschrauber mit kamera in der kanzel gleich hintendran gewesen sein und aus den logen kam jede menge beifall aber unten im saal bei den prolls schlug eine frau plötzlich krawall und rief so was hätte man nich zeigen dürfen nicht wenn kinder dabei sind das gehört sich nich vor kindern bis die polizei kam und sie rausschaffte ich glaub nich dass ihr groß was passiert ist kein mensch interessiert sich für was die prolls sagen typische prollreaktion nie können die –
Winston brach ab, unter anderem, weil er einen Krampf in der Hand bekam. Es war ihm unbegreiflich, wie er einen solchen Schwall von Blödsinn hatte produzieren können. Seltsam genug aber, dass währenddessen eine ganz andere Erinnerung in ihm wachgeworden war, so klar und deutlich, dass er sich beinahe imstande fühlte, sie aufzuschreiben. Dieser andere Vorfall, wurde ihm jetzt bewusst, war der Grund gewesen, warum er plötzlich beschlossen hatte, nach Hause zu gehen und heute mit dem Tagebuch anzufangen.
Ereignet hatte es sich am Morgen im Ministerium, falls man bei einer so ungreifbaren Sache überhaupt von einem Ereignis sprechen kann.
Es war kurz vor elf Uhr, und in der Abteilung Dokumentation, wo Winston arbeitete, wurden alle Schreibtischstühle in die Mitte des Großraumbüros getragen und vor dem großen Telebildschirm aufgestellt, für den Zwei-Minuten-Hass. Winston nahm gerade seinen Platz in einer der mittleren Reihen ein, als zwei Personen, die er vom Sehen kannte, mit denen er aber noch nie ein Wort gewechselt hatte, unerwartet den Raum betraten. Die eine war eine junge Frau, die ihm oft in den Fluren begegnete. Ihren Namen kannte er nicht, wusste aber, dass sie in der Abteilung Literatur arbeitete. Anscheinend – er hatte sie mehrmals mit einem Schraubenschlüssel und ölverschmierten Händen gesehen – war sie eine Art Technikerin, die die Romanmaschinen wartete. Die Frau, er schätzte sie auf ungefähr siebenundzwanzig, machte einen ziemlich kessen Eindruck, hatte üppige schwarze Haare, Sommersprossen im Gesicht und eine forsche, athletische Art, sich zu bewegen. Eine schmale scharlachrote Schärpe, das Abzeichen der Junioren-Anti-Sex-Liga, war mehrfach um die Taille ihres Overalls gewickelt, gerade eng genug, dass ihre wohlgeformten Hüften gut zur Geltung kamen. Sie war Winston sofort unsympathisch gewesen, schon als er sie das erste Mal gesehen hatte. Er wusste auch, warum. Es war ihre ganze Ausstrahlung, die ihn an Hockeyplätze, an kalte Bäder, an Wandertage und an eine rundum tadellose Gesinnung denken ließ. Ihm waren fast alle Frauen unsympathisch, vor allem die jungen und hübschen. Immer waren es die Frauen, und zuallererst die jungen, die sich als die engstirnigsten Parteianhänger erwiesen, die alle Slogans und Parolen schluckten, sich als Amateurspitzel betätigten und fleißig Gesinnungsschnüffelei betrieben. Aber speziell diese Frau wirkte auf ihn noch gefährlicher als die meisten anderen. Einmal, als er im Flur an ihr vorbeigegangen war, hatte sie ihn von der Seite angesehen, mit einem bohrenden Blick, der ihm durch und durch gegangen war. Im ersten Moment der Panik hatte er befürchtet, sie könnte eine Agentin der Gedankenpolizei sein. Das aber war, zugegebenermaßen, eher unwahrscheinlich. Trotzdem verspürte er weiterhin ein eigenartiges Unbehagen, gemischt mit Furcht und auch Feindseligkeit, sobald sie nur in seine Nähe kam.
Die andere Person war ein Mann namens O’Brien, Mitglied der Inneren Partei, in der er eine so hohe und bedeutende Funktion ausübte, dass Winston allenfalls ahnen konnte, worin genau sie bestand. Für einen Moment breitete sich Stille rund um die Stuhlreihen aus, als die Mitarbeiter den schwarzen Overall näherkommen sahen, der Angehörigen der Inneren Partei vorbehalten war. O’Brien war ein großer, bulliger Mann mit Stiernacken und derben Gesichtszügen, die Humor, aber auch Brutalität verrieten. Trotz seiner Respekt einflößenden Erscheinung konnte er einen gewissen Charme an den Tag legen. Sein Trick bestand darin, die Brille auf seiner Nase zurechtzurücken, was eigenartig entwaffnend wirkte – ja, irgendwie geradezu kultiviert. Es war eine Geste, die an einen englischen Adligen des achtzehnten Jahrhunderts hätte erinnern können, der seine Schnupftabakdose zückt und eine Prise daraus anbietet – wenn denn die Erinnerung an solche Figuren noch lebendig gewesen wäre. Winston hatte O’Brien bisher vielleicht ein Dutzend Mal zu Gesicht bekommen, in fast ebenso vielen Jahren. Er fühlte sich stark von ihm angezogen, und nicht nur, weil ihn der Kontrast zwischen O’Briens weltmännischer Art und seiner Boxerstatur faszinierte. Sondern vielmehr, weil er insgeheim glaubte – oder vielleicht nicht einmal glaubte, sondern lediglich hoffte –, dass O’Brien nicht hundertprozentig linientreu war. Irgendetwas in seinem Gesicht schien es unmissverständlich anzudeuten. Aber vielleicht war es auch gar nicht unbedingt Abweichlertum, was darin geschrieben stand, sondern einfach nur Intelligenz. Auf jeden Fall aber machte er den Eindruck eines Menschen, mit dem man reden konnte, falls es einem gelang, den Teleschirm zu überlisten und ihn unter vier Augen zu erwischen. Winston hatte nie auch nur den leisesten Versuch unternommen, sich diese Vermutung bestätigen zu lassen, und es gab auch schlicht und einfach keine Möglichkeit dazu.
In diesem Moment warf O’Brien einen Blick auf seine Armbanduhr, stellte fest, dass es schon fast elf Uhr war, und beschloss offenbar, in der Abteilung Dokumentation zu bleiben, bis der Zwei-Minuten-Hass vorüber war. Er nahm in derselben Reihe wie Winston Platz, nur zwei Stühle weiter. Eine kleine, rotblonde Frau, die in Winstons Nachbarkabine arbeitete, saß zwischen ihnen, die junge Frau mit den dunklen Haaren direkt dahinter.
Plötzlich ertönte aus dem großen Teleschirm am Ende des Raumes ein grässliches, durchdringendes Kreischen, wie von einer riesigen Maschine, der das Öl ausgegangen war. Es war ein Geräusch, das einem durch Mark und Bein ging. Der Hass hatte begonnen.
Wie üblich erschien als Erstes das Gesicht von Emmanuel Goldstein, dem Feind des Volkes, auf dem Bildschirm. Einige Zuschauer begannen zu zischen. Die kleine rotblonde Frau stieß einen Schrei aus, in dem sich Furcht und Abscheu mischten. Goldstein war der Renegat, der Abtrünnige, der einst, vor langer Zeit (wie lange genau es her war, wusste keiner mehr so genau), eine der führenden Figuren der Partei gewesen war, fast auf einer Ebene mit dem Großen Bruder selbst; dann aber hatte er sich an konterrevolutionären Umtrieben beteiligt, war zum Tode verurteilt worden, anschließend unter mysteriösen Umständen entkommen und seither verschwunden. Das Programm des Zwei-Minuten-Hasses variierte von Tag zu Tag, aber das beherrschende Thema war immer Goldstein. Er war der große Verräter, der Erste, der die Reinheit der Partei geschändet hatte. Sämtliche späteren Verbrechen gegen die Partei, jeder Verrat, alle Ketzereiein und Verirrungen, gingen direkt aus seiner Lehre hervor. Er war noch immer am Leben und heckte weitere Verschwörungen aus, an einem geheimen Ort, vielleicht irgendwo am Meeresboden, unter dem Schutz seiner ausländischen Geldgeber, oder vielleicht sogar – so ging mitunter das Gerücht – in einem Versteck in Ozeanien selbst.
Winstons Zwerchfell zog sich zusammen. Er konnte Goldsteins Gesicht nicht ansehen, ohne dass ihn schmerzlich gemischte Gefühle überkamen. Es war ein hageres jüdisches Gesicht, umgeben von einem großen, krausen, weißen Haarkranz und einem Ziegenbärtchen – ein kluges Gesicht und dennoch irgendwie grundsätzlich verabscheuungswürdig, zumal die lange, dünne Nase, auf deren Spitze eine Brille festgeklemmt war, eine gewisse Vertrotteltheit des Alters verriet. Die Ähnlichkeit mit einem Schafsgesicht war unverkennbar, und auch die Stimme hatte etwas Blökendes. Goldstein ließ gerade eine seiner üblichen giftspritzenden Tiraden gegen die Glaubensgrundsätze der Partei vom Stapel – Angriffe, die so übertrieben und verdreht waren, dass selbst ein kleines Kind sie durchschauen musste, und trotzdem gerade noch einleuchtend genug, dass man Grund zur Befürchtung hatte, andere, weniger besonnene Zuhörer als man selbst könnten darauf hereinfallen. Er beschimpfte den Großen Bruder, er prangerte die diktatorische Alleinherrschaft der Partei an, er forderte ein sofortiges Friedensabkommen mit Eurasien, er setzte sich für Redefreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit und Gedankenfreiheit ein, er rief mit hysterischer Stimme, die Revolution sei verraten worden – und das alles in einer hektisch ratternden Redeweise mit vielen mehrsilbigen Ausdrücken, eine Art Parodie des typischen Parteirednerstils, in der sogar Neusprech-Wörter vorkamen – mehr Neusprech-Wörter genau genommen, als selbst Parteimitglieder im täglichen Leben jemals verwenden würden. Und nur für den Fall, dass noch irgendwer im Zweifel darüber war, was denn wirklich hinter Goldsteins hohlem Geschwafel steckte, marschierten die ganze Zeit auf dem Teleschirm hinter seinem Kopf die endlosen Kolonnen der eurasischen Armee – in geschlossener Reihe schoben sich zackige Männer mit ausdruckslosen asiatischen Gesichtern in den Vordergrund des Bildschirms und verschwanden wieder, um der nächsten, völlig gleichartigen Reihe Platz zu machen. Das dumpfe rhythmische Stampfen der Soldatenstiefel bildete den akustischen Hintergrund zu Goldsteins meckernder Stimme.
Die Hass-Zusammenkunft war noch keine halbe Minute alt, da brach etwa die Hälfte der Anwesenden in ein unbändiges Wutgeschrei aus. Das selbstgefällige Schafsgesicht auf dem Bildschirm und die furchteinflößende Gewalt der eurasischen Armee dahinter, das war einfach zu viel, das war nicht zu ertragen. Hinzu kam, dass der bloße Anblick Goldsteins oder auch nur der Gedanke an ihn automatisch Angst und Wut erzeugte. Als dauerhaftes Hassobjekt eignete er sich sogar besser als Eurasien und Ostasien, denn immer wenn Ozeanien sich im Krieg mit einer dieser beiden Mächte befand, herrschte im Allgemeinen Frieden mit der anderen. Doch obwohl Goldstein von allen gehasst und verachtet wurde, obwohl seine Theorien auf Rednertribünen, auf dem Teleschirm, in der Zeitung und in Büchern jeden Tag, und jeden Tag wohl tausendmal, widerlegt, in der Luft zerrissen, lächerlich gemacht und der Öffentlichkeit als der erbärmliche Gedankenmüll vorgeführt wurden, der sie waren – trotz alledem schien sein Einfluss merkwürdigerweise nie abzunehmen. Immer wieder gab es irgendwelche Tölpel, die sich von ihm verführen ließen. Kein Tag verging, an dem nicht Spione und Saboteure, die nach seinen Weisungen handelten, von der Gedankenpolizei entlarvt wurden. Er war der Befehlshaber einer riesigen Schattenarmee, eines Untergrundnetzwerks von Verschwörern, die sich den Umsturz des Staates auf die Fahnen geschrieben hatten. Die Bruderschaft, so nannten sich diese Verschwörer offenbar. Hinter vorgehaltener Hand erzählte man sich außerdem von einem schrecklichen Buch, einer Sammlung aller ketzerischen Lehren, von Goldstein selbst verfasst und in gewissen Kreisen heimlich herumgereicht. Es war ein Werk ohne Titel. Wer überhaupt darüber sprach, bezeichnete es einfach als das Buch. Aber von solchen Dingen erfuhr man nur gerüchteweise, man wusste nichts Genaues. Die Bruderschaft und das Buch waren Themen, die ein gewöhnliches Parteimitglied nicht zur Sprache brachte, wenn es sich irgendwie vermeiden ließ.
Ab der zweiten Minute geriet der Hass außer Kontrolle. Etliche Teilnehmer sprangen von ihren Sitzen auf und schrien aus Leibeskräften, um die aus dem Teleschirm blökende Stimme zu übertönen, die sie schier zum Wahnsinn trieb. Das Gesicht der kleinen Rotblonden hatte sich knallrot verfärbt, und ihr Mund schnappte auf und zu wie bei einem an Land gespülten Fisch. Selbst O’Briens massiges Gesicht war gerötet. Er saß kerzengerade auf seinem Stuhl, die breite, schweratmende Brust vorgestreckt, als wollte er sich einer anbrandenden Welle entgegenstemmen. Die Dunkelhaarige hinter Winston rief mehrmals «Schwein! Schwein! Du Schwein!», und plötzlich griff sie sich ein schweres Neusprech-Wörterbuch und schleuderte es gegen den Teleschirm. Es traf Goldsteins Nase und fiel zu Boden, die Stimme aber quäkte ungerührt weiter. In einem Moment der Klarheit wurde Winston bewusst, dass auch er in das Geschrei mit eingestimmt hatte und wie wild auf die Querverstrebung seines Stuhles eintrat. Das Schreckliche an dem Zwei-Minuten-Hass war weniger der äußere Zwang, daran mitzuwirken, sondern vor allem die Tatsache, dass man sich ihm auch innerlich unmöglich entziehen konnte. Es brauchte nur dreißig Sekunden, und schon war jedes So-tun-als-ob unnötig geworden. Ein abscheulicher, aus Furcht und Rachsucht gemischter Rausch, der Wunsch zu töten, zu foltern, Gesichter mit dem Vorschlaghammer zu zertrümmern, schien wie ein Stromschlag in die ganze Zuschauergruppe zu fahren und jeden Einzelnen, auch gegen seinen Willen, in einen grimassierenden, grölenden Irren zu verwandeln. Und doch war die Wut, die man empfand, ein ganz abstraktes, diffuses Gefühl, das sich, wie die Flamme einer Lötlampe, mal auf dieses, mal auf jenes Objekt richten ließ. Und so kam es vor, dass der Hass, der Winston ergriff, gar nicht Goldstein galt, sondern im Gegenteil dem Großen Bruder, der Partei und der Gedankenpolizei. Und in solchen Momenten hatte er Mitleid mit dem einsamen, verhöhnten Ketzer auf dem Bildschirm, dem einzigen Bewahrer von Wahrheit und Vernunft in einer Welt der Lügen. Doch schon im nächsten Augenblick war er dann wieder eins mit den Menschen um ihn herum und davon überzeugt, dass alles die reine Wahrheit war, was über Goldstein gesagt wurde. Das waren die Momente, in denen sein geheimer Abscheu vor dem Großen Bruder in Verehrung umschlug – in denen der Große Bruder ihm in seiner ganzen Größe vor Augen erschien, als Fels in der Brandung, als unbesiegbarer, furchtloser Beschützer vor den Horden Asiens, während Goldstein, trotz seiner Isolation, seiner Hilflosigkeit und der Zweifel, die seine Existenz an sich umgaben, als ein teuflischer Hexenmeister dastand, der durch die schiere Macht seiner Stimme die Grundfesten der Zivilisation einreißen konnte.
Manchmal war es sogar möglich, seinen Hass vorsätzlich umzudirigieren. Mit einer heftigen Anstrengung, vergleichbar dem Ruck, mit dem man sich aus einem Albtraum reißt, gelang es Winston plötzlich, seinen Hass vom Bildschirm weg auf die Dunkelhaarige hinter ihm zu übertragen. Lebhafte, sehr reizvolle Fantasiebilder zuckten ihm durch den Kopf: Wie er sie mit einem Gummiknüppel zu Tode prügelte. Wie er sie nackt an einen Pfahl fesselte und dann mit Pfeil und Bogen auf sie schoss, bis sie durchlöchert war wie der heilige Sebastian. Wie er sie vergewaltigte und ihr im Moment des Höhepunktes die Kehle durchschnitt. Mit einem Mal wurde ihm auch vollends klar, warum er sie so sehr hasste. Er hasste sie, weil sie jung und hübsch, aber praktisch geschlechtslos war; weil er gern mit ihr ins Bett gegangen wäre, es aber nie würde tun können; weil um ihre so wunderbar schmiegsame Taille, die wie gemacht dafür schien, seinen Arm um sie zu schlingen, nur die abscheuliche scharlachrote Schärpe hängen durfte, dieses aggressive Symbol der Keuschheit.
Der Große Hass erreichte seinen Höhepunkt. Goldsteins Stimme wurde tatsächlich zum Schafsblöken, und für einen Moment verwandelte auch sein Gesicht sich in das eines Schafes. Dann wurde der Schafskopf überblendet mit der Gestalt eines eurasischen Soldaten, der auf dem Vormarsch zu sein schien, riesig und furchteinflößend, mit knatternder Maschinenpistole, unaufhaltsam, als würde er jeden Augenblick aus dem Bild direkt in den Zuschauerraum springen, sodass einige Leute in der ersten Reihe richtiggehend auf ihren Stühlen zurückzuckten. Doch genau in diesem Moment, begleitet von Stoßseufzern der Erleichterung, zerfloss die bedrohliche Gestalt auf dem Bildschirm, um Platz zu machen für das Gesicht des Großen Bruders mit den schwarzen Haaren und dem schwarzen Schnurrbart, Macht und eine geheimnisvolle Ruhe ausstrahlend und so riesig, dass es fast den ganzen Teleschirm ausfüllte. Niemand konnte verstehen, was der Große Bruder sagte. Es waren nur einige aufmunternde Sätze, wie sie im Schlachtengetümmel gesprochen werden und bei denen es nicht auf den genauen Wortlaut ankommt, sondern einfach nur darauf, Mut zu machen und Vertrauen zu schaffen. Anschließend verblasste das Gesicht des Großen Bruders wieder, und an seiner Stelle erschienen in fettgedruckten Großbuchstaben die drei Parolen der Partei:
KRIEG IST FRIEDEN
FREIHEIT IST SKLAVEREI
UNWISSEN IST STÄRKE
Darunter aber schien für einige Augenblicke noch immer das Gesicht des Großen Bruders durchzuschimmern, als hätte sich sein Bild den Zuschauern so lebhaft eingeprägt, dass es sozusagen noch auf der Netzhaut nachwirkte. Die kleine Rotblonde war aufgesprungen und beugte sich über die Rückenlehne des Stuhls vor ihr. Unter bebendem Gemurmel, aus dem so etwas wie «Mein Erlöser!» herausklang, reckte sie die Arme zum Bildschirm hin. Dann verbarg sie ihr Gesicht in den Händen. Es war offensichtlich, dass sie ein Gebet sprach.
In diesem Moment verfiel die gesamte Gruppe der Anwesenden in einen tiefen, langsamen, rhythmischen Sprechgesang: «G-B! … G-B! … G-B!» – immer und immer wieder, sehr langsam, mit langen Pausen zwischen dem G und dem B – ein dumpfes Murmeln, seltsam wild, unzivilisiert, man glaubte Trommelschläge und das Stampfen nackter Füße im Hintergrund zu hören. Volle dreißig Sekunden mochte es wohl andauern. Oft dienten solche Gesänge dazu, überwältigenden Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Zum Teil war es eine Hymne auf die Weisheit und die Erhabenheit des Großen Bruders, noch mehr aber ein Akt der Selbsthypnose, das willentliche Ausschalten des Bewusstseins mit Hilfe rhythmischer Geräusche. Winston hatte das Gefühl, seine Eingeweide würden gefrieren. Während des Zwei-Minuten-Hasses konnte er nicht anders, als sich dem allgemeinen Wahn anzuschließen, aber dieser kaum menschliche «G-B! … G-B!»-Sprechchor erfüllte ihn regelmäßig mit Entsetzen. Natürlich stimmte auch er mit ein – etwas anderes kam ja gar nicht in Frage. Seine Gefühle zu verbergen, seinen Gesichtsausdruck zu kontrollieren, genau das zu tun, was auch alle anderen taten, das war eine Sache des Instinkts. Und doch gab es einen kurzen Moment, vielleicht nur zwei Sekunden, in denen sein Blick ihn womöglich verraten haben konnte. Und es war genau dieser Moment, in dem das bedeutsame Ereignis stattfand – wenn es denn tatsächlich stattfand.
Für einen Augenblick fing er O’Briens Blick auf. O’Brien war aufgestanden. Er hatte seine Brille abgenommen und setzte sie in seiner typischen Art gerade wieder auf die Nase. Und dabei, für einen Sekundenbruchteil, begegneten sich ihre Blicke, und für die Dauer dieses kurzen Moments war Winston sich sicher – ja, er wusste es genau! –, dass O’Brien das Gleiche dachte wie er selbst. Es war der Austausch einer unmissverständlichen Botschaft. Es war, als hätten beide ihr Innerstes geöffnet, und jetzt flössen die geheimen Gedanken durch die Augen vom einen zum anderen. «Ich bin ganz bei dir», schien O’Brien zu sagen. «Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Ich weiß alles über deine Verachtung, deinen Hass, deinen Ekel. Aber keine Sorge, ich bin auf deiner Seite!» Gleich darauf jedoch war dieses Signal des Einverständnisses wieder erloschen, und O’Briens Ausdruck war so unergründlich wie zuvor.
Das war alles, und schon war Winston sich gar nicht mehr sicher, ob es wirklich passiert war. Nie folgte etwas aus solchen Vorkommnissen. Sie dienten ihm nur dazu, den Glauben oder die Hoffnung am Leben zu erhalten, dass auch andere außer ihm Feinde der Partei waren. Vielleicht waren die Gerüchte über gewaltige Verschwörungen im Untergrund ja doch wahr – vielleicht existierte die Bruderschaft tatsächlich! Man konnte ja, trotz endloser Verhaftungen, Geständnisse und Hinrichtungen, unmöglich sicher sein, dass die Bruderschaft mehr war als ein Mythos. An manchen Tagen glaubte er daran, an anderen nicht. Es gab keinen Beweis, nur flüchtige Anzeichen, die alles Mögliche oder auch gar nichts bedeuten konnten: aufgeschnappte Gesprächsfetzen, verblasste Kritzeleien an den Wänden öffentlicher Toiletten – einmal sogar, bei einer Begegnung mit einem völlig Unbekannten, eine unauffällige Handbewegung, wie zum heimlichen Zeichen des Erkennens. Man blieb aber ganz auf Spekulationen angewiesen: gut möglich, dass er sich das alles nur eingebildet hatte.
Er war zu seiner Kabine zurückgegangen, ohne O’Brien noch einmal anzusehen. Den Gedanken, den kurzen Kontakt weiterzuverfolgen, schlug er sich gleich wieder aus dem Kopf. Das wäre unfassbar riskant gewesen, selbst dann, wenn er eine Vorstellung gehabt hätte, wie man so etwas überhaupt anstellte. Für ein, zwei Sekunden hatten sie einen vieldeutigen Blick gewechselt, das war alles. Doch selbst das war ein denkwürdiges Ereignis in der abgekapselten Einsamkeit, in der er zu leben gezwungen war.
Winston riss sich aus diesen Gedanken und streckte den Rücken durch. Ein Rülpser stieg aus seinem Magen hoch. Der Gin machte sich bemerkbar.
Er wandte sich wieder dem aufgeschlagenen Tagebuch zu. Offenbar hatte er, während er ziellos vor sich hingrübelte, etwas hineingeschrieben, wie automatisch. Und was er da sah, das war nicht mehr die verkrampfte, ungeschickte Handschrift von vorhin. Sein Stift war großzügig über das glatte Papier gefahren und hatte in säuberlichen Großbuchstaben dies gemalt:
NIEDER MIT DEM GROSSEN BRUDER
NIEDER MIT DEM GROSSEN BRUDER
NIEDER MIT DEM GROSSEN BRUDER
NIEDER MIT DEM GROSSEN BRUDER
NIEDER MIT DEM GROSSEN BRUDER
Immer wieder, über eine volle halbe Seite.
Ein Gefühl der Panik fiel ihn an. Was absurd war, denn das Niederschreiben dieser speziellen Worte war auch nicht gefährlicher als die Tatsache, dass er das Tagebuch überhaupt führte. Trotzdem war er kurz versucht, die vollgeschmierten Seiten herauszureißen und das ganze Unternehmen abzublasen.
Doch er entschied sich dagegen, es wäre auch sowieso sinnlos gewesen. Ob er nun NIEDER MIT DEM GROSSEN BRUDER in das Tagebuch schrieb oder ob er es bleiben ließ, das machte schon keinen Unterschied mehr. Und ob er das Tagebuch weiterführte oder nicht, war ebenfalls egal. Die Gedankenpolizei würde ihm so oder so auf die Schliche kommen. Er hatte das größte Verbrechen überhaupt begangen, das Verbrechen, das alle anderen in sich einschloss – und würde es selbst dann begangen haben, wenn er nie einen Stift aufs Papier gesetzt hätte. Gedankenverbrechen, so wurde es genannt. Gedankenverbrechen waren keine Sache, die man ewig geheim halten konnte. Schon möglich, dass es einem gelang, für eine Weile, vielleicht sogar für ein paar Jahre, der Entdeckung zu entgehen, aber irgendwann, früher oder später, kriegten sie einen dran.
Und zwar immer nachts – die Verhaftungen fanden unweigerlich mitten in der Nacht statt. Plötzlich wurde man aus dem Schlaf gerissen, mit grober Hand an der Schulter gepackt, grelle Lichter schienen einem in die Augen, strenge Gesichter bildeten einen Kreis rund ums Bett. In der großen Mehrzahl der Fälle gab es kein Gerichtsverfahren, nicht einmal eine Verhaftungsanzeige. Die Leute verschwanden einfach, und immer in der Nacht. Der eigene Name wurde aus den Büchern und Registern entfernt, jedes Zeugnis darüber, was man in seinem Leben getrieben hatte, wurde vernichtet, die einstige Existenz erst geleugnet, dann vergessen. Man wurde abgeschafft, ausgelöscht: vaporisiert, also verdampft, war der gängige Ausdruck dafür.
Vorübergehend wurde Winston von einem hysterischen Anfall gepackt. Wie besessen kritzelte er drauflos:
sie werden mich erschießen ist mir egal mit Genickschuss mir egal nieder mit dem großen bruder immer töten sie mit genickschuss mir egal nieder mit dem großen bruder –
Ein bisschen beschämt lehnte er sich zurück und legte den Schreibstift aus der Hand. Im nächsten Moment zuckte er heftig zusammen. Es hatte an der Tür geklopft.
So schnell! Er rührte sich nicht, saß reglos wie eine Maus, in der sinnlosen Hoffnung, dass wer immer es war nur diesen einen Versuch machen und dann wieder weggehen würde. Aber nein, das Klopfen wiederholte sich. Das Schlimmste wäre jetzt, das Unvermeidliche hinausschieben zu wollen. Das Herz schlug ihm bis zum Hals, aber sein Gesicht war, aus langjähriger Gewohnheit, wahrscheinlich ausdruckslos. Er stand auf und bewegte sich schwerfällig zur Tür.
II
Winston griff schon zur Türklinke, da bemerkte er, dass er das Tagebuch aufgeschlagen auf dem Tisch hatte liegen lassen. Auf der ganzen Seite prangten die Worte NIEDER MIT DEM GROSSEN BRUDER, die Schrift groß genug, dass man sie beinahe quer durchs ganze Zimmer lesen konnte. Eine unfassbare Dummheit, die ihm da unterlaufen war. Und zwar, das wurde ihm im nächsten Moment klar, weil er bei aller Panik das wunderbar sämige Papier nicht hatte verschmieren wollen, indem er das Buch zuschlug, solange die Tinte noch nass war.
Er holte tief Luft und öffnete die Tür. Sofort überströmte ihn eine warme Welle der Erleichterung. Draußen im Flur stand eine blasse, verhärmt wirkende Frau mit dünnen Haaren und Falten im Gesicht.
«O Genosse», legte sie mit monoton leiernder Stimme los, «dachte ich doch, dass ich dich habe reinkommen hören. Meinst du, du könntest mal rüberkommen und einen Blick auf unsere Küchenspüle werfen? Die ist nämlich verstopft und –»
Es war Mrs. Parsons, die Nachbarsfrau von nebenan. (Der Ausdruck «Mrs.» war vonseiten der Partei eigentlich verpönt – man sollte sich gegenseitig immer mit «Genosse» oder «Genossin» anreden –, aber manche Frauen konnte man sich einfach nur als «Mrs.» vorstellen.) Sie war etwa dreißig, sah aber viel älter aus. Man hatte irgendwie den Eindruck, in den Falten ihres Gesichts hätte sich Staub abgelagert.
Winston folgte ihr durch den Flur. Reparaturen dieser Art fielen ärgerlicherweise fast täglich an, ohne dass man einen Handwerker hätte rufen können. Die Wohnungen in den Victory Mansions waren alt, erbaut um 1930 herum, sie verfielen immer mehr. Ständig rieselte Putz von der Decke und den Wänden, die Rohre platzten bei jedem strengen Frost; sobald Schnee fiel, leckte es durchs Dach, die Heizungsanlage lief meistens nur mit halber Kraft, wenn sie nicht – aus wirtschaftlichen Gründen – ganz abgeschaltet wurde. Reparaturen, die man nicht selbst vornehmen konnte, mussten von Komitees genehmigt werden, die wer weiß wo saßen und selbst die Ausbesserung einer Fensterscheibe gern mal um zwei Jahre verzögerten.
«Ich frage natürlich nur, weil Tom grad nicht zu Hause ist», jammerte Mrs. Parsons.
Die Wohnung der Parsons’ war größer als Winstons und auf andere Weise schäbig. Die ganze Einrichtung machte einen schadhaften, ramponierten Eindruck, als hätte sich ein wildes Tier hier ausgetobt. Sportausrüstung – Hockeyschläger, Boxhandschuhe, ein geplatzter Fußball, eine schweißgetränkte, auf links gekrempelte kurze Hose – lag auf dem Fußboden verstreut, auf dem Tisch stapelten sich schmutziges Geschirr und eselsohrige Schulbücher. An den Wänden hingen scharlachrote Fahnen der Jugendliga und der Kleinen Spione sowie ein Plakat des Großen Bruders in Lebensgröße. Der übliche, fürs ganze Haus typische Geruch nach gekochtem Kohl hing in der Luft; aber in dieser Wohnung mischte er sich mit noch schärferen Ausdünstungen, die – das roch man auf Anhieb, auch wenn man es nicht recht erklären konnte – von einer Person stammten, die im Moment nicht anwesend war. In einem anderen Zimmer versuchte jemand, mit einem Kamm und einem Streifen Toilettenpapier die Militärmusik zu begleiten, die noch immer aus dem Teleschirm schallte.
«Das sind die Kinder», sagte Mrs. Parsons mit einem leicht besorgten Blick zur Tür. «Sie sind heute noch nicht draußen gewesen. Und natürlich –»
Sie hatte die Angewohnheit, Sätze nicht zu Ende zu sprechen. Die Küchenspüle war fast bis zum Rand mit schmierig grünlichem Wasser gefüllt, das besonders übel nach Kohl stank. Winston kniete sich hin, um das Winkelgelenk des Abflussrohres in Augenschein zu nehmen. Er benutzte seine Hände nur ungern, und bücken mochte er sich auch nicht, denn davon musste er meistens husten. Mrs. Parsons stand hilflos daneben.
«Klar, wenn Tom zu Hause wäre, würde er die Sache in null Komma nichts beheben», sagte sie. «Da ist er in seinem Element. Unglaublich geschickt mit seinen Händen, das ist er.»
Tom Parsons war einer von Winstons Kollegen im Wahrheitsministerium, ein dicklicher, aber umtriebiger Mensch von lähmender Beschränktheit, die Verkörperung von hirnloser Begeisterung – einer dieser nie zweifelnden und bedingungslos loyalen Untertanen, die die Stärke der Partei ausmachten, mehr noch als die Gedankenpolizei. Mit seinen fünfunddreißig Jahren war er kürzlich, mehr oder weniger unfreiwillig, von der Jugendliga verabschiedet worden, und schon ehe er dort aufgenommen worden war, hatte er ein Jahr länger bei den Kleinen Spionen bleiben dürfen, als es die Altersvorschriften eigentlich gestatteten. Im Ministerium führte er untergeordnete Tätigkeiten aus, die keinerlei Intelligenz erforderten, dafür aber war er eine führende Figur im Sportausschuss und all den anderen Ausschüssen, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, Wandertage, spontane Demonstrationen, Sparaktionen und sonstige freiwillige Aktivitäten zu organisieren. Mit stillem Stolz, zwischen zwei Zügen aus seiner Pfeife, erzählte er jedem, der es hören wollte, dass er sich die letzten vier Jahre hindurch an jedem einzelnen Abend im Gemeindezentrum habe blickenlassen. Ein durchdringender Schweißgeruch, der sozusagen unbewusst demonstrierte, wie anstrengend sein Leben war, folgte ihm auf Schritt und Tritt und machte sich auch dann noch bemerkbar, wenn er nicht mehr da war.
«Habt ihr einen Schraubenschlüssel?», fragte Winston, während er sich an der Mutter des Winkelgelenks zu schaffen machte.
«Einen Schraubenschlüssel», wiederholte Mrs. Parsons und schien augenblicklich in sich zusammenzusacken. «Ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht die Kinder –»
Schwere Stiefelschritte und weitere Trompetenstöße auf dem Kamm ertönten, offenbar marschierten die Kinder gerade ins Wohnzimmer. Mrs. Parsons brachte den Schraubenschlüssel herbei. Winston ließ das Wasser abfließen und entfernte angewidert den Propf aus Menschenhaaren, der das Rohr verstopft hatte. So gut es ging, wusch er sich die Finger mit dem kalten Leitungswasser, dann ging er ins andere Zimmer zurück.
«Hände hoch!», schrie eine wilde Stimme. Ein hübscher, verwegen dreinblickender Junge von etwa neun Jahren war hinter dem Tisch aufgesprungen und drohte ihm mit einer automatischen Spielzeugpistole, während seine kleine Schwester, etwa zwei Jahre jünger, ihm nacheiferte, indem sie mit einem Stück Holz auf Winston zielte. Beide trugen blaue kurze Hosen, graue Hemden und rote Halstücher, die Uniform der Kleinen Spione. Winston hob die Hände über den Kopf, doch war ihm nicht wohl dabei, denn so rabiat, wie der Junge sich aufführte, war das hier mehr als nur ein Spiel.
«Du bist ein Verräter!», schrie der Junge. «Du bist ein Gedankenverbrecher! Du bist ein eurasischer Spion! Ich knall dich ab, ich vaporisier dich, ich schick dich ins Salzbergwerk!»
Plötzlich sprangen sie im Kreis um ihn herum und riefen immerzu «Verräter!» oder «Gedankenverbrecher», wobei das kleine Mädchen jede Bewegung, jede Geste seines Bruders nachahmte. Man konnte es durchaus mit der Angst zu tun bekommen, es war ein bisschen wie das Herumtollen von kleinen Tigerjungen, die schon bald zu menschenfressenden Raubtieren heranwachsen werden. Im Blick des Jungen lag so etwas wie berechnende Grausamkeit, der ziemlich deutliche Wunsch, Winston zu schlagen oder zu treten, und das Bewusstsein, dass er schon beinahe groß genug war, es auch zu tun. Man musste froh sein, dachte Winston, dass seine Pistole nicht echt war.
Mrs. Parsons’ Blick schweifte unruhig zwischen Winston und den Kindern hin und her. Im helleren Licht des Wohnzimmers registrierte Winston mit Interesse, dass tatsächlich Staub in den Falten ihres Gesichts lag.
«Heute sind sie richtig unruhig und laut», sagte sie. «Sind enttäuscht, weil sie nicht beim Aufhängen zugucken können, daran liegt es. Ich hab zu viel zu tun, um mit ihnen hinzugehen, und Tom kommt nicht rechtzeitig von der Arbeit zurück.»
«Warum können wir nicht zum Aufhängen gehen?», polterte der Junge mit seiner durchdringenden Stimme.
«Will das Hängen sehen! Will das Hängen sehen!», skandierte das kleine Mädchen, während es im Zimmer herumhüpfte.
An diesem Abend, erinnerte sich Winston, sollten im Park einige eurasische Gefangene gehenkt werden, die wegen Kriegsverbrechen angeklagt und verurteilt worden waren. Solche Veranstaltungen fanden ungefähr einmal im Monat statt und bildeten ein beliebtes Spektakel. Kinder lagen ihren Eltern in den Ohren, damit sie daran teilnehmen durften.
Winston verabschiedete sich von Mrs. Parsons und verließ die Wohnung. Er war aber noch keine sechs Schritte durch den Hausflur gegangen, da spürte er einen jähen Schmerz im Nacken. Es war, als wäre er mit glühendem Draht geschlagen worden. Er fuhr herum und sah gerade noch, wie Mrs. Parsons ihren Sohn durch die Tür zurückzerrte, während dieser sich ein Katapult in die Hosentasche schob.
«Goldstein!», brüllte der Junge, bevor die Tür zuschlug. Das war erschreckend genug, aber noch bemerkenswerter fand Winston den Ausdruck hilfloser Furcht im gräulichen Gesicht der Frau.
Zurück in seiner Wohnung, ging er rasch am Teleschirm vorbei und setzte sich wieder an den Tisch. Er rieb sich den Nacken, der noch immer brannte. Die Musik aus dem Teleschirm hatte aufgehört. Stattdessen war jetzt eine zackige Militärstimme zu hören, die mit einem gewissen brutalen Genuss eine Aufstellung der Bordwaffen auf der neuen Schwimmenden Festung verlas, die gerade erst zwischen Island und den Färöern vor Anker gegangen war.
Mit solchen Kindern, dachte Winston, musste das Leben dieser elenden Frau ein einziger Albtraum sein. Noch ein oder zwei Jahre, dann würden sie sie Tag und Nacht beobachten und nach Hinweisen auf mangelnde Linientreue suchen. Heutzutage waren fast alle Kinder so schrecklich. Das Schlimmste war, dass sie von Organisationen wie den Kleinen Spionen zu zügellosen kleinen Wilden erzogen wurden, was aber nicht bedeutete, dass sie jemals Lust bekamen, gegen die Parteidisziplin zu rebellieren. Im Gegenteil, die Partei und alles, was damit zusammenhing, liebten sie abgöttisch. Die Lieder, die Umzüge, die Fahnen, die Wanderungen, die Drillübungen mit Gewehrattrappen, das Rufen von Parolen, die Anbetung des Großen Bruders – das alles war für sie ein herrliches, aufregendes Spiel. Ihre ganze wilde Energie wurde nach außen gelenkt, gegen die Staatsfeinde, gegen Ausländer, Verräter, Saboteure, Gedankenverbrecher. Für Menschen über dreißig war es fast schon normal, Angst vor den eigenen Kindern zu haben. Und das mit gutem Grund, denn es verging kaum eine Woche, in der nicht in der Times davon berichtet wurde, wie so ein spionierender kleiner Petzer – «Kinderheld» war der gängige Ausdruck dafür – irgendeine verräterische Bemerkung belauscht und seine Eltern bei der Gedankenpolizei angeschwärzt hatte.
Der brennende Schmerz von der Katapultattacke hatte nachgelassen. Halbherzig griff Winston zum Federhalter, obwohl ihm im Moment nichts einfiel, was er noch ins Tagebuch schreiben könnte. Plötzlich kehrten seine Gedanken zu O’Brien zurück.
Vor Jahren – wie lange war das jetzt her? Bestimmt sieben Jahre – hatte er einmal geträumt, er würde durch einen stockfinsteren Raum gehen. Jemand, der dort saß, hatte ihn von der Seite angesprochen: «Wir werden uns an dem Ort treffen, wo keine Dunkelheit herrscht.» Das wurde sehr ruhig, fast beiläufig gesagt – eine Feststellung, kein Befehl. Er war weitergegangen, ohne innezuhalten. Seltsam war, dass diese Worte zu der Zeit, in diesem Traum, keinen großen Eindruck auf ihn gemacht hatten. Erst später, nach und nach, schienen sie an Bedeutung gewonnen zu haben. Heute konnte er sich nicht mehr erinnern, ob er O’Brien vor oder nach dem Traum zum ersten Mal gesehen hatte; auch wusste er nicht mehr, wann er die Traumstimme als die Stimme O’Briens identifiziert hatte. Jedenfalls hatte die Identifizierung stattgefunden. Es war O’Brien, der aus dem Dunkel zu ihm gesprochen hatte.
Winston war sich nie sicher gewesen – selbst nach dem Blickwechsel von heute Morgen nicht –, ob er in O’Brien einen Freund oder einen Feind sah. Darauf schien es aber auch gar nicht wirklich anzukommen. Zwischen ihnen gab es eine Verbindung, ein gegenseitiges Verständnis, und das war wichtiger als Zuneigung oder Parteilichkeit. «Wir werden uns an dem Ort treffen, wo keine Dunkelheit herrscht», hatte er gesagt. Winston wusste nicht, was das bedeutete, nur dass es, auf diese oder jene Weise, so kommen würde.
Die Stimme aus dem Teleschirm legte eine Pause ein. Ein Trompetensignal, klar und wunderschön, schwebte durch die verbrauchte Zimmerluft. Schnarrend fuhr die Stimme fort:
«Achtung, Achtung! Soeben erreicht uns eine Eilmeldung von der Malabar-Front. Unsere Streitkräfte in Südindien haben einen glanzvollen Sieg errungen. Ich darf mitteilen, dass die militärische Operation, von der wir nun berichten, ein Ende des Krieges in absehbarer Zeit näher rücken lässt. Hier also die Eilmeldung –»
Oje, schlechte Nachrichten, dachte Winston. Und tatsächlich, auf einen äußerst blutrünstigen Bericht über die völlige Vernichtung einer eurasischen Armee, in dem gewaltige Zahlen von Toten und Gefangenen genannt wurden, folgte die Ankündigung, dass von der folgenden Woche an die Schokoladenration von dreißig auf zwanzig Gramm gekürzt werde.
Winston musste wieder rülpsen. Die Wirkung des Gins ließ nach, ein Gefühl der Ernüchterung blieb zurück. Aus dem Teleschirm schmetterte jetzt «Ozeanien, du unsere Heimat» – vielleicht um den Sieg zu feiern, vielleicht um den bevorstehenden Schokoladenverlust zu verdrängen. Es wurde erwartet, dass man dabei strammstand. Da, wo er jetzt saß, war er allerdings nicht zu sehen.
Auf die Ozeanien-Hymne folgte leichtere Musik. Winston ging zum Fenster, stand mit dem Rücken zum Teleschirm. Die Luft draußen war unverändert klar und kalt. Irgendwo in der Ferne explodierte eine Raketenbombe mit dumpfem, widerhallendem Donner. Derzeit gingen pro Woche ungefähr zwanzig bis dreißig dieser Bomben über London nieder.
Unten auf der Straße flatterte das zerrissene Plakat im Wind hin und her, sodass das Wort ENGSOZ mal verschwand, mal wieder auftauchte. Engsoz. Die heiligen Prinzipien des Engsoz. Neusprech, Doppeldenk, die Veränderlichkeit der Vergangenheit. Winston kam sich vor, als würde er durch dichte Wälder auf dem Meeresgrund wandern, verloren in einer ungeheuerlichen Welt, in der er selbst das Ungeheuer war. Er war allein. Die Vergangenheit war tot, die Zukunft nicht auszudenken. Wie konnte er sicher sein, dass es in der Gegenwart auch nur ein einziges Menschenwesen gab, das auf seiner Seite stand? Und wie konnte er wissen, dass die Vorherrschaft der Partei nicht ewig bestehen würde?
Wie eine Antwort auf diese Fragen standen ihm die drei Parolen auf der weißen Vorderseite des Wahrheitsministeriums vor Augen:
KRIEG IST FRIEDEN
FREIHEIT IST SKLAVEREI
UNWISSENHEIT IST STÄRKE
Er zog ein Fünfundzwanzigcentstück aus der Tasche. Auch diesem waren in winziger, klarer Schrift dieselben Parolen aufgeprägt, und auf der Rückseite der Münze der Kopf des Großen Bruders. Selbst von dem Geldstück aus verfolgten einen diese Augen. Von Münzen, von Briefmarken, von Buchdeckeln, von Fahnen, von Plakaten und von Zigarettenschachteln – von überall. Immer die Augen, die einen beobachteten, und die Stimme, die einen umfing. Ob im Schlaf oder im Wachen, bei der Arbeit oder beim Essen, drinnen oder draußen, im Bad oder im Bett – es gab kein Entkommen. Und nichts, was wirklich einem selbst gehörte, außer den paar Kubikzentimetern im Innern deines Schädels.
Die Sonne war weitergezogen, und die unzähligen Fenster des Wahrheitsministeriums, auf die kein Licht mehr fiel, wirkten so düster wie die Schießscharten einer Festung. Winston sank das Herz im Angesicht der gewaltigen Pyramidenform. Diese Festung war zu stark, sie war uneinnehmbar. Eintausend Raketenbomben würden nicht reichen, sie zu Fall zu bringen. Erneut fragte er sich, für wen er das Tagebuch schrieb. Für die Zukunft, für die Vergangenheit – für ein Zeitalter, das es vielleicht nur in der Phantasie gab? Vor ihm, da lag nicht bloß der Tod, sondern die völlige Vernichtung. Vom Tagebuch würde nur Asche übrig bleiben, von ihm selbst nur Dampf. Nur die Gedankenpolizei würde lesen, was er geschrieben hatte, bevor sie es auslöschte und jede Erinnerung daran tilgte. Wie konnte man die Zukunft anrufen, wenn nicht die geringste Spur von einem, nicht einmal ein anonym auf ein Stück Papier gekritzeltes Wort überdauerte?
Der Teleschirm schlug vierzehn. In zehn Minuten musste er los. Um vierzehn Uhr dreißig hatte er wieder bei der Arbeit zu sein.
Seltsamerweise schien das Stundenläuten ihm neuen Mut eingeflößt zu haben. Er war ein einsamer Geist, und die Wahrheit, die er aussprach, würde niemand je hören. Aber solange er sie aussprach, bestand sie auf irgendeine Weise fort. Nicht indem man sich Gehör verschaffte, sondern indem man bei Verstand blieb, bewahrte man das menschliche Erbe.
Er setzte sich wieder an den Tisch, tauchte den Federhalter ein und schrieb:
An die Zukunft oder die Vergangenheit, an eine Zeit, in der die Gedanken frei sind, in der die Menschen verschieden sind und nicht alleine leben – an eine Zeit, in der Wahrheit existiert und man Geschehenes nicht ungeschehen machen kann:
Aus der Zeit der Gleichförmigkeit, der Zeit der Einsamkeit, der Zeit des Großen Bruders, der Zeit des Doppeldenk – seid gegrüßt!
Er war bereits tot, überlegte er. Es schien ihm, dass er erst jetzt, da er nach und nach lernte, seine Gedanken zu formulieren, den entscheidenden Schritt getan hatte. Die Folgen einer jeden Handlung sind Teil der Handlung selbst. Er schrieb:
Gedankenverbrechen hat nicht den Tod zur Folge: Gedankenverbrechen IST der Tod.
Nun, da er sich als Toten auf Abruf erkannt hatte, wurde es umso wichtiger, so lange wie möglich am Leben zu bleiben. Zwei Finger seiner rechten Hand waren mit Tinte beschmiert. Gerade Kleinigkeiten dieser Art konnten einen verraten. Irgendeine fanatische Schnüffelnase im Ministerium (eine Frau wahrscheinlich, jemand wie die kleine Rotblonde oder die Dunkelhaarige aus der Abteilung Literatur) könnte sich fragen, wozu er während der Mittagspause schreiben musste, warum er dafür einen altmodischen Federhalter benutzte und vor allem: was er da wohl zu Papier brachte – und an zuständiger Stelle einen entsprechenden Hinweis hinterlassen.
Er ging ins Bad und wusch sich gründlich die Hände mit der groben, dunkelbraunen Seife, die wie Schmirgelpapier über die Haut rieb und daher für diesen Zweck gut geeignet war.
Er packte das Tagebuch in die Schublade. Es hatte wenig Sinn, es verstecken zu wollen, aber er konnte wenigstens Vorkehrungen treffen, um zu erkennen, ob es entdeckt worden war oder nicht. Ein über die Seitenenden gelegtes Haar war zu offensichtlich. Mit einer Fingerspitze nahm er einige gut zu identifizierende weißliche Staubkörner auf und platzierte sie auf einer Ecke des Buchdeckels, von der sie zwangsläufig abgeschüttelt werden würden, falls jemand das Buch bewegte.
III
Winston träumte von seiner Mutter.
Er musste zehn oder elf gewesen sein, als seine Mutter verschwand. Sie war groß und ziemlich still, eine klassische Schönheit mit ruhigen Bewegungen und prachtvollen blonden Haaren. An seinen Vater erinnerte er sich eher verschwommen: dunkelhaarig, mager, immer in dunkler, schicker Kleidung (ganz besonders hatte Winston noch seine sehr dünnen Schuhsohlen vor Augen), Brillenträger. Die beiden waren offenbar von einer der ersten großen Säuberungswellen in den fünfziger Jahren erfasst worden.
In diesem Traum saß seine Mutter irgendwo tief unter ihm und hatte seine kleine Schwester im Arm. An diese Schwester konnte er sich fast gar nicht erinnern, nur dass sie ein winziges, kümmerliches Baby war, immer still, mit großen, aufmerksamen Augen. Beide blickten hoch zu ihm. Sie befanden sich an irgendeinem unterirdischen Ort – auf dem Boden eines Brunnens vielleicht, oder in einem sehr tiefen Grab –, aber dieser Ort, so tief er ohnehin schon lag, bewegte sich immer noch weiter abwärts. Jetzt war es der Salon eines sinkenden Schiffes, aus dem sie durch das immer dunklere Wasser zu ihm heraufblickten. Es gab noch Luft in diesem Salon, sie konnten ihn noch sehen und er sie auch, doch die ganze Zeit sanken sie immer weiter in die grünen Tiefen des Wassers hinab, in dem sie jeden Augenblick für immer verschwinden mussten. Er selbst stand im Licht und im Freien, während sie hinab in den Tod gesaugt wurden, und sie waren dort unten, weil er hier oben war. Er wusste es, und sie wussten es, und er konnte in ihren Gesichtern lesen, dass sie es wussten. Es war kein Vorwurf in ihren Augen oder in ihren Herzen, nur das Wissen darum, dass sie sterben mussten, damit er am Leben bleiben konnte, und dass dies Teil der nicht hintergehbaren Ordnung der Dinge war.
Er erinnerte sich nicht, was vorher geschehen war, aber im Traum wusste er, dass das Leben seiner Mutter und seiner Schwester auf irgendeine Weise seinem eigenen geopfert wurde. Es war einer von diesen Träumen, die zwar in typischen Traumkulissen spielen, tatsächlich aber eine Fortsetzung des bewussten Denkens sind und gewisse Tatsachen und Ideen ins Licht rücken, die auch nach dem Erwachen noch neu und wertvoll erscheinen. Schlagartig wurde Winston klar, dass der Tod seiner Mutter vor fast dreißig Jahren ein tragisches und trauriges Ereignis gewesen war, das heutzutage so nicht mehr möglich war. Tragik, begriff er, war etwas aus einer versunkenen Zeit, einer Zeit, in der es noch Liebe, Freundschaft und eine Privatsphäre gab, einer Zeit, in der die Mitglieder einer Familie einander ganz selbstverständlich beistanden, ohne einen Grund dafür haben zu müssen. Die Erinnerung an seine Mutter tat ihm im Herzen weh, weil sie in Liebe zu ihm gestorben war, während er noch zu jung und selbstsüchtig war, um diese Liebe zu erwidern, und weil sie sich – wie genau, wusste er nicht mehr – aufgeopfert hatte für ein persönliches, unerschütterliches Verständnis von Treue, die ihr wichtiger war als alles andere. So etwas konnte heute nicht mehr passieren. Heutzutage gab es Furcht, Hass und Schmerz, aber keine Würde des Gefühls, keinen wirklich tiefen Kummer. All dies glaubte er in den Augen seiner Mutter und seiner Schwester zu erkennen, die durch das grüne Wasser zu ihm heraufblickten, aus mehreren hundert Metern Tiefe und immer noch weiter sinkend.
Plötzlich stand er auf einer kurzen, weichen Grasnarbe, es war ein Sommerabend, die schrägen Sonnenstrahlen vergoldeten den Boden ringsum. Die Landschaft, auf die er blickte, tauchte so häufig in seinen Träumen auf, dass er sich nie ganz sicher war, ob er sie aus der realen Welt kannte oder nicht. Im Wachzustand nannte er sie das Goldene Land. Es war eine alte, von Kaninchen abgefressene Wiese, über die, zwischen einigen Maulwurfshügeln hindurch, ein ausgetretener Pfad führte. Im struppigen Gehölz auf der gegenüberliegenden Feldseite schaukelten die Zweige der Ulmen sanft im Wind, das dichte Laub wogte kaum merklich wie Frauenhaar. Irgendwo in der Nähe, wenn auch außer Sicht, plätscherte ein klarer, träger Bach, in dessen Tümpeln unter den Weiden kleine Fische schwammen.
Die dunkelhaarige junge Frau kam quer über das Feld auf ihn zu. Mit einer einzigen Bewegung riss sie sich die Kleider vom Leib und warf sie verächtlich zur Seite. Ihr Körper war weiß und glatt, weckte aber kein Verlangen in ihm, nicht einmal genauer hinsehen mochte er. Stattdessen war er voller Bewunderung für die Geste, mit der sie die Kleidung von sich geschleudert hatte. Diese Anmut und Unbekümmerheit schien eine ganze Kultur, ein ganzes Gedankengebäude zum Einsturz zu bringen – als könnte der Große Bruder, die Partei und die Gedankenpolizei einfach mit grandiosem Armschwung ins Nichts katapultiert werden. Auch diese Geste gehörte zu einer früheren Zeit. Winston erwachte mit dem Wort «Shakespeare» auf den Lippen.
Der Teleschirm gab plötzlich ein ohrenbetäubendes Pfeifen von sich, das ungefähr dreißig Sekunden lang auf gleicher Tonhöhe andauerte. Es war sieben Uhr fünfzehn, Aufstehzeit für Büroangestellte. Winston wälzte sich aus dem Bett – nackt, denn als Mitglied der Äußeren Partei erhielt er