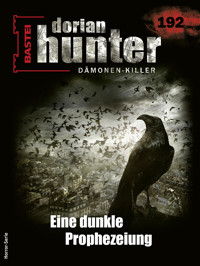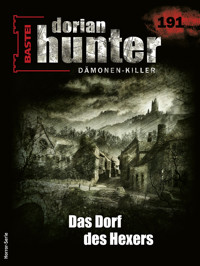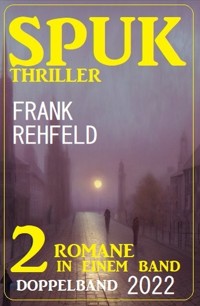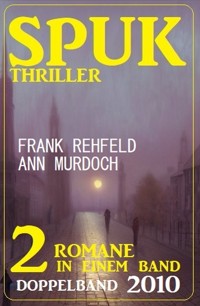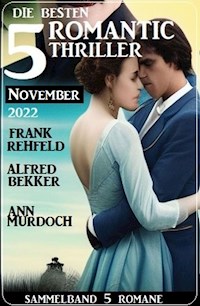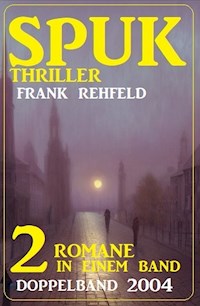Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Gruselromane: Party des Schreckens (Frank Rehfeld) Das Grauen schleicht durch München (Klaus Frank) Vampire in New York (Pete Hackett) Ein fehlgeschlagener Raub in einer Tankstelle, die Angestellte liegt im Koma. Ab diesem Zeitpunkt beginnt eine unheimliche Mordserie, die mit dem Selbstmord eines der Räuber beginnt. Doch die Leiche verschwindet auf geheimnisvolle Weise, und plötzlich ist niemand mehr seines Lebens sicher.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frank Rehfeld, Pete Hackett, Klaus Frank
Inhaltsverzeichnis
3 Gruselromane Halloween 2022
Copyright
Party des Schreckens
Das Grauen schleicht durch München
Vampire in New York
3 Gruselromane Halloween 2022
Frank Rehfeld, Klaus Frank, Pete Hackett
Dieser Band enthält folgende Gruselromane:
Party des Schreckens (Frank Rehfeld)
Das Grauen schleicht durch München (Klaus Frank)
Vampire in New York (Pete Hackett)
Ein fehlgeschlagener Raub in einer Tankstelle, die Angestellte liegt im Koma. Ab diesem Zeitpunkt beginnt eine unheimliche Mordserie, die mit dem Selbstmord eines der Räuber beginnt. Doch die Leiche verschwindet auf geheimnisvolle Weise, und plötzlich ist niemand mehr seines Lebens sicher.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author /
© dieser Ausgabe 2022 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!Verlags geht es hier:
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Party des Schreckens
Frank Rehfeld
Die Hauptpersonen:
Stephen Korn - Er ist Künstler und malt das Bild des Dämons.
Robert Korn - Sein Bruder ist der unerschrockene Detektiv und spürt die Sense des Zombies.
Jill Taylor - Robs schöne und mutige Verlobte.
Tartok - Er ist der Vorbote des Todes und schlägt immer wieder zu.
Mühsam unterdrückte Stephen Korn einen Fluch, als er die Karten auf den Tisch warf.
Seine Hände zitterten. Langsam zündete er sich eine Zigarette an. Gierig
inhalierte er den Rauch.
»Spielen Sie weiter?« fragte der Croupier.
Wortlos stand Korn auf. Wie in Trance ging er zum Ausgang des Spielcasinos. An zahlreichen Automaten und Spieltischen vorbei führte sein Weg, doch er würdigte sie keines Blickes.
»Gewonnen!« rief jemand neben ihm. Ich nicht, dachte Stephen. Das ging schon fast nicht mehr mit rechten Dingen zu. Seit Wochen verlor er.
Dabei war er früher fast so etwas wie Lieblingskind des Glücks gewesen. Nicht selten trug er dreistellige Gewinne aus dem Casino.
Am Ausgang ließ er sich seinen Mantel geben und trat in die Nacht hinaus.
Sofort griff die Kälte nach ihm. Schneidender Dezemberwind fuhr ihm ins Gesicht.
Fröstelnd knöpfte er den Mantel zu. Nicht mal für ein Taxi besaß er genug Geld.
Dann würde er eben laufen müssen, knapp eine Stunde Weg.
Er blickte auf seine Armbanduhr. Fast elf Uhr nachts. Zu Hause stand noch eine volle Flasche Whisky im Kühlschrank. Die hätte er jetzt gern gehabt.
Verbissen stapfte er los. Seine Schritte hallten durch die nächtliche Stille. Die bunten Neonleuchten des Casinos blieben hinter ihm zurück.
Die verlorenen sechzig Pfund waren sein letztes Geld gewesen. Er würde wieder mehr arbeiten müssen.
Sein Beruf war die Malerei. Hugh Harris, sein Agent, hatte gute Kontakte zu Verlagen. Dort brauchte man die Bilder als Titelbilder für Bücher.
Nicht eben das, was Stephen Korn sich vorgestellt hatte. Aber sonst wollte niemand seine Bilder kaufen. Also malte er, was Harris gerade von ihm verlangte.
Hauptsächlich Gruselszenen.
Bilder von Monstern und Vampiren, am besten, wenn sie gerade über einen Menschen herfielen.
Er erreichte die Kensington Road und ging sie entlang, bis er den Hyde-Park fand.
Durch ihn konnte er seinen Weg abkürzen. So sparte er fast zehn Minuten.
Die dunklen Bäume und Büsche erschienen ihm wenig einladend. Nur vereinzelt brannten Laternen.
Andererseits waren zehn Minuten ein Zeitraum, und die Kälte hatte sich inzwischen durch seinen Mantel gefressen. Die Temperatur lag bestimmt erheblich unter dem Gefrierpunkt.
Stephen Korn entschloß sich für die Abkürzung. Zwar las man schon mal von nächtlichen Überfällen, gerade im Hyde-Park, aber bei ihm war ohnehin nichts zu holen.
Er bog auf einen Weg ab. Sofort umhüllte ihn die Dunkelheit.
Um diese Jahreszeit hatten die Bäume längst ihre Blätter verloren. Wie tote Finger ragten die langen Äste in den Himmel. Auch die meisten Büsche waren kahl.
Nach einigen Schritten hatten seine Augen sich an die veränderten Lichtverhältnisse gewöhnt.
Es war eine sternklare Nacht. In einigen Tagen würde Vollmond sein. Fast rund hing der Erdtrabant am Himmel und schickte sein Licht auf die Erde.
Irgendwo schrie ein Nachtvogel. Stephen Korn beschleunigte seinen Schritt. Der Park beunruhigte ihn.
Irgendeine finstere Drohung schien in der Luft zu liegen, hinter jedem Baumstamm eine Gefahr zu lauern.
Kein Mensch begegnete ihm. Im Sommer war der Park nachts ein geschätzter Treffpunkt für Liebespaare. Im Winter gab es hier höchstens mal einen Stadtstreicher, der auf einer Bank übernachtete. War da nicht etwas? Korn blieb instinktiv stehen und lauschte. Ja, da war ein Geräusch, und es klang wie - Pferdegetrappel.
So abwegig dieser Gedanke auch schien, von Sekunde zu Sekunde war das Geräusch deutlicher zu vernehmen. Es waren Pferdehufe, die den Boden peitschten.
Unglaublich schnell näherte sich der Hufschlag. Jetzt konnte Stephen auch noch ein zweites Geräusch ausmachen: das Rollen von Rädern.
Eine Kutsche! Obwohl er sich selbst daran erinnerte, daß er sich im zwanzigsten Jahrhundert und mitten in London befand, verschwand der Spuk nicht.
Im Gegenteil, er kam in atemberaubendem Tempo näher. Plötzlich konnte Korn schon einen schwachen Lichtschimmer zwischen den Bäumen erkennen.
Eine nie gekannte Angst erfaßte ihn.
Er blickte sich um. Rechts und links gab es nur Wiesen. Die nächsten Bäume befanden sich viel zu weit weg, wenn er sie vor der Kutsche erreichen wollte.
Doch auf der rechten Seite gab es einen kleinen Abhang, ungefähr einen halben Meter tief.
Sein klarer Verstand war wie ausgeschaltet. Nackte Panik erfaßte den Maler.
Ohne zu denken, sprang er den Abhang hinunter und warf sich ins Gras.
In diesem Moment bog die Kutsche um eine Biegung. Jetzt konnte Korn das Gefährt genau sehen.
Es war pechschwarz, ebenso wie die beiden Pferde, die es zogen.
Zu beiden Seiten des Fahrersitzes baumelte eine Laterne. Stephen Korns Herz überschlug beinahe einen Schlag, als er den Sitz sah: Er war leer!
Niemand lenkte die Kutsche...
*
Ohne daß jemand die Zügel zog, wurden die Pferde langsamer. Genau auf Höhe des Malers blieben sie stehen.
Stephen Korn wagte kaum noch zu atmen. Sein Herzschlag erschien ihm überlaut. Seine Zähne klapperten, obwohl er die Kiefer fest aufeinander preßte.
Keine Kutsche konnte von selbst fahren. Überhaupt - wer bediente sich im Zeitalter des Autos noch eines solchen Gefährts?
Diese Frage stellte er sich, doch er wollte sie gar nicht beantwortet haben.
Wer auch immer in der Kutsche saß, er sollte weiterfahren. Mußten die Pferde ausgerechnet hier eine Pause einlegen?
Oder hatten sie bewußt angehalten? Witterten sie ihn? Noch tiefer preßte Stephen Korn sich, ins Gras, nur den Kopf hielt er etwas schräg, damit er die Kutsche sehen konnte.
Dann hörte er, wie eine Tür geöffnet wurde.
Offenbar waren die Scharniere lange nicht geölt worden. Nervtötendes Quietschen schnitt durch die Stille. Leise wieherten die Pferde und warfen unruhig den Kopf in den Nacken.
Die Tür befand sich auf der anderen Seite der Kutsche. Unter dem Gefährt hindurch konnte Stephen Korn sehen, wie ein Fuß auf den Boden gesetzt wurde... danach ein zweiter.
Ein Fuß? Nein, das war ein - Pferdehuf. Ein zottiger Pferdehuf.
Der Teufel!
Der Maler kannte die alten Legenden, die den Leibhaftigen mit einem solchen Huf beschrieben. Er selbst hatte ihn immer so gemalt.
Instinktiv begann der Mann in diesen Sekunden zu beten. Er flehte zum Allmächtigen, daß dies alles nur ein schrecklicher Traum war.
Es half nichts. Bestialischer Gestank nach Pech und Schwefel breitete sich aus und legte sich schwer auf seine Lungen.
Vor Angst bibbernd beobachtete er, wie der Unheimliche die Kutsche umrundete und über ihm stehenblieb.
Er wagte nicht, den Kopf zu heben, um die Gestalt ganz anzusehen.
»Wurm!« hörte er eine mächtige Stimme in seinem Innern. »Du tust gut daran, dich vor mir in den Staub zu werfen. Doch nun erhebe dich!«
Obwohl alles in ihm sich dagegen sträubte, mußte Stephen Korn dem Befehl gehorchen.
Der Schwefelgeruch drohte ihm den Atem zu nehmen. Mühsam quälte er sich auf die Beine.
Dann sah er sein Gegenüber. Es mußte wirklich der Teufel persönlich sein.
Gekleidet war der Bockfüßige in eine lange schwarze Kutte, unter der der Huf und der andere Fuß, der in einem dunklen Stiefel steckte, hervorragten.
Und sein Kopf? - Korn schrie auf, als er ihn sah.
Es war ein Totenschädel. Ein unheiliges rotes Feuer glühte in den Augenhöhlen. Gellendes Lachen drang aus der Fratze.
»Du ahnst, wer ich bin«, vernahm Stephen Korn wieder die Stimme in seinem Kopf. »Ja, ich bin Asmodis, der Teufel, der Herr der Hölle. Ich habe einen Auftrag für dich.«
Er streckte eine skelettierte Hand aus. Die Totenfinger deuteten genau auf Korns Stirn.
Ein greller Blitz löste sich aus ihnen. Von einem Augenblick zum anderen war die Persönlichkeit des Malers ausgelöscht...
Er wurde zu einem Sklaven Satans, ohne freien Willen. Jetzt wußte er, was er zu tun hatte, und verneigte sich.
»Ich gehorche, Meister.«
Erneut stieß der Bockfüßige ein gellendes Lachen aus, dann wandte er sich abrupt um und stieg wieder in die Kutsche. Wenige Sekunden später war sie verschwunden, als hätte es sie nie gegeben.
Der nächtliche Passant hinterließ keine Spuren, aber er hatte einem Menschen seinen dämonischen Befehl eingeimpft.
Mit eigenartigem Lächeln auf den Lippen schritt Stephen Korn weiter.
*
Robert Korn konnte sich nicht satt sehen an der dichten Wolkendecke. Obwohl sie nun schon mehrere Stunden flogen, faszinierte ihn das Bild immer noch.
Hier oben war nichts von der winterlichen Jahreszeit zu spüren. Über den Wolken schien immer die Sonne.
»Bitte stellen Sie das Rauchen ein und schnallen Sie sich an. Wir landen in wenigen Minuten«, klang es aus den Lautsprechern.
Seufzend drückte Rob seine Zigarette aus und schloß den Gurt. Seine Verlobte Jill Taylor, die neben ihm saß, tat das gleiche.
Das Flugzeug tauchte in die Wolkendecke. Minutenlang war außer diffusem Grau nichts außerhalb der Fenster zu sehen.
Dann lag plötzlich London unter ihnen. Hier war es diesig, die Sonnenstrahlen kamen nicht durch. Kaum etwas war von der Großstadt zu sehen.
»Vielleicht hätten wir deinem Bruder unser Kommen doch ankündigen sollen«, äußerte Jill ihre wiederholten Bedenken.
»Aber Darling, dann wäre doch die ganze Überraschung weg. Sowohl für ihn als auch für uns. Immerhin haben wir uns seit einigen Jahren nicht mehr geschrieben. Ich bin gespannt, wie es Stephen geht.«
Es gab einen winzigen Ruck, als die Reifen den Boden berührten, dann hatte das Flugzeug aufgesetzt. Langsam rollte es aus.
Sie lösten die Gurte und erhoben sich.
Schlauchartige Gangways wurden an das Flugzeug herangefahren, bis sich schließlich die Türen öffneten.
Robert Korn mochte die Schläuche nicht besonders, obwohl sie zweifellos bequem waren. Dafür war es romantischer gewesen, die normale Gangway hinabzusteigen und dann mit einem Bus zum Flughafengebäude gefahren zu werden.
Sechs Tage waren es noch bis Weihnachten, drei Wochen bis zu ihrer Hochzeit.
Es war eine Schnapsidee gewesen, Stephen Korn über Weihnachten zu besuchen. Rob liebte solche spontanen Einfälle. Außerdem war er der Meinung, daß sein Bruder seine Verlobte vor der Hochzeit ruhig mal kennenlernen konnte.
Genußvoll setzte Rob Korn nach mehr als zehn Jahren erstmals wieder seinen Fuß auf englischen Boden.
Stephen und er waren Waisen, da die Eltern bei einem Autounfall ums Leben kamen. Damals waren sie noch klein und wurden in einem Heim untergebracht, da sich kein Verwandter um sie kümmern wollte.
Mit achtzehn Jahren, kaum daß er mit der Schulausbildung fertig und volljährig war, hatte Rob alles ersparte Geld, einschließlich seines schmalen Erbteils zusammengekratzt und sich nach Amerika abgesetzt.
Doch auch im Land der unbegrenzten Möglichkeiten wurde ihm nichts geschenkt. Eine Zeitlang drohte er, unter die Räder zu geraten.
Seine Freunde stammten aus äußerst zweifelhaftem Milieu. Aber im Heim hatte er zu kämpfen verstanden, und es gelang ihm, sich durchzusetzen.
Eines Tages zog er einen radikalen Strich unter seine Vergangenheit. Er schlug sich auf die andere Seite.
Er ging zur Polizei, doch auch dort hielt er es nicht lange aus. Es gelang ihm, sich als Privatdetektiv selbständig zu machen.
Die Zähigkeit, mit der er einen Fall bearbeitete, hatte ihn rasch bekannt gemacht. Nach einigen Hungerphasen ging es aufwärts.
Sie wartete, bis sie ihr Gepäck bekamen. Mit den Koffern strebten sie dem Ausgang des Flughafens Heathrow zu. Dort stiegen sie in ein Taxi.
Bereits von New York aus hatte Robert Korn ein Doppelzimmer im Kings-Hotel reservieren lassen. Er nannte dem Taxifahrer das Ziel.
Es war um die Mittagszeit, und sie gerieten genau in den Berufsverkehr. So dauerte es fast eine halbe Stunde, bis sie durch die verstopften Straßen ihr Hotel erreichten. Mit Sorge um seinen Geldbeutel beobachtete Rob den unerbittlich fortschreitenden Taxameter.
An der Rezeption bekamen sie den Zimmerschlüssel ausgehändigt und trugen sich ins Gästebuch ein.
Zusammen mit einem Pagen, der ihr Gepäck trug, fuhren sie mit dem Lift in den zweiten Stock.
Das Zimmer war sauber und gemütlich, was auch bei Hotels dieser Klasse nicht immer der Fall war.
Obwohl es mitten in der City lag, hielten die doppelten Fensterscheiben den Straßenlärm fast völlig fern. Ausdrücklich hatte Korn auf einem Zimmer mit Bad bestanden.
Während er sich dort etwas erfrischte, räumte Jill die Kleider in den Schrank. Anschließend verschwand sie im Badezimmer.
Rob rauchte eine Zigarette, während er auf sie wartete. Als sie das Bad schließlich verließ, trug sie hautenge Jeans und einen roten Wollpullover, der ihre schlanke Figur gut betonte.
Sie hatte modisch geschnittene, blonde Haare, die ihr bis knapp auf die Schultern fielen. Ihr Gesicht hätte jedem Fotomodell zur Ehre gereicht, und sie brauchte es nicht erst durch Kosmetika zu verschönern.
»Na, wie gefalle ich dir?« fragte sie mit einem Lächeln. Dabei drehte sie sich einmal um die eigene Achse.
»Wie immer großartig, Darling. Und wenn ich nicht bald etwas zu essen bekomme, knabbere ich dich bestimmt an.«
Lachend hakte sie sich bei ihm ein. Zusammen verließen sie das Zimmer, um im hoteleigenen Speiseraum ihren Appetit zu stillen.
*
Zwei Tage arbeitete Stephen Korn schon an dem Bild. In dieser Zeit hatte er weder etwas gegessen noch getrunken.
Die dämonische Kraft, die in ihm steckte, ließ ihn die menschlichen Bedürfnisse vergessen.
Das Gemälde stand dicht vor seiner Vollendung. Noch mal tauchte er den Pinsel in die schwarze Farbe und zog die letzten Striche.
Korn trat einen Schritt zurück.
Prüfend musterte er sein Werk. Fanatisch funkelten seine Augen, und ein zufriedenes Lächeln stahl sich in seine Züge.
Das Bild war einfach perfekt!
Damit hatte er sich selbst übertroffen. Es war sein absolutes Meisterwerk. Doch würde es nie in die Öffentlichkeit gelangen.
Satan selbst hatte ihm die Fähigkeiten zu diesem Gemälde gegeben. Jeder Pinselstrich atmete Verderbnis.
Das Bild zeigte eine Spielkarte, doch nicht einfach irgendeine, es war das Pik-Ass.
Die Todeskarte!
In der Mitte der Karte war der Tod abgebildet, ein schwarzes Skelett, in eine Ritterrüstung gehüllt. In den Händen hielt es eine blitzende Sense.
Nur eine Kleinigkeit fehlte noch: die Augen.
Stephen ging in die Küche. Von dort holte er ein scharfes Messer und eine Untertasse. Damit kehrte er ins Atelier zurück.
Er löschte das Licht und entzündete eine Kerze. Worte einer fremden Sprache quollen über seine Lippen.
Er setzte das Messer an seinem Handballen an. Entschlossen zog er die scharfe Klinge durch das Fleisch.
Einige Blutstropfen rannen aus der Wunde, die er mit der Untertasse auffing.
Als eine dünne rote Schicht den Boden bedeckte, klebte er ein Pflaster über die Wunde.
Dann griff er nach einem frischen Pinsel und tauchte ihn in das Blut.
Mit wenigen Strichen vollendete er sein Werk. Immer noch murmelte er dabei höllische Beschwörungen.
Ein eisiger Luftstrom strich durch das Atelier, sobald er fertig war.
Im gleichen Moment bewegte sich das Skelett und löste sich von dem Bild.
Stephen Korn verneigte sich.
»Es ist vollendet«, sprach der Dämon mit dumpfer Stimme, die direkt aus einer Gruft zu kommen schien. »Tartok, der Vorbote des Todes, ist wieder frei. Ich danke dir, sterblicher Wurm. Du sollst angemessen belohnt werden.«
Bewegungslos sah Stephen mit an, wie der Dämon das Zimmer verließ. Bei jedem Schritt klirrte die alte Rüstung.
Die satanische Kraft verließ ihn. Jetzt forderte sein Körper den Tribut der Anstrengung.
Bewußtlos sackte er zusammen.
Währenddessen schlich das Grauen durch die Straßen von London...
*
»Du kannst mich mal, du altes Ekel«, brüllte Phyllis Parker. Außer sich vor Wut donnerte sie die Tür hinter sich zu.
Dabei schien es so ein schöner Abend zu werden. Ihr Freund Jim Davis hatte sie eingeladen. Seine Eltern waren für einige Tage verreist. So hatte er eine sturmfreie Bude.
Doch dann wurde wider Erwarten ein Pokalspiel im Fernsehen live übertragen. Als Fußballfan ließ Jim sich das nicht entgehen. Zu einem Spiel gehörte nach seiner Meinung auch Bier, um sich in Stimmung zu bringen.
Doch seine Lieblingsmannschaft Liverpool verlor haushoch. Um das zu verkraften, brauchte er noch mehr Bier.
Als das Spiel endlich zu Ende war, schimmerten seine Augen schon glasig, und seine Stimme hatte er nicht mehr unter Kontrolle.
Er wurde zudringlich. Gut, das hatte sie sich gewünscht, dafür war sie schließlich gekommen ... Aber nicht auf diese plumpe Art.
Als er ihr dann noch sagte, sie solle sich nicht so zieren, war alles aus.
Sie verpaßte ihm eine Ohrfeige, daß ihm der Kopf wackelte, und verließ das Haus.
Ihren Eltern hatte sie gesagt, daß sie bei einer Freundin übernachten würde. Diese günstige Gelegenheit wollte sie nun nicht ungenutzt verstreichen lassen.
Es gab genügend junge Männer, die ihr zu Füßen lagen. Ihre Figur trieb so manchem heiße Gedanken in den Kopf. Ihr hübsches Gesicht und die langen, lackschwarzen Haare taten ein übriges.
Sie würde in Charley's Pub gehen. Da traf man immer noch die nettesten Jungs. Vielleicht war auch Peter da.
Peter Connery war schon seit langem hinter ihr her. Er war intelligent und sah gut aus. Wenn da nicht Jim gewesen wäre, hätte sie sicher schon etwas mit ihm angefangen.
Aber das konnte man ja nachholen...
Nirgendwo entdeckte sie eine Telefonzelle. Auf keinen Fall würde sie zu Jim Davis zurückkehren, um sich von dort ein Taxi zu rufen.
Es war nur ein paar Minuten Wegstrecke. Dann würde sie eben laufen. Außerdem konnte sie dabei ihren Zorn abreagieren.
Obwohl es kurz nach zehn war, waren die Straßen wie leergefegt. Die Kälte trieb die Menschen in die Häuser.
Von Zeit zu Zeit fuhr ein Auto an ihr vorbei, dann herrschte wieder Stille.
Aus den Augenwinkeln nahm Phyllis Parker eine Bewegung wahr. Sie fuhr herum.
Ein Schrei blieb ihr in der Kehle stecken.
Vor ihr stand ein Skelett. Es hielt eine Sense in den Händen. . Ihre Knie wurden weich und begannen zu zittern. Aus weit aufgerissenen Augen starrte sie das schreckliche Wesen an.
Noch bevor sie sich bewegen konnte, zuckte die Sense hoch. Die Klinge beschrieb einen Halbkreis und sauste dann genau auf sie zu.
Sie spürte noch einen alles verzehrenden Schmerz am Hals, dann sank sie in den schwarzen Schacht des Todes.
Gierig saugte Tartok ihre Seele in sich auf. Er hatte sein erstes Opfer gefunden.
*
Chiefinspektor Stevenson bekam die Nachricht in seinem Büro in Scotland Yard Building. Er hatte schon länger gearbeitet, um fällige Berichte zu schreiben. Gerade war er fertig, als das Telefon klingelte.
In der Porson-Street war eine Leiche gefunden worden. Zum Teufel, warum hatte er bloß den Telefonhörer abgenommen
»Okay, ich komme«, .versprach er und knallte den Hörer verbittert auf die Gabel.
Auf dem Weg zur Tiefgarage holte er sich noch einen Kaffee aus einem Automaten. Ohne einmal abzusetzen, kippte er das heiße Getränk hinunter. Es schmeckte zwar mehr nach Wasser als nach Kaffee, aber der Koffein-Stoß machte ihn wieder munter.
Stevenson stieg in seinen Privatwagen, einen himmelblauen Ford. Sicher lenkte er ihn aus der Tiefgarage und durch die nächtlichen Straßen. Aus dem Autoradio klang Tanzmusik.
Schon von weitem sah er die Schaulustigen auf der Porson-Street. Es war wie verhext. Kaum ein Mensch befand sich auf den Straßen, aber wenn etwas passierte, waren sie plötzlich da.
Inspektor Stevenson parkte den Wagen und stieg aus. Er drängte sich durch die Menge der Gaffer. Das brachte ihm einige unfreundliche Bemerkungen und Ellenbogenstöße ein.
Ein Bobby trat ihm entgegen. Er war sichtlich entnervt. Neugier und Sensationslust der Schaulustigen gingen über seine Kräfte.
»Bitte treten Sie zurück«, forderte er Stevenson auf. »Gehen Sie doch alle weiter, hier gibt es nichts zu sehen.«
Der Chiefinspektor zückte seinen Ausweis. Plötzlich war der Bobby die Freundlichkeit in Person.
»Entschuldigen Sie, Sir! Ein Glück, daß Sie endlich da sind.«
»Was ist denn passiert?«
»Ein Hausbewohner hat vor seiner Tür eine Leiche gefunden, als er nach Hause kam.«
»Soviel habe ich auch schon am Telefon gehört. Weiß man schon Genaueres?«
»Nein, Sir. Sie sollten sich die Leiche selbst ansehen. Aber Vorsicht, das ist kein schöner Anblick.«
»Wie meistens. Allerdings bin ich schon einiges gewohnt.«
Der Bobby mußte sich wieder den Gaffern entgegenstellen. Diese wollten die Situation nutzen, um näher an den Tatort heranzukommen.
Stevenson ging auf den Polizeiarzt zu. Thomas Haller und er waren sich schon ein paarmal im Dienst begegnet.
»Hallo, Thomas«, begrüßte Stevenson ihn.
»Hallo, Dave«, kam es zurück. Die Augen des Arztes blickten ungewöhnlich ernst. Dabei hatte er sonst meistens einen Scherz auf den Lippen.
Er deutete auf eine Decke, unter der sich die Umrisse eines menschlichen Körpers abzeichneten.
Entschlossen zog Stevenson die Decke weg. Obwohl er sich innerlich gewappnet hatte, traf ihn das Grauen.
Vor ihm lag die Leiche eines jungen Mädchens. Sie war geköpft worden!
»Mein Gott«, murmelte der Chiefinspektor. Das Blut wich aus seinem Gesicht. Das hatte er nicht erwartet. Sorgfältig deckte er die Leiche wieder zu.
»Weiß man, wer sie ist?« erkundigte er sich mit belegter Stimme.
Haller reichte ihm eine Brieftasche. Den Papieren war zu entnehmen, daß das Opfer Phyllis Parker hieß und siebzehn Jahre alt war.
»Wir haben noch etwas gefunden«, mischte sich ein Bobby ins Gespräch. Er reichte dem Chiefinspektor ein Stück festes Papier.
»Eine Spielkarte«, murmelte Stevenson verblüfft. »Ein Pik-Ass!«
»Ja, wir fanden es in den Händen der Toten.«
»Das könnte ein Hinweis sein. Im Augenblick nutzt es uns aber nichts.« Er steckte die Karte sorgfältig ein. »Gibt es irgendwelche Spuren?«
»Nein, Sir«, antwortete der Bobby diensteifrig. »Aber die Kollegen von der Spurensicherung sind auch noch nicht eingetroffen.«
»Wo ist der Mann, der die, Leiche gefunden hat?« wandte Stevenson sich erneut an den Arzt.
»Er steht unter schwerem Schock. Ich habe ihn ins Krankenhaus fahren lassen.«
Die Beamten von der Spurensicherung trafen ein. Im Augenblick gab es hier für den Chiefinspektor nichts mehr zu tun.
Dafür erwartete ihn nun der schwerste Teil seiner Aufgabe. Er mußte die Eltern des Mädchens benachrichtigen.
Das ging jedesmal an die seelische Substanz. Es waren die Augenblicke, die er an seinem Beruf am wenigsten mochte.
*
Anhand eines Telefonbuches überprüfte Robert Korn, ob sein Bruder immer noch unter seiner alten Adresse zu erreichen war. Das war der Fall.
Von der Rezeption des Hotels aus rief er ein Taxi.
Ein reichhaltiges Menü hatte seinen und Jills Hunger gestillt.
Das Taxi brachte sie zu der gewünschten Adresse. Es handelte sich um ein fünfstöckiges Mietshaus. Die Fassade hätte unbedingt etwas. Putz und Farbe vertragen. Einladend sah das Bauwerk nicht gerade aus.
Die Haustür stand offen. Das kam Rob sehr gelegen, so konnte er seinen Bruder direkt an der Wohnungstür überraschen.
Sie betraten den Flur. Es roch muffig, nach Schmutz und allen möglichen Mittagsgerichten.
Dem Klingelbrett hatten sie entnehmen können, daß Stephen im dritten Stock wohnte.
»Deinem Bruder scheint es nicht so gut ergangen zu sein wie dir«, sagte Jill, während sie die breite Holztreppe hinaufstiegen.
»Dem Haus nach zu urteilen wirklich nicht«, antwortete Rob. »Die ganze Gegend scheint nicht astrein zu sein.«
Sie lag in direkter Nachbarschaft zu Soho. Und das war Londons verrufenster Teil.
Die beiden Typen lauerten auf dem zweiten Absatz. Sie sahen nicht sehr vertrauenerweckend aus: geflickte Jeans und mit Nieten beschlagene Lederjacken. Ihre Gesichter waren unrasiert und größtenteils hinter spiegelnden Sonnenbrillen verborgen.
»Den beiden möchte ich nachts nicht allein begegnen«, flüsterte Jill Taylor.
Beruhigend legte Robert Korn die Hand auf ihren Arm.
»Keine Angst. Vielleicht verhalten sie sich friedlich.«
Er suchte immer nach dem Guten im Menschen. Die provozierende Haltung der beiden jungen Männer sprach jedoch Bände.
Breitbeinig stellten sie sich ihnen in den Weg.
»Dürfen wir mal vorbei?« fragte Robert Korn freundlich.
»Dafür müßt ihr schon bezahlen«, erklärte einer der beiden ebenso freundlich. »Wegzoll, ihr versteht?«
»Und wenn wir uns weigern?«
Die Freundlichkeit war dem Kerl plötzlich wie aus dem Gesicht gewischt, er ließ die Maske fallen.
»Dann werdet ihr mit Billy und mir Bekanntschaft machen. Ich bin übrigens der nette Jolly.«
Nett war er nicht gerade. Das bewies seine vorschnellende Faust.
Rob hatte aber den Angriff erwartet und wich gedankenschnell aus. Dafür ließ er seine eigene Faust fliegen.
Er traf Jolly im Magen, und der Schläger taumelte erst mal zurück.
Rob sprang vor. Der Absatz war ziemlich breit. So konnte er sich entfalten.
Billy schlug gar nicht erst, er trat direkt zu. Viel zu langsam.
Der Privatdetektiv packte sein Bein und hebelte es. Schwer stürzte der Schläger.
Inzwischen hatte Jolly sich wieder erholt. Von hinten wollte er sich auf Robert Korn stürzen.
Dieser rammte den Ellenbogen nach hinten. Er traf Jolly am Kinn. Sofort fuhr Korn herum und setzte seine Faust hinterher.
Diese schien aus Stahl zu sein.
Dem Schläger wurde der Kopf in den Nacken gerissen. Er taumelte zurück, verfehlte die oberste Stufe und kugelte die Treppe hinunter.
»War ja nicht so gemeint«, rief Billy, als Rob auf ihn zutrat. Er wischte an dem Detektiv vorbei und hastete die Stufen hinunter, wo sein Kumpan sich gerade wieder aufrichtete.
Zusammen verschwanden sie.
»Sollen wir die Polizei rufen?« erkundigte sich Jill.
Robert Korn winkte ab. Der Kampf hatte ihn nicht sonderlich angestrengt. Von New York her war er ganz anderes gewohnt.
»Die kriegt die beiden doch nicht. Die kennen hier Dutzende von Verstecken.«
Sie erreichten den dritten Stock. Auf Anhieb fanden sie die richtige Tür. »Stephen Korn« stand auf einem kleinen Metallschild.
Robert begrub den Klingelknopf unter seinem Daumen. Nach wenigen Sekunden bereits wurde geöffnet.
»Ja?« erkundigte sich der Mann, als er die beiden Besucher sah. Dann leuchteten seine Augen plötzlich auf.
»Rob, bist du es wirklich?«
Er schlug seinem Bruder auf die Schulter und umarmte ihn herzlich.
»Rob, Mensch, das gibt es doch gar nicht. Wo kommst du denn her?«
»Darf ich dir erst mal meine Verlobte vorstellen, Jill Taylor. Wir heiraten in zwei Wochen.«
Stephen begrüßte die junge Dame.
»Na, herzlichen Glückwunsch! Kommt rein!«
Jill reichte ihrem zukünftigen Schwager die mitgebrachte Flasche Whisky. Sie wurden ins Wohnzimmer geführt.
Jill konnte eine Gänsehaut nicht ganz unterdrücken, als sie den Raum sah.
Überall hingen Bilder an den Wänden, die grauenhafte Monster zeigten.
»Mein Beruf«, erklärte Stephen. »Ich zeichne für Grusel-Magazine und Bücher. Warum habt ihr euch nicht angemeldet? Ich habe überhaupt nichts zum Anbieten da, außer Saft und eurem Whisky.«
»Wir wollten dich überraschen«, erklärte Rob.
»Das ist euch gelungen.«
Jill entschied sich für Saft, während Stephen Korn für sich und seinen Bruder den Whisky einschenkte.
Sie kam sich ziemlich verloren vor. Die Wiedersehensfreude ließ die beiden Männer sie fast vergessen.
Ihr Blick irrte zwischen den Brüdern hin und her. Wie unterschiedlich sie doch sind, dachte sie.
Tatsächlich hätte man aus ihrem Äußeren kaum schließen können, daß es sich um Geschwister handelte.
Robert besaß gelockte braune Haare, ein volles Gesicht und eine kräftige Statur.
Dagegen war Stephen blond, und seine Haare waren auch viel länger. Sein Gesicht war schmal, die Wangen waren eingefallen, seine Gestalt war dürr und hager.
Nur das Grübchen am Kinn schien beiden gemeinsam.
Die Brüder tauschten Jugenderinnerungen aus und erzählten sich, wie es ihnen in den letzten Jahren erging.
Über seine Arbeit sprach Stephen Korn kaum, um so ausführlicher über das Kartenspielen. Seit einigen Tagen hatte er phänomenales Glück, wenn man seinen Angaben trauen durfte.
»Damit verdiene ich zehnmal mehr als mit dem Zeichnen«, erklärte er. »Wollt ihr mich nicht heute abend ins Casino begleiten?«
Robert blickte zu Jill. Sie schüttelte den Kopf.
»Ich zumindest nicht. Die lange Reise war anstrengend, und ich möchte mich heute abend früh hinlegen. Aber wenn du willst...«, bot sie an.
»Okay. Ich komme mit. Dann sprengen wir zusammen die Bank. Wann willst du hin?«
»So gegen sieben.«
Der Detektiv blickte auf die Uhr.
»Mensch, es ist ja schon fünf. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Wir fahren ins Hotel zurück, umziehen, essen und so. Um sieben bin ich wieder hier.«
Stephen brachte sie zur Tür. Beim Abschied umarmte er seinen Bruder noch mal.
»Bis nachher. Und wir sehen uns morgen bestimmt noch«, verabschiedete er sich von Jill.
Sie hörten ein Hupen. Das mußte das Taxi sein, das sie telefonisch bestellt hatten.
Diesmal erlebten sie keine Störung auf der Treppe.
*
»Der Superintendent erwartet Sie schon«, verkündete die Sekretärin, als Stevenson das Vorzimmer betrat.
Der Chiefinspektor wußte, weshalb sein Chef ihn hatte kommen lassen. Er atmete noch mal tief durch, bevor er klopfte und eintrat.
Superintendent Holdsworth saß hinter seinem Schreibtisch. Kühl funkelten die Augen, als er Stevenson aufforderte, Platz zu nehmen.
»Ich nehme an, Sie haben die Akte von dem gestrigen Mordfall bereits gelesen«, begann er. Stevenson nickte. »Das sechste Opfer! Sechs junge Mädchen, die man geköpft hat... In jeder Nacht eine. So geht das nicht mehr weiter.«
»Wir tun, was wir können«, verteidigte sich der Chiefinspektor. »Die Streifen wurden verdoppelt, wir gehen der kleinsten Spur nach. Aber der Mörder hinterläßt keinerlei Spuren. Es gibt keine Verbindung zwischen den toten Mädchen, die uns auf seine Spur führen könnte.«
»Obwohl er jedesmal seine Visitenkarte hinterläßt.«
»Ja, so scheint es. Jedes der Mädchen hielt eine Spielkarte in der Hand, das Pik-Ass. Aber das hilft uns auch nicht weiter. Beim ersten Mord haben wir uns in allen Spielkasinos erkundigt, ob das Mädchen dagewesen wäre und deshalb vielleicht noch die Karte in der Hand hielt. Fehlanzeige, der Mörder selbst hat sie ihr in die Hand gedrückt.«
»So geht das nicht weiter«, wiederholte Holdsworth. »Die Presse zerreißt uns in der Luft. Selbst der Innenminister setzt mich schon unter Druck. Wir müssen diese entsetzliche Mordserie beenden.«
Aha, dachte Stevenson. Von da wehte also der Wind. Sein Chef bekam Druck von oben.
Irgendwie konnte er den Superintendenten auch verstehen. Er stand wenige Monate vor seiner Pensionierung, und das war wirklich kein befriedigender Abschluß für die Laufbahn.
Holdsworths Gesicht wirkte eingefallen und fast ebenso grau wie seine Haare. Tiefe Falten hatten sich in die Haut eingekerbt. Trotz seines Alters und seiner Schreibtischarbeit hatte er keinen Speck angesetzt und war immer noch eine imponierende Erscheinung.
»Tun Sie etwas, Stevenson«, flüsterte er leise.
»Wir tun, was wir können. Ich kümmere mich schon um nichts anderes mehr als nur um diesen Fall. Aber ich bin auch nur ein Mensch und kann nicht hellsehen.«
»Sie müssen mehr als ein Mensch leisten, dieser Wahnsinnige muß gestoppt werden. Und wenn nichts anderes hilft, dann gehen Sie meinetwegen auch zu einer Hellseherin.«
»Sir, ich habe mir geschworen, als ich die erste Leiche sah, den Mörder zu fassen. Und diesen Schwur werde ich halten, oder ich tauge nicht für meinen Beruf.«
Holdsworth erhob sich. Er reichte dem Chiefinspektor die Hand.
»Stevenson, Sie sind der beste Polizist, den ich kenne. Wenn Sie diesen Fall nicht lösen, schafft es keiner.«
Wenn es wenigstens eine Spur gäbe, dachte der Chiefinspektor, als er in sein Büro zurückkehrte. Zum wiederholten Male las er die Akten durch, ob er nicht vielleicht doch eine Kleinigkeit übersehen hatte.
*
Kaum daß die Tür hinter Robert Korn und Jill Taylor ins Schloß gefallen war, eilte Stephen in sein Atelier.
Ein schwarzes Samttuch hing über dem Bild des Dämons. Vorsichtig nahm er es ab.
»Verzeih mir, Meister, aber ich konnte nicht früher kommen. Ich hatte Besuch.«
»Dein Bruder, ich weiß. Es gefällt mir gar nicht, daß er jetzt auftaucht. Aber vielleicht ist wirklich alles nur ein Zufall.«
»Was meinst du damit?«
»Nichts, ich bin nur mißtrauisch. Er ist Privatdetektiv, also ein Schnüffler. Er hatte eine Frau bei sich.«
»Ja, seine Verlobte.«
Stephen Korn verstummte. Ein entsetzlicher Verdacht keimte in ihm.
»Nein, Meister, nicht sie«, flehte er.
»Doch«, donnerte der Dämon. »Sie gefällt mir. Ihre Lebenskraft wird mich stärken. Heute nacht wird sie allein sein.«
»Nein, Meister, bitte!«
»Schweig«, befahl Tartok. »Du wirst mit deinem Bruder ins Casino gehen und ihn dort möglichst lange aufhalten. Ich befehle es dir! Denk daran, wem du alle deine Erfolge in der letzten Woche zu verdanken hast.«
»Ich gehorche, Meister«, hauchte der Maler.
Nie in seinem Leben war ihm ein Satz so schwergefallen. Er hatte sich auf etwas eingelassen, das ihm über den Kopf wuchs.
Aber der Satan hatte ihn nicht nach seinem Willen gefragt, und auch Tartok hatte von Anfang an klargestellt, daß er ihn töten würde, wenn er nicht gehorchte.
Er hatte sich für Gehorchen entschieden. Außerdem sorgte der Dämon dafür, daß er eine goldene Hand beim Kartenspielen hatte. Seit einer Woche hatte er das Casino nur noch als Gewinner verlassen.
»Ich wußte, daß du dich so entscheiden würdest. Sterben wird sie ohnehin. Ihr Leben kannst du nicht retten, aber deines.«
Eine schmutzige Art, sein Leben zu retten, fand Stephen Korn. Aber gab es eine andere Möglichkeit für ihn?
*
»Willst du nicht doch mitkommen?« erkundigte sich Robert Korn, während er sich in seinen Smoking zwängte. »Die Müdigkeit ist doch nur eine Ausrede.«
»Ja, es ist eine Ausrede«, sagte Jill Taylor.
»Und was ist der wahre Grund?«
»Ach, du meine Güte, ihr seid Geschwister und habt euch lange nicht gesehen. Die Dinge, über die ihr sprecht, eure Erinnerungen, sie sind für euch sicher furchtbar wichtig, aber mich interessieren sie kaum. Ich habe mich schon heute mittag gelangweilt.«
»Wirklich?« Robert zuckte die Achseln. Sicher fand ein Außenstehender an ihren Jugenderinnerungen kein großes Interesse. Daß sie sich so langweilte, war ihm im Rausch der Wiedersehensfreude nicht aufgefallen.
»Außerdem«, begann Jill, verstummte dann aber.
»Was außerdem?«
»Nun, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Irgend etwas ist mir an deinem Bruder unheimlich. Seine Augen glitzerten so seltsam.«
»Aber das ist doch Unfug, Darling.«
Robert küßte seine Verlobte in den Nacken. Sie entzog sich seinen Zärtlichkeiten und ließ sich auf einen Sessel fallen.
»Siehst du, diese Antwort habe ich erwartet. Deshalb wollte ich auch erst gar nichts sagen. Jetzt laß mich auch ausreden. Ich habe ein Gespür dafür, wenn jemand sich mit Problemen herumschlägt. Dein Bruder wirkt, als habe er eine zentnerschwere Last zu tragen. Er schleppt ein düsteres Geheimnis mit sich herum, auch wenn er sich bemüht hat, es uns nicht merken zu lassen.«
Robert zündete sich eine Zigarette an.
»Du solltest als Partnerin bei mir einsteigen«, sagte der Detektiv dann. »Mir ist nichts aufgefallen, aber das war wohl wirklich die Freude. Jetzt, da du es sagst, fällt es mir auf.«
Der Spürinstinkt brach in ihm durch.
»Ja, da waren winzige Gesten. Schatz, du hast recht.«
»Erinnere dich an seine Finger«, forderte sie ihn auf. »Sie zitterten beim Einschenken. Nicht mal eine Zigarette konnte er ruhig halten. Überhaupt, an seinen Rauchkonsum kommst nicht mal du heran.«
»Na gut, ich sehe ein, daß ich geschlafen habe. Aber warum willst du nicht mitkommen? Er wird dich schon nicht umbringen.«
»Meine Güte, Rob, benutz doch mal deinen Verstand. Du bist sein Bruder. Vielleicht möchte er mit dir über Probleme sprechen, die er hat. Mich kennt er doch gerade erst, ich bin eine Fremde für ihn. Ich würde euch nur stören und ihn hemmen.«
Der Detektiv mußte zugeben, daß ihre Worte etwas für sich hatten. Von dieser Seite hatte er die Sache noch gar nicht betrachtet.
»Okay, ich gebe mich geschlagen. Und was machst du heute abend?«
»Ach, ich werde mich schon vergnügen. Vielleicht lerne ich an der Hotelbar jemanden kennen.«
»Na gut, vergnüg dich schön. Ich werde sehen, daß es nicht allzu lange dauert.«
»Quatsch, nimm jetzt bloß keine falsche Rücksicht. Mach mit Stephen einen Zug durch die Gemeinde. Nur paß auf, daß du nicht morgen den ganzen Tag ungenießbar bist, weil du einen Kater hast.«
Jill war wirklich ein Goldstück. Sie wußten, daß sie sich aufeinander verlassen konnten, und ließen sich deshalb alle Freiheiten. Das war einer der Gründe, weshalb er Jill so liebte.
Gemeinsam fuhren sie mit dem Lift ins Erdgeschoß. Diesmal brauchte Rob nicht mal ein Taxi zu rufen.
Gleich zwei warteten vor dem Eingang. Viele Gäste des Hotels fuhren am Abend in die City, um sich ins Londoner Nachtleben zu stürzen.
Er winkte Jill zum Abschied, bevor er einstieg und sein Ziel nannte.
Stephen erwartete ihn bereits vor dem Haus, stieg zu und gab die Adresse des Casinos an.
»Mensch, wo bleibst du denn so lange? Es ist schon gleich halb acht.»
»Tut mir leid, aber wir mußten mit dem Abendessen warten.«
»Na, macht ja nichts. Hauptsache, du bist überhaupt gekommen.«
Die Betonung, die Stephen auf den letzten Satz legte, gefiel Rob überhaupt nicht.
Er schwieg jedoch. Vielleicht ergab sich im Lauf des Abends eine Gelegenheit, sich mit dem Bruder auszusprechen.
Er ahnte nicht, wie es in dem Maler brodelte. Hätte er nachgefragt, wäre die Wand des Schweigens vermutlich zusammengebrochen, und er hätte Licht in den blutigen Kreis bringen können, der sich so um ihn schloß.
Eine hübsche Frau wie Jill Taylor blieb natürlich nicht allein an der Hotelbar.
Sie bestellte sich einen Martini. Noch bevor sie das Getränk serviert bekam, nahm jemand auf dem Hocker neben ihr Platz.
»So allein, schönes Kind?«
Jill musterte den Mann. Er mochte Anfang Vierzig sein. Volle schwarze Haare bedeckten seinen Kopf. Einige graue Strähnen ließen ihn interessanter wirken.
Seine Gesichtszüge waren markant, sein Kinn zeugte von Energie.
Die Bewegungen wirkten weltmännisch. Ein gewinnendes Lächeln lag um seine Mundwinkel.
Nur diese plumpe Anbiederung gefiel Jill nicht. Zu mehr als einer Unterhaltung würde es nicht kommen. Das würde sie ihm schon klarmachen.
»Ja, im Augenblick bin ich allein«, entgegnete sie.
»Darf ich mich vorstellen, Charles Willingham.«
»Jill Taylor.«
Der Barkeeper servierte den Martini. Jill trank einen Schluck.
»Ihre Aussprache klingt nicht, als stammten Sie von hier«, nahm Willingham das Gespräch wieder auf.
»Nein, ich komme aus New York.«
»Ja, ist denn das die Möglichkeit! Ich komme ebenfalls aus den Staaten. Aus Boston. Hatte geschäftlich in London zu tun.«